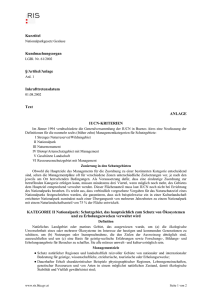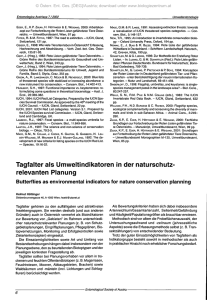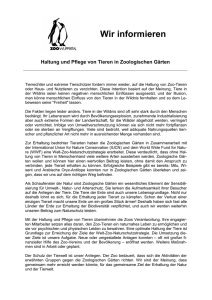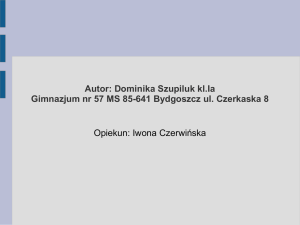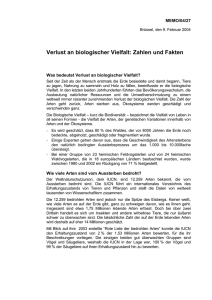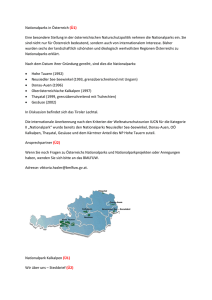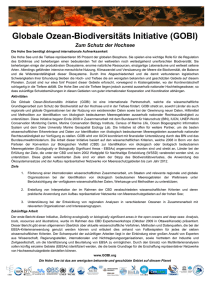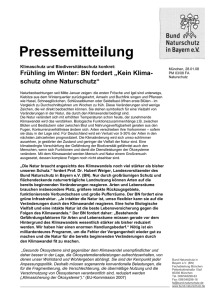Nationalparkkonzept Kellerwald
Werbung
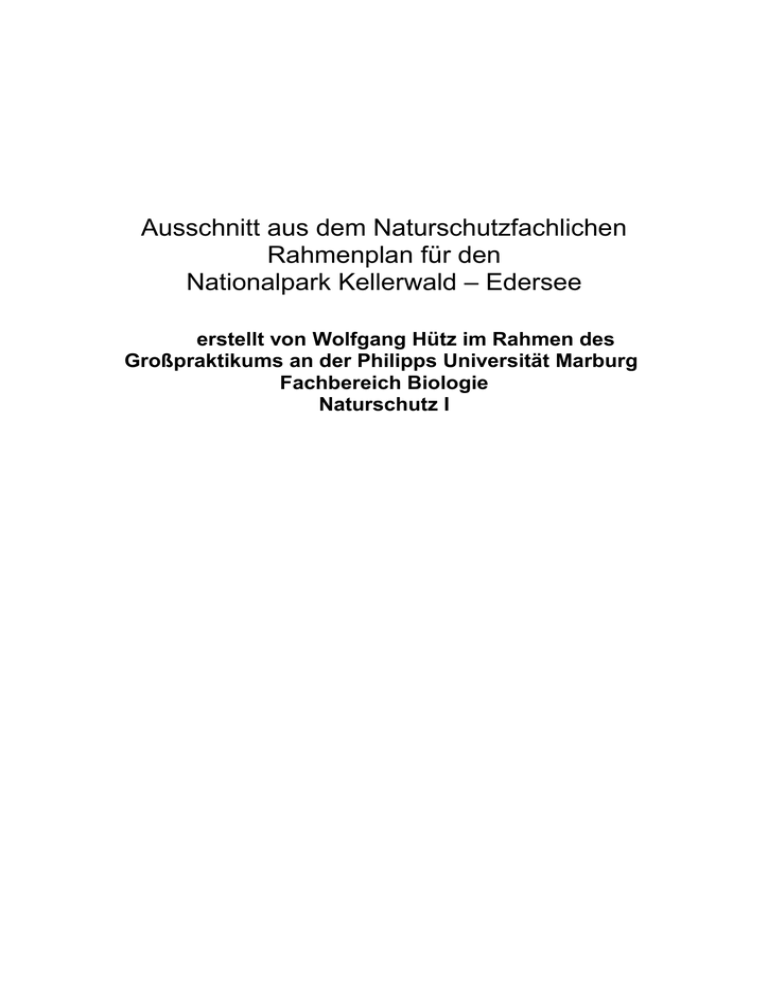
Ausschnitt aus dem Naturschutzfachlichen Rahmenplan für den Nationalpark Kellerwald – Edersee erstellt von Wolfgang Hütz im Rahmen des Großpraktikums an der Philipps Universität Marburg Fachbereich Biologie Naturschutz I 1. Einleitung 1.1 Ziel dieser Arbeit In Deutschland gibt es zurzeit 14 Nationalparke. Der überwiegende Teil hiervon wurde im Verlauf der Wiedervereinigung und in den darauf folgenden Jahren einge richtet. Diese Nationalparke haben erst eine relativ kurze Geschichte hinter sich und befinden sich im Prinzip in der „Einrichtungsphase“. Dies gilt sowohl für die Schutzgüter, die teilweise von einem natürlichen Zustand noch weit entfernt sind, als auch für Organisation, konkretisierte Zielbestimmung und Managementfestlegungen. Die nachfolgende Arbeit versucht exemplarisch am Beispiel des Nationalparks Kellerwald - Edersee, Methoden zur Entwicklung überzeugender Managementpläne für deutsche Nationalparke zu erarbeiten. Sie soll weiterhin die Möglichkeiten und Einschränkungen aufzeigen, denen die Entwicklung von Naturnähe in diesem Nationalpark unterliegt. Neben pragmatischen sollen auch auf mittelfristige Sicht wünschenswerte, derzeit nicht realisierbare Ziele formuliert werden. Im Unterschied zu dem von der Nationalparkverwaltung erstellten Rahmenplan konzentriert sich das vorliegende Zielkonzept auf naturschutzfachliche Anforderungen, die aus internationalen Richtlinien, nationalen Gesetzen, dem Stand der Forschung und lokalen Gegebenheiten resultieren. Eine Abstimmung mit der lokalen Bevölkerung oder lokalen Entscheidungsträgern konnte im Rahmen dieser Arbeit nicht geleistet werden. Der von EUROPARC (2000) für Nationalparkpläne geforderte Rückkopplungs- und Beteiligungsprozess entfällt damit und dem hier vorgelegten Zielkonzept kommt eine empfehlende Funktion zu. Der Kellerwald wurde als einer der jüngsten deutschen Nationalparke gewählt, da er die allgemeine Problemlage deutscher Großschutzgebiete gut abbildet und die hessische Landesregierung die Nationalparkverwaltung beauftragt hat, bis zum Ende des Jahres 2006 den Entwurf eines Managementplanes vorzulegen. 1.2 Die IUCN Schutzgebietskategorie „Nationalpark“ und ihre Umsetzung 1.2.1 Die Organisationen IUCN und WCPA Die IUCN (World Conservation Union) stellt einen internationalen Naturschutz -Dachverband dar. Diesem gehören 82 Staaten, 111 staatliche Institutionen, 800 Nichtregierungsorganisationen sowie 10000 Wissenschaftler und Experten aus 181 Staaten an. Die IUCN sieht ihre Aufgabe darin, Gesellschaften zur Bewahrung natürlicher Vielfalt aufzufordern, zu ermutigen und dabei zu unterstützen. Darüber hinaus tritt sie für eine sozial gerechte und ökologisch nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen ein (www.iucn.org). Innerhalb der IUCN werden Schwerpunkt-Themen von 6 Kommissionen bearbeitet, zu denen die WCPA (World Comission on Protected Areas) gehört. Diese soll die Ausweisung und das Management von Schutzgebieten fördern und verbessern sowie eine beratende Funktion erfüllen. Ein Schutzgebiet im Sinne der IUCN dient pri mär dem Schutz und dem Erhalt der Biodiversität (Artenvielfalt, genetische Vielfalt einer Art, Vielfalt an Ökosystemen). Weiterhin kann es dem Erhalt natürlicher Ressourcen und mit diesen verbundener kultureller Ressourcen dienen (IUCN 2006). Der Gebiets-Schutz muss durch gesetzliche oder andere effektive Mittel gewährleistet sein. Tabelle 1: Schutzgebietkategorien der IUCN und ihre Primärziele (nach IUCN 2000) Kategorie Bezeichnung Primärziel Ia Strenges Naturschutzgebiet Wildnisschutz zwecks wissenschaftlicher Erforschung Ib Wildnisgebiet Wildnisschutz II Nationalpark Ökosystemschutz/Ermöglichen von Naturerfahrung III Naturdenkmal Schutz eines herausragenden Naturelements IV Arten-/Habitatschutzgebiet Arten-/Habitatschutz, ggf. durch Management V Landschaftsschutzgebiet Schutz eines Landschaftsbildes/Ermöglichen von Naturerlebnis VI Ressourcenschutzgebiet Nachhaltige Naturnutzung 1.2.1.1 WCPA Definition des Begriffs „Nationalpark“ Gemäß der IUCN (2000) werden Nationalparke als Schutzgebiete definiert, deren Primärziele im Erhalt natürlicher Ökosysteme und ihres Erlebniswertes für den Menschen bestehen. Natürliche Dynamik soll zur freien Entfaltung kommen, weshalb wirtschaftsbestimmte Nutzungen in Nationalparken untersagt sind. Eine Ausnahme bilden traditionelle Nutzungsrechte indigener Völker, sofern diese den Primärzielen nicht entgegenstehen. Die Erlebbarkeit des Nationalparks durch Besucher wird durch Schaffung oder Aufrechterhaltung notwendiger Infrastruktur ermöglicht, beispielsweise in Form von Wegeunterhaltung und -sicherung. Um Konflikte zwischen den Zielen „Ökosystemschutz“ und „Ermöglichen von Naturerfahrung“ zu vermeiden findet Besucherlenkung statt. Ein zur Ausweisung vorgesehenes Gebiet sollte höchstens geringfügig durch menschliche Nutzung beeinträchtigt sein und ein oder mehrere komplette Ökosysteme enthalten. Deren Schutz soll sie für jetzige und künftige Generationen erhalten und ihre ökologische Unversehrtheit gewährleisten. Der im Original-Text für letzteres verwendete Begriff „ecological integrity“ beinhaltet auch die unveränderte Dynamik der Ökosysteme (MILLER & TYLER 1999). Nationalparke sollen weiterhin einen Landschaftstyp und seine Biozönose repräsentieren und erhalten, von hohem ästhetischem Reiz sein und von mindestens nationaler Bedeutung. Besuchern soll geistigseelische Naturerfahrung, Erholung und Umweltbildung ermöglicht werden. Ein wichtiger Teil hiervon besteht auch einer nachhaltige touristische Nutzung der National parke. Weiterhin ist die wissenschaftliche Erforschung naturnaher Ökosysteme in Nationalparken möglich. (IUCN, EUROPARC 2000) 1.2.1.2 Zonierung von Nationalparken Die Zonierung von Nationalparken und anderen Schutzgebieten wurde 1972 von der CNPPA (Commission on National Parks and Protected Areas, Vorgänger der WCPA) vorgeschlagen, um Ausweisungen in kulturell geprägten Landschaften Ostasiens und Europas zu erleichtern. Sie erlaubt z. B. die Integration von Kulturland schaften in Nationalparke und kann Pufferzonen gegenüber dem Umland festlegen. Maximal 25 % eines Schutzgebietes dürfen laut IUCN von seinem Hauptschutzziel abweichen und nach den Anforderungen anderer Schutzgebietskategorien behandelt werden (IUCN 1994). Demzufolge kann auf diesem Flächenanteil eines Nationalparks vom Zulassen natürlicher Dynamik abgewichen werden und beispielsweise eine Pufferzone oder Zone II definiert werden. Ein Grund hierfür kann sein, dass negative Einflüsse aus dem Nationalparkumfeld auf die Kernzone reduziert werden sol len. Andererseits kann das Nationalparkumfeld dadurch geschützt werden, beispielsweise vor dem Übergreifen von Insektengradationen. Der Mensch darf also hier lenkend in die Gebietsentwicklung eingreifen. Dies kann ebenfalls zur Pflege von Kultur- landschaften und historisch bedeutsamen Stätten (IUCN (2003): „special and/or unique values zone“ (Zone mit besonderen/einzigartigen Schutzobjekten *)) sowie zum Betrieb von touristischer Infrastruktureinrichtungen und Attraktionen wie Baumkronenpfaden geschehen (IUCN (2003): „Limited development zone“ („Zone für maßvoll beschränkte Entwicklung“*)). Im Vordergrund steht allerdings auch hier Schutz der Intaktheit eines Ökosystems und nicht wirtschaftlich bestimmte Nutzung. Der mindestens 75 % der Schutzgebietsfläche umfassende Anteil, welcher seinem Hauptschutzziel gemäß zu behandeln ist, wird im Nationalpark als Naturzone oder Zone I (IUCN (2003): „wilderness zone“ (Wildniszone *)) bezeichnet. Hier steht ungelenkte, dynamische Entwicklung von Ökosystemen im Vordergrund. 1.2.2 Umsetzung in Europa Schon das Primärziel „Schutz eines natürlichen Ökosystems“ kann in Europa mit wenigen Ausnahmen nur im borealen Biom verwirklicht werden. Vom Menschen un beeinflusste Ökosysteme finden sich ansonsten nur kleinflächig (siehe 2.1), wobei historische menschliche Nutzungen meist nicht vollständig ausgeschlossen werden können. Setzt man außerdem die Immissionen anthropogener Schadstoffe aus der Atmosphäre und den Klimawandel in Rechnung, gibt es keine vom Menschen unbeeinflussten Ökosysteme mehr (ELLENBERG 1996). Gemäß den Kriterien von „Caring for the Earth“ (IUCN ET AL 1991) können Ökosysteme in Anbetracht dieser Allgegenwart menschlicher Einflüsse noch als „natürlich“ definiert werden, wenn der Mensch sie seit 1750 nicht stärker als andere Lebewesen beeinflusst hat. Entscheidend ist, dass es zu keiner nachhaltigen Veränderung in der Struktur eines Ökosystems gekommen ist. Die Wahl der zeitlichen Schwelle ist dabei aber auf Nordamerika zugeschnitten, das größtenteils erst ab der Kolonisation durch Europäer stark ökosystemverändernden Nutzungsformen unterlag. Da in Mitteleuropa kein Vergleich mit unbeeinflussten Lebensräumen möglich ist, stellt sich die Frage, ob der menschliche Einfluss hier überhaupt quantifizierbar oder mit demjenigen anderer Lebewesen verglichen werden kann (siehe 2.1). Ein weiteres Problem besteht in der Abgrenzung von Ökosystemen, die ja „in Gän ze“ in einem Nationalpark enthalten sein sollen. Waldökosysteme beispielsweise müssten nicht nur Flächen in sämtlichen Waldentwicklungsstadien von den Pionierbis zu den Zerfallsphasen beinhalten, sondern auch den Erhalt eines vollständigen ökosystemtypischen Pflanzen- und Tierartenspektrums ermöglichen. Dies ist aus den folgenden Gründen problematisch. Großschutzgebiete stellen häufig isolierte „Inseln“ in der Kulturlandschaft dar, die für manche Arten die letzten Rückzugsorte sind. Hier können somit Erkenntnisse aus der Inselbiogeographie angewandt werden (Abb. 1). Diese konstatierte und belegte die Arten-Areal Beziehung, der zu Folge die Artenvielfalt großer isolierter Areale unabhängig von strukturellen Parametern größer ist als diejenige kleiner und isolierter Areale (MILLER & TYLER 1999). Ein Grund hierfür kann sein, dass jede Population einem gewissen Aussterberisiko unterliegt, das mit abnehmender Größe und zunehmender Isolation ansteigt. Einen wichtigen Faktor stellen dabei stochastisch bedingte Bestandseinbrüche und genetische Verarmung dar, die kleine und isolierte Populationen stärker beeinträchtigen können als große. Um Angaben über die Aussterbewahrscheinlichkeit bei bestimmten Populationsgrößen zu machen wurde das „Minimum viable Population“ Konzept entwickelt (PLACHTER 1991). Dem Schwarzspecht (Dryocopus martius) beispielsweise kommt in mitteleuropäischen Waldökosystemen die Rolle einer Schlüsselart zu, die für Besiedler von Baum- Abbildung 1: Abhängigkeit zwischen der Anzahl ausgestorbener Arten und der Größe von Nationalparken (Quelle: Scherzinger 1996) höhlen von Bedeutung ist. Daher würde sein Aussterben negative Konsequenzen für weitere Arten nach sich ziehen. Ein Schwarzspechtpärchen benötigt ein Revier von 400 ha (HEISS 1992). Der Erhalt einer Mindestpopulationsgröße (minimum viable population, häufig angegeben: 500 Individuen) in einem von Offenland umgebenen Waldnationalpark würde somit die Ausweisung einer Fläche von 100.000 ha erfor dern, was im größtenteils dicht besiedelten Europa kaum realisierbar ist. Erschwerend kommt hinzu, dass die Strukturarmut von Wirtschaftswäldern für anspruchsvolle Arten wie den Schwarzspecht, welcher alte Baumbestände und Totholz benötigt, nur geringe Siedlungsdichten ermöglicht. Große Säugetiere, insbesondere Karnivoren wie der Luchs (Lynx lynx), benötigen noch weitaus größere unzerschnittene Reviere. Somit liegen in Europa keine ausreichend großflächigen Gebiete vor, um dem oben formulierten Anspruch gerecht zu werden, komplette Ökosysteme mit ihren charakteristischen Arten in Form von Großschutzgebieten zu bewahren. In der Konsequenz darf sich der Naturschutz - zumindest in Europa - nicht auf die segregative Schutzgebietsausweisung beschränken. Diese macht nur dann Sinn, wenn sie durch Schutzkonzepte in der genutzten Landschaft ergänzt wird (z. B. Altholzinseln im Nutzwald für den Schwarzspecht) und Migrationskorridore geschaffen oder erhalten werden. Ein Beispiel hierfür können Grünbrücken über Autobahnen sein, die Habitate von Großtieren verbinden (VÖLK & WÖSS 2001). Da keine pauschalen Aussagen über die Mindestgrößen von Schutzgebieten in verschiedenen Ökosystemtypen gemacht werden können verzichtet die IUCN auf deren Festlegung. BIBELRIETHER ET AL (1997) schlagen für Nationalparke in Laubwäldern der deutschen Mittelgebirge eine Mindestgröße von 6000 bis 8000 ha vor. Gleichzeitig geben sie zu bedenken, dass auch Aspekte wie Isolation, Kompaktheit, Naturnähe etc. in die Betrachtung einfließen sollten und somit die „effektive“ Flächengröße bedeutender ist als die tatsächliche. Beispielsweise führt Kompaktheit zu einem günstigen Verhältnis der Gebietsfläche zu ihrem äußeren Rand.Daher sind geringere Flächenanteile von Randeffekten wie Schadstoffeinträgen, Prädation der Fauna durch Haustiere etc. betroffen als bei einer langgestreckten Schutzgebietsform. Um dem Mangel an Primärwäldern Mitteleuropas Rechnung zu tragen wurde der Begriff „Zielnationalpark“ etabliert. Dieser drückt aus, dass von Menschen veränderten Ökosystemen nach Ausweisung eines Nationalparks eine Entwicklung zu einem „natürlichen“ Ökosystem hin erlaubt wird. Gemäß der IUCN (2000) muss der Nationalpark nach seiner Ausweisung mittelfristig (innerhalb einiger Jahrzehnte) auf 75 % seiner Fläche einer Naturlandschaft entsprechen. Die 1994 veröffentlichte Ausgabe von Parks for Life mit dem Titel „Action for Protected Areas in Europe“ hingegen stellt als Anforderung lediglich natürliche Vegetation oder in freier Sukzession befindliche Vegetation. Werden in der Naturzone Lenkungsmaßnahmen wie die Entnahme standortfremder Baumarten durchgeführt, kann diese übergangsweise als „strenge Naturzone mit Management“ (Zone IIb) klassifiziert werden. Nach Beendigung der Umbaumaßnahmen ist sie in die „strenge Naturzone ohne Managementmaßnahmen“ (Zone I) zu integrieren (BIBELRIETHER ET AL 1997). Das Prädikat Nationalpark wird häufig nutzungsgeprägten Ökosystemen verliehen, beispielsweise in England (IUCN 1997). Im System der IUCN gehören derartige Schutzgebiete anderen Kategorien an, z. B. IUCN Kategorie V (Landschaftsschutzgebiet). In Deutschland entspricht ebenfalls ein Großteil der Nationalparke nicht den Kriterien der IUCN Kategorie II und wurden im Schutzgebietregister der Vereinten Nationen (www.unep-wcmc.org/wdpa) bis 2003 unter Schutzgebietskategorie V gelistet (BIBELRIETHER ET AL 1997 & DIEPOLDER 1997). Dies war u. a. unbefristete Nutzungen natürlicher Ressourcen begründet, z. B. durch die Entnahme junger Miesmuscheln in der Naturzone des NLP Niedersächsisches Wattenmeer und Trophäenjagd in NLP Jasmund (BIBELRIETHER ET AL 1997). Bei der letzten Aktualisierung des Schutzgebietsregisters wurden irrtümlich sämtliche Nationalparke Deutschlands unter Kategorie II gelistet, obwohl nach wie vor nicht mit der Nationalparkidee konforme Nutzungen vorliegen (PLACHTER ET AL 2006). 1.2.3 Der Nationalpark im Bundesnaturschutzgesetz Im §24 der aktuell gültigen Fassung des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatschG) werden Nationalparke als rechtsverbindlich einheitlich geschützte Gebiete charakterisiert, die großräumig und von besonderer Eigenart sind. Sie sollen auf einem Großteil ihrer Fläche den Voraussetzungen für die Ausweisung von Naturschutzgebieten genügen. Letztere können aus wissenschaftlichen, landeskundlichen oder naturgeschichtlichen Gründen, weiterhin aufgrund der Seltenheit, Eigenart oder Schönheit eines Biotoptyps oder Gebietes ausgewiesen werden. Das Schutzgut stellen dabei Lebensgemeinschaften oder Biotope dar. Im Gegensatz zu Naturschutzgebieten müssen Nationalparke jedoch in einem vom Menschen unbeeinflussten, wenig beeinflussten oder aber sich zu Wildnis entwickelnden Zustand sein. Letzteres trägt oben genannter Definition des Zielnationalparks Rechnung. Das Ziel ist ein Ökosystem, dessen Dynamik sich möglichst ungestört entfalten kann (siehe 1.3.5). Der Schutzstatus eines Nationalparks wird mit demjenigen eines Naturschutzgebietes gleichgesetzt. Allerdings wird dies dahingehend relativiert, dass Ausnahmen im Hinblick auf die Großräumigkeit und Besiedlung der Gebiete erforderlich sein können. Ein Nationalpark steht wissenschaftlicher Forschung, Umweltbildung und Erholung offen, sofern diese die primären Schutzgüter und –ziele nicht bedrohen. Die Verantwortung für Nationalparke obliegt den Bundesländern, die oben genannte Anforderungen lokalen Gegebenheiten entsprechend umsetzen sollen. Im Gegensatz zu den Leitlinien der IUCN umgeht das BNatschG den problematischen Aspekt, dass Nationalparke mindestens ein komplettes Ökosystem umfassen sollen. Damit sind auch unter Vorbehalt ableitbare Anforderungen an Mindestgrößen von Nationalparken den Bundesländern überlassen. Der wichtige Aspekt der ungestörten natürlichen Dynamik findet zwar Berücksichtigung, wird aber nicht mit der Forderung eines konkreten Flächenanteils verbunden. Die Forderung nach ungestörter Dynamik „in einem überwiegenden Teil ihres Gebiets“ (BNatschG §24 Absatz 3) umgeht die von der IUCN festgeschriebene Untergrenze von 75 % für die strenge Naturzone. Ein Nutzungsverzicht im Nationalpark liegt zwar aufgrund der Forderung nach möglichst ungestörtem Ablauf der Naturvorgänge nahe, wird jedoch nicht kon kret festgelegt. Dies kann einerseits Nutzung auf unter 50 % der Fläche erlauben. Andererseits gelten Jagd und Forstwirtschaft gemäß BNatschG §18 Absatz 2 nicht als Eingriffe in Natur und Landschaft, sofern sie die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege berücksichtigen. Weiterhin wird der Erlass von Ausnahmeregelungen erlaubt, die aus der Besiedlung großräumiger Nationalparke oder von deren Rändern resultieren. Aus diesen letzten Punkten ergeben sich Grauzonen, die in manchen Bundesländern zu massiven Abweichungen von den Kriterien der IUCN führen. Falls vor der Ausweisung eines Nationalparks Nutzungsverträge über die Ausbeutung natürlicher Ressourcen getroffen wurden, erlaubt die IUCN diese für eine Übergangszeit (IUCN 1994). Dabei muss allerdings ein Ende der Nutzung festgeschrieben werden und die Zonierung entsprechend so durchgeführt werden, dass keine Nutzung in der Zone I stattfindet. Naturerlebnis, Bildung und Forschung in Nationalparken treten im BNatschG hinter das Ziel „Schutz eines dynamischen Ökosys tems“ zurück. 1.2.4 Der Nationalpark im Hessischen Naturschutzgesetz Die Nationalparkdefinition und -verordnung des HENatG vom 4.12.2006 entspricht der bundesweit gültigen. 1.3 Wieso bedarf ungestörte Naturentwicklung eines „Planes“? Ein Nationalparkplan soll gemäß der IUCN das angestrebte naturschutzfachliche Leitbild festlegen. Weiterhin gilt es, die Umsetzungsmaßnahmen und die dafür in personeller, finanzieller, technischer Hinsicht benötigte Ausstattung zu ermitteln. Zur Erfolgskontrolle der Leitbildumsetzung muss ein Monitoringkonzept entworfen und ein Zeitplan erstellt werden, ab dem Teilziele erreicht sein sollen (IUCN 1994). Gegenwärtig nicht auf ganzer Fläche naturnahe Zielnationalparke können nur dann durch die IUCN anerkannt werden, wenn sie einen schlüssigen Managementplan aufweisen. Wieso aber ist all dies vor dem Hintergrund des Leitbildes „Natur Natur sein las sen“ notwendig? Für die Nationalparkausweisung vorgesehene Gebiete bedürfen häufig renaturierender Eingriffe, beispielsweise des Rückbaus störender Strukturen wie Straßen oder der Entnahme standortfremder Pflanzen- und Tierarten. Abhängig vom Leitbild kann in Ökosystemen ohne große Karnivoren Wildbestandsregulierung einen dauerhaft notwendigen Eingriff darstellen (siehe 2.6). Die Koordination derartiger Maßnahmen findet durch den Nationalparkplan statt (IUCN 1993). Die Beeinträchtigung des Gebietes durch Besucher ist mittels eines im Nationalparkplan festgelegten Lenkungs- konzeptes zu minimieren. Für EUROPARC (2000) sollen das angestrebte Leitbild und die zu seinem Erreichen notwendigen Maßnahmen verständlich formuliert werden, um sie Nichtwissenschaftlern wie Behördenvertretern, Politikern und Anwohnern nachvollziehbar zu machen. Diese erläuternde Funktion ist sinnvoll, da die Schritte bis zum Erreichen des Zieles „Naturlandschaft“ keinen objektivierbaren Regeln folgen und Raum für Interpretation lassen. Wie die folgenden Aspekte Waldumbau und Wildmanagement verdeutlichen, können sowohl bestimmte pflegende Eingriffe als auch Eingriffsverzicht im Sinne der Entwicklung „natürlicher Bedingungen“ interpretiert werden. Darüber hinaus soll auf Probleme hingewiesen werden, die sich aus der Funktion der Nationalparke als Orte des Naturgenusses ergeben. Dabei wird – dem Gegenstand dieser Arbeit entsprechend – der Schwerpunkt auf Waldnationalparke gelegt. Die Zusammensetzung mitteleuropäischer Waldgesellschaften ist vielerorts durch den Anbau nicht standortheimischer Arten verändert. Insbesondere raschwüchsige, anspruchslose Koniferen wie Fichte (Picea abies) und Kiefer (Pinus sylvestris) werden außerhalb ihrer aktuellen natürlichen Arealgrenzen – z. T. in Reinbeständen kultiviert. Hinzu kommen fremdländische Arten wie die nordamerikanische Douglasie (Pseudotsuga menziesii). Anhänger eines konsequenten Schutzes natürlicher Prozesse (siehe 2.4), der von einer Bewertung der Entwicklungsrichtung absieht, können das künstliche Entfernen standortfremder Vegetation für unvereinbar mit dem Ideal des Nichteingreifens interpretieren. Im Sinne der Wildnisentwicklung wäre denkbar, auch der Entwicklung einer anthropogen veränderten Vegetation freien Lauf zu lassen. Dabei kann wohl mit Verdrängung vieler allochthoner Arten im Laufe der Sukzession gerechnet werden. Die Veränderung der Ökosysteme durch Etablierung fremdländischer Arten muss aber auch in Kauf genommen werden. Hierfür spricht, dass verwandte Arten von Douglasie und vielen anderen heute fremdländischen Baumarten die Eiszeiten in Europa nicht überstanden haben, jedoch früher zur heimischen Flora gehörten. Die Eiszeiten haben Mitteleuropa an Baumarten verarmen las sen. Im Übrigen kann die Ausrottung von Arten ein kostspieliges Unterfangen darstellen, was die Frage nahe legt, ob nicht Investitionen in andere Naturschutzmaßnahmen sinnvoller wären. Wird hingegen primär Naturnähe angestrebt und über standorttypische Vegetation definiert liegt ein Umbau fehlbestockter Standorte nahe. Baumarten prägen ihren Lebensraum nachhaltig, da beispielsweise die Podsolierung in von Koniferen bestockten Böden in absehbarer Zeit irreversibel ist. Dies kann die Entwicklung zu naturnahen Baumartengemeinschaften weiter verlangsamen. Gerade in Form von dichten Altersklassenbeständen stellen nicht standortheimische Koniferenforste naturferne Lebensräume dar, deren Dynamik sich von derjenigen autochthoner Laubwaldgesellschaften stark unterscheidet. Exotische Arten ernähren i. d. R. weniger phytophage Arten als autochthone, weshalb zum Erreichen natürlicher Nahrungsketten letzteren der Vorzug gegeben werden sollte. Das invasive Potential fremdländischer Arten ist darüber hinaus häufig nicht kalkulierbar. Ihre Ausbreitung kann regionstypische Ökosysteme verändern und Vorkommen von bodenständigen Arten gefährden. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund des anthropogenen Klimawandels. Damit kann ihre Duldung dem Schutz standortheimischer Arten zuwiderlaufen. Abhängig von ihrem Leitbild und den vorkommenden Arten brauchen manche Nationalparke auch ein Wildtiermanagement. Strittige Punkte sind hierbei die „natürliche“ Wildtierdichte und die „natürliche“ Verbissbelastung. Einflüsse wie der Verbiss von Jungbäumen wurden und werden häufig per se als Folgen unnatürlich hoher Populationsgrößen gesehen, welche aus jagdlicher Wildhege und hohem Nahrungsangebot auf landwirtschaftlichen Nutzflächen resultieren. Somit gelten große Pflanzenfresser als „schädlich“ und die Forderung nach starker Reduktion zu Gunsten reger Naturverjüngung in Wäldern wird laut (BODE & EMMERT 2000). Zu den negativen Konsequenzen hoher Großherbivorendichten gehört im Wirtschaftswald zweifelsohne eine Entmischung, da viele durch die Dominanz der Buche ohnehin seltenen Mischbaumarten wie die Esche (Fraxinus excelsior) gerne von Rehen und Rothirschen verbissen bzw. geschält werden. Esche und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) z. B. können dann einen ihrer Konkurrenzvorteile, nämlich ein bei ausreichendem Lichtgenuss rascheres Wachstum, nicht gegenüber der Buche einsetzen und von dieser verdrängt werden. Weiterhin sind hohe Wilddichten für den Waldumbau ungünstig, da junge Laubbäume in Koniferenmonokulturen für Großherbivoren sehr attraktiv sind. Die Forstwirtschaft sieht Verbiss auch deshalb kritisch, weil sich Bäume durch Leittriebverbiss rege verzweigen. Daraus resultiert eine Wertminderung hiebreifer Bäume, was ebenfalls einen Beitrag zur Diskussion um Wildverbiss geleistet haben dürfte, aber für Schutzgebiete irrelevant ist. Anzumerken bleibt in diesem Zusammen hang auch, dass die Deposition luftverbreiteter Nährstoffe sowie stark gedüngte landwirtschaftliche Kulturen die Ernährungssituation für Ungulaten stark verbessern (SCHMIDT 2004). Das Reh braucht als Konzentratselektierer Futterpflanzen mit engem C/N Verhältnis (HOFMANN 2003), die ihm durch oben angeführte Faktoren in großer Menge zur Verfügung stehen. In Rotwildgebieten werden die Rehbestände allerdings durch das Vorkommen des in der Konkurrenz um Nahrungsressourcen überlegenen Rothirsches limitiert. Dessen Einfluss auf die Baumverjüngung wird allerdings durch ein eiweißreiches und rohfaserarmes Nahrungsangebot ebenfalls verändert. So sind Rothirsche nach der Aufnahme gedüngter Feldfrüchte physiologisch bedingt gezwungen, Holzgewächse zu verbeißen (SIMON 2007, mündliche Mitteilung). Bei der Bewertung von Wildverbiss wird häufig außer Acht gelassen, das dessen Intensität und die Ungulatendichte nicht immer kausal zusammenhängen (SUTER 2005). Störungen durch den Menschen können Verbissbelastungen vervielfachen, da sie die Nutzung von Offenflächen durch Wildtiere verhindern. Weiterhin spielt die Raumnutzung der Tiere eine wichtige Rolle, aufgrund derer die Intensität des Verbisses in der Fläche betrachtet unterschiedliche Ausmaße annimmt. In naturnahen Ökosystemen kommt der Einfluss von Karnivoren hinzu. Große Karnivoren reduzieren zwar unter europäischen Verhältnissen die Dichte der Herbivoren nicht nachhaltig, diversifizieren aber ihre Raumnutzung noch stärker. Nachdem schneereiche Winter und Nahrungsmangel die Herbivorenbestände reduziert haben, kann Prädation die Erholung der Bestände stark verlangsamen und so ein „Verjüngungsfenster“ für Bäume schaffen. Weiterhin kann sich in Naturwäldern die Vegetation innerhalb mancher Verhaue ungestört entwickeln, die durch Sturmwurf oder Einzelstammbruch entstehen. Auf zugänglichen Flächen kann eine Schädigung der Baumverjüngung durch Ungulaten als eine Strategie zur Verbesserung ihrer Nahrungsbasis gesehen werden, da die Verdrängung krautiger Vegetation durch Bäume verzögert wird. Haben letztere eine bestimmte Höhe erreicht ist auch ihre nutzbare Biomasse (besonders Blätter und Knospen) der Reichweite bodenbewohnender Herbivoren entwachsen. Darauf folgen lange Waldentwicklungsphasen, in denen den Ungulaten mit den Baumsamen nur ein kleiner Anteil der jährlichen Primärproduktion zugänglich ist (SCHERZINGER 1991). Welche Rolle nun Verbiss, Prädation, Fluktuation der Herbivorendichte und verjüngungsfördernde Strukturen (z. B. Verhaue) für naturnahe mitteleuropäische Waldökosysteme spielen ist nach wie vor offen. Die Aufrechterhaltung eines Wildmanagements kann jedoch zum Schutz von Kulturflächen im Nationalparkumfeld und zum Erreichen eines Zielzustandes der Vegetation unerlässlich sein. Der Sinn von Besucherlenkung steht in Anbetracht des Primärzieles Ökosystemschutz und der (erwünschten) hohen Attraktivität von Nationalparken für Touristen außer Frage. Damit Störungen durch Besucher möglichst kleine Flächen betreffen bedarf es Zugangsbeschränkungen und eines Wegegebotes. Diese Maßnahmen müssen allerdings insbesondere der lokalen Bevölkerung erläutert werden. Eine wichtige Grundlage ist die Zonierung eines Nationalparks, die eine nicht zu betretende Ruhezone definiert. Das Wegesystem ist in Nationalparken ohnehin extensiv zu gestalten, da von Wegen Störungen ausgehen. Diese bestehen unter anderem in: Nährstoffeinträgen Änderung des Waldinnenklimas Förderung von Offenlandarten Einwanderung krautiger Neophyten Trennwirkung für Habitate von Invertebraten und Pflanzen Beunruhigung von Tieren Wegesicherungsmaßnahmen wie Entfernung stehenden Totholzes Gerade in nährstoffarmen Ökosystemen zeigt sich, dass die Vegetation entlang von Wegen häufig durch nitrophile und lichtbedürftige Pflanzen bestimmt wird. Bei diesen handelt es sich meist um häufige Ruderalarten, für welche die Waldwege Migrations achsen darstellen. Manche Waldarten werden ebenfalls durch die Veränderung des Waldinnenklimas benachteiligt. Dadurch verringert sich die effektive Größe eines Schutzgebietes, das auf Waldarten ausgerichtet ist (HEISS 1991). Wege erwärmen sich bei Sonnenexposition stark, geben die Wärme nachts wieder ab und trocknen in Ermangelung von Vegetation leicht aus. Damit ähnelt ihr Klima demjenigen des Of fenlandes und führt dazu, dass viele Waldarten sie nicht überwinden. Die Störung von Tieren durch Erholungssuchende ist ebenfalls nicht zu unterschätzen. Sie reduziert die besiedelbare Fläche für störungsempfindliche Arten und wirkt auf ihr Verhalten ein. Nach PETRAK (2006, mündliche Mitteilung) können Störungen durch Menschen zu einer Verdreifachung von Verbissschäden und zu einer Verzehnfachung von Schälschäden durch Rothirsche führen. Dafür ist der durch die Flucht erhöhte Kalorienbedarf ebenso entscheidend wie der erzwungene Verbleib der Tiere im geschlossenen Wald (WOTSCHIKOWSKY AL 2004). Anderenfalls bietet an Wald grenzendes Grünland gerade Rothirschen eine gute Nahrungsgrundlage, wofür im Winter auch Schnee beiseite gescharrt wird. Störungsempfindliche Tierarten wie der Schwarzstorch meiden nach häufigen Störungen ihre Vorjahresnistplätze (ROHDE ET AL 2005). Laut HEINRICH (1998) sind störungsfreie Rückzugsgebiete für viele Vogel- und Säugetierarten zu entscheidenden Minimalfaktoren geworden. In Prozessschutzgebieten verursachen Wege auch haftungsrechtliche Probleme. Der Zusammenbruch stehenden Totholzes stellt entlang von Wegen eine Gefahr für Besucher dar, weshalb bei spielsweise im Nationalpark Jasmund in einem weit gefassten Wegeumfeld bruchgefährdete Bäume gefällt werden (PLACHTER ET AL 2006). Der Wert stehenden Totholzes für viele Waldarten lässt diesen Eingriff nur tragbar erscheinen, wenn aufgrund eines dünnen Wegenetzes kleine Flächenanteile betroffen sind. Grob überschlagen bedeu- tet dies aber, dass bei einer Wegedichte von 20m/ha und einem durch Fällungen ge sicherten Bereich von 30 m an beiden Seiten der Wege bereits über 10 % der Fläche eines Nationalparks betroffen sind. 2.Konzepte zur Leitbildentwicklung und ihre Eignung 2.1 Die Begriffe „Natur“, „natürlich“ und „naturnah“ Zur Formulierung eines Leitbildes für ein Gebiet, das sich zur Naturlandschaft entwickeln soll, bedarf es zunächst der Definition der Begriffe „Natur“, „natürlich“ und „naturnah“, die keineswegs gleichen Inhalts sind. Der Begriff „Natur“ bezeichnet laut DUDEN (2002) die „Gesamtheit aller organischen und anorganischen ohne Zutun des Menschen entstandenen, existierenden oder sich entwickelnden Dinge und Erscheinungen“. An gleicher Stelle wird „natürlich“ als „von der Natur geschaffen, nicht künstlich“ charakterisiert. Diese Definitionen sind problematisch, da sie indirekte oder vergangene menschliche Einflüsse außer Acht lassen, die der Natürlichkeit abträglich sein können (s. u.). Der Begriff „natürlich“ ist streng genommen aufgrund der bereits angeführten Allgegenwart menschlicher Einflüsse in Mitteleuropa kaum mehr anwendbar. Eine Referenz für den unbeeinflussten Zustand mitteleuropäischer Landschaftsräume findet sich auch beim Blick in die Vergangenheit nicht, da der menschliche Einfluss zumindest seit der letzten Eiszeit immer in verschiedenem Ausmaß vorhanden war. Theorien über die Gestalt der „Urlandschaft“ lassen sich nicht endgültig verifizieren, da ihnen die Rekonstruktion der Vegetation aus Pollendiagrammen zu Grunde liegt, die zwei Nachteile aufweist. Einerseits stellen Moore und Seen La gerstätten für Pollen dar, die nicht unbedingt die Pollen der zonalen „Normallandschaft“ aufweisen. Weiterhin sind in Pollendiagrammen windbestäubter Arten zwangsläufig überrepräsentiert (REIF 1999). Darüber hinaus ist die Nacheiszeitliche Rückwanderung noch nicht abgeschlossen, weshalb sich der heutige „natürliche“ Vegetationszustand Mitteleuropas auch ohne menschliches Zutun stark von jedem Referenzzeitpunkt nach der Eiszeit unterscheiden würde. SCHERZINGER (1996) schlägt drei mögliche im Naturschutz anwendbare Definitionen des Begriffs „natürlich“ vor: 1. Vom Menschen völlig unbeeinflusste Natur. 2. Indirekt vom Menschen beeinflusste, aber ohne unmittelbare Eingriffe belassene Natur (z. B. Fernverfrachtung von Luftschadstoffen, Pestiziden, Radioaktivität) 3. Von Wildbeutern und Sammlern genutzte, ansonsten ohne unmittelbare Eingriffe belassene Natur (z. B. ursprüngliche Buschmanngesellschaften, Aborigines in Australien). Die erste Definition verliert mittlerweile global zunehmend an Gültigkeit, da der Einfluss des Menschen sich als flächendeckender als bisher angenommen herausgestellt hat. Dabei spielt auch die Neubewertung des Einflusses von Wildbeuterkulturen eine Rolle (s. u.). Weiterhin werden Luftschadstoffe wie Persistant Organic Pollutants (POPs) auch in zivilisationsfernen arktischen Ökosystemen nachgewiesen. Die zweite Definition trägt dem Rechnung, indem sie Luftschadstoffe als der Natürlichkeit ab trägliche Einflussfaktoren ausklammert. Dies kann für Ökosysteme sinnvoll sein, die beispielsweise Säureeinträge aus der Luft abzupuffern vermögen und sich durch Stickstoffeinträge nicht wesentlich verändern. Oligotrophe, basenarme Standorte wie Hochmoore unterliegen jedoch starken Veränderungen, da nährstoffhaltige anthropogene Einträge aus der Atmosphäre die Verdrängung der lebensraumprägenden Torfmoose durch höhere Pflanzen bewirken. Der pragmatischen zweiten Definition schließen sich STREIT ET AL (1992) trotzdem an. Natürlich ist für sie, was „ohne direkten Einfluss des Menschen entstanden und vom Menschen nicht verändert, selbstre gulationsfähig“ ist. Die dritte Definition SCHERZINGERS sieht den Menschen als Teil der Natur, allerdings nur bis zu einem gewissen Grad an Nutzung. Dabei wird wohl vorausgesetzt, dass Jäger und Sammler in stärkerem Maß von der Kapazität ihres Le bensraumes abhängen und – im Vergleich zu fortschrittlicheren Landnutzern wie Ackerbauern - weniger ökosystemverändernd zu wirtschaften gezwungen sind. Dies wird durch die Ausrottung von Tierarten widerlegt, für die Jäger und Sammler Kulturen verantwortlich sind. Darüber hinaus hatte der Mensch auch auf dieser Kulturstufe durch die Beherrschung des Feuers massiven Einfluss auf die Struktur seines Lebensraums, beispielsweise indem er dieses zum Abbrennen der Vegetation einsetzte. Daher ist eine Einbeziehung des Menschen für die hier bearbeitete Schutzgebietskategorie und ihren Naturnäheanspruch nicht zielführend. Der DUDEN (1996) beschreibt als „naturnah“, was „der Natur entsprechend, ihre Bedingungen berücksichtigend“ ist. Für STREIT ET AL (1992) ist ein naturnahes Ökosystem „ohne direkten Einfluss des Menschen entstanden, durch menschlichen Einfluss nicht wesentlich verändert. Diese Ökosysteme verändern sich bei Aufhören des menschlichen Einflusses kaum und sind selbstregulationsfähig.“ REIF (1999) definiert „Naturnähe“ als „ein Maß für die Ähnlichkeit zur natürlichen, also vom Menschen unbeeinflussten Situation.“ Er merkt weiterhin an, dass für Wälder neben bodenständigen (autochthonen) Pflanzengesellschaften, Strukturmerkmalen und Dynamik auch der Einfluss von Tierarten in die Einschätzung des Naturnähegrades einfließen sollte. Wenn man die Bewertung der Pflanzengesellschaft zu Grunde legt können viele Buchenwälder die Naturnähedefinition von STREIT ET AL erfüllen. Laut HEYDER (1992) wurden Buchenbestände selten künstlich begründet. Wo Naturverjüngung nicht gelang oder bei Aufforstungen verwendete man meist Koniferen. Darüber hinaus ist in Totalschutzgebieten zu beobachten dass in Buchenwäldern häufig nur Buchenverjüngung durchkommt (z. B. STRAUSSBERGER 2000). Damit liegt zumindest hinsichtlich der Vegetation ein selbstregulationsfähiges System vor, das auch nach Aufgabe menschlicher Nutzungen keinen wesentlichen Veränderungen unterliegt. Reif erweitert die zu betrachtenden Kriterien jedoch um wichtige Aspekte, die aufzeigen, dass in Mitteleuropa – bis auf wenige Ausnahmen - vom Vorhandensein anthropogen überprägter Ökosysteme ausgegangen werden kann. Offen bleibt dabei, wie ähnlich der zonale Buchenwald der „vom Menschen unbeeinflussten Situation“ sein kann. Für KÜSTER (1998) stellt er einen Sekundärwald dar, der die vorherigen Waldgesellschaften ersetzt und eine Folge menschlichen Wanderfeldbaus ist. Ohne menschlichen Einfluss gäbe es daher die zonale Vegetationseinheit Buchenwald nicht in ihrer heutigen Form. Demzufolge finden sich wenige Waldgebiete, die nicht nach der Neolithischen Revolution zu irgendeinem Zeitpunkt in Ackerland umgewandelt wurden (KÜSTER 1998). Er sieht hierin den Grund für die fehlende Dominanz der Buchenwälder in den Interglazialen. Eine Konsequenz daraus wäre, dass Buchenwälder in keinem Fall auch nur naturnah sein könnten, da sie ein Produkt des menschlichen Einflusses sind und nicht „gering verändert“. BUNZEL-DRÜKE (1999) hingegen führt die fehlende Buchendominanz in den Interglazialen auf die höhere Artenzahl von Groß- und Megaherbivoren zurück, die massiven Einfluss auf die Vegetation nahmen. Die große Konkurrenzkraft und Standortamplitude der Buche machen allerdings unwahrscheinlich, dass sie wie KÜSTER annimmt ein Kulturfolger ist. Er benennt keinen Standortparameter, den die landwirtschaftliche Nutzung so zu ändern vermag, dass die Buche daraufhin für Jahrtausende die Oberhand erhält. BUNZEL-DRÜKES Theorie (1999), der zu Folge die mangelnde Verbissresistenz der Buche für ihr Auftreten mit zunehmendem Verschwinden von Megaherbivoren verbunden ist erscheint nachvollziehbarer. Allerdings geht sie nicht vom kompletten Fehlen geschlossener Wälder aus, da wohl produktive Habitate wie Auen stärkerer Beweidung unterlagen als unproduktive. Die Mittelgebirge beispielsweise werden als Waldstandorte gesehen (REMMERT 1991, BUNZEL-DRÜKE 1999). Die Konkurrenzkraft der Buche ist in der unteren montanen Stufe des Kellerwaldes maximal und gerade die hohe Vitalität von Kusselbuchen in intensiv beästen Bereichen macht unwahrscheinlich, dass die hiesigen Buchenvorkommen letztlich anthropogen begründet sind. KÜSTER (1998) räumt ein, dass die Buche vor der neolithischen Revolution bereits in den südlichen Mittelgebirgen vorkam. Die Ausbreitung in Einwanderung begriffener Baumarten verlief ihm zu Folge häufig entlang der Gebirge, da deren gegenüber dem Flachland ausgeprägteres Störungsregime ihnen eine schnellere Etablierung erlaubte. Aus dem gleichen Grund kann der Wanderfeldbau die Bucheneinwanderung lediglich beschleunigt haben. Weniger umstrittene Autoren wie ELLENBERG sehen Mitteleuropa in weiten Teilen als „Buchenland“. Die andauernde Expansion der Buche ist dem zu Folge nicht anthropogen bedingt. ELLENBERG (1996) gibt im Gegenteil zu bedenken, dass die Buche auch einen Teil der Standorte zu besiedeln im Stande wäre, die heute als von Natur aus eichendominiert gelten. Dazu zählen solche, die nährstoffarm und trocken sind und von denen die Buche in der Vergangenheit z. T. durch Niederwaldnutzung verdrängt wurde (siehe 2.1.1). Schlussendlich können nutzungsfreie Buchenwälder sich bezüglich der Stoff- und Energieflüsse, Strukturen und Konkurrenzbedingungen Naturwaldbedingungen annähern, wenn gemäß REIF (1999) der Einfluss der Fauna „natürlich“ ist. 2.2 Das Konzept der „Potentiell Natürlichen Vegetation“ Das Modell der potentiell natürliche Vegetation (PNV) wurde entwickelt, um die hypothetische Vegetation eines Standortes unter natürlichen Bedingungen zu ermitteln. Sie bezeichnet die pflanzensoziologische Einheit, die sich nach Beendigung jeglichen menschlichen Einflusses auf einer Fläche einstellen würde, wenn die aktuellen Standortbedingungen unverändert blieben. Letztere werden von den meisten Autoren (z. B. Ellenberg, Tüxen und Kowarik, in STURM 1994) nicht näher definiert. Als entscheidend können das vorhandene Artenset, Konkurrenz sowie klimatische und edaphische Bedingungen gelten (z. B. Ammer und Utschick in STURM 1994). Im Unterschied zur PNV steht die „reale Vegetation“ eines Standortes, bei der es sich um die vorhandene anthropogene Vegetationseinheit handelt, die nach einer Sukzession von der PNV ersetzt wird (REIF 1999). Letztere ist in Europa in der Regel nicht zwangsläufig mit der natürlichen Vegetation identisch, die ohne zwischenzeitlichen menschlichen Einfluss vorhanden wäre (z. B. wenn die Eintiefung begradigter Fließ gewässer den Grundwasserspiegel in der Aue abgesenkt hat). Das PNV Konzept ist sehr inhomogen, da es von verschiedenen Autoren unterschiedlich interpretiert wurde. Die PNV wird aber in jedem Fall nur anhand der Gesellschaft des „reifen“ Ökosystems der Optimalphase definiert. Zu diesem hin führende Sukzessionsstadien und endogene oder exogene Störungen nehmen auf dieses Leitbild keinen Einfluss. Darüber hinaus kann häufig nicht prognostiziert werden, wel che Vegetationseinheit am „Ende“ einer Sukzession steht. Stochastische Ereignisse wie Mastjahre oder Klimaschwankungen können den Sukzessionsverlauf beeinflussen und im Laufe der Zeit zu Abfolgen verschiedener „Klimaxgesellschaften“ führen, was eine Vorhersage anhand momentaner Bedingungen fragwürdig erscheinen lässt. Abweichungen von der PNV sind also keineswegs immer „unnatürlichen“ Ursprungs und damit negativ im Sinne an Naturnähe orientierter Leitbilder. Weiterhin findet der Einfluss der Fauna auf die Vegetation keine Berücksichtigung. Dies gilt zumindest für diejenigen Autoren, welche wirkende Einflussfaktoren benannt haben. Damit werden die zweifelsohne weitreichenden Einflüsse von Bibern (Castor spec) oder zu Gradationen neigenden Insektenarten wie den Borkenkäfern (Scolytidae) negiert. Gebietsfremde Pflanzenarten können Teil der PNV sein, sofern sie in der Kli maxgesellschaft überlebensfähig sind (REIF 1999). Daraus ergeben sich Probleme für die Anwendung im Naturschutz, da invasive fremdländische Pflanzenarten nicht in jedem Naturschutzkonzept und –gebiet erwünscht sind. 2.3 Die Mosaik-Zyklus-Hypthese Statische Sichtweisen wie das PNV Konzept kollidieren mit Erkenntnis der Ökologie, denen zu Folge Störungen und Veränderungen in Ökosystemen alltägliche Vorgänge sind. Sie bedingen häufig erst Artenvielfalt, indem sie die Dominanz konkurrenzstarker Arten reduzieren und ausbreitungsfähigen oder weniger störungsanfälligen Arten das Überleben ermöglichen. Ein Beispiel hierfür stellen Wälder von Schattbaumarten dar, deren Krautschicht sich erst nach dem Zusammenbruch von Bäumen entfalten kann. Teilflächen der Optimalphase weisen beispielsweise eine geringere Artenvielfalt auf als solche, die sich in der Zusammenbruchphase befinden. Beide sind Teile des natürlichen Ent- Abbildung 2: Kleinräumiges Nebeneinander wicklungszyklus und liegen in Na- verschiedener Phasen im Entwicklungszyklus von Waldteilflächen (Scherzinger 1996) turwäldern in unmittelbarer Nachbarschaft vor. Berücksichtigung fanden die systemtypischen Veränderungen in der Mosaik-Zyklus-Hypothese des Zoologen Hermann Remmert, die das patch-dynamics Konzept auf Wälder anwandte. Der Wald (und auch andere Lebensraumtypen) stellt demnach ein Mosaik aus verschiedenen Ausschnitten eines Entwicklungszyklus dar (Abb. 2). Dieser Zyklus verläuft von der Pionierphase des Ökosystems über die Optimalphase zur Zusammenbruchphase und beginnt dann von neuem. Es kommt dabei zu einem hohen Umsatz von Arten. So weist die Pionierphase lichtliebende Tierarten und krautige Pflanzen auf. Wächst nun eine neue Baumschicht heran kommt es zur Verdrängung dieser Arten, die dann neu entstandene Pionierstandorte besiedeln müssen oder aber bis zum Tod der neuen Baumgeneration als Samen ausharren. Jede Entwicklungs phase weist daher einen Anteil für sie typischer Arten auf, die bei ihrer Beendigung durch veränderte Lebensbedingungen zur Kolonisation neuer Habitate gezwungen sind. Als die wichtigsten Triebkräfte für die Dynamik sah REMMERT (1991) Konkurrenz um Ressourcen und exogene Störungen wie Windwurf. Auch wenn manche von REMMERTS Postulaten für Buchenwälder (Ausbildung von Zwischenbaumgenerationen, REMMERT 1991, Dauer der Entwicklungsphasen, REMMERT in ELLENBERG 1996) selten zutreffen liegt der Wert seiner Hypothese in der Neubewertung der Raum-Zeit-Dynamik des Ökosystems Wald. Diesem ist nun jede seiner Entwicklungsphasen gleichzeitig zuzurechnen und auch Störungen werden als notwendige natürliche Phänomene akzeptiert. Er betont weiterhin die Bedeutung von starkem Tot- und Altholz als Bestandteile von Entwicklungsphasen, die durch die geringen Umtriebszeiten aus Wirtschaftswäldern verschwunden sind (Abb. 2). 2.4 Prozessschutz 2.4.1 Entwicklung und Definition Der Schutz natürlicher Dynamik steht für die IUCN gleichberechtigt neben Arten-, Biotop- und Ressourcenschutz (PLACHTER 1996). Im deutschen Sprachraum wird er synonym für „Prozesschutz“ verwendet. Was aber verbirgt sich hinter den Schlagworten „natürlicher Prozess“ und „natürliche Dynamik“ in ihrer Anwendung im Natur schutz? Laut DUDEN (2002) ist ein Prozess ein „sich über eine gewisse Zeit erstreckender Vorgang , bei dem etwas (allmählich) entsteht, sich herausbildet“. JEDICKE (1998) definiert natürliche Prozesse als „... Veränderungen von Größen, Zuständen und/oder Interaktionen in ökologischen Systemen physiogener und/oder biotischer Art entlang der Zeitachse, vielfach einhergehend mit räumlichen Veränderungen.“ Die das Prozessgeschehen bedingende Dynamik ist eine „auf Veränderung, Entwicklung ausgerichtete Kraft, Triebkraft“ (DUDEN 2002). Da den teils stochastischen Abläufen in der Natur kein Zielrichtung zu Grunde liegt definiert Jedicke Dynamik für natürliche Sys teme als „die Kräfte (Mechanismen), welche den Ablauf von Prozessen in Ökosyste men verursachen (steuern)“. Dynamische Vorgänge bestehen beispielsweise in Bodenbildung und –erosion, Flutereignissen, Sedimentverlagerung in Fließgewässern, Bränden und Sturmwürfen (KNAPP 1998). Die räumlichen Dimensionen in denen Prozessewirken, ihr Einfluss auf Ökosysteme, ihre Häufigkeit und ihre Wirkungsdauer sind dabei vielfältig (PLACHTER 1996). In Deutschland führte STURM (1993) den Begriff „Prozessschutz“ ein, der zunächst natürliche Dynamik in Wäldern zum Schutzgut erklärte. Er bezog sich dabei in erster Linie auf Wirtschaftswälder, in denen z. B. durch Verzicht auf die Räumung von Windwürfen mehr Naturnähe und Stabilität (s. u.) erreicht werden sollten. Darüber hinaus forderte er nutzungsfreie Prozessschutzgebiete, die aktuell Hauptgegenstand dieses Leitbildes sind. Die Forderung, Waldgebiete durch Nutzungsverzicht einer ungestörten Entwicklung zu überlassen ist jedoch weitaus älter. Bereits der deutsche Naturschutzpionier Hugo Conwentz forderte am Anfang des 20. Jahrhunderts vergebens eine Ausweisung derartiger Schutzgebiete (SPERBER 2000). Allerdings wurden in Deutschland ab dem Jahre 1911 Naturwaldreservate ausgewiesen, die sich ohne menschliche Eingriffe entwickeln sollten. Dabei spielten sowohl ästhetische Motive eine Rolle als auch forstliche, sollte doch ermittelt werden, welche Baumarten sich auf den Flächen ohne menschliche Eingriffe durchsetzen ( AID 2003). Problematisch bleibt jedoch die geringe Größe der Naturwaldreservate, die durchschnittlich zwischen 20 und 30 ha liegt (SCHERZINGER 1996). Das erste großflächige Prozessschutzgebiet war dann der 1970 ausgewiesene Nationalpark Bayerischer Wald, in dem auch Borkenkäfergradationen im Zuge des Prozessschutzes geduldet werden. Auch REMMERT (1990) erhob den Schutz natürlicher Prozesse zu einem Primärziel des deutschen Naturschutzes. Er erweiterte ebenso wie beispielsweise JEDICKE (1998) und PLACHTER (1996) den Prozessschutzgedankens auf waldfreie Ökosysteme wie Fließgewässer. STURM (1993) bezeichnet Prozessschutz auch als den Schutz von Entwicklungsbedingungen, nicht von Zuständen. JEDICKE (1998) unterscheidet zwei Formen von Prozessschutz, die der Vollständigkeit halber Erwähnung finden sollen. Integrativer Prozessschutz bezieht anthropogene Nutzungsprozesse ein und dient dem Erhalt von Kulturlandschaften. Dabei wer den unrentabel gewordene Landnutzungsformen durch ein kostengünstiges Manage- ment ersetzt. Ein Beispiel hierfür besteht in großflächiger Nutztierbeweidung zum Erhalt halboffener Landschaften. Dabei kann aufgrund der Raumnutzung der Weidetiere nur bedingt der Erhalt definierter Artengemeinschaften an einem bestimmten Ort im Vordergrund stehen, sondern primär der Erhalt eines Landschaftsbildes. Der die Lebensgemeinschaft prägende Prozess wird hier durch den Menschen vorgegeben und durch ein Management begleitet. Für Nationalparke ist hingegen primär der segregative Prozessschutz relevant, welcher sämtliche menschlichen Einflüsse auszuschließen versucht. Es erfolgt kein Erhalt bestimmter Sukzessionsstadien und ihrer Arten durch Pflegemaßnahmen, ebenso wenig wie eine Lenkung hin zu einem bestimmten Landschaftsbild stattfindet. Stattdessen wird vorausgesetzt, dass ein ungestörtes Prozessgeschehen (im Sinne der Mosaik-Zyklus-Hypothese) Habitate für spezialisierte Arten permanent neu entstehen und wieder vergehen lässt und so über Habitatvielfalt auch Sekundärzielen wie dem Arterhalt gerecht zu werden vermag. 2.4.2 Umsetzungsmöglichkeiten Das Leitbild segregativer Prozessschutz weicht vom „klassischen“ Naturschutz ab, der auf menschliche Vorlieben für bestimmte Arten und Zustände von Biotopen ausgerichtet ist. Da „schädliche“ und „hässliche“ Arten und Zustände ebenso zugelassen werden wie attraktive stellt Prozessschutz ein biozentrisches Leitbild dar (SCHERZINGER 1996). Ein weiterer Vorzug besteht darin, dass keine Biotoppflege entgegen natürlicher Entwicklungsprozesse vonnöten ist und die in der Natur allgegenwärtige Dynamik ihren Verlauf nehmen kann. Wie allerdings SCHERZINGER (1996) betont, führt diese nicht zwangsläufig zu Artenvielfalt. So kann die auf einer Brache durch ungelenkte Sukzession entstehende Dickung weitaus artenärmer sein als das vorherige Kulturland. Auch wenn bei Ausweisung von Prozessschutzgebieten mit Aussterbeereignissen und Veränderungen des Artenspektrums gerechnet werden muss, können insbesondere Störungen zu einer hohen Habitat- und Artenvielfalt führen. Für Wälder hat Abbildung 3: Anteile verschiedener Waldentwicklungsphasen an einem Entwicklungszyklus und ihre Biodiversität (Scherzinger 1996) Prozessschutz die Konsequenz, dass nicht ein für statisch erachteter Wald der Optimalphase zum Schutzobjekt erklärt wird, sondern sämtliche Phasen der Waldentwicklung. Dies beinhaltet die Zusammenbruchphase ebenso wie die sich daraufhin entwickelnde Pionierphase. Wälder der Optimalphase weisen meist eine geringe Artenvielfalt auf, welche erst in den Alterungs- und Zusammenbruchphasen wieder eine Zunahme erfährt (Abb. 3). Ein Aspekt des Biodiversitätsschutzes ist der Erhalt genetischer Vielfalt von Arten (www.biodiv.org). Nur genetisch vielfältige Arten haben die Chance, sich Veränderungen ihrer Lebensumstände anzupassen, wie sie sich beispielsweise aus der Klimaveränderung ergeben. Schutz natürlicher Prozesse bedeutet auch, naturnahe Selektionsbedingungen zu erhalten (PLACHTER 1996). Nach STURM (1993) führt das Zulassen natürlicher Dynamik zu einer höheren genetischen Vielfalt von Baumpopulationen. Im Naturwald herrschende Selektionsfaktoren umfassen u. a. Schneebruch, Windwurf, Verbiss und Insektenkalamitäten. Forstliche Auslese hingegen entfernt beispielsweise tief beastete und krummschäftige Bäume, wodurch eventuell natürlichen Selektionsfaktoren gegenüber anfälligen Bäumen ein Konkurrenzvorteil gesichert werden kann (SCHERZINGER 1996). Durch Zulassen von Störereignissen erhöht sich also die phäno- und genotypische Vielfalt, was langfristig die Stabilität gegenüber schädigenden Umwelteinflüssen erhöhen kann. STURM (1993) fasst dies folgendermaßen zusammen: „Der natürliche Wald wird als ein zufallsbeeinflusstes, multivariates Sukzessionsmosaik beschrieben, dessen ökologische Stabilität durch eine Förderung der Selbstregulationsmechanismen erhöht wird.“ Das Leitbild Prozessschutz legt eine Selbstregulationsfähigkeit von Ökosystemen zu Grunde, die für Mitteleuropa durchaus in Frage gestellt werden kann. Saurer Regen, Eutrophierung durch Luftschadstoffe, Verinselung von Biotopen und das Fehlen von Schlüsselarten, insbesondere von großen Prädatoren, können die Selbstregulationsfähigkeit von Ökosystemen beeinträchtigen (PIECHOCKI ET AL 2004). Diese ökosystemare Selbstregulation wurde in der Vergangenheit häufig überhöht. Sie setzt auf die Erholung definierter Ökosystem und übersieht dabei, dass natürliche dynamische Vorgänge Veränderungen des Ökosystems bewirken können, die nur bedingt in das zyklische Schema passen, dem zu Folge sich am Ende der Entwicklung immer wieder der Ausgangszustand einstellt. Negativ zu bewertende Veränderungen können sich z. B. aus der Verinselung von Lebensräumen ergeben. Diese kann eine Metapopulationsdynamik verhindern, wodurch Aussterbeereignisse nicht kompensiert werden. Das lokale Aussterben einer Art kann nur durch Wiederbesiedlung kompensiert werden, wenn die betroffene Art ausbreitungsfähig ist oder entsprechende Migrationskorridore vorhanden sind. Darüber hinaus stellt sich die Frage, wie weit Prozessschutz in den vergleichsweise kleinen, insulären Schutzgebieten Europas gehen sollte, wenn er Restpopulationen seltener Arten gefährdet. Hier zeigt sich ähnlich wie bei den Flächenanforderungen für Minimum Viable Populations, dass Schutzgebiete in Mitteleuropa zwangsläufig zu klein bemessen sind. Daher stellt Prozessschutz keine „Heilslehre“ dar, wie noch REMMERT (1990) postulierte: „Würden wir die Möglichkeit zum Ablauf der natürlichen ökologischen Prozesse in allen Schutzgebieten schaffen können, würden wir unsere Naturschutzsorgen los sein.“ Für SCHERZINGER (1991) kann Prozessschutz nur dann konsequent auf der vollen Fläche eines Schutzgebietes umgesetzt werden, wenn es sehr großflächig und naturnah ist. Anderenfalls muss mit gravierenden Verlusten an Arten gerechnet werden, die Komponenten des geschützten Ökosystems sind. Trotz dieser Einwände ist Prozessschutz ein bedeutendes Konzept des Naturschutzes. Viele Arten sind gerade durch einen Mangel an Dynamik bedroht, darunter be - finden sich Arten der Auen und Naturwälder (siehe 3.2.2.2). Vor dem Hintergrund Jahrtausende andauernder menschliche Überprägung mitteleuropäischer Landschaften ist deren natürliche Dynamik weitgehend unbekannt. Große Prozessschutzgebiete können hier wichtige Erkenntnisse liefern, denen mehr Aussagekraft eingeräumt werden kann als denjenigen aus kleinen, isolierten Naturwaldreservaten. Das nacheiszeitliche Landschaftsbild ist allerdings nicht nur anthropogen verändert worden, sondern befand sich auch darüber hinaus in stetigem natürlichem Wandel. Dazu ge hören insbesondere klimatische Veränderungen. Zeitabschnitte mit mildem Klima wie das Atlantikum (ab ca. 4000 v. Chr.) wechselten sich mit kühleren Perioden ab. Die Einwanderungsgeschichte der Baumarten wiederum bedingte eine Sukzession verschiedener Waldgesellschaften, deren vorläufiges Ergebnis die Dominanz der Rotbuchenwälder auf einem Großteil der Standorte Mitteleuropas darstellt (ELLENBERG 1996). Die Rotbuche befindet sich immer noch in Ausbreitung. Laut PLACHTER ET AL (2000) haben die Wälder Mitteleuropas auch aufgrund natürlicher Vorgänge kein erkennbares Klimaxstadium erreicht. Da die nacheiszeitliche Rückwanderung von Arten, nicht von Artengemeinschaften vollzogen wurde, sind wohl auch die aktuellen Pflanzengesellschaften als jung einzustufen. Gerade vor dem Hintergrund der anthropogenen Klimaveränderung erscheint es sinnvoll, den sich wandelnden Ökosystemen ihre Entwicklungsrichtung selbst zu überlassen und von allzu eng gefassten Biotopdefinitionen als Leitbildern abzuweichen. 2.5 Wildnis als Leitbild Als das Entwicklungsziel von Nationalparken und anderen Prozessschutzgebieten wird häufig „Wildnis“ genannt. Der Begriff „Wildnis“ entzieht sich jedoch wissenschaftlicher Definition und bleibt damit von der subjektiven Naturwahrnehmung abhängig. Er umschreibt laut DUDEN (2002) „unbewohntes, unwegsames, nicht kultiviertes oder bebautes Land“. Für TROMMER (1997) ist „Wildnis (...) letztlich der Gegenbegriff zur Zivilisation schlechthin“ und damit definitorisch von einer Gegenüberstellung zu letzterer abhängig. Dies kann innerstädtische Brachen ebenso umfassen wie tropische Primärwälder. Mit Wildnis verbinden sich ambivalente Empfindungen, die von Furcht bis hin zu Ehrfurcht reichen (BIBELRIETHER 1998). Die ersten Wildnisschutzgebiete waren ab dem Jahre 1919 die Zapovedniki (Einzahl: Zapovednik) in Russland. Der wilde Charakter der Gebiete sollte durch keinerlei Eingriffe verändert werden, wodurch sie der Forschung als Referenzökosysteme zum Vergleich mit bewirtschafteten dienen konnten. Es herrschte (außer zum Zweck der Erforschung) ein Betretungsverbot (OSTERGREN & HOLLENHORST 2000). In der westlichen Welt entstand die Idee des Wildnisschutzes während des 19. Jahrhunderts in den USA. Laut TROMMER (1997) lag dort ein extremer Kontrast zwischen der zivilisierten Ostküste mit ihren Großstädten und der scheinbar unendlichen Wildnis im Landesinneren und Westen vor. Der Einfluss indigener Kulturen auf diese Wildnis wurde nicht zur Kenntnis genommen. Die rasche Kolonisation und Urbarmachung Nordamerikas führte jedoch dazu, dass der Verlust von „unberührten“ Gebieten spürbar wurde. Daher forderten Naturschutzpioniere wie Ralph Waldo Emerson und Henry David Thoreau bereits Mitte des 19. Jahrhunderts, in Staatsbesitz befindliche Naturgebiete unter umfassenden Schutz zu stellen, was Nutzungs- und Erschließungsverzicht beinhaltete. Zur gleichen Zeit war der beginnende deutsche Naturschutz überwiegend auf den Erhalt von im Verschwinden begriffenen Kulturlandschaftsformen ausgerichtet. Die erste Ausweisung eines Wildnisschutzgebietes fand in den USA 1924 statt und wurde von dem Forstwirt und Wildökologen Aldo Leopold initiiert. Bei dem betroffenen Gebiet handelte es sich um eine 250000 ha umfassende Waldfläche am Ober- lauf des Gila Flusses in New Mexico, das nach nationalem Recht geschützt wurde (TROMMER 1997). Zwar bestanden in den USA bereits Nationalparke, in diesen wurden jedoch entgegen heutigen Anforderungen zahlreiche Managementmaßnahmen durchgeführt. Dazu gehörte Bejagung von großen Beutegreifern, Schädlingsbekämpfung und Wildhege. Ziel des ersten Wildnisgebietes war es hingegen, menschliche Nutzungsansprüche von einem unberührten Gebiet fern zu halten und es vollkom men sich selbst zu überlassen. 1963 wurde gar der staatliche „Wilderness Act“ erlassen, der eine rechtliche Grundlage zur Ausweisung von Wildnisgebieten darstellte. Die Zapovedniki entsprechen der IUCN Kategorie Ia, da wissenschaftliche Erforschung im Vordergrund steht, während die Definition des US Wilderness Act sich weitgehend mit derjenigen der IUCN Management Kategorie Ib deckt (siehe 1.2.1). Ähnlich wie in der aktuellen Definition des Nationalparks soll sich ein Ökosystem nach der ihm eigenen Dynamik entwickeln. Allerdings dien(t)en Wildnisgebiete nicht der Erholung, was den Erhalt von Infrastruktur und Zonierung erübrigt. Ähnlich wie bei der Anwendung des Nationalparkkonzeptes (siehe Definition „Zielnationalpark“ unter 1.2) wird der Begriff „Wildnis“ in Mitteleuropa auch für in freier Sukzession befindliche Kulturlandschaften verwendet. In den Worten SCHERZINGERs (1996): „Der Weg zur Wildnis führt über Prozesse des Verwilderns und zwar auf verschiedenen Wirkungsebenen und in sehr unterschiedlichem Maßstab“. Dabei muss eingeräumt werden, dass das Ergebnis dieser Sukzession vielleicht naturnah ist, mit dem vor Jahrtausenden erstmalig vom Menschen veränderten Ökosystem u. U. aber wenig gemein hat. Insofern kann eine Urlandschaft nicht wiederhergestellt werden (SCHERZINGER 1996, PIECHOCKI ET AL 2004). Ein Vergleich mit den russischen Zapovedniki und dem nordamerikanischen „wilderness approach“ fällt also schwer, da dortige Ökosysteme vor ihrer Ausweisung durch Wildbeuter und primitive Formen des Ackerbaus verändert wurden. Deren Einfluss auf Landschaften darf zwar nicht unterschätzt werden, verändert diese aber sicher in geringerem Ausmaß als das Wirtschaften der Menschen im dichtbesiedelten, seit Jahrtausenden landwirtschaftlich genutzten Mitteleuropa. Trotzdem inspirierten insbesondere amerikanische Wildnisgebiete und Nationalparke europäische Ausweisungen von Großschutzgebieten. 2.6 Fazit: Welches Konzept eignet sich für mitteleuropäische Nationalparke? Aus der Nationalparkdefinition der IUCN (1994) folgt, dass in Nationalparken primär Ökosysteme geschützt werden, indem deren Nutzung untersagt wird und die Entfaltung ihrer natürlichen Dynamik zugelassen wird. Prinzipiell eignen sich damit die Leitbilder Prozessschutz und Wildnis, während die klimaxorientierte Vorstellung der PNV die Ökosystemdynamik negiert und damit stochastische Vorgänge als im Sinne der Naturnähe negativ bewertet. Die Satzung des Nationalparkes Bayerischer Wald definierte ursprünglich „gesunden Bergwald“ als Schutzobjekt, was die Bekämpfung von Borkenkäfergradationen gerechtfertigt hätte. Der Anspruch „Natur Natur sein lassen“ und der damit verbundene Verzicht auf Bekämpfung von Gradationen machte daher eine Satzungsänderung notwendig. Das Schutzziel „natürliche Dynamik“ schränkt allerdings die Verwendbarkeit vorgenannter dynamischer Leitbilder zunächst ein, da sie keine Bewertung der dynamischen Abläufe vornehmen. Die IUCN gibt als ein Managementziel für Nationalparke an, dass sie auch dem Erhalt „eines möglichst natürlichen Zustandes von repräsentative(n) Beispiele(n) physiographischer Regionen, Lebensgemeinschaften, genetische Ressourcen und Arten (dienen), (welche) ökologischer Stabilität und Vielfalt gewährleisten“ (IUCN 1994). Letztlich liegt also in den IUCN Vorgaben kein wirklich ergebnisoffenes Prozessschutzleitbild im engeren (segregativen) Sinne vor. Die Anwesenheit von Neobiota oder das Fehlen von Schlüs - selarten können zu dem Problem führen, dass sich weder natürliche Dynamik noch natürliche Ökosysteme entwickeln. Nicht jeder Prozess in einem (und sei es in der Vergangenheit) anthropogen veränderten Ökosystem ist natürlich und damit positiv zu bewerten. Dies kann zu Konflikten zwischen dem Erhalt eines definierten Ökosystems und der anthropogen veränderten Dynamik führen. Für SCHERZINGER (1997) ist die Qualität von Prozessen (im Sinne der Naturnähe) abhängig von Störungsregime der Artenausstattung dem standörtlichen Entwicklungspotential eines Ökosystems. Somit kann der Konflikt zwischen dem Schutz dynamischer Vorgänge und dem Erhalt eines Ökosystems mit seinen charakteristischen Arten häufig nur nach vorher veränderten Ausgangsbedingungen entschärft werden. Nationalparke sollten erst auf ganzer Fläche dem Prozessschutz überlassen werden, wenn ihr Artensatz standortheimisch ist oder eine selbständige Entwicklung zu diesem stattfindet. Dies sollte in erster Linie die lebensraumprägenden Schlüsselarten wie Phanerophyten und Ungulaten betreffen, die den Lebensraum und sein Prozessgeschehen prägen. Da die notwendigen Eingriffe streng genommen vor einer Ausweisung durchzuführen wären, sollten Zielnationalparke der Umbauphase klare Grenzen setzen und sie befristen. Falls allochthone Organismen nicht entfernbar sind oder ihr Einfluss auf ein zu schützendes Ökosystem erwiesenermaßen nicht nachhaltig ist kann von einer Entfernung abgesehen werden. Der Einfluss der Fauna auf die Vegetation wird in deutschen Nationalparken unterschiedlich bewertet. Während Borkenkäfergradationen im Nationalpark Bayerischer Wald im Sinne des Prozessschutzes geduldet werden, unterliegen die Ungulaten einem Management. Letzteres wird im Allgemeinen mit dem Fehlen großer Karnivoren gerechtfertigt, wie bereits unter 1.3 erläutert wurde. Laut REIMOSER (2004) können dem Verhältnis von Vegetation und Ungulaten in Schutzgebieten drei Leitbilder zu Grunde liegen. Bei Ausrichtung auf ungestörte Vegetationsentwicklung ist eine Beeinflussung durch Ungulaten unerwünscht, da sie als nicht natürlichen Bedingungen entsprechend gilt. Die gegenteilige Position sieht Verbiss per se als natürlichen Prozess, bei dem sich ein Eingriff im Sinne des Prozessschutzes verbietet. Im westlichen Mitteleuropa unterliegt der Schweizerische Nationalpark diesem Leitbild, wenngleich auch hier die außerhalb des Nationalparkgebietes befindlichen Wintereinstände bejagt werden (WOTSCHIKOWSKY 1978). Der unter 2.5.1 streng gefassten Wildnisdefinition kann nur dieses Leitbild nahe kommen. Von der Verwaltung des Nationalpark Kellerwald - Edersee wird die dritte von Reimoser benannte Zielrichtung angestrebt, der zu Folge eine Balance zwischen ungestörter Vegetationsentwicklung und Beeinflussung durch Herbivorie angestrebt wird, die jeweils auf unterschiedlichen Teilflächen vorliegen können. Dabei wird zwar Wert auf den Erhalt anhand von Pflanzenarten definierter Standortvielfalt gelegt, der Einfluss der Ungulaten darf allerdings so weit gehen, dass das „volle Standortpotential“ im Sinne einer PNV nicht überall entwickelt wird (KOMMALLEIN 2006, mündliche Mitteilung). Bei Durchführung von Wildmanagement kann von zwar von Prozessschutz gesprochen werden, der hohe Anspruch des wertungsfreien ablaufen Lassens aller sich einstellenden Prozesse wird jedoch nicht erfüllt. Wildnis im Sinne von 2.5.1 oder segregativer Prozessschutz liegen somit nicht vor, sind aber für den Schutz oben angeführter Güter unter mitteleuropäischen Be- dingungen nicht geeignet. Selbst unter den Voraussetzungen der Megaherbivorentheorie kann der Einfluss eines extrem großen zwischeneiszeitlichen Artensets nicht einfach mit Akzeptanz hoher Dichten der spärlichen Restfauna gleichgesetzt werden. Dies wird verschärft durch den Mangel an Kenntnissen über Habitatpräferenzen und Vor kommensdichte der einzelnen Herbivorenarten sowie durch den Mangel an großen Prädatoren und großflächigen Raumzusammenhängen.