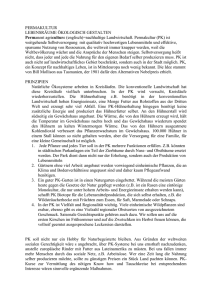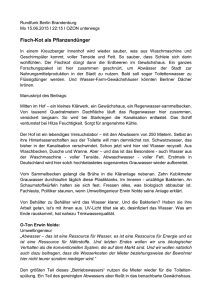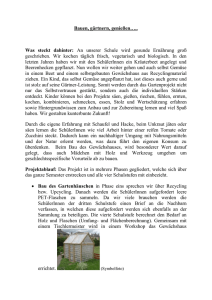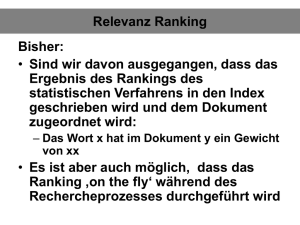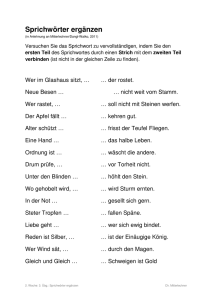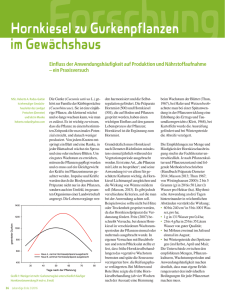Sonderprojekt Theater im öffentlichen Raum
Werbung

Sonderprojekt Theater im öffentlichen Raum Fonds Darstellende Künste Projekt: ID-clash (UA 10.10.2013) Angie Hiesl + Roland Kaiser aktiv Beteiligte: 5 Performerinnen; Stab: 16 Personen Ort: Köln, Poll Zuschauer: ca. 90 (kein Eintritt) Länge der Uraufführung: 110 Min. Besprechung der Uraufführung von Dr. Matthias Däumer I Beschreibung Der bespielte Parcours in einer am Stadtrand von Köln gelegenen Gärtnerei besteht aus drei Gebäuden, deren Inneres im Laufe der Performance unterteilt und semantisiert wird: ein großes, gemauertes Gewächshaus, ein kleines Glashaus und ein Treibhaus, mit fester Schiebetür und seitlichen Planen. Die Spielorte stehen rechtwinklig zueinander mit dem kleinen, ca. 2x3 m großen Glashaus im Schnittpunkt. Die Performance beginnt im vorderen Teil des Gewächshauses. Die fünf Performerinnen – zugleich „Expertinnen des Alltags“ – bepflanzen auf Regalwagen stehende Blumentöpfe mit Schildern. Auf jedem steht eine Bezeichnung für abweichende Geschlechtsidentitäten, Leitbegriffe der Gender-Studies, Rufnahmen der queer-Kultur, allgemeine Ausdrücke der Unsicherheit, Symbole und Schriftzüge in Bengali. Jeder der kleinen Blumentöpfe wird zusätzlich mit einem bunten Bonbon bepflanzt: ›Nimm Dir ein Bonbon – nimm Dir eine Festschreibung‹, scheint die Installation zu sagen, ›Beide sind süß – und keines davon natürlich‹. Nachdem die Blumentöpfe bepflanzt sind, gehen die fünf Performerinnen zu ihren jeweiligen Spiel-Orten, zwischen denen das Publikum sich frei bewegen und selbstständig entscheiden kann, wo und wann es in die laufenden Performances ein- und wieder aussteigt. (Auch ich bin zwischen den drei Spielorten hin und her gesprungen, sodass die folgenden Darstellungen nicht vollständig sein können). Im Gewächshaus bleiben Annonya und Katha. Sie sind beide Hijra, Vertreterinnen und Aktivistinnen des ›Dritten Geschlechts‹ in Bangladesch, und ausgebildete Tänzerinnen. Sie beginnen damit die Hirja-Kultur von ihrer rituell bunten Seite zu präsentieren. Flankiert von zwei Leinwänden, auf denen Filmsequenzen ihres Alltags sowie vom städtischen und dörflichen Straßenleben, aber auch Momente familiärer Religiosität ablaufen, errichten sie aus silbernen, vasenartigen Gefäßen, bunten Geschenkpackungen und mit Blumenerde ausgelegten bengalischen Schriftzügen einen rituellen Raum. Dort kleiden sie sich in traditionelle Gewänder, sprechen und singen in Mikrophone und verbildlichen so die traditionelle Aufgabe des Dritten Geschlechts, auf Hochzeiten, Hauseinweihungen oder zu Geburten von Söhnen die Familien zu segnen. Die Vorgänge haben schon während ihres Ablaufs etwas Zweischneidiges; Die Performerinnen wirken ironisch distanziert und irgendwann 1 passiert, was passieren muss, wenn man die Hijra nicht idealisiert, sondern realistisch porträtiert: Der bengalische Bilderbogen bricht. Die Performerinnen bewegen sich klatschend auf das Publikum zu. »Hey, hey, hey, we’re Hijra. We’re poor give us some money«. Sie verlassen den rituellen Raum. In einem monoton grün bepflanzen Teil des Gewächshauses stellt Annonya Hämmer umgekehrt auf und überzieht die Stiele mit Kondomen. Die bunten bengalischen Kondomverpackungen pflanzt sie zwischen die grüne Monokultur. Armut und Zwang zur Prostitution: die dunkle Seite des sonst so bunten Dritten Geschlechts, das in der modernen sekularisierten bengalischen Kultur kein anderes Einkommen mehr finden kann. Annonya wird bei der Hammerverhütung von Katha unterwiesen, die (so berichtet es die Biographie der Performerinnen im Programmheft) in Bangladesch auch als Aktivistin und Beraterin von Sexarbeiterinnen tätig ist. Zum Abschluss ihrer facettenreichen Darbietungen und Erzählungen begeben sich die beiden Tänzerinnen in ein Zelt vor dem Gewächshaus, in dem sie bis zum Ende der Veranstaltung auf Gaskochern Essen zubereiten und verspeisen: Ein Arbeitstag zwischen Gesprächen, Fest, Almosen, Aufklärung und bezahltem Sex findet seinen ärmlichen Feierabend. In der zweiten Station, dem kleinen Glashaus, steht ein rotes Sofa. Die aus Kuba stammende Melissa Marie Garcia Noriega erzählt dort ihre Lebensgeschichte – teils face to face oder auch gedankenversunken: eine unbeschwerte Jugend, in der es niemanden störte, dass der Junge sich mädchenhaft benahm; dann eine Vergewaltigung, das Bewusstsein, dass das Mädchen in ihr missbraucht wurde; mangelnde familiäre Akzeptanz des femininen Auftretens in der Pubertät, groteske Zwänge, kubanischer Macho zu werden, dann der Ausbruch. Ein Kunststudium, Psychotherapie, Geburt eines Sohnes, Möglichkeiten der neuen Selbstbestimmung im Zusammenleben mit einem Mann und schließlich ihre Geschlechtsumwandlung zur Frau, als welche sie noch mit demselben Partner zusammenlebt. Der Tänzerin und Choreographin gelingt es bei all diesen Erzählungen, die beim Publikum entweder Betroffenheit oder, schlimmer noch, das Gefühl psychotherapeutischer Autorität hätten aufkommen lassen können, stets die Dominanz zu behalten. Die rote Couch ist kein freudianischer Ort der Selbstentblößung, sondern ihr Spielraum, in dem sie sich durch Trübsinnigkeit, Aggression, ironische Posen, Echauffierung und herzerfrischende Direktheit bewegt. Die Sympathie, die sie damit erregt, die Selbstsicherheit, die sie ausstrahlt, macht das Publikum selbst zu ihrem Freund – und wären da nicht noch die anderen Orte, man würde ihr noch viel länger zuhören wollen. Melissas Erzählung pendelt zwischen ihren Erfahrungen in Kuba und in Deutschland, sodass das Glashaus als interkulturelle Schnittstelle dient, welche funktional die bengalischen Vorgänge im Gewächshaus mit denen im gegenüberliegenden Treibhaus verbindet. Diese sind eher den Gender-Neuverortungen im westlichen Kulturkreis gewidmet. Anfangs ist die Schiebetür des Treibhauses offen und man sieht, dass im vorderen Teil Erdbahnen aufgeschüttet sind, über denen an Bügeln Jackets hängen. Perspektivisch verlängert sich das maskulin konnotierte ›Spargelfeld‹ auf eine Monokultur von Stiefmütterchen hin. Die studierte Mathematikerin und Physikerin Michelle Niwicho beginnt damit, die Schiebetüren mit Eckdaten ihres Lebens2 laufs zu beschriften. Dann schließt sie die Tür von innen und es braucht eine Weile, bis das Publikum entdeckt, dass es nicht ausgeschlossen ist, sondern diesen Innenraum durch die seitlich aufgerollten Planen beobachten kann. Anfangs fühlt man sich durch diesen Vorgang in die voyeuristische Position gedrängt, doch die Vorgänge im Innern verdeutlichen schnell, dass das Gegenteil der Fall ist. Es bedarf dieses Innenraums, oder vielmehr: dieses Innenlebens, damit aus ihm heraus gesendet werden kann. Michelle baut ihren Arbeitsplatz auf: Schreibtisch, Laptop, Mouse. Hier schreibt sie (wie auch im wirklichen Leben) einen Blog, der sowohl auf dem Bildschirm, wie auf einer an der Innenseite der Schiebetür aufgezogenen Leinwand mitzulesen ist. Der Text handelt von dem Entschluss, als Transfrau zu leben, von den Problemen, die dadurch entstehen, dass man zum Zeitpunkt des späten Outings dreifacher Vater ist, von bürokratischen Schwierigkeiten, in Deutschland als Drittes Geschlecht anerkannt zu werden; aber auch von der Akzeptanz in der eigenen Familie, dem Managen der Karriere, steigender Selbstbehauptung und wunderbar grotesken Momenten im Alltag. Dadurch, dass man Michelles Schreibvorgang mitverfolgt, ihr Verbessern von Fehlern, dem Suchen nach der treffenden Formulierung, stellt sich eine ähnliche Nähe zur Lebenserzählung her wie bei Melissa im Glashaus. Zwischen dem Schreiben steht Michelle auf und trennt mit einer Zange die Befestigung der Jackets durch, sodass diese zu Boden fallen. Für jede Entfernung einer männlichen Kleidungstücks zieht sie an einem Schnursystem und weibliche Kleider wachsen aus den Spargelbahnen... wie die aus Drachenzähnen sprießenden Sparten aus den Ackerfurchen: die antiken Kämpfer Thebens – der moderne Kampf der Transfrau. Im hinteren gelb blühenden Stiefmütterchenfeld, das zusätzlich mit Stöckelschuhen besät wurde, legt die brasilianische Performerin Greta Pimenta ihre weibliche Kleidung ab und hängt sie, ähnlich wie die Jackets im vorderen Teil, an Bügel. Nackt duscht sie während beinahe der gesamten Performance und präsentiert ihren weiblichen Körper mit männlichem Genital. Dabei bleibt sie über den gesamten Verlauf stumm. Wie immer, wenn ein Publikum mit Nacktheit konfrontiert ist, kommt es zu Irritationen und die Mischung der sexuellen Marker verstärkt dies sicherlich. Doch dadurch, dass die Performerin über eine Stunde lang nackt bleibt, in der sie nie den Anschein erweckt, sich beobachtet oder geniert zu fühlen, wird ihr zweigeschlechtlicher Körper in der Wahrnehmung zur Normalität: Er gehört dazu – zur Performance wie zur Utopie einer freien Gesellschaft. Im Gesamten wirken die beiden Bereiche des Treibhauses wie die Vereinigung zweier Aspekte der Transgeschlechtlichkeit: Michelles intellektueller Zugang, der auch den Selbstzweifel nicht scheut, und Gretas unhinterfragbare Selbstsicherheit: Zwei Zustände eines Innenlebens, Intellekt und Körper, die sich dem seitlich hineinlukendem Publikum mit einer Freigiebigkeit präsentieren, die den ausbeuterischen Habitus des Voyeurismus erst gar nicht ermöglicht. 3 II Relation zum Antrag und zur Unort-Theorie In der Antragstellung war die Anlehnung an den Unort recht metaphorisch: Der Körper ein Ort, die geschlechtliche Unsicherheit als Verunortung. Bei einem engen theoretischen Konzept musste das problematisch erscheinen. Doch die Inszenierung schafft es, alle metaphorischen Unsicherheiten am Ort überzeugend zu konkretisieren. Auf einer ersten Ebene funktioniert dies über die kulturelle Semantisierung der Bauwerke: das ›Andere‹ der bengalischen Hijra im Gewächshaus, im Glashaus die verbindende Interkulturalität und die ›eigene‹ Kultur im Treibhaus, all dies logisch verbunden auf einem Parcours auf dem das Publikum nach Belieben wandern kann. Der Spielort wird so Repräsentant eines größeren Kursus oder (nach Foucault), zur Heterotopie, die Gegensätzliches und Entferntes im Kleinen zusammenführt. Eine andere Lesart erschließt sich über die Biographien der Performerinnen, welche die inhaltlichen Grundlagen der Inszenierung sind. Diese verbieten in ihren Individualitäten jegliche kulturelle Pauschalisierung. Über allem liegt ein je individuelles Wandeln zwischen den Körperkonzepten, von der mythisch konnotierten, doch sozial ausgegrenzten Drittgeschlechtlichkeit, über Hormonbehandlung und den Wechsel zum gefühlt richtigen Geschlecht und die Reflektion des Körperwandels im Text, bis hin zur selbstbewussten Präsentation beider Geschlechter an einem Körper. All dies präsentiert sich dem Publikum nicht schrill, sondern leise, feinfühlend, humorvoll, nachdenklich und visuell sehr reich. Und damit erweist sich die Transsexualität als ›natürlicher‹ als die dominierende Heteronormativität und sexuelle Binarität unserer Gesellschaft. Interkultureller und transgeschlechtlicher Diskurs werden solcherart am Ort in vielen Verschiebungen erlebbar und dieses Erleben macht klar, dass auch das Reden vom Dritten Geschlecht noch nicht genügt, der Vielseitigkeit des Geschlechtlichen sozial gerecht zu werden. Bei dieser Kombination von Interkulturalität und Transsexualität ist der Ort selbst, die Stadtgärtnerei, in all seiner Signifikanz mit eingebunden: das Gewächshaus als Inbegriff unseres ›Zuchtwillens‹, der künstlichen und autoritären Zwangshandlung, krampfhaft Normativität herzustellen: ein Unort im pejorativen, entindividualisierenden und verfremdenden Sinn (Augé); die Monokulturen als Bilder einer Gesellschaft, die mit ihrem Anpassungszwang eine feindliche Tristesse um die non-konformen Körper wickelt. Dass diese Körper dann aber in den Augen des Publikums natürlicher wirken, als die zwanghafte ›Spargel vs. Stiefmütterchen‹-Ordnung, ist der Wahrnehmungseffekt, der große Nachhaltigkeit erzeugt. Zugegeben: Diese Nachhaltigkeit ist nicht (wie in der Ausschreibung vorgesehen) auf den Ort bezogen. Doch wer will schon eine Stadtgärtnerei verändern, wo es die individuelle Freiheit zu retten gilt? Ebenso weist die Inszenierung geschickt über die Gärtnerei hinaus, steht diese doch im Schatten des phallusartigen Hochhauses der TÜV-Prüfstelle Köln-Porz: Diese ist nicht nur generell ein Ort der Normierung, sondern war auch ganz konkret die Geburtsstätte der DIN-Normen von Brustimplantaten – eine Wiege des normalisierten Geschlechtsmerkmals, der das bunte Treiben von ID-Clash das Bild vielseitiger Selbstbestimmung entgegensetzt. Nimmt man noch die Tristesse des angrenzenden Dietzer Friedhofs (inklusive monotoner Gräberreihen) oder gar die in der Nähe befindlichen Schrebergärten mit ihrem Gepränge von 4 Gartenzwergen (inklusive steil aufgerichteter Zipfelmützen) hinzu, steht fest: Einen besseren Standort kann man sich für diese Performance kaum vorstellen. Am 1. November 2013 übrigens wird das ›Dritte Geschlecht‹ auch in Deutschland endlich formaljuridisch anerkannt: Hiesls und Kaisers Performance, die 2015 nochmals in Dresden aufgeführt wird, ist wie eine Feier dieses Ereignisses. Oder besser noch: ein begleitendes Ritual, das den entindividualisierenden Ort der Monokultur und Geschlechts-Norm zusammen mit dem raumerschließenden Publikum (Partizipation) wandelt – zum (vorerst noch) utopischen Lebensraum interkultureller und transgeschlechtlicher Freiheit. 5