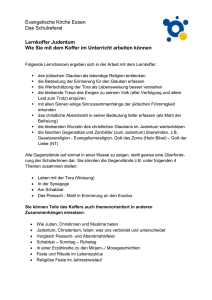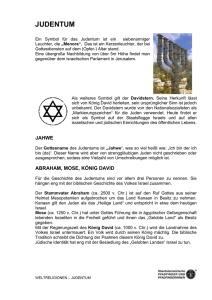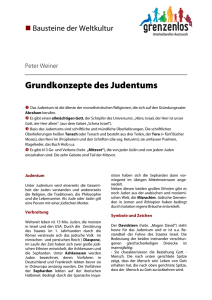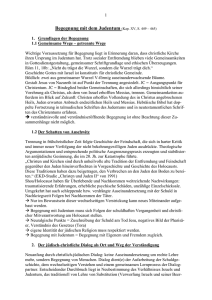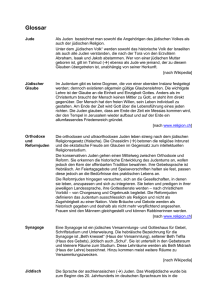Grundkurs Judentum
Werbung
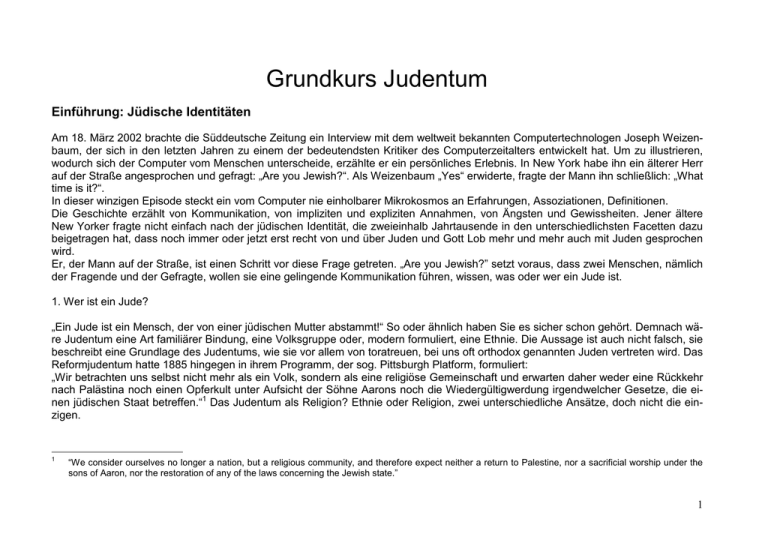
Grundkurs Judentum
Einführung: Jüdische Identitäten
Am 18. März 2002 brachte die Süddeutsche Zeitung ein Interview mit dem weltweit bekannten Computertechnologen Joseph Weizenbaum, der sich in den letzten Jahren zu einem der bedeutendsten Kritiker des Computerzeitalters entwickelt hat. Um zu illustrieren,
wodurch sich der Computer vom Menschen unterscheide, erzählte er ein persönliches Erlebnis. In New York habe ihn ein älterer Herr
auf der Straße angesprochen und gefragt: „Are you Jewish?“. Als Weizenbaum „Yes“ erwiderte, fragte der Mann ihn schließlich: „What
time is it?“.
In dieser winzigen Episode steckt ein vom Computer nie einholbarer Mikrokosmos an Erfahrungen, Assoziationen, Definitionen.
Die Geschichte erzählt von Kommunikation, von impliziten und expliziten Annahmen, von Ängsten und Gewissheiten. Jener ältere
New Yorker fragte nicht einfach nach der jüdischen Identität, die zweieinhalb Jahrtausende in den unterschiedlichsten Facetten dazu
beigetragen hat, dass noch immer oder jetzt erst recht von und über Juden und Gott Lob mehr und mehr auch mit Juden gesprochen
wird.
Er, der Mann auf der Straße, ist einen Schritt vor diese Frage getreten. „Are you Jewish?” setzt voraus, dass zwei Menschen, nämlich
der Fragende und der Gefragte, wollen sie eine gelingende Kommunikation führen, wissen, was oder wer ein Jude ist.
1. Wer ist ein Jude?
„Ein Jude ist ein Mensch, der von einer jüdischen Mutter abstammt!“ So oder ähnlich haben Sie es sicher schon gehört. Demnach wäre Judentum eine Art familiärer Bindung, eine Volksgruppe oder, modern formuliert, eine Ethnie. Die Aussage ist auch nicht falsch, sie
beschreibt eine Grundlage des Judentums, wie sie vor allem von toratreuen, bei uns oft orthodox genannten Juden vertreten wird. Das
Reformjudentum hatte 1885 hingegen in ihrem Programm, der sog. Pittsburgh Platform, formuliert:
„Wir betrachten uns selbst nicht mehr als ein Volk, sondern als eine religiöse Gemeinschaft und erwarten daher weder eine Rückkehr
nach Palästina noch einen Opferkult unter Aufsicht der Söhne Aarons noch die Wiedergültigwerdung irgendwelcher Gesetze, die einen jüdischen Staat betreffen.“1 Das Judentum als Religion? Ethnie oder Religion, zwei unterschiedliche Ansätze, doch nicht die einzigen.
1
“We consider ourselves no longer a nation, but a religious community, and therefore expect neither a return to Palestine, nor a sacrificial worship under the
sons of Aaron, nor the restoration of any of the laws concerning the Jewish state.”
1
Mit „What is a Jew?” oder „Who is a Jew?“ werden wir in den letzten Jahrzehnten auf dem Büchermarkt und im Internet überschwemmt. Der Staatsgründer Israels, Ben Gurion, schrieb 1949 40 jüdische Intellektuelle an, ihm die Frage zu beantworten, wie sich
jüdische Identität bestimmen lasse. Einer der Angeschriebenen war André Neher (1914-1988), von dem ein wichtiges Buch zur jüdischen Identität stammt2. Er schrieb dazu 1978: „Alle unsere zusammengetragene Weisheit hat es Ben Gurion nicht ermöglicht, klar zu
sehen. Der Widerspruch liegt im Wesen der jüdischen Identität. Und dies darum, weil es keine Antwort gibt auf die Frage: `Wer ist Jude?´ Diese Frage bleibt immer eine Frage, weil sie einen Teil in sich schließt, der für immer sie transzendiert.“3
Als der israelische Schriftsteller Amos Oz Christine Dössel im September 1999 ein Interview in der Süddeutschen Zeitung gab, zitierte
er Ben Gurion: „Jeder, der sich selbst Jude nennt, ist ein Jude – so einfach ist das. Es ist ein freies Spiel der Interpretation mittels
ständiger Diskussion.“
Die Aussage lässt keine Definition zu. Sie wehrt jeden Versuch ab, das Judentum als eine ethnische Gruppe oder als Religion zu verstehen, als Nation oder Ideologie. Damit könnte nun freilich dieser Abschnitt bereits enden. Eine Definition dessen, was und wer jüdisch ist, obliegt jeder einzelnen Jüdin und jedem einzelnen Juden. „Are you Jewish“ lässt dem Angesprochenen die Wahl, selbst zu
entscheiden, ob er sich Jude nennt oder nicht. Und vielleicht wird es nur eine Momententscheidung sein, wahrscheinlicher aber Ergebnis einer Überlegung, die auf Geschichte zurückblickt.
Und damit wird die Sache wieder viel komplizierter, weshalb es sich doch lohnt, ein wenig näher zuzusehen, was Identität, vor allem
kulturelle Identität eigentlich meint. Ich will dies in wenigen kurzen Absätzen beschreiben:
2. Kulturelle Identität
2.1. Kulturelle Identität ist prozesshaft und niemals abgeschlossen
Im Anschluss an den Jamaikaner Stuart Hall kann man kulturelle Identität als niemals abgeschlossenen Prozess bezeichnen. Sie
unterliegt einem beständigen Wandel, als „subject to the continuous play of history, culture, and power.“4
Laurence Silberstein betont in seinem hervorragenden Essay „Others Within and Others Without”5 die Bedeutung von „power,
struggle, and conflict”, also Macht, Streit und Konflikt als zentrale Elemente für die Bestimmung von Identität. Der Prozess der Definition des Selbst findet daher nicht im luftleeren Raum statt, sondern in der Auseinandersetzung mit dem Anderen. Identitätsfindung ist
Ein- und Ausschließen, beständiges Rekonstruieren des Selbst und des Anderen.
2
3
4
5
2
A. Neher, Jüdische Identität. Einführung in den Judaismus. Aus dem Französischen von Holger Fock, Hamburg 1995 (Original Paris 1989).
A. Neher, Le dur bonheur, d´être juif, Paris 1978, 215.
Stuart Hall, Cultural Identity and Diaspora, in: J. Rutherford (Ed.), Identity, Community, and Cultural Difference, London 1990, 223.
Laurcence J. Silberstein, Others Within and Without, in: L. J. Silberstein/R. L. Cohn (Hgg.), The Other in Jewish Thought and History. Constructions of Jewish
Culture and Identity, (New Perspectives on Jewish Studies), New York 1994, 1-34.
Für eine kollektive Gruppe wie das Judentum heißt dies mit Sicherheit, dass wir keine lineare, eindimensionale Entwicklung und keine
abgeschlossene Identitätsfindung annehmen dürfen. Über die Jahrhunderte hinweg ist Identitätsfindung im Fluss, wandelt sich, verzweigt sich. Es ist daher besser, von jüdischen Identitäten im Plural zu sprechen, und zwar sowohl in diachroner als auch synchroner
Hinsicht. Oder anders formuliert: Es entstehen nacheinander verschiedene Formen jüdischer Identitäten wie auch gleichzeitig unterschiedliche jüdische Identitäten nebeneinander existieren. Um diese Identitäten zusammenzuhalten braucht es das Gefühl des „Wir“,
die wie immer definierte oder auch subjektive Abgrenzung von den Nichtjuden, den „Anderen“. So betrachtet muss man die Frage des
New Yorkers an Joseph Weizenbaum folgendermaßen wiedergeben: „Sind Sie einer von uns oder sind Sie ein Anderer?“
2.2. Kulturelle Identität basiert auf der Beziehung zum Anderen und auf der Abgrenzung vom Anderen.
Der Andere ist das Medium, durch das wir uns beständig selbst definieren. Identitätsfindung findet in einem Spannungsfeld von Koexistenz und Integration und andererseits Abgrenzung bis hin zum Feindbild statt.
Mit dieser Begegnung sind auch Ängste vor dem Fremden verbunden, die sich auf zweifache Weise im Alltag auswirken. Einmal versucht man den andern bis zur Selbstaufgabe zur Integration zu zwingen, ihn also dem „Wir“ anzugleichen. Zum anderen grenzt man
das Fremde aus und versieht es mit Feindbildern und Vorurteilen.
Diese Beobachtungen sind hier festzuhalten und mehrfach wieder aufzunehmen. Auch das Judentum sieht sich beständig anderen
kulturellen Identitäten gegenüber und formt seine eigenen nicht zuletzt aus diesen Begegnungen. Ein wichtiges Element ist zuletzt
genannt worden: Abgrenzung. Die Abgrenzung gehört unabdingbar zur Definition des „Wir“ hinzu. Frederic Barth hat dies in Bezug auf
ethnische Gemeinschaften so beschrieben:
„Die Art der Kontinuität ethnischer Einheiten ist klar: Sie hängt von der Aufrechterhaltung einer Grenze ab. Die kulturellen Merkmale, welche die Grenze kennzeichnen, können wechseln, und die kulturellen Charakteristika der Mitglieder können ebenso transformiert werden, ja sogar die organisatorische Form der
Gruppe kann sich ändern - aber gerade das Faktum fortdauernder Trennung zwischen Mitgliedern und Außenstehenden ermöglicht uns, die Beschaffenheit der
6
Kontinuität zu bestimmen und die wechselnden kulturellen Formen und Inhalte zu erforschen.“
Nach Barth macht somit die Grenze die Gruppe. Es bleibt zu fragen, wieweit eine Gruppe sich über Jahrhunderte nur durch den Umstand halten kann, dass sie sich von anderen abgrenzt. Genügt es, überspitzt formuliert, zu sagen: „Ich weiß zwar nicht, wer `ich´ bin,
aber ich weiß, dass ich anders, dass ich nicht `sie´ bin?“
Die von Barth erwähnten Veränderungen, Brüche, Umwälzungen, Neuerungen gehören zweifellos zur Erfahrung von Gruppenidentität, auch zu jüdischer, aber sie sind begleitet von Kontinuitäten und kulturellen Eigenschaften wie Sitten, Werten, Gewohnheiten und
ähnlichem. Diesen Kontinuitäten werden wir auch im Judentum nachzuspüren haben.
6
Frederic Barth (Hg.), Ethnic Groups and Boundaries: The Organization of Cultural Difference, Bergen: Universitets Forlaget, 1969, 14.
3
Macht allein die Grenze die Gruppe, wie man Barth verstehen könnte oder ist es nicht auch und vielmehr umgekehrt? Macht nicht die
Gruppe Grenzen?
So ist Barth einerseits Recht zu geben und zu betonen, dass es ein „Wir“ nicht ohne das „Sie“ geben kann, andererseits müssen wir
nach einer erweiterten Definition von Identität suchen, in der auch die inhaltlichen Elemente, die kulturelle Basis, zu Wort kommt.
2.3. Eine inhaltliche Bestimmung von Identität
Anders als Barth definiert Anthony D. Smith:
„Eine ethnische Gruppe ist durch vier Merkmale gekennzeichnet: das Gefühl eines einzigartigen Ursprungs der Gruppe, die Kenntnis einer einzigartigen Geschichte der Gruppe und der Glaube an ihr Schicksal, eine oder mehrere Dimensionen kollektiver kultureller Eigenheit, und schließlich das Gefühl einer einzigartigen kulturellen Solidarität. Kurz: Wir können die »Ethnie« oder die ethnische Gemeinschaft als eine soziale Gruppe definieren, deren Mitglieder das Gefühl eines gemeinsamen Ursprungs teilen, eine gemeinsame und besondere Geschichte mit ihrer Bestimmung für sich in Anspruch nehmen, eine oder mehrere charakteristische Merkmale besitzen und das Bewusstsein einer kollektiven Besonderheit und Solidarität empfinden. Es ist der Mythos von einem gemeinsamen und
7
einmaligen Ursprung in Zeit und Raum, der grundlegend ist für das Selbstverständnis einer ethnischen Gemeinschaft.“
Smith zeigt hier vier Elemente auf, die er für unabdingbar hält, um von einer ethnischen kollektiven Gemeinschaft zu sprechen. Smith
kommt zu diesem Urteil aufgrund ausgiebiger Studien, die hier nicht nachgezeichnet werden können.
Dafür ist zunächst festzuhalten, dass alle vier Elemente keine empirischen Daten beinhalten, sondern sich im Bereich des kollektiven
Gedächtnisses abspielen. Die Begriffe „Gefühl“ und „Glaube“ drücken dies deutlich aus, aber auch die „Kenntnis“ der Geschichte
meint kein abstraktes Geschichtswissen, sondern verinnerlichte „Erinnerung“ in einem nichtempirischen Sinn.
Es spielt somit wenig Rolle, ob die Gruppe in der Tat einen gemeinsamen und einmaligen Ursprung vorweisen kann; wichtig ist vielmehr, dass die Mitglieder der Gemeinschaft fest daran glauben, dass die Gruppe sich auf einen einmaligen gemeinsamen Ursprung
zurückführt, der sich zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort zugetragen hat.
Für einen Grundkurs Judentum ist nun die Frage zu stellen, ob die sehr kompakten Thesen von Smith auf das Judentum angewendet
werden können.
In einem ersten Schritt beziehe ich mich auf die Anfänge des Judentums.
7
4
A.D. Smith, The Ethnic Revival, Cambridge 1981, 66.
I. Das Judentum in den Anfängen
In diesem ersten Kapitel des Grundkurses will ich in Anlehnung an das bisher Gesagte die Thesen von Shaye J. D. Cohen untermauern, die er in seinem wichtigen Buch „The Beginnings of Jewishness. Boundaries, Varieties, Uncertainties”8 äußert. Demnach sei das
Judentum in der Antike als Ethnie, als Volksgemeinschaft zu verstehen. Ich will dies in der Folge begründen.
1.Der Begriff „Jude(n)“
Sehr häufig wird unter dem Begriff Judentum auch die Geschichte Israels, wie sie im Tenach oder christlich gesprochen im Alten Testament gezeichnet ist, verstanden.
Sieht man genauer zu, so wird der hebräische Begriff für „Juden“, nämlich „(ha-)Jehudim“ bzw. das aram. „Jehudaje“ jedoch in den
biblischen Schriften erst in exilisch-nachexilischer Zeit verwendet und bezeichnet die ins Exil (586-538v.) geführten (Jeremia 52,28-30;
Daniel 2,25; 3,8.12; 5,13; 6,14; 13,4) und aus dem Exil zurückgekehrten Bewohner der Provinz Judäa, im Esterbuch die im persischen
Reich lebenden judäischen Abkömmlinge des Exils.
Genau genommen ist also von einem Judentum nicht vor dem babylonischen Exil zu sprechen.
2. Jude als Bezeichnung für „Judäer“
Vielmehr ist davon auszugehen, dass „Jude(n)“ in den Anfängen nichts anderes als die Bezeichnung für eine geografisch lokalisierbare ethnische Gruppe ist, eben die Judäer.
Genauer gesagt meint die Bibel einen bestimmten Teil dieser Judäer, nämlich
a) jene, die ins Exil geführt wurden. Es ist davon auszugehen, dass es sich dabei um eine Oberschicht und um nützliche Facharbeiter handelte, nicht um das gesamte Volk;
b) jene, die nach dem Edikt des persischen Königs Kyros die Erlaubnis erhielten, aus Babylonien in ihre Heimat zurückzukehren.
Wenn man weiters davon ausgeht, dass nur mehr die wenigsten Exilierten 538 am Leben sind, handelt es sich damit in der
Mehrzahl um die Zweite und Dritte Generation einer Elite aus Judäa.
Ein Teil dieser Gruppe bleibt in der Diaspora. Auf sie rekurriert das Buch Ester, auch wenn es selbst einige Zeit später entstanden ist.
Ein anderer Teil dieser Gruppe geht nach Judäa und verarbeitet ihre Wanderung in das Land als eine Form des von Gott initiierten
Exodus. Und sie bemüht sich nach Kräften, im Land, das sie nun gestaltet, Strukturen zu errichten, die eine eigenständige Identität
möglich machen.
8
Berkeley 1999.
5
Diese Gruppe erhält eine weitgehende Autonomie durch den persischen König. Gleichzeitig verpflichten sich die Judäer, dem König
gegenüber loyal zu sein.
Sie bauen den Tempel in Jerusalem als Zeichen der Gegenwart Gottes wieder auf, errichten später die Stadtmauer in Jerusalem und
lassen um das Jahr 398v. vermutlich öffentlich die Tora (= Pentateuch) als Zeichen der Anerkennung der judäischen autonomen Kultur promulgieren. Damit ist das Judentum im Prinzip zu seiner ersten umfassenden ausformulierten Identitätsfindung gekommen.
3. Die Endredaktion der Tora (= des Pentateuch) als Zeugnis der Identitätsdefinition der Gruppe
Auch wenn sich die Forscher diesbezüglich nicht völlig einig sind, so spricht doch sehr viel dafür, dass die Tora, die man in christlichen
Kreisen gerne auch als Pentateuch oder Fünf Bücher Mose bezeichnet, in ihrer Endredaktion um 400 v. nicht zuletzt auch das schriftliche Ergebnis dieser bahnbrechenden Übereinkunft widerspiegelt. In gewisser Weise kann man die Tora somit als die Gründungsurkunde des Judentums bezeichnen, zumindest aber als Zeugnis der Identitätsdefinition. Das persische Reich funktionierte nämlich
nicht als zentralistisch geführter Staat, sondern auf der Basis regionaler Gesetze und Einrichtungen, die von den Persern über die
sog. Reichsautorisation zum Reichsrecht erhoben wurden. Im biblischen Buch Esra findet sich in 7,12-26 in der offiziellen Reichssprache Aramäisch eine Replik auf dieses königliche Schreiben.
12 Artaxerxes, der König der Könige, wünscht dem Priester Esra, dem Schriftkundigen im Gesetz des Gottes des Himmels, alles Gute. 13 Das ist es, was ich
befehle: Jeder in meinem Reich, der zum Volk Israel oder seinen Priestern und Leviten gehört und gewillt ist, nach Jerusalem zu gehen, darf mit dir ziehen. 14
Denn du bist von dem König und seinen sieben Räten ausgesandt und sollst nach dem Gesetz deines Gottes, das in deiner Hand ist, untersuchen, wie es in
Juda und Jerusalem steht … 23 Alles, was der Gott des Himmels befiehlt, soll man mit frommem Eifer liefern für das Haus des Gottes des Himmels, damit nicht
ein Strafgericht das Reich des Königs und seiner Söhne trifft. 24 Auch wird euch folgendes bekannt gemacht: Niemand ist befugt, irgendeinem Priester, Leviten,
Sänger, Torwächter, Tempeldiener oder Arbeiter dieses Gotteshauses Steuern, Abgaben oder Zölle aufzuerlegen. 25 Du aber, Esra, bestelle Rechtskundige und
Richter nach dem weisen Gesetz deines Gottes, das in deiner Hand ist; sie sollen dem ganzen Volk im Gebiet jenseits des Stroms Recht sprechen, allen, die das
Gesetz deines Gottes kennen; wer es aber nicht kennt, den sollt ihr es lehren. 26 Doch über jeden, der das Gesetz deines Gottes und das Gesetz des Königs
nicht befolgt, halte man streng Gericht und verurteile ihn je nachdem zum Tod, zum Ausschluss (aus der Gemeinde), zu einer Geldstrafe oder zu Gefängnis!
Andererseits gibt es auch Vorbehalte gegenüber einer Redaktion des Pentateuch aus dem Verlangen der Reichsautorisation durch
die Perser. Kritiker sehen eher den innerjüdischen Vermittlungsprozess als Ansatz für die Sammlung und Redaktion der Tora. Mir
scheint ein Zusammenspiel beider Elemente wahrscheinlich. Einerseits suchte das Judentum sich in der Tora eine tragfähige Basis
und Identität zu schaffen, deren Absicht es war, möglichst viele Strömungen innerhalb des Judentums zu integrieren. Andererseits
gelang es, gegenüber Persien als selbstbewusste eigenständig agierende Ethnie mit funktionierender Gesetzgebung aufzutreten, die
es verdiente, eine autonome anerkannte Existenz zu führen.
Über die Tora ist viel geschrieben und ihre Entstehungsgeschichte sehr kontrovers nachgezeichnet worden. Es ist nicht Aufgabe eines
Grundkurses zum Judentum, auf diese Diskussion einzugehen. Vielmehr ist es mir daran gelegen, die These zu untermauern, dass es
6
mit Hilfe der Tora nach außen, aber vor allem gegenüber der eigenen Gruppe gelang, die von Smith angenommenen Kriterien der Identität einer ethnischen Gruppe zu erfüllen. Dies ist leicht nachzuzeichnen.
4. Die Thesen von Smith auf das frühe Judentum angewendet
4.1. Das Gefühl eines einzigartigen Ursprungs der Gruppe
In der Tora konnten die Judäer ihre eigene Ursprungsgeschichte auf faszinierende Weise nachzeichnen. Dazu mussten sie natürlich
nicht den gesamten Text neu schaffen, sondern konnten auf zahlreiche vorhandene Textsammlungen zurückgreifen. In der Endgestalt
aber wurde der Pentateuch auf die Identitätsfindung der Judäer zugeschnitten.
Schon die Weltschöpfung beschrieb man als ein Sieben-Tage Schema, das die Judäer in Babylonien entwickelten, mit einer sehr starken Betonung des Sabbat.
Der eine und einzige Gott ist sowohl Weltschöpfer als auch Herrscher über die ganze Welt und kontrolliert die gesamte Geschichte.
Die Geschichte des Volkes der Judäer wiederum ist eingebunden in die große Geschichte der Welt, wie sie in den ersten Kapiteln der
Genesis erzählt wird. Diese Universalgeschichte verästelt sich hin zu den großen Erzelterngestalten. Der große Ahnherr ist Abraham,
der aus Babylonien stammte, womit die judäischen Redaktoren ihre eigene „Herkunftsgeschichte“ als Abkömmlinge der Exilanten verpackten. Abrahams bedingungslos gehorsame Gottestreue machte ihn zum Vorbild für die Judäer als Aufbaugenerationen nach einem langen Exil in einem Land ohne besondere Reize und schlechten Bedingungen. Abrahams Herkunft markiert auch die Ursprungsgeschichte des Judentums als Geschichte der Galut. Von Abraham wird keine negative Erfahrung in Babylonien berichtet. Das
Beispiel der Estergeschichte zeigt, dass keineswegs alle Judäer Babylonien als Exil erlebten. Deshalb macht es Sinn, auch die Ursprungsgeschichte in der Galut nicht mit Exil oder Diaspora einseitig zu belegen. Der Ursprung des Volkes liegt nicht im Land Israel.
Darauf wird im Abschnitt „Land“ noch einmal zurückzukommen sein.
4.2. Die Kenntnis einer einzigartigen Geschichte der Gruppe und der Glaube an ihr Schicksal
Die einzigartige Geschichte der Gruppe setzt mit den Erzeltern ein, Abraham, Isaak, Jakob, nicht weniger aber auch mit den Stammmüttern Sara, Rebecka, Lea und Rahel sowie ihren Mägden Bilha und Silpa. Abraham und sein Sohn Isaak werden zum Sinnbild des
Volkes nach dem Exil, das allein aus dem Vertrauen auf Gottes Eingreifen lebt und diesem Gott bereit ist zu dienen. Das schildert
nicht zuletzt die so folgenreiche Erzählung in Gen 22, die Opferung Isaaks, hebr. Aqedat Jitzchaq oder Bindung Isaaks. Sie wird noch
des öfteren erwähnt werden.
7
Der Enkel des Abraham, Jakob, versinnbildlicht schließlich das gemeinsame Schicksal des Volkes unter einem neuen Namen, nämlich Israel. Jakob wird nach einem Kampf mit einem göttlichen Wesen in Gen 32 zu Israel (= der mit Gott kämpft/streitet) umbenannt.9
Jakob/Israel ist der Stammvater der 12 Stämme. 10 Stämme des Nordens werden im Zuge der Politik des 8. Jh. im assyrischen Großreich aufgehen und spielen in der Folgezeit keine nennenswerte Rolle mehr für das Selbstverständnis des Volkes. Im Rückblick übernimmt Judäa, indem es die Tora zu ihrer eigenen Ursprungsgeschichte macht, die Verantwortung für das gesamte Volk. Dies zeigt
sich beispielhaft in der Aufzählung „der Einwohner der Provinz Juda, der Verschleppten, die aus dem Exil heimgekehrt sind“ (Neh 7,6),
die am Ende der langen Liste als „Kinder Israels“ bezeichnet werden (V. 72).
Der Aufenthalt der Israeliten in Ägypten, der Exodus und der Durchzug durch die Wüste unter der Führung von Mose, Aaron und Miriam wird aus der Perspektive der Judäer als ferne Vergangenheit erinnert, die sich in der näheren Vergangenheit der Heimkehr aus
dem Exil bestätigt hat. Der Exodus endet jedoch im Pentateuch nicht im Land, das noch nicht betreten wird, sondern im großen Kumulationspunkt der Tora, die ihr auch den Namen gibt, nämlich der Gabe der lebensspendenden Weisung am Sinai. In ihr werden nun
die kulturellen Eigenarten des Volkes zusammengefasst und unter die Offenbarung des einen Gottes an Mose gestellt. Der größte Teil
des Stoffes von Exodus bis ins Deuteronomium befasst sich mit der Gabe und dem Inhalt dieser Weisung. Gottes Gegenwart ist nun
mitten in seinem Volk anwesend, in dem Bundeszelt. Aus der Sicht der Judäer ist der Sinai nicht zuletzt ein Abbild des Zion, des Tempelberges, in dem sich die göttliche Gegenwart niederlässt.
Von der Erfahrung weitgehender Autonomie im Perserreich ausgehend, konnte sich das Judentum frei entfalten. Ein Teil der Gruppe
wird im status quo die bereits universal wirksame Gottesherrschaft vermutet, ein anderer wahrscheinlich eine jenseits der Perserherrschaft anbrechende Gottesherrschaft vom Zion aus erwartet haben. Alle konnten in der Tora ihre Ansichten wieder finden und damit
ihre Identität begründen.
4.3. Eine oder mehrere Dimensionen kollektiver kultureller Eigenheit
Dieser Punkt ist ebenfalls maßgeblich in der Tora aufgenommen. Die kulturelle Eigenart des Volkes zeigt sich in seiner Bindung an die
Mosetora. Dieses Bewusstsein hat das Judentum bis in die Neuzeit geprägt. Die Tora macht es zu einer eigenständigen selbstbewussten Größe. Sie enthält die spezifischen Verhaltensweisen und Gebote, welche das Volk von anderen unterscheidet. Zentral ist
vor allem das Bekenntnis zu einem einzigen bildlosen Gott.
Nicht zuletzt daraus entwickelt sich auch der letzte wichtige Punkt.
4.4. Das Gefühl einer einzigartigen kulturellen Solidarität.
9
8
Die Herleitung von der Wurzel srh II (= herrschen) ist auch möglich. Allerdings hat sich in jüdischer Überzeugung die Verbindung mit der Wurzel srh I (= streiten) aufgrund der Geschichte Jakobs durchgesetzt.
Solidarität als Gruppenbindung ist bei allen Volksgruppen ein wichtiges Merkmal. Es speist sich aus gemeinsamer Geschichte und
Schicksal ebenso wie aus den kulturellen Eigenheiten. Diese Gruppensolidarität ist jedoch kein Hindernis, sich in einer anderen kulturellen Umgebung einzufügen und auch wohl zu fühlen. Der irische Polizist in New York ist genauso patriotischer Amerikaner wie er
wahrscheinlich den St. Patrick´s Day feiert. Die jüdische Erfahrung von Solidarität ist immer besonders herausgehoben worden. Sie
gilt auch für die Anfänge.
Die Solidarität mit der Gruppe hat auch die Abgrenzung von anderen zur Folge. Sie richtet sich gegen die von den Babyloniern einst
eingesetzte nichtjüdische Oberschicht ebenso wie gegen die Bevölkerung, die als Abkömmlinge jener Menschen in Judäa lebt, die
nicht ins Exil geführt wurden und nun verdächtig waren, sich mit der angesiedelten Bevölkerung vermischt zu haben.
Nichtjuden wurden prinzipiell aus der Gemeinschaft ausgeschlossen und der Kult auf strenge Einhaltung der aus der Tora erhobenen
Regelungen, besonders des Sabbat, verpflichtet. Die Gruppe bewahrte ihre Gemeinschaft auch durch ein Verbot der Mischehe. Die
Abgrenzung, die von Barth oben als wichtiges Kriterium ethnischer Gemeinschaften herausgestellt wurde, tritt hier in Kraft.
Solidarität zeigten auch die Judäer im Ausland, in der Diaspora, beispielsweise indem sie die für Männer jährlich vorgeschriebenen
Abgabe an den Tempel, den sog. halben Scheqel, entrichteten und sich damit als Teil des judäischen Gemeinwesens verstanden. Der
Tempel stellte die große Mitte dar, war sowohl Ausdruck der kulturell-religiösen Bindung als auch der politischen Eigenständigkeit.
Jerusalem übernahm die Vertretung aller Juden. Über die Bedeutung der Diaspora in dieser und späteren Zeiten wird ein eigenes Kapitel handeln.
Eine – allerdings sehr ambivalente - Bestätigung der Einheit des jüdischen Volkes findet sich auch bei nichtjüdischen Schriftstellern in der Antike, deren teilweise
antijüdischen Ausfälle nicht verschwiegen werden sollen. Um hier nur Beispiele zu nennen, behauptete Dio Cassius (Historia Romana 37.17.2 = Stern, Authors
406) im 3. Jh. von „den“ Juden, dass sie sich vom Rest der Menschheit in praktisch jedem Lebensbereich unterschieden. Diese Einheit wird a) positiv wie b) negativ zur Kenntnis genommen:
a) Bei Varro (Augustinus´ De Civitate Deo 4.31 = Stern, Authors 72a) ist vom positiven „Zeugnis des judäischen Volkes“ („gentem Iudaeam“) die Rede,
10
welche Gott bis heute bildlos verehrten. Das jüdische Volk hält zusammen, es erweist sich nach Cicero „quanta concordia“ (Pro Flacco 28.66 = Stern,
Authors 68). Bekannt ist die Ansicht des Tacitus, wonach die Juden sich gegenseitig helfen und stark zusammenhalten. Gleichzeitig meinte er,
b) dass die Juden gegenüber anderen nur Hass und Feindschaft („hostile odium“) empfänden (Historiae 5.5.1 = Stern, Authors 281).
Diese Aussagen zeigen, dass bereits in der Antike das Judentum als Einheit erfahren wurde, demgegenüber nicht selten feindselige Stimmung geschürt wurde.
Vorerst mag es hier genügen, die von Smith angeführten Elemente alle auch für das Judentum in seinen Anfängen deutlich festhalten
zu können.
Mit Recht kann daher das Judentum in seinen Ursprüngen als eine ethnische Größe bezeichnet werden, als ein Volk mit einer an der
Tora orientierten kulturellen Identität.
10
Was die Römer 170 Jahre auch getan hätten und leider nicht mehr tun, was sich auf den Gottesdienst negativ auswirke.
9
5. Judentum ist eine Ethnie auch in der nachpersischen Zeit
Die Definition des antiken Judentums als Ethnie ist vor allem gegenüber allen jenen vor allem christlichen Zuordnungen festzuhalten,
die das (antike) Judentum als eine Religion definieren wollen. Wolfgang Stegemann hat in seiner kritischen Analyse von Gerd Theißen
zu Recht auf diese häufige und problematische „christliche Konstruktion des antiken Judentums als Religion“11 verwiesen. Denn diese
Zuordnung übersieht, dass in der Antike Religion als separierbarer Lebensbereich gar nicht existiert. Was wir heute darunter verstehen, dafür kennen weder Griechen noch Hebräer ein eigenes Wort. Vielmehr ist das Gemeinte in die beiden wichtigsten Lebensbereiche, das Gemeinwesen und die Familie eingebettet.
Der griechische Historiker Herodot (Historien 8.144.2) hatte einst das Hellenentum (to hellenikon) durch folgende Aussagen umschreiben: gemeinsames „Blut“ und Sprache; gemeinsame Einrichtungen und Opfer für die Götter sowie gemeinsame Lebensweise. Dies
trifft nun weitestgehend auch für das antike Judentum zu.
Auch sie bilden eine „Ethnie“, ein Volk. Und sie war eine lange Zeit auf das Territorium Judäa konzentriert. Dies gilt für die persische
Zeit ebenso wie für die nach der Eroberung durch Alexander den Großen einsetzende Periode der ptolemäischen und später griechischen Herrschaft. Hier wird das Judentum vergleichbar dem „hellenikon“ zum „Ioudaismos“.
Wie Ägypter, Kappadozier, Thraker, Phrygier sind „Jehudim/Ioudaioi“ Mitglieder einer ethnisch abgrenzbaren und geografisch zuordenbaren Gemeinschaft, und zwar in Judäa oder in der Diaspora. Nicht jeder in Judäa lebende Mensch ist daher Judäer. Flavius Josephus unterscheidet deutlich zwischen Syrern, Griechen und Judäern, wenn er ethnische Konflikte innerhalb Judäas beschreibt (BJ
2.266f). Andererseits ist in vielen griechischen und römischen Texten von Judäern außerhalb Judäas die Rede.
Ergebnis:
Ioudaios, Iudaeus und Jehudi kennzeichnen also Judäer, nicht Juden in unserem Sinne. Judäer ist ein ethno-geografischer Begriff, ein
Mitglied einer an ein Heimatland gebundenen Gemeinschaft. Im Anfang konstituiert sich das Judentum als ethnische Gemeinschaft
auf der Basis des kulturellen Zusammenhangs der Tora. In Aufnahme und Bearbeitung der Geschichte und Tradition von Israel definiert es sich als „wahres Israel“. Dabei grenzt es sich nach außen ab und erhält eine breite Autonomie zugestanden, ohne Eigenstaatlichkeit zu besitzen.
6. Die seleukidische Ära: Ethnie und Bekenntnisgemeinschaft
11
10
Wolfgang Stegemann, Christentum als universalisiertes Judentum, Anfragen an G. Theißens „Theorie des Urchristentums“, KuI 2 (2001), 130-148, 141.
Shaye J. D. Cohen ortet schließlich einen Schwerpunktwechsel in der Zeit der hellenistischen Herrschaft. Während nämlich die persische und wohl auch noch (mit Einschränkungen) die ptolemäische Ära durch eine weitgehende Autonomie gezeichnet ist, wird unter
seleukidischer Machtausübung vor allem im 2. Jh. v. der Druck auf eine Änderung der Lebensweise und auf Angleichung mit dem
griechischen „Way of life“ stärker. Zur Zeit des Königs Antiochus IV., der von 175-163v. herrschte, soll nach Auffassung der Quellen
der Bücher der Makkabäer, die sich in der katholischen Bibel finden und von Protestanten als deuterokanonische Bücher bezeichnet
werden, die Situation eskaliert sein. 2 Makkabäer 6 schildert das Verhalten des Königs eindringlich:
6:1 Nicht lange darauf schickte der König einen alten Athener; der sollte die Juden zwingen, die Gesetze ihrer Väter aufzugeben und ihr Leben nicht mehr durch
Gottes Gesetze lenken zu lassen. 2 Auch sollte er den Tempel zu Jerusalem schänden und ihn Zeus, dem Herrscher des Olymp, weihen; ähnlich sollte er den
Tempel auf dem Berg Garizim nach Zeus, dem Hüter des Gastrechts, benennen, was der (gastfreundlichen) Art der Einwohner jenes Ortes entgegenkam. 3 Der
Ansturm der Bosheit war kaum zu ertragen und allen zuwider. 4 Denn die Heiden erfüllten das Heiligtum mit wüstem Treiben und mit Gelagen. Sie gaben sich mit
Dirnen ab und ließen sich in den heiligen Vorhöfen mit Frauen ein. Auch brachten sie vieles hinein, was nicht hineingehörte. 5 Auf den Brandopferaltar häuften
sie unerlaubte und vom Gesetz verbotene Dinge. 6 Man konnte weder den Sabbat halten noch die alten Feste begehen, ja, man durfte sich überhaupt nicht mehr
als Jude/Judäer bekennen. 7 Zu ihrer Erbitterung mussten die Einwohner sich jeden Monat am Geburtstag des Königs zum Opfermahl führen lassen, und am
Fest der Dionysien zwang man sie, zu Ehren des Dionysos mit Efeu bekränzt in der Prozession mitzugehen. 8 Auf Vorschlag der Einwohner von Ptolemaïs wurde in den benachbarten griechischen Städten ein Beschluss bekanntgegeben, sie sollten mit den Juden ebenso verfahren und Opfermahlzeiten veranstalten. 9
Wer sich aber nicht entschließen wolle, zur griechischen Lebensweise überzugehen, sei hinzurichten. Da konnte man nun das Elend sehen, das hereinbrach. 10
Man führte nämlich zwei Frauen vor, die ihre Kinder beschnitten hatten. Darauf hängte man ihnen die Säuglinge an die Brüste, führte sie öffentlich in der Stadt
umher und stürzte sie dann von der Mauer. 11 Andere waren in der Nähe zusammengekommen, um heimlich in Höhlen den Sabbat zu begehen. Sie wurden an
Philippus verraten, und da sie sich wegen der Würde des heiligen Tages scheuten, sich zu wehren, wurden sie alle zusammen verbrannt. 12 An dieser Stelle
möchte ich die Leser des Buches ermahnen, sich durch die schlimmen Ereignisse nicht entmutigen zu lassen. Sie mögen bedenken, daß die Strafen unser Volk
nicht vernichten, sondern erziehen sollen.
An dieser Stelle wird die Bedeutung der kulturellen Identität eindringlich beschrieben. Sie wird in den sog. „Gesetzen der Väter“, in den
Festen und vor allem im Zeichen der Beschneidung und im Sabbat sichtbar. In V. 6 ist davon die Rede, dass man sich nicht mehr als
„Ioudaios“ bekennen konnte. Cohen entscheidet sich hier für eine Übersetzung des griechischen Wortes mit „Jude“ anstatt „Judäer“.
Denn an dieser Stelle werde die Grundlage der kulturellen Identität zum entscheidenden Kriterium der Benennung. Judentum wird sozusagen zu einer Bekenntnisgemeinschaft, ohne dass die ethnische Identität damit verloren ginge.
Die Geschichte ist sehr drastisch erzählt und schildert ein unversöhnliches Gegenüber von hellenistischer und jüdischer Identität. Die
Realität war sicherlich komplexer. Dennoch kann nicht bestritten werden, dass es im Zuge der Hellenisierungspolitik zu einem erfolgreichen Aufbegehren vieler Juden unter den sog. Makkabäern gekommen ist, die in einen doch weitgehend unabhängigen Staat unter
den sog. Hasmonäern mündete, der erst durch die römische Herrschaft sein Ende fand.
7. Jüdische Identitäten in hellenistischer Zeit
11
Der biblische und deuterokanonische Befund erweckt den Eindruck, als habe das Judentum vor allem in Zeit der griechischen Herrschaft eine innere Spannung zwischen hellenistisch ausgerichteten und streng an den Überlieferungen der Väter orientierten Menschen aushalten müssen. Die dort geschilderten Vorgänge, die zum Aufstand der Makkabäer führten, sind durch die Brille einer stark
antihellenistisch eingestellten Gruppe gesehen.
Mit Sicherheit hat der Hellenisierungsprozess auch weit in die Bereiche des jüdischen Lebens hereingespielt und nicht wenige Juden
werden davon beeindruckt gewesen sein, ohne gleich ihr Judentum zu verleugnen. Biblische Bücher wie etwa Kohelet bezeugen eine
rege Auseinandersetzung mit hellenistischem Gedankengut. Genaue Grenzlinien sind schwer zu ziehen. Die hellenistische Ära wird in
der Forschung sehr unterschiedlich betrachtet. Mitunter neigt man heute dazu, das Seleukidenreich als polyglottes und multikulturelles, einzelnen regionalen Entwicklungen gegenüber recht tolerantes Gebilde zu beschreiben. Dabei muss aber beachtet werden, dass
gegenüber der persischen Autonomie die Bedeutung der kulturellen Werte, wie sie sich in der Tora niederschlugen, deutlich herabgemindert war. Anders als Persien strebte der Hellenismus eine Durchdringung der Strukturen an. Jerusalem erhielt den Status einer
Polis – inklusive Gymnasium, kultischen Festen und Spielen mit Opfern -, was zwar auch Teile der jüdischen Bevölkerung begrüßten,
traditionsorientierte Gruppen aber abschrecken musste, da sie nicht von den Prinzipien der Kultur des Judentums, sondern von
Grundlagen des nach Globalisierung strebenden Hellenismus getragen war. Auch wenn der Vergleich überzogen scheint, so ist doch
in gewisser Weise eine Parallele zu einer modernen globalisierten „amerikanisch-dominierten“ Kultur und einer autarken regionalen
Identität gegeben. Auch bei uns spannt sich der Bogen von Globalisierungsbefürwortern über vorsichtige Globalisierungskritiker bis
zu radikalen Globalisierungsgegnern. Und nicht jeder, der sich weigert, bei McDonalds zu essen, ist gleich ein Antiamerikaner. Und
nicht jeder, der gut englisch spricht, ist deshalb ein begeisterter Anhänger des amerikanischen Präsidenten.
So kann man aus dem Umstand, dass Juden gut griechisch sprachen, sich am gesellschaftlichen Leben der Polis beteiligten und wohl
auch Spiele und Festveranstaltungen besuchten, nicht schließen, dass sie deshalb vollständig ihre Traditionen vergessen oder verleugnet hätten. Gleichwohl konnte es dort zu Konflikten kommen, wo Loyalität zur eigenen Kultur gegenüber der Loyalität zum hellenistischen Herrscher zurücktreten musste.
Auch die hellenistischen Herrscher waren gegenüber ihren persischen Vorgängern weniger zimperlich in der Ausübung direkter
Macht. Sie mischten sich stärker in innere Angelegenheiten der Provinzen ein und bedienten sich auch gelegentlich an den Tempelschätzen. Dass sie für ihre Wohltaten Gegenleistungen erwarteten, ist selbstverständlich. Die kultischen Dankesfeiern waren eine solche. Aber schon sie mussten traditionstreue Juden wegen der geforderten Opfer für fremde Götter abschrecken. Und als Antiochus IV.
schließlich einen Zeus Olympios im Tempel aufstellen ließ, um damit die reichsumspannende Einheit zu dokumentieren, war der Konflikt nicht zu vermeiden.
Mit Ernst Baltrusch ist damit festzuhalten:
12
„Hellenistische Toleranz in Religionsangelegenheiten wurde offenkundig nur dem Gleichartigen, nicht dem völlig Andersgearteten zuteil. Und der jüdische Monotheismus war nicht nur inhaltlich völlig anders als der hellenistische Polytheismus, er war vor allem in besonderer Weise politisch und gewiss nicht in den hellenistischen Götterhimmel integrierbar.“12
Der Sieg der Makkabäer und die nach zähem Ringen mit den Seleukiden sich langsam verselbständigende Herrschaft der Hasmonäer
nach 129v. brachte die inneren Spannungen nicht zur Ruhe. Das Spektrum reichte von prohellenistisch geprägten Kreisen (in gewisser Weise auch die Sadduzäer)13 über kritisch distanzierte Laiengruppen (Pharisäer)14 bis hin zu stark priesterlich orientierten Gruppen, die sich wohl auch aufgrund ihrer radikalen Ablehnung von Auswirkungen der Hasmonäerherrschaft in die Wüste zurückzogen
(Qumrangemeinde).15
Ein radikaler Bruch entstand gegenüber der selbständigen Gemeinde in Samaria, die sich ihrerseits als jene Juden verstanden, welche die Tradition des Nordreiches weiter verkörpern wollten. Es ist irrig, sie als Sekte oder gar als Mischbevölkerung zu denunzieren.
Samaritaner halten sich an die Tora (in einer Fassung, die sich vom sog. Masoretentext leicht unterscheidet) als einzig verbindlichen
religiösen Text. Spätestens in makkabäischer Zeit verliert Jerusalem für sie gänzlich an Bedeutung. Ihr kultureller Mittelpunkt ist von
Anfang an der Berg Garizim in Samaria, wo sie einen Altar unterhalten. Ihre wahrscheinlich sogar gewalttätige Gegnerschaft gegenüber den Makkabäern dürfte letztlich ausschlaggebend für die Zerstörung dieses Heiligtums um 111v. gewesen sein. Die Rabbinen
betrachteten sie mit Argwohn, und sie selbst entwickelten mehr und mehr eine eigenständige Gemeinde mit eigenen Traditionen. Die
Frage, wieweit Samaritaner innerhalb der Grenzen des Judentums sind, wurde durch eine staatliche Regelung 1949 zugunsten der
Samaritaner positiv entschieden. Demnach hatten sie wie alle Juden das Recht, nach Israel einzuwandern und dort die Staatsbürgerschaft zu erlangen. 1992 hob das Religionsministerium diese Regelung (unter Arieh Deri) zwar wieder auf, doch wurde sie 1994 erneut durch ein Urteil des obersten Gerichtshofes wiedereingeführt. Heute leben etwa 600 Samaritaner in Nablus und in Holon bei Tel
Aviv.
Es war die Hasmonäerzeit, die erstmals in größerem Umfang auch eine Konversion von Nichtjuden/Nichtjudäern zum Judentum vorsieht. Das entscheidende Kriterium der Zugehörigkeit ist die Übernahme der Gebräuche, wozu bei Männern die Beschneidung kommt.
12
13
14
15
Ernst Baltrusch, Die Juden und das Römische Reich. Geschichte einer konfliktreichen Beziehung, Darmstadt 2002, 57.
Der Name geht auf die zadokidische Priesteraristokratie zurück. Die Sadduzäer repräsentierten die höhere Tempelpriesterschaft. Bei ihnen verband sich
konservative Religiosität und Tempelstaatsideologie mit einer offenen Haltung gegenüber dem Hellenismus.
Das Pharisäerbild hat unter der neutestamentlichen Polemik völlig zu Unrecht sehr gelitten. Grundsätzlich ist trotz der schlechten Quellenlage davon auszugehen, dass es sich dabei um eine mehrheitlich von Nichtpriestern getragene Bewegung handelte, die die Tora im alltäglichen Vollzug zur Geltung bringen
wollte. Das ganze Volk sollte durch Heiligung des Alltags zu einer von der Tora durchdrungenen Identität gelangen.
Über Entstehung und genaue Identifikation der Qumrangemeinde herrscht keine Einigkeit. Es gilt aber als plausibel, dass sie sich aus einem Konflikt mit dem
Jerusalemer Tempelkult entwickelt. Vgl. zu Qumran den Überblick von Armin Lange/Hermann Lichtenberger: TRE 28 (1997) 45-79.
13
Beschneidung und Übernahme der Gebräuche der Judäer machte die Konvertiten zu Mitgliedern einer judäischen Politeia, wobei der
in der griechischen Antike so wichtige Begriff „Politeia“ sowohl eine Bürgerschaft wie auch eine Lebensweise bezeichnet. So wurden
während der Herrschaft des Johannes Hyrkan die Idumäer in das judäische Volkswesen integriert.16
Die Grundlagen des Judentums sind gelegt. Bis zum heutigen Datum ist Konversion ins Judentum eine Möglichkeit, die allen Menschen ohne Rücksicht auf Geschlecht, Hautfarbe oder Herkunft offen steht.
Berühmten Konvertiten wie Sammy Davis jr., Marilyn Monroe oder Liz Taylor stehen in einer Reihe zahlreicher Frauen und Männer,
die diesen Vorgang vollziehen. Wer nach orthodoxem Ritus konvertiert, hat heute Anrecht auf die israelische Staatsbürgerschaft. Der
israelische Staat ist sicher nicht eins zu eins mit dem hasmonäischen Judäa zu vergleichen, die Grundidee einer umfassenden Gemeinschaft Judentum, einer Politeia, ist aber erhalten geblieben.
Damit will ich diesen ersten Teil beschließen. Er sollte zeigen, dass wir von einem Judentum erst mit der Erfahrung des Exils und dann
vor allem mit der Werdung des judäischen Volkes nach dem Exil sprechen können. Seine kulturelle Verankerung erhält dieses „judäische“ Judentum durch die Tora, den Pentateuch. Sabbat und Beschneidung sind wichtige Marker dieses Judentums, dessen Mitte der
Tempel auf dem Zion darstellt.
16
14
Josephus (AJ 13.257f. u.ö.) und Ptolemäus (Stern, Authors 146) beschreiben sie als gewaltsam, während sie Strabo – der im übrigen die Judäer als Abkömmlinge der Ägypter ansah - als freiwilligen Entschluss der Idumäer betrachtete, der auf die Überzeugungsarbeit des Aristobul zurückging (Stern, Authors
100; 115; AJ 13.319). Alexander Polyhistor behauptete sogar, dass der Name Judäa auf die Kinder der sagenumwobenen Semiramis zurückging, die Juda
und Idumäa hießen (Stern, Authors 53).
Literatur zu den ersten beiden Teilen:
Baltrusch Ernst, Die Juden und das Römische Reich. Geschichte einer konfliktreichen Beziehung, Darmstadt 2002.
Barth Frederic (Hg.), Ethnic Groups and Boundaries: The Organization of Cultural Difference, Bergen: Universitets Forlaget, 1969
Cohen Shaye J.D., The Beginnings of Jewishness. Boundaries, Varieties, Uncertainties, Bekeley 1999.
Dexinger Ferdinand/Reinhard Pummer (Hgg.), Die Samaritaner (WdF 604), Darmstadt 1992.
Hall Stuart, Cultural Identity and Diaspora, in: J. Rutherford (Ed.), Identity, Community, and Cultural Difference, London 1990
Lange Armin/Hermann Lichtenberger, Qumran: TRE 28 (1997) 45-79.
Neher André, Jüdische Identität. Einführung in den Judaismus. Aus dem Französischen von Holger Fock, Hamburg 1995 (Original
Paris 1989).
Neher André, Le dur bonheur, d´être juif, Paris 1978.
Saldarini Anthony J., Pharisees, Scribes and Sadduccees in Palestinian Society, Edinburgh 1989.
Silberstein Laurence J., Others Within and Without, in: L. J. Silberstein/R. L. Cohn (Hgg.), The Other in Jewish Thought and History.
Constructions of Jewish Culture and Identity, (New Perspectives on Jewish Studies), New York 1994, 1-34.
Smith Anthony D., The Ethnic Revival, Cambridge 1981.
Stemberger Günter, Pharisäer, Sadduzäer, Essener (SBS 144), Stuttgart
Stegemann Wolfgang, Christentum als universalisiertes Judentum, Anfragen an G. Theißens „Theorie des Urchristentums“, KuI 2
(2001), 130-148.
Stern Menachem, Greek and Latin Authors on Jews and Judaism, Publications of the Israel Academy of Sciences and Humanities:
Section of Humanities (Fontes ad res Judaicas spectantes), Jerusalem, 3 Bde., 1974-1984 = Stern, Authors.
15
II. Das rabbinische Judentum
In der Zeit zwischen dem 5.Jh. v. und dem 1. Jh. n. entwickelte sich eine kulturell und religiös um den Tempel in Jerusalem orientierte
jüdische Identität, die überaus rege in der Niederschrift der Zeugnisse der jüdischen Kultur war. In dieser Zeit wurden alle großen biblischen Werke redigiert und zusammengefügt und der Kanon der biblischen Bücher fertig gestellt. Die jüdischen Siedlungen erstreckten sich über weite Teile der damals bekannten Welt. Alexandria beherbergte eine große jüdische Minderheit, die etwa ein Drittel der
Bevölkerung ausmachte. Ihre Beziehung zu Jerusalem war ungebrochen, auch wenn diese Gemeinschaft intensiv nach einem politischen Stellenwert in der hellenistischen Diaspora rang. Aufgrund ihrer pointierten kulturellen Identität kam es zu einer Reihe von Konflikten, die ich hier nicht im Detail behandeln kann. 139v. etwa wurden Juden aus Rom vertrieben, weil sie nach offizieller Begründung
die römischen Sitten und die römische Ordnung gefährdeten. Daraus darf jedoch auf keine umfassende Bedrohung der Juden geschlossen werden. Die regionalen und zeitlichen Bedingungen konnten ganz unterschiedliche Folgerungen nach sich ziehen. Darauf
ist unter „Zentren und Peripherien“ noch einzugehen.
Nach dem Niedergang der hasmonäischen Herrschaft, die vor allem an inneren Querelen zerbrach, gelang es der „Schutzmacht“ Rom
mehr und mehr, die Kontrolle auf das kleine Judäa auszuüben. Dieser Zusammenhang ist weitgehend bekannt und dennoch auch mit
vielen Legenden behaftet, da diese Zeit mit Geburt, Wirken und Tod Jesu zusammenfällt.
Der große zeitgenössische Historiker Flavius Josephus ist eine geschätzte Quelle dieser Zeit, ebenso wie auch viele römische Schriften den Befund des Neuen Testaments um wichtiges Material ergänzen und nicht selten korrigieren.
1. Ein kurzer Blick auf Herodes und den Tempel
Unter dem skrupellosen Herrscher und geschickten Diplomaten Herodes dem Großen wurde nicht nur römische Kunst und Architektur
aus dem Westen importiert. Auch seine Ökonomie richtete sich an Rom aus. Außer den Leistungen an römische Edelleute und an
Familienmitglieder gab Herodes Unsummen für seine Prachtbauten aus, für das Herodium, den Hafen in Caesarea, die Zitadellen und
die Paläste in Jerusalem und Masada, den Palastkomplex in Jericho, für Städtebauten, Wassersysteme und vor allem für den Bau des
wohl imposantesten Gebäudekomplexes der damaligen Zeit, den Tempel in Jerusalem. Mit dem Bau des Tempels versuchte der gebürtige Idumäer sein Judentum besonders zu betonen, ja, ihm geradezu einen messianischen Anspruch zu verleihen. Der Tempel war
von Anfang an mit Erwartungen und auch Enttäuschungen verbunden. Seine Zerstörung unter den Babyloniern und seine Entweihung
unter den Seleukiden demütigten weite Teile des Volkes und führten zur Hoffnung nach Erneuerung und Wiederaufbau, war doch der
Tempel die einigende Kraft aller Teile des Volkes, das sich wenigstens dreimal jährlich anlässlich der großen Feste dort einfinden sollte, um gemeinsam vor Gott des Exodus, der Gabe der Tora, des Landes und der Feldfrüchte und Tiere zu gedenken und mit ausgelassener Freude zu feiern.
16
Die Finanzierung solcher Bauten war nur unter der Auflage zahlreicher Steuern möglich. Ertragssteuer für Agrarprodukte, eine Bodensteuer, eine Kopfsteuer, Handels- und Gewerbesteuern und Zwangs`geschenke' zu bestimmten Anlässen. Eine der bedeutendsten
Einnahmequellen war die Halbscheqelsteuer für das Heiligtum in Jerusalem. Sie war seit der Hasmonäerzeit zu einer jährlichen Abgabe gemacht worden, die von jedem Mann zu entrichten war. Der Scheqel zur Zeit des Herodes hatte den Wert einer Tetradrachme,
die vier römischen Denaren entsprach. Die zwei Denare waren in tyrischem Standard zu entrichten. Als Tyrus 19 v. aufhörte, seine
Münzen zu prägen, übernahm der Tempel in Jerusalem diese Aufgabe. Alle tyrischen Scheqel wurden fortan dort geprägt. Bei einer
minimalen Schätzung der jüdischen Bevölkerung auf zwei Millionen ergäbe sich ein jährliches Einkommen von einer Million Denaren
für den Tempel allein aus der Halbscheqelsteuer. Dies hätte nach der Schätzung von Broshi17 etwa 10-15% der Einkommen des Herodes ausgemacht. Entsprechend der - ideologisch unverdächtigen - Aussage von mScheqalim IV,2 konnte das Geld für Belange des
Tempels aber auch für die Stadt im allgemeinen verwendet werden, für Aquädukte, Mauer- und Turmbauten u.v.m. Dazu kam, dass
die große Zahl von Pilgern, die jährlich vor allem zu den Hauptfesten an den Tempel kam, Priesterabgaben, Geschenke und (Geld für)
Opfertiere mitbrachte, die zum Reichtum des Tempels und dem der herodianischen Familie entschieden beitrugen.
2. Mehrere Gruppen in Judäa
Neben der sozialen Dominanz des Tempels ergab sich ein weiterer konfliktträchtiger Spannungsbereich in dem Umstand, dass die
herrschende `Klasse' in Judäa dem hellenistischen und römischen Kulturbereich nacheiferte. Davon zeugt bis heute, um nur ein Beispiel zu nennen, die erhaltene Einrichtung des sog. `Verbrannten Hauses' im jüdischen Viertel der Jerusalemer Altstadt. Bereits in der
Hasmonäerzeit hatte sich Widerstand gegen deren Religionspolitik nicht nur aus Kreisen der Qumran-Bewegung geregt. Der Tempel
und die Tempelverwaltung lagen in der Hand von Menschen, die für einen beträchtlichen Teil der Bevölkerung nicht legitimiert dazu
waren. Diese Kritik kam zum einen aus einer konservativen Ecke, wo man von einem reinen, unverfälschten Priestertum an einem
kultisch reinen Tempel träumte, zum anderen aber auch aus der Gruppe engagierter Laiengelehrter, die eine Zukunft des Judentums
weniger in einem statischen Vollzug des Opfergottesdienstes erblickte, sondern in der weiterführenden Beschäftigung und konsequenten Auslegung der Tora.
Radikale Kräfte formierten sich in der Nachfolge eines Judas aus Gamala mit einem messianischen Eifer (deshalb Zeloten = Eiferer)
gegen Rom.
Weiters gab es in Judäa sozialkritische Kreise, die sich nicht nur gegen die Ausbeutung durch Rom, sondern auch gegen die soziale
und politische Vorherrschaft der Mächtigen in Jerusalem richtete. Es wäre vereinfachend, darunter jene Leute zu verstehen, die landläufig als `Pharisäer' in der wissenschaftlichen Literatur einen festen Platz haben, da eine Näherbestimmung bislang umstritten und
eine eindeutige Zuordnung unmöglich ist. Sicherlich waren im Sanhedrin Pharisäer und Sadduzäer vertreten. Auch die Größe dieser
Gruppe ist umstritten, ebenso ihre Einstellung zu Rom, die nicht einheitlich gewesen sein dürfte.
17
Magen Broshi, The Role of the Temple in the Herodian Economy: JJS 38 (1987) 31-37.
17
Die rabbinische Bewegung war eine Sammelbewegung, die auch priesterliches Material aufnahm, das im Laufe der Zeit wieder stärker
in den Hintergrund trat. Die Rabbinen einfach als Fortsetzung der Pharisäer zu bezeichnen, ist jedenfalls einseitig und nicht haltbar.
3. Die rabbinische Bewegung und ihre Bedeutung
Die Geburtsstunde der rabbinischen Bewegung war nun eigentlich die große Krise, die in den Unruhen und dem Aufstand gegen Rom
und schließlich in der Zerstörung des Tempels im Jahr 70n. kulminierte.
Unter Kaiser Nero und den Feldherrn (und späteren Kaisern) Vespasian und Titus war der große jüdische Aufstand von 66-70n. blutig
niedergeschlagen und den Tempel in Schutt und Asche gelegt worden. Damit endete ziemlich abrupt eine Epoche des Judentums,
das ich in den ersten Kapiteln beschrieben habe.
Die rabbinische Legende18 berichtet von einem gewagten Unternehmen des Rabbi Jochanan ha Zakkai, der sich in einem Sarg aus
der brennenden Stadt Jerusalem direkt in das Heerlager Vespasians bringen ließ.19 Dort sagt er Vespasian voraus, dass er Kaiser
werden würde und erbittet von ihm eine Stätte des Torastudiums in der Kleinstadt Jabne. Als aus Rom die Kunde kommt, dass Jochanan Recht hat, gewährt der frischgebackene Kaiser die Bitte.
Dies ist sozusagen die Geburtsstunde des Rabbinismus.
In einer rabbinischen Schrift des frühen 2. Jhs. heißt es: „Wer Schüler hat, die selbst wieder Schüler haben, den nennt man Rabbi.
Sind seine Schüler vergessen, nennt man in Rabban; sind auch die Schüler seiner Schüler schon vergessen, nennt man ihn (einfach)
beim Namen“.20
Dies zeigt, dass der Begriff Rabbi nicht vor 70 in der später gängigen Bedeutung eines autorisierten Toralehrers auftritt. Die Bezeichnung kann – so wohl auch in der Zeit Jesu – als Ehrentitel für gebildete Männer - etwa im Sinne von „mein Meister/mein Lehrer“ - verwendet worden sein, ihre eigentliche inhaltliche Fülle erlangt sie erst nach 70. Als nach der völligen Niederwerfung des sog. Bar
Kochba-Aufstandes von 132-135 der Tempel vollständig vernichtet und Jerusalem für Juden zur Sperrzone wurde, kam es zur endgültigen Ausformung des rabbinischen Bewusstseins mit dem Ziel, eine Identität des Judentums ohne Tempel und jenseits politischer
Unabhängigkeit zu garantieren.
Damit ist das rabbinische Judentum letztlich erfolgreich gewesen und hat den breiten Mainstream des Judentums bis in die Neuzeit
bestimmt.
18
19
20
18
Abot de Rabbi Natan A 4; Abot de Rabbi Natan B 13; Ekha Rabbati 1.31; bGittin 56ab.
Vgl. Abraham Schalit, Der Erhebung Vespasians nach Josephus, Talmud, Midrasch, in: Hildegard Temporini (Hgin.), Principat (ANRW II.2), Berlin-New York
1975, 208-327, 305ff.
TEdujot III,4.
In den Anfängen jedoch dürfte das rabbinische Judentum nur eine kleine Minderheit innerhalb der weitverzweigten jüdischen Gruppierungen und Richtungen dargestellt haben. Erst über Jahrhunderte gelang es ihnen, mehr und mehr die jüdischen Gesellschaften mit
ihren Überzeugungen, Grundsätzen und ihrer Lebensweise zu durchdringen und schließlich zu dominieren.
Das rabbinische Judentum knüpfte an Traditionen der schriftgelehrten Weisen an, die bereits in der Bibel und in den deuterokanonischen Schriften deutlich anklingen, so besonders im Buch Ben Sira, aber auch in der Endredaktion der Psalmen.
Der Bibeltext Ex 19,6 spricht davon, dass Israel ein Reich von Priestern und ein heiliges Volk sein soll. Diese Aussage steht dort quasi
als wichtige Präambel der großen und langen Sinaiperikope, die bis Ex 34 reicht. Sie signalisiert die Bedeutung des Verhaltens vor
Gott und seine Auswirkung. Im Vers vorher heißt es: „Jetzt aber, wenn ihr auf meine Stimme hört und meinen Bund haltet, werdet ihr
unter allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Mir gehört die ganze Erde.“ Der von Gott mit Israel bestehende Bund ist unkündbar, er gilt dauerhaft. Dies ist wichtig, um die Bedeutung des Gesagten richtig zu verstehen. Nicht der Bund steht auf dem Spiel, sondern die besondere Funktion des Volkes als „Eigentumsvolk Gottes“. Die so oft missverstandene Erwählung Israels bedeutet keine
überhebliche Selbstüberschätzung, sondern ist Auftrag zu einem Leben in „Heiligkeit“, die sich an den Bundessatzungen ausrichtet.
Darunter konnte im Kontext des Sinaigeschehens nur die Tora gemeint sein. So verstanden auch die Rabbinen die Heiligkeit des
Menschen als Aufgabe, die das Leben aller bestimmen sollte. Der Mensch wird zum eigentlichen Tempel, sein Alltag ist Gottesdienst.
Die Tora und das Studium dieser Weisung Gottes wird zum Inbegriff jüdischer Identität. Dieser Gedanke ist nicht neu. Schon die Gemeinde und Esra und Nehemia hatte die Tora als ihre kulturelle Grundlage in den Mittelpunkt jüdischer Identität gestellt. Nach der
Tempelzerstörung und nach dem völligen Verlust politischer Selbständigkeit kommt ihr aber umfassend die Funktion eines „portativen
Vaterlandes“ zu, wie es Heinrich Heine genannt hat.
Der Verdienst der Rabbinen in diesem Prozess ist nicht hoch genug einzuschätzen. Das rabbinische Judentum stellte jüdische Identität auf tragfähige Beine und ermöglichte das Überleben jüdischer Kultur auch unter extremen Gefährdungen.
4. Der Rabbi
In moderner Zeit ist unter einem Rabbiner ein Beruf zu verstehen, der je nach Ausrichtung der Gemeinde unterschiedliche Aufgaben
zu erfüllen hat. Dazu gehören – christlich formuliert - seelsorgerische Pflichten ebenso wie liturgische Aufgaben, besonders aber eine
umfassende Kenntnis der jüdischen Tradition, des Rechts und seiner Auslegung.
In der Frühzeit der Rabbinischen Bewegung war es keineswegs möglich, den Beruf eines Rabbi auszuüben. Das Ideal war, nicht davon zu leben, sondern einen „bürgerlichen“ Beruf auszuüben. Und so sind verschiedene Berufe von Rabbinen in der Antike bekannt.
Sie wirkten in der Landwirtschaft und im Handel, als Schneider, Wäscher, Schmiede, Sandalenmacher, Gerber, Handwerker oder
Schreiber. Rabbi zu sein bedeutete freilich eine umfassende Lebenshaltung, sich so viel als möglich mit dem Studium der Tora zu beschäftigen. Es setzt in der frühen Kindheit ein, wenn der Knabe sich mit der Tora auseinandersetzen soll.
19
Im Erwachsenenalter sollen sie ihre Weisheit und ihre Kenntnis der Bibel dazu verwenden, Lebensregeln aufzustellen, vorhandene
Überlieferungen und Erfahrungen zu sammeln, zu diskutieren und letztlich niederzuschreiben. Die Lebensweisungen der Bibel heißen
auf hebr. Tora, was nicht einfach mit unserem Verständnis von Gesetz, wie es vor allem im Bereich protestantischer Theologie oft verstanden wird, gleichzusetzen ist, sondern eine lebensspendende und den Alltag befruchtende Weisung meint, die aus Gottes Offenbarung abgeleitet das konkrete Leben der Juden bestimmt.
20
Ein Überblick über Gruppen innerhalb Israels und eine Analyse ihrer Zugehörigkeit zu Israel in den rabbinischen Schriften
(nach Sacha Stern)
Grafik
Israel
I:
Gruppen
zu Israel gezählt
Die Konvertiten (sg.
h.: ger tzedek)
Israel "minderer Qualität"
Schwellenexistenz zum Judentum
Eigene Gruppe zwischen
Verhalten wie Nichtjuden
Mit Nichtjuden verglichen
Israel und den Nichtjuden
und Konsequenzen
Nach Konversion (Ritus von Akzeptanz der
Tora, Beschneidung und Tauchbad) werden sie
Teil
Israels.
Ihr Schicksal ist am Sinai präsent. Sie sind im
Moabbund
integriert.
(Belege: bJeb 47b; LevR 1.2; NumR 8.1;
bSchab
146a;
bShewu
39a
u.ö.)
Dürfen sich in der Liturgie nicht auf "unsere
Erzeltern"
berufen.
Nach mKid 4.1 wird Herkunft wie folgt abgestuft: Priester, Levit, Israel, Priester, Konvertit,
Befreiter, Bastard, Gibeonit, Kind unbekannten
Vaters,
Findling.
Darf
keinen
Priester
heiraten.
Man soll sich um sie kümmern und sie lieben
Nach bBer 8b empfehlen einige Rabbinen,
(ER 27), ihnen keine Hindernisse in den Weg
keine Konvertitin zu heiraten.
legen
(NumR
8.2);
vgl. auch den außerkanonischen Traktat Gerim
Konvertiten haftet der "Geruch" von Götzendienst an (bQid 75a; bSan 94a).
Angst vor Rückfall. Man kann ihnen bis zur
7. bzw. gar zur 22. Generation nicht trauen
(PesR
22.5;
PRE
28).
Unterstellung, aus Angst und nicht Überzeugung konvertiert zu sein (bJeb 48b).
Sind in jeder Hinsicht Nichtjuden (yJeb
8.1). Sie halten aber die sieben noachidische Gebote oder gar alle mit Ausnahmen (Speisegebote) (bAZ 64b-65a).
Man unterstützt sie, sie dürfen im Land
wohnen (bPes 21b; Sifre Dtn § 259).
Die "Beisaßen" (sg. h.:
ger toshav)
Die
kanaanäischen
Sklaven (sg. h.: eved
kena`ani)
Werden zu Juden, wenn sie aus dem Sklavenstand befreit werden (bSan 58b).
DieSamaritaner
tim)
R. Meir (in GenR 94.7) gesteht den Schomronim zu, Abkömmlinge des Stammes Issachar
zu
sein.
Die Samaritaner sehen sich als Nachfahren
Josefs und sind heute in Israel als Juden anerkannt.
Problem Konversion: Schon in der Tosefta und
dann im Talmud besteht eine Kontroverse, ob
ihre Konversion aus Angst oder Überzeugung
geschah und daher anzuerkennen oder abzuerkennen sei (tTer 4.12; bQid 75b; bBK 38b;
bNid 55a; Kutim 2 u.ö.).
(Ku-
Die Apostaten (sg. h.:
mumar oder meshumad)
Bleiben trotz zahlreicher Fehlverhalten zu Israel
gehörig (Israel mumar). Brauchen nicht zu
konvertieren, sondern sollten umkehren (bAZ
17a). Nach yT ist ein reuiger Apostat liebenswerter als ein Konvertit (yHor 3.5), in bT dazu
keine
Meinung.
Apostaten dürfen Jüdinnen heiraten.
Müssen ein Tauchbad nehmen, werden beschnitten. Sie gehören während ihres Sklavenstandes noch nicht zu Israel, aber auch nicht
zu
den
Nichtjuden.
Müssen Gebote wie eine Frau erfüllen (bChag
4a
u.ö.).
Aus Ex 20,10 Vergleich mit Tier (GenR 56.2),
praktisch-halachische Konsequenz: Keine
Verlobung (bQid 62b) vor Freilassung; der
Fötus einer solchen Frau wird einem Tierfötus
gleichgesetzt (bQid 69a). Aus Gen 22,5 wird
der Vergleich mit Eseln gezogen (GenR 56.2
u.ö.). Auch daraus resultieren strafrechtliche
Bestimmungen, die sie Tieren gleichsetzen
(bJeb 62a; bQid 68a; bBQ 49a).
Sind 12 Monate des Götzendienstes verdächtig (bAZ 57a).
In der Mischna eine Gruppe eigener
Identität, an der die Grenze der Halacha
zwischen Juden und Nichtjuden erprobt
wird (mBer 7.1; 8.8; mDem 3.4; 5.9 u.ö.).
Nach dem außerkanonischen Traktat
Kutim handeln sie manchmal wie die
Juden, manchmal wie die Nichtjuden,
mehrheitlich
aber
wie
Israel.
Halten Sabbat und Abgabengebote
(mNed
3.10;
bBer
47b).
Müssen noch einmal konvertieren und
Jerusalem als Kultzentrum und die Auferstehung der Toten anerkennen (Kutim
Ende).
Werden üblicherweise in der rabb. Literatur als "Kutim" bezeichnet und als Abkömmlinge der Einwanderer aus Kuta
betrachtet (2 Kön 17,24-41), die konvertierten.
Problem
Konversion:
Schon in der Tosefta und dann im Talmud besteht eine Kontroverse, ob ihre
Konversion aus Angst oder Überzeugung
geschah und daher anzuerkennen oder
abzuerkennen sei (tTer 4.12; bQid 75b;
bBK 38b; bNid 55a; Kutim 2 u.ö.).
Schon in der Bibel ist ihre Konversion mit
Vorbehalten verbunden (Götzendiener).
Hätten Sex mit Menstruierenden (mNid 4.1).
Problem
Zuverlässigkeit:
Gelten in talmudischer Zeit als korrumpiert
und unzuverlässig in den Geboten, als
Götzendiener auf dem Garizim (yAZ 5.4
u.ö.), die eine Taube verehrten (bChul 6a).
Gelten dort wie Apostaten, sind also halachisch so zu behandeln, als wären sie
Nichtjuden, obwohl sie welche sind.
Gelten in praktisch- halachischer Hinsicht
wie
Nichtjuden
(yErub
6.2).
Apostaten werden vom Empfang der Tora
ausgeschlossen. Mose zerbrach ihretwegen die Tafeln (bSchab 87a).
Essen nicht koscher geschlachtetes Fleisch,
trinken verbotenen Wein, entehren den
Sabbat, machen Beschneidung rückgängig,
tragen Mischgewebe (tHor 1.5; bHor 11a).
Unterscheidung zwischen Apostaten aus
"Lust/Appetit" und Apostaten aus Überzeugung (die vertrauenswürdiger sind) (bSan
27a). Werden in der Gehenna eingeschlossen (tSan 13.4-5) und gelten als "zu hassender
Feind"
(ARN
16).
Gelten wegen ihres Abfalls von den Gebo-
21
ten mitunter als schlechter als Nichtjuden zu
behandeln (mScheq 1.5 u.ö.).
Die Häretiker (Minim)
Implizit ist aus der Gegenüberstellung zu den
Nichtjuden eine Verbindung mit Israel auszumachen, die rabbinisch durch die Betonung
ihres verachtenswerten Verhaltens herunter
gespielt wird.
Ihr Brot gilt wie nichtjüdisches Brot,
ebenso der Wein, ihre Produkte als
unverzehntet, ihre Bücher als Magie, die
Kinder als Bastarde. Handel mit ihnen ist
verboten, und man darf sich von ihnen
nicht heilen lassen (tChul 2.20ff.). Ihre
Torarollen werden zerstört.
Sie gelten als Götzendiener. Sie lehnen die
kommende Welt und die Auferstehung der
Toten ab (tChul 1.1;mBer 9.5; bSan 90b
u.ö.). Müssen wie Apostaten gehasst werden (ARN 16) und schmoren wie sie in der
Gehenna (tSan 13.4-5). Dort wird nach ExR
19.4 ihre Beschneidung rückgängig gemacht. Gelten wegen ihres Abfalls von Gott
als in mancher Hinsicht schlechter als
Nichtjuden (tSchab 13.5; tChul 1.1 u.ö.).
Die Sadduzäer (tseduqim)
Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zu Israel
wird kaum direkt und prinzipiell diskutiert. Man
unterscheidet die Auslegungen der Sadduzäer
von denen der Rabbinen. Sie bestreiten nämlich rabbinische Lehre (zuerst gehört dazu die
alleinige Berufung auf den Bibeltext - bSan 33b,
dann auch Positionen wie die Leugnung der
Belohnung/ Bestrafung nach dem Tod und die
Auferstehung - ARN 5.2 u.ö.).
bErub 68b-69a diskutiert kontrovers über
die Zugehörigkeit zu Israel in praktischhalachischen
Fragen.
Trennung von Israel könnte mit Vorsicht
auch aus Überlegungen wie folgender
abgeleitet werden: Wer immer die kommende Welt leugnet, gilt nicht als Nachkomme Abrahams (nach GenR 53.12).
Scholium zu Megillat Taanit unterscheidet
zwischen Israel und den Sadduzäern.
In Bezug auf Menstruationsunreinheit werden die Frauen mit den Kutim verglichen
(mNid 4.2). bJeb 63b verbindet mit ihnen Ps
14,1, also die Leugnung Gottes.
Die Ammei ha-Aretz
Akzeptieren prinzipiell die Tora (etwa im Hinblick auf Götzendienst, Beschneidung, Sabbat,
Feste, Almosengaben, Speisegebote u.ä.).
Sie haben gute Manieren und halten sich von
sexuellen Übertretungen, Diebstahl und allen
üblen
Dingen
fern
(ER
15).
Man soll sie Tora lehren (bBM 85a; LevR
34.13). Man soll sie lieben (ARN 16).
Gelten nach tDem 5.2 als zuverlässig in
Zehntfragen. Sie sind die Blätter des Weinstocks Israel (bChul 92a nach Gen 40,10) bzw.
ihre schützende Nussschale für die Nuss Toragelehrte (HldR 6.11).
Werden in praktisch- halachischen Fragen mitunter wie Nichtjuden behandelt:
man darf keine ihrer Töchter ehelichen,
ihre Frauen werden mit Tieren verglichen.
Ihre Laxheit in Reinheitsfragen bringt sie
Nichtjuden nah. Man soll Handel und gesellschaftlichen Kontakt mit ihnen meiden
und ihre Synagogen nicht besuchen (mDemai
2.2-3;
mAbot
3.10
u.ö.).
Besonders negativ beschreibt sie bPes 49b:
Sie hassen Toralehrer mehr als die Nichtjuden Israel. Sie werden der Neigung zum
Morden verdächtigt (vgl. KallaR 2), dürfen
geschlagen werden (bPes 49b ist aber ein
Text, der von zahlreichen anderen positiveren
kontrastiert
wird).
Über ihr Schicksal in der künftigen Welt
herrschen kontroverse Meinungen (bKet
111b).
Die Sünder
Die Beurteilung der Sünder ist in der Regel
positiv. Sie bekehren sich (bErub 19a). Selbst
die Schlechten unter Israel tun gute Taten
(NumR 3.1). Sie sind besser als göttlich geführte Nichtjuden (bGit 56b-57a). Obwohl sie sündigen, gelten sie als Israel (bSan 44a). Sie
werden positiv von den Apostaten abgesetzt.
Sie sind als Sünder Gottes Volk (Sifre Dtn §
308). Die Güte Gottes ist über ihnen (HldR 7.6).
Sie sind ein unverzichtbarer Bestandteil Israels:
In Sukkot repräsentieren sie die Bachweiden,
die weder Geschmack noch Geruch haben,
also weder Torastudium noch gute Taten, aber
sie halten den Verbund Israel, der hier im Lulav
symbolisiert ist, mit zusammen (LevR 30.12). In
bChul 92a repräsentieren sie die unfruchtbaren
Zweige des Weinstocks. Nach bKer 6b ist ein
Fest ohne sie kein Fest.
22
Sie verhalten sich im Gegensatz zum Chaver,
dem toragehorsamen "Musterjuden", also in
Kontrast zu den Rabbinen. Unwissen und laxer
Umgang
mit
Tora
prägen
sie.
Vor allem im Bezug auf Zehnten und Reinheitsvorschriften ist ihnen nicht vollständig zu
trauen (vgl. mDemai). Sie tragen keine Tefillin,
haben keine Mezuza, lehren die Kinder nicht
Tora usw. (bBer 47b u.ö.). Sie nennen Synagogen "Volkshäuser" (bSchab 32a), reden
schlecht über Toralehrer (ER 13).
Ihr Abirren ist kurz und beschränkt. Sie
werden auch nur kurze Zeit in der Gehenna
bleiben, die Beschneidung rettet sie (bErub
19a).
Der Ausdruck "Fremder/Nichtjude" (nokhri)
kann sich selten auf sie beziehen (bSan
54a).
Versuch einer Systematisierung und Begründung der "Nähe" oder "Ferne" zu Israel
Bezug zu Israel
Gruppe
Begründung
Voll zu Israel gerechnet
Konvertiten, Sünder
Annahme aller Gebote
Israel mit Einschränkungen/Grauzone
Ammei ha-Aretz
Akzeptanz
der
Aber Laxheit und Unverstand, Kritik an Toralehrern; Mordverdacht
Eine Vorstufe zu Israel
Sklaven
fehlende Freiheit
Eine eigene Gruppe
Sadduzäer
Diskussion um Wert der Konversion, Ablehnung der kommenden Welt und der
Auferstehung
Kutim
Gebote
Ablehnung der mündlichen Tora oder Teile der Tora, Verdacht des Götzendienstes; Ablehnung der kommenden Welt und der Auferstehung
Ablehnung der mündlichen Tora oder Teile der Tora, Verdacht des Götzendienstes; Beschneidung rückgängig gemacht
Apostaten
Zu Israel zu rechnen, aber den Völkern vergleichbar und in halachischen Belangen mitunter wie Nichtjuden zu behandeln
Ablehnung der mündlichen Tora oder Teile der Tora, Verdacht des Götzendienstes; Beschneidung rückgängig gemacht; Ablehnung der kommenden
Welt und der Auferstehung
Häretiker
23
Grafik II:
Die Völker
Bezeichnung
Positive Bewertung
Negative Bewertung
Daraus resultierende Bestimmungen
Nichtjuden (ohne spezifische
Unterscheidung):
dazu zählen auch oft die
"Aramäer"
unterschiedliche
Bezeichnungen:
häufig
"Sternendiener", "Völker
der Welt", "Götzendiener"; "Frevler"; mit Tieren
verglichen
es gibt Gerechte unter den Völkern: sie haben Anteil
an der kommenden Welt (tSan 13.2; bSan 105a). 30
Gerechte erhalten die Nichtjuden am Leben (bChul
92a). Jitro, Rahab, Rut und Antoninus gelten als Gerechte (QohR 5.11.1) - hier wird aber Konversion ins
Spiel gebracht
werden
verdächtigt,
Götzendienst,
Unzucht,
Mord
zu
betreiben
Diebstahl
Lügen
und
Falschaussagen
Götzendienst: häufiger Vorwurf (yBer 8.6 u.oft): Unterstützung von Nichtjuden steht immer
unter dem Verdacht, ihnen beim Götzendienst zu helfen. Dadurch sind auch viele Gegenstände von Nichtjuden nicht zu erwerben erlaubt und der Handel eingeschränkt (keine
Tiere verkaufen, keine Häuser vermieten usw.). Nichtjüd. Wein ist verdächtig (Libation
mAZ
4).
Teilnahme an Veranstaltungen von Nichtjuden (Hochzeiten, Bankette, Theater oder Zirkus)
gilt
wegen
der
Gefahr
des
Götzendienstes
als
verboten.
bMeg 13a:"wer Götzendienst ablehnt, wird ein "Jude" (Jehudi) genannt".
Nichtjuden sind nach schriftlicher Tora
rein, nach rabbinischer Tora aber in
vielerlei
Hinsicht
unrein.
Sind für die Tora unwürdig (Sifre Dtn §
311). Bzw. haben sie das Angebot der
Toragabe abgelehnt (Sifre Dtn § 343 u.
oft).
Die mündliche Tora wurde ihnen gänzlich vorenthalten.
Unzucht: Vergewaltigung von Kriegsgefangenen wird vorausgesetzt (mTer 8.12).
Umstritten ist, ob Ehen zwischen Nichtjuden ungültig sind (bSan 82a; bSan 57b). Nichtjuden gelten als promiskuitiv, treiben neben ihren Ehefrauen Unzucht, weshalb man eine
jüd. Frau nicht mit einem verh. Nichtjuden selbst in Anwesenheit seiner Frau allein lassen
darf (bAZ 25b) und kennen ihre Eltern nicht (HldR 6.8 u.ö.). Ihr Same ist wertlos (Vergleich mit Ez 23,20 in bJeb 98a), ihre Vaterschaft daher ungeklärt. Homosexualität ist
üblich (bChul 92ab); Sodomie verbreitet (mAZ 2.1; bGit 38a; bAZ 22b): Die Ursünde mit
der
Schlange
wirkt
nach
(Israel
wurde
am
Sinai
davon
gereinigt).
Mord: man darf sich von ihnen nicht beschneiden lassen, keinen ihrer Ärzte aufsuchen,
nicht die Haare schneiden lassen (vgl. tAZ 2 und 3 - es sei denn, der Barbier "praktiziert"
auf einem öffentlichen Platz, wo er nicht morden kann - mAZ 2.2), man muss sich in ihrer
Begleitung sehr in acht nehmen und darf ihnen keine Waffen verkaufen oder Gegenstände,
die
sie
irrtümlicherweise
als
Juden
kennzeichnen
könnten.
Diebstahl: man hat Angst, Geld von Nichtjuden nicht mehr zurück zu bekommen (bBQ
117a).
Lügen und Falschaussagen: Nichtjüdische Gerichte sind bestechlich; Nichtjuden halten
nicht Wort, sind nicht glaubwürdig (tPea 4.1; bBek 13b)
Römer
mitunter mit der Bezeichnung
"Aramäer"
Der
Begriff
"Römer"
bezieht sich auf hohe
Würdenträger und Militärs;
nicht selten ist von "Völkern" die Rede, wenn
konkret römische Maßnahmen gemeint sind.
Esau = Rom
positive Bewertung einzelner Würdenträger (etwa
Antoninus): vgl. Stemberger, Rom
Araber
Perser
24
positive Bewertung einzelner Herrscher (Schapur,
Yazdgard I). Hoffnung auf den Messias mit ihrem
Kampf
gegen
Rom
verbunden.
Leben unter ihnen ist besser als unter Römern. Haben
bessere Sitten: zu positiven Bräuchen Texte wie bBer
8b; GenR 74.2; KohR 7.23 §1; Tan Chukkat 6 (jeweils
in Verbindung mit Gen 31,4) und in Bezug auf den
Vorteil gegenüber Rom v. a. bGit 17a; bPes 87b. Das
Exil dort ist kürzer; es ist die ursprüngliche Heimat...
Sie können als das Sinnbild der (feindlichen) Völker schlechthin stehen: sie
betreiben Götzendienst, Unzucht, Mord
(bPes 87b; bAZ 10b; Sifre Dtn § 343;
NumR 14.10 u.ö.), Diebstahl (GenR
44.15 u.ö.), Homosexualität (GenR
63.10
u.ö.)
Mit dem Schwein verglichen (LevR 13;
GenR
65.1).
Sie zerstören den Tempel, ermorden
rabbinische Gelehrte, verfolgen sie,
setzen feindliche Dekrete und Steuern
in Kraft.
Sie werden besonders der Unzucht
verdächtigt (bQid 49b): vgl. auch Ammianius Marcellinus (14,4), ebenso des
Diebstahl (Sifre Dtn § 343; bBB 36a;
NumR 14.10; bAZ 33a)
"Sie essen und trinken wie ein Bär, ihr
Fleisch ist wie das eines Bären angeschwollen; sie tragen langes Haar wie
ein Bär und sind ruhelos wie ein Bär"
(bMeg 11a; bQid 72a; bAZ 2b).
Jüdische Feste
Einführungen unter
http://www.bnaibrith.ch/juedische1.htm
http://www.hagalil.com/judentum/feiertage/index.htm
Fasten
Erstgeborene
14. Nisan
Pesach
15. Nisan
Jom
26. Nisan
Lag
18. Ijar
Hoshana
21. Tischri
Rabba
Chanukka
2. Tewet
2
Pesach
Nisan
17. Nisan
Schemini
Atzeret
22. Tischri
7 Chanukka
3. Tewet
Shawuot
6. Siwan
Tu
15. Aw
Aw
8
3 Pesach
18. Nisan
4 Pesach
19. Nisan
Jom
Ha
Atzma'ut
3. Ijar
Ha
Jerusalem
Tag
28. Ijar
Tisha
be'
9. Aw
Fasten
Pesach
16.
Omer
Jom
Zikaron
2. Ijar
HaShoa
B'Omer
Gedalja
3. Tischri
1
1 Shawuot
7. Siwan
5 Pesach
20. Nisan
Pesach
14. Ijar
2
Beginn
Slichot
Elul
be'Aw
6 Pesach
21. Nisan
7 Pesach
22. Nisan
8
Sheini
17. Tammus
"Drei Wochen"
Rosh
HaShana
1. Tischri
Rosh
HaShana
2. Tischri
Jom
10. Tischri
Kippur
Sukkot
15. Tischri
1 Sukkot
16. Tischri
2 Sukkot
17. Tischri
3 Sukkot
18. Tischri
4 Sukkot
19. Tischri
5 Sukkot
20. Tischri
6
Simchat
23. Tischri
Tora
Chanukka
25. Kislew
1 Chanukka
26. Kislew
2 Chanukka
27. Kislew
3 Chanukka
28. Kislew
4 Chanukka
29. Kislew
5 Chanukka
1. Tewet
6
Esther
Fasten
13. Adar
Purim
14. Adar
Shushan
15. Adar
10. Tewet
Tu
15. Shevat
Bishvat
Purim
25
Grundkurs Judentum
Reader zum Grundkurs „Judentum“
zur begleitenden Lektüre und Prüfungsvorbereitung
Inhalt:
Glossar
Stichworte zum Judentum in den Anfängen
Sadduzäer; Pharisäer
Der Jude Jesus
Tempel und Synagoge
Jüdische Gruppen nach
den Rabbinen
Das „Höre Israel“
Das „Schmone Esre“ (18Gebet)
Talmud
Das erste und zweite
Gebot
Menschenrechte
Jüdische Feste
Die Juden in Spanien
Maimonides
Der Wiener Judenplatz
26
Quellen:
http://www.oppisworld.de/zeit/juden/judenlex.htm; http://www.etrend.ch/fundgrube/win_fundgrube/pal_glossar.htm
zusammengestellt von: Gerhard Langer
aus: Theologische Realenzyklopädie (TRE)
Vortrag und Artikel: Jüdische Stimmen zu Jesus, Protokolle zur Bibel 5/2 (1996) 95-107 und weiteres Material zur
Rezeption, von: Gerhard Langer
u.a.: Der Tempel. Ort der „Nichtdarstellung“ Gottes, von: David Banon (Strassbourg-Lausanne): WuUdB (Der
Tempel) 33-37.
„Als ob sie vor mir ein Opfer dargebracht hätten“. Erinnerungen an den Tempel in der Liturgie der Synagoge, von:
Clemens Leonhard.
Bemerkungen zum sozialgeschichtlichen Hintergrund der Entwicklung der Synagoge von: Gerhard Langer, Protokolle zur Bibel 2, 1993, 47-59.
Michael F. Mach, „Etwas Tempel“: WuUdB (Der Tempel) 38-40.
nach: Sacha Stern, Jewish Identity in Early Rabbinic Writings (Arbeiten zur Geschichte des Antiken Judentums
und des Urchristentums XXIII), Leiden-New York-Köln 1994.
Übersetzung: Jakob Petuchowski
Arbeitsblatt Langer
aus: Johannes Schaber (Hg.), Gemeinsame Wurzeln. Der Gottesglaube im Judentum, Christentum und Islam
(Schriftenreihe der Ottobeurer Studienwoche 3), Leutesdorf 2002, von: Alfred Bodenheimer und Gerhard Langer
Menschenrechte und Menschenwürde in der rabbinischen Literatur, in: Jahrbuch für Biblische Theologie 15
(2000), 67-92, von: Gerhard Langer
http://www.zum.de/Faecher/Eth/SA/stoff6/juden_feste.htm
Zwischen Duldung und Verfolgung. Das Schicksal der Juden im christlichen Spanien, in: Rainer Kampling/Bruno
Schlegelberger (Hg.), Wahrnehmung des Fremden… Berlin 1996, von: Mariano Delgado
in: Günter Stemberger (Hg.), Die Juden. Ein historisches Lesebuch, München 1990, von: Heinrich und Marie Simon
von: Gerhard Langer
Grundkurs Judentum
Kabbala
Der Zionismus
von: Gerhard Langer
Kalischer, Alkalai, Achad ha-Am, Herzl, aus: Profile des Zionismus. Die geistigen Ursprünge des Staates Israel,
Gütersloh 1998, von: Shlomo Avineri
Stichworte zum Judentum in den Anfängen
Perserreich: Juda als persische Provinz
Autonomie
Schriften wie die Tempelrolle entstehen als „Ergänzung zur Tora“, die in Qumran tradiert, aber nicht in den Kanon kamen
Tora als Grundgesetz (Pentateuch)
Tempel als politisches und religiöses Zentrum
Hohepriester als Oberhaupt – kein König (loyal zu Persien)
Judentum als ethnische Gemeinschaft mit kultureller Identität, die auf der Tora beruht: Feierliche Proklamation der Tora (Neh 9-10): Bundeserneuerung -Rückbezug auf Israel
Esra als Schriftgelehrter (Esr 7,6)
Etwa 100.000 Juden
Ptolemäische Herrschaft (ab 301v.)
Septuaginta entsteht als Übersetzung der Tora „für“ Ptolemaios II. Philadelphos 382-246v.
Seleukidesche Herrschaft (ab 198v.)
Autonomie gefährdet
Hellenistisches System angestrebt
Tempel geschändet
Religiöse Aktivität unterbunden
Aber auch Hinweise auf Attraktivität der hellenistischen Kultur
Judentum als religiöse Bekenntnisbewegung
Beschneidung, Sabbat und Feste haben besondere Bedeutung
Apokalyptische Bewegungen entstehen: Hoffnung auf radikale Änderung der politischen Verhältnisse, Geschichtsbruch
Weisheitsliteratur an der Blüte: Bewältigung des Daseins
Ideal des Schriftgelehrten (Sira)
Abgeschlossener Kanon der Prophetenschriften
27
Grundkurs Judentum
Makkabäer (ab 167v.)
Kriegerisch in Guerillakrieg zuerst Autonomie, dann Unabhängigkeit erzwungen
Tempel als religiöses Zentrum 164v.wieder eingeweiht: Chanukka
Hasmonäerreich
Staatliche Unabhängigkeit
Hellenistische Verfassung des Staates
Übernahme der Ethnarchen-, Hohepriester- und Feldherrnwürde (Strategos) (Simon): Verbindungen zu Rom und Sparta („Verwandtschaft“: 1
Makk 12)
Unter Johannes Hyrkan I. (135/34-104) Königsherrschaft
Widerstand der „Frommen“ gegen diese Ämterkumulation
Apokalyptische Bewegungen stark: Periodisierung der Geschichte, Zusatzoffenbarung wichtig sog. zwischentestamentliche Literatur (besser: Jüdische Schriften aus hellenistisch-römischer Zeit) beginnt: Henoch, Jubiläen, Testamente der 12
Patriarchen...
Vergrößerung des Staatsgebietes; Hegemonie
Bürgerkrieg um die Frage des Vorrangs vor politischer oder kulturell/religiöser Identitätsausprägung
Pharisäer und Sadduzäer erscheinen
Diasporazentren: Alexandrien
(500.000? Juden – 1/3 der Bevölkerung)
Rom
Diaspora:
Nützt die Wirren zur politischen Einflussnahme
Alexandrien Bestrebungen nach Polisbürgerrechten und Privilegien
63v. Einzug des Pompeius in Jerusalem
Gleichzeitig Bindung an Judäa
Verbündeter Rom wurde als neutraler Garant der Unabhängigkeit
missverstanden
Globale Interessen Roms, Erweiterung und Sicherung der Grenzen;
politisches Interesse an der Region
Zerschlagung des Hasmonäerstaats
Einsetzung des Herodes (37-4): König (rex socius)
Tempelbau als Zeichen seines „jüdischen“ Selbstverständnisses;
messianisches Symbol
Vier herodianische Nachfolgestaaten
6n. Judäa Prokuratur
Judäa Quelle persönlicher Bereicherung der Prokuratoren
Philo von Alexandrien
28
Grundkurs Judentum
Rom als Schutzmacht der Juden
Konflikte mit Griechen und Ägyptern
Herodesenkel Agrippa in Alexandrien gefeiert (37/38), erbost Nichtjuden: sie erheben einen schwachsinnigen Bettler zum „König der
Juden“ und kreuzigen ihn dann.
Caligula lässt Kaiserstauen in den Synagogen aufstellen
Rom lässt schließlich die Juden in einem Stadtviertel zusammenpferchen,
Besserung unter Claudius
Aufstand 66n. begründet im Autonomiestreben
Aber auch große innere Uneinigkeit über Umgang mit Rom
Vor 70n. etwa 7 Mio. Juden, 2,5 Mio. in Palästina
70n. Zerstörung des Tempels unter Vespasian und seinem Sohn
Titus
600.000 Tote (1/4 der Juden Palästinas)
Legende um Jochanan ben Zakkai
Konstitution des rabbinischen Judentums in Jabne bei Jaffa
Werke des Flavius Josephus (70-93)
Diaspora: Negative Folgen des verlorenen Krieges, vor allem in Antiochien; viele Kriegsgefangene wurden freigekauft; 115-117 Diasporaaufstände
132-135 Bar Kokhba Aufstand in Palästina
Jerusalem für Juden nach verlorenem Krieg verboten (Aelia capitolina in Iudaea capta)
29
Grundkurs Judentum
Der Jude Jesus
Gerhard Langer
Der Jude Jesus
Noch immer konzentriert und reduziert sich das Interesse am Judentum in christlichen Kreisen vor allem auf die Rolle Jesu und seine Zeit bzw. auf
die damit verbundene Frage nach dem Messias.
Noch immer werden die Fragen an die jüdische Religion nicht aus deren Selbstverständnis heraus gestellt, sondern aus dem Fragehorizont des
christlichen Glaubens. Dies bedingt, dass systematisch-theologische Fragestellungen und christologische Deutehorizonte den Rahmen vorgeben.
Nur wenige Christen wollen sich mit der Entwicklung des Judentums nach dem Neuen Testament auseinandersetzen.
Interesse besteht maximal an folkloristischen oder esoterischen Elementen.
Dies bedingt, dass ein starkes Defizit im Wissen über das Judentum besteht, ganz besonders im Hinblick auf Literatur, Theologie und zeitgenössische Strömungen.
Eine an meinem Institut durchgeführte Umfrage zum Thema Sensibilität für Anitjudaismus unter Seelsorgerinnen und Seelsorgern in Salzburg, OÖ
und Wien hat im letzten Jahr ein erstaunliches Ergebnis gebracht. Es fiel auf, dass die Priester und LaienmitarbeiterInnen in der Kirche in überzeugendem Maß die seit dem Zweiten Vatikanum angebrochene Wende hin zu einem Dialog mit dem Judentum weitgehend angenommen haben.
Die traditionell antisemitischen Stereotype, etwa die Schuld der Juden am Tod Jesu oder ein „typisch jüdischer“ Umgang mit Geld bestehen heute
praktisch nicht mehr. Fast einhellig wurde der Aussage zugestimmt, das Christentum sei ohne seine jüdische Wurzel undenkbar, mit überwältigender Mehrheit wurde auch die Bedeutung des christlich-jüdischen Dialogs für einen persönlich und für die Kirche herausgestrichen.
Doch im Detail, dort wo es um die theologischen Konsequenzen aus dieser Neubewertung des Judentums geht, gibt es noch genügend Aufgaben
für Bewusstseinsbildung in innerkirchlicher Aus- und Fortbildung. Mehr als zwei Drittel der Befragten sehen einen Gegensatz zwischen dem „Liebesgebot Jesu“ und dem „Gesetzesgehorsam“ des Alten Testaments, fast die Hälfte ist der Meinung, die Kirche des Neuen Testaments hätte Israel als Gottesvolk abgelöst. Rund ein Viertel meint, der Bund Gottes mit Israel wäre aufgehoben und versteht das Alte Testament nur als Vorstufe
des Neuen. Der Gedanke der Enterbung des Judentums, durch den der Glauben Israels in Jesus und durch die Kirche überboten, vollendet und
abgelöst wird, ist noch weit verbreitet.
Dabei ist gerade uns Katholiken die Kenntnis und die Auseinandersetzung mit dem zeitgenössischen Judentums aufgetragen. Das Zweite Vatikanum hat mit dem 4. Artikel seiner Erklärung „Nostra aetate“ einen Meilenstein in der Neubesinnung zum Judentum gesetzt und darin geschrieben:
»Bei ihrer Besinnung auf das Geheimnis der Kirche gedenkt die Heilige Synode des Bandes (vinculum), wodurch das Volk des Neuen Bundes mit
dem Stamme Abrahams geistlich verbunden ist«.
Das heißt: Indem und wenn die Kirche sich auf ihr ureigenes Geheimnis besinnt, stößt sie unweigerlich auf ihre Bindung zum Judentum. Um es mit
den Worten Johannes Pauls II. (aus seiner Rede in der Synagoge von Rom) zu sagen: »Die jüdische Religion ist für uns nicht etwas `Äußerliches´,
sondern gehört in gewisser Weise zum `Inneren´ unserer Religion. Zu ihr haben wir somit Beziehungen wie zu keiner anderen Religion. Ihr seid
unsere bevorzugten Brüder und, so könnte man gewissermaßen sagen, unsere älteren Brüder.« Das Gespräch der Kirchen mit den Juden und mit
der jüdischen Tradition ist als konstitutives Element kirchlichen Lebens ein Akt der Rückkehr zu den Wurzeln – und eine Suche nach Weggemeinschaft mit dem zeitgenössischen Judentum. Wer hier oberflächlich, unverständig oder zynisch von theologischem Philosemitismus reden oder nur
30
Grundkurs Judentum
Der Jude Jesus
das schlechte Gewissen der Kirchen am Werk sehen würde, hätte die Tiefendimension des Bandes nicht erfasst, das die Kirche und das Judentum unauflöslich verbindet, denn das Konzil gebraucht mit Band »vinculum« einen Begriff des Eherechts und drückt darin die Unverbrüchlichkeit
und Dauerhaftigkeit dieser Verbindung aus. Die katholische Kirche ist »zum Dialog mit der jüdischen Gemeinschaft verpflichtet«, wie Johannes
Paul II. am 28. Oktober 1985 vor den Teilnehmern der Jahresversammlung der internationalen Kommission für die Beziehungen zwischen der katholischen Kirche und dem Judentum formulierte. Der wohl derzeit profilierteste Bibliker des deutschsprachigen Raums, der Münsteraner Erich
Zenger spricht in diesem Zusammenhang von der bleibenden Verbundenheit des Christentums mit dem Judentum, was mehr ist als nur die Besinnung auf die Wurzel. Die bleibende Verbindung fordert uns daher auf, uns mit dem derzeit lebenden und pulsierenden Judentum auseinander zu
setzen, von ihm zu lernen und mit ihm zu kommunizieren.
In diesem Bewusstsein müssen wir die Frage nach der Religion Jesu heute als eine Frage nach der jüdischen Identität stellen, die unsere christliche prägt. Wir bekommen sie nicht mehr, indem wir unsere Augen vor dem lebendigen Judentum verschließen, das mit Jesus gerade nicht zu existieren aufgehört hat. Ganz im Gegenteil. Erst nach Jesus hat die Religion des Judentums jene prägende Entwicklung erfahren, die sie heute
prägt. Der Ur- und Wurzelgrund aber ist das Alte oder besser Erste Testament:
Diesem Ersten Testament will ich kurz Aufmerksamkeit widmen.
Es sollte selbstverständlich sein, dass Jesus keine andere Bibel hatte als das sog. Erste Testament. Er nannte es wie auch die überwiegende
Mehrzahl der im sog. Neuen Testament vertretenen Schriftsteller schlicht die Schrift oder auch „Gesetz und Propheten“, womit die beiden großen
Teile der jüdischen Bibel gemeint sind. Lk 24,44 nimmt noch die Psalmen hinzu, wodurch der dritte große Kanonteil, die Schriften anklingt. Jesus
verwendet diese Schrift als seine Bibel in all seinen Argumentationen. Sie ist ihm tief vertraut. Selbst gegenüber dem Satan argumentiert er nur mit
ihr (Mt 4). Und er kann schon einmal seinen Gegnern sagen, dass sie im Gegensatz zu ihm die Schrift nicht kennen (Mk 12,23). Lk 4,16 zeigt uns
Jesus als schriftgelehrten toratreuen Juden, der zur Vorlesung in der Synagoge aufgerufen wird: „So kam er auch nach Nazaret, wo er aufgewachsen war, und ging, wie gewohnt, am Sabbat in die Synagoge. Als er aufstand, um aus der Schrift vorzulesen, reichte man ihm das Buch des
Propheten Jesaja.“
Das Evangelium bemüht sich vielfach, Jesus als gläubigen Juden darzustellen. Mehr noch, den großen Vätern war es geradezu selbstverständlich,
Jesus als einen gesetzestreuen Juden vorzustellen. Der keineswegs judenfreundliche Johannes Chrysostomus etwa berichtet gleich von einer
dreifachen Erfüllung des Gesetzes durch Jesus. Jesus habe es nie übertreten, es durch den Sühnetod bestätigt und mit den matthäischen Antithesen sogar vertieft.
Johannes von Damaskus behauptet, dass Christus das Gesetz erfüllte, indem er sich beschneiden ließ, die Sabbate hielt und all die Wundertaten
vollbrachte, von denen die Schrift zeugt. Und der große Thomas von Aquin lässt Jesus sogar siebenfach das Gesetz erfüllen. Diese positive Betrachtung des Gesetzes in der Kirchengeschichte hatte allerdings einen nicht zu unterschätzenden Haken.
Ausgangstext all dieser Betrachtungen ist die Bergpredigt. In ihr heißt es unmissverständlich:
Mt 5,17 Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um zu
erfüllen. 18 Amen, das sage ich euch: Bis Himmel und Erde vergehen, wird auch nicht der kleinste Buchstabe des Gesetzes vergehen, bevor
nicht alles geschehen ist.
31
Grundkurs Judentum
Der Jude Jesus
Die christliche Auslegung hat ihren Schwerpunkt vor allem auf das griechische ouvk h=lqon katalu/sai avlla. plhrw/sai gelegt. Man verstand diese
plhrw/sai fast allgemein als „erfüllen, vollenden“ im Sinne eines qualitativ Neuen, etwa: „Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern zu vervollkommnen“. Darin sah man die Vollendung des von Haus aus unvollkommenen Gesetzes angelegt. Origenes sprach von der Entwicklung des
Gesetzes analog zur Entwicklung eines Kindes zum Mann, wobei das Kind zwar verwandelt, aber nicht zerstört wird. Dem Gesetz würde durch
Jesu die Gnade zur Vollkommenheit hinzugefügt. Johannes Chrysostomus meinte, Christus hätte die Rechtfertigung aus Glauben eingeführt und
so den Zweck des Gesetzes erfüllt. Auch Irenäus spricht von einem Mehr, das Jesus bringt, in dem er Glaube und die Ausdehnung des Geltungsbereichs des Gesetzes von der Tat auf die Begierde bringt.
Der Haken in der Auslegung liegt also genau in dem Umstand, dass die Erfüllung des Gesetzes durch Jesus mit einer Überhöhung und Neudeutung des Gesetzes verbunden wurde. Es finden sich kaum Spuren einer Interpretation, in der betont würde, dass Jesus das Gesetz in seinem Leben gehalten und in seinen Reden bestätigt habe. Doch genau das war in der Bergpredigt ausgesagt worden. Der Jude Jesus lebte und handelte
nach der Weisung, die er wie all seine Zeitgenossen im Text der hebräischen Bibel fand.
Anders als die alten Kirchenväter haben die Reformatoren allerdings Mt 5,17 gerade nicht als Vervollkommnung des Gesetzes gelesen. Sie meinten vielmehr, Jesus habe das Gesetz dadurch vervollkommnet, dass er es ausgelegt habe. „Ich will nicht ein ander odder new gesetz bringen, sondern eben die schrifft, so jr habt, nehmen und recht ausstreichen und also handeln, das jr wiset, wie mans halten sol“, meinte Luther in WA 32,
356. Diesem Grundverständnis könnte freilich auf den ersten Blick auch jeder Jude zustimmen. Denn gerade darin besteht ja das jüdische Verständnis der Schrift, dass sie immer und über alle Generationen hinweg neu gedeutet und interpretiert werden muss. Ich will Ihnen dazu eine Geschichte erzählen (aus Talmud bMQ 59ab):
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
32
Man hat gelehrt:
An diesem Tag „äußerte R. Eliezer alle Einwendungen, die es auf der Welt gibt, und man nahm sie von ihm nicht an.
Er sagte zu ihnen: Wenn die Halakha meiner Position entspricht, so möge dies jener Johannisbrotbaum erweisen!
Da entwurzelte sich der Johannesbrotbaum (und bewegte sich) 100 Ellen von seinem Platz fort. Manche sagen: 400 Ellen.
Sie sagten zu ihm: Man entnimmt keinen Beweis von einem Johannisbrotbaum!
Er redete erneut zu ihnen: Wenn die Halakha meiner Position entspricht, so möge dies der Wasserkanal erweisen!
Da floss der Wasserkanal rückwärts.
Sie sagten zu ihm: Man entnimmt keinen Beweis von einem Wasserkanal!
Er redete erneut zu ihnen: Wenn die Halakha meiner Position entspricht, so mögen dies die Wände des Lehrhauses erweisen!
Da neigten sich die Wände des Lehrhauses um einzustürzen.
Da herrschte sie R. Jehoschua an, und er sagte zu ihnen: Wenn die Gelehrten sich gegenseitig in der Halakha besiegen, was kümmert es
euch?!
Da fielen sie nicht um wegen der Ehre des R. Jehoschua und stellten sich auch nicht auf wegen der Ehre des R. Eliezer und stehen bis jetzt
geneigt.
Er redete erneut zu ihnen: Wenn die Halakha meiner Position entspricht, so möge sich dies aus dem Himmel erweisen!
Da erklang eine Bat Qol (Himmelsstimme) und sagte: Was habt ihr gegen R. Eliezer? Die Halakha ist wie er in jedem Fall.
Grundkurs Judentum
Der Jude Jesus
N
Da stellte sich R. Jehoschua auf seine Füße und sagte: SIE IST NICHT IM HIMMEL! (Dtn 30,12)
O
P
Warum (heißt es): Sie ist nicht im Himmel?
Es sagte R. Jeremja, dass die Tora schon am Sinai gegeben wurde. Wir achten nicht auf die Bat Qol, denn Du hast schon geschrieben am
Berg Sinai in die Tora: Nach der Mehrheit (ist) zu entscheiden (Ex 23,2).
Es traf R. Natan Elija. Er fragte ihn: Was tat der Heilige, gepriesen sei Er, in dieser Stunde?
Er sagte ihm: Er lächelte und sagte: Meine Kinder haben mich besiegt, meine Kinder haben mich besiegt!
Q
R
Das zitierte Beispiel zeigt sehr schön, dass die jüdische Tradition Exegese, also Bibelauslegung, in das grundsätzliche Verständnis von Text verankert. Niemand versteht Schrift, der sie nicht auslegt.
Kehren wir wieder zu Jesus zurück. Wenn wir uns einig sind, dass er in seinem Verständnis von Tora, von göttlicher Weisung, als Interpret auftritt,
dann ist zu fragen, worin das spezifisch Jesuanische etwa in den Antithesen liegt. Lassen Sie mich dazu kurz auf die Bergpredigt zurückkommen
und den Text betrachten, der den Antithesen vorausliegt. Dort heißt es:
Mt 5,20 Darum sage ich euch: Wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist als die der Schriftgelehrten und der Pharisäer, werdet ihr nicht in das
Himmelreich kommen.
Was wird hier gesagt? Entscheidendes, will man Jesu Verhältnis zu seiner jüdischen Welt verstehen, und ich spreche bewusst von Welt und nicht
von Umwelt, da er selbst Teil dieser Welt ist. Jesus sagt. Die Gerechtigkeit seiner Anhänger muss noch größer sein als die der Schriftgelehrten
und Pharisäer. Zum einen markiert es das Hauptanliegen der Bergpredigt und damit der Lehre Jesu überhaupt, Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist das
alles verbindende Stichwort der Botschaft vom Gottesreich. Jesus meint nun gerade nicht, dass Schriftgelehrte und Pharisäer ungerecht wären
oder nichts von der Gerechtigkeit verstünden. Vielmehr das Gegenteil ist wahr. In seinen Augen sind sie die Experten im Hinblick auf die Gerechtigkeit. Sie erkennen den Willen Gottes, sie deuten die Schrift und sie verstehen das Wort Gottes der jeweiligen Generation so auszudeuten, dass
sie im Tun der Gerechtigkeit erlebbar wird. Jesu Jünger, also wir, müssen diese Experten noch übertreffen. Die Antithesen zeigen, worin dieses
Übertreffen geschieht. Ich gehe in meinem Vortrag nicht auf die Antithesen ein, dass würde den Rahmen sprengen. Ich will nur ein paar Missverständnisse ausräumen.
Missverständnis eins: Jesus tritt in den Antithesen gegen das Alte Testament auf.
Das ist falsch. Er nimmt etwa im Beispiel Feindeshass Themen auf, die alttestamentlich nicht belegt sind. Jesus konzentriert sich aber in den Beispielen an den drei Kardinalgeboten des Judentums, die auch für Christen verständlich sind, nämlich sexuelle Vergehen, Mord und natürlich Götzendienst.
Missverständnis zwei: Jesu übertrifft in den Antithesen herrschendes jüdisches Recht.
Das ist falsch. Zu jedem einzelnen der Themen, die Jesus vorgibt, lassen sich Beispiele und Zitate in der Literatur des Judentums finden. Ich erinnere als Beispiel für die Rede vom Hinhalten der Backe nur an den markanten Spruch in BQ 89b: Wenn dein Genosse dich einen Esel nennt, binde dir einen Sattel um. Die jüdische Ethik hat die Bestimmungen des ersten Testaments regelmäßig verfeinert und beständig humanisiert. Gerade
die rabbinische Literatur zeichnet sich durch ein hohes Maß an Humanismus aus. Hier finden sich massive Ansätze zur Gesinnungsethik ebenso
wie auch die Bereitschaft, nicht mehr passende Regelungen aufzuheben. Inhaltlich steht also die jüdische Tradition den Vorstellungen Jesu in
nichts nach.
33
Grundkurs Judentum
Der Jude Jesus
Missverständnis drei: Jesus hebt mit dem Liebesgebot als Hauptgebot das jüdische Gesetz auf.
Betrachtet man die Bergpredigt, fällt auf, dass sie in einem konzentrischen Aufbau um das Vaterunser als Mitte kreist. Umrahmt wird das Vaterunser mit den Regeln zum Almosengeben, Beten und Fasten, den Anithesen und der Sorge um das Reich Gottes und schließlich dem Hinweis auf
die dauerhafte Geltung aller Gebote und der Goldenen Regel:
12 Alles, was ihr also von anderen erwartet, das tut auch ihnen! Darin besteht das Gesetz und die Propheten.
Diese Goldene Regel steht also auf einer Ebene mit den Geboten, die alle ihre Geltung besitzen. Jesus hat hier Anteil an einer Diskussion, die das
Judentum ebenfalls führte, und die einige Zeit nach Jesus zu einer interessanten Kontroverse führte. Man diskutierte nämlich über die Frage, ob
es Gebote in der Bibel gäbe, welche das Zentrum der Gebote überhaupt darstellen, also ein Hauptgebot bildeten. Manche Rabbinen verbaten sich
diese Diskussion und meinten, alle Gebote seien gleich wichtig. Dies würde Jesu ersten Statement entsprechen. Daneben gab es andere Rabbinen bzw. eine gewisse Schwerpunktsetzung, die auf die drei Hauptgebote Götzendienst, Unzucht und Mord abhob. Dies würde sich in den Antithesen angedeutet finden. Und wieder eine andere Linie der rabbinischen Diskussion suchte nach griffigen Grundregeln, die alle Gebote in sich
vereinigen konnten. Dazu gehört die goldene Regel oder das Liebesgebot. Die goldene Regel wird bekanntlich von R. Hillel einem jungen Mann
empfohlen, der ihn fragt, ob er die Grundlage der Tora kennenlernen könne, während er auf einem Bein steht. Hillel nennt ihm die goldene Regel.
Vielleicht noch eindrucksvoller ist der Text bMakkot 23b-24a, ein Talmudtext. In ihm wird über mehrere Etappen argumentiert, dass die ursprünglich 613 Gebote und Verbote im Laufe der Zeit auf ihre Mitte hin befragt wurden. Es treten auf: David, Jesaja, Micha, Jesaja, Amos und schließlich
Habakuk. Jeder von ihnen reduziert die Gebote auf einige wenige zentrale. Am Schluss bleibt ein Gebot über, das Habakuk definiert. Es heißt,
Hab 2,4b: „Der Gerechte wird aus dem Glauben leben“. Glauben meint dabei im Kontext der hebräischen Bibel Vertrauen auf den sich offenbarenden Gott, auch gegen die momentan konkrete Wirklichkeit von Leid und Unterdrückung.
Hierin sieht dieser Talmudabschnitt das Zentrum der Tora, das Zentrum des Gesetzes. Ich will diese Stelle nicht weiter auslegen und darf ganz
„eitel“ auf einen Artikel von mir verweisen, der ausführlich auf den Text eingeht.
Ich möchte die Stelle aber als Beispiel dafür sehen, dass jüdische Theologie und Gesetzesbetrachtung weit über einen mit Vorurteilen belasteten
Rigorismus hinaus geht. Die Suche nach einer Mitte der Tora war dem Judentum in keiner Weise fremd. Gerade die Schwerpunktsetzung auf Gerechtigkeit und Glaube im genannten Text beweist, dass zwischen Teilen der jüdischen Auslegung und dem von Jesus vertretenen Grundsätzen
mehr als nur Parallelen bestanden.
Aus der Bergpredigt lernen wir weiters, dass es Jesus vor allem und zuerst um das Himmelreich ging, das jeder Mensch erlangen kann, indem er
gerecht handelt. Das Tun steht im Vordergrund, nicht das Fürwahrhalten von Sätzen. Darum wird man die Gerechten auch nicht an ihren Beteuerungen erkennen, sondern an ihren Früchten. Die im Tun erlebte Gerechtigkeit setzt die Gebote Gottes in die Praxis um. Im Zentrum der Bergpredigt steht das Vaterunser: Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Beides gehört zusammen. Das Reich Gottes wird eintreten wenn Gottes Wille,
wenn sein Gesetz geschieht.
Ich will ein paar Beobachtungen im Hinblick auf den Juden Jesus hier zusammenfassen:
Wie dem Judentum allgemein geht es Jesus in seiner Botschaft um Gott und die Durchsetzung seiner Herrschaft.
Wie dem Judentum allgemein zeigt sich die Bedeutung des Willens Gottes in der Praxis eher als in der Theorie.
Jesus fühlt sich nicht zu den Heiden gesandt, sondern zu Israel. Jesus meidet die griechisch-römischen Ballungszentren und umgibt sich mit der
konservativ-jüdischen Mittel- und Unterschicht. Er erwählt zwölf Jünger in Anlehnung an die zwölf Stämme, um Israel zu erneuern. Er erhält schon
34
Grundkurs Judentum
Der Jude Jesus
von seiner Mutter den programmatischen Namen Jesus, der nichts anderes als „Retter“ bedeutet. War schon sie von seiner Aufgabe überzeugt
und ehrgeizig?
Pharisäer und Schriftgelehrte stehen Jesus in ihren Grundhaltungen am nächsten. Die Texte zeigen, dass er große Schwierigkeiten im Umgang
mit der herrschenden Nomenklatura, den Tempeloberen und sog. Sadduzäern hatte. Sowohl politisch als auch theologisch steht er dieser hellenistisch ausgerichteten Oberschicht mit äußerster Skepsis gegenüber.
Auch wenn wir über die sog. Pharisäer nach der bestehenden Quellenlage wenig ausmachen können, lässt sich mit aller Vorsicht sagen, dass er
sich wohl selber keiner der Gruppen zugeordnet fühlte.
Unbestritten sah er sich selbst in einer Phase der anbrechenden Endzeit. Unbestritten sah er sich in diesem Zusammenhang in einem absoluten
Naheverhältnis zu Gott, das seiner Botschaft eine Autorität verlieh, die der Autorität späterer Rabbinen überlegen zu sein scheint. Hier ist vielleicht
spezifisch Jesuanisches auch in den Antithesen der Bergpredigt zu finden. Jesus lehrt nichts Neues, aber sein Umgang mit der Schrift zeigt, dass
die Autorität, mit der er die Auslegung zum eigentlich verbindlichen Schriftzeugnis macht, eine bloße Paränese weit übersteigt. Anders als die
Rabbinen stellt er sich auch nicht in einen Diskurs, sondern lehrt autoritativ. Seine Auslegung ist die einzig richtige. Im Kontext rabbinischen Denkes hätte ihm solche „Präpotenz“ wohl „den Lehrstuhl gekostet“.
Aber Jesus ist eben weder Rabbi noch Schuloberhaupt. Wenn man ihn irgendwelchen Gruppen zuordnen möchte, so eignet sich im Prinzip nur
eine Bewegung wirklich, auf die der ungarisch-englische jüdische Historiker Geza Vermes in seinem bahnbrechenden Buch „Jesus der Jude“1 hingewiesen hat, die Charismatiker.
Durch Geza Vermes ist in der jüngeren Forschung die Bedeutung der charismatischen Frommen für ein Verständnis der historischen Person Jesu
besonders hervorgehoben worden. Diese in den rabbinischen Schriften und auch bei Flavius Josephus bezeugten Menschen waren zumeist freidenkende Fromme, die sich durch Wundertaten und Heilungen auszeichneten. Ein bekannter Vertreter dieser Gruppe ist Choni/Onias, der etwa
90-68v. als Beter und Wundertäter aktiv war.
Schon bei Josephus, und noch mehr in der Mischna Taanit, wird deutlich, dass Choni als von Gott besonders Geliebter galt. Sein
Gebet bewirkt Regen. Er selbst weiß sich in einem besonderen Kindschafts-Verhältnis zu Gott stehend, das sich von jenem der Israeliten unterscheidet. Nach der Mischna ist er der Haussohn, ja das Hätschelkind (vgl. Prov 8,30), das sich alle möglichen Ungehörigkeiten seinem Vater gegenüber erlauben kann. Diesen kindlichen Gottesbezug schmückt die babylonische Gemara noch weiter aus. Choni habe zu Gott „Abba“ gesagt und sei ähnlich familiär mit ihm umgegangen wie ein verwöhntes Kind... wird darauf
hingewiesen, dass das Beten um Regen eine Tradition sei, die auf die Propheten Elia (vgl. 1Kön 18) und Habakuk (Hab 2,1) zurückgehe. Choni war also vielleicht ein Einzelgänger seiner Zeit, er stand aber durch sein Beten und Wunderwirken in einem bis
zum Propheten Elia zurückreichenden Traditionszusammenhang.2
Neben Choni ist vor allem Chanina ben Dosa bekannt und ein Enkel Chonis, Abba Chilkija sowie Chanan Hannechba, der einmal um Regen angefleht wurde:
1
2
Jesus der Jude. Ein Historiker liest die Evangelien. Übers. von Alexander Samely. Bearb. von Volker Hampel, Neukirchen-Vluyn 1993 . - XII, 282 S. . - ISBN: 3-7887-13739.
Clemens Thoma, Das Messiasprojekt, Theologie jüdisch-christlicher Begegnung, Augsburg 1994, 310f.
35
Grundkurs Judentum
Der Jude Jesus
Abba, Abba, gib uns Regen! Da sagte er vor dem Heiligen, gepriesen sei Er: Herr der Welt. Tue es um jener willen, die nicht zwischen einem Abba unterscheiden können, der Regen gibt, und einem Abba, der keinen Regen gibt (bTaan 23a).
Ihr Verhältnis zu Gott hatte ihr Vorbild im Verhältnis des Kleinkindes zum Vater. Ihre Frauen spielten in ihrem Leben eine angesehene Rolle. Ihr Wunderwirken war immer schon zum Voraus von großer Zuversicht, dass die Erfüllung von Gott gegeben werde,
geprägt. Ihre eschatologische Erwartung war auf den heiligen Geist als den Bewirker der Auferstehung und Neugestaltung ausgerichtet, ihr „Messias“ war Elia, der bei der Auferstehung der Toten Hilfsdienste leisten werde. (Thoma 314f.)
Von Choni berichtet Josephus in Ant 14,22ff. übrigens, dass er von einer aufgebrachten Menge gesteinigt worden sei, weil er sich weigerte, politisch für eine Seite aktiv zu sein. Auch wenn dieses Bild dem eher verklärten der rabbinischen Literatur widerspricht, zeigt es doch erneut Parallelen zum gekreuzigten Jesus.
Chanina soll übrigens zum Verdruss seiner Frau in völliger Armut gelebt haben und zeigte wie auch die anderen Frommen Desinteresse an rituellen und rechtlichen Fragen.
Neben dem vertrauten Umgang mit Gott, der Sohnschaft, dem Wundertun, verbindet auch noch die besondere Heilkraft Jesus mit diesen frühen
Frommen. Vor allem die Verbindung der „Sohn Gottes“-Rede mit den Exorzismen Jesu sind hier typisch. Für den antiken Exorzismus gehört ein
Redeverbot zum „Standardrepertoire“. Gemäß der Vorstellung, dass die Krankheit Folge von Sünde sein konnte, war der Exorzist und Heiler nicht
zuletzt berufen, die Sünde zu vergeben. In einem stark beschädigten Fragment aus Höhle 4 in Qumran fand man das sog. Gebet des Nabonid,
einer Erzählung, die von Dan 4 inspiriert war, und in der es heißt:
Ich war mit einem bösen Geschwür sieben Jahre lang geschlagen... und ein gazer vergab mir meine Sünden. Er war ein Jude von
den Söhnen Judas und sagte: Schreibe dies auf, um den Namen des höchsten Gottes zu rühmen und zu erheben.3
Der „Gazer“, wohl ein Exorzist, hat Sündenvergebung vorgenommen. Damit scheint er auch die Krankheit zu besiegen. Dieser Beleg mag Jesu
Heilungen, in denen auch die Sündenvergebung eine Rolle spielt, in einem neuen Licht erscheinen lassen, die es nicht zwingend notwendig
macht, ihn aus dem jüdischerseits Möglichen und Denkbaren herauszunehmen:
Ihr sollt aber erkennen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf Erden Sünden zu vergeben. Und er sagte zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm deine Tragbahre und geh nach Hause! (Mk 2,10f.)
Weiters sei daran erinnert, dass die großen Vorbilder der wundertätigen Heilung im Ersten Testament auch die ersten großen Propheten waren,
nämlich Elija und Elischa, womit sich wieder der Kreis zwischen Prophetie und jesuanischem Wirken enger schließt.
Die jüdische Literatur, schon die zwischentestamentliche, hat aber auch anderen wichtigen Personen der Bibel Heilkompetenz zugeschrieben, so
Abraham (Genesisapokryphon) oder auch Mose (Artapanus), der der Legende nach den Pharao von den Toten auferweckt. David ist Exorzist und
hat Macht über die Teufel. Somit ist Jesus in guter Gesellschaft.
Alles in allem mag bislang dieser Ausflug genügen, um Jesus im Lichte der Zeit und vor allem auf dem Hintergrund der charismatischen Erweckungsbewegung zu sehen. Doch wollen wir weiter nach einem möglichen Hintergrund eines messianischen Anspruches Jesu forschen.
Der Titel „Sohn Gottes“ wird vor allem, aber nicht nur im Mund von Dämonen geäußert. Die Jünger Jesu gebrauchen ihn nur bei Mt 4,5f., als
Jesus auf dem See wandelt, hier also wiederum im Kontext einer Wunderhandlung.
Wiederum im Kontext Wunder gehört auch die hämische Aufforderung, vom Kreuz zu steigen, wenn er Sohn Gottes sei (Mt 27,40).
3
36
Vgl. J.T. Milik, Prière de Nabonide, RB 63 (1956) 407-411.
Grundkurs Judentum
Der Jude Jesus
Dämonen, Heilungen, Wunder scheinen somit die eine Seite der Rede vom Sohn Gottes zu sein, die noch keinen messianischen Anspruch beinhaltet, zumindest keinen, der über das Maß jüdischerseits möglicher Beschreibung hinausgeht. So heißt es über Chanina:
Die ganze Welt wird um meines (Gottes) Sohnes Chanina willen genährt; aber mein Sohn Chanina ist mit einem Kab Johannisbrot
von einem Sabbatvorabend zum nächsten zufrieden. (bTaan 24b)
Mk 15,39 schließlich sagt aber der heidnische Hauptmann: „Wahrlich, dieser Mensch ist Sohn Gottes gewesen!“ und bestätigt damit die große Linie des Markus, Jesus über sein Leid und seinen Tod als Messias darzustellen.
Und in den Berichten von der Taufe Jesu wird der berühmte Königspsalm 2 auf Jesus gedeutet. Zumindest in der Markus- und Lukasfassung, die
von einem persönlichen Erlebnis Jesu mit Anrede in 2. Person handeln, wird diese Berufung - und natürlich auch die eindeutig theologische und
unhistorische Verklärungserzählung - zur übernatürlichen Berufung hochstilisiert. Matthäus überliefert in der 3. Person und setzt damit ein größeres Auditorium voraus. Demnach wäre Jesus nach seiner Taufe von einer himmlischen Stimme per Adoption in seiner zukünftigen Heils- und
Wundertäterfunktion bestätigt worden. Dies muss noch immer keinen messianischen Anspruch bedeuten und steht ganz im Einklang mit jüdischrabbinischen Vorstellungen. Das ändert sich freilich durch die Geburtsgeschichten des Matthäus und Lukas, die Jesus im Sinne außerisraelitischer
Vorstellungen zu einem übernatürlichen Herrscher hochstilisieren. Ihr Ursprung scheint mir am ehesten im hellenistisch beeinflussten Ägypten zu
suchen zu sein. Ich verweise dabei auf die zahlreichen Veröffentlichungen von Manfred Görg.
Damit bin ich auch schon am Ende dieser kurzen Ausführungen zum Titel „Sohn Gottes“. Er scheint mir aufgrund der jüdischen Belege ursprünglich von Jesus wie von jüdischen Frommen ganz im Sinne einer engen und vertrauten Beziehung zu Gott verwendet worden zu sein, so wie ja Israel als „Kind Gottes“ bereits in der Bibel etabliert ist (vgl. Jer 31,9 oder Jes 64,7). Sir 51,10 heißt es in einem Gebet eines einzelnen über Gott:
„Du bist mein Vater, denn Du bist der Held meiner Erlösung“. In besonderer Weise konnte es den wundertätigen und exorzistisch wirksamen Menschen bezeichnen. In späterer Folge hat das vom Judentum losgelöste Christentum den Titel allerdings im herrschaftlichen Kontext hellenistischägyptischer Prägung auf Jesus angewendet, um diesen als Messias, als eschatologischen und präexistenten Retter einzuführen. Dazu gehörte
auch die im altägyptischen Kontext vertraute Jungfrauengeburt, die Inkarnationsvorstellung, die eine alte Adoptionsvorstellung ablöst.
Von hier aus führt der Weg zu den alten Konzilien und zu einer Vorstellung von Jesus als Christus, die das Judentum nicht mehr mittragen kann
und will. Ignatius von Antiochien schließlich kann Jesus als „unseren Gott“ bezeichnen (IgnEph 1,1).
Bevor ich in einem weiteren Schritt die Evangelien danach befragen will, ob ein und wenn welches messianische Verständnis dem historischen
Jesus gerecht werden könnte, sei noch ein kurzer Blick auf die Anklage vor dem Hohepriester gerichtet.
Mk 14,61 berichtet von der Frage des Hohepriesters an Jesus:
Bist du der Gesalbte, der Sohn des Hochgelobten? Jesus aber sprach: Ich bin´s (nach Varianten: Du sagst, dass ich's bin!)
Bei Mt 26,63f. heißt es hingegen:
Und der Hohepriester sprach zu ihm: Ich beschwöre dich... dass du uns sagst, ob du der Messias bist, der Sohn Gottes? Jesus
sprach zu ihm: Du sagst es!
Und Lk 22,67-70 läßt fragen:
Bist du der Christus, so sage es uns! Er aber sprach zu ihnen: Sage ich's euch, so glaubtet ihr es nicht... Da sprachen sie alle: Bist
du denn der Sohn Gottes? Er aber sprach zu ihnen: Ihr sagt, dass ich es bin!
Die isolierte Meinung des Markus ist hier zu betonen. Sie steht wohl ganz im Dienste seiner theologischen Absicht, Jesus angesichts des Leids als
Messias herauszustellen. Mt und Lk sehen die Antwort Jesu im Spannungsfeld zwischen ausweichender Antwort und Verweigerung, ja gar Verneinung. Nicht einmal angesichts des Todes bekennt Jesus klar, ein Messias zu sein. Pilatus gegenüber äußert er noch deutlicher ein „Du sagst
37
Grundkurs Judentum
Der Jude Jesus
es“, was Lukas eindeutig als Verneinung interpretiert und Pilatus von der Schuldlosigkeit des Menschen überzeugt sein lässt. Freilich ist hier überall Gemeindebildung zu spüren und Jesu originales Wort nicht mehr eruierbar. Dennoch kann aufgrund der konsequenten Weigerung Jesu, sich in
ein messianisches Korsett pressen zu lassen, der schroffen Zurückweisung des Petrus und der Antwort an den Hohepriester von einer hohen
Wahrscheinlichkeit ausgegangen werden, dass Jesu selbst sich nicht als Messias verstanden wissen wollte. Dies besagt jedoch nicht, dass er kein
gesundes Selbstbewusstsein und Sendungsbewusstsein gehabt hätte, in dem messianische Erwartungen eine wichtige Rolle spielten.
Messianische Perspektiven tauchen überall dort auf, wo Jesus den Ist-Zuständen den Kampf ansagt.
Allen messianischen Texten war ja gemein gewesen, dass sie mit der Situation des Jetzt unzufrieden waren und eine Veränderung in der - nahen Zukunft erwarteten. Diese Veränderung sollte vor allem mehr Gerechtigkeit und Recht für alle bieten. Sie sollte Frieden und Wohlstand sowie Gesundheit und ein Fehlen von Sünde voraussetzen. Hergestellt wird dieser Zustand fast immer von Gott selbst. Eine messianische Figur taucht dabei öfter als Garant, Stabilisator, Repräsentant dieser neuen Heilszeit auf oder hilft im besten Falle dabei mit, sie herzustellen.
Jesus nun gehört - ebenso wie die charismatischen Frommen - in mehrerer Hinsicht zu dieser Kategorie:
1) Die Berufung der Jünger als „Einsammlung der Exile“
Bereits der Prophet Ezechiel hat in 37,15-28 für die nahe Zukunft die Wiedervereinigung der 10 verlorenen Nordstämme mit Juda und Benjamin
erhofft. In 4 Es 13,1-13.25-53 wird von einer endzeitlichen Versammlung der Weltvölker gegen Jerusalem berichtet. Erst der eschatologische
Menschensohn wird diese Bedrohung verhindern helfen und sie besiegen. Mit ihm sammelt sich ein Friedensheer aus den 10 Stämmen des Nordens. Ein erneuertes 12-Stämmevolk war auch die Erwartung der frühen Rabbinen, auch wenn sie bezüglich der Erfüllung oft skeptisch blieben.
Unter dem Stichwort „Einsammlung der Exile“ (hebräisch „qibbuz galuyot“) ist diese Vorstellung Bestandteil messianischer Hoffnung geworden.
Im NT wird in Apk 7,4-8 davon gesprochen, dass alle Stämme Israels gerettet und zur Auferstehung gebracht werden. Jesus hat in dieser Hoffnung durch die Erwählung von zwölf besonderen Jüngern zeichenhaft die Wiedervereinigung des Vokes zum Ausdruck gebracht. Er hat sie damit
auch zu einem messianischen Symbol gemacht. Selbst wenn diese 12 niemals politische Funktion ausgeübt haben, so bildeten sie doch allein
durch ihr Vorhandensein eine politisch relevante Aussage. Jesus geht es um die Erneuerung des ganzen Volkes, um das Wiedererstehen eines
Israel vor Zerstörung und Untergang, um Beleben der alten Jakobstradition. Die spätere Kirche hat - beispielsweise in der oben genannten ApkStelle - die Völker als zweites Glied an das 12 Stämmevolk hinzugedacht. Bereits in Jes 49,6; Sach 2,14f. oder PsSal 17,44 gehörte ja der Zustrom der Völker zu Israel zum Zeichen der messianischen Heilszeit dazu. Sie geht christlicherseits dann durch das Ausbreiten der Botschaft im
Heidentum in Erfüllung. Jesus selbst sah sich nicht zu den Heiden gesandt. Seine direkten Ansprechpartner waren die einfachen ebenso wie die
gelehrten Juden, nicht die hellenisierte römisch beeinflusste Gesellschaft. Darum ist auch nichts davon belegt, dass Jesus seine Botschaft in den
großen galiläischen Städten verbreitet hätte, etwa in Sepphoris. Vielmehr hielt er sich in den aufstandsbereiten, religiös eher konservativen und
zumeist antirömisch gesinnten Gegenden Galiläas auf, dem Land um den See.
38
Grundkurs Judentum
Der Jude Jesus
2) Die Botschaft vom Reich Gottes
Was immer die konkrete nahe Endzeiterwartung Jesu gewesen sein mag, zweifellos hat er selbst sein Leben in den Dienst Gottes gestellt empfunden. Und er hat das Reich Gottes als Reich von Frieden und Gerechtigkeit, als Nähe Gottes unter den Menschen sich selbst in seiner Person
zur Aufgabe gemacht. Dieses Reich ist zeichenhaft unter den Israeliten anwesend, wenn Jesus Kranke heilt, Dämonen austreibt, dann ist das
Reich angebrochen.
Geza Vermes faßt zusammen:
Im Reich, wie er es sich vorstellt, gibt es keine Throne, keine Höflinge, keine himmlischen Chöre, keine Schlachten führenden Armeen mit Streitwagen, Schwertern, Lanzen. Statt dessen finden wir die Landschaften, Werkzeuge und Bewohner des galiläischen
Landes und seines vom See geprägten Lebens vor. Das Reich ist wie ein Acker. Das Reich ist wie ein Weinberg, in dem die Tagelöhner von dem Besitzer gut und sogar großzügig behandelt werden. Das Reich ist wie ein winziges Senfkorn, das zu einer Pflanze heranwächst, die derart groß ist, dass Vögel in ihren Zweigen brüten können. Oder: Jesus assoziiert das Reich mit dem Fisch,
dem Netz, dem Fang (Mt 13,47ff) und mit der Frau, die ihrem Mehl Sauerteig zusetzt, um Brot zu backen (Mt 13,33; Lk 13,20f).
Das Himmelreich gehört den Kindern und denen, die ihnen gleichen, den Demütigen und denen, die Vertrauen haben (Mt 18,3f;
Mk 10,13ff par). Es gehört den Armen, während es für Reiche schwieriger ist hineinzukommen als für ein Kamel, durch ein Nadelöhr zu gehen; hineinzugelangen ist für sie also unmöglich. (242)
3) Die Umkehr als Aufruf Jesu
Die große Chance des ersttestamentlichen Menschen vor Gott bestand in der Möglichkeit der dauerhaften Umkehr, der teschuba. „Kehrt um, denn
das Himmelreich ist nahe herangekommen“ sagt Jesus Mk 1,15 und Mt 4,17. Demnach ist es von geringer Bedeutung, wann das Reich kommt
und in welcher Naherwartung die Jünger Jesu konkret lebten. Vielmehr soll sich jede Person angesichts des Nahens Gottes besinnen und umkehren. Dieser Aufruf entspricht ganz und gar der prophetischen Funktion, die bei der Betrachtung der Person Jesu mehr und mehr an Gestalt gewinnt.
Habt ihr nicht im Gesetz gelesen, dass am Sabbat die Priester im Tempel den Sabbat entweihen, ohne sich schuldig zu machen?
Ich sage euch: Hier ist einer, der ist mehr als der Tempel (Mt 12,5f.).
Die Männer von Ninive werden beim Gericht gegen diese Generation auftreten und sie verurteilen; denn sie haben sich nach der
Predigt des Jona bekehrt. Hier aber ist einer, der ist mehr als Jona.
Die Königin des Südens wird beim Gericht gegen diese Generation auftreten und sie verurteilen, denn sie kam vom Ende der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Hier aber ist einer, der mehr ist als Salomo (Mt 12,41f.).
In diesem von Matthäus gezeichneten Portrait des Jesus von Nazaret ist er mehr als der Tempel (2 Makk 5,19). Das beweist Jesus durch sein Auftreten als Sabbathalakha-Interpret. Man erinnert sich an die Qumranbelege, die vom kommenden Toraausleger sprechen. Er ist mehr als ein König, weil mehr als Salomo und schließlich mehr als Jona, der Prophet. Dabei fällt auf, dass hier zwar die drei Hauptlinien der jüdischen Erwartung,
Priestertum, Prophetie und Königtum angesprochen werden, ein besonderer Schwerpunkt aber auf dem Prophetischen liegt. Denn so wie Jona
den Typus des klassischen Propheten verkörpert, der zur Umkehr aufruft, gehört die Toraauslegung sowohl in Qumran wie auch in der rabbinischen Literatur zum Repertoire des Propheten, und Salomo ist nicht nur ein König, sondern vor allem der Weise und der friedliebende Dichter.
Diese Weisheit des Salomo war bereits für den deuteronomistischen Autor von Gen 12,1-3 ein Zielpunkt der Wanderung des Abrahamsvolkes. Es
war eine Weisheit gemeint, die er in Dtn 4 als Torabefolgung interpretieren konnte. Der König sollte demnach vor allem ein Ausleger und Befolger
39
Grundkurs Judentum
Der Jude Jesus
der Tora sein, wie es auch das dtn Königsgesetz vorsah. Mit dem Stichwort Tora ist erneut die Verbindung zum Prophetentum ausgedrückt. Lehre
und Toraauslegung spielen für Jesus eine wichtige Rolle, und sie geschieht in Vollmacht (Mt 7,29; 21,23-27; Mk 1,22.27; 11,27-33 etc.). Die Magier der Kindheitsgeschichte - die freilich nicht viel mit einem Tatsachenbericht gemein hat, sondern vielmehr wundersame Legende von der Geburt eines großen Mannes ist - kommen zu Jesus, dem König (Mt 2,2). Sie bringen mit sich Gaben, die auch die Königin des Südens, die von Saba, dem Salomo überreichte (1 Kön 10).
Weitere Indizien für die Beziehung Jesu zur Prophetie wurden bereits genannt, die Volksmeinung, die Bezüge zu Elija und Elischa, die Wundertaten etc.
Ein besonderes Indiz für die Verbindung mit der Prophetie findet sich aber vor allem in der Erwähnung der besonderen Geistbegabung Jesu. Der
Geist war das Zeichen des Propheten, wer ihn trägt, steht in prophetischer Tradition. Für die rabbinische Theologie gilt grundsätzlich, dass der
Heilige Geist von Israel genommen war und derzeit der Wiederkunft harrt. Hinweise auf den Charismatiker Pinchas ben Jair und seinen Geistspruch mSot 9,15 und ähnliche Worte zeigen aber, dass auch späterhin der Zusammenhang von prophetischer Geistgabe und charismatischen
Persönlichkeiten bekannt war. Die zwischentestamentliche Literatur und Josephus haben ebenfalls Indizien geliefert, dass die prophetische Geistbegabung in ihrem Umfeld thematisiert wurde.
Wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, dann ist das Reich Gottes schon zu euch gekommen.
Das Königtum Jesu beschränkt sich weitgehend auf die nichtjüdische und römische Welt. Dies sowohl durch die Verhörfrage des Pilatus: „Bist du
der König der Juden?“ (Mt 27,11 u.P.) als auch bei der Verspottung durch die Soldaten (Mt 27,29 u.P.). Die Kreuzesinschrift wurde von Römern
verfaßt. Jesus als König zu verstehen war demnach in erster Linie den politisch denkenden Kräften des feindlichen Rom zu eigen. Sie werden ihn
wohl auch zu einem Umsturz-Aufrührer hochstilisiert haben, der er selbst von seinem Verständnis nie war. Im Johannesevangelium, wo das Volk
Jesus zum König ausrufen will, nachdem er ein Brotwunder getan hat, versteckt er sich vor der Menge (Joh 6,14f.).
Das Johannesevangeliums allerdings hat Jesus weit stärker als die Synoptiker mit der Königswürde in Beziehung gebracht. Dazu verweise ich auf
Ekkehard und Wolfgang Stegemanns Artikel: König Israels, nicht König der Juden? Jesus als König im Johannesevangelium, in: Ekkehard Stegemann (Hg.), Messias-Vorstellungen bei Juden und Christen, Stuttgart u.a. 1993, 41-56. Ich kann mich hier auf zwei Sätze daraus beschränken:
Die Konzeption des Johannes ist damit im Prinzip deutlich: Während er Jesus vom irdisch-politischen Königtum - besonders auch
in seiner apokalyptisch-revolutionären Spielart - distanziert, gibt er ihm Züge eines weisheitlichen Königs. Im Sinne dieser Tradition
ist Jesus wie Gott „König Israels“. (53)
Wolfgang Stegemann macht im selben Sammelband4 auf die Theologie des Lukas aufmerksam, in der die Messianität Jesu vor allem darin besteht, den Heiden eine Möglichkeit zu geben, am Heil teilzuhaben:
Im Unterschied zu Jesaja scheint Lukas freilich nicht die „Völkerwallfahrt“ zum Zion (Jes 2,2-5; 45,14-25; 60,1-9) als den Weg zu
verstehen, auf welchem die Heidenvölker zum Heil Israels hinzukommen. Er denkt wohl vielmehr daran, daß durch die Verkündigung der frohen Botschaft von der „Umkehr zur Vergebung der Sünden“ unter allen Völkern Israels messianisches Heil auch den
Heiden offenbar wird. Medium dieser Verkündigung sind die „Zeugen“ vom Leiden und Auferstehen des Messias Jesus (Lk 24,4648), zu denen als wichtigster Zeuge unter den Völkern schließlich Paulus hinzukommt. Denn Israel unter den Völkern will nach lukanischer Darstellung seine Aufgabe nicht wahrnehmen, „Licht der Völker“ zu sein. Lukas wird dann in der Apostelgeschichte häu4
40
Jesus als Messias in der Theologie des Lukas, 21-40.
Grundkurs Judentum
Der Jude Jesus
figer und äußerst ausführlich begründen, daß die „Umkehr zum Leben“... von Gott auch den Heiden geschenkt ist. Sie müssen
nicht erst Juden werden, um am Heil Israels Anteil zu bekommen (36f.).
Diese Ausführungen zeigen deutlich einen Trend auf, der festzuhalten ist. Die frühe Kirche war sich der Verankerung Jesus im Judentum voll bewusst und hat sie auch keineswegs geleugnet. Das Beispiel der Theologie des Lukas zeigt, dass man vielmehr bestrebt war, in Jesus die Brücke
zum Heidentum zu entdecken, eine Brücke, die über den Tod und die Auferstehung und damit auch über die messianische Bedeutung des Menschen Jesus führte.
Freilich setzt der christliche Typ der messianischen Idee den Glauben voraus, daß Jesus von Nazareth Israels Messias ist. Im Falle der lukanischen Theologie ist diese Beziehung auf die Verheißung Israels nicht zu übersehen. Doch behauptet Lukas nicht, daß
der Messias Jesus seine irdische Herrschaft schon angetreten hat. Die steht noch aus, der Messias dazu im Himmel bereit. Auf
dem „Schauplatz der Geschichte“, um mit Scholem zu sprechen, hat sich Jesu messianische Hoheit erst antizipatorisch (etwa in
seinen Heilungen und in seiner Verkündigung der Königsherrschaft Gottes zugunsten der Armen) realisiert... Wie Israel erwartet
die Christenheit in dieser Hinsicht immer noch das Kommen des Messias und die Aufrichtung seiner Königsherrschaft in Israel
sagt Stegemann (38f.) und sollte mit diesen Worten gehört und verstanden werden.
Die weitere jüdische Jesusrezeption in Stichworten:
Rabbinen
haben Jesus kaum rezipiert: siehe Johann Maier, Jesus von Nazareth in der talmudischen Überlieferung, Darmstadt 1978.
Jesus als Verführer und Zauberer, Sohn des Pantera. Texte sind in ihrer Abfassung umstritten. Vielleicht ma. Einfügungen (Toldot Jeschu).
Mittelalter:
Toldot Jeschu (6. Jh.) – im MA bearbeitet. Jesus hat Wunder vollbracht, war aber Zauberer, der seine Zauberei in Ägypten erworben hat oder in
das Allerheiligste des Tempels eingedrungen sei. Jesus war hinterlistig und selbstsüchtig. Judas sei vom Sanhedrin aufgefordert worden, sich in
die Bewegung einzuschleichen und von innen aufzurollen. Trotzdem blieben noch viele Anhänger Jesu. Deshalb schleuste man einen Rabbi namens Petrus ein, der die vollständige Trennung vom Judentum bewirkte. Es waren also Juden, die das Geschick der chr. Gemeinschaft bestimmten, nicht göttlicher Wille.
Günter Schlichting, ein jüdisches Leben Jesu: Die verschollene Toledot-Jeschu-Fassung tam u-mu´ad, Tübingen 1982.
Andere Traditionen: Menachem Ham-Meiri von Perpignan (1249-1316): Christen keine Götzendiener, hoher ethischer Standard.
Maimonides (1135-1204): Christentum und Islam gehören zum göttlichen Plan, die Welt durch Ausbreitung der Gotteserkenntnis bis zu den Heiden auf die Erlösung vorzubereiten. Jesus selbst aber war ein Häretiker.
Profiat Durian (+1414): Jesus wollte nicht göttlich sein, sondern habe zur Bewahrung und Bindung an die Tora aufgerufen.
41
Grundkurs Judentum
Der Jude Jesus
Isaak Troki (1533-1594): Chizzuk Emuna: stellt Historiziät des NT in Frage.
Jacob Emden (1697-1776): Jesus habe sich nur an Heiden gerichtet, um diese zur Annahme der noachidischen Gebote zu bewegen. Habe keinen Anspruch an Göttlichkeit erhoben.
Moses Mendelssohn (1729-1789): Jesus moralische Persönlichkeit ohne übernatürliche Ansprüche. Jesus Lehrer der Ethik. Jesus hat nichts getan, was Juden zu Feinden gemacht hätte.
19. Jh.: Joseph Salvador und Heinrich Graetz machen Jesus zum Essener, der magische Rituale – in Ägypten gelernt - ausführte. Hier stehen
die Toledot Jeschu noch im Hintergrund.
Josef Salvador: Geschichte der mosaischen Institutionen (1828): nichts Neues verkündet oder getan. Christentum leitet sich wie der Islam gänzlich vom Judentum ab. 1841 Leben Jesus, Christentum jetzt Verbindung von gr. und hebr. Elementen. Bergpredigt finde sich auch bei Ben Sira.
Jesus habe Dinge der Welt zugunsten des Jenseits abgewertet.
J. Salvador, Das Leben Jesu und seine Lehre, die Geschichte der Entstehung der christlichen Kirche, ihrer Organisation und Fortschritte während
des ersten Jahrhunderts, Dresden 1841.
Die eine, die Moral Moses, stellt bis auf einen gewissen Punkt den Mann in seiner Kraft und Altersreife dar, begabt mit Urtheilskraft und Rechtssinn, fest und bestimmt in seinem Wort; die andere, die Moral Jesu, entspricht mehr dem Charakter des Weibes, mit dem tiefen Bedürfnis der Ergießung und Zärtlichkeit, mit der Gedankenerhebung und Entsagung, von der sie öfters Beispiele darbietet, wenn ein wahres Gefühl oder eine unwiderstehliche Täuschung sich ihrer Einbildungskraft und ihres Herzens bemächtigt haben (192).
Samuel Hirsch: Judentum ist gleichbedeutend mit Toleranz, Christentum mit Intoleranz (wegen der Intoleranz gegenüber nichtchr. Religionen)
wegen korumpierenden Einflusses des Heidentums, das zum Dogma führt.
Samuel Hirsch, Die Humanität als Religion, Trier 1854.
Jesus lehrte nur Jüdisches, wollte die Schrift wieder lebendig machen, wandte sich gegen buchstäblichen Gottesdienst der Pharisäer und Sadduzäer, wollte „die lebendige Stimme der Propheten“ hörbar machen.
Heinrich Graetz: Jesus inspirierte die Juden mit Frömmigkeit, Leidenschaft, Glauben an Gott und Werten der Demut. War aber Essener und
nahm Gottessohnschaft und Menschensohnschaft in Anspruch und glaubte, Macht über Dämonen und den Satan zu haben. Er reformierte das
Judentum aber nicht. Sanhedrin für Tod verantwortlich. Christentum schließlich Produkt des Paulus.
Verbindung zu den Essenern erklärte Graetz auch den Fanatismus im Christentum, bizarre, extremistische Elemente im Judenhass. War auch
gegen die Reform des Judentums, das er als Christianisierung anprangerte.
Heinrich Graetz, Sinai et Golgotha, ou les origines du judaisme et du christianisme, suivi d´un examen critique des Evangiles anciens et modernes,
Paris 1867.
42
Grundkurs Judentum
Der Jude Jesus
Isaak Markus Jost (1793-1860): Geschichte der Israeliten: verherrlichter Jesus inmitten degenerierter rabbinischer Kultur. Juden sind treue Untertanen des Staates. Jesus habe durch seine Erneuerungstendenz den Hass der jüdischen Führung auf sich gezogen.
Moses Hess bezeichnete das Christentum als „Gift“ für die Juden:
Moses Hess, Rom und Jerusalem: die letzte Nationalitätenfrage, Leipzig 1899.
Abraham Geiger: stellt Jesus als frommen Juden dar und zeichnet ihn als Pharisäer, der gegen die Sadduzäer auftrat. Die frühe Jesusbewegung
sei von Sadduzäern infiltriert worden, um es für antipharisäische Kampagne dienstbar zu machen.
Dazu Susannah Heschel, Der jüdische Jesus und das Christentum. Abraham Geigers Herausforderung an die christliche Theologie. - Dt.
Erstausg. Berlin 2001.
Zur Jesusinterpretationen im 20. Jh. siehe Armin Wallas, Rabbi Jeschua ben Josseph. Jüdische Jesus-Interpretation im 20. Jahrhundert, Das jüdische Echo 46 (1997), 21-38. Gerhard Langer, Jüdische Stimmen zu Jesus, Protokolle zur Bibel 5 (1996) 95-107.
Einige Autoren, die Jesusliteratur schrieben (dazu Wallas):
Albert Ehrenstein (zu Ahasver)
Joseph Klausner: Jeshu Hanozri (1922: wichtiges Werk: Jesus pharisäischer Rabbi, aber unpolitisch und in mess. Erwartung, Betonung der jüdischen Ethik)
Emil Ludwig (Jesus jüdischer Prophet)
Martin Buber (Jesus ein Am-ha-aretz, kein Pharisäer, später rückt er ihn in Nähe Pharisäer).
Elijahu Rappoport: Buch Jeschua (1920: Jesus als Bundeserneuerer, Revolutionär gegen starres Gesetz).
Eugen Hoeflich (wendet sich positiv der Judasfigur zu).
Leo Baeck (befreit Jesus von dogmatischem „Ballast“: Jesus Jude unter Juden, Vision eines jüdischen Urevangeliums).
Constantin Brunner: Unser Christus oder das Wesen des Genies (1921: Jesus Mystiker, größtes Phänomen jüdischen Prophetentums wieder
dem Judentum zurückgeben, antizionistisch).
Franz Werfel: Paulus unter den Juden (1926: Paulus ist Israels Selbsthass, gegen Gamaliel, der Gesetz und die „heilige Menschenverantwortung“
gegen die „Menschwerdung Gottes“ betont, aber ambivalentes Ende. Jesus ist auch für den konvertierten Werfel letzter Typus jüdischer Menschlichkeit).
Max Brod (zeichnet Jesus nationaljüdisch), 1952: Der Meister, wo er den Philosophen Maleagros von Gadara zu Jesus kommen lässt und Jesus
als göttliche Person mit Liebeskraft beschreibt.
43
Grundkurs Judentum
Der Jude Jesus
Schalom Asch: The Nazarene (1939): Schildert Jesus als pharisäischen Juden.
Gerhard Langer
Jüdische Stimmen zu Jesus, Protokolle zur Bibel 5/2 (1996) 95-107.
In jüngerer Zeit läßt sich eine bemerkenswerte Wiederentdeckung Jesu durch jüdische Gelehrte feststellen. Dabei wird immer wieder auf seine
tiefe Verwurzelung im Judentum hingewiesen. Die meisten Ansätze sind stark von (christlich-) dogmatischen Vorgaben wie Messiasvorstellung
oder Hoheitstitel beeinflußt. Gefordert wird daher eine neue Diskussion um Jesus ohne christologische „Vor-Urteile“. .
Der Umgang des Judentums mit dem Christentum schien in den letzten Jahrzehnten ausgespannt zu sein zwischen den beiden Polen der völligen
Ignoranz und dem massiven Bestreben nach Dialog.[1] Bis heute findet sich auf der einen Seite dieses Spektrums die extreme Orthodoxie, die mit
dem Christentum schlechterdings nichts anzufangen weiß und sich auch nicht um Verständigung bemüht. Ihr Hauptanliegen ist die „Neuevangelisierung“ des Judentums von der Orthodoxie her.
Daneben existiert nach wie vor eine berechtige Skepsis gegenüber dem Christentum auch in nichtorthodoxen Kreisen. Der Holocaust-Theologe
Eliezer Berkowitz formulierte es so: „Alles, was wir von den Christen wollen ist, daß sie ihre Finger von uns und unsern Kindern lassen“[2] Die andere, die dialogbereite Seite, wurde lange Zeit im deutschen Sprachraum von einigen wenigen Namen beherrscht, die von ganz unterschiedlicher
Qualität zeugen.
1. Flusser, Ben-Chorin, Lapide
Neben Martin Buber, der Jesus stets als seinen „großen Bruder“[3] bezeichnete, sind Pinchas Lapide, Schalom Ben-Chorin oder David Flusser
weiten Kreisen ein Begriff geworden. Während m. E. Pinchas Lapide im Judentum selbst kaum anerkannt wird, führte Schalom Ben-Chorin mit
seinem Sohn eine liberale jüdische Gemeinde in Jerusalem (´Or Hadash), die inzwischen auch in Österreich einen Ableger hat. David Flusser
wirkte jahrelang als Professor für Neues Testament und frühes Christentum an der Hebrew University in Jerusalem. Sein Vermittlungsversuch des
Christentums soll Juden wie Christen betreffen. Flussers Zugang zu Jesus ist nun tatsächlich einige Beobachtungen wert. Bereits 1968 erschien
44
Grundkurs Judentum
Der Jude Jesus
bei Rowohlt sein „Jesus in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten“. Darin findet sich viel Lesenswertes über Flussers Jesusbild. Jesus sei demnach in Nazaret geboren, habe - als Ältester - vier Brüder und Schwestern gehabt, sei um 28/29 getauft worden und im Jahr 30 oder 33 gestorben.
Die Jungfräulichkeit Mariens leugnet er nicht, zumindest nicht explizit. Flusser betätigt sich als Biograf Jesu, berichtet über seine Bildung, die
Spannung mit der Familie, die sich erst nach Jesu Tod zum „Glauben“ bekennt. Flusser berichtet von der Taufe und Geistbegabung Jesu als historischem Ereignis. Johannes sei der endzeitliche Elija gewesen und mit Jesus sei das Königreich Gottes angebrochen. Jesus sei kein rationalistischer Theoretiker gewesen und habe sich zwar gegen den „Starrsinn der Stockfrommen“[4] gewendet, selbst aber nur die sittliche Seite gegenüber der rituellen des Gebotes betont und es nicht aufheben wollen. Insgesamt sei Jesus - und hier ist Flusser sicher auf dem richtigen Weg - ein
Jude gewesen, der sich zu Juden gesandt fühlte. Die Pharisäer erscheinen bei Flusser wiederum recht unhistorisch klischeehaft, werden aber von
jeder Schuld am Tode Jesu freigesprochen. Flusser legt Jesus in seiner Botschaft in der Peripherie der Essener an, ohne ihn mit diesen gleichzusetzen. Das Nahen des Königreichs Gottes sei ein zentraler Punkt der Verkündigung gewesen, in der die Umwertung aller Werte und nicht nur die
soziale Dimension hervorstechen. Stichwort dazu wäre „realisierende Eschatologie“ durch Jesus. Ähnlich wie später Geza Vermes bringt auch
Flusser die Nähe Jesu zu den jüdischen Charismatikern Choni oder Chanina ein. Aber gegenüber Vermes betont er die Einzigartigkeit der Sohnschaft Jesu als Folge der Erwählung durch den Heiligen Geist. Diese sei historisch jedoch eigentlich erst bei der Verklärung erfolgt, die Flusser
somit ebenfalls als geschichtlich ansieht. Dieses Bewußtsein der Sohnschaft sei von Anfang an überschattet von der Todesahnung gewesen. Jesus habe aber seinen Tod nicht gewünscht oder gar als heilbringend erachtet. Dies sei Ergebnis nachjesuanischer Theologie. Jesus selber habe
sich aber - nach anfänglichem Zögern - wohl selber als Menschensohn im Sinne eines endzeitlichen Richters verstanden.
Über 20 Jahre später - 1990 - erschien im Kösel-Verlag München Flussers Buch „Das Christentum - eine jüdische Religion“. In ihm äußert er sich
zu Maria, zu Christusliedern, zu den jüdischen Wurzeln des Christentums, der Messiaserwartung Jesu, zu Paulus und zum gemeinsamen Auftrag
der Brüderlichkeit. Viele Annahmen wiederholt er aus seinem Jesusbuch. Er insistiert darauf, daß Jesus Johannes als Elija gesehen habe und vor
allem darauf, daß Jesus der einzige antike Jude gewesen sei, der den Anfang des Königreiches Gottes predigte. Er selbst habe sich als Messias
gesehen: „Solange daran nicht manche christliche Neutestamentler zu zweifeln begonnen haben - und sogar erklärt haben, das Leben Jesu sei
unmessianisch gewesen (wie sieht denn ein messianisch lebender Mensch aus?) -, ist es keinem Juden eingefallen, an dem messianischen
Selbstbewußtsein Jesu zu zweifeln... ich habe in den letzten Jahren viel Kraft und Fleiß darauf verwendet, sowohl hebräisch als auch englisch zu
zeigen, daß sich Jesus als der Messias, der kommende Menschensohn wirklich verstanden hat“.[5] Nach Flusser habe Jesus urjüdische eschatologische Motive umgruppiert: nach der biblischen Zeit realisiert sich das Königreich des Himmels und wartet weiter auf das endzeitliche Gericht
des Menschensohnes. Flusser gelingt es so - und dies muß man ihm als Verdienst anrechnen - die Bedeutung der irdischen Wirksamkeit Jesu
gegenüber dem sog. Sühnetod zu betonen. Seine penetrante Verteidigung der Messianität Jesu als zukünftiger Menschensohn zeigt aber gerade
seinen persönlichen Zugang auf. Flusser interpretiert Jesus als Juden, vor und nach der Auferstehung. Aber er macht den unübersehbaren Versuch, den Juden Jesus als einmalig, als göttlich, als Messias erscheinen zu lassen. Flusser ist zweifellos um den Dialog bemüht, er äußert bedenkenswerte theologische Positionen, bleibt in vielen Einzelfragen m. E. aber zu unkritisch. Die Bezüge zwischen Essenern und Johannes d. Täufer,
Jesus und Paulus, die Theologie der „Pharisäer“ u.a. bedürfen einer weit differenzierteren Sicht. Menschensohn, Messianität und Prophetenamt
sind weitere Stichwörter, die viel Diskussion aufwerfen und in bezug auf Jesus mit großer Akribie untersucht wurden. Flusser ist hier zweifellos zu
ergänzen und auch zu korrigieren.
45
Grundkurs Judentum
Der Jude Jesus
Schalom Ben-Chorin hat schon in seinem Buchtitel „Bruder Jesus. Mensch - nicht Messias“, München 1967, klargemacht, daß er Flussers Thesen
nicht teilt. Seine Ausführungen unterliegen jedoch zum Teil derselben Kritik: zu viel wird als sicher vorausgesetzt, die Schulen Hillels und Schammais, die Pharisäer, all das sind Größen, die klar umrissen scheinen. Jesus stünde demnach den Pharisäern am nächsten. Er sei ein Rabbi, deshalb wohl auch verheiratet gewesen. Im einzelnen anders als Flusser und doch methodisch ihm gleich unterscheidet Ben-Chorin zwischen historisch glaubwürdigen und unglaubwürdigen Aussagen von und über Jesus. Die Auferstehung erscheint ihm so erst durch Paulus bedeutsam und
historisch ungewiß. Anders als Flusser, der gerade in den Menschensohnworten Hinweise auf Jesu Messianität sieht, meint Ben-Chorin: „Das ist
der Mensch schlechthin. Der Mensch, wie du und ich, der in seiner Geringfügigkeit exemplarische Mensch. Als diesen Menschen, der in seiner
Menschlichkeit exemplarisch lebt, unbehaust und den Leiden ausgesetzt, hat sich Jesus selbst verstanden. Indem er sich als Menschensohn bezeichnet, steht er nicht als Prophet oder als Messias, sondern als Bruder vor uns. Und da er der Menschensohn ist, bricht in ihm die Frage des
Menschen auf: `Wer bin ich?´“[6]
Pinchas Lapide schließlich ist bekannt für sein pointiertes Eintreten für den jüdischen Jesus und formuliert so etwa in einem 1979 erschienenen
Buch „Der Jude Jesus. Thesen eines Juden. Antworten eines Christen“[7] 3 Thesen:
1. These: Jesus hat sich seinem Volk nicht als Messias kundgegeben;
2. These: Das Volk hat Jesus nicht abgelehnt, und
3. These: Jesus hat sein Volk nicht verworfen.
Die streitbare und leider zu plakative Form der Auseinandersetzung mit dem Thema prägt das gesamte Buch. Der historische Jesus soll darin von
den Verfälschungen und Verzerrungen befreit werden, die bereits die Evangelisten anbrachten, um des Rabbi Jesu Messianität zu beweisen. Implizit unterstellt Lapide schon dem frühen Christentum, Jesus aus antijudaistischen Motiven hochstilisiert zu haben. Mag im einzelnen letztlich vieles von Lapides Grundannahmen stimmen, bleiben die Art und Weise der Darstellung und seine oft viel zu wenig reflektierten Behauptungen zu
kritisieren. Sie stützen sich wie bei Flusser oder Ben-Chorin ebenso wieder auf ein vorliegendes unreflektiertes Bild des „Kernjudentums“ zur Zeit
Jesu. Je verschwommener, undeutlicher und offener dieses Bild wird, umso mehr versinken die Zugänge zum „Juden“ Jesus in Spekulation. Allgemein kann festgehalten werden, daß die jüdischen Zugänge zu Jesus von einigen wenigen Fragen geleitet sind. Dazu gehören eben die Messiasfrage (Hoheitstitel), der Zugang zur Tora, seine „Gruppenzugehörigkeit“ und die Frage nach der Schuld am Tod. Diesbezüglich erwähne ich
auch die Arbeiten von J. T. Pawlikowski.[8]
2. Die Arbeit Donald A. Hagners
Vor allem in der englischsprachigen Literatur tat und tut sich einiges. Bruce Chilton faßt in seinem jüngst erschienenen Artikel die Ansätze zusammen[9] und bereits 1984 hat Donald A. Hagner in seinem Buch „The Jewish Reclamation of Jesus“[10] wichtige jüngere jüdische Stimmen zu Jesus zusammengetragen und befragt. Er konzentrierte sich dabei auf so wichtige Gelehrte wie Claude Goldsmith Montefiore, Israel Abrahams, Joseph Klausner, Geza Vermes, Samuel Sandmel und auf die schon genannten Ben-Chorin, Flusser, Lapide. Hagners Arbeit zeigt an vielen Beispielen die Bemühungen auf, die jüdische Autoren dieses Jahrhunderts darauf verwenden, Jesus als den ihren, den jüdischen, wiederzugewinnen.
Hagner zeigt an heiklen Themen die jüdischen Standpunkte auf, so zu den Antithesen der Bergpredigt, den Sabbatregelungen, der Autoritätsfrage,
46
Grundkurs Judentum
Der Jude Jesus
dem Scheidungsrecht, den Speisegeboten, ethischen Weisungen Jesu, der Feindesliebe usw. Besonderen Raum nimmt natürlich auch die Person
Jesu ein: Messiasfrage, Menschensohn, Sohn Gottes. Hagners Arbeit zeigt deutlich auf, wie sehr die eigenen theologischen Positionen in die Beurteilung Jesu eingeflossen sind. Er hebt die Bedeutung der Aufklärung im Judentum hervor, die das Interesse an Jesus beflügelt hat. Er geht auf
die verschiedenartigen Schwierigkeiten ein, die sich den jüdischen Wissenschaftlern beim Umgang mit Jesus stellten. Vor allem in Fragen der Halakha, aber natürlich auch im Selbstverständnis Jesu suchen die Autoren ganz unterschiedlich nach Wegen, die es erlauben, Jesus im Kontext
eines rabbinischen Judentums zu halten. Ich will dies an einem einzigen Beispiel erläutern, nämlich der Frage nach dem Sabbatgebot.[11] Montefiore etwa sah im Verhalten Jesu eine Bestätigung der von ihm vertretenen liberalen Position, daß manche Halakhagebote absurd und legalistisch
waren. Abrahams sah ähnlich wie Montefiore Jesus die Halakha brechen, wobei er die Sabbatregelungen der Schulen Hillels und Schammais als
historische Voraussetzungen akzeptierte. Auch für Klausner oder Cohen war Jesu Sabbatverhalten ein Halakhabruch. Andere wie Jacobs, Schonfield oder Trattner sahen in Jesu Verhalten keineswegs einen Halakhabruch, sondern nur einen Widerspruch gegenüber „haarspalterischen“ Pharisäergruppen. Daube verwies auf die Argumentation Jesu in Mt 12, die ihm letztlich gut rabbinisch erschien. Nach Kohler habe sich Jesus einfach
an die Schule des Hillel angehängt. Nach Flusser sei das Ährenraufen am Sabbat ein griechischer Übersetzungsfehler aus einem hebräischen
Original des Mk. Das Aufheben herabgefallener Ähren, ihr Zerreiben in den Händen sei auch am Sabbat erlaubt gewesen. Erst die spätere Übersetzung habe daraus ein Ährenraufen gemacht. Nach Flusser komme dazu, daß nicht Jesus, sondern nur die Jünger sich diesbezüglich schuldig
machten. Besonders interessant sei der Umstand, daß die Heilung einer verdorrten Hand am Sabbat, im Gegensatz zu anderen Heilungen, nur mit
dem Wort und ohne Berührung erfolgte, was somit auch an Sabbaten erlaubt wäre. Lapide und Vermes schließen sich hier an. Vermes erwähnt
allerdings gerechterweise auch Lk 13,13ff, wo Jesus eine kranke Frau am Sabbat sehr wohl berührt, deutet dies aber als Sondergut des Lukas,
der damit die - ansonsten unverständlichen - Vorwürfe gegenüber einem die Sabbathalakha brechenden Jesus untermauern würde.
M. E. zeigen die Beispiele sehr deutlich ein Dilemma der jüdischen Auslegung auf, das sehr häufig anzutreffen ist. Ich meine den Versuch, Jesus
mit dem sog. „rabbinischen Judentum“ in Einklang zu bringen. Ein solches ist vor der Mischna und den frühesten Midraschim nicht greifbar, und
das ist nun einmal fast 200 Jahre nach Jesus. Immer wieder strapazierte Texte wie die Pirqe Abot erweisen sich bei näherem Hinsehen zusehends als spät. Der konkrete politische, soziale und religiöse Einfluß der Rabbinen war in frühen Zeiten weit geringer als die Schriften vorgeben.
Und insgesamt müßte weit eher die sog. zwischentestamentliche Literatur auf Parallelen zu Jesus befragt werden als die rabbinische, wenngleich
freilich diese auch Reminiszenzen auf frühere Epochen bietet, die jedoch sehr genau zu prüfen sind. Die jüdische Jesusdeutung unterliegt hier auf
weiten Strecken einem ähnlichen Problem wie die christliche. Ist es dort die traditionelle Sicht Jesu als Neuerer, der sich vom rabbinischen Judentum absetzt und dieses sprengt, so hat die jüdische Deutung sich bemüht, zumindest den historischen Jesus in die rabbinische Tradition einzufügen. M. E. verstellt das kontroverstheologische Vor-Urteil von vornherein eine ungezwungene Suche nach dem wirklichen Jesus von Nazaret. Bewußt oder unbewußt wird er in ein Schema gepreßt, vorgegeben von einem dogmatischen Christusbild und einer konservativen Rabbinistik. Dies
gilt selbstverständlich für die klassische christliche Exegese, die Jesus zumeist in Abhebung von einem Strack-Billerbeck-Judentum als torakritischen Erneuerer definierte, mit einer nicht geringen eschatologischen Erwartung und starkem Selbstbewußtsein, das sich als Exklusivbeziehung
zum Abba-Gott darstellt. Die jüdischen Gesprächspartner haben dagegen die Einbindung des toratreuen Jesus in das Judentum betont und nicht
davor zurückgeschreckt, auch Zuordnungen zu Gruppen zu treffen (Pharisäer[12], Zelot[13]). Neuere Zugänge bemühen sich um stärkere Flexibilität, aber die wirklich großen Entwürfe eines umfassenden Jesusbildes sind trotz unübersehbarer Literatur rar.
3. Geza Vermes
47
Grundkurs Judentum
Der Jude Jesus
Ich möchte hier kurz an die Arbeiten von Geza Vermes erinnern.[14] Sein Ansatz scheint mir, bei kritikwürdigen Details, bislang der ausgereifteste
und vernünftigste zu sein. Der britische jüdische Historiker hält fest, daß es ihm um den historischen Jesus geht. Er beginnt daher seine Ausführungen mit den Daten zur Person, stellt Jesus als Zimmermann, Lehrer, Heiler, Wundertäter und Exorzist vor, geht auf seine Einbindung in Galiläa
ein und zeigt in besonderer Weise Parallelen zu den charismatischen Frommen auf. Bekannt sind hier Choni der Kreiszieher oder Chanina ben
Dosa. Als in Galiläa beheimatete Wundertäter mit einer sehr persönlichen Gottesbeziehung seien sie am ehesten mit dem historischen Jesus zu
vergleichen. Der gesamte zweite und dritte Teil des Buches ist - und hier entspricht Vermes ganz der genannten Tendenz - den Hoheitstiteln (Prophet, Herr, Messias, Menschensohn, Sohn Gottes) gewidmet. Auch Vermes sieht sich demnach genötigt, intensiv auf die Debatte um die Person
des Christus einzugehen. Und er tut dies unter Rückgriff auf zwischentestamentliche und rabbinische Literatur äußerst gewissenhaft und argumentativ. Demnach ließe sich für Jesus weder ein Selbstverständnis als Messias noch als hoheitlich mißverstandener Menschensohn im Sinne der
späteren Danielrezeption feststellen. Bezüglich der Sohnschaft Jesu weist Vermes wieder auf Parallelen zu den charismatischen Wundertätern
hin. Choni galt als „Haussohn“ bei Gott und von Chanina heißt es: „Die ganze Welt wird um meines Sohnes Chanina willen genährt; aber mein
Sohn Chanina ist mit einem Kab Johannisbrot von einem Sabbatvorabend zum nächsten zufrieden“ (bTaan 24b). Auch R. Meir wird von Gott als
„mein Sohn“ bezeichnet (vgl. bHag 15b). Wie bei Jesus erkennen auch die „rabbinischen“ Dämonen die Wundertäter an. Chanina etwa wird von
der Königin der Dämonen, Agrat, angefleht, ihr doch wenigstens Mittwoch und Freitag abend als Betätigungsfelder zu lassen, was Chanina gewährt. Für Vermes gilt jedenfalls, daß Jesus selbst sich im Rahmen eines bunten Spektrums jüdischer Persönlichkeiten der Zeit recht gut einordnen lasse und konstatiert erst für die hellenistische Kirche die Tendenz, den Jesus der Evangelien aus dem Judentum herauszureißen und als
Gott zu überhöhen. In seinem äußerst unpolemisch gehaltenen Buch äußert Vermes nur sanft Vermutungen über die Motivation der Christen, Jesus als Messias zu verherrlichen: „Die Wortstreiter für das Christentum scheinen einem eingebürgerten Verfahren gefolgt zu sein: Das Evangelium
war perfekt, aber mit den Juden war etwas grundsätzlich verkehrt. Deren Widerspenstigkeit in der Zurückweisung des Messias, der größten aller
göttlichen Verheißungen an Israel, war der Höhepunkt einer uralten Verderbtheit, und diese war der Hauptgrund dafür, daß ihre Privilegien nun
unwiderruflich auf die Nichtjuden übergegangen waren“[15]. Eigentlicher Rädelsführer der Umdeutung Jesu zum Christus sei - und hier trifft sich
Vermes mit beinahe allen jüdischen Jesusforschern - natürlich Paulus: „Ich vermute, daß von dem Augenblick an, als Paulus als »Apostel der Heiden« (Röm 11,13; Apg 9,15) anerkannt und eine an Nichtjuden gerichtete Mission von der Kirchenführung in Jerusalem gebilligt worden war (Apg
15), die urspüngliche Ausrichtung des Wirkens Jesu radikal umgeformt wurde. Nichtjuden traten der Kirche in großer Zahl bei, und sie tat - in Übereinstimmung mit dem damals im Judentum vorherrschenden Konversionsmodell - ihr bestes, den neuen Anforderungen gerecht zu werden und
sich der veränderten Situation anzupassen... Eine andere einschneidende und an die Substanz gehende Veränderung infolge der Verpflanzung
der christlichen Bewegung auf heidnischen Boden betraf den Status der Tora, die für Jesus die Quelle der Inspiration und den Maßstab für seine
Lebensführung darstellte. Trotz Jesu gegenteiliger Anordnung wurde sie nicht nur für unverbindlich, sondern für abgeschafft, annulliert und überholt erklärt. Die Tora, die er mit solcher Einfachheit und Tiefe aufgefaßt und mit solcher Integrität für das, was er als dessen innere Wahrheit sah,
umgesetzt hatte, wurde von Paulus hinsichtlich ihrer tatsächlichen Wirkung als ein Instrument von Sünde und Tod definiert... Derselbe Paulus ist ...
dafür verantwortlich, daß die imitatio Dei eine beispiellose Wendung nahm, die die große Kluft zwischen Judentum und Christentum schuf“[16]. Die
Einführung von Mittlern und der Christozentrismus gegenüber dem Theozentrismus Jesu trenne daher Christen von Juden, nicht aber Juden von
Jesus. Denn Jesus „aus Fleisch und Blut (wurde) in Galiläa und in Jerusalem gesehen und gehört, kompromißlos und beharrlich in seiner Gottesund Nächstenliebe, überzeugt davon, daß er seine Mitmenschen durch Beispiel und Lehre mit seiner eigenen leidenschaftlichen Beziehung zum
Vater im Himmel anstecken könnte. Und dies tat er... Viele Zeitalter sind vergangen, seit der einfache jüdische Mensch der Evangelien in den Hintergrund trat, um für die prächtige und majestätische Figur des kirchlichen Christus Platz zu machen“.[17]
48
Grundkurs Judentum
Der Jude Jesus
Nun ist die Zuordnung Jesu zu den Charismatikern nicht neu - Vermes greift hier selbst auf George Foot Moore zurück - und nicht alles am Entwurf unproblematisch. Chilton äußert mehrere Kritikpunkte, auf die ich hier nicht näher eingehe. Dennoch ist Vermes als positives Beispiel kritischer jüdischer Auseinandersetzung mit Jesus hervorzuheben.
4. Der jüdische Jesus wird wiederentdeckt
Insgesamt konnte Daniel Harrington[18] eine bemerkenswerte Tendenz moderner jüdischer Wissenschaftler feststellen, Jesus in das Judentum zu
integrieren und gerade dadurch von vielen christlichen Forschern abzuheben.
Clemens Thoma gibt in seinem „Messiasprojekt“[19] einen kurzen Überlick über die jüdischen Stimmen zu Jesus, die ich hier noch kurz zitiere:
„Für die meisten mittelalterlichen Juden war Jesus eine gefährliche Unperson: ein Zauberer, ein Betrüger, ein Veranlasser der Judenfeindschaft,
ein Unterdrücker der Tora und der Gründer einer götzendienerischen judenfeindlichen Religion. Es gab aber bereits damals einzelne Juden, die
aus Mt 5,17f und Lk 18,18f herauslasen, daß Jesus die Tora nicht hatte abschaffen wollen, und daß er sich auch geweigert hatte, sich den Mantel
der Gottheit umzuhängen. Diese Juden ergriffen die Gelegenheit, um Jesus gegen das Christentum auszuspielen. Jesus sei ein toraverbundener
Jude gewesen, seine Botschaft sei aber im Christentum einer Idolatrie verdreht worden... Rabbi Menachen Ham-Meiri von Perpignan (1249-1316)
erklärte, die Christen seien keine Götzendiener, sondern verträten eine Lehre von hohem ethischen Standard. Rabbi Jacob Emden (1697-1776)
meinte, Jesus habe seine Botschaft nicht an das jüdische Volk gerichtet, sondern ausschließlich an die Völker, um diese zum Einhalten der Noachidischen Gebote zu bewegen. Moses Mendelssohn (1729-1786) betonte im Anschluß an mittelalterliche Vorstellungen, man könne auch dann
gute Gründe gegen das Christentum vorbringen, wenn man vom moralischen Charakter seines Stifters überzeugt sei; allerdings müsse man die
Voraussetzung akzeptieren, daß Jesus keinerlei Ansprüche auf Göttlichkeit für sich gemacht habe. Im 19. und 20. Jh. wurde jüdischerseits sehr
viel über Jesus und das Christentum geschrieben. Liberale und zionistisch gestimm Untaber auch traditionelle Juden äußerten sich zu Jesus und
zum Christentum in vielfältiger Weise. Jesus sei ein nationalistischer Jude gewesen, eine ethische hebräische Persönlichkeit par excellence. Er
habe keine universale Religion gründen wollen: Joseph Klausner (1874-1958). Jesus sei ein Apokalyptiker gewesen, auch seine Anhänger seien
an seinem Tod mitschuldig gewesen. Er habe nur eine jüdische Sekte gegründet. Diese sei dann zu einer universalen Religion umgewandelt worden. Der jüdische Monotheismus sei das ganze Geheimnis der Kraft und des Einflusses sowohl Jesu als auch des Christentums und des Islam.
Die beiden nachjüdischen Religionen hätten nur deshalb Überlebenschancen, weil sich in ihnen der jüdische Monotheismus als Lebenselixier befinde: Yehezkel Kaufmann (1889-1963). Die christlichen Auslegungen der heiligen Schrift könnten jüdischerseits als eine der 70 Möglichkeiten, die
Tora zu verstehen, akzeptiert werden: Jakob J. Petuchowski: 1925-1991.“[20]
Die genannten Beispiele mögen genügen, um eine Tendenz anzugeben. Namhafte und hochgebildete jüdische Wissenschafter wie Geza Vermes
oder David Flusser, engagierte Brückenbauer wie Schalom Ben-Chorin und viele andere haben Jesus als Juden wiederentdeckt und ins Bewußtsein gerufen. Dem entsprechen das verstärkte begrüßenswerte Interesse christlicher TheologInnen an einer Integration Jesu ins Judentum und die
faszinierenden Ansätze jüdisch-christlicher Theologien.[21] Daneben ist vornehmlich in Israel ein neuerwachtes religionswissenschaftliches Inte49
Grundkurs Judentum
Der Jude Jesus
resse am Christentum und auch an der Kirchengeschichte entstanden. Dies ist aus Vorlesungszyklen, Vorträgen oder an Arbeitsschwerpunkten
verschiedener ForscherInnen ersichtlich. Hier findet wohl eine begrüßenswerte Emanzipation statt, die das Christentum als wichtigen gesellschaftlichen und religiösen Faktor ernst nimmt, ohne sich von ihm vereinnahmen zu lassen. Wie es in Westeuropa eine Zeit lang zum guten Ton gehörte,
sich intensiv mit den ostasiatischen Religionen zu beschäftigten, entdeckt das jüdische Israel das Christentum. In kritischer Distanz, mit wissenschaftlichem Interesse, ohne Berührungsängste.
Die jüdisch-feministische Literatur hat ebenfalls Jesus zum Thema gemacht, wenn auch nicht in Form großer Monografien, so doch vor allem in
der Auseinandersetzung mit einer zeitweilig antijudaistisch anmutenden Inbesitznahme des Jesus von Nazaret durch christliche oder postchristliche Feministinnen, die ihn, den „Neuen Mann“ als einen die jüdische „Männerwirtschaft“ überwindenden Feministen darstellen wollen. Diesbezüglich hat sich vor allem Susannah Heschel in verschiedenen Publikationen überaus kritisch geäußert.[22] Die große Dame der jüdischen Theologie,
Pnina Navé Levinson hat jüngst in einem Interview für die feministische Zeitschrift „Schlangenbrut“ sehr pointiert gesagt: „Solange an den theologischen Fakultäten die Prüfungsordnungen nicht geändert werden, wird sich nichts ändern; solange der Antijudaismus als Kirchenlehre vertreten
wird, ebenfalls nicht. Feministinnen, die im Studium nur Abwertendes über das Judentum hören, daß Jesus die Frauen angenommen, die Kinder
zu sich gelassen habe, von den Juden umgebracht wurde und die Juden uns den Vatergott eingebracht haben, solange kann sich nichts ändern.“[23] Jüdische Frauen kämpfen hier also auch um eine ausgewogene, nicht antijudaistische Sicht Jesu in ihren eigenen Reihen.
5. Die „messianischen“ Juden
Nur erwähnt werden sollen alle jene jüdischen Gruppen, die sich als „messianische Juden“ bezeichnen und immerhin nach Schätzungen bis zu
100.000 Menschen ausmachen sollen.[24] Hier ist die „Internationale Judenchristliche Allianz“ zu nennen oder amerikanische Vereinigungen wie
die „Blue Collar Congregation“ in Minneapolis, das „Beth Yeshua“ in Philadelphia, das „Beth Messiah“ in Washington, „Adat ha Tikvah“ und „B´nai
Maccabim“ in Chicago oder ebensolche in Kanada. Am 27. Juni 1979 wurde von 19 Gruppen die amerikanische Dachorganisation „Union of Messianic Jewish Congregations“ gegründet. Zentrale Inhalte sind das Vertrauen auf die Bibel als absolute Autorität in allen Fragen des Lebens und
der Glaube an Jesus, der durch seinen Tod und die Auferstehung die Welt erlöst hat und als Messias und Gott anzuerkennen ist.
David H. Stern brachte in Amerika beispielsweise eine Übersetzung des Neuen Testaments als „Jüdisches Neues Testament“ heraus und leitete
diese mit Bemerkungen zu den jüdischen Wurzeln oder zum Messias Jeschua ein. Erstaunlicherweise kommt hier das „Verheißung-Erfüllung“Schema voll zum tragen. Jesus erfüllt die Weissagungen des AT. Stellen wie Gen 3,15; 12,3; 17,19; 21,12; 28,14 oder Num 24,17.19 und noch
viele mehr verwiesen auf Jesus. Das NT wird von ihm als „Neue Torah“ verstanden. Ziel dieser Tora „ist der Messias, der jedem, der vertraut, Gerechtigkeit anbietet.“[25]
In Deutschland ist der Verein „Ruf der Versöhnung“ des Arie ben Israel zu nennen, der sich in den Dienst der Versöhnung von Juden und Christen
aber auch Juden und Arabern gestellt hat und eine periodische Zeitschrift gleichen Namens herausgibt, Studienaufenthalte in Israel organisiert,
Seelsorge betreibt, Altersheime und Jugendheime unterstützt. Auch wenn diese Aktivitäten als solche zweifellos positiv zu bewerten sind, bleibt
der tatsächliche Gewinn für einen partnerschaftlichen jüdisch-christlichen Dialog durch diese Gruppen gering. Mitunter wird die theologische Position dieser Gruppen, wie die Übersetzung von Stern zeigt, sogar eher hinderlich für einen Dialog sein.
50
Grundkurs Judentum
Der Jude Jesus
6. Zukunftsperspektiven
Eine wirkliche religiöse Annäherung wird es erst geben, wenn die über Jahrhunderte überlieferten gleichen Urteile und beschrittenen Wege verlassen werden. So wäre es - um abschließend nur ein Beispiel zu nennen - dringend an der Zeit, die Bedeutung der Messiasfrage für ein adäquates
Verständnis von Juden- und Christentum grundsätzlich zu hinterfragen. Dogmatische Vorverständnisse müssen neuen Ansätzen weichen. Das verdienstvollerweise gerade jüdischerseits betonte - Judesein Jesu hat konsequent ernst genommen zu werden. Juden und Christen sollten die
dogmatische Ebene verlassen und müßten sich dennoch nicht auf einen rein historisierenden Standpunkt zurückziehen. Diese Abkehr von eingefahrenen dogmatischen Sichtweisen scheint aber den Kirchen schwer zu fallen. Noch immer gilt, was Gerschom Scholem 1963 sagte: „Eine Erörterung des messianischen Problemkomplexes betrifft einen delikaten Bereich. Ist es doch hier, daß der essentielle Konflikt zwischen Judentum
und Christentum sich entscheidend entwickelt hat und fortbesteht“.[26] Eine Einsicht in die theologische Bandbreite des Judentums und der strukturelle Vergleich zwischen Tora-Theologie und Christologie könnten das jüdisch-christliche Gespräch auf theologischer Ebene enorm befruchten.
Dazu bedarf es aber nicht zuletzt in der Kirche mehr judaistisch ausgebildeter TheologInnen.
Fußnoten
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Vgl. als Überblick W. Vogler, Jüdische Jesusinterpretationen in christlicher Sicht, Weimar 1988.
E.F. Talmage (Ed.), Disputation and Dialogue, New York 1975, 293.
Vgl. dazu D. Berry, Buber´s View of Jesus as Brother, JES 14 (1977) 203-218.
D. Flusser, Jesus in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten (rowohlts monographien), Reinbek 1968, 47.
D. Flusser,Das Christentum - eine jüdische Religion, München 1990, 47f.
S. Ben-Chorin, Bruder Jesus. Mensch - nicht Messias, München 1967, 134f.
P. Lapide/U. Luz, Der Jude Jesus. Thesen eines Juden. Antworten eines Christen, Zürich u.a. 1979.
J.T. Pawlikowski, The Trial and Death of Jesus: Reflections in Light of a new Understanding of Judaism, ChicStud 25 (1986) 79-94, u.a.
B. Chilton, Jesus within Judaism, in: J. Neusner (Ed.), Judaism in Late Antiquity II (HO 17), Leiden u.a. 1995, 262-284.
D.A. Hagner, An Analysis and Critique of Modern Jewish Study of Jesus, Grand Rapids 1984.
Vgl. zu diesem Punkt Hagner, Analysis (Anm. 10) 105ff.
Vgl. dazu die zusammenfassende Darstellung bei L. Swidler, Der umstrittene Jesus (Kaiser Taschenbücher 130), Gütersloh 1993, 59-67. Vgl.
H. Falk, Jesus the Pharisee, New York 1985.
Heute selten, vgl. z.B. R. Eisler, Jesus basileus ou basileusas, 2 Bde., Heidelberg 1929f.
G. Vermes, Jesus der Jude. Ein Historiker liest die Evangelien, Neukirchen 1993.
Vermes, Jesus (Anm. 14) 139f.
Vermes, Jesus (Anm. 14) 271-273.
Vermes, Jesus (Anm. 14) 274.
D. Harrington, The Jewishness of Jesus: Facing Some Problems, CBQ 49 (1987) 1-13.
C. Thoma, Das Messiasprojekt. Theologie jüdisch-christlicher Begegnung, Augsburg 1994.
Thoma, Messiasprojekt (Anm. 19) 335f.
51
Grundkurs Judentum
21
22
23
24
25
26
52
Der Jude Jesus
Vgl. die Arbeiten von F. W. Marquart oder C. Thoma.
Vgl. etwa: S. Heschel, Jüdisch-feministische Theologie und Antijudaismus in christlich-feministischer Theologie, in: L. Siegele-Wenschkewitz
(Hg.), Verdrängte Vergangenheit, die uns bedrängt. Feministische Theologie in der Verantwortung für die Geschichte, München 1988, 54103. In neuerer Zeit erschienen zwei wichtige Sammelbände: C. Kohn-Ley/I. Korotin (Hg.), Der feministische „Sündenfall“, Wien 1994; L.
Schottroff/M.-T. Wacker (Hg.), Von der Wurzel getragen. Christlich-feministische Exegese in Auseinandersetzung mit Antijudaismus (Biblical
Interpretation Series 17), Leiden u.a. 1996. In letzterem wenden sich christliche Theologinnen gegen die antijudaistische Ausdeutung der Bibel. Hervorzuheben ist der Artikel von M.S. Gnadt, „Abba isn´t Daddy“. Aspekte einer feministisch-befreiungstheologischen Revision des Abba Jesu, 115-131.
Schlangenbrut 51 (1995) 13.
So zumindest nach D.H. Stern, Das jüdische Neue Testament. Eine Übersetzung des Neuen Testamentes, die seiner jüdischen Herkunft
Rechnung trägt, Stuttgart 1994.
Stern, Testament (Anm. 24) XXVI.
G. Scholem, Zum Verständnis der messianischen Idee im Judentum, zuletzt in K. Koch/J.M. Schmidt (Hg.), Apokalyptik (WdF 365), Darmstadt 1982, 327-369: 327.
Grundkurs Judentum
Tempel und Synagoge
Die Bedeutung von Tempel und Synagoge im Judentum
Zusammenstellung für den Grundkurs
Im Qumranschrifttum, in weiten Teilen des äthiopischen Henoch, in der Testamentenliteratur, in den Psalmen Salomos, in der Himmelfahrt des
Mose und wohl noch anderswo werden messianische Gestalten beschrieben, die in beachtenswerter Parallelität zu den Eigenschaften des Johannes Hyrkan stehen. Im Grunde kommen vier Kennzeichen des Messias (oder der Messiasse) mehr oder weniger ausgeglichen zum Tragen: Die
messianischen Gestalten - teilweise auch schon ihre Vorgestalten - kommen 1. aus dem vertraulichen Umgang mit Gott her, und sie tragen 2. hohepriesterliche, 3. fürstliche und 4. prophetische Züge an sich.1
Das hohepriesterliche Amt war an den Tempel als Zentrum der religiösen Identität des Volkes gebunden. Der Tempel war daher von Anfang an mit
Hoffnungen, Erwartungen und auch Enttäuschungen verbunden. Seine Zerstörung unter Nebukadnezzar und seine Entweihung unter Antiochus
IV. demütigten das Selbstbewußtsein des Volkes und führten zur dringenden Hoffnung nach Erneuerung und Wiederaufbau, einte der Tempel
doch spätestens seit der Reform des Joschija im 7.Jh.v. alle Teile Israels zu einem Gottesvolk, das sich wenigstens dreimal jährlich anläßlich der
großen Feste hier einfinden sollte, um gemeinsam vor Gott der Befreiung aus der Knechtschaft, der Gabe der Tora und des Landes und der
Früchte dieses Landes zu gedenken und freudig zu feiern. Die zwischentestamentliche Zeit war ebenfalls geprägt von der Hoffnung auf Erneuerung des Tempels, geschürt durch die Einweihung durch Judas Makkabäus nach seinem Sieg über die Griechen und durch die hasmonäischen
Versuche einer Wiederbelebung des Kultes. Die Qumranleute erhofften dagegen eine vollständige Erneuerung des Tempelkultes, da ihnen die
Jerusalemer Reformen nicht genügten und sie diese als Gott mißfällig erachteten (CD 6,2-21 u.a., vgl. vor allem die Tempelrolle). Messianische
Hoffnung und Tempelkulterneuerung können zusammengehören, ja werden nicht zuletzt nach der endgültigen Zerstörung des Tempels 70n. besonders akut. Gerade dieser Zusammenhang wirft ein bezeichnendes Licht auf die Aktion des Herodes, der daranging, mit dem Bau eines der bedeutendsten Gebäude der Antike sich selbst ein Denkmal zu setzen. Der Tempelbau des Herodes, dessen Spuren bis heute Pilger und Touristen
fasziniert und dessen bautechnische Leistung die antiken Historiker schwärmen ließ, kann wohl mit gutem Recht auch als Zeichen latenten messianischen Anspruches der herodianischen Familie gesehen werden.
Da traten einige auf und machten folgende Zeugenaussage gegen ihn: Wir haben ihn sagen hören: Ich werde diesen mit Händen gemachten
Tempel niederreißen und in drei Tagen einen andern, nicht mit Händen gemachten, erbauen. Aber auch in diesem Falle stimme ihr Zeugnis nicht
überein
heißt es bei Mk 14,57-59. Auch wenn Mt 26 diese Aussage zusehens entschärft und ein direktes Jesuswort nicht mehr zu eruieren sein wird, so
bleibt hier und durch die prophetische Zeichenhandlung der Tempelreinigung der tempelkritische Zugang Jesu unbestritten. Er steht damit in guter
jüdischer Tradition, unterstreicht die messianische Bedeutung des Tempels, ohne selbst Angaben über die Art und Weise der Neugestaltung zu
machen. Das menschliche Bauwerk wird seiner Aufgabe jedoch augenscheinlich nicht gerecht.
Und wenn Kinder zu dir sagen: Laßt uns gehen, wir wollen den Tempel aufbauen! dann höre nicht auf sie. Und wenn Greise zu dir sagen: Komm,
wir wollen den Tempel niederreißen! dann höre auf sie. Denn der Aufbau von Kindern ist ein Niederreißen, und das Niederreißen von Alten ist ein
Aufbau
1
Messiasprojekt 132.
53
Grundkurs Judentum
Tempel und Synagoge
soll Johanan ben Zakkai nach ARN B 31 (66f.) gesagt haben. Die kritische Sicht des Tempelbaus wird hier nach der Zerstörung 70 noch deutlicher
als zuvor. Die Erneuerung des Tempels wird mehr und mehr zur eschatologischen Hoffnung, die Menschen nicht einlösen sollen. Dies trifft
schließlich auch auf die Tempelbaupläne des Kaisers Julian (361-363) zu.
Zwischen 67 und 70, also am Höhepunkt des Aufstandes gegen Rom, wird von den radikalen Kräften, den Zeloten, ein Steinmetz zum Hohepriester ausgerufen, Pinchas ben Samuel aus Chafta. Josephus überschüttet diese Tat mit Spott (Bell 4,147-157). Tatsächlich aber stammte dieser
Pinchas aus zadokidischer Familie und sollte wohl nach den umstrittenen Hohepriestern der hasmonäischen Linie wieder unumstritten, auch für
die Qumran-Leute akzeptabel sein. War er vielleicht gar in messianischer Absicht an die Spitze gesetzt worden? Dies läßt sich kaum mehr entscheiden, verliert sich doch seine Spur 70 im Untergang des Tempels selbst. Wahrscheinlich war er unter den Toten, da Titus alle Priester hinrichten ließ. Der Hebräerbrief, v.a. das Kap. 7 bringt einen Nachhall auf die hohepriesterlich-messianische Dimension, wenn er Christus als letzten
Hohepriester schlechthin darstellt.
54
Grundkurs Judentum
Tempel und Synagoge
Der Tempel. Ort der „Nichtdarstellung“ Gottes
Von David Banon (Strassbourg-Lausanne)
WuUdB (Der Tempel) 33-37
Die Errichtung des Heiligtums (hebr. Mischkan) beherrscht den Großteil der letzten Kapitel des Buches Exodus: Kapite12,5 bis 31 und 35 (Vers 4)
bis 40. Dieses Heiligtum steht so im Zentrum von vier Sabbatperikopen ( am Sabbat gelesene Verse). Die beiden ersten handeln vom „Auftrag“
und den Einzelheiten des geplanten Vorhabens, während die beiden letzten sich der Umsetzung und einer Bestandsaufnahme und Wertung widmen. Eingeschoben zwischen diese Bibelstellen taucht die Episode vom Goldenen Kalb auf, wobei immer wieder auf die Errichtung des Heiligtums
verwiesen wird.
Ein Zugeständnis? Daß dem Heiligtum ein so großer Stellenwert zukommt, wirft schon deshalb Fragen auf, weil die Errichtung eines Mischkan
nach den Zehn Geboten, der wichtigsten Quelle der biblisch-jüdischen Glaubenslehre, nicht vorgesehen ist. Das Projekt kommt erst an späterer
Stelle und wie zufällig ins Gespräch. Nach dem Midrasch soll das Heiligtum auf Drängen des jüdischen Volkes entstanden sein:
Herr des Universums, die Könige der Völker,
besitzen Paläste, in denen man einen Tisch findet,
Kerzenleuchter und andere Zeichen des Königtums,
so daß sie als solche erkennbar sind. Und Du, unser König, Befreier und Retter,
Sollst Du kein Zeichen des Königtums haben,
damit alle Bewohner auf Erden erkennen,
daß du der König bist?
(Midrasch Haggada, Teruma 27,1)
Das Zeltheiligtum - und der später nach seinem Vorbild errichtete Tempel waren trotz des Gesamtaufbaus, der symbolträchtigen Materialien, des
Weiheritus und des Bauauftrages durch Gott, nur ein notwendiger Kompromiß, ein Zugeständnis an die Natur des Menschen, der die Vorstellung
von einem unsichtbaren Gott, vom deus absconditus, nicht akzeptieren kann. In Ex 25,8 heißt es: „Macht mir ein Heiligtum! Dann werde ich in ihrer
Mitte wohnen.“ Ein rätselhafter Vers! Fast scheint die elementare Grammatikregel, wonach das Verb angeglichen werden muß, mißachtet worden
zu sein: Der im Singular ('ein Heiligtum') beginnende Vers endet mit einem Plural ('unter ihnen').
Statt diesen „Druckfehler“ zu korrigieren, versuchen ihm die Lehrmeister des Midrasch auf den Grund zu gehen. Nach einer Erklärung lasse Gott
sich nicht auf einen einzelnen Aufenthaltsort festlegen. Er beschränke sich nicht nicht auf einen umgrenzten Raum, sei nicht lokalisierbar, nicht auf
einen Raum festzunageln. Auch wenn einer der Namen Gottes in der jüdischen Überlieferung „Ort“ (Hamakom) bedeutet, ist dieser Name im Sinne des Midrasch zu verstehen: Rav Huna sprach im Namen von Rav Ami: Warum bezeichnet man das geweihte Heilige auch als Makom? Weil Er
der Ort der Welt ist und Seine Welt Ihm nicht als Wohnstatt dienen könnte. (Genesis Rabba 68,10; siehe auch Raschi zu Ex 33,2)
Mit anderen Worten: Gott ist „ortlos“. Er umschließt alle Orte der Welt und geht über sie hinaus (und falls er eine Wohnstätte hat, kann er mit ihr
nicht gleichgesetzt werden. Vgl. Jes 6,1). Deshalb wenden sich die Lehrmeister des Midrasch gegen den Glauben der Heidenpriester, sie könnten
das Heilige festhalten, es einsperren oder auf einen Punkt festnageln.
Der Wunsch nach dem Bau eines Heiligtums bedeutet folglich einen Rückschritt, eine Nachahmung der Götzendiener, einen Ausdruck der Unfähigkeit, Gott mit Herz und Geist zu dienen, ohne zu versuchen, ihm ein greifbares Äußeres zu geben, das doch immer nur Zerrbild sein kann. Und
55
Grundkurs Judentum
Tempel und Synagoge
wie um den Unterschied zwischen der monotheistischen Lehre („der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel für meine Füße“ Jes 66,1;
Levitikus Rabba 30,2) und dem Götzendienst (der sich unter anderem im ortsansässigen Lokalgott ausdrückt) aufrechtzuerhalten, wie um dem
gefährlichen, aber nicht ausrottbaren Bedürfnis nach Nachahmung Einhalt zu gebieten, beschreibt die Bibel minutiös und detailliert dieses tragbare
Heiligtum, ein Bollwerk gegen das Goldene Kalb, in dem nichts, aber auch gar nichts, an den Götzendienst erinnert.
Eine leere Kultstätte als Aufnahmeort des Wortes.
Das Zeltheiligtum kann theologisch als Reaktion auf den Turmbau zu Babel begriffen werden, hinter dem die Absicht gesteckt hatte, sich „einen
Namen zu machen“, während es jetzt eben darum ging, einen „Namen zu heiligen“. Hatte Babel für den Sturmangriff auf Gott gestanden, so sollte
das Heiligtum Gottes Wort in sich aufnehmen. Griff der Turm zwischen Himmel und Erde Platz, so stand das Zelt für die Verneinung jeder Gebundenheit an einen bestimmten Ort. Denn in Babel hatten die Menschen ihre Identität darin gesehen, den Raum durch seine Weihe zu beherrschen,
die Distanz zwischen sich und der unendlichen Sphäre des Göttlichen durch die Errichtung eines gewaltigen Bauwerkes zu überbrücken. Dieser
Turm, der fest in der Erde verankert bis in den Himmel hinaufreichen sollte, bedeutete die Verabsolutierung des Raumes, durch die die zeitliche
Dimension - und vor allem das gesprochene Wort - verdrängt wurde.
Das Heiligtum ist nur insofern ein räumlicher Bezugspunkt, als in ihm das Wort angesiedelt werden soll. Als Örtlichkeit dient es lediglich der Mahnung und dem Angedenken daran, daß der Dialog mit Gott möglich und im Gange ist. Erst durch das Wort erhält das Heiligtum als Raum Bedeutung, Richtung und somit Sinn. Folglich wird mit dem Heiligtum eine Verwurzelung in der unpersönlichen Natur, eine räumliche Festlegung Gottes
vermieden, daher auch seine Bezeichnung „Zelt der Begegnung“ (Ohel moed).
Entgegen mystischen Anschauungen, die Räume zu Heiligtümern erheben, indem in ihnen ortsgebundene Götter angesiedelt werden, steht das
Heiligtum der Bibel vornehmlich für die zeitliche Dimension. Das Mischkan (oder Mikdasch) ist ein Zelt, das weniger Gott als vielmehr dem Menschen zugedacht ist. Mit Blick auf Gott ist er ein „Nicht-Ort“, eine Mahnung, daß dem Herrn keine Wohnstätte zugewiesen werden kann, sondern
ein Ort, an dem der Mensch stets erneut zur Einhaltung des Gesetzes (Exodus Rabba 34,1) ermahnt und zur Verantwortung gerufen wird. Zogen
die Israeliten nicht zum Heiligtum, um dem Wort zu lauschen? Um seinen Befehlen zu gehorchen oder um bei Verstößen Buße zu tun? Nicht zufällig wird der später errichtete Tempel als 'Debir' (von dabar = Wort) bezeichnet (1 Kön 6ff), ein Ausdruck für einen Raum, für ein Forum par excellence, für das Zwiegespräch mit Gott. Das Heiligtum bereitet durch das Lauschen des Gottesworts die Gotteserkenntnis vor. Es verkittet Risse,
überwindet Gräben und verkürzt Distanzen, doch kann es weder die auf dem Sinai vernommenen Worte - die Zehn Gebote und andere (Ex 21) noch das Gesetz ersetzen. Verweist uns das Heiligtum durch seine räumliche Dimension nicht an jene Art der Offenbarung, die „Rede“ ist? An das
Wort, das an jemanden gerichtet wird, das auf den anderen zugeht? Dies verringert die Gefahr, Gott über seinem Auffangbecken, seiner Wohnstatt, zu vergessen.
Begegnet uns hier nicht die naive Überraschung des Titus? Seine Verblüffung, als er nach der Erstürmung und Plünderung des Tempels im Allerheiligsten nur Leere, nur ein Nichts antrifft? Nichts hinter den Vorhängen! Nichts als ein leerer Raum! Denn das Heiligtum wird zum Ausdruck ohne
Inhalt, sobald man das Wort, das zwischen den Flügeln der Cherubim über der Bundeslade vernehmbar war, aus ihm vertrieben hat; wenn man
zwar Opfergaben darbringt und sich vor der Bundeslade verneigt, aber dabei die in den steinernen Tafeln eingemeißelten Gesetze mißachtet und
mit Füßen tritt. Wer so handelt, verneigt sich vor einer leeren Hülle, mißachtet, absichtlich oder nicht, den Inhalt des Wortes. Das Heiligtum bildet,
wie im Midrasch Haggada (Teruma 27,1) angedeutet, keineswegs ein Symbol des Königtums oder einfach ein Zeichen. Um wahrgenommen und
beachtet zu werden, muß es auf ein anderes, nicht räumliches, sondern zeitliches Zeichen verweisen. Nur der im vierten der Zehn Gebote verankerte Sabbat wird (Ex 31, 13 und 17) explizit „Zeichen „ genannt. Dagegen wird weder das Heiligtum noch eines seiner Bestandteile je mit diesem
Namen belegt.
56
Grundkurs Judentum
Tempel und Synagoge
Seltsam bleibt also der Zweck dieses Ortes: Er umschließt eine Leere, die das Wort in sich aufnehmen, es organisieren soll. Er hat die Aufgabe,
das Wort auf andere auszurichten, es ihnen zu verkünden, vor allem denen, die noch nichts von ihm mitbekommen haben. So hatte das Heiligtum
auf Erden nur dann einen Sinn, „wenn es seinem Zweck nach zum Thron in der Höhe ausgerichtet ist (maschon/meschuwan: Wohnstatt/ausgerichtet)“. (Ex 15,17; vgl. Talmud Jeruschalmi, Berachot, Kap. 4 Halacha 5). Und worin besteht diese Ausrichtung hin zur Transzendenz,
wenn nicht in der Sorge für den anderen und in der Errichtung einer gerechten Gesellschaft oder zumindest eines „Rechtsstaates“.
Wichtig ist auch das „Mobiliar“ im Heiligtum, seine Materialien, Bestandteile und Funktionen: die Bundeslade mit den cherubim, der Tisch mit den
Schaubroten, der Leuchter, der Rauchopferaltar und der Brandopferaltar. Auch dieses Mobiliar steht für die grundlegend soziale Symbolik des Heiligtums - die keine Gelegenheit zur Flucht in den Mystizismus bietet. So symbolisiert der Tisch mit den Schaubroten beispielsweise die dauerhafte
Verantwortung der politischen Macht - der Könige - gegenüber dem Hunger der Menschen. Es handelt sich nicht direkt um das Brot einer symbolischen Gemeinschaft, sondern um ein Brot, das den Hunger der Menschen stillt und nur so Anspruch auf den Symbolwert eines Brotes der Gemeinschaft erheben kann. Im Kult ging es darum, die Opferbrote, die Brote des Angesichts, in einem Gestus der Erhebung und Heiligung vom
Marmortisch auf den goldenen Tisch und in die Münder der Priester zu befördern. Zudem diente der Brandopferaltar, der eherne Altar, als Ort der
Selbstbeherrschung, an dem der Mensch lernte - oder zumindest lernen sollte -, seine Triebe zu kontrollieren.
So begriffen, symbolisiert das Heiligtum den Gestaltungsort der rechtlich-politischer Institutionen der Gesellschaft Israels. Während Athen um die
Agora zentriert ist, steht der Tempel im Zentrum des Staates und der Gemeinschaft der Kinder Israels, und dies ohne Götterstatue und ohne eine
Priesterkaste mit unumschränkter Macht. Im Heiligtum ruht vielmehr die Lade mit den Statuten des Bundes, mit anderen Worten, die Tora. Diese
zentrale Schrift bildet die einzige Existenzberechtigung des Tempels, über ihre Vermittlung wohnt die Gottheit in der Stadt. Tempel oder Tora sind
so die Zeugnisse des nicht darstellbaren Gottes, also Zeugnisse seiner Abwesenheit oder paradoxalen Gegenwart, die notwendig ist für den Fortbestand einer Welt, die aus der Scheidung vom göttlichen Wesen hervorgegangen ist.
Der Tempel als gesellschaftlicher und politischer Kodex Israels
Das Verbot, Gott darzustellen, ist so im Zentrum der Macht verankert, und nur in diesem Sinn ist der Tempel Schauplatz der Machtausübung oder
vielmehr die Quelle der Macht. In dieser Hinsicht kommt der Bundeslade, in der die Statuten des Bundes, also die Tora, verwahrt werden, kardinale Bedeutung zu. Dabei geht es weniger um die Gegenwart des Gesetzes als darum, daß sie der Ausgangspunkt aller Gesetze ist, die Quelle, aus
der die Menschen zur Schlichtung von Streitigkeiten und zum Aufbau ihrer Gesellschaft schöpfen. Wenn also Tempel und Tora Zeugnisse des
nicht darstellbaren Gottes sind, wenn der Tempel die Quelle aller Gesetze und jeder Macht ist, dann gründet sich der jüdische Staat auf ein Vakuum, auf eine Abwesenheit.
Wer kontrolliert den Tempel als Quelle der Macht? Nicht die Priesterkaste. Hinter dem System seiner Verwaltung steht ein ganz eigenes Modell.
Um dies zu verstehen, muß man sich vergegenwärtigen, daß das Volk Israel in Stämmen organisiert ist.
Einer dieser zwölf Stämme hat an der Aufteilung des Bodens keinen Anteil, so daß er nicht über ein eigenes Territorium verfügt: der Stamm Levi,
dessen Erbteil allein Gott ist (Num 26,62; Jos 13,14 und 18,17) und der für den Kult und für den Tempel verantwortlich zeichnet. Charakteristisch
für die jüdische Priesterschaft ist damit die Besitzlosigkeit im Hinblick auf Territorium und Boden. Leviten steht lediglich städtischer Hausbesitz zu:
Sechs Asylstädte und 42 weitere „Städte“, in denen ihnen Boden zum Wohnen, nicht aber zur Bewirtschaftung zugewiesen ist (Num 35,1-8). Kraft
dieses Prinzips erhalten die Leviten den Zehnten von den besitzenden Stämmen als Ausgleich und Ersatz dafür, daß ihnen ein Einkommen aus
Grundbesitz verwehrt bleibt. Deshalb zählen sie in der Bibel auch gewöhnlich zu den Armen in der Stadt („...und die Leviten, die ja nicht wie du
Landteil und Erbbesitz haben, die Fremden, die Waisen und die Witwen...“ (Dtn 14,29), die beim Almosengeben nicht übergangen werden sollen.
57
Grundkurs Judentum
Tempel und Synagoge
Obwohl die Leviten so als „Parias“ erscheinen, ist ihre Funktion im Staatsgefüge von enormer Bedeutung: Innerhalb der politischen Gemeinschaft
stehen sie für das „Prinzip der Nicht-Vertretung“, was bedeutet, daß ihnen nicht jene Mittlerrolle zwischen Gott und den Gläubigen zukommt, die
den Kern der theokratischen Herrschaft bildet. Dieses Prinzip spiegelt sich auch in Unterteilung des Stammes der Leviten in zwei Funktionen wider: Während die Familie Aarons (die Priester) die Aufgabe des Opferpriesters erfüllt, sind die eigentlichen Leviten mit Gesängen, dem Tempeldienst, der Lehre und der Gerichtsbarkeit betraut (2 Chr 19,8-11 ). Diese Aufgaben werden nach dem Rotationsprinzip auf die 24 Klassen der Leviten verteilt, wobei jedes Amt die Erfüllung eines anderen ausschließt. Daß der Tempel der Autorität der Priester untersteht (nur der Hohepriester
tritt einmal jährlich zu Jom Kippur ins Allerheiligste ein), bedeutet keineswegs, daß diese Autorität sich über die Tempelmauern hinaus auf die gesamte Gesellschaft erstreckt (was man angesichts der zentralen Bedeutung des Tempels innerhalb des Staates erwarten könnte). Deshalb haben
die Meister des Midrasch den Begriff des Mischkan als Akrostichon gesehen, hinter dem sich eine Verfassung verbirgt.
*Als Akrostichon: Sie zerlegen das Wort Mischkan in seine Bestandteile, also in die Buchstaben mem, schin, kaf und nun, die dann als Anfangsbuchstaben neuer Wörter gelten. Daraus ergibt sich folgende Aufstellung.
Melech König
Schofet Richter
Kohen Priester
Navi Prophet
*Als Verfassung: Sie umfaßt die vier Ämter, die in drei aufgehen, da Königtum und Richteramt in Personalunion ausgeübt werden. Doch ist diese
Verfassung keineswegs starr; sie stellt vielmehr eine Art institutionelle Grundlage dar, aus der sich die einzelnen Funktionen und ihre Bedeutung
herleiten. Da das Richteramt über allen anderen Ämtern steht, kommt dem König eine herausragende Stellung zu; zunächst einmal deshalb, weil
diese Funktionen gegenüber der Gesetzgebung, der Kriegführung oder der Repräsentation höheres Ansehen genießt. Dann auch deshalb, weil
der König mit ihr eine weitere Aufgabe, ein Amt der Berufung (Ex 18,13-27), erhält. Andererseits ist der König nicht nur der Melech, sondern auch
der „Gesalbte“ (Maschiah, aus dem sich das Wort Messias ableitet). Diese Salbung durch den Richter-Propheten, die ein ganzes Geschlecht erhebt, ist freilich an Verpflichtungen geknüpft, denen sich der Gesalbte nicht entziehen kann, ohne vom Propheten als dem Garanten des Gesetzes
zur Ordnung gerufen zu werden.
Aber hat dies so immer funktioniert? Blieb die Integrität dieser Institutionen trotz der Begierden und Intrigen der Menschen, trotz ihrer Winkelzüge
und Raffinessen erhalten? Anscheinend nicht! Bekannte Gründe haben im dreizehnten Herrschaftsjahr des Joschija (637-609 v. Chr.) und unter
seinen Nachfolgern Jojakim und Zidkija zum Bruch des Bundes geführt: Mißachtung von Freiheit und Gerechtigkeit, das Scheffeln von Reichtümern, die Weigerung, sie weiter zu verteilen, usw.
Anzuführen ist hier zudem der Abfall des Königs (König Zidkija erfüllt seine Pflichten zu keinem Zeitpunkt), die Verweltlichung der Priesterschaft (
die sich mit dem Zehnten nicht mehr begnügen und den Propheten mundtot machen wie Paschhur, der Jeremia schlagen und in den Bock spannen läßt, vgl. Jer 20, 1-6 ), sowie das Auftauchen von Lügenpropheten. So manifestiert sich die Auflösung der oben erwähnten Verfassung.
Der Mensch als Heiligtum Gottes
Die einzige Möglichkeit, eine heilsame Krise auszulösen, das Volk wachzurütteln und es vom Irrweg auf die Wege des Lebens zurückzuführen, ist
der Appell an die Teschuwa. Wörtlich genommen, bezeichnet dieser hebräische Ausdruck weniger Reue als vielmehr Umkehr, also eine Rückbesinnung auf sich selbst, auf sein innerstes Wesen und damit auf Gott. Der Ausdruck beinhaltet so eine Richtungsänderung und Neuorientierung.
Aber Teschuwa bedeutet zugleich auch Antwort. Der Akt der Rückbesinnung auf sich und Gott ist eine Antwort auf die Verirrungen der Institutionen. Sind diese Institutionen folglich überflüssig? Es scheint so! Denn das wahre Heiligtum Gottes ist der Mensch. Dies ist denn auch der Sinn des
58
Grundkurs Judentum
Tempel und Synagoge
oben angeführten Verses: „Macht mir ein Heiligtum! Dann werde ich in ihrer Mitte wohnen.“ (Ex 25,8) Die Gegenwart Gottes ist nicht anders denkbar als unter dem Volk Israel, unter den Menschen, „ um ihr Gebet und ihren Dienst zu empfangen“ (Kommentar des italienischen Rabbiners Sforno aus dem 16. Jh. zu Ex 25,8). „Ich werde mitten unter den Israeliten wohnen und ihnen Gott sein. Sie sollen erkennen, daß ich der Herr, ihr Gott
bin, der sie aus Ägypten herausgeführt hat, um in ihrer Mitte zu wohnen, ich, der Herr, ihr Gott.“
(Ex 29,45-46). Auch Salomo erinnert an diese Gewißheit: „Wohnt denn Gott wirklich auf der Erde? Siehe, selbst der Himmel und die Himmel der
Himmel fassen dich nicht, wieviel weniger dieses Haus, das ich gebaut habe.“
(1 Kön 8,27). Der Prophet Jeremia formuliert dies in kraftvollen Worten als Gebot:
„Ich habe euren Vätern, als ich sie aus Ägypten herausführte, nichts gesagt und nichts befohlen, was Brandopfer und Schlachtopfer betrifft. Vielmehr gab ich ihnen folgendes Gebot: Hört auf meine Stimme, dann will ich euer Gott sein, und ihr sollt mein Volk sein. Geht in allem den Weg, den
ich euch befehle, damit es euch gut geht.“
(Jer 7,22-23). Die einzige Forderung, das einzige Gebot, besteht darin, auf Gottes Stimme zu hören. Und dies wiederum heißt, sein Wort empfangen, zu Ihm zurückkehren und Teschuwa tun. Wenn aber Gott in des Menschen Innersten, in seiner Seele, keine Wohnstätte fände, wäre jede
Teschuwa vergeblich. Des Herrn erste Gnade besteht darin, daß Er den Menschen zu seiner Wohnstätte macht. Und als weitere Gnade zieht Er
sich aus dem einzelnen auch dann nicht zurück, wenn er gefehlt und das Heiligtum seines Innersten besudelt hat. Anscheinend residiert Gott auch
dann in den Tiefen der Seele, wenn der Mensch zum Sünder wird. Der amerikanische Rabbiner Soloveitchick ( 1903-1993 ) drückte es so aus:
„Gott hat zwei Wohnorte im Inneren des Menschen. Der eine ist das Heiligtum der Tugenden und Gefühlsregungen: Güte, Barmherzigkeit, Gottesfurcht, Freude, Kummer, Verwunderung usw. Der andere ist das Heiligtum der Vernunft. Wenn der Mensch nachsinnt oder die Tora studiert, wenn
er seinen Verstand schärft und ihn heiligt, wird er zur Residenz Gottes.“
Doch bedeutet dies keineswegs, daß das Zusammenleben Gottes mit den Menschen immer nur harmonisch verläuft, als sei es eine Glückseligkeit. Vielmehr bereitet es im wesentlichen Schmerzen, denn es erfordert andauernde Anstrengungen, seine Triebe, Neigungen und Begierden zu
zügeln. Denn das heißt, das „Joch“ des höchsten Gottes anzunehmen, den Willen Gottes auf dem Altar der Transzendenz zu heiligen.
59
Grundkurs Judentum
Tempel und Synagoge
Clemens Leonhard
„Als ob sie vor mir ein Opfer dargebracht hätten“
Erinnerungen an den Tempel in der Liturgie der Synagoge*
Problemstellung
Mit dem Dialog, der von E. Fleischer über den Ursprung der jüdischen Pflichtgebete angeregt wurde, ist die Frage nach der historischen und theologischen Verwandtschaft zwischen der Liturgie des Tempels und der Synagoge untrennbar verbunden.2 Dabei ist zunächst an den Ursprung der
jüdischen Liturgie zu denken und zu untersuchen, welche Beziehung sie zum Tempel und seiner Zerstörung hat; ob sie nach 70 gleichsam aus
dem Nichts geschaffen wurde oder ob sie auf Vorläufer zurückgeht, die viele ihrer Charakteristika schon zur Zeit, als der zweite Tempel noch bestand, aufweisen. Die Beziehung der jüdischen Liturgie zum Tempel endet aber nicht im ersten Jahrhundert. Im Gegenteil, die Liturgie des Tempels bleibt für die Liturgie der Synagoge ein unverzichtbarer Bestandteil ihres Verständnisses im ganzen und mancher ihrer rituellen Details. Die
Beziehung zwischen Tempel- und Synagogenliturgie ist dabei nicht nur in der Rekonstruktion des Verständnisses der Frühzeit problematisch, sondern bleibt ein spannungsvolles Thema in der Liturgiegeschichte. Fragen wie die wertende Distanz zum Tempel und die Kontinuität von Institutionen und Interpretationen der Tempelliturgie in der Synagoge werden in den Epochen der Liturgiegeschichte unterschiedlich beantwortet und hinterlassen ihre Spuren in den Riten und Texten. Die umfassende Beschreibung dieser Beziehung ist eine Aufgabe, die die Möglichkeiten eines Aufsatzes übersteigt.
Im folgenden Essay soll in den ersten Texten des Gebetbuchs nach den Spuren der Auseinandersetzung mit der Liturgie des Tempels gesucht
werden. Die gefundenen Stellen sind Anregungen für die folgenden Überlegungen und kein vollständiges Repertoire zur Tempelthematik im Gebet. Aus ihnen ergeben sich zwei Haltungen zur Tempelliturgie (in der Synagogenliturgie), die im Anschluss daran kurz auf ihre Wurzeln in der
rabbinischen Literatur hin untersucht werden. Die Zusammenfassung bündelt die Beobachtungen für den Einstieg in Detailanalysen. Die folgenden
Überlegungen sind ein Versuch, wichtige Fragen zu stellen, keine Sammlung von Antworten auf dieselben.
*
2
60
Mein besonderer Dank gilt der österreichischen Akademie der Wissenschaften für die Freistellung zur Forschung, die mir durch das Stipendium des APARTProgramms gewährt ist. Der vorliegende Beitrag ist eine überarbeitete Fassung des Referats, das ich am 11.01.2001 am Sonderforschungsbereich in Bonn auf die freundliche Einladung von Prof. Dr. Albert Gerhards halten durfte. Ich danke Prof. Dr. Günter Stemberger für die ausführliche Diskussion des Themas vor meinem Referat und die
Lektüre einer Version dieses Aufsatzes sowie für zahlreiche Hinweise auf Literatur und Stellen der rabbinischen Texte. In seinem Aufsatz (2001, im Druck) diskutiert er
wichtige Aspekte der Thematik dieses Essays in einem breiteren literarischen und historischen Rahmen. Rabbinische Texte sind (wenn nicht anders angegeben) nach BarIlan University/Responsa Project 1999. Global Jewish Database. Ramat Gan: Bar-Ilan Research and Development Company Ltd. [CD-ROM Version 7.0] zitiert.
Fleischer (1989/90). Langer (1999, vgl. auch 2000) fasste die Diskussion zusammen, worauf Fleischer (2000) kritisch reagierte und kurz seine Position darlegte. Falk (2000)
präsentiert die Ergebnisse der Erforschung möglicher Parallelen zwischen in Qumran belegten liturgischen Texten und der späteren Liturgie der Synagoge. Am Tempel
selbst ist die Gleichzeitigkeit des Vollzugs der Opferliturgie und einer Gebetsliturgie durch das Schweigen, mit dem die Opfer dargebracht wurden, ausgeschlossen, vgl.
Knohl (1996). Der Ausdruck bishtiqa „(etwas) schweigend (tun)“ kommt in den Talmudim und der Tosefta fast ausschließlich im Kontext der Opfer vor (G. Stemberger).
Liturgie als Gebet war daher vom Tempel als Ort der Opferliturgie per definitionem getrennt. Zum Gottesdienst der Synagoge vgl. Van der Horst (1999). Weinfeld (1988,
482f) erreicht unter anderem durch die Gleichsetzung von da‛at – in einer Benediktion von 1QS – und tora, dass bereits die Liturgie von Qumran die wesentlichen Elemente des Anfangs des späteren Morgengebets, bzw. in diesem Fall die Benediktion über die Toralektüre, enthielt. Er macht allerdings keine Angaben zur Torarezitation, wie sie im Mittelalter durch die Lektüre von Num 28 ins Morgengebet aufgenommen wurde. Es ist daher nicht auszuschließen, dass die Benediktion über die Tora
auch eine Folge der erst später belegten Rezitation gewisser Passagen aus ihr war. An dieser Stelle weist ihr Text als Privatgebet die größte Variationsbreite auf, Heinemann (1977, 171f).
Grundkurs Judentum
Tempel und Synagoge
Bibeltexte und Gebete zu Beginn des täglichen Morgengebets
Die jüdische Tagzeitenliturgie sieht für Werktage drei Gebete vor (Morgen-, Nachmittags- und Abendgebet), die am Shabbat um das Musaf erweitert werden. Die Namen der Horen erinnern bereits an die Liturgie des Tempels. Morgen- und Abendgebet sind zwar Begriffe, die die bloße Tageszeit bezeichnen, Mincha (Gebet am Nachmittag, bzw. vor dem Abend) und Musaf verweisen allerdings bereits auf die Opfer, die zur jeweiligen
Zeit im Tempel dargebracht wurden. Auf die zeitliche Übereinstimmung zwischen den Opfern der Vergangenheit und den Gebeten der Gegenwart
wurde Wert gelegt: „Rabbi Jehoshua Ben Levi sagte: ‚Die Gebete richteten sie entsprechend der Tmidim [der immerwährenden Opfer am Morgen
und am Abend jeden Tages] ein’“ (bBer 26b, vgl. tBer 3,1ff).3
Wer ein traditionelles jüdisches Gebetbuch aufschlägt, gelangt zu den Benediktionen zum Händewaschen, zum Anlegen von Tallit und Tfillin sowie
zum Dank dafür, nach der Nacht wieder heil erwacht zu sein (vgl. yBer 4,2 7d). Die kurzen Benediktionen sind von bBer 60b angeregt, wo der
Lobpreis Gottes in die Verrichtungen des Tages integriert wird, z. B.: „Gepriesen bist du GOTT, unser Gott, König der Welt, der uns durch seine
Gebote geheiligt hat und uns die Händewaschung geboten hat.“
Seit Amram (Ben Sheshna) Gaon (gest. ca. 875) ist dieser Abschnitt durch liturgische Dichtungen erweitert worden. Schon zu Beginn interpretiert
sich der Beter, der die Synagoge betritt, in der aus Bibelzitaten zusammengestellten Dichtung „Wie schön sind deine Zelte, Jakob…“4 als einer der
in den Tempel schreitet: „Und ich komme in der Fülle deiner Gnade in dein Haus. Ich werfe mich zum Allerheiligsten deiner Heiligkeit in Furcht vor
dir hin“ (Ps 5,8).
Die Gebete dieses Abschnitts gehören zu den jüngsten Teilen des Morgengebets.5 Sie wurden lange als Privatgebete betrachtet und erst langsam
und keineswegs überall in die öffentliche Liturgie der Synagoge vor dem eigentlichen Morgengebet integriert. Trotzdem sind sie in ihrem Grundbestand bereits Teil des ältesten überlieferten Gebetbuchs (Amram Gaon).6 Die hohe Popularität und Autorität des Gebetbuchs von Amram Gaon
führten jedoch dazu, dass Vervielfältigung und Überarbeitung ineinander flossen und den Urtext unerreichbar machten.7 Die Gebete sollten vom
Vorbeter der Synagoge gesprochen werden, damit niemand, der sie nicht rezitieren konnte, vom Vollzug ausgeschlossen war.8
Diesen kurzen Benediktionen mit der Erweiterung durch mittelalterliche Dichtungen folgt ein Abschnitt des Torastudiums. Er besteht aus Bibeltexten, die von talmudischen Texten und späteren Gebeten ein- und ausgeleitet werden. Nachdem nun Tora rezitiert wird, konnten an dieser Stelle
Gebete gesprochen werden, die die Gelehrten des Talmud dem Torastudium zuordneten, die aber bei der liturgischen Lesung des Wochenabschnitts der Tora nicht aufgenommen worden waren. Ziel und Zweck der Auswahl der Bibeltexte und der sie umgebenden Gebete ist die Auseinandersetzung mit der Frage nach Kontinuität und Diskontinuität der Liturgie des Tempels und damit zur Frage der sakramententheologischen
Bedeutung der Liturgie von Gebet und Schriftlesung.
3
4
5
6
7
8
In diesem System wird das Abendgebet dann zum Problem, wenn es nicht am späten Nachmittag, sondern tatsächlich in der Nacht verrichtet wird, da es im Tempel keine
Opfer während der Nacht geben konnte. Maimonides integriert dadurch das Gebet ins Opfersystem, dass er auf das Weiterbrennen der Teile des (vor-)abendlichen
Tamid während der Nacht anspielt [In: Mischne Tora. Kap. Hilkhot tfilla unesiat kappayim 1,6].
Ma Tovu (Num 24,5), aus dem 11. Jh.; Elbogen (1993, 76f §12, 2).
Hoffman (1979, 128): „the last … to be codified“.
Spätere Gebetbücher enthalten Erweiterungen dieses Texts. Der Opfergedanke wird z. B. durch die Lesung von Gen 22 (Bindung Isaaks) im folgenden Kontext betont und
erweitert.
Reif (1993, 186f).
Elbogen (1993, 76). Für Maimonides war ihr Charakter als öffentliches Gebet umstritten, nicht aber die prinzipielle Verpflichtung, sie zu verrichten, Freehof (1950/51, 339ff).
61
Grundkurs Judentum
Tempel und Synagoge
Nach dem Zitat der Einsetzung des Priestersegens (Num 6,24ff) folgt im Siddur Amrams quasi einer der beiden „Einsetzungsberichte“ des Morgengebets mit Num 28,1–10, in dem das Tamid angeordnet wird.9 Die Lesung wurde durch weitere Bibeltexte erweitert, die das Szenario der Opfer präzisieren. So beginnen die Kurzlesungen heute (noch nicht bei Amram) mit Ex 30,17–21, wo es um die Herstellung der Einrichtungen für die
priesterlichen Waschungen und die Anordnung dieser Waschungen selbst geht. Lev 6,1–6 ergänzt den Text über das Tamid mit Details aus den
Geboten zum Brandopfer und dem nicht verlöschenden Feuer am Altar. Der Lesung über das Tamid folgt der Vers Lev 1,11 über die Schlachtung
und Ausschüttung des Blutes.
Die Bibeltexte über die Opfer bleiben nicht ohne rabbinisch legitimierte Exegese innerhalb der Liturgie. Mit dem langen Abschnitt „An welchem Ort
finden die Schlachtopfer statt? …“ (mZev 5,1ff) wird das Szenario weiter entfaltet. Die 13 Auslegungsregeln des Rabbi Jishmael schließen den
Abschnitt des Morgengebets ab.
Die umfangreichen Texte der Tora und der rabbinischen Literatur, die in (bzw. vor) jedem Morgengebet zu rezitieren sind, sollen nicht täglich mit
aller exegetischen Tiefe rezipiert und meditiert werden. Ihre Anwesenheit an dieser Stelle entspricht aber den ältesten rabbinischen Traditionen,
mit dem Verlust der Liturgie des Tempels einerseits intellektuell und andererseits liturgisch umzugehen. Das ist in zwei Exkursen durch Parallelen
anzuzeigen.
[Exkurs: Lesungen der Opfergesetze] Die Mischna deutet in Bezug auf die Festlesungen (mMeg 3,4ff) das älteste Lesesystem – bzw. gerade
die Unterbrechung eines nicht spezifizierten Lesesystems durch die im Kalender fixierten Feste – an. So ist zwar Ex 12,1ff als Lesung in den Wochen vor Pesach vorgesehen, am Fest selbst wird aber Lev 22,26ff gelesen. Dass am Versöhnungstag Lev 16 zu lesen ist, ist zu erwarten, weil
der Versöhnungstag nicht wie Pesach oder das Wochenfest einen historisierenden Festinhalt hat. Die Mischna sieht aber auch für das Laubhüttenfest, das schon vor 70 mit einer historischen Erinnerung an den Exodus versehen worden war (Lev 23,43), Lesungen der Opfergesetzgebung vor:
„Am ersten Tag des Laubhüttenfests liest man den Festabschnitt aus Leviticus (aus Lev 23) und an den übrigen Tagen des Laubhüttenfests den
Abschnitt über die Festopfer (Num 29,17–39)“ (mMeg 3,5). Für das Wochenfest sieht die Mischna (Meg 3,5) die Einsetzung des Fests nach Dtn
16,9 vor. Die Tosefta (Meg 3,5) kennt die Alternative Lesung von Ex 19,1ff. Dieser Text beschreibt, wie die Israeliten im dritten Monat (ca. 50 Tage) nach Pesach die Wüste Sinai erreichen. Damit wird der Ablauf des Auszugs aus Ägypten auf den Jahreskreis übertragen und die Festlesung
zur Erinnerung an den Exodus. Im Talmud (bMeg 31a) werden die beiden Texte auf den ersten und zweiten Festtag (der Diaspora) angesetzt. Eine analoge Tendenz zeigt sich zum Neujahrsfest. Am ersten Tag wird die Einsetzung des Fests und der Opfer gelesen (m/tMeg 3,5: Lev 23,24)
am zweiten Tag Gen 21,1ff (tMeg 3,6 und bMeg 31a). Das System der Festlesungen hat ursprünglich ein starkes Interesse an der Opfergesetzgebung, bzw. der Rezitation der Einsetzungstexte der Feste als Teile der Tempelliturgie. Die bereits vor der Entstehung der Mischna belegte Akkumulation historisierender Festinhalte ist für die Zeit der zitierten Quellen liturgisch nicht relevant.
[Exkurs: Das Studium der Opferliturgie] Nicht nur die Festlesungen der Synagogenliturgie betonen die Opferliturgie, sie ist auch in den Anweisungen zur Gestaltung der Tischliturgie präsent. Die Tosefta verlangt, dass man sich die gesamte Pesachnacht mit den Gesetzen, die das Pesach
(-lamm/-opfer) betreffen, befasst (tPes 10,11f): „Jeder ist verpflichtet, sich die ganze Nacht mit den Gesetzen, die das Pesach betreffen, zu beschäftigen. Sogar nur mit seinem Sohn oder nur mit sich selbst, oder sogar nur mit seinem Schüler. Eine Begebenheit mit Rabban Gamaliel und
den Ältesten, die im Haus des Baytos Ben Zonin in Lod zu Tische lagen. Sie beschäftigten sich die ganze Nacht bis zum Hahnenschrei mit den
Gesetzen, die das Pesach betreffen. [Die Tischdiener] hoben vor ihnen [die Tabletts] weg. Da wurden sie aufgestört! und gingen ins Lehrhaus [=
Bethaus].“ Wenn nach 70 kein Pesachtier mehr verzehrt werden kann, weil es nicht mehr im Tempel geschlachtet werden kann, tritt als Ersatz da9
62
Goldschmidt (1971, 3 = [Morgenbenediktionen] bet Z. 9), Übersetzung: Hedegård (1951, 16).
Grundkurs Judentum
Tempel und Synagoge
für das Studium der Pesachgesetze ein. Das Pesach ist zwar keines der Opfer, die regelmäßig im Tempel von darauf spezialisiertem Personal
durchgeführt werden (wie das Tamid), doch auch der Modus seines Ersatzes ist das Studium der es betreffenden Gesetze. Analoge Gedanken
werden (zum Zitat von Mal 1,11) auch in bMen 110a breit entfaltet.10
Darüber hinaus wird im palästinischen Talmud die Lehre Shim‛ons des Gerechten über die drei Grundfesten der Welt (Tora, Gottesdienst, Werke
der Barmherzigkeit) zweimal zur Aussage „Die Welt steht nur auf den Opfern.“ assoziiert (yTaan 4,2 68a). In yMeg 3,6 74b wird die Passage sogar
als einziger Kommentar zur Mischna über die Lesung der Opfergesetze zu Sukkot gebracht. Als Belegvers wird darauf Jes 51,16 herangezogen
und seine Textelemente auf die drei Grundfesten der Welt verteilt. Zunächst reichen „Tora“ und „Werke der Barmherzigkeit“, um „im Schatten des
Heiligen – gepriesen sei er – zu sitzen“.11 Die Auslegung von Jes 51,16 wird nach einem kurzen Einschub fortgesetzt und „das Einpflanzen des
Himmels und die Gründung der Erde“ auf die Opfer hin interpretiert. Diese Exegese wird durch die Beobachtung von Rabbi Chanina Bar Pappa
erhärtet, dass Israel („mein Volk“) nirgends in der Schrift außer hier „Zion“ genannt wird. Die Opfer bleiben in dieser Stelle des Talmud eine der
Grundfesten der Welt. Dadurch aber, dass die Passage als Argument für die Lesung der Opfergesetze gebracht wird, ist evident, wie die Opfer
nach 70 noch ihre Funktion als Säule der Welt erfüllen.
Mit den beiden Exkursen nimmt der Zweck der Rezitation der Bestimmungen über das Tamid (und der sie ergänzenden Texte aus der Tora und
der rabbinischen Literatur) deutliche Konturen an. Das Studium des Textes ist zur selben Tageszeit und mit derselben Regelmäßigkeit an die Stelle des Opfervollzugs getreten.12
Das Bild, das sich durch die Anordnung und Auswahl der Lesungen ergibt, wird durch die Gebetstexte explizit gemacht und bestätigt. Den Lesungen der Opfergesetze wird zunächst die folgende Bitte vorangesetzt: „GOTT, unser Gott, und Gott unserer Väter es möge dir gefallen, dass du
dich unser erbarmst, uns alle unsere Sünden vergibst, uns von allen unseren Verbrechen entsühnst, alle unsere Vergehen vergibst und den Tempel rasch in unseren Tagen aufbaust, damit wir vor dir das Tamidopfer, das uns entsühnt, darbringen, wie du über uns in deiner Tora durch Mose,
deinen Diener, aus dem Mund deiner Ehre geschrieben hast, so wie gesagt ist: [Es folgen die Bibeltexte.]“13 Verzeihung und Erbarmen Gottes möge im Licht des Gebets dazu führen, dass Gott die Wiederaufnahme der Opfer im Tempel ermöglicht. Die folgenden Opfergesetze erinnern Gott
daran, wonach sich der Beter im einzelnen sehnt.
Nach der Rezitation der Texte folgt ein Gebet, das einen anderen Akzent setzt: „Herr der Welten, du hast uns geboten das Tamidopfer zu seinem
Termin darzubringen, Priester in ihrem Gottesdienst, Leviten auf ihrer Tribüne und Israeliten an ihrem Standplatz zu sein. Aber jetzt ist durch unsere Verbrechen der Tempel verwüstet und das Tamid abgeschafft und wir haben weder einen Priester in seinem Gottesdienst noch einen Leviten
auf seiner Tribüne noch einen Israeliten auf seinem Standplatz. Du aber hast gesagt, ‚Wir wollen Stiere durch unsere Lippen ersetzen!’ [Hos
14,3].14 Deshalb möge es dir gefallen, GOTT, unser Gott und Gott unserer Väter, dass die Rede unserer Lippen vor dir [= von dir] angerechnet,
angenommen und mit Wohlgefallen akzeptiert sei, als ob wir das Tamidopfer zu seinem Termin und an seinem Ort und seinen Ausführungsbe10
11
12
13
14
Vgl. Stemberger (2001 im Druck, Kap. 4).
Nach der Traditionsliste sind die drei Säulen der Welt bei Shim‛on Ben Gamliel „Recht, Wahrheit und Friede“ – die Ethik kommt ohne Liturgie aus (wenn auch mAv 1,18 im
Kontext von 1,2 gelesen werden muss). Genauso tröstet Gott David darüber hinweg, dass er den Tempel nicht bauen wird, indem er Davids „Recht und Gerechtigkeit“
über die wohlgefälligen Opfer Salomos stellt (yBer 2,1 4b und seine Paralleltexte). Der Text thematisiert die Frage, wie Israel vor der Errichtung des Tempels Opfer darbrachte, nicht.
Vgl. Elbogen (1993, 79 § 12, 6).
r/v
Siddur Bet Ja‛akov, fol. 35 mit einer Rubrik, die den Gebrauch freistellt, bzw. auf Shabbate und Festtage beschränkt – ohne Rubrik in modernen Siddurim.
Die Einheitsübersetzung folgt der Septuaginta in diesem Versteil und verfehlt daher den Sinn des überlieferten hebräischen Texts. Vgl. Fine (1998, 86) und PesK 24,19.
63
Grundkurs Judentum
Tempel und Synagoge
stimmungen entsprechend dargebracht hätten.“15 Diese Bitte, die den Lesungsabschnitt des Morgengebets vor den Morgenpsalmen abschließt,
gibt den Lesungen einen anderen Sinn als die oben zitierte. Sie drückt die Hoffnung aus, dass Gott das Opfer der „Lippen“ – die Rezitation der
Bibeltexte – anstelle der Opfer selbst anerkennen möge. Dadurch werden die Texte sakramententheologisch anders qualifiziert. Die Versöhnung
mit Gott, die vor 70 auf die Opfer hin gewährt wurde,16 wird jetzt auf die Lesung hin erbeten. Die Bitte wird durch den Beleg aus Hos 14,3 theologisch legitimiert.
Die Lesungstexte sind im ersten Teil des Morgengebets durch ihren Rahmen in eine theologische Spannung eingebunden, die auf der Ebene der
Liturgie nicht mehr gelöst wird.17 In Frage steht die Haltung des Beters zur Beziehung zwischen der Liturgie des Tempels und der Synagoge. Soll
er seinen Blick auf die Zukunft richten und um die Restitution eines Zustands der Vergangenheit oder um die Anerkennung der Liturgie der Gegenwart als vollwertigen Ersatz für die Tempelliturgie beten? Bevor dieser Frage weiter nachgegangen wird, soll zunächst der Blick kurz auf die
‛Amida (das Achtzehngebet) gerichtet werden, um in einem Text höherer Dignität und Öffentlichkeit nach denselben Spuren der Auseinandersetzung mit der Tempelliturgie zu suchen. Der darauf folgende Abschnitt soll die Frage auf Texte der rabbinischen Literatur anwenden.
Zum Thema „Tempel“ in der ‛Amida
Im liturgischen Vorspann des Morgengebets wird die sakramententheologische Position, dass das Studium der biblischen Gesetze über die Opfer
deren Nachfolge angetreten hat, durch die Lesung impliziert und durch das folgende Gebet explizit zum Ausdruck gebracht. In der ‛Amida (Achtzehngebet oder einfach „Das Gebet – Ha-Tfilla“ schlechthin)18 kommt dagegen das oben zitierte Prinzip: „Die Gebete richteten sie entsprechend
der Tamidopfer ein“ zum Tragen. Nicht nur das Schriftstudium, sondern auch die verpflichtende Gebetsliturgie wird in den rabbinischen Quellen als
Entsprechung zur Tempelliturgie verstanden. Nachdem die ‛Amida neben dem Shma‛ Jisrael und den dieses rahmenden Benediktionen das wichtigste Gebet der jüdischen Tagzeitenliturgie ist, trägt sie viele Assoziationen und Konnotationen in ihren Textvarianten und in ihren Deutungstraditionen, die nicht mit dem Thema „Tempelliturgie“ zusammenhängen. Dennoch spielt es eine wichtige Rolle in ihr.
Seit der Antike (bBer 4b, 9b; yBer 4,4 8a) wird der ‛Amida (zuweilen neben anderen Versen) Ps 51,17 „Herr, öffne meine Lippen und mein Mund
wird dein Lob erzählen.“ vorangestellt. Die Anwesenheit des Verses kann im Zusammenhang mit dem vorhergehenden Vers gesehen werden, wo
der Beter analog zu V. 17 um die Rettung durch Gott bittet, was ihm ermöglichen wird, Gottes Gerechtigkeit zu jubeln. In diesem Sinn wäre Ps
51,17 eine Fortsetzung des Abschlusses der Benediktion nach dem Schma‛ (Emet we-jatsiv): „Gepriesen bist du, GOTT, der Israel erlöst hat“.19
15
16
17
18
19
64
r
Siddur Bet Ja‛akov, fol. 38 . Die beiden Gebete gehören zu den jüngsten Schichten des Gebetbuchs und finden sich z.B. noch nicht bei Amram Gaon. Sie drücken allerdings nur in den Worten des Gebets aus, was durch viele andere Quellen ebenfalls belegt ist.
Die sündenvergebende Wirkung des Tamid vor der Zerstörung des Tempels geht nicht aus den biblischen Gesetzen zum Tamid hervor, ist aber durch Neh 10,34 für die
Zeit des zweiten Tempels belegbar. Vgl. PesK 6,4.
In diesem Kontext ist die Frage zu stellen, ob eine Dichotomie zwischen der eschatologischen Erwartung der vollen Restitution des Kults und dem Bewusstsein, dass er
bereits ersetzt ist, immer als solche empfunden wurde. Je nach der eigenen wissenschaftlichen Position zu Zweck und Bedeutung der Synagogen vor 70 wird man
mehr oder weniger Fine (1998, 25) zustimmen können, dass Juden zur Zeit des zweiten Tempels gleichzeitig loyal zum Tempel sein und doch gemeinschaftliche religiöse Erfahrung in der Synagoge finden konnten. Die Ausgangstexte dieses Essays stammen aus späteren Epochen und verbieten einen leichtfertigen Brückenschlag in
die Zeit vor 70. Dennoch ist mit aller Vorsicht vor ungerechtfertigten Vergleichen davon auszugehen, dass vor 70 ein Widerspruch zwischen dem Tempel und anderen
Räumen religiöser Erfahrung nicht notwendigerweise (bzw. nicht überall) gesehen werden musste. Vgl. das Kapitel „Second Temple Period“ bei Fine (1998) und
Schreiner (1999, 374f).
Die Textvarianten der ‛Amida können im Kontext dieses Aufsatzes nicht besprochen werden.
Kimelman (1997, 126f Anm. 209), der das Thema „Befreiung“ in der ‛Amida untersucht, gibt eine Liste von Interpreten der ‛Amida, die den Vers in dieser Weise deuten.
Grundkurs Judentum
Tempel und Synagoge
Die andere Möglichkeit, den Vers im Licht der ihm folgenden Zeilen zu lesen, wurde ebenfalls erwogen.20 In diesem Sinn bittet der Beter Gott, dass
er ihm die Lippen zum Gebet in der Zuversicht, dass Gott an Schlachtopfern keine Freude hat und eigentlich „die Schlachtopfer Gottes ein zerbrochener Geist“ ist, öffnen möge. Wie die Gebete um die Schriftrezitation im Morgengebet drückt auch das Ende des Ps 51 die Hoffnung aus, dass
das Gebet das eigentlich von Gott gewünschte Opfer ist. Er erwähnt Gott in der dritten Person. Wenn sich der Beter in den letzten beiden Versen
wieder an Gott wendet, ist der Inhalt seines Gebets die Bitte um Wiederaufbau der Stadt Jerusalems und der an Gott gerichtete Ausdruck der Gewissheit, dass der in aller Ordnung eingerichtete Gottesdienst „gerechte Schlachtopfer“,21 die Gott sehr wohl gefallen werden, enthält. Die Bitte um
Wiedererrichtung des Gottesdienstes in der Zukunft und die Gewissheit, dass er in der Gegenwart durch die Liturgie des Wortes ersetzt ist, kann
sich auf denselben biblischen Text berufen.
Die Struktur der fünften und siebzehnten Benediktion der ‛Amida transportiert ebenfalls den Gedanken der Substitution der Tempelliturgie durch
das Gebet. In freier Assoziation der Prinzipien, die auch in mAv 1,222 enthalten sind, stellt die fünfte Benediktion Tora, Umkehr und Gottesdienst
einander gegenüber.23 Dabei bleibt nach dem isoliert betrachteten Text der Benediktion noch unbestimmt, ob es sich bei der Bitte, Gott möge die
Beter seinem „Gottesdienst näher bringen“, um eine erwünschte Restitution des Tempels oder die Bitte um Annahme der Gebetsliturgie anstelle
der Opfer handelt.
Ältere Versionen der ‛Amida erbitten von Gott in der siebzehnten Benediktion noch explizit die Restitution der Liturgie am Tempel.24 In diese Bitte
ist in ihrer später üblichen Form zum Gottesdienst im Tempel der Hinweis auf das Gebet (der ‛Amida) interpoliert: „Möge dir, GOTT, unser Gott,
dein Volk Israel und ihr Gebet gefallen. Restituiere den Gottesdienst zum Heiligtum deines Tempels. Nimm die Feueropfer Israels und ihr Gebet
mit Gefallen an. Der Gottesdienst Israels, deines Volkes, möge immer25 zu deinem Gefallen sein. (Einschub: ja‛ale wejavo) Mögen unsere Augen
deine Rückkehr nach Zion in Erbarmen sehen. Gepriesen bist du GOTT, der seine Shechina nach Zion zurückkehren lässt.“
Damit zeigt sich (synchron) in der ‛Amida dieselbe Dichotomie, die bei den Gebeten im Kontext der Lektüre der Opfergesetze zu sehen ist. Die
Bitte um die Restitution der Tempelliturgie bleibt nicht isoliert, sondern wird durch das Bewusstsein um die faktische Ersetzbarkeit derselben erweitert. Dazu ist nachzufragen, wie diese Vorstellungen in den geistesgeschichtlichen Kontext des rabbinischen Judentums passen, bzw. ob sie sich
selbst in einen historischen Rahmen dort einfügen lassen.
20
21
22
23
24
25
Kimelman (1997, 217 Anm. 211) zitiert Abudarham (verf. 1340), der sich seinerseits auf bBer 26b beruft.
In Dtn 33,19 sind es die „Völker“, die diese Schlachtopfer auf dem „Berg“ darbringen. Die „Völker“ sind nach Raschis Pentateuchkommentar die „Völker der Stämme Israels.“ Er will offenbar eine Verbindung mit Mal 1,11 vermeiden.
„Shim‛on der Gerechte … pflegte zu sagen: ‚Die Welt steht auf drei Dingen: auf der Tora, auf dem Gottesdienst und auf Werken der Barmherzigkeit.’“ Vgl. dazu Schreiner
(1999) und die von ihm zitierten Belege, die im folgenden vorausgesetzt werden. mAv ist ein junger Text und die ihm vorgeschaltete Liste ihm gegenüber sekundär, vgl.
Stemberger (1996). Er ist kaum als Quelle liturgischer Texte anzunehmen, wenn diese vor der Endredaktion der Talmudim entstanden sein soll. Das Logion kann der
Liturgie aber aus anderen rabbinischen Quellen bekannt sein (yTaan 4,2 68a).
Diese Analyse folgt Kimelman (1997, 188–190).
Kimelman (1997, 190). Vgl. auch die ‛Amida aus der Geniza (seit 1898 mehrmals gedruckt, z. B. bei Elbogen 1993, 396 einfach zugänglich): „16. Möge es dir, GOTT, unser
Gott, gefallen, dass du in Zion wohnen mögest und deine Diener dich in Jerusalem bedienen mögen. Gepriesen bist du GOTT, den wir dich in Furcht bedienen wollen“.
Das Wort „bedienen“ (la‛avod) bezieht sich auf den (Gottes-) Dienst, ‛avoda.
Kimelman übersetzt (1997, 190): „May the Tamid offering of the ‛avodah of Israel, Your people, be acceptable to You …“. Das Verb tehi stimmt grammatikalisch eher mit
‛avodat Jisrael als mit tamid überein. Damit wäre tamid als Adverb „immer“ und nicht als Substantiv „Tamidopfer“ zu übersetzen. Vgl. Elbogen (1993, 50).
65
Grundkurs Judentum
Tempel und Synagoge
Anmerkungen zu rabbinischen Quellen
Die Bewegung der Rabbinen gewann erst nach und nach an Bedeutung innerhalb des Judentums26 und hat dabei auch Haltungen anderer (z. B.
priesterlicher) Kreise übernommen. Die Rabbinen spielten zu Beginn der Zeit nach 70 in der Entwicklung der Synagoge und ihrer Liturgie nicht die
wichtigste Rolle. So verbietet eine Baraita27 neben der Imitation (bzw. Rekonstruktion) von Tempelarchitektur in der Synagoge vor allem den Einsatz eines siebenarmigen Leuchters. Archäologische Daten (vor allem nach der Zeit der Tannaiten) und die Texte, die siebenarmige Leuchter verbieten, beweisen, dass sie sehr wohl üblich waren. Während die zur Aufbewahrung der Tora gehörigen Elemente der Architektur schon hinreichend an der Heiligkeit der Tora partizipierten, lag es für den Rest des Gebäudes (wie auch der Leuchter) nahe, in anderer Hinsicht Annäherungen
an den Tempel zu versuchen.28 Die von der Tora abgeleitete Heiligkeit der Synagoge stand außer Frage. Die Meinungen zwischen den Rabbinen
und anderen geistigen Strömungen des Judentums gingen nur darin auseinander, ob und wie weit der Tempel als konkretes Vorbild für die Synagogen verstanden werden sollte.
Die Tannaiten erklärten wenige und marginale Elemente der Liturgie durch deren (tatsächliche oder rückdatierte) Vorläufer im Tempel. Der
Wunsch, dass der Tempel „rasch in unseren Tagen“ wiedererrichtet werde, findet sich selten und mitunter an Positionen im Text, die sie als spätere Zusätze erscheinen lassen.29 Mit SivDev 41 wird das Gebot von Dtn 11,13, Gott zu „dienen“, auf Torastudium und Gebetsgottesdienst (zitiert
u. a. Ps 141,2) gedeutet. Ob die 17. Bitte der ‛Amida um Wiedererrichtung Jerusalems und Restitution der Liturgie des Tempels tatsächlich die
Grundhaltung der tannaitischen Zeit ausdrückt, müsste daher detaillierter bewiesen werden.30 Die Sehnsucht nach der Wiedererrichtung des Tempels hielt sich in Grenzen und die Liturgie des Gebets wurde sorgfältig von zu viel Nostalgie dem Tempel gegenüber freigehalten. Die älteren rabbinischen Lehrer positionierten sich in großer Distanz gegenüber der Tempelliturgie. De facto konnte damit auch der höchste Respekt vor dem
Jerusalemer Tempel aufrecht erhalten werden.
Nach der Zeit der Tannaiten wurde das Verhältnis von Tempelliturgie und Gebet/Torastudium häufiger expliziert.31 Spätere Autoritäten erbitten daher im Gebet die Wiedererrichtung des Tempels (yBer 4,2 7d: Rabbi Jannai – bBer 44a: Rabbi Dimi). Gleichzeitig (Rabbi Pinchas als Tradent der
26
27
28
29
30
31
66
Vgl. Stemberger (1999).
bRHSh 24af. Vgl. Fine (1998, 48f) für weitere Belege und eine Diskussion derselben.
Fine (1998, 49).
mTam 7,3: ein sekundärer Zusatz am Ende des vorletzten Abschnitts des Traktats? Analog dazu ist der Wunsch als letzter Satz von mTaan (4,8) belegt. Am Ende von Kap.
2 (9) von tRHSh ist der Gedanke im Namen von R. Jochanan ben Zakkai mitgeteilt. Vgl. Stemberger (2001, Kap. 1.1) und die Diskussion von mPes 10,6 dort. Die folgende Geschichte steht im Kontext des Verbots, am Shabbat in der Nacht Tora zu lesen. In tShab 1,13 ist nach dem [nicht vorsätzlichen] Neigen einer Lampe am
Shabbat auf die Tafel des Tannaiten Jishma‛el Ben Elisha‛ geschrieben: „Er hat das Licht am Shabbat geneigt [damit ausreichend Öl an den Docht kommt]. Sobald der
Tempel wiedererrichtet ist, wird er ein Sündopfer darbringen.“ Der Gedanke ist wohl im Irrealis des Eschatons gehalten (vgl. auch mMSh 5,2, bRHSh 30a und Paralleltexte). „Als ob der Tempel in seinen Tagen gebaut worden wäre,“ ist nach Rabbi Elazar der Zustand eines Menschen, der „Einsicht/Weisheit“ erworben hat (bBer 33a,
bSan 92a). Vgl. Fine (1998, 50ff).
Fine (1998, 52f).
Die Diskussion um ein mögliches Echo der Politik Kaiser Julians in der rabbinischen Literatur bleibt hier unberücksichtigt (s. Stemberger 2001 im Druck, Kap. 2.5 und
Schreiner 1999). Immerhin kann dadurch die Frage nach Restitution und/oder Substitution des Tempels näher zum Zentrum des theologischen und exegetischen Interesses gerückt worden sein.
Grundkurs Judentum
Tempel und Synagoge
Lehre von Rabbi Hoshaja) und im selben Traktat gilt der, der „im Bethaus das Gebet verrichtet als ob er ein reines Opfer (mincha) dargebracht
hätte“ (yBer 5,1 8d).32
Ähnlich wie in der späteren Liturgie des Morgengebets und in den unterschiedlichen amoräischen Quellen verarbeitet PesK 6 aus der Tradition
geerbte theologische Probleme und Desiderata im Kontext der Zerstörung des Tempels.33 Das Predigtkapitel geht von Num 28,2, dem Abschnitt
über die Tamidopfer aus. Damit ist die Brücke zur Rezitation dieser Texte im Morgengebet geschlagen. Der Prediger weist zuerst entschieden und
mit vielen Belegen den Gedanken, dass Gott Speise und Trank benötigt, zurück. Abschnitt 3 beginnt damit, die doppelte Anordnung der Tamidopfer (Ex und Num) zu thematisieren. Die ersten beiden Erklärungen ordnen die Gebote verschiedenen Epochen der Geschichte Israels zu – der
Text aus Num schärft danach jeweils ein, dass die in Ex gebotene Praxis des Tamid nicht aufgegeben werden soll. Über den Tempel wird dabei
noch nichts gesagt – auch nicht über eine Zeit nach seiner Zerstörung. Sind die Tamidopfer also „für alle Generationen (ledorot)“ angeordnet? Ein
Zitat der Mehrheitsmeinung leitet zur Spiritualisierung der Opfer über: „Die Rabbinen sagen: ‚Das eine für das Studium und das andere zur tatsächlichen Ausführung’“.34 Der Auftrag, die Opfergesetze zu studieren, ist danach keine Erfindung der Rabbinen nach 70, sondern von Gott selbst
in der Tora positiv für alle Zeiten vorgesehen.35 Alternativ dazu sagt Rabbi Acha im Namen von Rabbi Chanina Bar Pappa: „Damit die Israeliten
nicht sagen mögen: ‚Früher haben wir Opfer dargebracht und uns damit beschäftigt. Jetzt aber, da wir keine Opfer darbringen, wieso sollten wir
uns mit ihnen beschäftigen?’, sagte der Heilige, gepriesen sei er: ‚Sobald ihr euch mit ihnen beschäftigt, ist es so wie wenn ihr sie darbringt.’“ Auf
derselben Linie liegt auch die folgende Interpretation von Mal 1,11. Die Erwähnung des „reinen Opfers“ (das außerhalb Jerusalems technisch undenkbar ist) durch den Propheten beweist, dass das Studium der Opfergesetze als Ersatz für die Opfer im Sinn der heiligen Schrift ist. Das sechste Kapitel schließt (nicht in allen Textzeugen) mit einer Diskussion zwischen Mose und Gott, die in mehreren Schritten darauf hinausläuft, dass die
vorgeschriebenen Opfer (vor allem das Tamid) mit ihrem tatsächlichen Wert weit unter der theoretisch vor Gott bestehenden Schuld liegen. Die
Versöhnung mit Gott, die er an die Opfer gebunden hat, ist und bleibt daher sein Geschenk. PesK bricht damit den Gedanken einer mechanischen
Verhältnismäßigkeit36 und damit einer sachlichen Notwendigkeit der Opferliturgie. Das Kapitel endet aber nicht mit den Aussagen über den Ersatz
der Opfer, sondern – indem es in die Zeit des Mose zurückblickt – mit der positiven Feststellung der von Gott eingesetzten, bzw. gewährten, Bedeutung und Wirkung der Opfer.
Die Rezitation der Opfertexte zu Beginn des Morgengebets und die später eingefügten Bitten um Restitution der Tempelliturgie und Annahme des
Schriftstudiums anstelle derselben sind durch Aussagen der rabbinischen Literatur gedeckt. Dasselbe gilt für die Gleichzeitigkeit dieser Aussagen.
Ältere Autoritäten tendieren dazu, die Frage nicht zu explizieren. In amoräischer Zeit stehen beide Alternativen nebeneinander, ohne dass ein Wi32
33
34
35
36
Vgl. Fine (1998, 86).
Vgl. zu dieser Thematik in PesK Stemberger (2001 im Druck, Kap. 2.3).
Mandelbaum (1962, 117f) erklärt in der Anmerkung den Unterschied aus der Formulierung der beiden Texte: Ex 29,38: „Das ist, was du auf dem Altar tun wirst (bzw. tun
sollst)…“; Num 28,1: „Befiehl den Kindern Israels und sage zu ihnen…“. Num 28 enthält die explizite Aufforderung; Ex 29 einen Hinweis darauf, was in der Zukunft sein
wird.
Was nach 70 noch erhalten ist, wird in dieser Strategie (Suche nach Elementen der tatsächlichen Kontinuität) auch als das eigentlich wirksame Prinzip vor 70 gesehen. Den
Versöhnungstag betreffend wird dieses Prinzip in tYom 4,16f, yYom 8,7 45c, ySan 10,1 27d, yShevu 1,6 33c ausgeführt: „Es gelten den Bock betreffende Bestimmungen, die nicht für den Versöhnungstag gelten und den Versöhnungstag betreffende, die nicht für den Bock gelten, wobei der Versöhnungstag ohne den Bock sühnt, aber der Bock nicht ohne den Versöhnungstag. Es gilt die den Bock betreffende Bestimmung, dass der Bock sofort sühnt; der Versöhnungstag aber erst, sobald es dunkel wird.“ Jenseits des Festtags selbst ist nach 70 nichts geblieben. Der Tag wird daher zum Wirkungsgrund vor 70 und der Bock zu einem vergleichsweise unbedeutenden Faktor, der die Versöhnung um ein paar Stunden nach vor verlegt.
Vgl. Schreiner (1999, 385) und Stemberger (2001 im Druck, Kap. 4) darüber, dass das Torastudium als weit wirksamer als die Opfer erachtet wurde.
67
Grundkurs Judentum
Tempel und Synagoge
derspruch zum Thema der Erörterung gemacht würde. Dieser Umstand kann in unterschiedlichen Traditionsströmen liegen. Wahrscheinlich wurde
die Widersprüchlichkeit nicht in der Schärfe gesehen, wie sie heute erscheinen mag. Das Morgengebet und die zitierten rabbinischen Texte zeigen, dass Restitution und Substitution viel näher beieinander liegen, als das auf den ersten Blick erscheinen mag. Die Hoffnung auf die Restitution
sichert die Notwendigkeit der Substitution und das Bewusstsein, dass die Liturgie angerechnet wird „als ob…“, garantiert gleichzeitig die Weiterwirkung der Liturgie in der Gegenwart und verhindert das selbstzufriedene Versinken im Provisorium.
Zusammenfassung
Die Zerstörung des Jerusalemer Tempels bleibt in der jüdischen Liturgie ein Thema, das nicht mehr umgangen werden kann. Die unterschiedliche
Deutung der Wichtigkeit der Tempelliturgie könnte historisch dadurch geklärt werden, dass der Wunsch nach Restitution der Tempelliturgie und die
Gewissheit, dass sie in der Synagogenliturgie und im Schriftstudium längst ersetzt ist, verschiedenen Epochen oder Trägergruppen zugeordnet
werden. Sie können aber in dasselbe theologische System integriert werden, indem durch die Bitte um Restitution der Tempelliturgie deren Unverzichtbarkeit und Unersetzbarkeit ausgedrückt wird. Diese Aussagen verhindern eine billige Nachahmung oder Kontinuität im Kleinen. An den Rändern der rabbinischen Literatur werden derartige Tendenzen sichtbar (und abgelehnt, wie zum Beispiel der Brauch, weiterhin Pesachtiere zu verzehren). Eine reguläre Wiederaufnahme der Opferliturgie wurde nie versucht und war immer unerwünscht. Die Hoffnung auf den eschatologischen
Tempel verhindert de facto seine Wiedererrichtung. Gleichzeitig werden liturgische Institutionen der jeweiligen Gegenwart als Ersatz der Tempelliturgie oder sogar als dieser überlegen dargestellt und verstanden. Vorläufer der Institutionen der liturgischen Gegenwart wurden darum in der Zeit
vor 70 gesucht oder dahin zurückdatiert, weil sie so selbstverständlich geworden waren, dass sogar die Liturgie des Tempels ohne sie als defizient
erscheinen hätte können. Die Theorie des Ersatzes der Tempelliturgie bedarf der Korrektur durch diese eschatologische Perspektive. Wenn sich
die gegenwärtige Liturgie als aus sich selbst wirkmächtige Erbin der Tempelliturgie versteht, verliert sie schließlich selbst an Dignität durch die implizite Herabminderung ihres Vorbilds und ihrer Vorgängerin. Aus diesem Grund bleibt die Betonung der prinzipiellen Unersetzbarkeit (durch die
Bitte um Restitution) und der faktischen Ersetzung (durch die Bitte um Gewährung der Wirkungen der Tempelliturgie) auch weiterhin in einer
Spannung bestehen, die nicht aufgelöst werden soll.
Zitierte Literatur
Elbogen, I. 1993. Jewish Liturgy. A Comprehensive History. By Ismar Elbogen. Philadelphia – Jerusalem – New York. [Translated by R. P.
Scheindlin. Based on the original 1913 German edition and the 1972 Hebrew edition edited by Joseph Heinemann, et al.]
Falk. D. K. 2000. „Qumran Prayer Texts and the Temple“ In: D. K. Falk, F. G. Martínez, E. M. Shuller (Hgg.), Sapiential, Liturgical and Poetical
Texts from Qumran. Proceedings of the Third Meeting of the International Organization for Qumran Studies. Oslo 1998. Published in Memory of
Maurice Baillet. Leiden – Boston – Köln (StTDJ 35), 106–126.
Fine, S. 1998. This Holy Place. On the Sanctity of the Synagogue during the Greco-Roman Period. Notre Dame, IN (CJAn 11).
Fleischer, E. 1989/90. „On the Beginnings of Obligatory Jewish Prayer“ In: Tarbiz 59, 397–441 [hebr.].
Fleischer, E. 2000. „On the Origins of the ‛Amidah: Response to Ruth Langer“ In: Prooftexts 20, 380–284.
Freehof, S. B. 1950/51. „The Structure of the Birchos Hashachar“ In: HUCA 23, 359–364.
Goldschmidt, D. 1971. Seder Rav Amram Gaon. Jerusalem.
Hedegård, D. 1951. Seder R. Amram Gaon. Part I. Lund.
Heinemann, J. 1977. Prayer in the Talmud. Forms and Patterns. Berlin – New York (SJ 9).
68
Grundkurs Judentum
Tempel und Synagoge
Hoffman, L. A. 1979. The Canonization of the Synagogue Service. Notre Dame, IN (SJCA 4).
Kimelman, R. 1997. „The Literary Structure of the Amidah and the Rhethoric of Redemption“ In: W. G. Dever und J. E. Wright (Hgg.), The Echoes
of Many Texts: Reflections on Jewish and Christian Traditions. Essays in Honor of Lou H. Silberman. Atlanta, GA (Brown Judaic Studies 313),
171–218.
Knohl, I., 1996. „Between Voice and Silence: the Relationship between Prayer and Temple Cult“ In: JBL 115, 17–30.
Langer, R. 1999. „Revisiting Early Rabbinic Liturgy: The Recent Contributions of Ezra Fleischer“ In: Prooftexts 19, 179–204.
Langer, R. 2000. „Considerations of Method: A Response to Ezra Fleischer“ In: Prooftexts 20, 384–387.
Mandelbaum, B. 1962. Pesikta de Rav Kahana. According to an Oxford Manuscript…Vol. 1. New York.
Reif, S. C. 1993. Judaism and Hebrew Prayer. New Perspectives on Jewish Liturgical History. Cambridge [Repr. 1995].
Schreiner, S. 1999. „Wo man Tora lernt, braucht man keinen Tempel. Einige Anmerkungen zum Problem der Tempelsubstitution im rabbinischen
Judentum“ In: B. Ego, A. Lange und P. Pilhofer (Hgg.), Gemeinde ohne Tempel. Community without Temple. Zur Substituierung und Transformation des Jerusalemer Tempels und seines Kults im Alten Testament, antiken Judentum und frühen Christentum. Tübingen (WUNT 118),
371–392.
Siddur: Ja‛akov von Emden (Hg. und Kommentator, gest. 1776), Siddur Bet Ja‛akov. Teil 1. … Edition: Lemberg 5664 [= 1903/04; Repr. Israel o.
J.].
Stemberger, G. 1996. „Die innerrabinische Überlieferung von Mischna Abot“ In: H. Cancik, H. Lichtenberger und P. Schäfer (Hgg.), Geschichte –
Tradition – Reflextion. Festschrift für Martin Hengel zum 70. Geburtstag. Band I. Judentum. Tübingen, 511–527.
Stemberger, G. 1999. „Die Umformung des palästinischen Judentums nach 70: Der Aufstieg der Rabbinen“ In: A. Oppenheimer und E. MüllerLuckner (Hgg.), Jüdische Geschichte in hellenistisch-römischer Zeit. Wege der Forschung: Vom alten zum neuen Schürer. München (Schriften
des Historischen Kollegs 44), 85–99.
Stemberger, G. 2001 (im Druck). „Reaktionen auf die Tempelzerstörung in der rabbinischen Literatur“ Erscheint in: J. Hahn (Hg.), Zerstörungen
des Jerusalemer Tempels. Tübingen (WUNT).
Van der Horst, P. W. 1999. „Was the Synagogue a Place of Sabbath Worship Before 70 CE?“ In: S. Fine (Hg.), Jews, Christians, and Polytheists in
the Ancient Synagogue. Cultural Interaction During the Greco-Roman Period. London – New York (Baltimore Studies in the History of Judaism),
18–43.
Weinfeld, M. 1988. „The Morning Prayers (Birkhoth Hashachar) in Qumran and in the Conventional Jewish Liturgy“ In: RdQ 49–52, 481–494.
69
Grundkurs Judentum
Tempel und Synagoge
Gerhard Langer
Bemerkungen zum sozialgeschichtlichen Hintergrund der Entwicklung der Synagoge, Protokolle zur Bibel 2, 1993,
47-59
Herkunft und Entwicklung der Synagoge als Zentrum jüdischen Glaubenslebens und als Kristallisationspunkt der rabbinischen Lehre und Ausbildung sind trotz zahlreicher Publikationen1 noch immer mit vielen Rätseln behaftet. Es erscheint jedenfalls schwer belegbar, eine Institution wie die
der Synagoge vor der Hasmonäerzeit anzusetzen. Der Begriff synagogé freilich dürfte sich zuerst auf die Versammlung der Gläubigen und erst in
zweiter Linie auf ein dazugehöriges Gebäude bezogen haben. Voll entwickeln konnte sich die Einrichtung der Synagoge erst nach der Zerstörung
des Tempels (70 n.) in Jerusalem. Er war vor allem in der Zeit des Herodes Zentrum der jüdischen Glaubenswelt und - dies ist in dem hier untersuchten Zusammenhang von Bedeutung - ökonomisches Herz des Landes.
1. Der Tempel unter Herodes als ökonomische Größe und die Entwicklung bis zur Tempelzerstörung
Unter Herodes dem Großen wurde nicht nur römische Kunst und Architektur aus dem Westen importiert. Auch seine Ökonomie richtete sich an
Rom aus. Schon zu Beginn seiner politischen Laufbahn war Herodes gezwungen, Antonius gewaltige Summen als `Geschenke' zur Erhaltung seiner Freundschaft zu überweisen. Beträchtliches Familienerbe sowie vor allem die Pacht der Balsampflanzungen bei Jericho und die der kyprischen Kupferbergwerke ermöglichte es dem Idumäer allerdings, diese Zahlungen mehr als zu kompensieren. Außer den Leistungen an römische
Edelleute und an Familienmitglieder gab Herodes Unsummen für seine Prachtbauten aus, für das Herodium, den Hafen in Caesarea, die Zitadellen und die Paläste in Jerusalem und Masada, den Palastkomplex in Jericho, für Städtebauten, Wassersysteme und vor allem für den Bau des
vielleicht imposantesten Gebäudekomplexes der damaligen Zeit, den Tempel in Jerusalem. Die Finanzierung solcher Bauten war nur unter der
Auflage zahlreicher Steuern möglich.2 So betrug die Ertragssteuer für Agrarprodukte 1/5 bis 1/3 bzw. bei Früchten die Hälfte des Ertrags, dazu
kam eine Bodensteuer, eine Kopfsteuer, Handels- und Gewerbesteuern und Zwangs`geschenke' zu bestimmten Anlässen. Eine der bedeutendsten Einnahmequellen war die Halbscheqelsteuer für das Heiligtum in Jerusalem. Sie war seit der Hasmonäerzeit zu einer jährlichen Abgabe gemacht worden, die von jedem Mann über 13 Jahren zu entrichten war. Der Scheqel zur Zeit des Herodes hatte den Wert einer Tetradrachme, die
vier römischen Denaren entsprach. Die zwei Denare waren in tyrischem Standard zu entrichten. Als Tyrus 19 v. aufhörte, seine Münzen zu prägen, übernahm der Tempel in Jerusalem diese Aufgabe. Alle tyrischen Scheqel wurden fortan dort geprägt. Bei einer minimalen Schätzung der
jüdischen Bevölkerung auf zwei Millionen ergäbe sich ein jährliches Einkommen von einer Million Denaren für den Tempel allein aus der Halbscheqelsteuer. Dies hätte nach der Schätzung von Broshi3 etwa 10-15% der Einkommen des Herodes ausgemacht. Entsprechend der - ideologisch unverdächtigen - Aussage von Scheqalim IV,2 konnte das Geld für Belange des Tempels aber auch für die Stadt im allgemeinen verwendet
werden, für Aquädukte, Mauer- und Turmbauten u.v.m. Dazu kam, dass die große Zahl von Pilgern, die jährlich vor allem zu den Hauptfesten an
den Tempel kam, Priesterabgaben, Geschenke und (Geld für) Opfertiere mitbrachte, die zum Reichtum des Tempels und dem der herodianischen
Familie entschieden beitrugen.
Neben der sozialen Dominanz des Tempels ergab sich ein weiterer konfliktträchtiger Spannungsbereich in dem Umstand, dass die herrschende
`Klasse'4 in Judäa dem hellenistischen und römischen Kulturbereich nacheiferte. Davon zeugt bis heute, um nur ein Beispiel zu nennen, die erhaltene Einrichtung des sog. `Verbrannten Hauses' im jüdischen Viertel der Jerusalemer Altstadt. Bereits in der Hasmonäerzeit hatte sich Widerstand
70
Grundkurs Judentum
Tempel und Synagoge
gegen deren Religionspolitik nicht nur aus Kreisen der Qumran-Bewegung geregt. Der Tempel und die Tempelverwaltung lagen in der Hand von
Menschen, die für einen beträchtlichen Teil der Bevölkerung nicht legitimiert dazu waren. Diese Kritik kam zum einen aus der konservativen Ecke,
wo man sich ein reines, unverfälschtes Priestertum an einem kultisch intakten Tempel erträumte, zum anderen aber auch aus jener Gruppe von
engagierten Laiengelehrten, die eine Zukunft des Judentums weniger im statischen Vollzug des Opfergottesdienstes erblickte, sondern in der weiterführenden Beschäftigung und Auslegung der Tora. Weiters gab es in ihr sozialkritische Kreise, die sich nicht nur gegen die Ausbeutung durch
Rom, sondern auch gegen die soziale und politische Vorherrschaft der Mächtigen in Jerusalem richtete.5 Es wäre vereinfachend, darunter jene
Leute zu verstehen, die landläufig als `Pharisäer' in der wissenschaftlichen Literatur einen festen Platz haben, da eine Näherbestimmung bislang
umstritten und eine eindeutige Zuordnung unmöglich ist.6 Sicherlich waren im Sanhedrin Pharisäer und Sadduzäer vertreten. Auch die Größe dieser Gruppe ist umstritten, ebenso ihre Einstellung zu Rom, die nicht einheitlich gewesen sein dürfte.
Die rabbinische Bewegung nun war eine Sammelbewegung, die nach der Zerstörung des Tempels auch priesterliches Material aufnahm, das im
Laufe der Zeit wieder stärker in den Hintergrund trat. Die Rabbinen einfach als Fortsetzung der Pharisäer zu bezeichnen, ist jedenfalls einseitig
und nicht haltbar.
Dies alles wirkte auf die Entstehung der Synagoge mit ein. Der Tempel als ökonomisches und kultpolitisches Zentrum des Landes hatte seine Bedeutung verloren. Die Opfertheologie wurde aufgehoben in der Auseinandersetzung mit den religiösen Schriften und Traditionen, die Macht der
herrschenden Klasse am Tempel hatte schlagartig aufgehört. An Stelle des einen Zentrums Tempel entstanden viele kleinere Versammlungszentren oder wurden, falls sie schon bestanden, aufgewertet. Die Halbscheqelsteuer war nun nicht mehr an das Heiligtum, sondern direkt an den Kaiser zu entrichten. Neue Einflussbereiche taten sich auf. Für das einfache Volk ergab die Ablösung des Tempels durch den Synagogengottesdienst
bedeutende Änderungen allein schon dadurch, dass es ab nun nicht mehr allein Sache einer besonderen Priesterklasse war, im Zentrum des Kultes zu wirken, während die Menschen in verschiedenen Vorhöfen in `gebührlicher' Distanz zu den Vorgängen im Heiligtum gehalten wurden. Die
gesamte Versammlung der Gläubigen war nun an einem Ort konzentriert, nicht mehr geschieden in Priester und Laien, zumeist auch nicht mehr
geschieden zwischen Männern und Frauen. Wie Brooten7 im 6. Kapitel ihrer Arbeit überzeugend nachweist, findet man in den wenigsten antiken
Synagogen Hinweise auf eine Frauenempore oder eigene Abteilungen für Frauen. Die Synagoge demokratisierte Israel, sie entmachtete den Klerus und gab Verantwortung an Laienkräfte ab.
Bevor ich über die Verantwortlichen handle, will ich jedoch noch einmal auf den Ursprung und die Bedeutung der Synagoge zurückkommen.
2. Die Diasporasynagogen und ihre Bedeutung
Das älteste archäologisch belegte Gebetshaus8 befand sich nicht in Israel, sondern in der Diaspora. Es ist das von Delos auf den kleinen Zykladen, wo sich einst ein berühmtes Apolloheiligtum befand. Seine Entstehungszeit reicht in das 2. vorchr. Jh.9 Der Grundriss zeigt einen großen
rechteckigen Saal, der mit Steinbänken umsäumt war. Im Süden befand sich ein Hof, vor dem Eingang ein Peristyl. Dieser Bau wurde im 1. Jh. v.
verändert, indem man den Betsaal durch eine Mauer abteilte und an der Westwand einen Sitz - wohl für den Leiter des Gottesdienstes - errichtete.
Es war ein typischer Profanbau im Stil eines Versammlungssaals. Es fehlen Hinweise auf eine besonders reichhaltige Ausstattung oder kultisch
hervorgehobene Räume. Neben Gebetsräumen dürften diese Bauten auch Versammlungsplätze gewesen sein. Möglicherweise spielten sie auch
eine Rolle als Gebäude für den Unterricht, waren aber kaum Ersatz für den Tempel in Jerusalem.
In Jericho wurde erst vor kurzem die älteste Synagoge im sog. Hl. Land ausgegraben, die um etwa 75-50v. gebaut wurde.
71
Grundkurs Judentum
Tempel und Synagoge
Viele, auch galiläische Synagogen sind im antiken Basilikastil erbaut, ebenso der Glanz der hellenistischen Diaspora, die Synagoge von Alexandrien, die 116 n., knapp 80 Jahre nach ihrer Erbauung, zerstört worden war. Von ihr heißt es in TSukka IV,6 (L 273)10: „Es sprach R. Jehuda: Jeder,
der nicht gesehen hat die Doppelgalerie von Alexandrien in Ägypten hat nicht gesehen den Glanz Israels in seinem Leben. Sie war von der Art
einer großen Basilika, eine Galerie innerhalb einer anderen. Manchmal gab es darin doppelt soviele (Menschen) als die, welche aus Ägypten auszogen, und 71 Throne aus Gold waren dort entsprechend den 71 Ältesten, jeder einzelne 25 Myriaden wert und eine hölzerne Bima in der Mitte.
Der Chazzan der Gemeinde steht auf ihr, und Tücher11 sind in seiner Hand. (Irgend)Einer beginnt zu lesen, und dieser (der Chazzan) winkt mit
den Tüchern, und sie antworten: Amen! auf jeden einzelnen Segensspruch; dann winkte jener mit den Tüchern und sie antworteten: Amen! Und
sie saßen nicht durcheinander, sondern die Goldschmiede bei ihresgleichen, die Silberschmiede bei ihresgleichen und die Weber12 bei ihresgleichen, die Bergleute13 bei ihresgleichen und die Schmiede bei ihresgleichen. All das warum? Sodass, wenn ein Bedürftiger kam und seine Berufskollegen fand, er von dort einen Unterhalt bekam.“ Neben der religiösen Funktion, die aus diesem Text deutlich hervorgeht, kamen den Synagogen
demnach auch soziale Aufgaben zu. Die in Zünfte gegliederte Bevölkerung saß entsprechend ihrer Berufsgruppe in je eigenen Abteilungen des
Gebäudes, sodass ein vorbeiziehender arbeitssuchender Handwerker leicht während des Gottesdienstes Kontakte knüpfen und Arbeitsmöglichkeiten erkunden konnte.
Eine weitere Funktion der Synagogen geht aus einer Inschrift, die in Kairo gefunden wurde, hervor, wonach der König Euergetes und seine Frau in
der Proseuche Asyl gewährten (CPJ III 1449). Die Abfassungszeit der Inschrift ist umstritten, auch die Frage, um welchen Euergetes es sich handelt. Jedenfalls ist bislang schon die Bedeutung der Synagoge als soziale Einrichtung deutlich geworden.
Die Beziehung zur heidnischen Umwelt war zumeist gut. Dies geht nicht nur aus den Ehrendekreten für Machthaber und Vornehme hervor, die
man in den Synagogen aufstellte. Ehrenzeichen wie Kronen oder Kränze wurden an verdienstvolle Gönner oder den Kaiser verliehen. Kraabel betont die Beziehungen zwischen Juden und Nichtjuden in den Gemeinden wie Dura, Sardis, Ostia oder Delos und schreibt: „all four are relatively
open communities, accustomed to new faces- -traders, travellers, soldiers, government officials--and to changes within their population.“14
3. Die Aufgabe der Synagoge
Die Institution der Synagoge besaß neben den schon erwähnten weitere Aufgaben, die aufgrund des Materials zu eruieren sind.15 Dazu gehören:
a) Funktionen als Bethaus
b) Funktionen als Versammlungshaus
c) Funktionen als Lehrhaus16
d) Die Einrichtung eines Gerichtshofes (Makk III,12 u.a.). Die Aufgaben dieses Gerichtshofes waren mannigfach und bezogen sich auch auf soziale Belange wie z.B. die Schätzung von Gütern, die einer geschiedenen Frau als Ketubba zustehen (Ketubbot XI u.ö.).
e) Dort befand sich die Armenkasse17, wie aus einigen rabbinischen Quellen hervorgeht (TSchabbat XVI,22 L 79; TTerumot I,10 L 109; TBaba
Batra VIII,14 Z 409 u.a.). Die Gemeinde unterstützte Arme und Waisen ebenso wie arme Bräute oder Frauen, deren Männer nicht in der Lage waren, für eine (standesgemäße) Versorgung zu sorgen. Auch die Bestattungskosten und die Auslösung von Gefangenen18 wurden im Bedarfsfall
übernommen. Verantwortlich für die Armenversorgung waren eigens dafür vorgesehene Einheber und Verteiler (Pea VIII,7; Demai III,1 u.ö.). Verpflichtet zur Armenabgabe wurden alle Männer. Frauen, Waisen und Arme blieben ausgenommen.
f) Man sammelte in ihr für den Tempel und
72
Grundkurs Judentum
Tempel und Synagoge
g) konnte sie als Herberge verwenden, wie vor allem auch die Theodotus-Inschrift in Jerusalem bezeugt. Letzteres problematisiert ein Abschnitt
des pT:
Es wird gelehrt: Synagogen und Lehrhäuser, in ihnen soll man sich nicht unehrerbietig benehmen. Man soll in ihnen weder essen noch trinken; man soll in ihnen nicht herumlaufen; man soll in ihnen nicht schlafen. An Sonnentagen soll man sich nicht wegen der Sonne und an Regentagen nicht wegen des Regens betreten. Aber man darf in ihnen lernen und forschende Lehre betreiben. Rabbi Yehoshua`-ben-Lewi sagte: Synagogen und Lehrhäuser gehören den Gelehrten und ihren Schülern. Rabbi Hiyya (und) Rabbi Yassa empfingen in der Synagoge Besuch [oder: schlugen ihr Quartier in der Synagoge auf]. Rabbi Immi trug den Kinderlehrern auf: Wenn jemand zu euch kommt, der sich auch nur ein wenig in der
Lehre auskennt, so sollt ihr ihn bei euch aufnehmen, ihn und seinen Esel und sein Gepäck (jMeg III,4(3)74a nach Hüttenmeister19 121).
Immerhin geht auch aus diesem Text hervor, dass die Synagoge auch als Quartier für Durchreisende diente. Belege für den Aufenthalt in der Synagoge, für die Armenverpflegung dort und ihre Rolle als Unterstand für Obdachlose gibt es auch an anderen Stellen.20 Qidd 73b bezeugt, dass
auch ausgesetzte Kinder in Synagogen aufgelesen wurden.
4. Stiftung von Synagogen
Ein entscheidender Punkt bei der sozialgeschichtlichen Wertung des Synagogenbaus ist der Umstand, dass eine ganze Reihe von Gebäudeteilen,
Mosaiken oder Inventar, gelegentlich sogar ganze Synagogen21 durch private Stiftungen22 ermöglicht wurden. Der älteste Beleg dafür stammt aus
37 v. und betrifft die Stiftung einer Synagoge in Alexandrien durch einen gewissen Alypos (CII 1432).
Ich brauche hier nicht mehr im einzelnen auf die Texte einzugehen, da sie bereits mehrmals herausgegeben und behandelt wurden, so vor allem
von Lifschitz23 und Chiat24. Ich beschränke mich daher auf einige wenige Beispiele:
In der Inschrift der Synagoge von Stobi findet sich der Name des Stifters als „Klaudios Tiberios Polycharmos der auch Achyrios genannt wird“. Er
behält sich vor, über alle Räume des Obergeschoßes für sich und seine Erben zu verfügen. Wollte jemand etwas daran ändern, müsste er an den
Patriarchen 1/4 Million Denare zahlen. Mit dem Patriarchen tritt die höchste Autorität innerhalb des Judentums auf. Die Inschrift ist nach Hengel25
in das 3.Jh. zu datieren. Darauf verweist auch die Verpflichtung, eine so hohe Summe als Strafgeld bei Anfechtung des Besitzrechtes zu zahlen.
Solche Zahlungen bewegten sich üblicherweise im Rahmen von 500-10.000 Denaren. Der Betrag von 250.000 Denaren könnte ein Hinweis auf
die rapide Inflation am Ende des 3. bzw. am Anfang des 4.Jhs. sein. Erst Diokletian stabilisierte den Geldwert durch Einführung des Aureus und
des Silberdenars. Anders als in den galiläischen Synagogen und in Alexandrien, Sardis oder Kapharnaum handelt es sich in Stobi nicht um eine
Basilika, sondern um ein umgebautes Privathaus, wie dies auch für Delos und Dura Europos nachzuweisen ist. Auch die Synagogen von Priene
und Ägina entstanden aus Privathäusern. Sie gingen durch Schenkung oder Kauf in den Gemeindebesitz über. Davon wie vom umgekehrten Fall,
dass eine Privatperson eine öffentliche Synagoge erwirbt, berichtet auch jMeg III,1,73d. Zweifellos setzte die Stiftung einer Synagoge hohes gesellschaftliches Ansehen und beträchtliche Mittel voraus, sie bewirkte aber auch ihrerseits Anerkennung durch die Gemeinde. So erhielt die Stifterin der Synagoge von Phocaea in Ionien, Tation, einen goldenen Kranz und einen Ehrenplatz (CII 2, 738). Solche Ehrerweisung kam normalerweise römischen Statthaltern oder - wie in Alexandrien - gar dem Kaiser zu. Mit dem Ehrenplatz dürfte ein spezieller Sitz gemeint sein, wie er auch in
den Synagogen von Delos, En Gedi und Chorazim auftaucht. Auf Teos wird ein Synagogenvorsteher Proutioses und seine Frau Bisinnia Demo
erwähnt, welche eine Synagoge aus eigenen Mitteln stifteten (CII II, 744). Im phrygischen Akmonia wurde die Synagoge von Julia Severa, einer
wohl nichtjüdischen Gönnerin, in Auftrag gegeben (CII II, 766). Heidnische StifterInnen lassen sich nebenbei auch aus dem rabbinischen Schrifttum belegen, so etwa aus TMeg III,16 (L 352). In Berenike in der Cyrenaica werden einmal 55 n. 18 StifterInnen (Lifshitz 100) erwähnt. Die Stifterin
73
Grundkurs Judentum
Tempel und Synagoge
Theopempte in Myndos wird in einer Inschrift aus dem 4. oder 5. Jh. (CII II, 756) als `Synagogenvorsteherin' postuliert, was mit Sicherheit mehr als
einen Ehrentitel bezeichnet. Brooten26 widmet der Frage nach der inhaltlichen Füllung dieses Begriffes ein ganzes Kapitel. Darauf ist im folgenden
Abschnitt über die Ämter daher nicht mehr näher einzugehen.
5. Ämter27:
a) Der Pariarch28
Die Stellung des Patriarchen als größte weltliche Instanz innerhalb des Judentums ist umstritten und zeitbedingt unterschiedlich. Aus der schon
genannten Inschrift von Stobi geht seine Bedeutung als Rechtsinstanz hervor. Aus einem Brief des Kaisers Julian (Stern II 486a) lässt sich entnehmen, dass der Patriarch zumindest zeitweise eine in der Folge der Halbscheqelsteuer auf dem Judentum lastende Abgabe kassierte. Das lässt
sich auch aus dem Codex Theodosianus erheben (16.8.14,17,29). Unter Julian oder Theodosius I. stieg der palästinische Patriarch in den Rang
eines Senators auf. Er trug von da an den Ehrentitel eines der `viri clarissimi et illustres'. Die Ausweitung der Befugnisse, die dem Patriarchen im
Laufe des 4. Jh. zukamen, bezeugt ein Brief des Libanius (Stern II 504) aus dem Jahr 364 sowie vor allem einer des Epiphanius, der von der Autorität des Patriarchen über Synagogenvorsteher, Priester, Älteste und Chazzanim spricht (GCS 25.346). Weitere Zeugnisse brauchen hier nicht erwähnt zu werden. Cohen29 listet sie auf und kommt zu dem Schluss, äthat the patriarch did not have theoretical power over the synagogues of the
Diaspora until sometime in the fourth century, probably the latter part of the century.”30 Stemberger urteilt, „dass der Patriarch im 4. Jahrhundert
zur höchsten Gesellschaft gehörte; rangmäßig war er der bedeutendste Mann schlechthin in Palästina.“31
Palladius schreibt in seinem Dialogus de vita S. Joannis Chrysostomi 15 (PG 47,51) über die Unsitte des Patriarchen, jedes Jahr oder jedes zweite
Jahr die Synagogenvorsteher zu wechseln, um Geld einzuheben. Diese polemische Aussage kann als Indiz für eine Autorität des Patriarchen über
die nächstwichtige Gruppe der im Rahmen der synagogalen Verwaltung interessierenden Amtsträger(Innen) genommen werden.
b) Die SynagnogenvorsteherInnen
Zweifellos handelte es sich bei den SynagogenvorsteherInnen um InhaberInnen einer sozialen Position, die mit zahlreichen administrativen Belangen zu tun hatten, erschöpfte sich aber nicht darin. Vielmehr muss damit gerechnet werden, dass diese Aufgabe auch spirituelle und intellektuelle
Fähigkeiten voraussetzte, wie dies sogar polemisch Justin der Märtyrer in seinem Dialog mit Tryphon (137) unterstreicht, wenn er vor den verderblichen Lehren der Synagogenvorsteher warnt. Eine Gemeinde konnte mehrere solche Vorsteher(Innen) besitzen. Einerseits gibt es Belege über
die Erblichkeit dieses Amtes (CII II, 584, 587, 1404), andererseits ist in manchen Regionen auch eine Wahl als wahrscheinlich anzunehmen. Als
Aufgaben stellen sich nach CII 1404 die Verantwortung für den Lehrbetrieb und die Lesung der Tora. Nach Pes 49b handelt es sich bei den SynagogenvorsteherInnen selbst um Gebildete. Lehre und spirituelle Betreuung setzt auch Lk 13,10-17 voraus. Zusammen mit den Gemeindevorstehern sammelten sie Geld von der Gemeinde, welches - wie oben erwähnt - dem Patriarchen übersandt wurde (Codex Theodosianus 16.8.14,17).
Aufgrund der Inschriften lässt sich die besondere Rolle der SynagogenvorsteherInnen bei der Stiftung von Synagogen hervorheben, was darauf
schließen lässt, dass es sich um Mitglieder wohlhabender Familien handelte. Innerhalb der Hierarchie der Synagogenbediensteten dürften die SynagogenvorsteherInnen an der Spitze gestanden haben. Sie werden in den Inschriften als erste erwähnt (CII II, 766, 803).
c) Die Ältesten
74
Grundkurs Judentum
Tempel und Synagoge
Die Funktion der Ältesten der Synagoge, der Presbyteroi, differierte ebenfalls je nach Zeit und Ort. Sie können einzeln oder mehrfach in einer Gemeinde belegt sein. Neben Gemeindeaufgaben in der Verwaltung wie etwa der Mithilfe am Requirieren von Geld für den Patriarchen kamen ihnen
auch religiöse Aufgaben zu. Qidd 32b definiert sie als Gelehrte. Taanit II,2 beschreibt den Ältesten als einen Mann, `der Kinder hat und dessen
Haus leer ist'. Damit war zweifellos physische Armut gemeint. Bereits der pT verändert dies insofern, als er jetzt in jTaanit II,2,65b Haus und Feld
besitzen soll, und in einer Baraita des bT (Taanit 16a) interpretiert man das leere Haus u.a. auf tadellosen Lebenswandel oder Sündenlosigkeit des
Besitzers. Damit fällt der sozialgeschichtlich bedeutsame Hinweis auf die Armut der Ältesten. Doch auch der bT hat an derselben Stelle in einer
Aussage des R. Jehuda den Hinweis auf die Armut des Ältesten bewahrt, wenn er ihn sagen lässt, dass der Alte sich auf dem Felde abmüht. Er
beschreibt ihn als demütig und beim Volk beliebt aber auch als gelehrt in der Bibelauslegung und im Studium der Tradition wie der kultischen Segnungen.
Aus dem Codex Iustinianus I.9.15 von 418 geht hervor, dass die Ältesten richterliche Aufgaben wahrnahmen. Sechs griechische Inschriften bezeugen weibliche `Älteste'.32
Der Patriarch, die SynagogenvorsteherInnen und die Ältesten waren aber nicht die einzigen wichtigen und auch kaiserlich privilegierten AmtsträgerInnen, denen etwa die römische Gesetzgebung die zeit- und geldaufwendige Teilnahme an den öffentlichen Ämtern, den munera corporalia, erließ. Entsprechend dem Codex Theodosianus 16.8.4 wurden auch Priester und `Väter der Synagogen' sowie weitere nicht näher genannte Synagogenbedienstete davon befreit. Priester(Innen) und `Väter' sowie `Mütter der Synagoge' treten auch in den Inschriften häufig auf.
d) Die PriesterInnen
Die Priesterwürde bedingte auch nach der Zerstörung des Tempels noch eine Sonderstellung im Gottesdienst und Vorrechte, aber auch besondere Pflichten. Drei Inschriften belegen Frauen als PriesterInnen33, ohne dass die exakte Bedeutung klar wäre. Möglicherweise handelt es sich hier
um Töchter oder Frauen von Priestern.
e) `Väter' und `Mütter der Synagoge'
Eine genaue Funktionsbeschreibung ist auch hier nicht möglich. Vielleicht handelte es sich nur um Ehrentitel. Es könnte sich der Terminus in seiner Bedeutung im Laufe der Jahrhunderte verändert haben, sodass er später, wie dies auch der Codex Theodosianus nahe legt, eine bestimmte
Stellung in der Synagoge umschrieb. Nach CII 533 aus Castel-Porziano bei Ostia wird Livius Dionisius als `Vater' bezeichnet, der zusammen mit
dem Gerousiarchen und einem sog. Antonius die Synagogengemeinde leitete. Er teilte dem Gerousiarchen Land für ein Familiengrab zu, was bedeutet, dass er Einfluss auf die Verteilung der Synagogengelder hatte. Auch hier bezeugen wieder sechs Inschriften aus Italien, die von `Müttern
der Synagoge'34 sprechen, dass auch Frauen diese Ehrenstellung oder Funktion innehaben konnten.
Neben den genannten Titeln spielten in der Synagoge noch andere Personen eine Rolle, die ich hier nur noch erwähne, ohne näher auf sie
einzugehen. Da sind die Schriftgelehrten und Schreiber ebenso zu nennen wie der Chazzan, der neben kultischen auch richterliche Funktionen
übernehmen konnte und dessen Stellung von Zeit zu Zeit variierte. Daneben existierten Synagogendiener und Schulklopfer, die zum Gottesdienst
riefen.
Synagogale Ämter müssen durch politisch-öffentliche Ämter ergänzt werden, ohne dass der Trennungsstrich innerhalb der jüdischen Gemeinschaft immer exakt zu ziehen wäre. Genannt werden in der Diaspora die Archontes neben den Archisynagogoi. Diese Archontes bildeten die
Gerousia einer Stadt. Ihre Zahl variierte je nach Größe des Gemeinwesens. Ein erhaltenes Dekret aus Berenike aus dem Jahr 55 n. (Lifshitz 100)
75
Grundkurs Judentum
Tempel und Synagoge
sieht vor, dass die Namen derer, die an der Restaurierung der Synagoge beteiligt waren, in Stein gemeißelt werden sollen. Neun werden als Archontes bezeichnet, einer als Priester. In Berenike gab es offenbar neun Archonten, in Rom je einen pro Kongregation. Aufgabe der Archonten
war u.a. auch die Getreideversorgung und die Regelung des Marktwesens. Nach jBer II,8,5c sitzt der Archon über einen Räuber zu Gericht. Demnach hat er hier die Funktion eines Ortsrichters inne.
In Rom bildete die jüdische Gemeinschaft eine Vielzahl von Kongregationen, die nicht wie in Alexandrien in einer Verwaltung vereinigt waren.
Nach Pseudo-Aristeas standen bereits an der Spitze der Alexandriner Politeuma des 3. Jhs. v. Presbyteroi und Hegoumenoi. Zur Zeit Strabos
führte die Juden ein Ethnarch, der für die politische Führung, die Gerichtsbarkeit und die geordnete Beziehung zum heidnischen Staat verantwortlich war. Seine Rolle entsprach der des Archon einer unabhängigen Stadt.
6. Die soziale Position der Synagogenbediensteten und das Gelehrtenideal
Aus den obigen Ausführungen geht eindeutig hervor, dass die verschiedenen Funktionen innerhalb der Synagoge zunehmend Personen innehatten, die erheblichen sozialen und politischen Einfluss genossen. Sie werden eindeutig zur Oberschicht gezählt haben. Dies geht aus den Weihinschriften oder den Bestimmungen des Codex Theodosianus ebenso hervor wie aus Bemerkungen der jüdischen Traditionsliteratur. Dennoch bezeugt gerade die rabbinische Literatur auch ein Ideal von Gelehrsamkeit, das sich mit redlicher schwerer Arbeit verbindet. So heißt es noch in Qohelet Rabba IX.9.1 (vgl. Qidd 30b), dass man Jose b. Meschullam und Simeon b. Menasia zur `heiligen Bruderschaft' rechnete, weil sie den Tag in
Tora, Gebet und Arbeit gliederten bzw. nach anderer Ansicht im Winter Tora studierten, im Sommer aber Feldarbeit verrichteten. Dass Torastudium und `weltliche Beschäftigung' sich ergänzen sollten, war auch aus Abot II,2 bereits als Ideal bekannt. „Es gibt kaum ein Handwerk, das nicht
von den Gelehrten ausgeübt wurde: Sie arbeiteten als Tagelöhner, Zisternengräber, Feldmesser, Siegelstecher, Schuster, Schneider, Bäcker,
Schmied, Gerber, Müller, Zimmermann u.s.w.“35 Daneben berichtet die rabbinische Literatur jedoch auch von der Unterstützung der Gelehrten
durch die Gemeinde, um diesen das Torastudium zu finanzieren. Die bekannte Stelle Ketubbot 62b/63a erzählt von der Frau des R. Aqiba, die
diesem 24 Jahre lang das Studium ermöglichte. Als er als gelehrter Mann zurückkam, schenkte ihm ihr Vater, einer der reichsten Männer der Zeit,
die Hälfte seines Vermögens.
Die wirtschaftliche Not, der vermehrte Steuerdruck und die Missernten des 3. und 4. Jhs. stellten die Gemeinden auf eine harte Probe. Dieser Umstand ist unumstritten. Unterschiedlich allerdings wurde die Frage beantwortet, inwieweit die christliche Gesetzgebung des 4.Jhs. die freie
Entwicklung der Synagoge beeinflusst und das soziale Umfeld verändert hat. Dieser Punkt sei hier abschließend noch kurz behandelt.
7. Die Baugeschichte als soziales Indiz für ein Miteinander von Juden und Christen
Neuere Studien haben gezeigt, dass die `christliche Wende' unter Konstantin für das Judentum in Palästina keinen sozialen Einbruch bedeutete.
Gerade das 4.Jh. zeichnet sich durch Bautätigkeit aus. „Die Baugeschichte deutet kaum eine Verschlechterung in der Lage der Juden an; vielfach
folgen einander an derselben Stelle drei jedesmal größere und immer wieder umgebaute Synagogen. Die Gründe für das Verlassen von Meiron
und die zeitweilige Räumung von Chorazin sind unbekannt. In Bet Schearim dürfte der Wegzug des Patriarchen daran schuld gewesen sein, dass
man sich in der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts an keinen Neubau mehr machte. Das Festhalten an einem einmal für eine Synagoge bestimmten Platz ist typisch. Es ist halakhisch bedingt, wurde aber auch durch die Umstände ermöglicht. Im Lauf der Zeit sind die Synagogen jedoch nicht
nur vergrößert, sondern meist auch reicher ausgestattet worden. Es gibt keinen einzigen Beleg für die Umwandlung einer Synagoge in eine Kirche.
76
Grundkurs Judentum
Tempel und Synagoge
Eine Ausnahme ... ist Gerasa, wo 530 über einer Synagoge aus dem 4. oder 5. Jahrhundert eine Kirche errichtet wurde. Vereinzelt wurden Synagogen später als Moscheen verwendet.“36 Das jüdisch-christliche Zusammenleben dürfte im Heiligen Land daher keineswegs so belastet gewesen sein, wie man dies nach der Kirchenväterliteratur annehmen würde. Die kaiserliche Gesetzgebung hat ebenfalls kaum Spuren hinterlassen.
Anders ist das Bild in der Diaspora. Johannes Chrysostomus sei als unrühmliches Beispiel des antijüdischen Ausfalles der Kirchenväter genannt.
Nach seinem Tod enteignet der Patriarch Kyrill die Synagogen Antiochiens, vertreibt die Juden aus der Stadt und lässt die Plünderung ihres Eigentums zu.
Abkürzungen:
CII=Corpus Inscriptorum Iudaicarum. Recueil des iscriptions juives qui vont du IIIe siecle avant Jesus-Christ au VIIe siecle de notre ere par R.P.
Jean-Baptiste Frey C.S.Sp. II: Asie-Afrique (Sussidi allo Studio delle Antichit… Cristiane III), Rom 1952.
SEG = Supplementum Epigraphicum Graecum
Stern= M. Stern (Hg.), Greek and Latin Authors on Jews and Judaism, Jerusalem 1976 (I) 1980 (II).
Anmerkungen:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Vgl. K. Hruby, Die Synagoge. Geschichtliche Entwicklung einer Institution (Schriften zur Judentumskunde 3), Zürich 1971; J. Gutmann, The
Origin of the Synagogue: The Current State of Research, in: The Synagogue: Studies in Origins, Archaeology and Architecture (The Library
of Biblical Studies), New York 1975, 72-76; ders., Synagogue Origins: Theories and Facts, in: Gutmann J. (Hg.), Ancient Synagogues. The
State of Research (Brown Judaic Studies 22), Chico 1981, 1-6; L. Levine, The Synagogue in Late Antiquity, New York 1987.
Vgl. dazu A. Schalit, König Herodes. Der Mann und sein Werk (Studia Judaica. Forschungen zur Wissenschaft des Judentums IV), Berlin
1969, 262-298.
M. Broshi, The Role of the Temple in the Herodian Economy: JJS 38 (1987) 31-37.
Vgl. zur herrschenden Klasse M. Goodman, The Ruling Class of Judaea. The Origins of the Jewish Revolt Against Rome A.D. 66-70, Cambridge u.a. 1987.
Vgl. hierzu TMen XIII,21 Zuckermandel 533 über die Häuser der Hohepriester, die ihre Macht missbrauen, „weil sie Hohepriester sind und
ihre Söhne Schatzmeister und ihre Schwiegersöhne Aufseher und ihre Knechte herauskommen und uns mit Stöcken schlagen.“
Vgl. dazu G. Stemberger, Pharisäer, Sadduzäer, Essener (SBS 144), Stuttgart 1991.
B.J. Brooten, Women Leaders in the Ancient Synagogue. Inscriptional Evidence and Background Issues (Brown Judaic Studies 36), Chico
1982, .
Allerdings ist hier nicht von einer Synagoge, sondern von einer Proseuché die Rede. Laut Gutmann (Anm. 1) hätten diese „different goals
and functions that may be at variance with those of the synagogue...Whatever the proseuche was cannot be definitely ascertained. That it
was not a synagogue, however, appears evident” (3).
Inschriftlich kann man die Entwicklung der Synagoge allerdings noch weiter verfolgen (CII 1440; 1532A).
Vgl. die leichten Varianten in jSukka V,1,55a; Sukka 51b.
swdr vom gr. Sudarion, lat. sudarium, was ein Schweißtuch bezeichnet.
77
Grundkurs Judentum
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
78
Tempel und Synagoge
Eine Synagoge der Weber oder Tarsier erwähnen auch jScheq II,7(5)47a und Jeb 96b.
irsv kann sowohl den Bergmann oder den Kupferarbeiter bezeichnen.
A. Th. Kraabel, Social Systems of Six Diaspora Synagogues, in: Gutmann J. (Hg.), Ancient Synagogues. The State of Research (Brown Judaic Studies 22), Chico 1981, 79-91, 86.
Zu den rabbinischen Texten im Zusammenhang mit den Synagogen und Lehrhäusern in Israel vgl. die umfassende Zusammenstellung bei
F. Hüttenmeister; G. Reeg, Die antiken Synagogen in Israel. Teil 1: Die jüdischen Synagogen, Lehrhäuser und Gerichtshöfe (Beihefte zum
Tübinger Atlas des Vorderen Orients. Reihe B [Geisteswissenschaften] Nr. 12/1), Wiesbaden 1977.
So schreibt z.B. A. Th. Kraabel [The Diaspora Synagogue: Archaeological and Epigraphical Evidence since Sukenik, in: Haase W. (Hg.),
Principat. Religion (Judentum: Allgemeines; Palästinisches Judentum) (ANRW II.19.1), Berlin-New York 1979, 477-510] über Sardis: „The
building had three uses: religious services, education and community meetings” (487).
Zur Armenversorgung schon S. Krauss, Talmudische Archäologie III (Schriften herausgegeben von der Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft des Judentums), Leipzig 1912, 63-74; A. Ben-David, Talmudische Ökonomie I. Die Wirtschaft des jüdischen Palästina zur Zeit der
Mischna und des Talmud, Hildesheim/New York 1974, 306ff.
Vgl. dazu M. Hengel, Proseuche und Synagoge: Jüdische Gemeinde, Gotteshaus und Gottesdienst in der Diaspora und in Palästina, in: The
Synagogue: Studies in Origins, Archaeology and Architecture (The Library of Biblical Studies), New York 1975, 27-54, 43f.
F.G. Hüttenmeister, Megilla-Schriftrolle (Übersetzung des Talmuds Yerushalmi II/10), Tübingen 1987.
Vgl. dazu u.a. S. Krauss, Synagogale Altertümer, Wien 1922 (repr. Nachdruck Hildesheim 1966), 192ff.
Dies vor allem außerhalb Israels. In Israel selbst ist natürlich Theodotos zu erwähnen, der in Jerusalem eine Synagoge stiftete. Im 5. Jh.
ließen Eustochios, Hesychios und Euagrios die Synagoge von Hulda bei Rehovot erbauen; möglicherweise wurden auch andere Synagogen durch Einzelpersonen gestiftet, so in Chorazin (Judan b. Ischmael), Kfar Bar'am (Eleazar bar Judan), Ammudim in der Nähe von Tiberias (Joezer und Simeon).
In einer Reihe von Fällen zahlten mehrere Personen anteilig für den Bau einer Synagoge. In Eschtemoa, 15 km südlich von Hebron, stifteten der Priester Eleazar und seine drei Söhne einen Tremissis (1/3 Golddenar), also eine relativ kleine Summe.
B. Lifshitz, Donateurs et fondateurs dans les synagogues juives. R‚pertoire des d‚dicaces grecques relatives … la construction et … la
r‚flection des synagogues (Cahiers de la Revue Biblique 7), Paris 1967.
M. J. S. Chiat, Handbook of Synagogue Architecture (Brown Judaic Studies 29), Chico 1982.
M. Hengel, Die Synagogeninschrift von Stobi, in: The Synagogue: Studies in Origins, Archaeology and Architecture (The Library of Biblical
Studies), New York 1975, 110-148.
(Anm. 7).
Vgl. Brooten (Anm. 7) 5-99; E. Schürer, The History of the Jewish People in the Age of Jesus Christ (175 B.C.- A.D. 135). A New English
Version Revised and Edited by G. Vermes; F. Millar; M. Goodman, III.1, Edinburgh 1986, 87-107; Krauss (Anm.17) 102-198.
Vgl. G. Stemberger, Juden und Christen im Heiligen Land. Palästina unter Konstantin und Theodosius, München 1987, Kap. IX.
S.J.D. Cohen, Pagan and Christian Evidence on the Ancient Synagogue, in: L.E. Levine (Hg.), The Synagogue in Late Antiquity, New York
1987, 159-181, 170ff.
Ebd. 174.
Stemberger (Anm. 28), 194.
Grundkurs Judentum
32
33
34
35
36
Tempel und Synagoge
CII 731c (Kreta); CII 692 (Thrakien); CII 581, CII 590 und CII 597 (Apulien); CII 400 aus Rom sowie SEG 27 (1977) 1201 aus der Tripolitania.
CII 1514 (Tell el-Jahudije); CII 315 (Rom); CII 1007 (Bet Schearim).
CII 166; CII 496; CII 523; CII 606; CII 619d; CII 639.
Ben-David (Anm. 17) 316.
G. Stemberger (Anm. 28), 130.
Michael F. Mach
„Etwas Tempel“
WuUdB (Der Tempel) 38-40
Viele betrachten das moderne Judentum als eine Neuschöpfung der rabbinischen Theologie infolge der Tempelzerstörung des Jahres 70 n. Chr.
Praktizierende Juden allerdings betonen eine andere Perspektive: Für sie ist das heutige Judentum keine „Notlösung“ des tempellosen Volkes Israel, sondern gewachsener Teil einer 4000-jährigen Geschichte.
Trotz des historischen Abstandes hängen die früheren Zeiten Israels mit dem heutigen Judentum zusammen. Die Religion Abrahams und seiner
Nachfahren, die erweiterte Offenbarung am Sinai unter Mose und die darauf folgende israelitische Geschichte sind so gesehen ältere Stadien jener Religion, die dann durch die Rabbinen fortgeführt wurde. In der Auseinandersetzung mit der rabbinischen Lehre wird dieses letzte Stadium bis
heute aufrecht erhalten. So ergibt sich ein historischer Ablauf vom Urahn bis zur letzten Generation.
Zwischen Wandel und Tradition
Leider ist die konstruierte geschichtliche Kontinuität nicht in der Lage, wesentliche Elemente des gelebten Judentums zu erklären. Eine Reihe von
liturgischen und geistesgeschichtlichen Elementen bleiben unverständlich, solange die Neuorientierung des seines Tempels beraubten Judentums
nicht in ihrer vollen Bedeutung ernst genommen wird. Denn diese aufgezwungene Umstrukturierung greift wesentlich auf (früher) Vorhandenes
zurück. Von daher geht es hier nicht darum, das völlig Neue im tempellosen Israel zu bestimmen, sondern das Gleichgewicht zwischen Tradition
und Neuschöpfung auszuloten. Zunächst wird man sich zu vergegenwärtigen haben, daß die antike jüdische Tempelreligion nicht nur eine unter
anderen Religionen war, die einen Tempelgottesdienst mit Opferkult voraussetzen: Das mag für die Epoche des ersten Tempels gegolten haben;
aber mit der Rückkehr aus Babylon hat sich die jüdische Situation grundlegend verändert. Der zweite Tempel erhält innerjüdisch einen Rang von
Einmaligkeit und Ausschließlichkeit, der sonst in der Antike nicht mehr zu finden ist. Ein ganzes Volk, schon damals über die bekannte Welt verteilt
(nicht wenige Juden waren in Babylon geblieben und die hellenistische Diaspora entwickelte sich schnell über die bekannte Mittelmeerwelt hinaus)
fand den Ausdruck seiner religiösen Definition in diesem Jerusalemer Tempel. Die problematische nationale Identität eines in der Zerstreuung lebenden Volkes wurde gestützt durch die religiöse, und beide hatten ihren Brennpunkt im Tempel. Mit der rigorosen Zentralisierung des Kultes
hängt auch die Verschärfung monotheistischer Vorstellungen zusammen. Die Masse der jüdischen Bevölkerung jener Zeit verband den einen Gott
mit dem einen Tempel und bezog aus beiden ihre Selbstdefinition. Zwar entstand im 2. Jh v. Chr. der Tempel Onias' IV. in Heliopolis sozusagen in
Konkurrenz zum Jerusalemer, aber von den alexandrinischen Juden wird er nirgends erwähnt, was doch wohl als ein Indiz für die Ausschließlichkeit des Jerusalemer Tempels auch in den Augen der Diasporajuden zu werten ist. Erst wenn die Bedeutung des Tempels als sichtbare Ort für die
79
Grundkurs Judentum
Tempel und Synagoge
Gegenwart des einen jüdischen Gottes in ihrer Tragweite für jüdisch Selbstbestimmung überhaupt erkannt worden ist, wird auch die Tragik der
Tempelzerstörung des Jahres 70 n. Chr. unter dem späteren römischen Kaiser Titus verständlich Der sog. 4. Esra, ein nicht-kanonisches Werk,
das innerjüdisch verloren gegangen ist, aber von der Kirche wenigstens in Übersetzung bewahrt wurde, drückt die anfängliche Verzweiflung aus.
Selbst dann bestand noch die Hoffnung auf eine Wiederherstellung des Verlorenen. Auch die Juden in der Zerstreuung scheinen solche Hoffnungen gehegt zu haben. Die Aufständischen des Bar-Kochba (132-135 n. Chr.) prägten Münzen, die nach den Jahren der Befreiung gezählt wurden.
Es war offensichtlich eine Zeit der Hochspannung und der Erwartung eine erneuerten Tempels. Doch die Römer setzten derartigen Hoffnungen ein
blutiges Ende.
Die rabbinische Neuformulierung des Judentums
In diesen bewegten Jahren hat das Judentum etliche Veränderungen durchgemacht, die bis heute prägend geblieben sind. Einige davon sind offensichtlich und d weithin bekannt, andere dagegen eher versteckt. Direkt nach der Zerstörung des zweiten Tempels gründete der berühmte Gelehrte Rabban Jochanan ben Sakkai in Jabne (Jamnia) ein rabbinisches Lehrhaus, das in den folgenden Jahrhunderten zur Grundlage für die rabbinische Akademie des Landes werden sollte. Wie zu erwarten, konnte sich die neue, rabbinische Führungsschicht nicht sofort durchsetzen - das
zeigt schon der Bar-Kochba-Aufstand - aber hier wurde die Neuformulierung des Judentums wenigstens bewußt in Angriff genommen. Das Lehrhaus des Rabban Jochanan mußte seinen Standort mehrmals wechseln und gelangte schließlich nach Tiberias. Dort kodifizierte gegen Ende des
2. Jhs. ein späterer Lehrhaus-Vorsitzender, Rabbi Jehuda der Fürst, die mündliche Lehre: So entstand die Mischna. Dieses Stadium ist deshalb so
entscheidend, weil sowohl die folgenden Generationen der rabbinischen Lehrer im Lande Israel als auch ihre Kollegen in Babylon diesen Kodex
übernommen und weiter ausgelegt haben (die Auslegung ist in den beiden Talmuden zu finden). Spätere rabbinische Diskussion wird sich an dieser Auslegung orientieren. Die Mischna ist somit die erste rabbinische Sammlung der Neuformulierung des Judentums und zugleich die gemeinsame Ausgangsbasis für alle künftigen Generationen. Schon hier wird bewußt versucht, einige Bräuche des Tempelgottesdienstes in den tempellosen Alltag zu übernehmen. Rabban Jochanan ben Sakkai werden im Zusammenhang mit dem Neujahrsfest einige solcher liturgischer Änderungen zugeschrieben, die alle darauf hinauslaufen, Bräuche, die eigentlich Privilegien des Tempels waren, nun auch außerhalb desselben und z. T.
sogar außerhalb Jerusalems zu begehen.
Die neue Rolle der Synagogen
Aus der Synagoge wird eine Art Tempelersatz, in den Worten der Rabbinen: „etwas Tempel“. Die Gebetszeiten entsprechen nun denen der festen
Opfer, was sich beim Abendgebet (für das es kein paralleles Opfer gab) noch darin äußert, daß der Vorbeter hier das Kerngebet nicht Wort für
Wort wiederholt; die Hallelpsalmen (113-118), die eigentlich in den Opfergottesdienst gehören, sind fester Bestandteil der Liturgie an Wallfahrtsfesten und Neumondstagen. Schon seit den letzten Jahrzehnten des bestehenden Tempels richten Juden ihr Gebet nach Jerusalem aus; der Toraschrank befindet sich an der nach Jerusalem weisenden Wand, und nicht wenige sehen in dem Pult, worauf die Torarollen zur Lesung gelegt werden, eine Art Altarersatz. Daraus könnte man schließen, der fehlende Tempelgottesdienst habe in der synagogalen Liturgie ein Äquivalent gefunden. Und doch bleibt die Liturgie der Synagoge kein Ersatz für den Tempelgottesdienst: Die Bitte um Wiederherstellung des Tempels ist Teil des
dreimal täglich zu rezitierenden Kerngebets; an den Tagen, für die die Bibel Zusatzopfer vor schreibt und an denen Juden entsprechend ein Zusatzgebet sprechen, wird die Bitte um Restitution des Tempelgottesdienstes ausführlicher formuliert (verbunden mit dem Wunsch, daran teilnehmen zu dürfen). Schon hier deutet sich also eine wesentlich tiefer greifende Folge der Tempelzerstörung an; sie führte zu einer gewissen Ambivalenz im Gesamtgefüge jüdischer Theologie: Einerseits wird ersetzt und übernommen, was immer ersetzbar und übertragbar schien, andererseits
80
Grundkurs Judentum
Tempel und Synagoge
wird der Verlust weiter empfunden und beklagt. Zur letzteren Einstellung gehört wohl die Vorschrift, daß bestimmte Gegenstände, die eigentlich
zum Tempel gehörten (wie die Menora oder der siebenarmige Leuchter), nicht nachgeahmt werden dürfen. Das Bedürfnis, den verlorenen Tempel
im jüdischen Alltag zu bewahren, scheint aber noch weitere Folgen gehabt zu haben. Ein Beispiel: Am Anfang der Mischna steht die Frage, von
welcher an Stunde das Abendgebet gesprochen werden darf. Die Antwort lautet dort: „Von der Stunde an, da die Priester eintreten, um von ihrer
Hebe zu essen“. Der Bezug zum Tempelkult ist offensichtlich: Es geht um Priester, die kultisch unrein geworden waren und daraufhin ein Tauchbad nehmen müssen. Deren Reinheit folgt aber nicht direkt auf das Bad, sondern erst mit Eintreten des Abends mit dem Aufleuchten der ersten
drei Sterne. Somit ist in der Regelung für den Tempel auch die Definition für den frühesten Zeitpunkt des Abendgebets enthalten. Die Schwierigkeit mittelalterlicher und neuzeitlicher Kommentatoren besteht in der Frage, warum die Mischna das so umständlich ausdrückte. Anscheinend liegt
die Antwort nicht einfach in dem Wunsch, en passant noch eine weitere Vorschrift zu lehren, sondern vielmehr in der Absicht, auch das Abendgebet (für das es, wie gesagt, kein paralleles Standardopfer gab) in einen Zusammenhang mit der kultischen Praxis am Tempel zu bringen. Solche
Zusammenhänge lassen sich an verschiedenen Stellen beobachten. Eine besondere Nuance erhält diese Suche nach Tempel-Analogien im jüdischen Alltag nach 70 besonders dort, wo die Mischna die Eheschließung als 'Heiligung' der Frau bezeichnet und die anschließende talmudische
Diskussion die Gemeinsamkeiten und Verschiedenheiten dieses Akts gegenüber anderen 'Heiligungen' erörtert. Dabei handelt es sich etwa um
Spendenversprechungen an den Tempel, wodurch der versprochene Gegenstand nun „geheiligt“, also dem Profangebrauch entzogen war. Diese
Auseinandersetzung ähnelt auf den ersten Blick eher einer modernen philologischen Abhandlung über die Bedeutung des Terminus 'Heiligung';
aber im tieferen Sinne geht es hier darum, etwas von jener Heiligkeit des Tempels ins jüdische Familienleben zu übertragen und so das alltägliche
Leben von dieser Heiligkeit regulieren zu lassen. Die Obsessivität, mit der die Rabbinen kultische Reinheitsvorschriften pflegen und diskutieren,
hängt mit unserer Frage direkt zusammen, insofern ein Teil dieser Vorschriften ja ursprünglich dem Schutz des Tempels vor Profanisierung galt.
Hier tritt wieder jene Ambivalenz zutage: Neben detaillierten Diskussionen über Vorschriften, die speziell den Tempel betrafen, werden auch solche behandelt, die unabhängig vom Opfergottesdienst im Alltagsleben geübt werden sollen. Die ausschließlich tempel-bezogenen Vorschriften
werden studiert, damit man die Feinheiten nicht vergißt -in der Hoffnung, sie in Bälde im neu-errichteten Tempel wieder rite einhalten zu können.
Auf dieser Basis versteht sich nicht nur die sechste Ordnung der Mischna (und daher der Talmude), sondern auch die Ordnung über OpferVorschriften und der verhältnismäßig große Anteil, den die jeweiligen Opfergebote bei der Diskussion der Einzelgesetze jedes Feiertags einnehmen. Bis heute erinnert die Tora-Lesung ein-zwei Wochen vor dem Pessach-Fest den Juden daran, daß er sich kultisch zu reinigen hat in Vorbereitung auf die Darbringung des Opferlamms im Tempelvorhof. Für den ganzen Ritus der kultischen Reinigung fehlt nur ein wesentlicher Bestandteil: der Tempel! Man kann das bisher Gesagte vielleicht so zusammenfassen: Zum einen übernimmt die Erinnerung an den Tempel und die mit
ihm zusammenhängenden Vorschriften weitgehend die Aufgabe des Tempels, Identität zu stiften, zum anderen bleibt gerade hier die Lücke besonders spürbar. Über derartige innere Spannungen hinweg stellt die Mischna nun aber auch eine bewußte Korrektur am jüdischen Geistesleben
dar; nicht alle haben deren Grundlinien nachher geteilt. Es entsteht ein dialektisches Judentum, für das einige Grunddokumente bestimmte Ansichten vorschreiben, andere ausklammern; wo hingegen andere Strömungen sich diesen Vorschriften nicht unbedingt anschließen, um dann entweder auf dem Wege der Auslegung wieder in die offizielle Diskussion zu gelangen - oder aber für viele Generationen eine Rand-Existenz zu führen.
Die Ambivalenz zwischen offizieller Theologie und unterschwelligen Strömungen bestimmt weite Teile des späteren Judentums und führt zu seiner
Aufspaltung in die verschiedensten Gruppen.
Polarisierungen der Hoffnung
Ein markantes Beispiel hierfür ist die Erwartung des Messias. Wer die jüdische Literatur aus der Epoche des zweiten Tempels kennt, weiß um das
stetige Ansteigen messianischer Erwartungen. Allerdings gab es auch die gegenläufige Tendenz. Die Führungsschicht sah messianische Erwar81
Grundkurs Judentum
Tempel und Synagoge
tungen nicht nur deshalb mit Skepsis, weil diese ihre eigene Stellung gefährden könnten, sondern in erster Linie aus Sorge um den Bestand des
Volkes. Es blieb die Spannung zwischen einem eher messianischen und einem messianisch reservierten, wenn nicht gar skeptischen Judentum.
Für die messianisch Ausgerichteten wurde es bald zu einem Topos, daß der Messias unter anderem den Tempel wieder aufrichten werde. Erlösung ist hier die Wiederherstellung der natürlichen Einheit des Einen Gottes mit seinem Volk, versinnbildlicht im Gottesdienst des einen Jerusalemer Tempels. Diese zwiefache Einschätzung des Glaubens an den Messias erschöpft das Ausmaß an Mehrdimensionalität aber noch nicht: Die
apokalyptische Literatur des Judentums aus der Zeit vor der Tempelzerstörung enthält u.a. Erzählungen vom Aufstieg des apokalyptischen Sehers
in den himmlischen Tempel. Für die Apokalyptiker war damit sicher auch ein gewisses Maß an Kritik dem Jerusalemer Tempel gegenüber impliziert. Aber nach dessen Zerstörung verändern sich die wenigen erhaltenen Erzählungen vom Aufstieg der Visionäre zunächst dahingehend, daß
aus den zwei Hallen des himmlischen Tempels sieben himmlische Sphären werden. Wenige Jahrzehnte danach setzt offenbar jene jüdischmystische Literatur ein, deren hebräischer Name (Hechalot) am besten mit „Palast-Mystik“ wiederzugeben ist: Die Mystiker betreten nun die sieben himmlischen Paläste. Und das hebräische Wort für „Palast“ (Hechal) ist biblisch zugleich eine der gebräuchlichsten Bezeichnungen für den
Tempel! Aus der Kritik am bestehenden Tempel ist eine mystische Sehnsucht geworden, die dem Gläubigen anbietet, Gott in seiner himmlischen
Wohnstatt aufzusuchen. Das geschieht unter Rezitation mystischer Gesänge, die teilweise Eingang in die allgemein übliche Liturgie gefunden haben oder diese doch wenigstens an mehreren Punkten beeinflußten. An einer Stelle geht die Übernahme so weit, daß auch die christlichen Kirchen sich dem Gesang nicht haben entziehen können: Im „Sanctus“. Ursprünglich war das der himmlische Gesang der Seraphim und (in der liturgisch erweiterten Form, die wir heute kennen) auch der Cherubim. Die Apokalytiker maßten sich an, im Verlauf ihrer Himmelsreise auch dem dortigen Gottesdienst beigewohnt zu haben; dabei hätten sie sich am Gesang der Engel beteiligt. Häufig berichten diese Seher, daß die Engel den
Gesang angestimmt hätten, nachdem Gott das Endgericht angesetzt habe. Noch heute findet sich das Sanctus daher in der jüdischen Liturgie direkt hinter dem Lob Gottes für die Auferweckung der Toten. So nimmt die Gemeinde am himmlischen Geschehen teil und erlebt il Vorwegnahme
die endzeitliche Erlösung. Indem sie in der Synagoge jenen Seraphengesang rezitiert, den einst der Prophet Jesajah im Jerusalemer Tempel vernahm, macht sie aus dem Bethaus noch einmal „etwas Tempel“ und hofft, dereinst im wiedererrichteten Gotteshaus dasselbe Lob anstimmen zu
dürfen.
Synagoge im MA
aus: Helmut Eschwege, Die Synagoge in der deutschen Geschichte, Dresden 1980, 17ff.
...Doch im Mittelalter wurde erneut im Judentum das uralte jüdische Verbot besonders der Darstellung von menschlichen Gestalten wirksam. War
das Verbot im Altertum die Reaktion auf die Darstellung von »Götzen«, so im Mittelalter die auf das Christentum mit seinen vielfältigen Ikonen- und
Heiligenbildern.
In Deutschland waren aber noch im 12. Jahrhundert die Synagogen üppig ausgemalt: die alte Regensburger mit Tiergestalten, die in Meißen mit
Bäumen und Vögeln, die Glasmalereien der von Köln zeigten Löwen und Schlangen.
In dieser Periode zeigt sich die jüdische Kunst besonders in der Schrift, meist in Initialen, wie wir es von den alten Pergamentrollen kennen, aber
auch in der Kalligraphie. Nach der Einführung des Buchdruckes wurde diese Kunst noch verstärkt. Besondere Mühe gab man sich bei der Gestaltung der ersten Seiten, bei dem Beginn einzelner Abschnitte und auch bei der Einbandgestaltung. Hierfür gab es besondere Handwerker. In den
82
Grundkurs Judentum
Tempel und Synagoge
Ghettos des Mittelalters, in denen Buchdruckerwerkstätten bestanden, treffen wir bald Holzschneider, Kupferstecher und Radierer an, die illustrative Elemente wie Phantasieblumen und -pflanzen, Leuchter, Krüge oder Ornamente den jüdischen Schriften als Flechtwerk hinzufügen.
Am üppigsten wurden die Pessach- Hagadah und das Buch Esther (Megillah) illustriert. Zur selben Zeit trifft man auch schon auf Kupferstiche mit
dem Porträt Moses, die Zehn Gebote haltend. Wahrscheinlich eine Anlehnung an die schnell unter den Juden populär gewordene Moses-Skulptur
von Michelangelo in der römischen Kirche S. Pietro in Vincoli.
Dies alles hatte großen Einfluß auf die späteren Malereien in den aus Holz gebauten Synagogen des 17. und 18. Jahrhunderts in Polen, Litauen
und Weißrußland, die sich dann in den Synagogen wiederfinden, die aus dem Osten zurückkehrende Juden in Deutschland errichteten. So finden
wir Gerätschaften des ehemaligen Tempels dargestellt wie auch Papageien, Schlangen, Kamele und andere exotische Tiere aus dem alten Israel.
Häufig ist auch die Darstellung von Zweigen des Lebensbaumes. Sie wurden in Phantasie-Ornamente verwandelt, die sich um einzelne markante
Sätze aus den Gebeten und Segenssprüchen ranken. Verwendet wurden hierbei meist die Farben Ocker, Zinnober, Hellblau und Lila.
Dieser Volkskunst widmeten sich im Osten nach Öffnung der Ghettos durch die Große Sozialistische Oktoberrevolution einige Künstler und Grafiker, die Weltruhm erlangten, so Chagall, Lissitzky, Ribak, Nathan, Aronson, Kaplan und viele andere.
Im mittelalterlichen Deutschland hatte man in der Synagoge zunächst einen gemeinsamen Betraum und errichtete erst später durch Ein- oder
auch Anbau eine besondere Frauensynagoge. Ihr wurde nicht derselbe Grad der Heiligkeit zugesprochen wie der »Männerschul«. An vielen Orten
besaßen die Frauen eine Vorbeterin, die durch ein kleines Fenster den Vorbeter der Männersynagoge beobachtete und so den Gottesdienst der
Frauen leitete.
Die Frauenschule war nicht Synagoge im eigentlichen Sinne. Sie hatte weder Bima, das erhöhte Pult, auf dem aus der Thora vorgelesen wurde,
noch Aron, die Lade, in die diese hineingestellt wurde. Die Frauensynagoge war nicht selbständig, in ihr vollzog sich keine geschlossene religiöse
Handlung; sie war im buchstäblichen Sinne des Wortes ein Anhängsel der Synagoge. Die rituelle Handlung spielte sich in der Männersynagoge
ab; der Gottesdienst der Frauen bildete eine unnötige und nicht wahrgenommene Begleitung. Als Raum war die Frauensynagoge völlig in sich abgeschlossen. Das Gestühl war hier gleich dem der Männersynagoge nach innen zentriert. Die Verbindung mit der Männersynagoge war also bewußt zerrissen. Befand sich der Betraum für die Frauen in der Synagoge der Männer, so wurde der den Frauen zugewiesene Teil durch immer
dichter werdende Gitter oder gar Tücher künstlich abgeteilt. Die großen spitzbogigen Öffnungen der Männersynagoge in Worms, wie wir sie aus
den Abbildungen der letzten Jahrhunderte kennen, sind ein Werk der Neuzeit. Zu jeder Synagoge gehörte ein Vorraum zur Vorbereitung bestimmter religiöser Handlungen. Hier befanden sich ein Becken zum Händewaschen, eine Lade zur Aufbewahrung zerschlissener Gebetbücher und dergleichen, ein Stuhl und ein Tisch zur Vorbereitung für die Beschneidung eines Säuglings. In den ältesten romanischen Synagogen Deutschlands
waren die Thorarollen noch in Mauernischen untergebracht. Da die Thorarollen unter der Feuchtigkeit der Mauer litten, führte man hölzerne Laden
ein, und schon um 1200 wurden Steinnischen nicht mehr gebraucht. Die Lade stand gewöhnlich an der Ostwand. Von früher Zeit an wurde auf die
Gestaltung dieser Lade allergrößte Sorgfalt verwendet. Später wurde sie an der Ostwand so angebracht oder aufgestellt, dass man einige Stufen
zu ihr emporsteigen musste. Vor der Lade hatte der Vorbeter seinen Platz. Inmitten der Synagoge, oft auch vor der Lade, stand erhöht das Pult
(Bima oder auch Almemor), von dem aus die jeweiligen Abschnitte der Thora verlesen wurden. Die Bima war oft ein Meisterstück des Kunsthandwerkes, vielfach war sie aus kostbaren Hölzern oder aus Marmor hergestellt. Nachdem im 19.Jahrhundert der Raumersparnis wegen die Bima
häufig beseitigt worden war, kam sie im 20.Jahrhundert wiederum zur Geltung. Die Bima war Mittelpunkt des Synagogenraumes. Die Vorgänge
auf ihr und um sie sollten von allen Plätzen aus aufmerksam verfolgt werden können, entsprechend war das Gestühl um die Bima gruppiert.
Sitzgelegenheiten gab es in der Synagoge des Mittelalters sicher ähnliche wie die uns aus den Abbildungen des 17.Jahrhunderts bekannten. Das
sitzen auf dem Boden, wie es auf Miniaturen dargestellt ist, war eine orientalische Gewohnheit. Anfangs genügten Sitzbänke, mit der Verbreitung
83
Grundkurs Judentum
Tempel und Synagoge
der Gebetbücher wurden auch Pulte notwendig. In allen neueren Synagogen war zumeist festes Gestühl angebracht. Es wurde allmählich entsprechend der langen Dauer mancher Gottesdienste -bequem gehalten. Die einzelnen Plätze im Gestühl waren oft durch Armlehnen getrennt.
Unter dem Klappsitz oder unter dem schrägen Pult befand sich ein Kasten zur Aufbewahrung für das Gebetbuch und den Gebetmantel. Zu den
notwendigen Einrichtungsgegenständen der Synagoge gehörten Lampen und Leuchter, da man trotz des natürlichen Lichtes aus Gründen der
Feierlichkeit auch am Tage Beleuchtung für notwendig hielt; dem Herkommen entsprechend, brennen noch heute zwei Kerzen vor dem Vorbeterpult. In allen noch erhaltenen mittelalterlichen Synagogen und auch noch in der Neuzeit lief ringsum in etwa zwei Meter Höhe ein mit Stacheln versehenes Gesims zur Aufstellung der Lichter.
Jüdische Rückwanderer aus Polen verpflanzten im 17. Jahrhundert Holzsynagogen mit ihren in Polen üblichen reichen Wand- und Deckenmalereien und zum Teil auch den Vierpfeilertypus nach Deutschland. In diesen Synagogen allein kam eine eigenständige jüdische Folklore zum Ausdruck. Die christlichen Gemeinden gestatteten den Juden Jahrhunderte lang keine monumentalen Synagogenbauten. Da der Talmud aber an einer Stelle vorschrieb, dass die Synagoge höher als die umliegenden Häuser gebaut sein müsse, forderten die Rabbiner die jüdischen Besitzer der
umliegenden Häuser auf, ihre höheren Bauten abzutragen. Diese setzten sich jedoch mit dem Argument zur Wehr, dass im nördlichen und mittleren Europa die Dächer nicht wie im Orient flach seien, also kein Einblick in die Synagoge möglich wäre und somit der Gottesdienst nicht gestört
werden könne. Um 1650 wurde es in Polen üblich, um den Vorschriften des Talmuds Genüge zu tun, am Dache der Synagoge eine Stange anzubringen. Diese Sitte hat in Deutschland, allerdings in künstlerischer Ausführung, Eingang gefunden. Aus dieser Zeit stammen die vorher nicht üblichen Dachverzierungen.
Man sollte eigentlich annehmen, dass sich der Bautypus der Synagogen von jener ältesten Zeit bis auf unsere Tage historisch entwickelt habe,
etwa analog den Gotteshäusern anderer Religionen. Eine fortschreitende Entwicklung des eigentlichen Synagogentypus ist indessen trotz einschneidender kultureller Veränderungen Jahrhunderte lang nicht wahrzunehmen. Erst mit der Emanzipation der Juden zu Beginn des 19. Jahrhunderts zeigen sich gewisse Ansätze, die jedoch eher als Rückschritt denn als Weiterentwicklung der bis dahin typischen Anlagen der Synagogen zu bezeichnen sind. Für die stetige Entwicklung des Synagogenbauwesens fehlte aber auch die Zentrale, welche, analog der römischen Kirche, zu allen Zeiten Vorschriften erlassen konnte. Die Zerstreuung der Juden, ihre wirtschaftliche Unsicherheit, der Mangel an dauernden wechselseitigen Beziehungen stellten sich einer stetigen Entwicklung störend entgegen. So konnte die synagogale Baukunst stets nur dann einsetzen,
wenn ein mächtiger Patron das Bauen überhaupt gestattete. Da aber bereits der Nachfolger solcher Schutzherren oft eine den Juden feindliche
Gesinnung zeigte, war eine Weiterentwicklung sodann vielfach ausgeschlossen. Erst nach der Emanzipation und nachdem alle einschränkenden
Baugesetze für Synagogen weggefallen waren, setzte allgemein ein lebhafter monumentaler Synagogenbau ein. Zur gleichen Zeit baute man alte
Synagogen aus, wobei durch Entfernen des Almemors viel Althergebrachtes zerstört wurde. Ein eigener Synagogenstil hat sich aber auch dann
nicht entwickelt. Mit Beginn des 19.Jahrhunderts übernahm man allmählich den Grundriß christlicher Kirchen für den Synagogenbau.
Was den Juden im Ghetto ihre Synagoge bedeutete, beschreibt Adolph Kohut in seiner »Geschichte der deutschen Juden«. »Von Gassen und
Häusern umgeben, bildete die Synagoge auch für die gesamten Angelegenheiten der Gemeinde einen gemeinsamen Sammel- und Brennpunkt.
Die Synagoge war das Zentrum des ganzen Denkens und Empfindens, aller Bestrebungen der deutschen Juden, dorthin zogen auch alle die zeitlichen Einflüsse und die sich immer erneuernden Eindrücke. Je nach den festlichen oder traurigen Ereignissen wurde der Gottesdienst und der
Gebetsablauf verändert. Für Hochzeiten gab es besondere Gedichte und Gebete, die zu ihren Ehren eingeschaltet wurden. Wurde ein Gemeindemitglied ernstlich krank, so beteten alle für dessen Genesung. Leidtragende wurden von der Gemeinde ins Gotteshaus geleitet.« Den Juden des
Mittelalters und der Neuzeit war ihre Synagoge nicht bloß der Ort des Gebetes, sondern, dem ursprünglichen Begriff der Synagoge entsprechend,
Stätte des gesamten Gemeindelebens. Entsprechender Nebenraum war oft vorhanden. Hier amtierte die Gemeindeverwaltung, hielten die Rabbi84
Grundkurs Judentum
Tempel und Synagoge
ner Gericht ab, erfolgten auf Verlangen der Regierungsbehörden Ankündigungen aller Art, auch die sie diskriminierenden Eide mussten hier von
den Juden abgelegt werden. Ein Jude, der glaubte, dass ihm Unrecht geschehen wäre, und kein Mittel sah, zu seinem Recht zu gelangen, durfte
den Gottesdienst unterbrechen, bis ihm Gerechtigkeit widerfahren war. Strenge Maßregeln waren getroffen, um hier Missbrauch vorzubeugen.
Häufig bot die Synagoge auch der Schule Unterkunft, sie diente auch der Abhaltung politischer Versammlungen, Leichenfeiern und als Herberge
für durchreisende Glaubensbrüder. Auch Kirchen waren nicht immer ausschließlich (dem Gottesdienst vorbehalten. Bis zum Konzil von Lyon 1274
wurden sie zuweilen auch als Verkaufshallen für Handelsmessen, für eine Königswahl und zuweilen auch für eine Gerichtssitzung genutzt. Aber
das waren nur Ausnahmen. Die Synagoge hingegen betrachtete all ihre Funktionen als gleichberechtigt. »Vor der jüdischen Schul«, »vor dem
jüdischen Gericht« und »in der jüdischen Schul« steht in den (Urkunden gleichwertig nebeneinander als auswechselbares Synonym. Selbst Ausweisungsedikte wurden, wie 1448 in Konstanz und 1498 in Nürnberg, den Juden in ihrer Synagoge kundgetan.
85
Grundkurs Judentum
Talmud
Talmud
Wörtlich heißt Talmud soviel wie „Lehre“, eine Nominalisierung eines hebräischen Verbs mit der Wurzel lamad (Qal) = lernen bzw. limmed (Piel) =
lehren. Er enthält die Mischna, die um 200 redigierte erste Sammlung jüdischen Wissens nach der Bibel, und die Gemara, den dazu gehörigen
Kommentar. Gemara bedeutet ebenfalls „Lehre“, ist vor allem aber aufgrund der Sprachwurzel „gamar“ als Vervollständigung und Vervollkommnung der Mischna zu verstehen. Dabei ist wohl weniger gemeint, dass die Gemara die Mischnakommentierung abschließt, weil im Judentum
Kommentar immer wieder neuen Kommentar nach sich zieht, sondern eher der Umstand angesprochen, dass erst die Kommentierung eine Aussage, eine Schrift, eine Lehrmeinung, vollständig und vollkommen macht, also in ihrem Sinngehalt ausschöpft. Der Talmud ist daher von seinem
Ansatz her nicht eine abgeschlossene und in sich ruhende endgültige Lehräußerung, er ist vielmehr die beständig neu zu interpretierende und auf
den jeweiligen Sachverhalt hin auszulegende Basis.
Mischna + Gemara = Talmud.
Der sog. Palästinische Talmud oder Jeruschalmi (aufgrund seiner in Jerusalem angesetzten Abfassung) kommentiert nur etwa 39 von insgesamt
63 Traktaten. Er ist insgesamt die wesentlich kürzere und auch unbedeutendere Version des Talmud, weshalb man üblicherweise beim Begriff
Talmud an den babylonischen denkt, den man kurz Bavli nennt. Der babylonische Talmud wiederum kommentiert auch nicht alle Mischnatraktate,
nur 36,5. Wesentliche Teile fehlen also auch hier, was unterschiedliche Gründe hat. Der babylonische Talmud entsteht im heutigen Irak in einer
sehr langen Zeitspanne. Das genaue Datum des Abschlusses des Talmud ist unklar, aber wir können mit einer Zeitspanne der Talmudwerdung
vom 3. Jh. bis ins 8. Jh. (Ibn Daud, Saboräer bis 689) rechnen, wobei Drucker und Abschreiber den Text noch bis ins 19. Jh. hinein korrigierten
und veränderten, sodass wir eine endgültige Form des Textes erst vor knapp 200-150 Jahren annehmen müssen.
Fast 6000 Seiten Folio sind entstanden. Sie enthalten alles den Rabbinen in Babylonien wichtige Material und beschränken sich keineswegs nur
auf die Kommentierung der Mischna. Insgesamt kann man mit Günter Stemberger eher von einer Enzyklopädie sprechen. Neben ausführlichem
Material zu den jüdischen Gesetzen finden sich darin Legenden, Anekdoten, Wissensstoff aus allen wichtigen Disziplinen wie der Mathematik, Biologie, Medizin und vieles mehr, ein Traumbuch (Ber 55a-57b), ein Traktat über Wunder und Visionen (bBB 73a-75b), historische Erinnerungen etc.
Dabei wurde viel Material aus dem sog. Westen, also aus Palästina, übernommen und verwertet, sodass sie im babylonischen Talmud auch eine
Fülle rabbinischer Aussagen zu Palästina/Israel finden. Natürlich reflektiert man auch über die Beziehung der Juden zu Rom, dem großen Weltreich, das mit den Persern über Jahrhunderte in einem meist sehr gespannten Verhältnis stand.
Der Talmud selbst bietet oft eine lange und komplexe Argumentationslinie, die es eigentlich verbietet, einzelne kurze Abschnitt aus dem Kontext
zu reißen. In jedem Fall wird die Aussage verkürzt und der Gesamtzusammenhang gerät aus dem Blick. Es empfiehlt sich in jedem Fall, immer
den gesamten Abschnitt, die sog. Sugia, zu lesen und die darin enthaltenen Aussagen auf ihre Bedeutung im Kontext zu prüfen. Dann werden
auch die vielen Missverständnisse und Irritationen weniger werden. Allerdings bedarf es dazu eines gewissen Vorwissens und eines Einlassenkönnens auf die rationale und komplexe Denkwelt mit ihren vielen Assoziationen zu Bibeltext, Praxis, Hintergrundwissen und beständiger Verweistechnik auf andere Stellen im Gesamtwerk. Nicht umsonst lautet einer der großen Grundsätze der rabbinischen Schriftauslegung, dass es kein
Vorher und Nachher in der Tora gebe (bPesachim 6b und öfter). Alle Texte sind Teil eines großen Gewebes und können aufeinander bezogen,
miteinander in Beziehung gesetzt werden. Die zeitliche Abfolge ihrer Abfassung ist dabei nebensächlich, wenngleich sie nicht immer vernachlässigt wird. Im Mittelpunkt aber steht für den Talmud der Text als Sinngefüge, das im Hier und Heute Geltung und Bedeutung gewinnen muss.
Einige wichtige Grundlagen des talmudischen Denkens:
86
Grundkurs Judentum
Talmud
1. Es handelt sich um die Sammlung von Wissen zu allen Lebensbereichen, um Juden eine jüdische Weltsicht zu ermöglichen und zu jeder
Frage aus jüdischer Sicht diskutieren zu können.
2. Die Peripherie, die „Minderheit“, rückt ins Zentrum, betrachtet die Welt mit ihren Augen, wodurch die „Mehrheit“ zur „Um“-Welt wird. Auf diese Weise wird Geschichte der beherrschenden Kulturen mit einer Gegengeschichte interpretiert und relativiert.
3. Jüdische Identität wird durch Abgrenzung von den anderen Kulturen und noch stärker durch inhaltliche Beschreibund des „richtigen“ Judentums und Sinngebung definiert. Diese besteht in erster Linie
a) im Studium der Tora
b) in der Heiligung des Alltags
Bruchlinien verlaufen hier auch gegenüber innerjüdischen Gruppen.
4. Juden wird eine Existenz in der Diaspora ermöglicht. Israel rückt als souveräner Staat in die Ferne. Erst der Messias wird Israel wieder in
jüdische Hand geben. Die nur in Israel durchführbaren Gebote (landbezogene Gebote wie Eckenlass, Zehnten etc.) werden durch das Studium der dafür vorgesehenen Perikopen ersetzt.
5. Der Talmud rückt die rabbinische Existenz in den Mittelpunkt. Nicht mehr König, Krieger, Prophet, sondern der Toragelehrte beherrscht die
gesellschaftliche Realität. Wissen ist Macht, die aber nicht missbraucht, sondern segenbringend eingesetzt werden soll.
6. Mit den herrschenden Mächten und Kulturen ist friedvoll umzugehen. Vor Aufständen wird gewarnt. Die Tora ist das portative Vaterland des
Judentums und seine Stütze über die Zeit.
87
Grundkurs Judentum
Das erste und zweite Gebot
Alfred Bodenheimer
Das erste Gebot
Eine exegetische Annäherung an das jüdische Verständnis des Monotheismus: in: Johannes Schaber (Hg.), Gemeinsame Wurzeln. Der Gottesglaube im Judentum, Christentum und Islam (Schriftenreihe der Ottobeurer Studienwoche 3), Leutesdorf 2002,
13-29.
„Anochi Haschem Elokecha ascher hozeticha me’erez mizrajim mibeit avadim.“ „Ich, J-h-w-h bin dein Gott, als welcher ich dich aus dem Lande
Ägypten herausgeführt habe, aus dem Hause von Knechten.“ So lautet, im hebräischen Urtext bzw. in der Übersetzung des namhaften Bibelforschers Benno Jacob in seinem Exodus-Kommentar, der Vers 2.B.M. 20,2. Dieser Vers ist nach der jüdischen Überlieferung für sich allein genommen das erste der Zehn Gebote. Daß sich die jüdische Lesart damit von den (unter sich wiederum unterschiedlichen) Lesarten der christlichen
Konfessionen unterscheidet, ist offensichtlich und wird gegen Ende dieses Beitrags noch eingehender zur Sprache kommen. Zunächst einmal aber läßt sich festhalten, daß dieser jüdischen Lesart zufolge das erste Gebot gar kein Gebot ist oder zumindest nicht so aussieht. Es besitzt weder
einen positiv noch einen negativ formulierten Imperativ. Es ist eine Aussage. Aber was für eine Aussage? Steht irgend etwas darin, was wir nicht
von der Toralektüre schon wüßten oder was zum Verständnis der folgenden neun Gebote (oder Aussagen) beiträgt? Diese Grundfrage nach dem
Neuen, Notwendigen, Nicht-Redundanten eines Verses, eines Worts oder auch eines Buchstabens in der Tora ist die Urfrage der jüdischen Exegese, welche die Heiligkeit des Textes letztlich an seiner durchgehenden Befragbarkeit festmacht.
Der Talmud erklärt, nur das erste und das zweite Gebot, in welchen Gott in der ersten Person spricht, habe das Volk von Gott direkt vernommen,
den Rest habe Moses ihm übermittelt. Gershom Scholem überliefert dazu den Gedanken des chassidischen Rabbis Menachem Mendel von Rymanow, Gott habe überhaupt nur das unvokalisierte Alef von Anochi gesprochen, also einen stummen Kehllaut, der für sich allein gar kein Laut
ist.1 Der in Jerusalem lehrende Literaturwissenschaftler Stéphane Mosès meint dazu in einem Aufsatz, die göttliche Stimme offenbare sich nach
dieser chassidischen Version „comme une pure promesse de sens“, wie ein reines Sinnversprechen. Die Offenbarung in sich, so Stéphane Mosès,
sei eine Leere, die sich nur über die Interpretation erschließen läßt.2
Die Kontraktion des selbst ausgesprochenen „Ich“ Gottes auf das Alef verdeutlicht ebenfalls, daß hier das Volk Israel mit etwa konfrontiert wird,
das ursprünglicher noch ist als die Schöpfung. Der Schöpfungsbericht beginnt mit dem hebräischen Wort „bereschit“ (im Anfang) und damit mit
dem zweiten Buchstaben des hebräischen Alphabets, Bet, während die Offenbarung mit dem ersten, Alef, beginnt. Was sich am Sinai offenbart,
war vor der Schöpfung da, und die Gebote, die folgen werden, die Eltern zu ehren, nicht falsch zu schwören, sich nicht an seinem Nächsten zu
vergehen, sind nicht gesellschaftliche Konventionen zwischen Mensch und Mensch oder mythisch verbrämte Rituale zwischen Mensch und Gott,
sondern der Dekalog ist der Schöpfung inbegriffen, bzw. ihr vorausgesetzt. Wer die Gebote verletzt, handelt gegen den Sinn der Schöpfung selbst,
ja, gegen den Sinn, der der Schöpfung vorausging.3
1
2
3
88
Gershom Scholem: Zur Kabbala und ihrer Symbolik, Zürich 1960, 47f.
Stéphane Mosès: L’éros et la loi. Lectures bibliques, Paris 1999, 82f.
Im Babylonischen Talmud, Traktat Pessachim 54a wird die Tora als erstes von sieben Dingen genannt, die vor der Schöpfung geschaffen wurden (was heissen
soll: ohne welche die Schöpfung a priori keinen Bestand hätte).
Grundkurs Judentum
Das erste und zweite Gebot
Doch bevor wir uns weiter, und ausführlicher, mit diesem ersten Wort der Zehn Gebote beschäftigen, soll der Satz als ganzer in seinen Elementen
betrachtet werden, und zwar von hinten nach vorne. Denn es scheint, daß so das Gewicht, das auf dem göttlichen „Ich“, dem hebräischen „anochi“, liegt, noch deutlicher gemacht werden kann. In der zitierten Übersetzung Benno Jacobs wird „mibeit awadim“ übersetzt mit „aus dem Haus
von Knechten“. Wie bei jeder Übersetzung unvermeidlich, ist dies eine Entscheidung für eine Sinnoption. Dass es in diesem Falle zwei solcher
Sinnoptionen gibt, darauf hat bereits Raschi (Akronym für Rabbi Schlomo ben Jitzchak, 1040-1105), der bis heute im jüdischen Bibelstudium wichtigste Kommentator, aufmerksam gemacht: Entweder: Aus dem Knechthause, also jenem Haus, in welchem du geknechtet warst, oder eben, wie
Jacob übersetzt: Aus dem Haus von Knechten, wo du selbst Knechten dientest. Die beiden Aussagen sind grundverschieden, aber nicht unvereinbar: Nach der ersten Aussage wird die Befreiungstat des Exodus ins Zentrum der göttlichen Offenbarung gestellt. Israel würde nicht dort stehen,
wo es zum Zeitpunkt der Offenbarung steht, es würde über kurz oder lang gar nicht mehr existieren, wenn es aus der Knechtschaft nicht befreit
worden wäre. In diesem Fall ist „mibeit awadim“ untrennbar von „als der ich dich herausgeführt habe aus dem Lande Ägypten“. Es soll Israel in
Erinnerung rufen, daß es eben nicht die Fleischtöpfe und das Gemüse waren, die im Zentrum des Aufenthalts von Ägypten standen, sondern
schwere Fronarbeit, gepaart mit systematischem Mord an (männlichen) Kindern, wie ihn Moses durch die List seiner Mutter und der Vorsehung im
berühmten pechbestrichenen Weidenkörbchen auf dem Nil überlebt hat. Aus diesem Schicksal herausgeführt zu sein, bedeutet auch, für Gottes
Stimme und seine Offenbarung empfänglich zu sein.
Die andere Interpretation, „aus dem Haus von Knechten“, deutet darauf hin, daß, wie der zionistische Publizist Achad Haam (Pseudonym für Ascher Ginsberg) sich einmal ausgedrückt hat, auch die Geistlichen, die Galilei Galileo davon abbrachten, seine These zu verkünden, sich dennoch
zur selben Zeit ebenfalls auf der Erde um die Sonne bewegten. Auch Ägypten, das nicht an Gott glaubt, besteht demzufolge aus Knechten Gottes.
Aus der Perspektive unserer Zeit, die anthropologische und psychohistorische Forschungen über das Entstehen von Religion und die Konstruktion
von Gottesbildern anstellt, mag im Anspruch Gottes, über andersgläubige Völker ebenso zu herrschen wie über das von ihm auserwählte, der indirekte Weltherrschaftsanspruch eines de facto nie sehr mächtigen Volkes stecken. Sigmund Freud hat im jüdischen Auserwähltheitsgedanken Überreste eines solchen Anspruchs zu entdecken vermeint. Doch so ist diese Auslegung kaum gemeint. Vielmehr wird die Welt hier einer einheitlichen Ordnung unterworfen, die an und für sich mit den Ansprüchen des Volkes, zu dem Er hier gerade spricht, nichts zu tun hat. Ägypten steht für
alle Länder, sie alle sind „Häuser von Knechten“ Gottes, mit oder ohne ihr Wissen. Diener Gottes ist, so lautet die Quintessenz dieser Deutung,
nicht nur, wer Ihm dient.
Gehen wir im Wortlaut des ersten Gebots einen Schritt weiter zurück, stossen wir auf die Singularisierung des Angesprochenen, die die ganzen
Zehn Gebote hindurch vorherrscht: „Dein Gott, als der Ich dich hinausgeführt habe“. Zum Kern der Liturgie am Sederabend, dem ersten Abend
des Pessachfestes, wo die Erinnerung an den Exodus im Zentrum steht, gehört die Forderung, jeder einzelne in jeder Generation habe sich zu
betrachten, als sei er selbst aus Ägypten ausgezogen. Dasselbe liesse sich hier vorbringen: Jeder einzelne, in jeder Generation hat als aus Ägypten Geführter auch die Offenbarung erlebt. Die berühmte rabbinische Meinung, wonach alle Seelen des Volkes Israel, auch die Seelen der noch
nicht Geborenen, bei der Offenbarung anwesend waren, stützt diese Idee. Doch auch das Gegenteil wird hier ausgedrückt: Gott spricht zu einer
Generation, die den Auszug erlebt hat, die sich nicht in einem auf alle Zeiten erstreckten Kollektiv wiederfinden muss, sondern das konkrete, erst
einige Wochen zurückliegende Ereignis des Exodus nun mit dem verknüpfen soll, was kommt: Dem Gesetz. Die späteren Generationen, die das
lesen, finden sich in der doppelten Rolle wieder, späte Zeugen eines historischen Akts und selbst in diesem Akt Angesprochene zu sein, und der
einzelne Nachgeborene empfindet diese Doppelheit sehr viel stärker, als wenn er sich symbolisch einem „ihr“ subsumieren kann oder soll. Doch
das tiefste Geheimnis des Du in den Zehn Geboten liegt wohl wiederum im göttlichen Ich, zu dem wir uns nun weiter rückwärts durchkämpfen.
89
Grundkurs Judentum
Das erste und zweite Gebot
Wieso, fragt es sich deshalb weiter, identifiziert sich Gott gerade als jener, der uns aus Ägypten geführt hat? Aus der Sicht des am Sinai angesprochenen Zeitgenossen ist dies verständlich. Gott verweist auf eine Erfahrung, die der Angesprochene mit diesem Moment verbinden kann. Er
verweist auf die Einlösung des Bundes mit Abraham, dem er die Knechtschaft seiner Nachkommen vorausgesagt und ihre Befreiung versprochen
hat. Der am Sinai Angesprochene weiß also, mit wem er es zu tun hat – oder eben nicht. Wiederum ist es Raschi, der darauf verweist, daß Gott
dem Volk seine unterschiedlichen Erscheinungsweisen klar machen muss. Der ‚gewaltige‘ Sturm- und Naturgott, der wenige Wochen zuvor das
Meer geteilt hat, ist identisch mit dem ‚weisen‘ Gott der Lehre und des Gesetzes, der jetzt spricht. Die Unmöglichkeit, Gott finale Eigenschaften
zuzuschreiben, wie das bei jeder funktionsbestimmten Gottheit der polytheistischen Kultur notwendigerweise geschieht, erfährt hier ihre Grundlage. Die Selbstdefinition Gottes durch seine Taten bestimmt sein Bild auf dreierlei Weise: Erstens setzt sie natürlich ein Gottesverständnis voraus,
nach welchem Gott ein tätiger Gott ist. Der geschichtsmächtige Gott kann nicht ein Gott sein, der um seiner selbst willen existiert. Er interferiert mit
den Ereignissen auf dieser Welt. Zweitens reduziert dies Gott im menschlichen Verständnis zugleich auch auf die Summe seiner Taten,.so daß
das menschliche Nachdenken und Sprechen über Gott immer im Bewußtsein von dessen Unfaßbarkeit geschieht. Maimonides hat in seiner philosophischen Hauptschrift „Führer der Unschlüssigen“ schon dargelegt, daß das Zumessen von Eigenschaften an Gott immer nur bildlich, am
menschlichen Fassungs- und Vorstellungsvermögen entlang gesprochen ist, aber über Gottes Wesen keinerlei Aussage enthält. Das Sprechen
über Gottes Taten hingegen, etwa über das Herausführen aus Ägypten, ist (Punkt eins, also den geschichtsmächtigen Gott vorausgesetzt) eine
objektive Aussage. Gott sagt von sich selbst nicht, er sei barmherzig, gross oder stark, er spricht nur davon, daß er das Volk mit starker Hand befreien werde, bzw. hier, daß Er es hinausgeführt hat. Drittens schließlich: Ist Gott durch eine Tat identifiziert, die in das Leben des Menschen eingreift und dem Menschen neue Möglichkeiten eröffnet, so entscheidet über den Sinn der göttlichen Tat letztlich der Mensch. Dies gilt in besonders
auffälliger Weise für den Zusammenhang zwischen Exodus und Sinai: Wir können nicht genau sagen, weshalb Gott das Volk Israel aus der ägyptischen Sklaverei errettete, bis nicht Israel das Gesetz erfüllt und damit Gottes Handlung ihren Sinn zurückverleiht. Gottes Vorstellungsformel ist
also nicht nur eine Identifizierungshilfe, sondern enthält in sich die Vorgabe, die geleistet worden ist, etwas salopp ausgedrückt, die göttliche Investition in das Volk Israel. Es ist nicht nur so, daß Gott nun, da er das Volk befreit hat, dafür als Preis die Annahme seines Gesetzes verlangt. Gott ist
in gewissem Sinne geradezu darauf angewiesen, dass Israel seinen Befreiungsakt mit Sinn füllt. Betrachten wir das Gesetz als der Schöpfung inhärent mitgegebenes Werk, als Alef vor dem Bet, so erahnen wir, welche Erlösung für Gott es bedeutet, sein Gesetz bei einem Volk zu deponieren, es durch dieses Volk in die Welt zu bringen. Am Dornbusch hat Gott Moses noch gesagt, er habe sich mit seinem Namen „J-h-w-h“ den
Stammvätern nicht offenbart, was von manchen Erklärern so verstanden wird, dass er den Vätern Versprechen zwar gegeben, sie aber noch nicht
eingelöst habe. Mit dem Auszug aus Ägypten hat der Einlösungsprozeß begonnen, er wird die Referenz Gottes bleiben, seine Legitimation, sich
weiter „J-h-w-h“ zu nennen.
Was aber bedeuten, um schließlich bei dieser rückwärts laufenden Satzdeutung an den Anfang des Satzes zu gehen, dessen erste Worte: „Ich, Jh-w-h bin dein Gott“? Die beiden Gottesnamen, das sogenannte Tetragramm J-h-w-h und der vielfach verwendbare Begriff Elohim als nebeneinander bestehende Bezeichnungen des einen Gottes haben seit jeher Erklärungsbedarf geweckt. Daß sie seit den Tagen der textkritischen Bibellektüre zu ganzen Umschichtungen der Tora unter anderem in eine Jahwisten- und eine Elohistenschrift geführt haben, muß hier nicht weiter erläutert werden, denn es führt am Wesen meines Deutungsversuchs vorbei. Auf jüdischer Seite hat schon Rabbi Jehuda Halevy im Mittelalter eine
qualitative Trennung der beiden Begriffe unternommen, die wir in etwas modifizierter Weise im 20. Jahrhundert bei Benno Jacob wiedertreffen.
Jacob versteht den Begriff „Elohim“ als Bezeichnung für die Gottheit überhaupt. An Gott als einzigen „Elohim“ können auch die Völker glauben, es
ist der Grundbegriff des Monotheismus (wobei der Begriff auch im Zusammenhang mit „Elohim acherim“, die verbotenen „anderen Götter“ gebraucht wird). „Elohim“ ist deshalb wie im Hebräischen jedes Substantiv mit einem Suffix versehbar, also mit einer Endung, die ein Possessivpro90
Grundkurs Judentum
Das erste und zweite Gebot
nomen ausdrückt: Elohai, Elohecha, Elohenu etc. Das Tetragramm hingegen ist der göttliche Namen, mit dem sich Gott ganz spezifisch gegenüber Israel offenbart und mit welchem Gott von Israel angerufen wird. Das Tetragramm läßt sich allenfalls mit einer vorgestellten Präposition wie
„me“ (von) , „ba“ (in) oder „la“ (an) verbinden, aber nicht flektieren. Benno Jacob benützt deshalb weder das gebräuchliche „Ich bin Gott , dein
Herr“ oder „Ich bin der Ewige, dein Gott“ noch das Buber-Rosenzweigsche in Großbuchstaben geschriebene „ICH“ für das Tetragramm, sondern
er setzt J-h-w-h als Eigennamen ein. Gott stellt sich im ersten Gebot Israel vor und verleiht Israel im selben Moment mit der Offenbarung seines
Namens eine eigene, unverwechselbare Statur unter den Völkern.
Bis hierher folgen wir einer akkurat jüdischen Deutung der ersten Gebots, das, wie ich zu Beginn dieses Vortrags schon gesagt habe, beinahe alles enthält, außer einem Gebot. Es scheint aber, wenn wir uns auf das allererste Wort dieses ersten Gebots zurückziehen, jenes anochi, das wir
bisher allein seines Anfangsbuchstabens wegen betrachtet haben, im göttlichen Ich vielleicht nicht ein Gebot, aber doch ein Ruf verborgen zu sein.
Das „Ich“ eines allumfassenden, allgegenwärtigen Gottes ist doch eigentlich ein skandalon. Um zu erörtern, ein wie großes skandalon es ist, müssen wir zuerst die Gegengröße des menschlichen Ich betrachten. Das Ich bedeutet den Rückzug des Individuums auf eine irreduzible Größe, vorausgesetzt, das Individuum kann diese Irreduzibilität intellektuell erfassen. Wir wissen vom Menschen, daß er dies erst zu einem bestimmten Zeitpunkt im Kleinkindalter kann. Das Baby erfährt sich zunächst noch nicht als von der Mutter getrenntes Wesen, ein Gefühl für das eigene Ich ist
Ergebnis eines geistigen Entwicklungsprozesses. Und dieses Bewußtsein des eigenen Ich ist auch nicht gesichert, es kann durch psychische Erkrankung oder äußere Manipulation schwer beschädigt werden. Wenn ein Mensch „Ich“ sagt, ist dies folglich immer auch eine Erfolgsmeldung seines fortbestehenden Irreduzibilitätsbewußtseins. Er kann nicht weniger werden als er ist und er ist auch nicht nur als Teil von mehrereren seiend.
„Ich“ ist also immer ein Kampfbegriff, ein Widerstehen gegen die Anfechtungen der Ichvergessenheit. Gerade die Form „anochi“, in welcher Gott
im ersten Gebot als „Ich“ auftritt, erscheint in der Tora erstmals in einer Situation, da das Ich-sagen als Akt des Widerstands, als Selbstvergewisserung erscheint. Es ist Kains Antwort auf Gottes Frage nach dem Verbleib seines Bruders Abel: „Lo jadati, Haschomer achi anochi?“ – „Ich wußte
nicht, bin ich meines Bruders Hüter?“ Kain, der soeben seinen Bruder, gewissermaßen den anderen Teil seines Kosmos (der Midrasch verstärkt
diese Wirkung noch durch die Behauptung, sie seien Zwillinge), erschlagen hat, der zugleich im Schatten dieses Bruders stand, dessen Opfer
Gott, im Gegensatz zu seinem eigenen, angenommen hatte, dieser Kain findet sich nun selbst vor Gott: „Haschomer achi anochi?“ Indem er Gott
diese rhetorische Frage stellt, vergewissert er sich vor allem einer Sache: Ich bin noch da. Daß dieses Ich eher ein Defizit als ein Gewinn ist nach
dem Mord an dem anderen Ich, das begreift Kain erst nach Gottes schwerem Tadel.
Am Anfang des Dekalogs nun ist es Gott, der „anochi“ sagt. Gott muß sich seiner nicht vergewissern. Und Gott ist zwar einer, aber nicht im Sinne
einer irreduziblen Individualität, sondern im Sinne einer allumfassenden Entität. Wie kann das Wort „Ich“ hier irgendetwas Wesenhaftes repräsentieren, das sich der Mensch als sprechendes Subjekt vorstellen kann?
Am Anfang des schon erwähnten „Führers der Unschlüssigen“ des Maimonides steht die Frage, ob es eine göttliche Gestalt gibt und wie sie beschaffen sei. Das Problem wird von Maimonides angegangen, indem er auf den Bau des Menschen „nach dem Bild Gottes“ verweist. Da der
Mensch eine physische Gestalt besitzt, muß nicht auch der, nach dessen Bild er geschaffen wurde, zwangsläufig eine physische Gestalt besitzen?
Maimonides verneint natürlich und bezieht die Ähnlichkeit des Menschen zu Gott, das, was den Menschen von allen anderen Lebewesen unterscheidet, auf die Vernunft, auf das Vermögen zu denken.4 Diese Antwort mag einem mehr oder weniger durchtrainierten Monotheisten auf den
ersten Blick banal erscheinen, aber sie ist es durchaus nicht. Maimonides nämlich schafft es, das zentrale Problem, die physische Gestalt Gottes,
4
Mose ben Maimon: Führer der Unschlüssigen, ins Deutsche übertragen und mit erklärenden Anmerkungen versehen von Adolf Weiss, Leipzig 1923, Erstes Buch, 27-37
(Kapitel 1-3).
91
Grundkurs Judentum
Das erste und zweite Gebot
gerade durch den physischen „Bild“-Begriff so umzudeuten, daß daraus die Fähigkeit zur Abstraktion wird. Im Bilde Gottes geschaffen zu sein bedeutet demnach gerade die Fähigkeit des Menschen, sich vom Bild Gottes zu lösen, Gott nichtbildlich zu denken.
Das Verständnis des Maimonides kann uns helfen, die Bedeutung des göttlichen „Ich“ zu begreifen. Der Mensch, der sich im Ebenbild Gottes
sieht, erkennt, daß er auch beim „Ich“-Sagen oder im wesentlichen beim „Ich“-Sagen einen Akt vollbringt, der nicht nur die eigene Individualität
bestätigt, sondern auch als Akt und Manifestation menschlicher Gottesebenbildlichkeit geschieht. Das Verständnis des „Ich“ wird ein anderes,
wenn aus diesem „Ich“ zugleich das „anochi“ des ersten Gebots mithallt. „Ich“ sagen zu können, ist also nach der Tora nicht nur eine anthropologisch zu wertende entwicklungspsychologische Errungenschaft des Menschen, es deutet auch darauf hin, daß er sich dem Akt der Offenbarung
anschließt. Gottes „Ich“ verleiht dem menschlichen „Ich“ einen ungeheuren Hintergrund und eine ungeheure innere Macht. Wer „Ich“ sagt, steht
nicht nur für sich als physische, als empirisch faßbare, messende, bestimmende, gestaltende Person ein, wie sie Descartes entworfen und der
Idealismus des 19. Jahrhunderts in verhängnisvoller Weise weiterentwickelt hat, sondern er beruft sich implizit auch für seine gottgegebene Fähigkeit und Legitimation, „Ich“ zu sagen. Sein „Ich“ ist Selbstbild und Ebenbild in einem, es ist ein authentisches und ein dem göttlichen Potential des
Ichsagens entliehenes „Ich“, eine „transzendentales Ich“, um einen Begriff von Emmanuel Lévinas zu gebrauchen. Es gibt deshalb vielleicht keinen
annähernd so göttlichen Akt für den Menschen wie das Aussprechen des Wortes „Ich“.
Rabbiner Joseph Carlebach, ein begnadeter spiritueller Führer, der in den zwanziger und dreißiger Jahren Rabbiner in Altona und Hamburg war,
mit den Verbliebenen seiner Gemeinde deportiert wurde und 1942 in Riga in den Tod ging, schrieb einmal über das göttliche „Ich“: „Dieses Ich,
das den Menschen anredet, hinter dem keine Polizei, keine Gewalt steht, das nur den Menschen anredet und ihn in seinem Angesprochensein
sich selbst überläßt, ob er auf diese Stimme reagieren wird, dieses Ich Gottes soll ihm begegnen. Wir sollen aus jedem Wort im gegebenen Moment unseres inneren Erlebens die Stimme eines Höheren vernehmen, die Stimme der Offenbarung.“
Offenbarung, nicht als gewaltiges Naturereignis und nicht als von einem in der Wüstensonne taumelnden Volk erlebte Massensuggestion, sondern
als vom Menschen erbrachte Leistung, das Göttliche in sich und auch außerhalb seiner selbst, als innere wie als äußere Rede, schwingen zu lassen, liegt in jenem „Ich“, jenem ersten Gebot überhaupt verborgen. Die Offenbarung als menschliche Leistung hervorzuheben, ist auch ein Anliegen Leo Adlers gewesen, des 1978 verstorbenen Basler Rabbiners, den ich noch meinen Lehrer nennen darf. Als ich mich mit seinem Nachlaß zu
beschäftigen begann und eine seiner Schawuot-Predigten las, da glaubte ich mich erinnern zu können, die wesentliche These dieser Predigt
schon einmal aus seinem Mund selbst gehört zu haben, nicht im Gottesdienst, sondern im Unterricht als Schüler in der inzwischen nach ihm benannten Jüdischen Primarschule in Basel. Die Zehn Gebote nämlich, so erklärte er, auch dem hebräischen Ausdruck „asseret hadibrot“ folgend,
sind nicht eigentlich Gebote, sondern Worte, Aussagen. Alle Verbote, die innerhalb dieser Zehn Geboten formuliert sind, werden eigentlich korrekt
nicht als Imperative übersetzt, im Gegensatz zu den positiv formulierten Geboten, die eine klare Imperativ-Form aufweisen. Ein Verbot zu morden
müßte heißen „al tirzach“, mit der verneinenden Negativformel „al“ eingeleitet werden. Es heißt aber „lo tirzach“, und „lo“ ist ein neutrales Verneinungswort, womit das Wort „tirzach“, eine Futurumform, die man auch imperativ übersetzen kann, wieder zum Futur neutralisiert wird: „Du wirst
nicht morden.“ Das Erlebnis göttlicher Präsenz in der eigenen Existenz und das Anerkennen der Rolle und Funktion des eigenen Ich führen nicht
primär zu einer Befolgung von Gebot und Verbot, sondern zu einem Selbst- und Weltverständnis, in welchem gewisse Handlungen keinen Raum
mehr besitzen.
An diesem Punkt möchte ich meine methodische Meditation beenden und noch ein paar Sätze zur Wirkungsgeschichte dieses prominenten Satzes in der jüdischen Geschichte sagen. Ich meine nämlich, daß dieser Satz , nicht allein, aber im Gefüge der Tora, in welcher er steht, durchaus
eine spezifisch jüdische Wirkungsgeschichte hat. Um dies zu erfassen, ist es vielleicht angezeigt, die jüdische Einteilung der Gebote mit den
christlichen Einteilungen zu vergleichen, die davon durchaus differieren. Das katholische Verständnis der Zehn Gebote versteht diesen Satz ge92
Grundkurs Judentum
Das erste und zweite Gebot
meinsam mit dem nach der jüdischen Überlieferung folgenden zweiten Gebot, keine Götter neben Gott zu haben, als ein einziges Gebot. Gottes
im ersten Satz manifestierte Präsenz wird danach gewissermassen im Verbot, keine anderen Götter zu haben, bestätigt. Das findet in der jüdischen Überlieferung insofern einen gewissen Widerhall, als, wie ich vorher erwähnt habe, der Talmud diese beiden ersten Gebote als die einzigen
am Sinai von Gott selbst und nicht von Moses ausgesprochenen betrachtet. Die protestantische Version sieht diesen ersten Satz überhaupt nicht
als Teil eines Gebots an, sondern als Präambel der Zehn Gebote als Ganzes, die für die Protestanten erst mit dem für die Juden zweiten Gebot
überhaupt beginnen. Auch diese Vorstellung ist dem jüdischen Standpunkt aus auch nicht ganz fremd, unter Berücksichtigung der erwähnten jüdischen Deutung, daß das Verstehen des göttlichen „Ich“ auf die anderen Sätze ausstrahlt.
Trotzdem ist die jüdische Konzeption eine fundamental andere als die der beiden christlichen Konfessionen, und zwar aus zweierlei Gründen: Zum
einen bedeutet das Erheben eines gänzlich unimperativen Satzes zum eigenen Gebot eine Relativierung des Gebotscharakters überhaupt aller
Gebote. Die Gebote sind eine Quintessenz menschlicher Existenz nach Maßgabe der Tora. Sie stehen im Judentum nicht isoliert als für jedermann verbindliche Gesetze in einer die jüdische „Gesetzesreligion“ prinzipiell ablehnenden Theologie, sondern sie spiegeln summarisch ein Leben
wieder, das im Sinne der Tora geführt wird. Zweitens denke ich, daß die Erwähnung des Auszugs aus Ägypten in diesem Satz eine jüdische Saite
angerührt hat, die in der christlichen Rezeption niemals dieselbe Resonanz besitzen kann. Indem Gott zum Individuum von seinem Auszug aus
Ägypten spricht, appelliert er an ein persönliches Beziehungsgefühl, das diesen Auszug nicht symbolisch, sondern existentiell versteht. Dieses
Wort von Ägypten ist für den Juden nicht einfach umfassend als göttliche Daseinsbestätigung zu verstehn, es ist auch spezifisch, in seinem Anruf
nicht einfach in ein Allgemeines integrierbar, die Aufforderung, das menschliche Ich dem göttlichen Ich folgen zu lassen. Die Diasporaexistenz der
Juden, besonders im christlichen Abendland, ist geprägt von zwei dichotomisch auseinandergehenden Deutungen des jüdischen Exils. Für die
Juden blieb das Überleben im bedrängten Exil immer die versteckte Bestätigung einer besonderen Beziehung zu Gott, die auf dem Auszug aus
Ägypten und dem darin inhärenten Versprechen einer neuerlichen Befreiung beruhte. Für die Christen war es im wesentlichen die Bestrafung der
Juden, wenn nicht für ihren Christusmord, dann zumindest für ihre Starrköpfigkeit, mit welcher sie sich der offensichtlich siegreichen christlichen
Religion verschlossen. So hat das Christentum das „ascher hozeticha mimizraim“, den Bezug zum Auszug aus Ägypten, viel eher einem allgemeinen Gottesbegriff unterordnen können als das Judentum, das hier ein konstitutives Element göttlicher Tat vernahm, das auch im halachischen
(vom jüdischen Gesetz bestimmten) Alltag durch die Mizwa etwa der Zizit (Schaufäden), des Schmahgebets (in dem der Auszug aus Ägypten eine
wichtige Stellung einnimmt) oder der Pessacherzählung über den Exodus explizit bestätigt werden mußte.
So ist das erste Gebot, in der Form, wie es hier besprochen worden ist, das einzige Gebot, das nur für die Juden eines ist. Und gerade für die Juden ist es, wie sich aus diesem Text hoffentlich hat entnehmen lassen, im Grunde möglicherweise ohnehin keines.
93
Grundkurs Judentum
Das erste und zweite Gebot
Gerhard Langer
„Du sollst neben mir keine anderen Götter haben“ – das zweite Gebot in der jüdischen Zählung: in: Johannes Schaber (Hg.), Gemeinsame Wurzeln. Der Gottesglaube im Judentum, Christentum und Islam (Schriftenreihe der Ottobeurer Studienwoche 3), Leutesdorf 2002,
31-58
Alfred Bodenheimer hat ausgeführt, dass die jüdische Zählung mit guten Gründen und einer herausragenden Rezeption das „Anokhi JHWH“ in V.
1 als erstes Gebot zählt. Diesem schießt sich unmittelbar das in mehrere Detailinterpretationen aufgefächerte Verbot anderer Götter an. Die Bedeutung für das Judentum ist nicht hoch genug einzuschätzen. Es würde bei weitem den Rahmen eines Vortrags sprengen, auch nur annähernd
alle Nuancen der Bedeutung des Fremdgötterverbots im Judentum zu beschreiben. Darum will ich mich auf einige wenige wichtige Bereiche beschränken und vor allem die sog. rabbinische Literatur als Grundlage des Judentums in den Blick nehmen.5
1. „Jehudi“ ist „Jechidi“:
Wenn wir von Juden reden, so müssen wir zuallererst fragen, was denn damit überhaupt sprachlich gemeint ist. Viel zu schnell wird der Schluss
gezogen, der hebräische Begriff „Jehudi(t)“ bezeichne einen „Juden“/eine „Jüdin“, „Jehudim“ „Juden“ im Sinne einer ethnischen Gruppe bzw. noch
stärker im Sinne einer religiösen Gemeinschaft, wobei wird Religion als eigenständig separierbarer Lebensbereich aufgefasst wird.
Doch diese Zuordnung übersieht, dass in der Antike Religion als separierbarer Lebensbereich nicht existiert. Was wir heute darunter verstehen,
dafür kennen die alten Griechen und Hebräer kein eigenes Wort. Vielmehr ist das Gemeinte in die beiden wichtigsten Lebensbereiche, das Gemeinwesen (politeia) und die Familie eingebettet. Herodot (Historien 8, 144) konnte etwa das Griechentum (to hellenikon) durch folgende Aussagen umschreiben: gemeinsames „Blut“ und Sprache; gemeinsame Einrichtungen und Opfer für die Götter sowie gemeinsame Lebensweise. Dies
trifft nun genauso für das antike Judentum zu. In seiner hervorragenden Studie “The Beginnings of Jewishness“ erhellt Shaye J. D. Cohen überzeugend, dass „Die Juden (Judäer) der Antike ... ein ethnos, eine ethnische Gruppe [bildeten]. Sie waren eine mit einem Namen, der mit einem
spezifischen Territorium verbunden war, bezeichnete Gruppe. Ihre Mitglieder teilten ein Gefühl gemeinsamer Ursprünge, erhoben Anspruch auf
eine gemeinsame und besondere Geschichte bzw. Schicksal, besaßen ein oder mehrere besondere Charakteristika und ein Gefühl kollektiver Einzigkeit und Solidarität. Die Summe dieser besonderen Charakteristika wurde mit dem griechischen Wort Ioudaismos bezeichnet. Und wir werden
sehen: Die eigentümlichste Besonderheit der Juden war die Art, in der sie ihren Gott verehrten, was wir heute ihre Religion nennen würden. Aber
der Begriff Ioudaismos, der Vorläufer des englischen Wortes judaism, bedeutet mehr als nur Religion. Für die antiken Griechen und heutige Sozialwissenschaftler ist >Religion< nur eine von vielen Einzelheiten, die eine Kultur oder eine Gruppe unterscheidbar machen. Deshalb sollten wir
vielleicht Ioudaismos nicht mit >Judaism<, sondern mit >Jewishness< übersetzen.“ 6
5
6
94
Vgl. auch Günter Stemberger, Der Dekalog im frühen Judentum, JBTh 4 (1989) 91-103.
Shaye J. D. Cohen, The Beginnings of Jewishness. Boundaries, Varieties, Uncertainties (Hellenistic Culture and Society 31), Berkeley/London 1999. Übersetzung von Rolf
Rendtorff und Edna Brocke in KuI 2 (2001) 106f., im Original 7.
Grundkurs Judentum
Das erste und zweite Gebot
Der Ausdruck „Jehudi“ ist einmal geografisch zuzuordnen. Der Begriff tritt erst in nachexilischer Zeit auf und bezeichnet in den Büchern Esra, Nehemia, Daniel und vor allem Ester nichts anderes als die Bewohner der Provinz Judäa. Diese Bedeutung behält er auch in seleukidischer und römischer Zeit. Wie Ägypter, Kappadozier, Thraker, Phrygier sind „Jehudim“ Mitglieder einer ethnisch abgrenzbaren und geografisch zuordenbaren
Gemeinschaft, und zwar in Judäa oder in der Diaspora. Nicht jeder in Judäa lebende Mensch ist daher Judäer. Flavius Josephus unterscheidet
deutlich zwischen Syrern, Griechen und Judäern, wenn er ethnische Konflikte in Judäa beschreibt (BJ 2.266f). Andererseits ist in vielen griechischen und römischen Texten von Judäern außerhalb Judäas die Rede.
Die Rabbinen überliefern schließlich im Midrasch Ester Rabba 6.2 eine spannende Definition des Namens „Jehudi“ = „Jude/Judäer“ im Zusammenhang mit Ester 2,5:
EIN MANN; EIN JUDÄER; WAR IN SUSA; DER FESTUNG; UND SEIN NAME WAR MORDECHAI, SOHN JAIRS; SOHN SCHIMIS; SOHN
KISCHS; EIN MANN; EIN JEMINI: EIN JUDÄER. Warum wird er Judäer genannt, war er doch nicht ein Benjaminit? Weil er den Gottesnamen gegenüber der ganzen Menschheit „einte“, wie geschrieben steht: Mordechai aber fiel nicht nieder und huldigte ihm nicht (Ester 3,2). Suchte Mordechai denn Streit oder Ungehorsam gegenüber dem Befehl des Königs? Tatsache ist, dass Ahasverosch anordnete, dass alle vor Haman niederfallen sollten. Dieser hatte ein Götzenbild an seiner Brust befestigt, damit alle dem Götzenbild huldigen sollten. Als Haman sah, dass Mordechai ihm
nicht huldigte, wurde er mit Zorn erfüllt. Mordechai sagte zu ihm: Es gibt einen Herrn, der über allen Erhabenen erhaben ist, wie kann ich ihn erniedrigen und einem Götzenbild huldigen? Weil er den Namen des Heiligen, gepriesen sei Er, „einte“ (jiched), wird er Judäer (Jehudi) genannt um
auszudrücken, dass Judäer „Einsmacher“ (Jechidi) heißt. Und es gibt welche, die sagen, dass er Abraham in seiner Generation aufwog. So wie
Abraham unser Vater sich selbst in den Feuerofen werfen ließ und die Geschöpfe bekehrte und die Größe des Heiligen, gepriesen sei Er, erkennen ließ, wie es heißt: Und die Seelen, die sie in Haran schufen (Gen 12,5), so erkannten auch in den Tagen des Mordechai die Menschen die
Größe des Heiligen, gepriesen sei Er , wie es heißt: Und viele aus der Bevölkerung des Landes wurden Judäer/Juden und „einten“ den Namen
des Heiligen gepriesen sei Er und heiligten ihn. Dementsprechend wird er Judäer genannt, wie geschrieben steht: Ein Mann aus Judäa. Lies nicht:
Jehudi, sonder Jechidi („Einsmacher“).
Dieser Text zeigt den dramatischen Zusammenhang zwischen ethnisch geografischer Zugehörigkeit und einer kulturell-religiösen Definition auf.
Seit den Tagen der Hasmonäer, also dem 2. Jh. v. war es in größerem Stile möglich geworden, sich dem Judentum anzuschließen, ohne selbst
„Judäer“ zu sein. Dies geschah etwa bei der Eingliederung der Idumäer während der Herrschaft des Johannes Hyrkan. Beschneidung und Übernahme der Gebräuche der Judäer machte sie zu einem Mitglied der judäischen Politeia. Was versteht man nun unter Politeia? Der Begriff kennzeichnet sowohl eine Bürgerschaft wie auch eine Lebensweise. Liegt der Schwerpunkt auf der Lebensweise, auf dem „way of life“, wird die Integration fremder Ethnien erleichtert. Wenn wir zum Text des Midrasch zurückkehren, wird unzweifelhaft deutlich, dass hier die rabbinischen Autoren
die Frage, was im Zentrum der judäischen Kultur steht, eindeutig beantworten wollen. Es geht um nichts weniger als die Bereitschaft, den einen
Gott zu bekennen und die anderen Götter als nichtige Götzen zu verwerfen. Mordechai wird damit zum Vorbild judäischer Kultur schlechthin. Sein
Verhalten erinnert an Abraham, der nach jüdischer Tradition bereits als kleines Kind in Haran seinem Vater die Götzen zerschlägt und dafür in einen glühenden Ofen geworfen wird.7 Als erster großer Märtyrer überlebt er dies jedoch unbeschadet. Das Wunder beeindruckt viele, das weitere
Leben und der Einsatz des Abraham lassen eine Reihe von Menschen Abschied vom Götzendienst nehmen. Sie werden in der rabbinischen Dikti7
Etwa schon Jubiläen 12; Apokalypse Abrahams 1-8; Testament Ijob 2-5 etc.
95
Grundkurs Judentum
Das erste und zweite Gebot
on zu Proselyten (gerim). Darunter sind jene Menschen zu verstehen, die das Judentum freiwillig und ohne Hintergedanken annehmen. Wiederum
macht Ester Rabba dazu deutlich, dass es vor allem das 2. Gebot ist, an dem sich die volle Eingliederung in die Schaffung einer gemeinsamen
kulturellen Identität von Proselyten und Judäern auszeichnet.
Die babylonische Version des Midraschtextes in Talmud bMegilla 13a bringt zusätzlich Nuancen ein:
Und warum nennt man ihn „Jehudi“?
Weil er den Götzendienst ableugnete, denn jeder, der den Götzendienst ableugnet, wird „Jehudi“ genannt.
Dies wird neben Mordechai an einem weiteren Beispiel erläutert. Die Tochter des Pharao, die Mose wie ihr eigenes Kind aufzieht, wird „Jehudit“
genannt, weil sie zum Nil hinabstieg, um sich vom Götzendienst zu reinigen.
Es steht außer Zweifel, dass die Ablehnung des Götzendienstes zu den bedeutendsten Wegmarken des Judentums gehört. Nicht nur an dieser
Stelle, auch in bNedarim 25a oder jNedarim 3,4,38a wird die Ablehnung des Götzendienstes mit der Annahme der gesamten Tora gleichgesetzt.
Bedeutsam ist der Midraschtext Sifre Num § 111zu Num 15,22, auf den ich gleich noch weiter eingehen werde.
2. Drei Hauptgebote
Das Judentum hat im Laufe der Geschichte immer wieder die Frage nach einem Kern der Tora gestellt und diese unterschiedlich beantwortet. Da
ist einerseits davon die Rede, dass jedes Gebot gleich zu werten sei, andererseits aber auch deutlich gemacht, dass es innerhalb des Kanons einen Schwerpunkt gibt. Drei Gebote, genauer gesagt Verbote, werden dabei besonders hervorgehoben, das Verbot des Götzendienstes, der sexuellen Verfehlung und des Mordes. Sie formulieren nicht nur jüdische Grundgebote, sondern gelten vielmehr als Pfeiler einer Menschheitsethik
schlechthin:
Aber treibt eure Sinne in eurer Brust an: Flieht vor ungesetzlichem Götzendienst! Dient nur dem lebenden (Gott)! Meide Ehebruch und das rechtlose Bett mit einem Mann! Den eigenen Nachwuchs von Kindern ziehe auf! Und morde nicht! Denn darüber zürnt der Unsterbliche, wer so sündigt
heißt es schon im 3. Buch der Sibylle (762-766), einem Text, der um die Zeitenwende entstanden ist. In der rabbinischen Tradition erhalten sie
besonderes Gewicht. Sie gelten als drei große Unreinheiten (bSchebuot 7b) und man diskutiert, ob diese drei Kapitalverbrechen vom Ritus des
Versöhnungstages gesühnt werden. Für die Rabbinen sind gerade diese drei Sünden mit der Gegenwart Gottes unvereinbar.8 Jeder Mensch wird
ihretwegen zur Rechenschaft gezogen:
Wegen drei Geboten wird ein Noachide hingerichtet: (...)
wegen Unzucht
und wegen Blutvergießens
und wegen Verfluchung des Namens (Gottes)9
heißt es in bSanhedrin 57a. Nur auf die Übertretung dieser drei der sieben noachidischen Gebote steht die Todesstrafe.
a. Die noachidischen Gebote
8
9
96
Deutlich in Sifre Deuteronomium § 254 zu Dtn 23,10.
Rut Rabba Peticha 1 (1a) sieht die Übertretung dieser drei Gebote als Grund für die Anklage Israels und der Völker mit dem Tod.
Grundkurs Judentum
Das erste und zweite Gebot
Die noachidischen Gebote wiederum sind der Kern der Tradition der vorsinaitischen Gebote, die bei den Rabbinen wie beim größten mittelalterlichen Gelehrten des Judentums, Maimonides, ausgefaltet werden. Die zentrale Belegstelle für die rabbinische Fassung der sieben noachidischen
Gebote findet sich im babylonischen Talmud, Traktat bSanhedrin 56a/b (vgl. Tosefta Aboda Zara 8.4):
Auf sieben Gebote sind die Söhne Noachs verpflichtet: (auf das Gebot der) Rechtssprechung und (auf das Verbot der) Verfluchung (wörtl.: Segnung) des Namens, des Götzendienstes und der Unzucht und des Blutvergießens und des Raubes und des (Essens von einem) Stück von einem
Lebewesen.
Maimonides schreibt schließlich:
Auf sechs Dinge wurde der erste Mensch verpflichtet: - auf (das Verbot des) Götzendienst, - auf (das Verbot der) Verfluchung des Namens (Gottes), - auf (das Verbot des) Blutvergießens, - auf (das Verbot der) Unzucht, - auf (das Verbot des) Raubes - und auf (das Gebot der) Errichtung
von Gerichtsstätten. Obwohl alle diese (Gebote und Verbote) in unsere Hand Tradition von Mose, unserem Meister, sind und sich auch der
Verstand zu ihnen hin neigt, ist aus dem Gesamtsinn der Worte der Tora ersichtlich, dass er (Adam) auf sie verpflichtet wurde.
Er (Gott) fügte für Noach (das Verbot des Essens eines Stücks von einem Lebewesen hinzu, wie gesagt ist: (..., Gen 9,4). Es finden sich (so) sieben Gebote.
Und so verhielt sich die Sache in der ganzen Welt bis Abraham. Abraham kam und er wurde auch auf die Beschneidung verpflichtet und er betete
das Morgengebet. Isaak sonderte den Zehnten ab und fügte ein weiteres Gebet hinzu zum Mittag. Jakob fügte (das Verbot des Essens des) Hüftnerves hinzu und betete das Abendgebet. In Ägypten wurde Amram verpflichtet auf weitere Gebote, bis Mose, unser Meister, kam und die Tora
auf seiner Hand vollendet wurde.
(Sefer Schoftim, Hilkhot Melachim 9,1)10
b. Götzendienst in Sonderstellung
Die drei „Kardinalsünden“ sind nun wiederum „Herzstück“ dieses noachidischen Rechts. Dass die Verfluchung des Gottesnamens anstelle des
Verbotes des Götzendienstes in der Reihe der drei Kardinalsünden stehen kann, ist insofern nicht außergewöhnlich, als beide Verbote inhaltlich
verwandt sind und in der rabbinischen Literatur gemeinsam vorkommen.11
Innerhalb der drei Kardinalsünden nimmt das Verbot des Götzendienstes wiederum eine Sonderstellung ein. In bSanhedrin 74a wird unter dem
Namen von R. Jischmael überliefert, dass ein Mensch Götzendienst üben darf, um sein Leben zu retten (mit Lev 18,5). Er bleibt mit dieser Ansicht
in der Minderheit. Gotteslästerung und Götzendienst gehören eng zusammen und werden dennoch rechtlich unterschieden. Nach mancher Ansicht ist nur die Gotteslästerung mit dem Tod zu bestrafen (Levitikus Rabba 22.6 zu Lev 17,3), nach anderer Meinung wird zwischen öffentlicher
und privater Entweihung des Namens unterschieden.
c. Die Verbindung von Unzucht und Götzendienst, Mord und 1. Gebot
10
11
2
Vgl. zu den noachidischen Geboten Klaus Müller, Tora für die Völker. Die noachidischen Gebote und Ansätze zu ihrer Rezeption im Christentum (SKI 15), Berlin 1998;
Matthias Millard, Die Genesis als Eröffnung der Tora. Kompositions- und auslegungsgeschichtliche Annäherungen an das erste Buch Mose (WMANT 90), NeukirchenVluyn 2001.
Vgl. jSanhedrin 7,11, 25b.
97
Grundkurs Judentum
Das erste und zweite Gebot
Bereits eine Reihe biblischer Texte, vor allem die Propheten, haben Unzucht und Götzendienst verbunden. Die Rabbinen nehmen diese Verbindung häufig auf. So werden in der Mekhilta de Rabbi Jischmael Bachodesch VIII (L II 262f.) zu Ex 20,12-14 die Zehn Gebote in zwei Tafeln überliefert, die aufeinander bezogen sind. Fünf Weisungen auf der einen Tafel entsprechen fünf der zweiten. Die Gebote 1 und 2, die beide mit dem
Alleinverehrungsanspruch Gottes zu tun haben, werden mit Mord und Ehebruch parallelisiert. Götzendienst steht in direkter Beziehung zum Verbot des Ehebruchs, in Form eines Gleichnisses aber auch in Beziehung zu Mord:
Auf welche Weise wurden die Zehn Gebote gegeben? Fünf auf einer Tafel und fünf auf der anderen Tafel. Es steht geschrieben: „Ich bin YHWH,
dein Gott“; und gegenüber steht geschrieben: „Du sollst nicht morden“. Die Schrift weist darauf hin, dass es jedem, der Blut vergießt, angerechnet
wird, als hätte er (Gottes) Ebenbild geschmälert. Ein Gleichnis über einen König aus Fleisch und Blut. Er betrat ein Land, und sie stellten ihm
Standbilder auf und machten ihm Bildnisse und prägten ihm Münzen. Nach einiger Zeit stürzten sie seine Standbilder um, zerstörten seine Bildnisse und entwerteten seine Münzen und schmälerten (so) das Ebenbild des Königs. So wird jedem, der Blut vergießt, angerechnet, als hätte er (Gottes) Ebenbild geschmälert, wie es heißt: „Der das Blut eines Menschen vergießt usw. denn im Bild Gottes machte er den Menschen“ (Gen 9,6). Es
steht geschrieben: „Du sollst [keine anderen Götter haben]“; und gegenüber steht geschrieben: „Du sollst nicht ehebrechen“. Die Schrift weist darauf hin, dass es jedem, der Götzendienst begeht, angerechnet wird, als habe er die Ehe gebrochen vom ORT weg, wie es heißt: „Die Frau, die
Ehebruch begeht unter ihrem Gemahl, nimmt Fremde“ (Ez 16,32); und es steht geschrieben: „Und es sprach YHWH zu mir: Liebe eine Frau, die
von einem anderen geliebt wird und die Ehe bricht [so, wie der Herr die Kinder Israels liebt, obwohl sie sich anderen Göttern zuwenden und Opferkuchen aus Rosinen lieben]“ (Hos 3,1).
Die einzelnen Bestimmungen des Dekalogs ergänzen und erläutern sich. Dadurch erklärt sich die Abfassung in zwei Tafeln. Daraus entsteht die
Einteilung in sog. Sakralrecht (V. 2-12) gegenüber Profanrecht (V. 13-17).12 Nach der Auffassung der Mekhilta de Rabbi Jischmael ist beides aufeinander bezogen. Das Gleichnis fungiert als Schlüssel zum Verständnis des Textes und stellt eine untrennbare Verbindung zwischen 1. und 2.
Gebot her. Der König wird durch Bildnisse geehrt. Werden sie vernichtet, geht auch sein Einfluss, seine Macht und sein Prestige verloren, man
vernichtet ihn selbst, weil er sich in den Bildern repräsentiert. Gott aber ist kein König aus Fleisch und Blut. Er will entsprechend dem 2. Gebot keine Bildnisse als Ebenbilder. Der Mensch allein stellt das irdisches Ebenbild Gottes dar. Tötet man einen Menschen, so tötet man Gottes Bildnis.
Ez 16,32 und Hos 3,1 belegen schließlich den metaphorischen Gebrauch des Ehebruchsmotivs. Bei Hosea wird der Bezug zwischen Ehebruch
und Götzendienst im zitierten Vers explizit ausgesprochen. Dieser Text zeigt exemplarisch, dass mit dem Verbot des Götzendienstes letztlich die
gesamte Tora auf dem Spiel steht.
Ziel und Inbegriff des Verbots, andere Götter zu verehren oder sich Bildnisse von Göttern zu machen ist mehr als der Anspruch Gottes auf Alleinverehrung. In diesem Verbot steckt der eigentliche Ursprung des Humanismus. Wenn Gott allein im Menschen ein ihm ebenbürtiges Gegenüber
findet, dann kann letztlich auf Erden nur der gerechte und soziale Umgang mit dem Mitmenschen wahrer Gottesdienst sein. Ihm steht der Dienst
an der toten Materie, am Götzen, gegenüber, welche Form sie auch immer haben mag. Das Bilderverbot des 2. Gebotes bezieht sich zwar unmissverständlich auf Götterbilder, hat in seiner rigorosen Ablehnung jeglicher bildlichen Darstellung aber natürlich Auswirkungen auf die Kunst über die Zeit gehabt. Ich kann diesen Aspekt hier nicht betrachten und auf die vielen Aspekte hinweisen, die sich daraus für eine Kunstgeschichte
des Judentums ergeben. Praxis und Theorie gehen auch mitunter weit auseinander und es finden sich Beispiele für eine reiche Bebilderung - die
12
98
Vgl. hier als Beispiel G. Beer, Exodus (HAT 3), Tübingen 1939, 99-103.
Grundkurs Judentum
Das erste und zweite Gebot
wahrscheinlich auch vor einer zumindest impliziten Gottesdarstellung wie in der Synagoge von Bet Alpha nicht Halt machen13 - und gleichzeitig für
den Respekt vor dem Gebot wie in der berühmten Vogelkopfhaggada aus Deutschland um 1300. Die berühmte amerikanisch-jüdische Autorin
Cynthia Ozick hat in ihren zahlreichen Kurzgeschichten und Erzählungen immer wieder die Verbindung zwischen dem 2. Gebot als Inbegriff des
Humanismus und dem Götzendienst gezogen, der zum Menschenopfer führt, so wie sie nicht müde wird, Paganismus und Judentum als unversöhnliche Gegensätze einander gegenüber zu stellen. Das Judentum repräsentiert die Werte des Humanismus, die im Götzendienst nicht zum
Vorschein kommen können. Menschliches Mitgefühl werde durch die Abkehr von Gott ausgeschlossen. Dabei geht sie etwa in dem Essay „Literature as Idol: Harold Bloom“ im Sammelband Art and Ardor, der 1983 als Reprint des Commentary von 1979 in New York erschien, soweit, zu behaupten, dass selbst die Kunst zum Götzen werden könne, wenn sie u.a. sagt: „Man muss nur das Spiel von Mozart an den Toren von Auschwitz
in Erinnerung rufen, um zu sehen, wie die Musen dem Moloch dienen können“. Ozick ist eine wichtige Zeugin des untrennbaren Zusammenhangs
zwischen jüdischer Identität, Humanität und 2. Gebot, das sich hier unzweifelhaft als Hauptgebot herausstellt.
d. Götzendienst als Hauptgebot
Dies wird besonders im schon erwähnten Midrasch Sifre Num § 111zu Num 15,22 ausgeführt. Die Rabbinen beziehen Num 15,22 („Wenn ihr aus
Versehen irgendeines dieser Gebote, die der Herr zu Mose gesagt hat, nicht haltet...“) auf das besondere Vergehen des Götzendiensts, der als
das Hauptgebot gilt. Ich kann hier nicht auf alle wichtigen Details und Aussagen des Textes eingehen und auch nicht seine exegetische Beweisführung nachzeichnen. Wichtig ist dabei der Begriff dabar/dibber („Wort“, „sprechen“), der an den Dekalog, das Zehn-Wort erinnert. Die Verwendung von „alle jene Worte“ (Pl.) und „sprach“ in Ex 20,1 wird im Vergleich mit Ps 62,12 („eines sprach Gott“) und Jer 23,29 („mein Wort“ Sg.) so
ausgelegt, dass die Mehrzahl der Gebote des Dekalogs sich im einen Gebot des Götzendienstes bündeln. Nach rabbinischer Ansicht sprach er
den Dekalog wie ein Wort, auf einmal (vgl. auch Numeri Rabba 11.7).
Zwei wichtige Teile möchte ich zitieren:
Alle Gebote wollen über dieses eine lehren: Wie der, der alle Gebote übertritt, das Joch (der Tora) abwirft und den Bund übertritt und sich gegen
die Tora auflehnt, so wirft auch der, der dieses eine Gebot übertritt, das Joch (der Tora) ab, übertritt den Bund und lehnt sich gegen die Tora auf.
Und was ist das? Götzendienst, denn es heißt: „Um seinen Bund zu übertreten“ (Dtn 17,2).
Im weiteren Verlauf des Abschnittes wird davon gesprochen, dass ein Götzendiener sich weder an die Tora des Mose noch an die Propheten noch
an die Gebote hält, die bereits den sog. Vätern gegeben wurden. Damit wird an die vorsinaitischen Weisungen angespielt. Es heißt dann:
Die Schrift sagt damit: Jeder, der sich zum Götzendienst bekennt, leugnet die Zehn Gebote ab, das, was Mose geboten hat, das, was den Propheten geboten wurde und das, was den Vätern geboten wurde. Jeder aber, der den Götzendienst ableugnet, bekennt sich zur gesamten Tora.
Der Text macht zweierlei deutlich. Er illustriert zum einen, dass die Tora in all ihren Facetten und Nuancen letztlich nur eine Ausdeutung und
Näherbeschreibung des einen wichtigen Verbots des Götzendienstes ist, und er macht mit seiner Schlussbemerkung klar, dass jemand, der sich
aus ganzer Überzeugung gegen den Götzendienst stellt, im Endeffekt alles diese Facetten und Nuancen zu übernehmen bereit ist. Dies war im
rabbinischen Umfeld in Auseinandersetzung mit jenen zahlenmäßig nicht zu unterschätzenden Menschen wichtig, die sich vom Judentum angezogen fühlten und auch bereit waren, den jüdischen Gott als einzigen anzuerkennen, jedoch weiterhin in ihren eigenen Sitten und Gebräuchen festhielten und keineswegs alle rabbinischen Gebote zu übernehmen gewillt waren. Natürlich können hier auch Juden gemeint sein, die sich von der
13
Vgl. Günter Stemberger, Biblische Darstellungen auf Mosaikfußböden spätantiker Synagogen, JBTh 13 (1998) 145-170.
99
Grundkurs Judentum
Das erste und zweite Gebot
rabbinischen Bewegung und ihrer Gesetzesauslegung nicht zur Gänze einverstanden erklärten oder sich im Alltag nicht daran hielten. Wichtig ist
bis heute natürlich in diesem Zusammenhang die Frage des Dialogs mit anderen monotheistischen Religionen, auf die ich am Ende noch kurz eingehen werde. In jedem Fall gilt Götzendienst als das zentrale Verbot, an dem sich letztlich entscheidet, ob man im rabbinischen Sinne an der Tora
festhält oder nicht, und die Tora bestimmt nun einmal die Identität des Judentums.
Auch der Talmud-Abschnitt bSchabbat 118b redet vom Götzendienst als dem Sinnbild für die Übertretung der Gebote. Hier heißt es:
R. Chija ben Abba sagte: R. Jochanan hat gesagt: Jedem, der den Sabbat gemäß seiner Regel hält, selbst wenn er wie (die Generation von) Enosch Götzendienst treibt: ihm wird verziehen.
Während der Sabbat hier eine gewaltige versöhnende Wirkung bekommt, wird mit Enosch der Götzendienst als Sünde schlechthin in die Urzeit
zurückversetzt. Ausgangsstelle ist Gen 4,26: „Auch dem Set wurde ein Sohn geboren, und er nannte ihn Enosch. Damals begann (hochel) man
den Namen des Herrn anzurufen.“ Dieser außerhalb der rabbinischen Literatur positiv ausgelegte Text wird von den Rabbinen aufgrund des Begriffes hochel, den sie von chalal („entweihen“) ableiten, negativ interpretiert. Schon in der Mekhilta Bachodesch 6 heißt es:
Rabbi Jose sagt: „‘Andere Götter.’ Warum wird dies gesagt? Um den Völkern der Welt keinen Entschuldigungsgrund zu geben zu sagen: ‘Wenn
sie (d.h. die Götter) mit seinem (d.h. Gottes) Namen gerufen worden wären, hätten sie längst Bedeutung gehabt, sieh, sie wurden mit seinem Namen genannt, und sie haben (trotzdem) keine Bedeutung gehabt. Seit wann wurden sie (d.h. die anderen Götter) mit seinem Namen gerufen? Seit
den Tagen Enoschs, des Sohnes Sets, wie es heißt: ‘Damals begann man, den Namen JHWHs anzurufen’ (Gen 4,26b). In derselben Stunde
stieg der Ozean empor und überflutete ein Drittel der Welt. GOTT (wörtlich: DER ORT) sagte zu ihnen: ‘Ihr habt etwas Neues gemacht und euch
selbst Gottheiten genannt. Auch ich werde etwas Neues machen und mich selbst JHWH nennen.’ Und deshalb sagt er: ‘Der die Wasser des Meeres ruft und sie auf dem Antlitz der Erde ausgießt - JHWH ist sein Name’“ (Am 5,8).
Diese Auslegung ist eine von sieben des Götzenverbotes in der Interpretation des Dekaloges in der Mekhilta Rabbi Jischmael. Sie setzt voraus,
dass schon in der Enoschgeneration die Götter anstelle des wahren Gottes angerufen werden und Gott deshalb zu seiner unterscheidenden Bezeichnung seinen Namen wählt. Am 5,8 illustriert einen Aspekt, der für sie über das Motiv der Flutgeschichte mit Gen 4,26 als Text vor der Fluterzählung der Genesis verbunden ist. Targum Pseudo Jonathan und Targum Onkelos zu Gen 4,26 machen ebenfalls deutlich, dass bereits die Generation des Enosch Götzenbilder anfertigte, mit dem Gottesnamen benannte und den wahren Gottesdienst damit durch Götzendienst ersetzte.
Mit Gen 4,26 beginnt kein rechter Gottesdienst. Nach dem vorgehenden Mord an Abel (Gen 4,8) und dem folgenden sexuellen Vergehen (Gen
6,2) wird der Götzendienst so zum dritten Element der Ursünde, die die Sintflut nach sich zieht. In der rabbinischen Tradition wird also bereits die
Generation der Enkel Adams an den drei Kardinalsünden gemessen.
3. Das Judentum deutet die Geschichte als Konflikt zwischen Götzendienst und Gottesdienst
Die rabbinische Tradition hat die Geschichte als dramatischen Konflikt zwischen Götzendienst/Götzendienern und wahren Gottesglauben/Gottesgläubigen dargestellt. Nach bSanhedrin 38b habe selbst Adam bereits Gott geleugnet. Enosch wurde schon genannt, dessen Generation durch ihren Götzendienst die Sintflut mitbewirkt. Die Männer des Turmbaus von Babel haben Götzendienst getrieben (bSanhedrin 109a). Von
Abrahams beherztem Kampf war ebenfalls schon die Rede, ihm stehen vor allem die Leute aus Sodom gegenüber, die (nach Genesis Rabba 40/
41.7 zu Gen 13,13; bSanhedrin 109a) Götzendiener, Mörder und ausschweifend in ihrer Sexualität sind. Ismael, Abrahams Sohn, übertritt alle drei
Gebote (Genesis Rabba 53.7 zu Gen 21,3), ebenso sein Enkel Esau, der in der rabbinischen Tradition zum Sinnbild Roms wird (u.a. Genesis
100
Grundkurs Judentum
Das erste und zweite Gebot
Rabba 63.12 zu Gen 25,29f.). bBaba Batra 16b (Parallele Tanchuma Schemot 1 und Pesiqta Rabbati 12) lastet Esau am Todestag seines Vaters
fünf Übertretung an:
Rabbi Jochanan sagte: Fünf Übertretungen, er (Esau) übertrat sie am selben Tag (am Todestag seines Vaters): - Er ging zu einer verlobten
Jungfrau (d.h.: er vergewaltigte sie), - und er tötete jemanden, - und er verleugnete den Grund (d.h. Gott), - und er verleugnete die Auferstehung
der Toten, - und er verachtete die Erstgeburt.
Nach Pesiqta Rabbati 12.7 (176) bedingt die Heirat mit einer Götzendienerin Esaus Götzendienst, womit das Element der (verbotenen) Mischehe
auftritt, das in der biblischen und rabbinischen Tradition zum Standardrepertoire gehört.
Für die Israeliten wird der Götzendienst in Ägypten vor allem durch den Pharao repräsentiert, der sich selbst zu Gott macht.
Demgegenüber stellt die Gabe der Tora am Sinai das größte Geschenk dar, das der eine Gott einem Volk geben kann. Die rabbinische Tradition
macht deutlich, dass alle Völker am Sinai das Angebot bekommen hätten, die Tora anzunehmen, dass sie aber mit Ausnahme Israels ablehnen.
In der jüdischen Tradition hat sich nie eine Theorie einer Erbsünde entwickelt, dennoch haben einzelne Texte von einer bleibenden Konsequenz
des Fehlverhaltens des Urpaares gesprochen. Besonders zu nennen sind bSchabbat 146a und bJebamot 103b, wo davon gesprochen wird, dass
die Schlange Eva Lust injizierte, die Israel durch die Annahme des Dekalogs am Sinai verlor, während die Weltvölker – hier als Götzendiener bezeichnet - sie nicht verloren. Der Sinai hält mit den 10 Geboten das Heilmittel für den bösen Trieb bereit. Israel sprach dort, es wolle „tun und hören“ und wurde daraufhin von Gott mit Geschenken überschüttet. Massenweise Dienstengel verwöhnten die Israeliten, wie es beispielhaft in TanchumaB Tetsawwe 7 (50ab) heißt:
„Und das ist die Sache, die du ihnen tun sollst [um sie zu weihen]“ (Ex 29,1). Das ist, was die Schrift sagt: „Die Weisen werden die Ehre erben“
(Spr 3,35) - das ist Israel. „Und die Toren tragen Schande davon“ (ebd.) - das sind die Weltvölker. Und wann erbten die Israeliten die Ehre? Als sie
die Tora am Sinai empfingen. Es sprach R. Johanan: 600.000 Dienstengel stiegen mit dem Heiligen, gepriesen sei Er, herab zum Sinai, und sie
setzten Kronen auf das Haupt eines jeden einzelnen aus Israel. Es sprach R. Abba b. Kahana: Als Israel am Berg Sinai stand und sie sprachen:
„Wir wollen tun und hören“ (Ex 24,7), verliebte der Heilige, gepriesen sei Er, sich sofort in sie. Und Er gab einem jeden einzelnen von ihnen zwei
Engel, und der eine gürtete sie mit Waffen, und der andere setzte ihm eine Krone auf sein Haupt. Es sprach R. Simeon: Mit Purpur bekleidete Er
sie, wie es heißt: „Und Ich kleidete dich bunt“ (Ez 16,10). R. Simeon b. Johai sagt: Waffengerät gab Er ihnen, und der Gottesname war darauf eingraviert. Das ist: „Die Weisen werden die Ehre erben“ (Spr 3,35) - das ist Israel, welches die Tora empfing. „Und die Toren tragen Schande davon“
(ebd.) - das sind die Weltvölker; der Heilige, gepriesen sei er, machte sie zur Schande.
Israel verliert jedoch schnell alle seine Vorzüge durch eine schicksalhafte Entscheidung, nämlich das Goldene Kalb herzustellen. Wenn überhaupt
von einer Art Ursünde im Judentum geredet werden kann, so ist es dieser in Ex 32 überlieferte Götzendienst mit dem Goldenen Kalb. jTaanit
4,8,68b formuliert es so:
Rabbi Judan im Namen von R. Jassa: Es gibt überhaupt keine Generation, in der es nicht eine Unze von der Sünde des Kalbes gibt.
Schlag auf Schlag wird jetzt das Volk seine Privilegien verlustig und kann nur durch den intensiven Einsatz des Mose bei Gott vor dem Tod bewahrt werden. Götzendienst überschattet also nicht nur das Schicksal der Nichtjuden, es ist auch die beständige Bedrohung der Existenz Israels.
Götzendienst bewirkt konsequenterweise das Verderben.
Weil Israel keinen natürlichen Anspruch auf das Land hat, das im übrigen nur deshalb von Israel erobert werden konnte, weil die Völker dort Götzendienst trieben (Dtn 8 u.ö.), führt die Abkehr vom einen Gott auch konsequenterweise in das Exil.
101
Grundkurs Judentum
Das erste und zweite Gebot
Die Konsequenz des Götzendienstes ist so weitreichend, dass nach rabbinischer Ansicht selbst der Erzkontrahent des antiken Judentums, Rom,
nicht existieren würde, wenn Israel nicht vom Glauben an den einen Gott abgewichen wäre. So heißt es in bSchabbat 56b über die Ehe Salomos
mit der ägyptischen Prinzessin, die ihn zum Götzendienst verführte:
Rab Juda sagte im Namen des Samuel: Als Salomo die Tochter des Pharao heiratete, stieg Gabriel herab und pflanzte ein Schilfrohr in das Meer,
und es wuchs darauf eine Sandbank, auf der die große Stadt Rom gebaut wurde. In einer Baraita wurde gelehrt: Am Tag, als Jerobeam die beiden
goldenen Kälber brachte, das eine nach Betel, das andere nach Dan, wurde eine Hütte errichtet und sie entwickelte sich zum griechischen Italien.
Die negativen Eckpfeiler der Geschichte sind Folge des Götzendienstes, so die Zerstörung des Heiligtums, die Auslieferung an den König Nebukadnezzar, einem König, der sich wie schon Pharao zum Gott erklärte (Jes 14,14). Aber auch er kann zurecht die Israeliten anklagen, wie es etwa
in Levitikus Rabba 33.6 heißt:
R. Johanan sagte etwas anderes: Er (Nebukadnezzar) sagte ihnen: Als ihr in eurem Land wart, schicktet ihr zu uns und kauftet Klauen, Haare und
Knochen von Götzendienst, ihr habt darauf eingeritzt, um zu bestätigen, was geschrieben steht: „Bildnisse der Chaldäer, eingeritzt mit roter Paste“
(Ez 23,14). Und da seid ihr gekommen, meinen Götzendienst zu zerstören!
R. Jehuda b. R. Simeon sagte zweifaches: Er (Nebukadnezzar) sagte ihnen: Als ihr in euerem Land weiltet, habt ihr verschiedene Abteilungen für
die Götzen geschaffen, wie es heißt: „Und du hast deine Beine gespreizt für jeden, der vorüberging“ (Ez 16,25). Und da seid ihr gekommen, meinen Götzendienst zu zerstören!
In dieser Begegnung mit Nebukadnezzar spielen die drei Jünglinge Hananja, Mischael und Asarja eine Rolle, die der des Abraham nahe kommt.
Sie bekennen den einen Gott und werden dafür von Nebukadnezzar in den glühenden Ofen geworfen, aus dem sie unbeschadet wieder heraussteigen. Sie lassen Gott erneut seines Bundes gedenken, sie rufen sein Erbarmen hervor. Mit der Gestalt der drei Jünglinge zieht die MidraschLiteratur die historisch-theologische Linie von Abraham bis zum Exil weiter aus. Dies zeigt sich beispielhaft in Sifre Deuteronomium § 306, wo von
drei großen Perioden der Geschichte erzählt wird, in denen Gott seinen Namen verherrlichte, nämlich 1) in Ägypten, 2) am Schilfmeer, Jordan und
Arnon und 3) an Daniel und den drei Jünglingen. Ihre deutliche Parallelisierung mit Abraham (und umgekehrt: Stichwort „Feuerofen“) lässt die Geschichte mit Gott neu anfangen.
Weitere berühmte Götzendiener sind der aus dem Esterbuch bekannte Haman und dann natürlich der Frevler Titus, der den Tempel in Schutt und
Asche legen ließ. Im Laufe der Zeit sind weitere Gestalten hinzugekommen.
Die Zukunft wird aus der Vergangenheit und aus dem Heute schöpfen. Sie wird mitgestaltet durch das Verhalten der Israeliten und ist zugleich
gnädige Zuwendung Gottes. Jerusalem wird in neuem Glanz erstrahlen und die Völker bei sich beherbergen. Israel wird sein Verhalten überdenken und in neuer Unmittelbarkeit mit Gott leben. Am Ende der Zeit werden auch die Völker freiwillig ihre Götter aufgeben. Wie bei Abraham oder
am Schilfmeer, als die Ägypter sich reihenweise von ihren Göttern abwandten, da sie die Größe Gottes sahen (vgl. Mekhilta Beschallach 8 zu Ex
15,11), werden sie versuchen, ihren Götzendienst abzulegen. Den götzendienerischen Völkern aber bleibt das Gericht nicht aus (vgl. beispielhaft
den MTeh zu den Psalmen 97-99). Sie werden erkennen, dass Gott sich in Israel verliebt hat, weil es seinen Willen tut. Sie werden sich daher bemühen, selber die Tora für sich in Anspruch zu nehmen. Nach Tanchuma Schoftim 9 bzw. TanchumaB Schoftim 8.10 (16ab) werden die Götzendiener auf der Welt beschämt werden. Gott wird seine Heiligkeit öffentlich zeigen. Er wird seinen Thron an die Stelle des Sonnenaufganges setzt
und lässt dann alle die Herrlichkeit schauen. Er ist Sonne und Schild, der vor dem Gericht rettet, wo Gott die Gesetzestafeln befragen wird, ob die
Völker sich um sie gekümmert haben. Sie werden antworten, dass nur Israel sich um die Gesetze angenommen hat, während die Völker sich gegenseitig Ehre erwiesen und dabei Götzendienst betrieben (Ps 97,7). Dann werden sie beschämt sein, ihre (als Götzen dienenden) Tauben sind
geschlachtet, ihre Steine zerbrochen und ihre Fische auf dem Markt verkauft. Die Völker treten nun einzeln vor Gott und verteidigen ihre Werke als
102
Grundkurs Judentum
Das erste und zweite Gebot
Dienst an Israel. Doch Gott entlarvt sie als eigennützig. Nun drängen sie sich auf, die Tora erfüllen zu wollen. Sie stellen eine Laubhütte auf, verlassen sie jedoch sofort wieder, als die Sonne auf sie scheint und es ihnen zu heiß wird. Sie verwerfen ihre Bereitschaft, mit Israel die Tora anzunehmen, worauf Gott sie auslacht (Ps 2,3.4). Dann richtet Gott die Götzen gemeinsam mit den Völkern (Jes 66,16). Die Götzen werden von den
Völkern aufgefordert, sich vor Gott zu beugen (Psalm 97,7), doch er schickt sie wie die Völker ins Feuer. Die zwei Teile des Landes, von denen
Sach 13,8 gesprochen hat, sind die Völker. Der dritte Teil ist das gerettete Israel, das aus den drei Grundlagen der Welt, aus den Erzvätern,
kommt.
Die Höllenstrafe scheint unausweichlich. Besonders tragisch erlebt sie Nebukadnezzar in MTeh 5:
„Jerusalem, preise den Herrn, lobsinge, Zion, deinem Gott!“ (Ps 147,12) und abschließend: „Halleluja!“ (Ps 147,20). Der Frevler (Nebukadnezzar)
sagte: „Ich, Nebukadnezzar, lobe, preise und rühme nun den König des Himmels“ (Dan 4,34). David sagte: „Denn der Herr ist gerecht, er liebt gerechte Taten“ (Ps 11,7). Der Frevler (Nebukadnezzar) aber sagte: „Denn alle seine Taten sind Wahrheit“ (Dan 4,34). Und Hanna sagte: „Der Herr
macht tot und lebendig, er führt zum Totenreich hinab und führt auch herauf. Der Herr macht arm und macht reich, er erniedrigt, und er erhöht“ (1
Sam 2,6f.). Der Frevler (Nebukadnezzar) aber sagte: „Die Menschen, die in stolzer Höhe dahinschreiten, kann er erniedrigen“ (Dan 4,34).
So sagte der Heilige, gepriesen sei er, zu Nebukadnezzar: Gestern erst sagtest du (zu Chananja, Mischael und Asarja): „Welcher Gott kann euch
dann aus meiner Gewalt erretten?“ (Dan 3,15), jetzt aber bringst du Worte des Lobpreises und der Verehrung. Ich möchte keinen Anteil an dir
noch an deinem Lobpreis. Wer ist allein würdig, mich zu preisen? Israel, wie es heißt: „Das Volk, das ich mir erschaffen habe, wird meinen Ruhm
verkünden“ (Jes 43,21).
Der Lobpreis nützt Nebukadnezzar nichts. Er wird ihm auch nicht als späte Reue oder Einsicht angerechnet. Sein Verhalten disqualifiziert ihn, sein
Werk entlarvt ihn. Diese Passage ist auch eine Mahnung an Christen im Umgang mit dem Gott, den sie durch das Judentum kennen gelernt haben
und im Umgang mit oft zu laut geäußertem Philosemitismus. Denn einst wird danach gefragt werden, welches Verhalten man an den Tag gelegt
hat. In bAboda Zara 10b beispielsweise diskutiert der Vertreter der feindlichen Besatzungsmacht, der römische Kaiser Antoninus mit Jehuda haNasi, der üblicherweise einfach Rabbi genannt wird. Antoninus fragt den Rabbi: „Werde ich die kommende Welt betreten? Ja, antwortet dieser.
Aber, meint der im übrigen natürlich bibelfeste Antoninus, es heißt doch beim Propheten Obadja (1,18): „Und vom Haus Esau wird keiner entkommen“. Das, antwortet Rabbi, bezieht sich nur auf jene, deren üble Taten denen Esaus gleichen. Aber weiter hat man gelernt: „Und vom Haus Esau
wird keiner entkommen“ – daher könnte man meinen, keiner! Darum sagt die Schrift (dagegen): „vom Haus Esau“, um es nur auf die anzuwenden,
die so handeln wie Esau. Aber, sagte Antoninus, es steht geschrieben: „Dort (in der Hölle) liegt Edom, mit seinen Königen und all seinen Fürsten“
(Ez 32,29). Hier, so meint Rabbi, (heißt es) „seinen Königen“, es heißt nicht „all seinen Königen“, „all seine Fürsten“, aber nicht „all seine Oberen“.“
Es gilt also der Grundsatz: Nur wer das Werk Esaus unterstützt - und damit sind Götzendienst, Ausschweifung und Mord in den verschiedensten
Facetten als Werk der römischen Regierung gemeint -, wird keinen Anteil an der kommenden Welt haben. Das bringt mich zum letzten Punkt.
4. Die Völker und Israel
Ohne im Detail hier die Zeit zu haben, die nuancierte Einstellung des Judentums gegenüber den Nichtjuden aufzuzeigen, will ich doch im Zusammenhang mit dem 2. Gebot deutlich machen, dass ein doppelter Prozess der Selbstbestimmung abläuft. Zum einen werden die Nichtjuden, wie wir
bereits sehen konnten, als Götzendiener typisiert. Oft ist in der rabbinischen Literatur nicht von Völkern, sondern von „Sternendienern“ oder „Götzendienern“ die Rede. Götzendienst ist der wohl häufigste Vorwurf an die Nichtjuden. Daher steht nach rabbinischer Ansicht die Unterstützung von
Nichtjuden immer unter dem Verdacht, ihnen beim Götzendienst zu helfen. Dadurch sind auch viele Gegenstände von Nichtjuden nicht zum Er103
Grundkurs Judentum
Das erste und zweite Gebot
werb erlaubt und der Handel eingeschränkt. Man darf keine Tiere verkaufen, keine Häuser vermieten usw., weil sie für Götzendienst genützt werden könnten. Nichtjüdischer Wein ist verdächtig, weil er für eine Libation verwendet werden könnte (mAboda Zara 4). Auch die Teilnahme an Veranstaltungen von Nichtjuden (Hochzeiten, Bankette, Theater oder Zirkus) gilt wegen der Gefahr des Götzendienstes als verboten. Besonderen
Stellenwert erhält natürlich die Mischehe, vor der bereits in der Bibel ausgiebig gewarnt wurde und die man in nachexilischer Zeit gänzlich ablehnt.
Zwei Wege gibt es nach jüdischer Ansicht, dem Verdikt des Götzendienstes zu entkommen. Sie bestehen in der Annahme der sieben noachidischen Geboten und in der Konversion als Proselyt, hebräisch ger. Sifra Behar 8 (110a) belegt bereits die Unterscheidung zwischen dem ger tsedeq und dem ger toschav, der weiterhin nicht koscheres Fleisch isst. Klaus Müller arbeitet die Unterscheidung heraus und meint: „Der ger toschav
ist der Beisasse aus den außerjüdischen Völkern, der die sieben noachidischen Gebote für sich als verbindlich anerkannt hat“.14 Maimonides kann
schließlich zum ger toschav formulieren: „Ohne Beschneidung und Tauchbad ist er zu akzeptieren und gilt als ein Frommer der Weltvölker“.15 Die
noachidischen Gebote sind dabei nicht einklagbares und kontrolliertes Recht, sondern „Ausdruck des theologisch-ethischen Horizonts, in dem sich
die geistig-religiöse Nachbarschaft zum außerjüdischen Mitmenschen vollziehen kann“.16 Der ger tsedeq ist schließlich der Proselyt, der die jüdischen Gebote zur Gänze zu übernehmen bereit ist.
In der bekannten Diskussion in tSanhedrin 13.2 und bSanhedrin 105a wird klar, dass jene Nichtjuden, die Gott nicht vergessen, Anteil an der
kommenden Welt haben.
Diese Option steht allen Menschen ohne Unterschied offen. Sie steht aber als warnendes Vorzeichen auch immer vor Israel. Denn Israel wird seine Existenz und seine Identität nur bewahren, wenn es an Gott festhält. In den Versuchen der Rabbinen, eine Definition zu finden, wer in den Bereich „Israel“ gehört und wer nicht, spielt die Kategorie des Götzendienstes eine herausragende Rolle. An Anerkennung oder Ablehnung Gottes
entscheidet sich, ob man zu Israel oder zu den götzendienerischen Völkern gezählt wird. Immer wieder spürt man die Gefahr des Götzendienstes
als Angst vor dem Verlust der jüdischen Identität. So ist davon die Rede, dass Konvertiten noch der "Geruch" von Götzendienst anhafte (bQidduschin 75a; bSanhedrin 94a). Die sog. Minim, also die Häretiker, die man oft als Christen identifizieren wollte, aber breiter und umfassender einfach
jüdische Menschen bezeichnen, die sich vom Judentum – rabbinischer Kategorie – abzulösen beginnen, gelten als Götzendiener. Von ihnen heißt
es, sie lehnten die kommende Welt und die Auferstehung der Toten ab (tChullin 1.1; mBerakhot 9.5; bSanhedrin 90b u.ö.). Sie schmoren wie auch
die Apostaten in der Gehenna (tSanhedrin 13.4-5), wo nach Exodus Rabba 19.4 ihre Beschneidung rückgängig gemacht wird. Wegen ihres Abfalls
von Gott gelten sie als in mancher Hinsicht schlechter als Nichtjuden (tSchabbat 13.5; tChullin 1.1 u.ö.).
Diese kurzen Bemerkungen genügen, um zu zeigen, dass das Verbot des Götzendienstes im traditionellen Judentum die entscheidendste und
wichtigste Kategorie der Zuordnung oder Ausgrenzung darstellt. Dieser Umstand hat wichtige Auswirkungen auf die Begegnung mit Christentum
und Islam. Während in der Geschichte der Islam im jüdischen Bewusstsein als monotheistisch galt und daher eine relativ hohe Wertschätzung erzielte, wurde das Christentum häufig wegen der Trinität aber auch wegen der Verehrung von Heiligen als götzendienerisch abgelehnt. Aber auch
hier gab es bemerkenswerte Ausnahmen wie etwa Maimonides, der dem Christentum eine positive Funktion in der Vermittlung des Gottesglaubens zubilligte. Heute ist der Dialogprozess mit den zwei monotheistischen Religionen recht weit gediehen und vielerorts kommt es zu ehrlichen
und offenen Begegnungen auch zwischen traditionellen Juden und Christen sowie Moslems. Eine befriedigende und umfassende Annäherung
14
15
16
104
Müller, Tora 75.
Maimonides, Hilkhot issure bi´a 14,7.
Müller, Tora 79.
Grundkurs Judentum
Das erste und zweite Gebot
zwischen Christen und orthodoxen Juden lässt aber noch auf sich warten. Diese wird nicht zuletzt auch davon abhängen, wie sehr Christen in der
Praxis zeigen, dass sie das „Werk Esaus“ nicht tun.
105
Grundkurs Judentum
Menschenrechte
Gerhard Langer
Menschenrechte und Menschenwürde in der rabbinischen Literatur, in: Jahrbuch für Biblische Theologie 15 (2000),
67-92.
Wer die 30 Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (UNO) von 1948 aufmerksam liest, wird immer wieder aufs Neue überrascht
sein, wie einleuchtend sie uns zum einen erscheinen und wie sehr wir dennoch feststellen müssen, dass manche davon selbst in zivilisierten
Ländern nicht umgesetzt werden. So heißt es etwa im Artikel 23: „(1) Jeder Mensch hat das Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl, auf angemessene und befriedigende Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz gegen Arbeitslosigkeit. (2) Alle Menschen haben ohne jede unterschiedliche Behandlung das Recht auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit. (3) Jeder Mensch, der arbeitet, hat das Recht auf angemessene und befriedigende Entlohnung, die ihm und seiner Familie eine der menschlichen Würde entsprechende Existenz sichert und die, wenn nötig, durch andere soziale
Schutzmaßnahmen zu ergänzen ist.“ Ganz zu schweigen von den zahlreichen Verletzungen fast aller Artikel in der großen Mehrzahl der Staaten,
was uns direkt vor unseren Augen auf dem Balkan erst jüngst wieder auf erschreckende Weise nahegebracht wurde.
Sucht man als Bibliker nach Grundlagen für die Menschenrechte, so ist unschwer zu den verschiedenen Artikeln ein biblischer Ansatz zu finden,
der den Weg in deren Richtung weist. Die jüdische Tradition hat die Ansätze weiterentwickelt. Eine detaillierte Betrachtung der Entwicklung der
Menschenrechte auf der Basis der Menschenrechtsdeklaration wäre lohnend, ist jedoch hier in diesem beschränkten Rahmen nicht zu leisten und
zum Teil bereits geleistet worden. Ich verweise dazu auf das wichtige Buch von Haim Cohn, Human Rights in Jewish Law.1
Diese Arbeit vorausgesetzt, will ich hier einen biblischen Teilbereich herausgreifen, der in der theologischen Betrachtung immer wieder eine wichtige Rolle spielt, nämlich das Urteil der Psalmen über den Menschen. Verschiedene Psalmtexte sagen Grundsätzliches über den Menschen, seine
Verfasstheit, Stellenwert und Würde aus. Von solchen Texten ausgehend, möchte ich einen Blick in die rabbinische Rezeption werfen und in diesem Umfeld nach verwandten und weiterführenden Aussagen fragen, ohne alle Bereiche auch nur annähernd abdecken zu können.
I. Der Mensch neben Gott und vor den Engeln
1. »Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst, des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst?« (Ps 8,5)
Wer hat sich noch nie diese Frage gestellt? Wir stellen sie einerseits angesichts von Massenvernichtung oder Brutalitätsorgien des Menschen ebenso wie andererseits im Blick auf seine mehr und deutlicher erfahrene Winzigkeit im Kosmos. Der Psalm stellt die Frage in seinem Zeitkolorit im
Wissen um Gottes gewaltige Schöpfermacht. Welche Rolle sollte in ihr der Mensch spielen? Warum denkt Gott an ihn, warum hat er ihn selbst fast
wie einen Gott geschaffen?
Den Rabbinen war der Vers vor allem die erste Betrachtung wert. Was ist der Mensch, der doch voller Vergehen und Verbrechen ist? Nach Ansicht der frühjüdischen Gelehrten sind es daher auch die kritischen Dienstengel, welche den Ps 8,5 bei der Schöpfung (Gen 1,26) als Anfrage an
Gott stellen. Sie sind es, die Gottes Entscheidung, den Menschen zu schaffen, mit äußerster Skepsis begegnen. Ihnen muss Gott den Menschen
geradezu „verkaufen“. So argumentiert Gott in NumR 19.3//KohR 7.33 zu 7,23; Tan Chuqqat 6//TanB Chuqqat 12 (55b); PRK 4.3; PesR 14.9 mit
1
106
New York 1984. Vgl. auch das Heft 2 des Bandes 26 der Zeitschrift Concilium (1990), das sich dem „Ethos der Weltreligionen und Menschenrechte“ widmet.
Grundkurs Judentum
Menschenrechte
der Weisheit des Menschen. Diese Weisheit übersteigt die der Engel. Als Beweis dient die Benennung der Tiere durch den Menschen. Die Engel
kennen die Namen der Tiere nicht, der Mensch vermag sie zu benennen. Stier, Löwe, Pfau, Pferd, Kamel und Adler erhalten vom Menschen die
richtigen Namen. Der Mensch benennt sich selbst ADAM, weil er von der Ackererde abstammt und auch Gott wird vom Menschen mit seinem richtigen Namen, nämlich JHWH, versehen (Zitat Jes 42,8: »Ich bin JHWH, das ist mein Name«). Die Texte zeigen gerade aufgrund der Benennung
Gottes überzeugend, dass die Namengebung durch den Menschen, wie sie in Gen 2,19f. erfolgt, keine Herrschaftsposition (etwa des Menschen
über die Tiere) ausdrückt, sondern die Weisheit des Menschen beschreibt, die richtigen Namen zuweisen zu können.2 Der Mensch, so läßt sich
aus dieser Tradition ableiten, ist also weise, und zwar weiser als die Engel. Der Kontext könnte darauf schließen lassen, dass die Engel die
Gleichwertigkeit des Menschen nicht anerkennen wollen.3 Immer wieder begegnen in der rabbinischen Literatur Beispiele, wie sehr die Engel den
Menschen in seiner Position abzuwerten versuchen. Eifersucht, Neid und Mißgunst finden sich hier gepaart mit der keineswegs falschen Erkenntnis der Sündhaftigkeit und Labilität des Menschen. Die genannte Tradition besagt noch nichts über das Verhalten des Menschen, sie zeigt nur,
dass er das bevorzugte Geschöpf Gottes ist, das seine Schöpfung zu erkennen - weil zu benennen - in der Lage ist.
Anders ist dies in der folgenden Tradition. In Tan Bechuqqotai 4//TanB Bechuqqotai 6 (56b), PesR 25.3 offenbart Gott seinen Wunsch, die Tora
durch den Menschen aufrichten zu lassen. Die Tora, das ist der innerste Bauplan der Welt, das Zentrum der Schöpfung, der Kraftstoff, der die
Maschine Welt in Gang hält. Fehlt die Tora, versinkt die Welt wieder in Tohu und Bohu. Der Mensch nun ist es, der diese Tora aufrecht erhält, die
Engel sind dazu nicht imstande. Sie haben gar nicht die Voraussetzung für die Tora. Sie essen nicht (Speisegebote), sie gebären nicht (Regeln
über die Geburt), sie sterben nicht usw. (Regeln über den Umgang mit Toten), weshalb sie eine ganze Reihe von Torarichtlinien überhaupt nicht
einhalten können. Nur der Mensch bereitet Gott ein Brandopfer, einen Tisch am Sabbat und bringt sich selbst im Gelübde dar.
In bSchabbat 88b (vgl. PesR 20.4 und ARN 2) erwächst dem Menschen aus der Annahme der Tora geradezu eine lebensbedrohende Gefahr
durch die Engel. „Diesen geheimen Schatz, der von dir 974 Generationen vor der Weltschöpfung verborgen wurde, möchtest du Fleisch und Blut
anvertrauen? »Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst, des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst?« (Ps 8,5) »Herr, unser Herrscher,
/ wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde; über den Himmel breitest du deine Hoheit aus« (Ps 8,2).” Gott muss Mose schließlich vor den
Engeln beschützen.
Noch eine andere Wendung erfährt die Darlegung, wenn die Engel von Gott aufgrund historischer Erfahrung überzeugt werden. Dies hebt vor allem auf das positive Beispiel der Väter ab. In Tan Wa-jera 18 zeigt Gott die Ehre Abrahams, Sara und die Opferung des Isaak. Abraham, Sara und
Isaak werden so zu vorbildlichen Menschen, zu Menschen-Bildern, die zeigen, wie Gott sich den Menschen vorstellt, dessen er gedenken will.
Nach TanB Wa-jera 4 (43a) lädt Gott die Engel zu einem Besuch des frischbeschnittenen Abraham ein und sagt als Antwort auf die Frage der
Engel, was denn der Mensch sei, dass er sich - angesichts von Blut und Gestank - seiner annehme, dass ihm der Geruch des Haufens voller
Vorhäute nach der Beschneidung Abrahams und seiner Sippe lieber als Myrrhe und Weihrauch sei.
Nach tSota 6,5 überzeugt das Schilfmeerlied als Ausdruck der Anerkennung Gottes die Engel vom positiven Effekt der Menschenschöpfung, nach
Meinung des R. Simeon b. Eleazar ist es allerdings wieder die Opferung Isaaks.
In GenR 8.6 lassen sich die Engel von Gott schon dadurch bereits zu einem Lobpreis hinreißen, dass er ihnen erklärt, dass die Schaffung von
Fischen und Landtieren nutzlos gewesen wäre ohne den Menschen, der sie essen soll.
2
3
Vgl. dazu den Artikel von G. Büsing, Adam und die Tiere - Beobachtungen zum Verständnis der erzählten Namengebung in Gen 2,19f., in: G. Langer/M. Millard (Hgg.),
Bibel und Midrasch. Zur Bedeutung der rabbinischen Exegese für die Bibelwissenschaft (FAT 22), Tübingen 1998, 191-208.
Vgl. die Auslegung bei P. Schäfer, Rivalität zwischen Engeln und Menschen. Untersuchungen zur rabbinischen Engelvorstellung (StJud 8), Berlin-New York 1975, 89.
107
Grundkurs Judentum
Menschenrechte
Wesentlich gewalttätiger als in diesem eher pragmatischen Beispiel löst Gott das Problem nach bSanhedrin 38b (und PesR 20.4). Demnach
tötet/verbrennt er gleich zwei Klassen von Engel, die sich gegen die Menschenschöpfung auflehnen, sodass die dritte resigniert hinnimmt, was
Gott tut. Als bei der Sintflut die Schlechtigkeit des Menschen offenbar wird, erinnen die Engel Gott daran, dass die vernichteten Engelklassen doch
nicht Unrecht gehabt hätten. Doch Gott hält auch in dieser schwierigen Belastung (mit Zitat Jes 46,4) zu den Menschen (vgl. SER 31). In GenR
31.12 stimmt Gott an dieser Stelle den Engeln in ihrer Skepsis zu, schließt zugleich aber einen Bund mit den Menschen in der Arche, damit diese
überleben können.
Die Menschenschöpfung war also mit ziemlichen Schwierigkeiten verbunden. Gott musste sein ganzes Gewicht einsetzen, um dem Widerspruch
der Engel gegen diese Entscheidung etwas entgegenzusetzen. Über die Menschenwürde erfahren wir aus dieser Psalmenrezeption vor allem,
dass der Mensch von Anfang an den Schutz und das Wohlwollens Gottes braucht und dass er dazu ausersehen ist, die Tora auf Erden zu erfüllen.
Von Anfang an steht also der Mensch im Fokus der Tora, der ethischen Weisung. Aufgrund seiner ihm inhärenten Weisheit kann der Mensch sie
auch befolgen. Wahres Menschsein wird von den Erzeltern Israels exemplarisch aufgezeigt.
Der Einsatz der Engel gegen den Menschen zeigt die Problematik der Menschenschöpfung an sich auf. Der Mensch ist nicht einfach gut, er hat
die potentielle Fähigkeit zu Gutem wie Bösem. Schäfer sieht zurecht, dass „die Kritik der Engel... also keine Verurteilung einzelner Vergehen und
Sünden des Menschen (ist), sondern sie richtet sich gegen die Existenz des Menschen überhaupt... Einige Midraschim halten deswegen auch den
Engeln entgegen, daß Gott von Anfang an um die Sündhaftigkeit des Menschen gewußt und diese akzeptiert hat. Die Barmherzigkeit Gottes und
die Buße des Menschen ermöglichten die Existenz des Menschen.“4 Die Engel sind die Anwälte der Gerechtigkeit, und sie beabsichtigen, auch
Gott auf das Attribut der Gerechtigkeit einzuschwören und damit einen Anspruch durchzusetzen, dem der Mensch nicht entsprechen kann, wodurch die himmlische Sphäre sozusagen unter sich bliebe. Gott aber will den Menschen mit gutem und bösem Trieb, mit der Fähigkeit zu sündigen
und der Fähigkeit umzukehren, ebenso wie mit Möglichkeit, das Gute und Richtige zu tun. Gott schafft den Menschen in diesem Wissen und in
dieser inneren Spannung, er verdrängt den Gedanken an die Gerechtigkeit und lässt den Gedanken an seine Barmherzigkeit sich durchsetzen
(vgl. GenR 8.4f.).
2. »Wach auf! Warum schläfst du, Herr? Erwache, verstoß nicht für immer!« (Ps 44,24)
Der Mensch definiert sich aus seiner bleibenden Gottesbeziehung. Bricht der Kontakt zu Gott ab, wendet Gott sein Gesicht ab, oder scheint er gar
zu schlafen, zerfällt die Welt in Chaos und Gewalt. Gerade deshalb ist die dauernde Kontaktaufnahme mit Gott von immenser lebenserhaltender
Bedeutung. Sie geschieht durch Gebet, Bitte und Klage, aber auch durch den kritischen Dialog. So haben nach Ansicht von tSota 13,9; ySota
9,11,24a; bSota 48a die Leviten täglich den Psalmvers 44,24 gebetet, um Gott aufzurütteln, da Israel in Not ist, während die Völker, die es unterdrücken, in Wohlstand und Glück lebten. Vor allem die Erzeltern, Mose und David bieten Vorbilder für eine dialogische Rede mit Gott, in der er in
seinem Denken und Verhalten bewegt und verändert werden kann. Immer wieder begegnen im rabbinischen Schrifttum Belege für einen Disput,
bei dem die menschlichen Gesprächspartner als Sieger hervorgehen. Nur ein Beispiel sei hier genannt, nämlich bSchabbat 89a. Hier wird Isaaks
Gespräch mit Gott beschrieben. Gott hat gegenüber Abraham und Jakob festgestellt, dass Israel sich verfehlt hat. Beide Erzväter stimmen der Bestrafung durch den Märtyrertod zu. Doch will sich Gott damit nicht zufrieden geben. Erst Isaak lehnt sich auf. Er weist Gott darauf hin, dass es sich
hier um seine eigenen Kinder handelt, die er nicht einfach nur dann gut behandeln kann, wenn sie sich gut verhalten: „Und wie viel haben sie ü4
108
Schäfer, Rivalität 221.
Grundkurs Judentum
Menschenrechte
berhaupt gesündigt? 70 Jahre beträgt das Leben des Menschen (Ps 90,10); zieh davon 20 ab, für die du sie nicht strafst, bleiben 50; zieh davon
wieder 25 für die Nächte ab, so verbleiben 25; zieh davon wieder 12½ für Beten, Essen und Austreten ab, so verbleiben 12½. Willst du alle auf
dich nehmen, ist es gut, wenn nicht, nehme ich die Hälfte auf mich, und du die andere Hälfte auf dich. Willst du aber, dass ich alles auf mich nehme, so habe ich mich ja vor dir opfern lassen!“ Isaaks Opferung in Gen 22 bewirkt an dieser Stelle stellvertretend die Sühne des Volkes.5 Gott wird
an seine Vaterschaft gemahnt und insgesamt seine mögliche Sündhaftigkeit auf ein Minimum zu reduzieren gesucht. Aus dem Text wird nicht zuletzt deutlich, dass die Menschheit immer wieder große Einzelpersönlichkeiten braucht, die für sie eintreten und ihr Recht zu wahren trachten.
Die rabbinische Tradition lässt keinen Zweifel daran, dass sie die eigentliche Würde des Menschen an die Gotteskindschaft bindet und seine besonderen Rechte aus seinem Verhalten und seiner Bereitschaft ableitet, den Willen Gottes zu erfüllen. Die Erfüllung der Weisung Gottes unterscheidet die Menschen voneinander, nicht Hautfarbe oder gesellschaftlicher Rang. Die Annahme der Tora am Sinai hätte daher Israel selbst in
himmlische Höhen erhoben und von Not und Tod befreit.
3. »Wohl habe ich gesagt: Ihr seid Götter, ihr alle seid Söhne des Höchsten. Doch nun sollt ihr sterben wie Menschen, sollt stürzen wie jeder der
Fürsten« (Ps 82,6f.)
Mit der Ausnahme Tan Bereschit 7, wo die Verse auf den Menschen (Adam) und seinen bösen Trieb bezogen werden, sind sich die Rabbinen
darüber einig, dass in Ps 82,6f. Israel gemeint ist. Israel allein habe durch die Gabe der Tora am Sinai die Chance erhalten, den Engeln zu gleichen, denen der Tod nicht droht. Doch schon mit der Sünde mit dem Goldenen Kalb – die zur eigentlichen Ursünde Israels wird – habe Israel diesen Status verspielt: »Doch nun sollt ihr sterben wie Menschen, sollt stürzen wie jeder der Fürsten« (V 7) (Mek Bachodesch 9 L II 272; bAboda
Zara 5a; KohR 3.19; 8.3; TanB Chuqqat 18 58a; PRK 4.4; PesR 10.4 und KohR 8.3 sowie die folgenden Belege). ExR 32.1 geht darüber hinaus.
Nicht nur der Tod wäre erspart geblieben, auch das Exil.6 Nach LevR 11.3 hätten die Israeliten nach der Übernahme der Tora sogar fliegen können (Anklang an Ex 19,4). LevR 18.2, eine Auslegung von Hab 1,7 im Kontext der Exegese von Lev 15,1f., nennt Lepra als Strafe für Israels
Treuebruch. Auch in NumR 7.4 wird diese Meinung vertreten. Nach diesem Text hätte Israel in der Wüste nicht einmal austreten müssen. In NumR
16.24 zu Num 14,11 steht der Psalmvers im Rahmen einer langen Aufzählung von Gottes Wohltaten an Israel und Israels Starrsinn, beginnend in
Ägypten. Schon am Schilfmeer hatte das Volk Gott getrotzt (Ps 106,7). Am Sinai war Gott mit Tausenden von Engeln herabgestiegen und hatte
Israel mit Kronen geschmückt und mit Waffen behängt bzw. mit herrlichem Gewand bekleidet. Weder der Todesengel noch irgendein Übel hatte
Macht über sie, weil der unaussprechliche Gottesname auf den Waffen geschrieben stand. Doch sie stellten das Goldene Kalb auf, und sofort
mussten sie alles wieder ablegen.
Als Israel die Tora bekam, sagte Gott dem Todesengel, dass er über alle Menschen außer über Israel Macht hat. Jose ha-Gelili habe festgestellt,
dass der Engel sich bei Gott beschwerte, dass er nutzlos auf der Welt sei. Gott antwortete ihm, er sei als Vernichter der Götzendiener geschaffen
worden, doch Israel dürfe er nicht anrühren. Israel sollte nach dem Willen Gottes ewig leben7 (Dtn 4,4). Um dies sicherzustellen, hatte Gott die Tafeln dem Mose übergeben. In Ex 32,16 findet sich das entscheidende Stichwort „charut“ (eingegraben), das als „cherut“ (Freiheit) zu lesen ist.
5
6
7
Vgl. GenR 56.10; HldR 1.14; LevR 29.9; Targum zu Gen 22. Das Pessachlamm erinnert schließlich Gott an dieses Opfer, und jedes Jahr soll das Osterfest durch Pessachblut und Pessachlamm an jenes Ereignis erinnern. Für alle Zeiten bleibt Isaaks Tat wirksam und jedes Opfer ist nur vergegenwärtigender, erinnernder Nachvollzug des
Verdienstes Isaaks.
In Sifre Dtn Ha´azinu §320 ist das Exil nicht direkte Folge der Sünde mit dem Goldenen Kalb, wohl aber Folge der Auflehnung gegen David in 2 Sam 20,1.
Vgl. auch ExR 32.7. Ps 82,7 bedeutet in dieser Tradition, dass Israel den Völkern gleichgestellt wird. Diese haben einen Schutzengel, so auch Israel.
109
Grundkurs Judentum
Menschenrechte
Gemeint ist: Freiheit von den Fremdvölkern (Jehuda), Freiheit vom Tod (Nehemja) oder Freiheit von Leid (Rabbi). All dies war durch Israels Verehrung des Goldenen Kalbs zunichte gemacht worden.8 Es folgt eine fast verzweifelte Rede Gottes: „Ich dachte, ihr würdet euch nicht verfehlen und
Leben haben und für immer Bestand, so wie ich, so wie ich Leben und Bestand habe für immer und ewig. Ich sagte: »Ihr seid göttliche Wesen, ihr
alle seid Söhne des Höchsten« (Ps 82,6) wie die Dienstengel, welche unsterblich sind. Doch, nach all dieser Größe, wolltet ihr sterben! »Doch nun
sollt ihr sterben wie Adam« (Ps 82,7). Das bedeutet, wie Adam, dem ich ein Gebot auferlegte, das er befolgen sollte und leben und bestehen für
immer, wie es heißt: »Seht, Mensch war wie einer von uns«9 (Gen 3,22), sowie: »Gott schuf also den Menschen als sein Abbild« (Gen 1,27). (Das
bedeutet,) dass er leben sollte und bestehen wie er. Er aber richtete sein Werk zugrunde, und ich machte meinen Beschluss nichtig, denn er aß
von dem Baum, und ich sagte zu ihm: »Denn Staub bist du, (zum Staub musst du zurück)« (Gen 3,19). Auch euch habe ich gesagt: »Ihr seid göttliche Wesen« (Ps 82,6). Ihr habt euch selbst zugrunde gerichtet wie Adam, deshalb: »Doch nun sollt ihr sterben wie Adam« (Ps 82,7).“10
Diese Unheilsgeschichte setzt sich in der Wüste fort. Das Manna war so wundersam gewesen, dass es sich in schmackhaftes Fleisch verwandelte
(Ps 68,25) und die Israeliten nicht austreten mussten. Doch murrten sie auch gegen das Manna. Und selbst die Kundschafter hatte Gott geschützt,
indem er die feindlichen Mächte ablenkte. Doch auch sie murrten.
Diese Geschichte soll aufzeigen, dass der Mensch allgemein und Israel im speziellen immer wieder Gottes Zuwendung ins Gegenteil verkehrt hat.
Es hat es sich so selbst zuzuschreiben, nicht göttlich, sondern sterblich zu sein, nicht unbesiegbar und ins Exil geworfen.
Versöhnlicher klingt DtnR 7.12. Ausgehend von Dtn 29,4 wird ausgesagt, dass Gott mehr als ein menschlicher Vater sein Volk behütete und es in
höchste Höhe erhob (Ps 82,6 als Erklärung zu Dtn 1,31). So wird er sich ihm auch im Alter zuwenden und auch in der zukünftigen Welt Israel erhöhen (Jer 31,20).
Sifre Dtn Ha´azinu § 306 überliefert eine Lehre des R. Simaj, wonach der Mensch eigentlich ein Mittelwesen sei, seine Seele stamme vom Himmel, sein Körper von der Erde, doch: „Wenn der Mensch die Tora erfüllt und den Willen seines Vaters im Himmel tut, siehe, dann ist er wie die oberen Geschöpfe, wie es heißt: »Ihr seid göttliche Wesen, ihr alle seid Söhne des Höchsten« (Ps 82,6). Erfüllt er aber die Tora nicht und tut nicht
den Willen seines Vaters im Himmel, siehe, dann ist er wie die unteren Geschöpfe, wie es heißt: »Doch nun sollt ihr sterben wie Adam« (V 7). R.
Simaj schließt eine Reflexion über die Auferstehung an, wo Himmel und Erde den Menschen richten (Ps 50,4). In einer Reflexion über die Tora in
HldR 1.2 §5 sind Israel die „Fürsten Gottes“ nach 1 Chr 24,5, wenn sie in Reinheit leben. Dann können sie sowohl den oberen wie den unteren
Lebewesen ihren Willen aufdrücken.
Auch GenR 8.11 erläutert zu Gen 1,27, dass der Mensch als Mittelwesen vier Eigenschaften mit der himmlischen Sphäre und vier Eigenschaften
mit den Tieren gemein hat. Mit den Engeln verbindet ihn der aufrechte Gang, das Sprechen, Verstehen und (die Art des) Sehen(s). Mit den Tieren
verbindet ihn Essen und Trinken, Fortpflanzung, Ausscheidung und Tod.11
Das Sterben des Menschen gehört nach dieser Tradition aber zum natürlichen Bestandteil seiner Existenz, wobei ihm wieder das ewige Leben
winkt, wenn er Gottes Geboten entsprechend lebt. Die Beschreibung beinhaltet auch keine Wertung. Ihr folgt allerdings ein Auftrag:
„»Und herrscht über die Fische des Meeres« (Gen 1,28). R. Chanina sagte: Wenn er es verdient (heißt es): «uredu» (»herrscht«); wenn er es nicht
verdient: «yerdu» (»laßt ihn untergehen«). R. Jakob aus Kfar Chanan sagte: Von dem, der in unserem Bild und Abbild bleibt: «uredu»; aber von
8
9
10
11
110
Parallele zu diesem Abschnitt Tan Tissa 16 und Eqeb 8; TanB Wa-era 9 (13a).
Hier positiv als Zustand vor dem Sündenfall zu lesen.
Vgl. zum letzten Abschnitt auch TanB Schelach 2 (39a).
Zur Würde des Menschen gegenüber dem Tier vgl. auch LevR 32.2; KohR zu 10,20.
Grundkurs Judentum
Menschenrechte
dem, der nicht in unserem Bild und Abbild bleibt: «yerdu».“ Hier klingt die Abbildfunktion des Menschen an, die ihm als Auftrag bei der Schöpfung
mitgegeben wird. Wo der Mensch also Anteil an der himmlischen Sphäre bekommen hat, muss er sich als Gottes Abbild bewähren.
4. „Wie bei Zwillingen ist es: Wenn einer Kopfschmerzen hat, spürt es der andere. Wenn man so sagen darf, sagte der Heilige, gepriesen sei er,
zu seinem Volk: »Ich bin bei ihm in der Not« (Ps 91,5)“ (PesK 5.6)
Gott und Mensch sind Zwillinge. Für Gott heißt daher seine enge Verwandtschaft auch Mit-Leid und Solidarität mit dem in der Not Befindlichen, wie
das Gleichnis in PesK 5.6 sagt. Was aber meint das Abbild-Sein für den Menschen? Wohl nicht in erster Linie äußere Ähnlichkeit, wenngleich
manche Texte auch dies nahelegen. Meint es die Stellvertretung Gottes auf Erden als Herrscher und Verwalter? Oder meint es die Nachahmung
Gottes als Vorbild im Miteinander? Die Rabbinen zielen in erster Linie auf letzteres ab und beschreiben die Abbildfunktion als ethische Kategorie.
Dazu dienen vor allem - paradoxerweise - die Kontrastgleichnisse, in denen Gott als der ganz andere geschildert wird, der gerade nicht so zu handeln pflegt, wie es Menschen üblicherweise tun. In diesen Kontrastgleichnissen spiegeln sich die idealen Erwartungen an den Menschen. Gott wird
als bescheiden und großzügig dargestellt, als barmherzig und langmütig, als Person, der als Überlegener niedrige Dienste tut und damit die sozialen Normen umkehrt.12 Gott bleibt vor allem in seinen Fähigkeiten unübertrefflich, aber zugleich dem Menschen aufs Nächste verwandt. Aus dieser
Verwandtschaft resultieren wichtige Bestimmungen in bezug auf die Menschenwürde. Das allen Menschen gleichermaßen auferlegte Tötungsverbot etwa begründet Mek Bachodesch 8 (Lauterbach II 262f.) zu Ex 20,12-14 folgendermaßen:
„Auf welche Weise wurden die Zehn Gebote gegeben? Fünf auf einer Tafel und fünf auf der anderen Tafel. Es steht geschrieben: »Ich bin YHWH,
dein Gott«; und gegenüber steht geschrieben:
»Du sollst nicht morden«. Die Schrift weist darauf hin, dass es jedem, der Blut vergießt, angerechnet wird, als hätte er (Gottes) Ebenbild geschmälert. Ein Gleichnis über einen König aus Fleisch und Blut. Er betrat ein Land, und sie stellten ihm Standbilder auf und machten ihm Bildnisse und
prägten ihm Münzen. Nach einiger Zeit stürzten sie seine Standbilder um, zerstörten seine Bildnisse und entwerteten seine Münzen und schmälerten (so) das Ebenbild des Königs. So wird jedem, der Blut vergießt, angerechnet, als hätte er (Gottes) Ebenbild geschmälert, wie es heißt: »Der
das Blut eines Menschen vergießt usw. denn im Bild Gottes machte er den Menschen« (Gen 9,6). Es steht geschrieben: »Du sollst [keine anderen
Götter haben]«; und gegenüber steht geschrieben: »Du sollst nicht ehebrechen«. Die Schrift weist darauf hin, dass es jedem, der Götzendienst
begeht, angerechnet wird, als habe er die Ehe gebrochen vom ORT weg, wie es heißt: »Die Frau, die Ehebruch begeht unter ihrem Gemahl,
nimmt Fremde« (Ez 16,32); und es steht geschrieben: »Und es sprach YHWH zu mir: Liebe eine Frau, die von einem anderen geliebt wird und die
Ehe bricht [so, wie der Herr die Kinder Israels liebt, obwohl sie sich anderen Göttern zuwenden und Opferkuchen aus Rosinen lieben]« (Hos 3,1).“
Der König im Gleichnis wird geehrt, indem man ihm Bildnisse aufstellt. Werden sie vernichtet, so geht zugleich auch sein Einfluss verloren. Mehr
noch, man vernichtet ihn selbst, insofern er sich in den Bildern repräsentiert. Gott ist kein König aus Fleisch und Blut. Er will auch keine Bildnisse
als Ebenbilder. Vielmehr stellt der Mensch selbst ein irdisches Ebenbild dar. Tötet man einen Menschen, so tötet man Gottes Bildnis. Ähnlich verhält es sich mit Götzendienst und Ehebruch. In diesen drei Vergehen sind die klassischen „Hauptgebote“ des Judentums angesprochen. Alle drei
haben ihre Erklärung in der Ebenbildlichkeit des Menschen. Die Auslegung von Dtn 21,23, wonach ein Gehängter nicht über Nacht auf dem Pfahl
hängen bleiben darf, wird in tSanhedrin 9,7 und bSanhedrin 46b dazu verwendet, Gottes Mitgefühl mit dem Verbrecher auszudrücken und im
Gleichnis klarzustellen, dass der hingerichtete Straßenräuber ein „Zwillingsbruder“ des Königs (Gottes) ist. Der Mensch ist also auch als Schwer12
Vgl. die Zusammenstellung bei T. Thorion-Vardi, Das Kontrastgleichnis in der rabbinischen Literatur (JudUm 16), Frankfurt a. Main u.a. 1986, z.B. 56ff.
111
Grundkurs Judentum
Menschenrechte
verbrecher ein Bild Gottes, dem Wertschätzung und Ehre gebührt. Es ist in diesem Zusammenhang naheliegend, dass auch die Überlegungen zur
Verhängung von Todesstrafe von solchen Einsichten getragen werden müssen. Zum einen ist unschuldig vergossenes Blut nicht ungesühnt zu
lassen, zum anderen hat aber auch der Mörder als Geschöpf Gottes fundamentales Menschenrecht. mMakkot 1,10 jedenfalls stellt fest, dass ein
Gerichtshof, der einmal in 70 Jahren ein Todesurteil fällt, unheilbringend genannt wird. R. Tarfon und R. Aqiba, zwei überaus wichtige Mischnagelehrte, hätten überhaupt kein Todesurteil zugelassen.13 Weiters wurden die menschlichen Gerichtsautoritäten auch mit dem Umstand konfrontiert,
dass Gott selbst straft (Ex 20,7, Dtn 5,11), wenn sein Name verunreinigt wurde. Die irdischen Autoritäten konnten daher einen Teil der Strafe Gott
überlassen (bSchebuot 21a).
Wie der Mensch Ebenbild Gottes ist, so werden auch Gott Attribute zugeordnet, die ihn aufs Engste mit dem Menschen verbinden. Gerade diese
Verwandtschaft ermöglicht es schließlich Israel, Gottes Autorität auch in Fragen der Tora freiwillig zu akzeptieren. Denn Gott hat sich vorher - am
Exodus und am Schilfmeer - in besonderer Weise als fürsorglicher Vater erwiesen. In einer in mehreren Varianten erzählten Geschichte wird Gott
als hübscher Jüngling beschrieben, der die Kinder in Ägypten aufzieht. So heißt es in ExR 23.8:
„R. Jehuda spricht: Wer sang dem Heiligen, gepriesen sei er, Lobpreis? Die Kinder. Jene nämlich, die der Pharao im Nil ertränken wollte, waren
es, die den Heiligen, gepriesen sei er, erkannten. Auf welche Weise? Wenn immer Israel in Ägypten war und eine von den Töchtern Israels gebären sollte, ging sie aufs Feld und gebar dort. Als sie geboren hatte, verließ sie den Jungen und übergab ihn [der Obsorge des] Heiligen, gepriesen
sei er, und sprach: Herr der Welt, ich habe das Meinige getan, tu du das Deinige! R. Johanan (A2) sagte: Sofort stieg der Heilige, gepriesen sei er,
herab in seiner Herrlichkeit - wenn man so sagen darf - schnitt ihre Nabelschnur ab, wusch sie und salbte sie; und so sprach Ezechiel: »Und du
wurdest auf freiem Feld ausgesetzt, aus Abscheu vor dir« (Ez 16,5); und es steht geschrieben: »Und deine Herkunft: Am Tag deiner Geburt wurde
deine Nabelschnur nicht abgeschnitten« (Ez 16,4); und es steht geschrieben: »Ich kleidete dich in bunte Gewänder« (Ez 16,10); und es steht geschrieben: »Und ich wusch dich mit Wasser« (Ez 16,9).Er gab ihm zwei Steine in die Hand; einer fütterte es mit Öl und einer fütterte es mit Honig,
wie es heißt: »Er ließ ihn Honig saugen aus dem Felsen« (Dtn 32,13). Und sie wuchsen heran auf dem Feld, wie es heißt: »Zahlreich wie das Gewächs des Feldes machte Ich dich« (Ez 16,7). Und sobald sie herangewachsen waren, gingen sie in ihre Häuser zu ihren Vätern. Als sie gefragt
wurden: Wer hat auf euch geachtet?, antworteten sie: Ein netter, hübscher junger Mann stieg herab und hat sich um all unsere Belange gekümmert, wie es heißt: »Mein Geliebter ist glänzend und rot und vor Zehntausenden ausgezeichnet« (Hld 5,10). Und als die Israeliten zum Meer kamen, da waren die Kinder dort mit ihnen, und sie sahen den Heiligen, gepriesen sei er, im Meer, und sie begannen zu ihren Vätern zu sprechen:
Dieser ist es, der all diese Dinge für uns getan hat, als wir in Ägypten waren, wie es heißt: »Er ist mein Gott; ihn will ich verehren« (Ex 15,2).“
Auf intensivste Weise wird hier Gottes „Menschlichkeit“ und Nähe zum Ausdruck gebracht, durch die er Israels Vertrauen und Anerkennung gewinnt. Denn Israel soll Gottes Tora anerkennen.
II. Der Mensch vor dem Gesetz
1. „»Die Erde mit allen, die auf ihr wohnen, mag wanken« (Ps 75,4), bedeutet, dass die Welt schon lange zerflossen wäre, wenn Israel nicht am
Sinai gestanden hätte“ (RutR Peticha 1)
13
112
Zur Diskussion um das Strafmaß, die Beschränkung von Strafen und die Regelungen, welche eine doppelte Bestrafung für ein Delikt verbieten, vgl. bKetubbot 32b; bBaba
Kamma 83b; bMakkot 4b.13b und die mittelalterlichen Kommentare zu mMakkot 3,1.
Grundkurs Judentum
Menschenrechte
In RutR Peticha 1 heißt es: „»Zu der Zeit, als die Richter regierten« (Rut 1,1). R. Jochanan begann (seine Auslegung mit dem Vers): »Höre, mein
Volk, ich rede. / Israel, ich klage dich an, ich, der ich dein Gott bin« (Ps 50,7). R. Jochanan sagte: Zeugnis gibt es nur beim Hören. R. Judan sagte
im Namen von R. Simon: In der Vergangenheit hatte Israel einen Namen wie der Rest der Völker: »Sabta, Ragma und Sabtecha« (Gen 10,7), in
weiterer Folge werden sie nur `mein Volk´ genannt: »Höre, mein Volk, ich rede«. Ab welchem Zeitpunkt an habt ihr es verdient, `mein Volk´ genannt zu werden? Von da, wo ihr am Sinai vor mir spracht und sagtet: »Alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun und hören« (Ex 24,7). R.
Jochanan sagte: »Höre, mein Volk« - in dieser Welt; »ich rede« - in der kommenden Welt, wonach ich den Mund öffnen werde gegenüber den
Fürsten der Welt, die in der Zukunft vor mir stehen werden und sagen: Herr der Welt! Diese haben Götzen gedient und wir haben Götzen gedient;
diese haben sich der Unzucht schuldig gemacht und wir haben uns der Unzucht schuldig gemacht, diese haben Blut vergossen und wir haben Blut
vergossen. Diese gehen in den Garten Eden, wir aber in die Hölle. In diesem Augenblick schweigt der Verteidiger Israels. Das bedeutet, was geschrieben steht: »In jener Zeit tritt Michael auf« (Dan 12,1)... Und der Heilige, gepriesen sei er, sagte zu ihm: Bleibst du schweigend und hast keine
Verteidigung für mein Volk anzubieten? Bei deinem Leben, ich will Gerechtigkeit sprechen und mein Volk retten! Mit welcher Gerechtigkeit? R. Eleazar und R. Jochanan: Einer sagte: Die Gerechtigkeit, mit der ihr für mein Wort eintratet und meine Tora annahmt. Denn hättet ihr meine Tora
nicht angenommen, hätte ich die Welt wieder in Tohu und Bohu zurück verwandelt. R. Huna sagte im Namen des R. Acha: »Die Erde mit allen, die
auf ihr wohnen, mag wanken« (Ps 75,4), bedeutet, dass die Welt schon lange zerflossen wäre, wenn Israel nicht am Sinai gestanden hätte. Wer
hat dann die Welt auf festen Grund gestellt? »Ich selbst habe ihre Säulen auf festen Grund gestellt« (Ps 75,4). Durch das Verdienst des `Ich´. Ich
habe ihre Säulen für immer auf festen Grund gestellt. Der andere sagte: Durch die Gerechtigkeit, welche ihr selbst über euch gebracht habt, indem
ihr meine Tora angenommen habt; denn wäre es nicht so, hätte ich die Völker euch vernichten lassen.“
Die Begründung des Gerichts liegt hier in der Annahme der Tora durch Israel. Sie garantiert Gottes Zuwendung auch gegenüber den kritischen
Anfragen der Völker. Die Grundentscheidung für die Tora hält die Welt am Dasein. Das Vorrecht Israels besteht demnach nicht darin, vorbildlicher
als die Völker gelebt zu haben. Niemand leugnet oder verdrängt die Fehler und Vergehen Israels. Nur wer den Wert der Gabe der Tora zu verstehen weiß, kann allerdings erahnen, welche Gerechtigkeit in ihr liegt. Sie ist die Ordnung, auf der die Welt ruht. Sie in ihrer ganzen Kraft und Bedeutung anzunehmen, auch wenn man immer wieder an ihr scheitern mag, stellt einen gewaltigen Wert dar. Gott hat die Tora allen Völkern angeboten, und obgleich er wußte, dass sie sie ablehnen würden, überließ er ihnen die freie Entscheidung. Israel hat mit seiner Annahme der Tora die
Welt vor dem Chaos gerettet. Darin liegt das besondere Verdienst Israels.
In LevR 23.3 heißt es dementsprechend: R. Azarja sagte im Namen des R. Jehuda b. R. Simon. Der Vers (Hld 2,2: »Ein Lotus unter Dornen...«)
gleicht einem König, der einen Garten besaß, in dem Reihen von Feigen, Trauben und Granatäpfeln und von Äpfeln gepflanzt waren. Er übergab
ihn einem Pächter und zog weg. Nach Jahren kam der König zurück und schaute nach dem Garten, um zu wissen, was geschehen war. Er fand
ihn voller Dornen und Disteln vor. Er ließ Schnitter kommen, um ihn zu schneiden. Er blickte auf die Dornen und sah darin einen Lotus wie eine
Rose. Er nahm ihn und roch daran und seine Seele kam zur Ruhe darüber. Der König sprach: Wegen dieses Lotus soll der ganze Garten gerettet
werden. So wird die ganze Welt nur wegen der Tora geschaffen. Nach den 26 Generationen schaute der Heilige, gepriesen sei er, auf seine Welt,
um zu wissen, was mit ihr geschah, und er fand sie voll Wasser in Wasser. Die Generation des Enosch war Wasser in Wasser, die Generation der
Flut war Wasser in Wasser, die Generation der Spaltung (= des Turmbaus) war Wasser in Wasser. Also ließ er Schnitter kommen um sie zu
schneiden; wie es heißt: »Der Herr thronte über der Flut« (Ps 29,10). Er sah darin einen Lotus wie ein Rose - das sind die Israeliten, und er betrachtete ihn und er roch daran - in der Stunde, als er ihnen die Zehn Gebote gab; und seine Seele kam zur Ruhe darüber - in der Stunde, als sie
sprachen: »Wir wollen tun und hören«. Es sprach der Heilige, gepriesen sei er: Wegen dieses Lotus soll der ganze Garten gerettet werden - wegen des Verdienstes der Tora und Israels soll die Welt gerettet werden.“
113
Grundkurs Judentum
Menschenrechte
2. »Du allein bist der Gott, der Wunder tut, du hast deine Macht den Völkern kundgetan« (Ps 77,15)
Wenn die Welt um Israels und der Tora willen erhalten wird, welche Bedeutung haben dann überhaupt die Nichtjuden? Sind sie gerade noch geduldete Menschen zweiter Klasse? Wer die rabbinischen Stellen zu den Völkern anliest, wird auf den ersten Blick vielleicht diesen Eindruck sogar
bestätigt bekommen.
Immer wieder begegnet man Ausführungen über den Umstand, dass die Völker am Sinai die Tora abgelehnt haben. Über die Folgen dieses
schwerwiegenden Fehlers gibt es unterschiedliche Ansichten. Tan Berakha 4, TanB Berakha 3 (28a) und PRK S1.15 zu Dtn 33,2 überliefern Traditionsbeweise, dass die Völker dafür von Gott mit der Höllenstrafe belegt werden. Micha gilt als Zeuge (Mi 5,14), dann David in Ps 77,15. Obwohl
Gott wußte, dass die Völker die Tora nicht annehmen würden, bot er sie ihnen an, um ihnen die freie Entscheidung nicht zu nehmen. Nach anderer Ansicht bot er sie ihnen aus Rücksicht auf das Verdienst Abrahams und Isaaks an, die immerhin die Väter von Ismael und Esau sind, aus denen schließlich das auch hier wesentlich angezielte Rom entspringt. Gott ist eben nicht wie Menschen aus Fleisch und Blut. Er ist einzigartig und
unvergleichlich (Ps 86,8; Ex 15,11)
Die Völker erscheinen des öfteren generell als verderbt, götzendienerisch, ehebrecherisch und arrogant, sind Israel feindlich gesinnt und wollen es
ausrotten. Sieht man jedoch näher hin, bildet sich ein viel differenzierteres und nuancierteres Bild.14 So ist einmal zu unterscheiden „zwischen allen
oder einzelnen Weltvölkern en bloc und Individuen oder Gruppen aus den Weltvölkern, die in eine positive Beziehung zu Israel oder zum Gott Israels getreten sind, treten oder treten werden. Dazu zählen hauptsächlich die Proselyten (gerîm), die Gottesfürchtigen (yir´ê schamayîm), die Noachiden (bne noach), die gerechten Nichtjuden (goyîm zaddîqîm) und manchmal die Fremden, die ihre eigenen Traditionen getreu wahren
(nokrîm).“15 Eine besondere Bedeutung haben die Verpflichtungen der sieben sog. noachidischen Gebote erlangt, deren Einhaltung den Völkern
auferlegt wird. Sie betreffen nach tAboda Zara 8.4 die Rechtspflege, Götzendienst, Gotteslästerung, Unzucht, Blutvergießen, Raub, ein Glied von
einem lebenden Tier. Diese Aufzählung wird noch ergänzt durch Einzelmeinungen und findet sich mit leichten Umformulierungen und Umstellungen auch in bSanhedrin 56ab und GenR 34.8.16 Bei aller Differenz im einzelnen ist hier die Grundeinstellung festzuhalten, auch den Völkern eine
in der biblischen Überlieferung verankerte Tora quasi als „Grundrechtskatalog“ zuzuweisen. Der Mensch ist daher nie im rechtsfreien Raum, er hat
seine Grundrechte und -pflichten von Beginn seiner Existenz an.17
Letztlich kann man die sieben Gebote wiederum auf den Kern von drei Kardinalgeboten zurückführen, die gleichermaßen für Juden wie Nichtjuden
von Bedeutung sind, nämlich Götzendienst, Unzucht und Mord. Dies läßt sich vor allem aus bSanhedrin 57a erheben, wonach ein Noachide nur
wegen Vergehen gegen diese drei Gebote hingerichtet wird. In GenR 34.8 stehen sie bewusst am Beginn der noachidischen Reihe und weisen
14
15
16
17
114
Vgl. den Artikel von J. Sievers, Heidentum II: TRE 14 (1985) 601-605.
C. Thoma, Die Weltvölker im Urteil rabbinischer Gleichniserzähler, in: C. Thoma/G. Stemberger/J. Maier (Hgg.), Judentum - Ausblicke und Einsichten. Festgabe für Kurt
Schubert zum siebzigsten Geburtstag (JudUm 43), Frankfurt am Main u.a. 1993, 115-133, 116
Zum gesamten Themenkomplex vgl. K. Müller, Tora für die Völker. Die noachidischen Gebote und Ansätze zu ihrer Rezeption im Christentum (SKI 15), Berlin 1994.
Weshalb schließlich in der Rezeption der Noachidischen Gebote bereits Adam als Empfänger von 6 Grundgeboten angenommen wird (GenR 16.6).
Grundkurs Judentum
Menschenrechte
diese daher als Ausweitung der drei Kardinalvergehen aus. Ebensolches läßt sich für bYoma 67a sagen. „Gedanklich-konzeptionell hängen die
drei Hauptgebote und die noachidische Siebenerreihe engstens zusammen: Der entwicklungsgeschichtliche Weg zu den Sieben ist als »Entfaltung
eines Prinzips«, des Prinzips universaler Weisung zu verstehen, deren Herzstück die Warnung vor Götzendienst, Unzucht und Blutvergießen ist.“18
Auch für Juden sind nur diese drei Gebote auch bei Lebensgefahr einzuhalten (bSanhedrin 74b). Ihretwegen zieht sich Gottes Gegenwart zurück
(Sifre Dtn § 254). Sie sind die großen Verunreinigungen, die in bSchebuot 7b genannt werden. Müller weist auch für die christliche Rezeption in
den Lasterkatalogen des Neuen Testaments (Gal 5,19-21; 1 Kor 5,10f. und 1 Kor 69f.; 1 Tim 1,9f.; Tit 3,3; Apk 9,20f; 21,8) nach: „Die Trias der
Kardinalsünden als das Kernstück der nachmaligen noachidischen Weisung ist für die junge Christenheit verbindliche ethische Orientierung... In
der Aufnahme jener drei Hauptverbote schließt sich das frühchristliche Schrifttum faktisch einer jüdischen Summierung der Tora - hinsichtlich der
sog. mitsvot des Nicht-Tuns - an.“19 Und er fährt fort: „Dem Widerstehen gegen die drei Hauptsünden des Götzendienstes, des Blutvergießens und
der Unzucht korrespondiert »positiv« die mitsva des Tuns der Liebe. Ob in Gestalt des Wortes aus Lev 19,18 bzw. seines Äquivalentes, der Goldenen Regel, oder des Doppelgebotes: die Autoren des Neuen Testamentes von Paulus bis zu den Pastoralbriefen schöpfen das Gebot der avga,ph als Summe und Telos der Weisung an die christlichen Gemeinden aus der Tora Israels.“20
Die Einhaltung der drei Grundgebote bietet demnach eine mögliche Verbindung zwischen jüdischer und christlicher Einstellung zur Tora als Ausformung von Grundpflichten, die das Zusammenleben der Menschen und die gelungene Beziehung zu Gott ermöglichen. Oder wie es Artikel 29
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte formuliert: „(1) Jeder Mensch hat Pflichten gegenüber der Gemeinschaft, in der allein die freie und
volle Entwicklung seiner Persönlichkeit möglich ist.“
Die Völker brauchen daher auch nicht die gesamte Sinai-Tora zu halten. Wer es dennoch tut, ist nach Ansicht R. Meirs einem Hohepriester gleich
zu achten, während Jochanan im selben Kontext für ihn die Todesstrafe fordert (bSanhedrin 59a). In einer Zeit, wo Philosemitismus und rituelle
Nachahmung jüdischer Bräuche in christlichen Kreisen gang und gebe sind, sollte uns das Wort R. Jochanans warnen. Viel zu oft ist Philosemitismus nur die Kehrseite des Antisemitismus, die jederzeit umschlagen kann. Anders als das geradezu naiv positive Diktum R. Meirs sieht Jochanan
hier die Gefahr einer Übernahme von Bräuchen und Regeln einer anderen Kultur, ohne sich wirklich im letzten auf diese einzulassen, für diese
Kultur selbst, die in ihrem Selbstwert und ihrer Identität bedroht ist.
Das Judentum, das sich am Sinai entschloss, die Gebote Gottes anzunehmen, ringt in seinen Schriften seinerseits immer wieder um die Frage
nach der Wichtigkeit einzelner Weisungen und dem Verhältnis der Gebote zueinander. Eine detailliertere Beschäftigung mit dieser Frage kann ich
hier nicht leisten. Wichtig ist aber, darauf hinzuweisen, dass das rabbinische Judentum die Tora als Gottes Wort versteht, das nicht einfach als
Naturrecht abzuleiten ist, wenngleich Gott die Tora bei der Schöpfung als Bauplan benützte. Die Tora ist in den biblischen Schriften als Offenbarungstext niedergelegt und Israel zur beständigen Interpretation übergeben. Mit ihrer Hilfe vermag Israel sein eigenes Leben und zugleich die gesamte Welt zu erhalten.
5. „Mose nahm die Tora gefangen, wie es heißt: »Du zogst hinauf zur Höhe, führtest Gefangene mit« (Ps 68,13)“ (TanB Wa-jiqra 6 3a)
18
19
20
Müller, Tora 59.
Müller, Tora 194f.
Müller, Tora 195f.
115
Grundkurs Judentum
Menschenrechte
TanB Wa-jiqra 6 (3a) betont, dass Gott um der Liebe zu Israel willen (Zitat Ps 84,3) die himmlischen Sphären verließ und bei Israel im Offenbarungszelt wohnte. Er berief („benannte“) in Lev 1,1 Mose, wie er das Licht in Gen 1,5 berief. Dieses Licht ist die Tora, das Mose von der Höhe holte und „gefangen nahm“. Er ist das Haupt in dieser Welt und der Anführer der Gerechten in der zukünftigen Welt. Es verwundert daher in diesem
Zusammenhang nicht, dass die Rabbinen in Mose, ihrem Toramittler, den Gott-nahen Menschen zu finden glaubten.
So läßt man Mose gegenüber dem Pharao (Ex 7,1)21 als Gott erscheinen. In DtnR 11.4 und PRK S 1.9 definiert man genau, wann Mose Gott war
und wann ein Mensch. Er war Mensch, als man ihn in den Nil warf, aber Gott, als er den Fluss in Blut verwandelte. Er war Mensch, als er vor dem
Pharao floh, aber Gott, als er den Pharao ins Meer warf. Als er in den Himmel stieg, um die Tora zu empfangen, war er ein Mensch. Als er jedoch
zurückkam, war er Gott. Nach anderer Ansicht war er auch beim Aufstieg Gott, weil er wie die Engel keine Nahrung zu sich nahm. Wiederum nach
anderer Ansicht war sein oberer Teil göttlich, sein unterer aber menschlich.
In bRosch ha-Schana 21b; bNedarim 38a; Tan Wa-jiqra 3//TanB Wa-jiqra 4 (3a) wird Mose mit Ps 8,6 identifiziert, wobei der Kontext gerade die
Demut und Bescheidenheit Mose betont. Er hat ihn nur ein wenig geringer als Gott selbst gemacht, ihm Anteil gegeben an Gottes immenser Weisheit. Gerade die Verbindung von Weisheit und Bescheidenheit trägt hier zum Verständnis des Menschen bei. Wie Mose erweist er sich gerade in
seiner Bescheidenheit in wahrer Größe.
6. »Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verschmähen« (Ps 51,19)
Mek Bachodesch 9 (Lauterbach 273f.) beschreibt Mose in seiner Demut und schließt von ihm auf die Menschheit: „»Mose näherte sich der dunklen Wolke« (Ex 20,21). Was veranlasste seine Bescheidenheit? Wie es heißt: »Mose aber war ein sehr demütiger Mann« (Num 12,3). Die Schrift
erklärt, dass jeder, der demütig ist, schließlich bewirken wird, dass die Schekhina mit den Menschen auf Erden wohnt, wie es heißt: »Denn so
spricht der Hohe und Erhabene, der ewig Thronende, dessen Name «Der Heilige» ist: Als Heiliger wohne ich in der Höhe, aber ich bin auch bei
den Zerschlagenen und Bedrückten, (um den Geist der Bedrückten wieder aufleben zu lassen und das Herz der Zerschlagenen neu zu beleben)«
(Jes 57,15); und es heißt: »Der Geist Gottes, des Herrn, ruht auf mir; denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen
eine frohe Botschaft bringe (und alle heile, deren Herz zerbrochen ist, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Gefesselten
die Befreiung)« (Jes 61,1); und es heißt: »Denn all das hat meine Hand gemacht; (es gehört mir ja schon - Spruch des Herrn.) Ich blicke auf den
Armen und Zerknirschten« (Jes 66,2); und es heißt: »Das Opfer, das Gott gefällt, ist ein zerknirschter Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes
Herz wirst du, Gott, nicht verschmähen« (Ps 51,19).“
Bescheidenheit ist hier nicht identisch mit Duckmäusertum oder fehlender Zivilcourage. Vielmehr soll gerade die Solidarität mit den Armen betont,
die Umkehr- und Versöhnungsbereitschaft des Menschen angesprochen und der Wert des einfachen Menschen vor Gott bestärkt werden. In
bChullin 89a wird umfassend dargelegt, warum die Welt auf dem Fundament der Bescheidenheit ruht. Abraham und noch mehr Mose und Aaron
sowie David (Ps 22,7) haben sich durch ihre Bescheidenheit ausgezeichnet. Ijob 26,7 bezeugt, dass Gott die Erde an ein „Nichts“ hängt, was bedeutet, dass er das „Nichtssein“ von Mose und Aaron zum Fundament dieser Welt erklärt und sie ihretwegen erhält. Aus Ps 58,2 geht nun weiters
hervor, dass der Mensch schweigsam sein soll, sich also nicht prahlerisch hervortue. Doch bezieht sich dieses Schweigen nicht auf die Worte und
das Studium der Tora, auf das Durchsetzen und Eintreten für Gerechtigkeit in der Welt. Im Gegenteil. Der Mensch soll, so heißt es ja im Psalm,
21
116
Vgl. RutR Peticha 1; ExR 82; LevR 26,7; NumR 9,47; 14.6; 15.13; in ExR 2,6 wird „Elohim“ in Ps 84,8 auf Mose gegenüber dem Pharao bezogen.
Grundkurs Judentum
Menschenrechte
Gerechtigkeit sprechen und die Menschen gerecht richten. Dieses „gerecht“ heißt im h. mešarîm. Es klingt wie mîšor, was soviel wie „niedrige Ebene“ bedeutet. Daraus kann man ableiten, dass der Mensch dort, wo er vehement für Gerechtigkeit eintritt, selber bescheiden bleiben soll.
7. »Gott steht auf in der Versammlung der Götter/Elohim, im Kreis der Götter/Elohim hält er Gericht« (Ps 82,1)
Der Kontext ist Gerechtigkeit und Gericht, ein Kontext, der wieder an die Tora zurückbindet und zugleich immer im Begriff Gott als „Elohim“ mitschwingt. Denn der Begriff Elohim wurde von den Rabbinen als Synonym für das richterliche Handeln Gottes verstanden. Gerade der Richter hat
darum Vorbild für den Menschen als unbestechlicher Anwalt der Tora zu sein. Der gerechte Richter ist Gottes Partner bei der Weltschöpfung
(bSchabbat 10a), er lässt die Schekhina auf die Welt herabkommen (bSanhedrin 7a) und strahlt himmlische Licht aus (bBaba Batra 8a).
Besonders Ps 82,1 gibt den Rabbinen Anlass, über den Wert des Richtens nachzudenken. So wird die Schekhina, die Anwesenheit Gottes im
Volk, durch den Psalmvers vor allem in der betenden Gemeinde konkretisiert, und sie verlässt Israel, wenn sich die Menschen ihre eigenen Gesetze geben und von Gottes Geboten abweichen. Dies konkretisiert sich im Verhalten vor Gericht. Nicht mehr das Recht ohne Ansehen der Person,
sondern Verleumdung und Parteinahme prägen das Bild, weshalb die Schekhina sich entfernt (bSota 47b; bSanhedrin 7a; Tan Mischpatim 4). Die
„Götter“ im Psalmvers werden hier (exklusiv22) auf die Richter bezogen. Gottes Anwesenheit ist nur möglich, wenn gerechte Richter wirken, die ein
„wahres“ Urteil ohne Ansehen der Person fällen.23
In Tan Schoftim 7 und TanB Schoftim 6 (15b) erwächst aus dem Psalmvers ein eher allgemeiner Aufruf an die Prozeßparteien, sich in Ehrfurcht zu
benehmen und an die Richter, sich immer so zu verhalten, als sei die Schekhina in ihrer Mitte. Auch tSanhedrin I,9; ySanhedrin I,1,18b und bSanhedrin 6b funktionieren den Vers als Mahnung an die Richter um, die vor Gott Zeugnis geben und dereinst für ihre Prozesse Rechenschaft ablegen müssen.
Tan Beschallach 11 zitiert den Psalmvers unter einer Reihe von Texten, die Gottes Güte, Barmherzigkeit und Wahrhaftigkeit seines Richteramts
ausdrücken. Letztlich sollen sich die Richter wiederum an Gott orientieren.
Menschenrechte und Menschenwürde sind also von den verantwortlichen Rechtspersönlichkeiten zu wahren und zu beschützen. Die Richter erhalten einen überdimensional hohen Status. RutR Pet 1 knüpft an die Auslegung von Ps 82,1 an, wenn es auf die Richter anspielt, die Gott selbst
zu „Göttern“ erhöht habe (Ex 22,27). Wehe also dem Volk, das die Richter verachtet.
Die Richter sind Repräsentanten des göttlichen Wortes in der Praxis. Sie haben die Menschenrechte einzuhalten und umzusetzen. Es verwundert
daher nicht, dass eine der eindringlichsten Passagen zur Menschenwürde in mSanhedrin 4.5 in Überlegungen zur Gerichtsverhandlung eingebettet ist.
22
23
Vgl. eine Reihe anderer Texte, in denen unter Elohim die betende Gemeinde verstanden wird: In Mek Bachodesch 11 (L II 287); mAvot III,6; ARNB 18 und bBerakhot 6a
beweist Ps 82,1, dass Gott in der Synagoge zu finden ist, wenn der Minjan (die Zehn) zusammenkommt. Aufgrund dieses Verses sollen auch nicht weniger als zehn Personen nach PRE 8 den Kalender bestimmt haben. In derselben Mek Bachodesch wird der Text aber auch auf das aus drei Personen bestehende Richterkollegium bezogen
(vgl. MRS 115). DtnR 7.2 lässt keinen Zweifel daran, dass Gott in der Synagoge direkt über dem Betenden steht. yBerakhot V,1,9a möchte näherhin mit dem Psalmvers
und Jes 55,6 begründen, dass das Gebet in den Synagogen und Lehrhäusern erfolgen soll. Vgl. auch TanB Wa-jera 4 (43b) und AgBer 19. In NumR 11.2 und HldR 2.9 §2
c
erwähnt man besonders die Zitation des Schma , bei der Gott über den Israeliten steht, während sie sitzen. Gott steht nicht nur, er steht „bereit, anzunehmen und das Gebet zu beantworten“ (PRK 5.8; PesR 15.9; vgl. GenR 48.7 und NumR 11.2).
Vgl. dazu auch Soferim 4: »Gott steht auf in der Versammlung der Götter« meine eine himmlische Götterversammlung; »im Kreis der Götter hält er Gericht« beziehe sich
aber auf menschliche Richter.
117
Grundkurs Judentum
Menschenrechte
III. Der Mensch und seine Grenzen: Jeder Mensch ist einmalig und wertvoll
In mSanhedrin 4.5 heißt es: „Deshalb wurde der Mensch als einzelner in der Welt erschaffen, um zu lehren, dass man es auf jeden, der eine Person vernichtet, bringt, als ob er die ganze Welt vernichtet hätte. Und auf jeden, der eine Person erhält, bringt man es, als ob er die ganze Welt erhalten hätte. Und (dies) wegen des Friedens der Geschöpfe, damit nicht ein Mensch zu seinem Nächsten sage: Mein Vater ist angesehener als
dein Vater! Und damit die Sektierer nicht sagen: Es gibt eine Menge Gewalten im Himmel!“
Alle Menschen stammen von einem Menschen ab. Dies ist die Grundlage der Gleichheit aller. Selbst in Extremsituationen ist die Würde der
Gleichheit aller Menschen zu achten: Ist denn das Blut eines Menschen röter als das eines anderen? (bSanhedrin 74a; bPesachim 25b; bYoma
82b). Und dennoch sind alle Menschen unverwechselbare Individuen und wertvoll wie eine ganze Welt. Jeder Mensch kann, so heißt es im Text
weiter, von sich behaupten: „Meinetwegen wurde die Welt erschaffen“, weil kein Mensch dem andere gleicht, sie aber doch alle aus dem ersten
Menschen geprägt sind.
1. »Unser Leben währt siebzig Jahre, und wenn es hoch kommt, sind es achtzig. Das Beste daran ist nur Mühsal und Beschwer, rasch geht es
vorbei, wir fliegen dahin« (Ps 90,10)
Der Tod ist natürlicher Teil des Lebens.24 Gott läßt dabei den Menschen im Unklaren über seine konkrete Lebensspanne (Ps 39,5; vgl. bSchabbat
30a). Ps 90,10 nennt 70 bis 80 Jahre als natürliche Lebenszeit. Dies wird von den Rabbinen aufgenommen (bPesachim 94b). bMoed Qatan 28a
unterscheidet verschiedene Todesarten und benennt sie. Der „schönste“ Tod wird Mose und Mirjam zuteil, weil sie durch den Kuß Gottes sterben.
Ein fünftägiger Todeskampf erscheint normal, stirbt jemand schneller, kann man dies entweder als überstürzten Tod oder eben als Zeichen eines
göttlichen Verweises sehen. Stirbt man mit fünfzig Jahren, so wird dies als Strafe Gottes für Vergehen erachtet. Wer mit 60 stirbt, hat die magische
Grenze der Bestrafung durch Gott schon durchbrochen und kann auf einen natürlichen Tod hoffen. Man ist dann in seinem „vollen Mannesalter“
(nach Ijob 5,26). Mit 70 gilt man als „Grauhaar“, mit 80 kommt man ins „Kraftalter“ (geburot). Die verwendeten Begriffe drücken Wertschätzung für
das Alter aus, was schwer ins Deutsche übersetzt werden kann, zumal die herkömmliche Übersetzung für „Grauhaar“ als „Greis“ wesentlich weniger die Anerkennung des Grauhaarigen als Weisen als vielmehr Gebrechlichkeit suggeriert.
bMoed Qatan 28a bringt weiter einige Beispiele von Vorkommnissen, die belegen sollen, dass das Schicksal des Menschen keineswegs immer an
seinem Verhalten hängt, dass Krankheit, Kindersegen und Wohlstand vom Glück und nicht von Gottes Strafe oder Belohnung abhängen (vgl. auch
bChagiga 4b).
In GenR 19.8 überlistet Gott die Engel schon wieder bei der Bestrafung Adams. Nachdem er ihm die Todesstrafe am selben Tag angedroht hatte,
falls er vom Baum der Erkenntnis esse, lässt er ihm nicht einen Menschentag, sondern einen Gottestag zukommen, der 1000 Jahre beträgt. Von
den 1000 Jahren sind wieder 930 für ihn persönlich bestimmt, und 70 sollen seine Kinder, also wir, abbekommen.
Tod und Leiden sind Bestandteile des Lebens. Wie schon die biblischen Autoren versuchen auch die Rabbinen, das Leid des Menschen zu begreifen und in einen religiös-ethischen Kontext zu stellen. Man versucht, Leid im Zusammenhang mit Sünde zu erklären, bleibt in diesem Erklärungs-
24
118
Vgl. auch Ps 144,4 und dazu beispielhaft TanB Wa-jechi 2.(106b).
Grundkurs Judentum
Menschenrechte
versuch angesichts der Erfahrung des Leids Unschuldiger aber nicht stehen und entwickelt verschiedene Antworten.25 Wenn R. Alexandri in
GenR 92.1 feststellt, dass überhaupt niemand existiert, der nicht leidet, spiegelt sich darin eine allgemeine Erkenntnis wider, zum andern aber
auch das Schicksal eines Volkes in Fremdherrschaft.
2. »Bewahre deine Zunge vor Bösem und deine Lippen vor falscher Rede!« (Ps 34,14)
Ein todbringendes Vergehen ist Verleumdung bzw. Verrat. „Wenn ihr vor der Hölle gerettet werden wollt, haltet euch vor der Verleumdung fern,
und ihr seid dieser und der kommenden Welt würdig“ (TanB Mesora 5 23b). Neben Ps 34,13f. wird vor allem auf Ps 12,5 verwiesen. Insgesamt
erscheint das Buch der Psalmen als Buch des Lebens, weil es auf den Umstand aufmerksam macht, dass die Verleumdung dem Menschen Tod
bringt.26 Der Kampf gegen Verrat und Verleumdung stellt nur sehr bedingt eine Einschränkung der freien Rede dar. Er spiegelt vielmehr die Angst
und den notwendigen Selbstschutz vor politischer Verfolgung angesichts eines Lebens unter fremder Herrschaft und zugleich die hohe Achtung
des Rufs eines Menschen wider.
Besonders anschauliche Beispiele für die Wirkung des Verrats sind Doeg und Ahitofel, die David nach den Samuelbüchern verraten haben. Gott
läßt sie beide mit knapp 30 wegen ihrer Verleumdung sterben (vgl. bSanhedrin 106b; DtnR 5.10; LevR 26.2 und PRK 4 (Mandelbaum 56f); NumR
19.2; Tan Chuqqat 4//TanB Chuqqat 7 53ab; Tan Mesora 2//TanB Mesora 4 22b/23a; MidrPss 7.7 34a sowie yPea I,1,16a). In Tan Mesora
2//TanB Mesora 4 (22b/23a) heißt es dazu beispielhaft, dass der Verrat sogar die drei großen Kapitalvergehen übersteigt: „Und Doëg wurde aus
dem Leben dieser Welt entwurzelt und (auch) aus allen Leben der zukünftigen Welt, wie es heißt: »Darum wird Gott dich verderben für immer,
(dich packen und herausreißen aus deinem Zelt, dich entwurzeln aus dem Land der Lebenden)« (Ps 52,7) - aus dem Leben der zukünftigen Welt.
Was ist schwerwiegender: wer mit dem Schwert tötet, oder wer mit dem Pfeil tötet? Sage: Wer mit dem Pfeil tötet. Denn wer mit dem Schwert tötet, kann sein Gegenüber nur töten, wenn er nahe bei ihm ist und ihn trifft. Wer mit dem Pfeil tötet, bei dem ist es nicht so, sondern er schießt den
Pfeil ab und tötet ihn überall, wo er ihn sieht. Deswegen wird [der Verleumder] mit dem Pfeil verglichen, wie es heißt: »Ein tödlicher Pfeil ist ihre
Zunge« (Jer 9,7). Und so sagt sie (die Schrift): »Ich muss mich mitten unter Löwen lagern, die gierig auf Menschen sind. Ihre Zähne sind Spieße
und Pfeile, ein scharfes Schwert ihre Zunge« (Ps 57,5). Sieh, wie schwer die Verleumdung ist - dass sie schwerer (wiegt) als Blutvergießen und
Unzucht und Götzendienst. Von der Unzucht steht geschrieben: »Wie sollte ich da ein so großes Unrecht begehen« (Gen 39,9).Vom Blutvergießen steht geschrieben: »Da sprach Kain zum Herrn: Meine Sünde ist größer, als dass ich sie tragen könnte« (Gen 4,13). Vom Götzendienst steht
geschrieben: »Ach, dieses Volk hat gesündigt« usw. (Ex 32,31). Aber wenn er die Verleumdung erwähnt, sagt er weder `groß´ noch `große(s)´
(Sg.) sondern `große´ (Plural), wie es heißt: »Der Herr vertilge alle falschen Zungen, jede Zunge, die Großes (Pl.) redet.« (Ps 12,4). Deshalb wird
gesagt: »Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge« (Spr 18,21).“
25
26
Vgl. zur rabbinischen Tradition D. Kraemer, Responses to Suffering in Classical Rabbinic Literature, Oxford 1995; Y. Elman., The Suffering of the Righteous in Palestinian
and Babylonian Sources, JQR 80 (1990) 315-339, z.B.: „The Babylonian Talmud ..., on the other hand, in a number of scattered but significant sugyot, propounds the view
that suffering in its widest sense (including poverty, lack or loss of children, and the like) may be undeserved, and this for reasons having nothing to do with collective retribution or vicarious atonement. It may be ascribed to the effects of unfocused divine anger, the exigencies of historical necessity, the hazards of everyday life, astrological
circumstance, original sin, and more“ (316); ders., Righteousness as its Own Reward. An Inquiry into the Theologies of the Stam, PAAJR 57 (1990f) 35-67. Vgl. Stellen wie
Mek Pischa 11 (Lauterbach I 85); bBaba Qamma 60ab; bAboda Zara 4a; yHorajot III,3;47c; LevR 20.2; MidrPss 73; 90.
Vgl. diesbezüglich die Erzählung vom Hausierer und R. Jannaj in Tan Mesora 2//TanB Mesora 5; WaR 16.2; MidrPss 52.
119
Grundkurs Judentum
Menschenrechte
Nach bSanhedrin 103a werden vier Menschengruppen nicht von Gott angenommen: die Spötter, Lügner (Zitat Ps 101,7), Heuchler und Verleumder (Zitat Ps 5,5).
3. »Die Schwachen werden unterdrückt, die Armen seufzen. / Darum spricht der Herr: Jetzt stehe ich auf, dem Verachteten bringe ich Heil« (Ps
12,6)
Das Regelwerk des menschlichen Zusammenlebens ist geprägt von der Weisung der Tora, die einerseits überzeitlich gültig ist, andererseits immer
wieder neu den veränderten Gegebenheiten angepaßt werden muss. Der Mensch ist Gott, seinem Mitmenschen und der gesamten Schöpfung
gegenüber verantwortlich, er hat aktiv für Gerechtigkeit und Frieden einzutreten. So sind auch jene Texte wie z.B. MidrPss 12.2 (u.ö.) zu verstehen, die festhalten, dass auch Gerechte, die angesichts des Unrechts in der Welt nicht protestieren, ja sogar die, welche zwar seufzen und klagen,
aber nicht dagegen aktiv werden, von Gott gestraft werden. Gott, so meint MidrPss 12.3, wird im Gegensatz dazu angesichts der Unterdrückung
der Armen zu besonderer Größe anwachsen, sein Attribut der Gerechtigkeit wird heiß werden und die Unterdrücker, vor allem die ungerechten
Richter, strafen.
Gottes Parteinahme für die Armen, das überreiche biblische Zeugnis einer sozialen und gerechten Gesellschaft haben das Judentum immer wieder angeregt, sich gerade der sozialen Frage mit großem Ernst und Energie zu stellen. Der hohe Wert der Arbeit und des Arbeiters wird in der
rabbinischen Tradition ebenso betont (bBerakhot 8a; bKidduschin 33a u.ö.) wie der der notwendigen Freizeit, die sich an Gottes Willen orientiert.
Es braucht hier keine Debatte über den Sabbat/Sonntag geführt zu werden. Die Vehemenz, mit der rabbinisches Schrifttum auch auf den sozialen
Wert des Sabbat verweist, ist evident. Er ist für den Menschen geschaffen, nicht der Mensch für den Sabbat (bYoma 85b). War auch die Zeitspanne des Arbeitstages von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang (nach Ps 10422f. – bBaba Metsia 83b) in unseren Augen hoch bemessen, schloss
sie dennoch die Nachtarbeit im Regelfall aus. Zudem wurde bereits für den Freitag eine angemessene Vorbereitungszeit auf den Sabbat eingeräumt (yBaba Metsia 7,1,11b). Eine Fülle von arbeitsrechtlichen Bestimmungen muten uns heute modern an und mahnen uns, im Zeichen des
wirtschaftlichen Liberalismus nicht hinter die sozialen Standards der Antike zurückzufallen. Arbeitspausen für Essen und Erfrischung waren ebenso selbstverständlich (bBaba Metsia 86a) wie Zeit für das Gebet (bBerakhot 16a). Weil der Mensch nur Gott allein als Herren hat, ist er auch keinem menschlichen Dienstgeber ausgeliefert. Er kann von sich aus ein Arbeitsverhältnis jederzeit lösen (bBaba Metsia 10a). Lohnregelungen,
Preisfestlegungen durch die Gemeinschaft und die Einrichtung gemeinsamer Versicherungsfonds für den Notfall (bBaba Batra 8b; tBaba Metsia
11,24ff.) sind Wegbereiter für ein Sozialsystem ebenso wie für Gewerkschaften. Die Kommentatoren des Mittelalters haben die Bestimmungen
ausgebaut und erläutert.
Der soziale Einsatz für die Schwachen wird von den Rabbinen grundlegend verankert. Dazu ist natürlich das Stichwort „Tsedaqa“ zu erwähnen. Es
ist die private und öffentliche Wohlfahrt, die den Armen ihre grundlegenden Bedürfnisse zu befriedigen hat. Deshalb wurden bereits in rabbinischer
Zeit Fonds eingerichtet, die sich um die Wohlfahrt, die Auslösung von Gefangenen, die Begräbnisse Bedürftiger und die Unterstützung für die rituellen Bedürfnisse der Armen kümmerten. Ausstattung der Braut, der Witwen und Waisenkinder gehören ebenso hierher wie die Versorgung einer
armen Familie (vgl. insgesamt bKetubbot 67b/68a). Der Traktat Ketubbot regelt beispielsweise vor allem Ansprüche von Frauen und Kindern in
verschiedensten Lebenslagen. Diese Regelungen sind – zumindest auf dem Papier - sehr weitreichend und bestrebt, das Wohlergehen und den
Lebensstandard von Frauen zu sichern. Rechte und Pflichten (vgl. mKetubbot 5,5) werden definiert. Frauen haben laut Tora Anspruch auf Nah-
120
Grundkurs Judentum
Menschenrechte
rung, Kleidung und Geschlechtsverkehr, was ebenfalls in diversen Regelungen ausgefeilt wird.27 Die Spendenfreudigkeit einzelner sollte nach
bKetubbot 50a ein Fünftel des Einkommens nicht übersteigen, da man sonst Gefahr läuft, selbst zu verarmen. Nach bSota 14a sind die Liebeswerke (zu denen Tsedaqa gehört) Anfang und Ende der Tora. Nach tPea 4,19, yPea 1,1,15b, bSukka 49b wiegen Gerechtigkeit und gute Taten
alle Gebote der Tora auf. bMakkot 24a nennt als Beispiele die Ausstattung der Braut und das Hinausführen der Toten. Besonders beispielhaft sind
dort auch die Unterstützung der Verwandten und das Zinsverbot genannt.
Ich will an dieser Stelle schließen, im Bewusstsein, nur wenige Ausschnitte aus der Fülle der rabbinischen Betrachtungen zum Menschenrecht
vorgestellt zu haben. Das Judentum hat uns mit seiner Bibel die Grundlage der Menschenrechte überhaupt hinterlassen. Als immer wieder verfolgte und im Überlebenskampf befindliche Minderheit war gerade die jüdische Identität über die Jahrhunderte hinweg gefährdet. Das Judentum musste einen Weg zwischen Anpassung und Selbstbehauptung hindurch finden, der es in seiner spezifischen Eigenheit am Leben erhielt. Gerade hier
zeigte sich die Botschaft der Tora als überaus hilfreich. Den Rabbinen war das Zusammenleben auf der Basis der Tora die Grundlage der Existenz
überhaupt. Nicht Reichtum, Macht oder Einfluß machen den Wert eines Menschen aus, sondern das „Streben nach religiösem Wissen und geistiger Bildung. Beständiges Lernen, Auslegen und Tradieren effizierten und sicherten dauerhaft die Durchdringung aller Lebensbereiche und aspekte mit dem Geist des Göttlichen und schufen eine Eigengesetzlichkeit - eine Selbst-`Heiligung´/Absonderung durch Gebotserfüllung, die dem
jüdischen Volk - auch über den Verlust von territorialer Souveränität und kultischem Zentrum hinweg, durch die Zeiten und die unterschiedlichsten
kulturellen Rahmenbedingungen der jeweiligen Zufluchtsorte - die Bewahrung einer spezifischen religiösen Identität und somit das weiterer Fortbestehen als eine verwandtschaftliche, schicksalsmäßig verbundene und kontinuierliche Gruppe ermöglicht hat.“28
In modernen Gesellschaften haben die religiösen Werte Umformungen mitgemacht. So stellt Klaus Hödl in der amerikanischen Gesellschaft ein
weitestgehendes Aufgehen der jüdischen Kultur in die amerkanische bei gleichzeitiger signifikanter ethischer Ausrichtung fest. „Über 80% der Judenschaft versagte letzterem (Bush) die Unterstützung und wählte statt dessen Bill Clinton. Dieses Wahlverhalten war keine Ausnahmeerscheinung auf der Liste der Manifestationen der politischen Orientierung der amerikanischen Juden. Franklin D. Roosevelt und sein New Deal stützten
sich in einem besonderen Maße auf die sozial gesinnte amerikanische Judenschaft. John F. Kennedy konnte ebenfalls mit überwältigender Unterstützung durch die Juden rechnen. Juden waren in der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung in einem überproportionalen Maße aktiv, sprechen
sich mehrheitlich für großzügigere Sozialausgaben, die mittels Steuererhöhungen finanziert werden sollen, aus und unterstützen auch andere soziale Belange in einer bemerkenswerten Weise.
Juden weisen ein soziales Engagement auf, wie es von keiner anderen ethnischen Gruppe in Amerika an den Tag gelegt wird... Während andere
weiße Gemeinschaften mit steigendem Wohlstand eine zunehmend konservative Einstellung an den Tag legen und die Republikaner unterstützen,
zeigen Juden in ihrem liberal-sozialen Verhalten eine Beständigkeit, die traditionelle soziale Erklärungen für diese Eigenheit unwirksam werden
läßt... Das soziale Engagement der Juden kann ebenfalls aus traditionellen Werten hergeleitet werden, beispielsweise aus der Bedeutung des
Begriffes `tzedakah´, der Verpflichtung, Menschen in Schwierigkeiten zu helfen. Dieser Wert war eine Überlebensstrategie der Juden im Laufe der
Geschichte und schlägt sich in einem politischen Verhalten nieder... Es hat die jüdischen Immigranten um die Jahrhundertwende ausgezeichnet,
27
28
Vgl. meinen Artikel: Zum Vermögensrecht von Frauen in der Ehe am Beispiel des Mischna- und Tosefta-Traktates Ketubbot, Kairos 34/35 (1992/93) 27-63. Vgl. zum Bereich „Frauenrechte“ vor allem Rachel M. Herweg, Die jüdische Mutter. Das verborgene Matriarchat, Darmstadt 1993.
Herweg, Mutter 87f.
121
Grundkurs Judentum
Menschenrechte
die verarmt in Amerika ankamen und ihr Leben als Hausierer fristen mussten, und charakterisiert auch die dritte Generation, die schon längst den
Aufstieg in das wohlhabende Bürgertum geschafft hat.“29
29
122
Klaus Hödl, Die jüdische Integration in den USA – ein Problem des Erfolgs? Das Jüdische Echo 46 (1998) 208-213, 213.
Grundkurs Judentum
Maimonides
Heinrich und Marie Simon
Moses ben Maimon
Zu den bedeutendsten jüdischen Gelehrten des Mittelalters gehört Moses ben Maimon (1135-1204), auch als Maimonides oder Maimuni bekannt.
Nach den Anfangsbuchstaben seines Namens, Rabbi Moses ben Maimon = RMBM, wird er auch als Rambam bezeichnet. Sein wissenschaftliches Werk hat nicht nur die Entwicklung des Judentums in außerordentlich starkem Maße beeinflußt, sondern auch auf die europäische Scholastik, namentlich auf Albertus Magnus und Thomas von Aquino eingewirkt.
Maimonides sah es als seine Aufgabe an, aristotelische Philosophie und Offenbarungsreligion zu einer Synthese zu bringen, und zwar nicht auf
dem Wege der weitgehenden Identifizierung, wie es Abraham ibn Daud letztlich erfolglos versucht hatte, sondern durch die Abgrenzung des wissenschaftlich Erweisbaren von demjenigen, das als Offenbarung hingenommen werden muß.
[...]
Über das Leben des Maimonides sind wir relativ gut informiert, besser als über das der anderen jüdischen Denker des Mittelalters. Er wurde in
Cordova geboren und entstammte einer vornehmen und einflußreichen Gelehrtenfamilie. Sein Vater war Mitglied des Rabbinatskollegiums und hat
sich durch eine Reihe wissenschaftlicher Werke einen Namen gemacht. Als im Jahre 1148 Cordova in die Hand der vor allem gegen Andersgläubige intoleranten Almohaden fiel, verließ die Familie die Stadt und hielt sich einige Jahre in verschiedenen Orten Spaniens auf. Gegen 1159 siedelte sie dann nach Fes in Nordafrika über. Da auch diese Stadt zum Herrschaftsbereich der Almohaden gehörte, ist es nicht klar, warum die Familie des Maimon sich gerade dorthin wandte, denn die Verhältnisse dürften in Fes im Prinzip kaum günstiger gewesen sein als in Spanien. Für
die Ansicht, die Familie habe zum Schein den Islam angenommen, gibt es keine Beweise. [...]
Die Familie des Maimon hat die Konsequenz gezogen, allerdings erst einige Zeit später: 1165 verließ sie Nordafrika und segelte nach Akko. Nach
kurzem Aufenthalt in Palästina nahm sie dann in Fustat (Altkairo) ihren ständigen Wohnsitz. In Ägypten, das damals unter der Herrschaft der Fatimiden stand, war die Lage der Juden günstiger; die persönliche Situation des Maimonides jedoch wurde bald schwierig. Der Vater starb kurz nach
der Ankunft in Ägypten, und nicht viel später kam der jüngere Bruder des Maimonides, der durch einen Juwelenhandel die Familie erhielt, auf einer
Geschäftsreise nach Indien bei einem Schiffbruch ums Leben. Bis dahin hatte sich der Denker ausschließlich seinen Studien widmen können, nun
mußte er danach trachten, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. So begann er, als Arzt tätig zu sein. Im Gegensatz zum christlichen Europa stand
ja im arabischsprachigen Raum die Medizin im engen Verhältnis zur Philosophie, und der Erwerb medizinischer Kenntnisse gehörte zur philosophischen Ausbildung, so daß Maimonides entsprechende theoretische Kenntnisse besaß, die er nun praktisch anwenden konnte.
Er war als Arzt sehr erfolgreich und brachte es schließlich bis zur Position eines Leibarztes am Hof der Ajjubiden, die das Fatimidenkalifat beseitigt
hatten (1171) und Ägypten de facto souverän beherrschten. Auf Grund seines großen talmudischen Wissens nahm Maimonides außerdem eine
führende Position innerhalb der jüdischen Gemeinschaft in Ägypten ein und wurde später auch offiziell das geistige und politische Oberhaupt der
ägyptischen Juden, so daß er eine sehr große Arbeitslast zu bewältigen hatte. Er starb in Fustat (1204); seine Leiche wurde nach Tiberias in Palästina gebracht, wo sein Grab heute noch erhalten ist.
Die Werke des Maimonides lassen sich grob in drei Hauptgruppen einteilen:
seine Arbeiten auf talmudischem Gebiet, seine philosophischen Schriften und seine medizinischen Abhandlungen. Damit ist das Arbeitsgebiet des
Maimonides nur sehr ungenau umrissen, wenn man nicht berücksichtigt, daß zur Philosophie im mittelalterlichen Sinne auch die gesamte Naturwissenschaft gehört und daß die Verzweigtheit des talmudischen Stoffes den auf diesem Gebiet Tätigen auf Themen aus allen Lebensbereichen
123
Grundkurs Judentum
Maimonides
führen kann. Uns mögen diese drei Hauptarbeitsgebiete des Maimonides als äußerst heterogen erscheinen; für Maimonides selbst jedoch besteht
zwischen ihnen ein sehr enger Zusammenhang. Die Grundlage des Lebens der Menschen sind die Satzungen, die für die Juden ihre Kodifizierung
im Talmud gefunden haben. Folglich befaßt sich die Arbeit des Maimonides auf talmudischen Gebiet im Grunde mit der Reglementierung des Lebens des einzelnen und der Gesellschaft, also mit letztlich ethischen Fragen. Die philosophischen Schriften des Maimonides beschäftigen sich mit
dem Sinn und Zweck der Gesetze; sie geben die rationale theoretische Begründung für die Verbindlichkeit der rechtlichen Normen. Die Medizin
erhält bei Maimonides eine ethische Fundierung und wird dadurch in seine philosophische Gesamtkonzeption einbezogen. Da das Übel in der
Welt etwas Negatives ist und die gottgewollte Harmonie der Welt stört, hat der Mensch die Aufgabe, durch den Kampf gegen das Übel an der
Verwirklichung der göttlichen Absicht mitzuwirken. Auf diese Weise wird der Kampf gegen die Krankheit, und vor allem auch die Erhaltung der Gesundheit, zur religiösen Pflicht. [...]
Noch während seines Aufenthaltes in Spanien begann Maimonides, in arabischer Sprache einen Kommentar zur Mischna, der mündlichen Lehre,
zu verfassen, den er im Jahre 1168 in Ägypten zum Abschluß brachte. Dieser Kommentar, dessen hebräische Übersetzung vielen Mischnaausgaben beigedruckt ist, zeichnet sich durch das Bemühen um eine Systematisierung des Stoffes aus. Maimonides liebt es, die allgemeinen Regeln
und Grundsätze jeweils zusammenzufassen und geordnet darzustellen. Das geschieht besonders in den Einleitungen, die er dem ganzen Werk
und der Behandlung einzelner Mischnatraktate voranstellt. Unter philosophischem Aspekt sind besonders die "Acht Kapitel" von Interesse, die Einleitung zum Traktat Awot, den "Sprüchen der Väter", einer Sammlung von Sentenzen jüdischer Schriftgelehrter. In dieser Einleitung bietet uns
Maimonides einen Abriß seiner Ethik, deren Aufgabe es sei, die Eigenschaften des Menschen zu veredeln und seinen Charakter zu vervollkommnen. Er behandelt in diesem Zusammenhang auch die menschliche Seele und ihre Kräfte, die Frage der menschlichen Willensfreiheit, die Prophetie und die Gotteserkenntnis als Ziel des menschlichen Daseins.
Auch das religionsgesetzliche Hauptwerk des Maimonides, der hebräisch geschriebene Mischne Tora, zeigt das Bemühen, Lehren der Religion
mit dem Stand der Wissenschaft zu harmonisieren, und ist darum in philosophischer Hinsicht ebenfalls wichtig. Der im Jahre 1180 abgeschlossene
Mischne Tora - der Titel ist dem Bibeltext entnommen, und die Septuaginta übersetzt die Worte mit "Deuteronomion" - ist ein Talmudkompendium,
das den gesamten gesetzlichen Lehrstoff zusammenfaßt und systematisiert. Die literarische Anlage des Talmuds, in dem den Lehrsätzen der
Mischna, der mündlichen Lehre, sich jeweils die Diskussionen der Gelehrten, die Gemara, anschließen, machen dieses Werk außerordentlich unübersichtlich, da sich die Diskussionen oft weit von den Problemen entfernen, von denen sie ausgehen. Daher erscheinen Rechtsentscheidungen
der Gelehrten häufig in Zusammenhängen, wo sie nicht zu erwarten sind. Da jedoch der Talmud die Grundlage des gesamten Rechts bildete und
der Richter aus ihm seine Entscheidungen abzuleiten hatte, waren äußerst subtile Kenntnisse erforderlich, die nicht immer ohne weiteres vorausgesetzt werden konnten. Maimonides begründet die Notwendigkeit seines Werkes mit dem Rückgang der rabbinischen Bildung und stellt darum
die dem Talmud zu entnehmenden juristischen Entscheidungen nach sachlichen Gesichtspunkten und infolgedessen übersichtlich zusammen. Der
Intention nach um faßt der Mischne Tora alle Vorschriften des Judentums. [...]
Nicht nur durch die systematische Zusammenfassung des Zusammengehörigen unterscheidet sich der Kodex des Maimonides von der talmudischen Darstellungsweise, sondern auch dadurch, daß der Verfasser nur die Ergebnisse der talmudischen Diskussionen bietet und abweichende
Ansichten der Gelehrten unberücksichtigt läßt. Da es indessen im Talmud nicht nur klare Entscheidungen gibt, sondern vielfach die Festlegungen
verschiedene Auslegungsmöglichkeiten offenlassen, ist die Tatsache, daß Maimonides Entscheidungen fällt, ohne anzumerken, worauf sich diese
stützen, bereits bei seinen Zeitgenossen auf Kritik gestoßen.
124
Grundkurs Judentum
Maimonides
Maimonides hat den Talmud nicht nur systematisiert, er hat ihn auch modernisiert, indem er alles das übergeht, was seiner Meinung nach vom
Standpunkt der Wissenschaft nicht mehr haltbar ist. Dazu gehören Lehren und Schlußfolgerungen, die auf dem Glauben an Dämonen beruhen,
und astrologische Anschauungen, die die Menschenschicksale von Gestirnkonstellationen abhängig machen. Ebenso ließ er solche Lehren aus,
die den seit der talmudischen Zeit erheblich gewachsenen medizinischen Kenntnissen widersprachen. Statt dessen nutzt er die naturwissenschaftlichen Kenntnisse seiner Zeit und baut sie in sein Werk ein. Daher ist der Mischne Tora nicht nur eine Zusammenfassung der bereits vorliegenden
talmudischen Vorschriften, sondern das Werk steht auch gleichzeitig auf der Höhe der Wissenschaft der Zeit, indem es sich griechischer Wissenschaft und griechischer, und zwar aristotelischer Philosophie bedient. Das Vorgehen des Maimonides ist wie das Wirken jedes Reformers heftig
angegriffen worden und hat auf der anderen Seite auch leidenschaftliche Befürworter gefunden. Der Autor selbst rechtfertigte sein Vorgehen einmal in einem Brief mit den Worten: "Die Augen sind vorne und nicht hinten."
Seine Absicht, die rechtlichen Vorschriften des Talmuds mit dem neuesten Stand der Wissenschaft zu verbinden wird in seinem Religionskodex
vor allem daran sichtbar, daß er das erste Buch dieses aus 14 Büchern bestehenden Werkes zunächst den Problemen der Physik und der Metaphysik widmet, das infolgedessen eine Art religionsphilosophisches Lehrbuch darstellt. Der Autor sammelt und systematisiert in diesem "Buch der
Erkenntnis" genannten ersten Buch seines Religionskodex Mischne Tora nicht nur dasjenige, was sich an philosophischen Gehalten verstreut im
Talmud findet, sondern bringt vieles, was im Talmud nicht nur nicht enthalten, sondern ihm auch nicht gemäß ist. Da das Judentum eine Gesetzesreligion ist, geht es bei einer Kodifizierung weniger um weltanschauliche Lehrmeinungen als um die Reglementierung des Handelns. Daher ist es
zunächst nicht ohne weiteres ersichtlich, warum Physik und Metaphysik in diesen Rahmen gehören. Besonders betrifft das den Bereich der Physik, die ganz im Sinne der aristotelischen Philosophie von Maimonides behandelt wird. Er findet aber einen Weg, diese dem Judentum ursprünglich fremden Anschauungen als Voraussetzung für die Rechtsvorschriften sinnvoll einzubauen, indem er die Physik ethisiert. Maimonides knüpft
sie an das Gebot der Gottesliebe und der Ehrfurcht vor Gott: Nur wenn wir das Weltall betrachten, können wir zur Liebe Gottes gelangen, denn
aus der Ordnung der Welt, aus dem Verständnis ihres Aufbaus und ihres Funktionierens wird uns Gottes Weisheit bewußt, die uns dazu bringt,
Gott zu lieben. Ebenso erwächst in uns, wenn wir unser kleines Ich dem großen All gegenüberstellen, ein Gefühl der Ehrfurcht Gott gegenüber.
Die Behandlung der Metaphysik, besonders des Problems der Gotteserkenntnis, erklärt sich durch die rationalistische Einstellung des Maimonides, daß die Liebe zu Gott aus der Gotteserkenntnis resultiere. Auch Probleme der Ethik werden im ersten Buch des Mischne Tora behandelt.
Obwohl die Grundlegung der Ethik auf der Religion beruht, hält sich Maimonides im einzelnen weitgehend an die Nikomachische Ethik des Aristoteles. Er übernimmt die Aristotelische Einteilung der Tugenden in ethische und dianoetische und erkennt den letzteren wie Aristoteles den Vorrang
zu. Die Aristotelische Definition der Tugend als Mitte zwischen zwei Extremen findet Maimonides bereits in der Bibel, indem er den Satz "Richte
gerade das Geleise deines Fußes" (Sprüche 4,26) im Sinne des Wägens versteht, bei dem die Wagschalen ins Gleichgewicht gebracht werden.
Der Einbau philosophischer Lehren in ein religionsgesetzliches Werk machen den Mischne Tora zu etwas unerhört Neuartigem, so daß sich schon
zu des Maimonides Lebzeiten der Kampf der Orthodoxie gerade gegen das erste Buch dieses Kodex richtete.
Als das [...] bedeutsamste Werk des Denkers gilt sein "Führer der Unschlüssigen", der gegen 1190 vollendet wurde. Das in arabischer Sprache
geschriebene Buch, dessen Originaltitel "Leitung der Ratlosen" lautet, wurde bereits zu Lebzeiten des Maimonides von Samuel ibn Tibbon, der in
der Provence lebte, ins Hebräische übertragen. [...] Wenig später wurde durch den Dichter Jehuda Alcharisi eine zweite Übersetzung des "Führers" hergestellt, die sich von der des Samuel ibn Tibbon durch größere sprachliche Eleganz, aber geringere Genauigkeit unterscheidet. Sie ist
insofern zu philosophiehistorischer Bedeutung gelangt, als sie, nicht aber die Übersetzung des Samuel ibn Tibbon, zur Grundlage der lateinischen
Version wurde, aus der die europäische Scholastik ihre Kenntnis der Lehren des Maimonides bezogen hat. [...]
125
Grundkurs Judentum
Maimonides
Die Aufgabe, die sich Maimonides im "Führer der Unschlüssigen" stellt, ist die Leitung derer, die sich nicht entscheiden können, welchen Weg sic
einschlagen sollen, die zwischen demjenigen schwanken, was die religiöse Überlieferung vorschreibt, und dem, was die Ratio, das philosophische
Denken für wahr erkennt. Es geht dem Autor also um das für das Mittelalter zentrale Problem des Verhältnisses von Glauben und Wissen. Das ist
eine durchaus philosophische Fragestellung, trotzdem aber ist es schwer, den "Führer" ein philosophisches Werk zu nennen.
Die Absicht des Maimonides ist im Grunde theologisch: Das heißt aber nicht, daß er die Bedeutung der Philosophie bestritten hätte. Wenn sie
auch nach seiner Meinung als Gesamtsystem zur Erklärung der Welt unzureichend sei und ihre Behauptungen nicht beweiskräftig seien, so akzeptiert er sie dort, wo ihre Beweise stichhaltig sind. Insoweit Aristoteles für die Erklärung bestimmter Probleme stringente Beweise geliefert hat,
macht sich Maimonides diese zu eigen, und in diesem Sinne ist er als Aristoteliker zu bezeichnen, weil der Aristotelismus als Philosophie die richtige ist. [...]
Der "Führer der Unschlüssigen" ist im Gegensatz zu den anderen Werken des Autors nicht für eine breite Öffentlichkeit bestimmt, sondern richtet
sich an eine intellektuelle Elite, die durch die Kenntnis der Wissenschaften in Konflikt mit den biblischen Anschauungen gekommen ist. Maimonides geht es darum, diesen Personenkreis dazu zu befähigen, den Bibeltext nicht in seinem äußeren Wortsinn zu verstehen, sondern die Geheimnisse des Gesetzes, den eigentlichen Sinn und die richtige Interpretation der Offenbarungslehren zu erfassen. Unter Geheimnissen der Bibel sind
im wesentlichen zwei Problemkomplexe zu verstehen, die Lehre vom Schöpfungswerk und die Lehre vom göttlichen Thronwagen, im Anschluß an
die Vision des Propheten Ezechiel. Beide Themen wurden bereits in talmudischer Zeit diskutiert, doch stellten sie eine Geheimlehre dar und durften nicht vor einem breiteren Publikum behandelt werden. [...]
Maimonides identifiziert die Thematik der Schöpfung mit dem Gegenstand der Physik, die theosophische Spekulation mit dem der Metaphysik, er
behandelt also in seinem "Führer" Fragen der Metaphysik und Prinzipien der Physik, wobei er aber das beiseite läßt, was seiner Meinung nach der
Aristotelismus bewiesen hat, und sich auf Probleme beschränkt, die darüber hinausgehen.
Um das talmudische Verbot nicht zu verletzen, über Physik und Metaphysik in der Öffentlichkeit zu handeln, schickt Maimonides dem Werk einen
Brief an seinen Schüler Josef ben Jehuda voraus, so daß die Fiktion aufrechterhalten wird, der "Führer" sei nur für eine Person bestimmt. Auch
hält sich Maimonides an die Vorschrift, nur die Hauptpunkte mitzuteilen, und überläßt es dem entsprechend vorgebildeten Leser, aus Andeutungen
den Sinn zu erfassen. Dadurch ist der "Führer" ein nicht leicht lesbares Buch [...]
Das System, das Maimonides aufgebaut hat, um den Schwankenden den Weg zu zeigen, wie sie, ohne ihre Traditionen aufzugeben, im Sinne der
Zeit wissenschaftlich gebildet sein konnten, ist seinem Wesen nach eine Synthese, die einen Ausgleich zwischen zwei im Grunde heterogenen
Elementen zu schaffen sucht. Dieser Ausgleich ist dadurch möglich, daß Maimonides strikt die irdische Welt vom Bereich des Übersinnlichen
scheidet und der Vernunft soweit Raum gibt, wie ihre Möglichkeiten gehen, unanfechtbare Beweise zu liefern. Der Autor ist bereit, jeden Gedanken
und jede Meinung vorurteilslos zu prüfen und jedes traditionelle Denkschema aufzugeben, sofern beweiskräftige Gegengründe vorhanden sind. So
modifiziert er von den Offenbarungslehren des Judentums her den Aristotelismus und schränkt seine Geltung ein, die Religion wird von ihm jedoch
rational systematisiert und zu einer Art philosophischem System gemacht. Maimonides versteht das Judentum als ein rationales Gebäude, in dem
sich Glauben und Wissen ergänzen. Er teilt nicht die Ansicht der arabischen Aristoteliker, daß die Philosophie und die Religion zwar dieselbe
Wahrheit aussprechen, diese aber nur von der Philosophie klar formuliert werde, so daß der Glaube gegenüber dem Wissen abgewertet wird, das
Wissen jedoch nur wenigen zugänglich ist. Auf der anderen Seite ist für Maimonides die Vernunft auch nicht eine bloße Vorstufe des Glaubens,
sondern er sucht Glauben und Wissen in der Weise zu verbinden, daß das Geglaubte Aufgabe der Erkenntnis sein müsse, daß der unreflektierte
Glaube Vorstufe der Erkenntnis sei. Dabei hat aber die Philosophie dort ihre Grenze, wo die Möglichkeit stringenter Beweise aufhört. Dem philosophischen Denken wird einerseits das Recht der Spekulation verwehrt, andererseits wird ihm der Bereich des Beweisbaren uneingeschränkt frei126
Grundkurs Judentum
Maimonides
gegeben. Auf diese Weise vermeidet Maimonides eine antithetische Gegenüberstellung von Glauben und Wissen und befreit die Philosophie insofern aus ihrer sektenhaften Rolle, die sie in der arabischen Gesellschaft spielte, als er die Allgemeinheit nicht prinzipiell von der richtigen Erkenntnis, von der philosophischen Interpretation der Offenbarungslehren ausschließt, sondern im Gegenteil es zur religiösen Pflicht aller macht, zu einer
philosophisch geläuterten und rational verstandenen Religion zu gelangen. [...]
So hat Maimonides nach beiden Seiten Konzessionen gemacht, indem er sowohl die Philosophie als auch die jüdische Religion umgestaltet und
radikal umgebogen hat. Seine Synthese ist letztlich nur auf dem Wege des Kompromisses möglich, und in gewisser Weise gehört Maimonides
selbst zu den Schwankenden, deren Führer sein Werk sein wollte. Als religiöser Reformer war er radikal: Ohne Sentimentalität, dabei aber durchaus des Wertes der Tradition eingedenk, stand er mit kritischem Verstand der historisch gewordenen Gestalt der Religion gegenüber. Auf die weitere Entwicklung des jüdischen Denkens hat sein Werk außerordentlich befruchtend gewirkt, weil in der Folgezeit niemand an dem von Maimonides aufgeworfenen Problem vorbeigehen konnte, wie man die gesicherten Ergebnisse der Wissenschaft akzeptieren kann, ohne die eigene Tradition preiszugeben. Der Denker hat mit sicherem Blick erkannt, daß der Kern der jüdische Religion, den es auf jeden Fall zu bewahren gilt, die Beziehung des Menschen zur Tora und die damit gegebene Ausrichtung auf Gott ist, und hat sich nicht gescheut, alle Bestandteile des Judentums,
die dem Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis nicht entsprechen, in einer Weise zu interpretieren, die auch vom Standpunkt der Wissenschaft
unanfechtbar war.
Das Vorgehen des Maimonides, der philosophisches Den ken zu einer religiösen Pflicht macht und der das Judentum als eine Vernunftreligion
versteht und es entsprechend aus- und umbaut, hat ebenso leidenschaftliche Zustimmung als auch Ablehnung gefunden. Die Vertreter der Orthodoxie bekämpften vor allem den "Führer" und das erste Buch seines Religionskodex Mischne Tora, weil ihnen die philosophische Fundierung der
Offenbarung als gefährliche Neuerung erschien. Das rationale Element gewinnt im System des Maimonides ein so starkes Übergewicht, daß letztlich der Glaube dem Verstande unterworfen wird; zugleich aber werden dem Verstand Schranken gesetzt, die dem Bestand der Religion garantieren sollen. Die Auffassung, daß das Judentum eine Vernunftreligion sei, verbindet sich für die Folgezeit mit Wirkung und Autorität des Maimonides.
[...]
Die Bedeutung des Maimonides liegt vor allem in seiner systematisierenden Leistung. Er hat den Grundstein dafür gelegt, daß sich das Judentum
in einer Weise verstehen ließ, die es ermöglichte, die jüdische Tradition dem wissenschaftlichen Fortschritt und dem jeweiligen Erkenntnisstand
unschwer zu akkommodieren.
Nicht nur auf die weitere Entwicklung des Denkens im Judentum hat Maimonides einen wesentlichen Einfluß ausgeübt, sondern die Wirkung seiner geistigen Leistung ist auch im Bereich der christlichen europäischen Scholastik in starkem Maße spürbar. Als sich teils auf Grund der Übersetzungen aus dem Arabischen, teils auch durch direkt aus dem Griechischen stammende Übertragungen die Kenntnis der Philosophie des Aristoteles im christlichen Europa ausweitete, stand die Kirche vor der Aufgabe, sich mit dem Problem des Verhältnisses von Glauben und Wissen auf der
Basis des neuen philosophischen Materials und seiner arabischen Interpretationen erneut auseinanderzusetzen. Auf die Einbeziehung des Aristotelismus in die religiösen Lehren des Abendlandes ist das Werk des Maimonides - auch dort, wo seine Lösungen nicht unbedingt akzeptiert wurden - von maßgeblichem Einfluß geworden.
127
Grundkurs Judentum
Kabbala
Vielerlei Möglichkeiten gibt es, ein Thema wie das Verhalten gegenüber Juden in der Geschichte zu betrachten. Eine Betrachtung der wirtschaftlichen Interessen liefert wichtige Einblicke in die Judenpolitik der Herzöge, eine politische Betrachtung wiederum fördert die komplexen Verflechtungen im Zusammenhang mit dem Kampf gegen die Hussiten zutage, eine soziologische Betrachtung erhellt den Lebensstandard der Menschen und
eine monetäre Betrachtung zeigt die Folgen der herrscherlichen Zinspolitik auf. Alle Komponenten zusammen erst aber ergeben ein Bild der
schwierigen Situation des Judentums in Europa, einer Situation, die maßgeblich geprägt ist vom christlichen Erbe. Dieses christlich-religiöse Element der Betrachtung greift manchmal in den historischen Untersuchungen zu kurz, wohl, weil viele Historiker wenig mit Theologie zu tun haben
(wollen). Die christlichen Theologen wiederum haben lange Zeit den Umgang mit dem Judentum entweder vernachlässigt oder das Thema marginalisiert. Die Kirchengeschichte konzentrierte sich auf eine Betrachtung der Papsthistorien oder einer Erörterung der Entwicklung kirchlicher Lehren und Dogmen. Zudem lag ihr die Auseinandersetzung mit innerchristlichen Spaltungen näher als die Beschäftigung mit dem Judentum. Mitunter
haben sogar eher Nichttheologen wie der große Friedrich Heer wichtige Impulse hinterlassen, denen nur zaghaft nachgegangen wurde. Vor allem
der überaus fleißigen Arbeit des Münsteraner Professors Heinrich Schreckenberg ist es zu verdanken, daß die christlichen Kirchenlehrer aller
Jahrhunderte auf ihre Haltung gegenüber dem Judentum befragt wurden. Sein dreibändiges Werk über die christlichen Adversus Judaeostexte
erhellt eine erschreckend konsequenten Linie des Antijudaismus. Sie findet eigentlich erst nach der Schoa Widerspruch, in der katholischen Kirche
mit dem 2. Vatikanum und den Folgedokumenten. Ich will nicht auf die Frage eingehen, ob die Versuche ausreichen, wieweit der christliche Antijudaismus mit dem Antisemitismus der Nazis zusammenspielte und wie erst zögerlich auch in der breiten kirchlichen Öffentlichkeit eine andere
Theologie gegenüber dem Judentum entwickelt wird. Ich will vielmehr versuchen, die Zeit stehen zu lassen um 1420/21 und zu zeigen, wie Juden
in dieser Umwelt leben konnten, welche religiösen Überlegungen das Christentum bestimmten und wie diese die Tragödie des Wiener Judentums
zur Folge hatten. Lassen Sie mich vorerst stichwortartig die politischen Ereignisse vor 1420 kurz darstellen:
Die Lage der Juden vor 1420
Juden dieser Zeit unterstanden dem sog. Judenrecht. Das meint jene Satzungen, die Juden von Kaisern oder Landesherrn erteilt wurden. Ursprünglich hatten nur Kaiser oder Könige dieses Recht als unmittelbare Herrn über die Juden, Satzungen für sie zu erlassen. Doch nahmen es im
Zuge erfolgreicher Zurückdrängung der Kaisermacht durch die Landesfürsten immer mehr auch die Herzöge für sich in Anspruch. Im Jahre 1244
erließ der österreichische Herzog Friedrich der Streitbare ein Privileg, in dem er die Judenpolitik für Österreich regelte. Aus ihm geht deutlich hervor, welche Rolle dem Judentum von einem christlichen Herrscher zugewiesen wurde: Juden sollten in erster Linie den Adel mit Darlehen versorgen. Die wirtschaftlichen Voraussetzungen waren also klar. Juden sollten dem Herzog Geld bringen. Er nahm sie aus der Zuständigkeit des kaiserlichen Kammergutes heraus und eignete sich als Landesfürst seine Juden an. Von den 30 Artikeln des Privilegs beziehen sich 22 auf pfandrechtliche und strafrechtliche Fragen, was ihre Wichtigkeit aufzeigt. Als Gegengeschäft für finanzielle Hilfe gewährte der Herzog Schutz von Leib und
Gut, vor Zwangstaufe, Handelsrechte und die Einsetzung eines christlichen Judenrichters. Juden brachten also Darlehen für den Adel, zu Zinssätzen von etwa 10 Prozent auf längerfristige Anleihen, von 8 Pfennigen vom Pfund für die Woche auf kurzfristige. Da diese Kredite wie gesagt kurzfristig waren, kann man sie auch nicht aufs Jahr aufrechnen. Eine Berechnung von etwa 170% Jahreszinssatz verfälscht, zeigt aber dennoch auf,
daß hier Konflikte vorprogrammiert waren, Konflikte, die die herzögliche Politik, nicht die Juden in ihrer unfreien abhängigen Stellung zu verschulden haben. 1338 senkte man in Wien den Zinssatz auf 60%, um Ausschreitungen im Zuge des Vorwurfs der Hostienschändung von Pulkau zu
vermeiden.
128
Grundkurs Judentum
Kabbala
Die meisten Juden, die in jener Zeit in Wien lebten, so wissen wir aus den Quellen, stammten wohl aus Bayern, aus der Nähe von Regensburg,
und sie wohnten, nachdem die herzogliche Burg an den Standort der jetzigen Hofburg übersiedelte, vornehmlich im Bereich der alten Burg Am
Hof, wo man ihnen Häuser überließ. Bäder, Spital und Fleischhof gehörten ebenso zum Bestand der funktionierenden Gemeinde wie die Synagoge. Ab den sechziger Jahren des 13. Jh. wirkte in der Stadt ein gewisser Isaak ben Mose. Er war in Paris erzogen worden und galt als hervorragender Rechtsgelehrter. Seine Gutachten brachten ihm so reichen Ruhm, daß er den Namen eines seiner Werke erhielt, Or Zarua, zu Deutsch
„die Saat des Lichts“. Dieser Name sollte nun auch das gewaltige Gotteshaus prägen, das auf dem heutigen Judenplatz 8 entstand. Der Bau wurde in drei Entwicklungsphasen vollendet, deren erste, ein Gebetsraum für Männer (Männerschul) und ein breiter Raum schon um 1294 bestand.
Die dritte Stufe schließlich umfaßte eine immerhin über 450 stehenden Menschen Platz bietende Männerschul, eine Frauenschul, einen Eingangsraum, Toraschreine und eine sechseckige Bima (Pult zum Vortragen der Tora) mit einem Baldachin und einer steinernen Brüstung. Der Ausbau
der Synagoge war nach starker Zuwanderung notwendig geworden. So gab es in den 60er Jahren des 14. Jhs. etwa 800-900 Juden in der Stadt,
was einem Bevölkerungsanteil von rund 5% entspricht. Die Zuwanderung war durch den Herzog begünstigt worden, der Juden als Geldleiher
brauchte, nachdem ihm die Vergabe von Bankprivilegien an Wiener Bürger durch den Kaiser verwehrt worden war. So waren es Juden, die Wien
im 14. Jh. am wirtschaftlich-finanziellen Leben erhielten. Ein bekannter Name unter den jüdischen Großfinanziers ist David Steuss. Seine Schwiegersöhne Abraham Klausner und Meir-ha-Levi gehen als große Gelehrte in die Annalen ein. Sie und noch mehr ihre Frauen betrieben auch große
Geldgeschäfte. Daneben betrieb man Pfandgeschäfte, Kleinhandel und Grundstücksgeschäfte. Doch zahlten die Wiener Juden auch umfassend
ordentliche und außerordentliche Steuern, die gegen Ende des 14. Jhs. bald unerträglich wurden. Anläßlich eines dreitägigen Brandes in der Stadt
kam es 1406 zu massiven Plünderungen mit einem Schaden von 100.000 Pfund. Die Geschäftseinnahmen sanken in dieser Zeit rapid, während
der moralische und finanzielle Druck stieg.
Zugleich mischten sich in die finanziellen Schwierigkeiten auch politische Anschuldigungen, den Feinden der katholischen Kirche, den böhmischen
Hussiten freundlich gesinnt zu sein. Während die Hussiten ihrerseits angeblich Lieder jüdischer Rabbiner sangen und den Wert der Bibel hoch
hielten, zeigten viele Juden offene Sympathie für diese Minderheit. Am 9. September 1419 wurde die theologische Fakultät mit den Anschuldigungen befaßt und kam zum Schluß, daß Juden mit Waldensern und Hussiten gemeinsame Sache machten und Waffen lieferten, warf den Juden aber zugleich vor, lästerliche Literatur zu besitzen, in Luxus zu leben und sich über Gebühr zahlenmäßig auszubreiten.
Albrecht V. war 1411 für großjährig erklärt worden und hatte sich sogleich bemüht, neue Judensteuern einzutreiben. Er deckte damit nicht nur die
Kosten des neuen Hofes sondern auch die Fertigstellung des Stephansturms. Juden waren den Herrschern auf Gedeih und Verderb ausgeliefert.
Zwar durften sie Geld verleihen, und – wie gesagt, zu einem ansehnlichen Zinsfuß – doch konnte der Herzog jederzeit sog. Tötbriefe ausstellen,
mit denen er gegenüber Günstlingen Darlehen bei Juden für gestrichen erklärte. Ebenso sah das Recht vor, daß Frauen nicht für die Schulden
ihrer verstorbenen Männer hafteten. Im Zuge der Hussitenkriege kamen viele Männer ums Leben, was zahlreiche Einbußen für die jüdischen
Geldgeber brachte. Juden mußten Leute des Hofstaates auf ihre Kosten einquartieren und Betten, Bettzeug, Geschirr und Utensilien für das Gefolge bereitstellen, ja sie wurden sogar gezwungen, Geschenke an Bischöfe und geistliche Würdenträger zu Weihnachten und Neujahr zu schicken. Doch alle politischen Erklärungen, jeglicher Hinweis auf Interessen und Willkür der Herrschenden läßt letztlich das eigentliche Drama der
Judenverfolgung unbeantwortet, deren Wurzel viel tiefer liegt, nämlich in der Ablehnung und Ausgrenzung des Judentums durch das Christentum.
Diesem Umstand will ich in der Folge nachgehen und zu zeigen versuchen, warum der Tod der Juden in der Wiener Gesera letztlich Ergebnis der
christlichen Theologie und Politik ist.
Die Juden als geduldete Feinde und „Gottesmörder“
129
Grundkurs Judentum
Kabbala
Von Beginn der Ausbreitung des Christentums an setzte sich in der Theologie tief die Enttäuschung fest, daß jenes Volk, aus dem Jesus von Nazaret stammte, in seiner großen Mehrheit nicht bereit war, ihn als Erlöser des Judentums und der Welt, zu betrachten. Und kaum ein Vorwurf war
tiefgreifender und folgenschwerer als der, daß die Juden Verantwortung für den Tod des Messias trugen. Dieser Jesus Christus wird im Zuge der
christlichen theologischen Reflexion zur zweiten göttlichen Person, was den Vorwurf noch verstärkt: Juden haben Jesus, sie haben damit Gott
selbst getötet. Das Wort des Matthäus in 27,25, wonach die Juden vor Pilatus geschrien hätten, „sein Blut komme über uns und unsere Kinder“
wurde als Selbstverfluchung gedeutet. Stellvertretend für die christliche Theologie kann ein Zitat des großen Kirchenlehrers Hieronymus gelten:
Das Beispiel Hieronymus
„Viele Verbrechen hast du, Jude, begangen. [...] Warum sieht sich der allzeit gütige Gott, der euch nie vergessen hat, nach so langer Zeit der Not
nicht veranlaßt, eure Knechtschaft zu beenden oder, um mich richtiger auszudrücken, den von euch erwarteten Antichristus zu senden! Welchen
Verbrechens, welch fluchwürdigen Vergehens wegen hat Gott seine Augen von euch abgewandt! Wißt ihr es nicht! Denkt an das Wort eurer Väter:
Sein Blut komme über uns und unsere Kinder! Kommt, laßt uns ihn töten, und unser wird das Erbe sein (Mk 12,7)! Wir haben keinen König außer
dem Kaiser (Joh 19,15). Nun habt ihr, was ihr gewählt habt. Bis zum Ende der Welt werdet ihr dem Kaiser dienen, bis die Fülle der Heiden sich
bekehrt. Dann kann auch ganz Israel gerettet werden (Röm 11,26-26), aber was einst Kopf war, wird jetzt zum Schwanz werden“ (Schreckenberg
203).
In diesem Zitat verbirgt sich die Grundlage der Judenpolitik der Spätantike und vor allem des Mittelalters. Auch wenn die Evangelien eine klare
Sprache sprechen und historische Untersuchungen eindeutig zeigen, daß die federführenden Kräfte der Verurteilung und Hinrichtung Jesu keine
Juden, sondern Römer waren, blieb bis in unsere Jahrzehnte wohl kein Vorurteil so hartnäckig und so folgenschwer, wie jene Kollektivschuld, die
auf dem Judentum zu liegen kam, nämlich Christi Blut vergossen zu haben. Juden hatten sich selbst – so folgerte man daraus - durch den Gottesmord zu Sklaven erniedrigt. Sie waren Knechte des Kaisers, eine Vorstellung, die sich in der realen Politik in Form der sog. Kammerknechtschaft niederschlug, die einstmals kaiserliches Privileg im Laufe der Zeit mehr und mehr in die Hände der Landesfürsten und Herzöge überging,
die nun Besitzer „ihrer Juden“ wurden. Die Knechtschaft sollte erst enden, wenn die Botschaft von Jesus dem Christus über die Welt getragen und
alle Nichtchristen bekehrt würden. Um dies zu erreichen, bedurfte es enormer Anstrengungen. Dazu brauchte es Missionare und Soldaten, Kämpfer und Prediger zugleich. Es mutete den Christen ungemein schmerzlich an, daß gerade jene Stätte, in der der Erlöser sein Blut hingab, sog. Ungläubige saßen, Muslime. Man erachtete es daher nur als recht und billig, daß man Jerusalem dem Christentum wiedererobern wollte und dabei
auf die Juden im eigenen Land nicht vergaß. So schrieb ein Chronist im 12. Jh.:
Die Kreuzfahrer
„Als sie nun auf ihrem Zuge durch die Städte kamen, in denen Juden wohnten, riefen sie untereinander: `Sehet, wir ziehen den weiten Weg, um
die Grabstätte aufzusuchen und uns an den Ismaeliten zu rächen, und siehe, hier wohnen unter uns die Juden, deren Väter ihn unverschuldet umgebracht und gekreuzigt haben! So lasset zuerst an ihnen uns Rache nehmen und sie austilgen den Völkern, daß der Name Israel nicht mehr erwähnt werde; oder sie sollen unseresgleichen werden und zu unserem Glauben sich bekennen.´“ Mit diesem Spruch begann die Verfolgung der
Juden in der Kreuzfahrerzeit, der Gemeinden wie Worms, Speyer, Mainz oder Köln (1096) zum Opfer fielen.
130
Grundkurs Judentum
Kabbala
Jenen Juden, die auch die Kreuzfahrerhorden überlebten, sich nicht taufen ließen und als Kammerknechte im christlichen Land aushielten, zeigte
sich das Christentum offiziell immer unnachsichtiger. Wer jetzt Jude blieb, der sollte spüren, daß er ein Außenseiter war.
Das 4. Laterankonzil
Im Jahre 1215 versammelte sich die hohe Geistlichkeit im Lateran zu einem Konzil, das für das Judentum einschneidende Bestimmungen traf. Auf
diesem sog. 4. Laterankonzil wurde der Klerus zu einem eigenen Stand erhoben, das Pflichtzölibat durchgesetzt und mit Privilegien ausgestattet.
Er erhielt das alleinige Recht, die Sakramente zu erteilen, zu lehren und zu predigen und die Kommunion in beiderlei Gestalt zu empfangen. Den
Laien wurde die Beichte befohlen (1x jährlich). Über die Juden heißt es im Kanon 68:
In nonnullis. 4. Laterankonzil (11·11.-30.11.1215), Kanon 68 (Potthast, P. 438; Mansi 22, 1055-1056; Gregorii Decret. V, 6, 15 [Friedberg, col. 776777]; Hefele-Leclercq V, 2, 1387-1388; Conciliorum oecumenicorum decreta, Bologna 1973, 266):
„In einigen Kirchenprovinzen unterscheidet bereits die unterschiedliche Tracht (habitus diversitas) Juden und Muslime von den Christen; in gewissen (anderen) hat sich jedoch eine Art von Durcheinander so eingebürgert, daß sie durch keinen Unterschied auseinandergehalten werden können. Daher geschieht es manchmal, daß irrtümlich Christen mit jüdischen und muslimischen, Juden und Muslime mit christlichen Frauen Geschlechtsverkehr haben. Damit also nicht Sünden in Gestalt eines so verbrecherischen Verkehrs künftig unter dem Deckmantel des Irrtums eine
Ausflucht dieser Art haben können, bestimmen wir, daß solche Leute (d.h. Juden und Muslime) beiderlei Geschlechts in jeder Kirchenprovinz und
jederzeit durch eine besondere Tracht (qualitate habitus) öffentlich sich von der übrigen Bevölkerung unterscheiden sollen, zumal zu lesen ist, daß
eben dies ihnen (d.h. den Juden) schon durch Moses auferlegt ist (vgl. etwa Lv 19, 19, Nm 15, 37-41; Dt 22, 5.11). An den Tagen der Trauer (d.h.
von Donnerstag bis Samstag der Karwoche; zur Liturgie dieser drei Kartage gehören die Klagelieder des Propheten Jeremia) und der Passion des
Herrn sollen sie (d.h. die Juden) keinesfalls ausgehen und sich in der Öffentlichkeit sehen lassen; denn, wie wir vernommen haben, schämen sich
einige von ihnen nicht, gerade an solchen Tagen (vielleicht wegen des etwa gleichzeitigen Passahfestes) im Festgewand einherzugehen, und die
Christen, die im Gedenken an die allerheiligste Passion Zeichen der Trauer tragen, zu verspotten. Das aber verbieten wir aufs strengste, daß sie
sich irgendwie dreist herauswagen, um den Erlöser zu beleidigen. Und da wir über die Schmähung dessen, der unsere Schandtaten tilgte, nicht
einfach hinweggehen dürfen, schreiben wir vor, daß Missetäter dieser Art durch die weltlichen Herrscher mittels Zuerkennung einer angemessenen Strafe in ihre Schranken gewiesen werden, damit sie nicht den für uns Gekreuzigten irgendwie zu lästern wagen“ (Schreckenberg 423f.). Man
schärfte weiter ein, daß Juden natürlich keine Amtsgewalt über Christen haben dürften. Auch wenn man immer wieder damit argumentiert, daß mit
der Kennzeichnung der Juden durch die phrygische Mütze, den sog. Judenhut, nicht automatisch eine Diskriminierung erfolgen mußte und auch
jüdische Darstellungen selbst solche Erkennungszeichen aufweisen konnten, ist unbestreitbar, daß der Judenhut mehr und mehr zum Faktor der
Ausgrenzung wurde und die mittelalterliche Ikonographie vor allem nach 1215 Judenhüte als polemisch-denunziatorischen Hinweis auf die verachtete Judenheit gebrauchte. Zur Durchsetzung der kirchlichen Bestimmungen, die immer nur zaghaft auch im östlichen Europa umgesetzt wurden,
sannte Clemens IV. Kardinal Guido aus, der mit Eifer für die Einhaltung der Judendiskriminierung kämpfte. Im Mai 1267 fand daher auch unter
seinem Vorsitz das 22. Salzburger Provinzialkonzil in Wien statt, das sich diese Bestimmungen zu eigen machen sollte. Juden sollten nicht nur
den gehörnten Hut tragen, man verbot ihnen den Besuch von Wirtshäusern und Bädern, das Halten christlicher Dienstboten und das gemeinsame
Essen oder Trinken mit Christen. Diese durften unter Androhung von Exkommunikation nicht an Hochzeiten und Festen von Juden teilnehmen.
Synagogen durften nicht neu errichtet, wohl aber repariert werden. Besonders makaber mutet der Passus an, wonach sie dem Pfarrer, in dessen
Sprengel sie sich aufhielten, dafür zu entschädigen hatten, daß sie den Platz anderen Christen wegnahmen. Hinter allen Maßnahmen stand erneut
131
Grundkurs Judentum
Kabbala
die Überzeugung, daß das Judentum vom Christentum fernzuhalten und in Schranken und spürbaren Grenzen zu halten war. Seine bewußte Ablehnung des Christentums erweckte in der geschlossen christlichen Gesellschaft Mißtrauen, der nur allzu leicht in Haß umschlagen konnte. Die
jahrhundertelang gelehrte Mär vom Gottesmord und die beharrliche Weigerung der Konversion machten den Juden im Mittelalter zum stereotypen
Feind. Das System von Vorurteilen, das in den Kirchen gelehrt und vom Volk rezipiert wurde, erreichte bald eine Intensität, die gar keine leibhaftigen Juden brauchte, um zu funktionieren. Die Vorurteile blieben bestehen, wenn sie sich im Laufe der Zeit auch an ganz unterschiedliche Motive
hafteten. Für das Verständnis des Geschehens in Wien 1420 ist vor allem das Motiv des Hostienfrevels von großer Bedeutung geworden.
Der Hostienfrevel und die Transsubstantiationslehre
Im schon erwähnten 4. Laterankonzil wurde zum ersten Mal in der Kirchengeschichte die sog. Transsubstantiationslehre deutlich artikuliert. Diese
Lehre bedeutete nicht mehr und nicht weniger als daß sich die Hostie durch die Wandlungsworte des Priesters in den wahren Leib Christi verwandle. Mit dieser Entscheidung wurde ein theologischer Diskurs über die Bedeutung der Wandlungsworte und der Vergegenwärtigung Jesu in
Brot und Wein entschieden. Zur Entwicklung dieser Lehre:
Auf der einen Seite standen die Vertreter eines spiriualistischen Symbolismus (wie Rathramus +868 oder Berengar), auf der anderen die Vertreter
eines übersteigerten Sakramentenrealismus (Paschalius Radbertus # 859 und später Gregor VII.). Im Falle der Transsubstantiationslehre siegte
der Realismus über den Symbolismus. Die Transsubstantiationslehre unterscheidet zwischen den unveränderlichen Akzidentien, also der Hostie,
und der gewandelten Substanz, womit sie die Wirklichkeit des präsenten Christus meint. Worin besteht nun die große Problematik des Verständnisses? Sie liegt darin, daß nicht die Gegenwart des Handelns Christi im Handeln der Kirche vergegenwärtigt wird, sondern (nur) die Person Christi in den eucharistischen Gestalten. Dieses prinzipielle Verständnis war nur zu gut dafür geeignet, in der breiten Bevölkerung durch Volksglauben
und Wundererzählungen angereichert zu werden. Die Folge dieser Entwicklung ist eine stark wachsende Hochschätzung des im Sakrament gegenwärtigen Herrn, tiefe Ehrfurcht und eine unvorstellbare Ängstlichkeit im Umgang mit den Hostien und Wein. Die theologische Reflexion und die
Frömmigkeit konzentrierten sich auf das Daß und Wie der Gegenwart Christi, sie harrten gespannt auf den zeitlich fixierten Akt der Konsekration,
durch den der Priester, der die Wandlungsworte spricht, die Gegenwart Christi bewirkt, an der die Gemeinde ehrfürchtig schauend und anbetend
(Elevation) Anteil gewinnt. Diese Auffassung mischt sich mit dem aristotelischen materia-forma-Schema, nach dem die ,Materie' (hier sind es Brot
und Wein) und die ,Form' - das sind die mit geradezu abergläubischer Scheu behandelten Konsekrationsworte (Meyer, Lutheri.214-237) als allein
wesentlich erscheinen. Beides führt zu der für die Einschätzung der Meßliturgie folgenreichen Meinung, daß nur das konsekrierende Handeln des
Priesters entscheidend sei: Der Priester zelebriert die Messe - das Volk wohnt ihr bei; die Wandlung ist allein wichtig - alles übrige nur zeremonielle Zutat; die Kirche, repräsentiert durch den Priester, nicht aber durch die feiernde Gemeinde, bringt den kraft der Konsekration gegenwärtigen
Leib und das Blut Christi als ihr Opfer dem Vater dar. Diese Auffassung kommt einer „Wiederholung“ des Kreuzesopfers bedenklich nahe. Man
vermißt dabei völlig das Verständnis der Messe als eine der Gemeinde aufgetragene Gedächtnisfeier. Mit der Konzentration auf die durch die
Konsekration vom Priester bewirkte Realpräsenz und mit dem Verständnis der Messe als Opfer der Kirche hängt es zusammen, daß die mittelalterliche Meßtheologie und –frömmigkeit sich intensiv mit dem Wert der Messe (Iserloh) und mit der Frage nach den Meßfrüchten (Franz 3672) und
deren Zuwendbarkeit beschäftigte. Die in Predigten und Erbauungsbüchern popularisierend vergröberte Auffassung vom (schon in actu primo)
begrenzten Wert einer Messe einerseits und deren heilsamen Wirkungen andererseits verstärkte die Tendenz, möglichst viele Messen zu feiern
oder wenigstens der Konsekration und Elevation (also der Erhebung der Hostie) als deren Herzstück beizuwohnen.
132
Grundkurs Judentum
Kabbala
Es verwundert nicht, daß in dieser Zeit die Hostie leibhaftig als Kind oder Knabe geschaut wurde, daß „verletzte“ Hostien „bluteten“ und die Wunderwirksamkeit der geweihten Hostie auch zu allerlei Mißbrauch verleiteten. Man schluckte die Hostie zuweilen nicht, sondern steckte sie heimlich
ein, um sie aufzubewahren, handelte mit ihr und ihrer Wirkmacht. So konnte es nicht ausbleiben, daß dem Erzfeind schlechthin, dem Juden, vorgeworfen wurde, mit den Hostien in frevlerischer Absicht umzugehen.
Ab dem 14. Jh. verbreitete sich zudem rasant die festliche Begehung von Fronleichnam, einem Fest, das auf die mystischen Visionen von Juliana
von Liége im 13. Jh. zurückgeführt wird und durch den Bischof von Liége kräftig gefördert wurde. Papst Urban IV. schrieb das Fest bereits 1264 für
die ganze Kirche vor, doch erst Papst Johannes XXII. konnte es 1317 mit einer Dekretalensammlung nachdrücklich einführen. Zentraler Inhalt der
durch Prozessionen gesteigerten Festaktivität war die Verehrung der Eucharistie. Bis heute hat vor allem das an Fronleichnam nach wie vor gesungene Pange lingua antijudaistische Tendenzen behalten, sodaß der Koordinierungsausschuß für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit 1997 ein
Memorandum zu Liedtexten des Fronleichnamsfestes veröffentlichte, in dem unter anderem auf folgende Strophe hingewiesen wurde: „Das Gesetz der Furcht muß weichen, da der neue Bund begann; Mahl der Liebe ohnegeleichen: nehmt im Glauben daran teil.“ Dieses Beispiel zeigt, daß
die Nachwirkungen mittelalterlicher Judenfeindschaft immer noch anhalten. Das Gesetz der Furcht, mit dem die jüdische Tora abgekanzelt wird, ist
für viele noch immer die Negativfolie des guten mit Christus gebrachten Liebesbundes.
Doch lassen Sie mich zurückkehren zum Thema des Hostienfrevels, wie er im Zuge der mittelalterlichen Hostienverehrung mehr und mehr zum
Repertoire der Agression gegen das Judentum wird. Frantisek Graus schreibt zurecht:
„Man versuchte, sich auf verschiedenste Weise geweihte Hostien zu verschaffen - die einfachste Art war natürlich, bei der Kommunion die Hostie
nicht zu schlucken, sondern sie aufzubewahren; aber auch Diebstahl, geradezu ein Handel mit Hostien (ähnlich wie zuweilen mit Reliquien der
Heiligen) kam gelegentlich auf. Da nun »allgemein bekannt« war, daß die Juden »Feinde des Christengottes« seien, konnte es nicht ausbleiben,
sie mit Hostien in Verbindung zu bringen. Ihre Feindschaft übertrug sich, diesen Vorstellungen nach, zwangsläufig auf den in den Hostien wirklich
existenten Christus. Die Martern, die die Juden einst Christus zugefügt hatten, wurden magisch an der Hostie immer neu wiederholt. Allerdings
hatte diese Übertragung gewisse Schwierigkeiten: Die Juden, die die Hostien »marterten«, mußten zwangsläufig Anhänger der Lehre von der
Transsubstantiation sein, d.h. auch sie mußten glauben, daß der Christengott, den sie schmähen oder martern wollten, wirklich und körperlich in
der Hostie anwesend sei. (Wenn echte Hostienschändungen durch Juden tatsächlich vorkamen, so haben in diesen Fällen die »verstockten Juden« Ansichten der Christen übernommen.) Die sonst so ungläubigen Juden wären in dieser Hinsicht rechtgläubiger gewesen als so manche
Christen. Manche Kleriker waren sich dieser Schwierigkeiten bewußt, und sie halfen sich aus diesen Schwierigkeiten dadurch, daß sie Hostienwunder mit den Bekehrungen von Juden verbanden; die Wundermacht der Hostie überwand letztendlich den Starrsinn des verstocktesten Juden
und verwandelte ihn flugs in einen gläubigen Christen. Oder man begnügte sich mit der Behauptung, die Juden hätten die Hostie nur verspottet,
sie unehrerbietig behandelt. Das Gros der Erzählungen über die Hostienfrevel der Juden, wie sie seit dem 13. Jahrhundert im Schwange waren,
wählte jedoch trotz Schwierigkeiten der Logik die Analogie zur Passionsgeschichte: diesen Berichten nach verhielten sich die Juden ihrer Zeit gegenüber der Hostie letztlich genauso, wie einst ihre Vorväter gegenüber Christus selber. Obwohl auch in Erzählungen über Hostienfrevel die Juden nicht allein vertreten waren (ihnen gesellten sich verschiedene Ketzer und später besonders Hexer und Hexen hinzu, die nicht nur die Hostien
schmähten, sondern sie auch für ihre unreinen Praktiken verwendeten), so waren es dennoch vor allem die Juden, die als Gottesmörder« in ihrer
altbewährten Rolle weiterwirkten. Auch dabei waren es geradezu standardisierte Erzählungen, die in den gängigen Exemplar- und Geschichtsbüchern reichlich vertreten waren, die jederzeit hervorgeholt, an lokale Bedingungen angepaßt, beliebig wiederholt werden konnten. Bezeichnenderweise wird in diesen Erzählungen meist eine Kollektivschuld der Juden vorausgesetzt: Hostienfrevel waren nicht das Werk von Einzelnen, sondern
von ganzen Judengemeinden, bzw. sogar von weitreichenden Organisationen. Die Strafen sollten daher, ähnlich wie bei den Ritualmorden, nicht
133
Grundkurs Judentum
Kabbala
bloß einzelne Schuldige, sondern die Gesamtheit der »Gottesmörder« treffen. Durch die Schmähung und Verunglimpfung Gottes erhielt das
»Verbrechen der Hostienschänder eine mythische Dimension, die geradezu zur psychologischen Analyse reizt; vor allem aber bedrohten diese
Taten das Leben aller Mitmenschen, denn ein so ungeheuerliches Sakrileg drohte ein göttliches Strafgericht heraufzubeschwören, das alle treffen
würde.“ (288f.)
Im Jahre 1338 werden die Juden im nö. Pulkau beschuldigt, eine Hostie geschändet zu haben. Die von dort ausgehende Verfolgung erreichte fast
ganz Niederösterreich. In Krems wurden die Häuser der jüdischen Gemeinde in Brand gesteckt. Die Juden verbrannten bei lebendigem Leib. Diese Ausschreitungen führten zum massiven Eingreifen des Herzogs, der seine Juden schützte, wohl nicht aus Liebe, sondern aus Angst um sein
Geld. Albrecht II. sticht dennoch auf jeden Fall als judenfreundlich aus dem Kreis seiner Vor- und Nachfahren heraus. Die Rädelsführer der Aufstände ließ er hinrichten, die Städte hohe Bußzahlungen leisten. Das änderte nichts daran, daß die unselige Mischung als religiösem Fanatismus,
Volksglauben und problematischer Theologie selbst die Exzesse gegenüber Juden auch in den nächsten Jahrzehnten nicht aufhören ließen.
Zur Geschichte der Hostienfrevelbeschuldigung: Die Deggendorfer Gnad
„Von den «Hostienfreveln», die in den folgenden Jahrzehnten «entdeckt» wurden, hat man die ganz überwiegende Mehrzahl Juden angelastet.
Schon 1298 kam es in den deutschen Orten Röttingen, Iphofen, Lauda, Weikersheim, Möckmühl sowie in Mürzburg zu solchen Beschuldigungen,
die den Anlaß doch zumindest den Vorwand für blutige Massaker an zahlreichen jüdischen Gemeinden im weiteren Umkreis gaben - und in Lauda
und Iphofen erinnern heute noch Wallfahrtskirchen mit entsprechenden bildlichen Darstellungen an diese vorgeblichen Freveltaten der Juden.
Auch die noch sehr viel weiträumigeren Massaker der 1336-1338, als das vor allem aus Bauern bestehende Heer des «König Armleder» die jüdischen Gemeinden hauptsächlich in Franken und Elsaß heimsuchte, aber auch in Hessen, an der Mosel, in Böhmen und Niederösterreich Judenverfolgungen zu verzeichnen waren, standen im Zusammenhang mit Hostienfrevel-Beschuldigungen. Im Oktober 1338 wurde das niederbayerische Deggendorf zum Ausgangspunkt einer weiteren Welle blutiger Judenverfolgungen. Von einem «Hostienfrevel» war hier offenbar zunächst
nicht die Rede; vielmehr scheint diese Legende erst nachträglich zur Rechtfertigung des Massakers an den Deggendorfer Juden herangezogen
worden zu sein. Dennoch wurde die 1360 geweihte Grabkirche zum Ziel einer wichtigen und bis heute bestehenden Wallfahrt, der weit über Niederbayern hinaus berühmten «Deggendorfer Gnad».
Der Zusammenhang mit dem Gottesmord-Vorwurf erscheint in diesem bekanntesten deutschen Fall einer Hostienfrevel-Beschuldigung besonders
deutlich greifbar. «Do bart Gotes Laichenam funden», schildert kurz und bündig die Bauinschrift der Grabeskirche den Fund der von den Juden
gemarterten Hostien in einem Brunnen. In anderer Weise erscheint dieser Zusammenhang auf den Tafelbildern des Nerio Miller von 1725, die das
grausige Geschehen bis vor wenigen Jahren in der Kirche veranschaulichten und auf denen unter anderem zu sehen war: «Die heiligen Hostien
werden von den Juden bis auf das heilige Blut mit Dornen gekratzt und es erscheint unter solcher Marter ein kleines Kind.» Dem G1äubigen konnte nicht zweifelhaft sein, daß es sich bei diesem Kind um den Jesusknaben handelte, wie ihm auch in einem Andachtsbüchlein der Zeit um 1910
folgendes Gebet in der Grabkirche anempfohlen wurde:
«O mildreichster Jesus! der du dich gewürdiget hast, denen jüdischen Feinden als ein liebreiches Kindlein zu erscheinen, da du doch vorgesehen,
daß sie dich nicht erkennen, sondern lästern und in den Abgrund eines Brunnens werfen werden; würdige dich auch, über mich Sünder (Sünderin)
durch dieses wunderbare Sakrament dein Gnadenlicht scheinen zu lassen.»
Auch ein Bühnenspielen kam der «Hostienfrevel» zur Aufführung, so 1800 in Regen im bayerischen Wald, wo unter anderem der Satan als Deggendorfer Jude in Erscheinung trat; und auch in dieser derben Burleske wird deutlich, daß die Juden in der Hostie Jesus selbst martern:
134
Grundkurs Judentum
Kabbala
«Moses: wir wollen nemmen spitzige Schuehahlen, und wollen stechen den Messias, damit Er verliert den Kitzl.
Satan: Ach! mit Dörnern wolln wir ihn kratzen, daß ihm vergeht die Frad [Freude; S. R.].
David: jo, jo, so wolln wir machen, daweil fallt mir auch ein gedancka, daß wir haben unsern längern spas, wir wollen gehn, und bitten unsere
Nachbarn zu uns, sie sollen begucken den großen Messias, der erlöst hat die gantze Welt.»
Durch illustrierte Gnadenbüchlein und dergleichen wurde die Geschichte von dem Deggendorfer «Hostienfrevel» bis in die jüngste Vergangenheit
propagiert. In dem letzten derartigen, 1960 erschienenen Traktat aus der Feder eines Benediktinerpaters heißt es nach einer ausführlichen Würdigung der über die Jahrhunderte hinweg bewährten Frömmigkeit Deggendorfer Bürger und Wallfahrer:
«Betrachtet man die vorgeführten Tatsachen, und wie ununterbrochen Groß und Klein, Hoch und Nieder, Geistlich und Weltlich aus der Nähe und
Ferne dem in der Grabkirche aufbewahrten hl. Fronleichnam so mannigfach ihre Anbetung und Verehrung zollten, so ist der Wahnwitz derjenigen
nicht leicht zu begreifen, welche in neuerer Zeit das hl. Mirakel als Unsinn und Schwindel verhöhnen, und die Andacht und Wallfahrt zu ihm als
Verherrlichung des Judenmordes ausschreien.»“ (Rohrbacher/Schmidt 292-295).
Und in einem Flugblatt, das im Sommer des Jahres 1998 (bitte hinhören, 1998) während des Salzburg-Aufenthaltes des Papstes verteilt wurde,
heißt es noch immer über die Heiligkeit der Hostie:
Ein Flugblatt der Eucharistischen Bewegung zur Verherrlichung Gottes
Zwangstaufen, Kiddusch ha-Schem und das Ende der Gemeinde in Wien
Was 1960 noch vehement verteidigt wird, und was 1998 noch deutlich spürbar bleibt, ist für die Juden des Mittelalters schlimmste Bedrohung an
Leib und Leben. Der einfache Christ dachte: Diese Juden, die Gott getötet haben und sich beharrlich weigern, die Taufe zu nehmen, sie verfolgen
und töten Christus aufs Neue in jeder geweihten Hostie, die ihnen in die Finger kommt. Was blieb zu tun: Zum einen konnte man erneut versuchen, sie der allein selig machenden Kirche einzugliedern. Und so wurden Ende des 14. Jhs. wieder viele Stimmen laut, die einer Zwangstaufe
von Juden das Wort redeten. 1420 war es auch in Wien soweit. Am 23. Mai 1420 wurden sämtliche Juden in den herzoglichen Städten Österreichs
gefangen genommen, ihr Vermögen zog man ein. Im Herbst wurde in der Dominikanerkirche den einst jüdischen Neuchristen gepredigt. Ja, die
Taufbewegung muß einen gewissen Erfolg gehabt haben, obwohl die jüdischen Quellen darüber schweigen. Die sog. Wiener Geserah, das zum
Lob der Märtyrer entstandene Schreiben, berichtet hingegen ausführlich über die Ablehnung der Taufe durch die Wiener Juden. Die Armen unter
ihnen wies man schließlich aus Österreich aus und setzte sie in Zillen auf der Donau aus. Die Reichen behielt man hingegen als Geiseln und folterte sie, um eventuelle Verstecke der Schätze herauszulocken. Die Wiener Gezerah erzählt über die Gefangennahme und über den Raub an den
Reichen, und sie berichtet über jene verzweifelt Entschlossenen, die sich in der Synagoge versammelten, um dort den Selbstmord als gottverherrlichende Antwort auf die christliche Repression zu wählen. Dort heißt es:
„Als der Herzog sah, daß die Juden sein Essen und seinen Wein verschmähten, ließ er wieder den getauften Juden holen und fragte ihn, was er
des weiteren tun solle.
Dieser antwortete, man solle den Juden alle Kinder unter fünfzehn Jahren wegnehmen. Dies ließ der Herzog in aller Heimlichkeit von seinen Amtmännern ausführen.
Eine Jüdin, die den Amtmann von Mödling kannte, erfuhr es von diesem. Darauf schrien alle Frauen mit flehentlich hoher Stimme: Weh über Weh,
unsere heiligen und frommen Kinder sollen, Gott behüte, verunreinigt werden!
Sie faßten den Beschluß, sich umzubringen und warfen das Los, wer es denn tun sollte.
Das Los fiel auf einen Frommen, den Rabbi Jonah. Es war am Laubhüttenfest (im Jahr 1420), als sich der Rabbi vor dem Toraschrein aufstellte.
Alle in der Gemeinde baten sich gegenseitig um Verzeihung, beteten das Sündenbekenntnis und nahmen sich in der Männerschul vor dem Tora135
Grundkurs Judentum
Kabbala
schrein das Leben.
Auch die Frauen nahmen sich in ihrer Schul das Leben.
Eine Frau blieb über. Sie bat den Rabbi Jonah, er möge sie durch das Fenster der Frauenschul töten.
Danach hatte der Rabbi Jonah nicht mehr die Kraft, Hand an sich zu legen. Er nahm also alle Betpulte der Schule, legte sie übereinander und goß
das Öl darauf. Dann betete er zu Gott, daß er das, was er getan habe, um des Himmels Willen getan habe, setzte sich auf den Altar und zündete
ihn von unten an. Als das Feuer aufflammte, nahm er sich das Leben.
Als es Tag wurde, riefen die Wiener in die Judenschul hinein und da niemand antwortete, sagten sie: Vielleicht schlafen sie, wir wollen laut schreien.
Wie sie keine Antwort erhielten, kletterten sie auf das Dach und sahen die Märtyrer (tot) unten liegen.
Danach befahl der Herzog, man solle (die Leichen) vor die Stadt werfen, und so verscharrte man sie unweit von einem Weingarten.“
Seit der Zeit der Verfolgungen unter den Seleukiden im 2. vorchristlichen Jahrhundert hatte sich im Judentum immer mehr das Verständnis herausgebildet, daß die Heiligung des Namens Gottes unter bestimmten Umständen den Selbstmord einzelner oder der Gruppe nötig macht. Man
wehrte sich jedoch streng gegen einen Mißbrauch dieser Vorstellung im Sinne eines leichtfertigen Aufs-Spiel-Setzen des eigenen Lebens. Das
Leben galt immer als ungemein hohes Gut. Nur drei schwere Gebote konnten das Martyrium verlangen, nämlich die Ehre des Namens Gottes, der
Kampf gegen den Mißbrauch der Sexualität und Mord. Vor allem die Ehre des Namens Gottes veranlaßte in Zeiten der Verfolgung Juden, eher zu
sterben als sich taufen zu lassen. Dieses Vorgehen, das von den jüdischen Autoritäten immer wieder heftig diskutiert und bis in den Holocaust natürlich auch heftig kontrovers behandelt wird, soll Juden wie Nicht-Juden die Kraft der jüdischen Ehrfurcht vor Gott und Seiner Tora bezeugen. Die
Welt sollte Respekt vor den hohen moralischen Forderungen der jüdischen Religion erhalten. So ist auch der Schritt der Gemeindemitglieder in
Wien zu sehen. Hier demonstrierte eine Gruppe ihre entschlossene Überzeugung, den Bund des Volkes mit Gott zu halten, auch bis in den Tod.
Ende März 1421 lebten nur mehr 300 Juden in Wien. Aus ihnen konnte man kein Geld mehr herauspressen. Sie waren nun ganz und gar der Willkür des Herzogs ausgesetzt. Waren die Taufe, die Plünderung und die Erpressung bislang Mittel gewesen, mit denen man das Judentum konfrontierte, und waren durch den Massenselbstmord endgültig wichtige Geldgeber und Steuerzahler dem Herzog entglitten, wollte man den Rest, mittellos geworden, mittels einer tiefgreifenden und allseits verständlich Beschuldigung loszuwerden trachten.
Sie fand man – wen wundert´s jetzt noch – im Vorwurf der Hostienschändung. Eine Mesnerin von Enns hätte, so heißt es, eine Hostie entwendet
und den Juden übergeben, welche sie gemartert und geschändet hätten. Am 12. März 1421 entschied der Herzog schließlich, sie auf dem Scheiterhaufen zu verbrennen. Und so brannten 210 Juden auf einer Wiese bei Erdberg. Die Wiener Geserah schreibt dazu: „Wie nun die Juden zum
Brandhaus geführt wurden, hoben sie an zu tanzen und zu springen, als ob es um eine Hochzeit ginge. Unter lauten Zurufen und Trostworten zueinander baten sie sich gegenseitig um Vergebung und erhofften sich ein glückliches Jenseits.“ In der Aschen suchten christliche Studenten nach
Gold und Silber. Für die Juden war Österreich fortan zum „Blutland“ geworden und als solches in die Literatur eingegangen. Der als Märtyrer gestorbene Rabbi Isserlein meinte zurecht über die Menschen, die diese Schauspiel beiwohnten und es guthießen: „Sie haben ein Ekel vor uns und
wir sind wie Dornen in ihren Augen“. Die Christen haben ihre Version nachdrücklich auf dem Haus zum Großen Jordan wiedergegeben. Dieses
Haus am Judenplatz 2, gehörte vor 1421 einem Juden namens Hocz, später erhielt es Georg Jordan, der es 1497 erneuerte und mit einem Wappen versah, welches im Motiv an die Taufe am Jordan erinnert. Auf ihr heißt es nach wie vor:
Die Tafel am Jordanhaus
136
Grundkurs Judentum
Kabbala
Flumina Jordani terguntur
labe malisque
corpora cum cedit, quod
latet omne nefas.
Sic flamma assurgens totam
furibunda per
urbem 1421 Hebraeum
purgat crimina saeva canum.
Deucalioneis mundus
purgatur ab undis
sicque iterum poenas igne
furiente luit.
Durch die Fluten des Jordan wurden die Leiber von Schmutz und Übel gereinigt. Alles weicht,
was verborgen ist und sündhaft. So erhob sich (im Jahre) 1421 die Flamme des Hasses, wütete
durch die ganze Stadt und sühnte die furchtbaren Verbrechen der Hebräerhunde. Wie damals
die Welt durch die Deukalionischen Fluten (Sintflut) gereinigt wurde, so sind durch das Wüten des Feuers alle Strafen verbüßt.
Die wütende Flamme des Hasses, von der hier die Rede ist, zeichnete eine blutige Spur durch die Jahrhunderte. In der Nacht vom 9. zum 10. November des Jahres 1938 berichtet ein SD-Leiter:
„Gegen acht Uhr begann die Aktion planmäßig abzurollen. Die jüdischen Geschäfte wurden geschlossen (hauptsächlich eine Arbeit der Pl), mit
den Verhaftungen der Juden wurde begonnen und vor den jüdischen Tempeln und Bethäusern fuhren Rollkommandos der VT [SSVerfügungstruppe] vor und begannen mit Handgranaten das Inventar für eine Inbrandsetzung vorzubereiten. Innerhalb von zwei bis drei Stunden
waren sämtliche Tempel und Bethäuser Wiens in Brand gesetzt oder zerstört. Die Feuerwehr beschränkte sich einer höheren Weisung folgend,
[nur] auf eine Lokalisierung der Brände. Im ganzen wurden in Wien gegen 3.000 Juden festgenommen, die in Sammelstellen abtransportiert wurden. Die Warenlager der geschlossenen jüdischen Geschäfte wurden vielfach abtransportiert und der NSV [NS-Volkswohlfahrt] zur Verfügung gestellt. Leider konnte[n] in einigen Fällen auch sinnlose Zerstörungen des Inventars und auch Plünderungen nicht verhindert werden. In den Vormittags-stunden erschienen ... in jüdischen Wohnungen Pl-, SS- oder SA-Leute und teilten den Juden mit, daß sie die Wohnungen binnen 24 Stunden
zu räumen hätten... In Baden wurden die Juden aus ihren Wohnungen in Elendsquartiere umgesiedelt und die dort wohnenden Volksgenossen in
die jüdischen Wohnungen eingewiesen...“
Der Nationalsozialismus, dessen furchtbare Greuel wir vor wenigen Tagen wieder erinnert haben, als wir des Novemberpogroms vor 60 Jahren
gedachten, hat auf einer Basis aufbauen können, die lange vor dem nationalen und rassistischen Ideologisieren da war. Er konnte an ein christliches Vorbild anschließen, daß über 2 Jahrtausende Juden als Gottesmörder betrachtete und – wenn man es für nötig erachtete – dem „Feuer der
Reinigung“ übergab. Es sollte bis ins Jahr 1997 dauern, ehe die katholische Kirchenleitung Wiens eine Tafel in Auftrag gab, die unter Federführung von Prof. Dr. Kurt Schubert ein neues Bild von den Vorgängen auf dem Judenplatz zeichnen sollte, ein Bild, das dokumentieren sollte, daß
137
Grundkurs Judentum
Kabbala
die Kirche endlich bereit war, das Judentum nicht als Masse von Gottesmördern zu sehen, als Feinde Christi und als von Gott verfluchte Kreaturen, deren Vernichtung – wenn schon nicht unterstützt- so doch auch nicht vehement bekämpft wurde. Erst 30 Jahre nach dem 2. Vatikanischen
Konzil, in der man endlich von der Lehre des Gottesmordes Abstand nahm, sollte eine Tafel an das Leid der Juden hier erinnern. Die Tafel wurde
am 29. Oktober feierlich von Kardinal König enthüllt. In ihr heißt es:
Die neue Tafel am Judenplatz:
„Kiddusch HaSchem“ heißt „Heiligung Gottes“. Mit diesem Bewußtsein wählten Juden Wiens in der Synagoge hier am Judenplatz – dem Zentrum
einer bedeutenden jüdischen Gemeinde- zur Zeit der Verfolgung 1420/21 den Freitod, um einer von ihnen befürchteten Zwangstaufe zu entgehen.
Andere, etwa 200, wurden in Erdberg auf einem Scheiterhaufen lebendig verbrannt.
Christliche Prediger dieser Zeit verbreiteten abergläubische judenfeindliche Vorstellungen und hetzten somit gegen die Juden und ihren Glauben.
So beeinflußt nahmen die Christen in Wien dies widerstandslos hin, billigten es und wurden zu Tätern. Somit war die Auflösung der Wiener Judenstadt 1421 schon ein drohendes Vorzeichen für das, was europaweit in unserem Jahrhundert während der nationalsozialistischen Zwangsherrschaft geschah.
Mittelalterliche Päpste wandten sich erfolglos gegen den judenfeindlichen Aberglauben, und einzelne Gläubige kämpften erfolglos gegen den Rassenhaß der Nationalsozialisten. Aber es waren viel zu wenige. Heute bereut die Christenheit ihrer Mitschuld an den Judenverfolgungen und erkennt ihr Versagen. „Heiligung Gottes“ kann heute für die Christen nur bedeuten: Bitte um Vergebung und Hoffnung auf Gottes Heil.
Wie immer man zu dieser Tafel stehen mag, ob man sie als ausreichend oder als zu wenig deutlich erachtet, zeigt sich doch in ihr ein Ansatz zum
Umdenken der Kirche. Der Zusammenhang von christlichem Antijudaismus und Nationalsozialismus wird deutlich ausgesprochen und die Mitschuld der ganzen Christenheit an den Judenverfolgungen betont. Was ich Ihnen meine Damen und Herren zeigen wollte war, daß die mittelalterlichen Verfolgungen und Diskriminierungen keineswegs Ausfälle einzelner Weniger oder finanziell und soziologisch allein erklärbar sind. Vielmehr
offenbart sich in ihnen der Zugang des Christentums zum Judentum als Ergebnis einer antijudaistischen Theologie, die erst langsam und in mühsamer Kleinarbeit aufgearbeitet und verändert wird.
Kurzüberblick über die Kabbala und Mystik im Judentum:
MERKABA – MYSTIK: Mystik vom Thronwagen, nach Ez 1 und 10
Älteste Mystik ist Thronmystik, Schau der Erscheinung um Thron, präexistenter Thron Gottes.
Älteste Bücher in talmudischer Zeit: Hekhalotbücher – Schilderungen der Hallen (Hekhalot) und Palästen: Kleine Hekhalot: alt, in ihnen tritt R. Aqiba auf. Große Hekhalot: Sammlung, Hauptredner R. Jischmael. Kaum Exegese, orginäre Beschreibung und Schau der Göttlichkeit. Schauende
Versenkung in die “Herrlichkeit” (kabod). Merkaba hat Kammern und Paläste. Kleine Hekhalot sprechen vom Aufstieg zur Thronwelt, in den Großen Hekhalot allerdings redet man vom Abstieg zur Merkaba. Die Mystiker heißen dann auch Jorde Merkaba. Organisierte Gruppe von Mystikern.
Palästina (?), Babylonien, Italien, Deutschland. Die Gruppe wollte das Geheimnis bewahren, unter sich bleiben. Nur Auserwählte, acht moralische
Vorbedingungen, aber auch physiognomische und chiromantische Kritierien. Vielleicht vom Eindringen neuplatonischen Einflusses beeindruckt,
138
Grundkurs Judentum
Kabbala
deutet man auch Jes 3,9 als Hakkarat Panim, als Erkenntnis der Stirnlinien. Die Würdigen bemühten sich um Abstieg zur Merkaba wohl durch die
sieben himmlischen Paläste. Gnostischer Einfluss: Aufstieg der Seele von der Erde durch die feindlichen Planetensphären bis zu ihrer göttlichen
Heimat im Pleroma der Lichterwelt Gottes.
Askese von 12 oder 40 Tagen. Tiefe Selbstversunkenheit, das Haupt zwischen den Knien gelegt, wird man der Schau teilhaftig. Im Talmud auch
Haltung des tief versunkenen Beters. Große Hekhalot schildern die Wanderung durch die sieben oberen Paläste. Zu überwinden sind Scharen von
Torwächtern, die durch spezielle Passworte besiegt werden. Pass ist ein magisches Siegel aus einem geheimen Namen. Alles Siegel stammen
aus der Merkaba selber.
Sind Angriffswaffen und Panzer der Seele. Es wird von Mal zu Mal schwieriger, die richtigen Passwörter zu finden, sodass sich seitenweise neue
und längere magische Schlüsselworte entwickeln müssen. Die Gefahren sind enorm groß. Die Seele muss geläutert sein und das Wesen bereit.
Engel und Archonten werden gefährlicher, versuchen den Himmelsstürmer zu bremsen. Aber auch sein eigenes loderndes Feuer kann ihn
verbrennen. Henoch erzählt, wie der Patriarch R. Jischmael seine Metamorphose in den Engel Metatron erzählt, bei der sein Fleisch sich in eine
lodernde Fackel verwandelt. Hände und Füße verbrennen nach mancher Ansicht, also muss er auch ohne sie stehen können.
Sechstes und siebtes Tor ist besonders schwierig. Am sechsten Palast wachen Domiel und Kaspiel.
Die Rede von den sieben Himmeln ist alt, Beispiel Himmelfahrt Jesaja. Visionen Ezechiels, sieben Himmel und sieben Merkabot.
Vorstellung von den sieben Hekhalot verwandelt die Erfahrung vom Bau der Welt in eine Schau der Hierarchie des Hofstaats. Gott-König wichtig.
In den Hekhalot ist Gott vor allem König, heiliger König. Gerade die Idee der Schekhina ist die andere Seite, sie spielt hier keine Rolle. Gott ist der
fern Thronende, der auch in der Ekstase nicht in die Welt eindringt. Wer alle Strapazen überwunden hat, der schaut und hört, aber nicht mehr. Es
geht stärker um Gottes Königtum als um sein Schöpfertum. Erscheinungsformen der Glorie sind Geheimnamen Gottes wie Achtariel, Adiriron, Soharariel, Tetrassija,
Literaturgattung: Gebete und Hymnen: inspiriert, weil aus Engelsmund. R. Aqiba kann sie erlauschen.
Beispiel: Hymne des Soharariel:
“Sein Thron prunkt vor ihm und sein Palast ist voller Pracht. Die Majestät steht ihm wohl an, und seine Glorie ist ihm Zier. Seine Diener singen vor
ihm und künden die Macht seiner Wunder, als König aller Könige und Herr aller Herren, der umkreist ist von Kronenreihen, umgeben von den Gliederungen der Fürsten des Glanzes. Mit einem Schimmer seines Strahls umhüllt er die Himmel, und seine Pracht erglänzt von den Höhen her. Abgründe entflackern seinem Mund, und seine Gestalt entsprühen Firmamente.” (Große Hekhalot 64).
SHI´UR KOMA:
Im Aram. bedeutet Koma „Körper“, weshalb nicht „Maß der Höhe“, sondern Maß des Körpers zu übersetzen ist. Die Spekulation über
das Maß der Gottheit nimmt in der Merkaba-Mystik breiten Raum ein. Hier ist das Hohelied Vorbild: 5:10ff.
„Mein Geliebter ist weiß und rot, ist ausgezeichnet vor Tausenden. 11 Sein Haupt ist reines Gold. Seine Locken sind Rispen, rabenschwarz. 12
Seine Augen sind wie Tauben an Wasserbächen; (die Zähne), in Milch gebadet, sitzen fest. 13 Seine Wangen sind wie Balsambeete, darin Gewürzkräuter sprießen, seine Lippen wie Lilien; sie tropfen von flüssiger Myrrhe. 14 Seine Finger sind wie Stäbe aus Gold, mit Steinen aus Tarschisch besetzt. Sein Leib ist wie eine Platte aus Elfenbein, mit Saphiren bedeckt. 15 Seine Schenkel sind Marmorsäulen, auf Sockeln von Feingold. Seine Gestalt ist wie der Libanon, erlesen wie Zedern. 16 Sein Mund ist voll Süße; alles ist Wonne an ihm. Das ist mein Geliebter, ja, das ist
mein Freund, ihr Töchter Jerusalems.“
139
Grundkurs Judentum
Kabbala
Kontext: Verständnis des Hld als Exodusmidrasch
Weitere Beschreibung als Detailbeschr. von Gliedern Gottes. Buchstabenkombinationen Geheimnamen der Glieder. Vers: Ps 147,5: gadol elohenu werab koach. Die Größe unseres Herrn ist 236 Parasangen. Grundzahl. Parasange = 3 Meilen, Meile 10000 Ellen, Elle drei Spannen, und eine
Spanne erfüllt Welt = Jes 40,12.
Der Sefer Jezira
Der Sefer Jezira ist eines der faszinierendsten Beispiele der jüdischen Auseinandersetzung mit der Schöpfung und den Geheimnissen der Buchstaben. Sein Name schon verrät, dass es sich um ein Buch über die Erschaffung handelt, wobei nicht klar ist, welche Erschaffung damit gemeint
ist. Schon die rabbinische Literatur hat in einigen Beispielen Spekulationen über die Erschaffung von Dingen angestellt. So berichtet San 65b,
dass Rabbi Hanina und Rabbi Hoshia sich jedesmal freitags vor dem Sabbat mit dem Sefer Jezira beschäftigten und sich dabei ein dreijähriges
Kalb erschufen, dass sie daraufhin verspeisten. Diese Erzählung ist in mehreren Varianten weiterüberliefert und ausgelegt worden. Manche Ausleger schwächten die Tatsache einer solchen Schöpfung dadurch ab, dass sie behaupteten, es habe sich um eine meditative Schau gehandelt.
Selbst der uns noch ausgiebig beschäftigende Abraham Abulafia hat im 13. Jh. behauptet, ihre Schöpfung sei mystisch, nicht physisch gewesen.
Rabbi Shlomo ben Aderet wiederum fand es besonders aufschlussreich, dass der Tag, an dem die Schöpfung geschah, ein Freitag war, an dem
ursprünglich die Säugetiere erschaffen wurden. In jedem Fall haben wir es mit dem vorliegenden rabbinischen Zeugnis mit einer wichtigen Quelle
für die weitere Tradition zu tun. Ebensolches wird auch für die Erschaffung des Golem gelten, auf die ich später ausführlich eingehen werde.
Eine Identifikation des Sefer Jezira im Talmud mit unserer mystischen Schrift ist nicht notwendig, aber auch nicht unmöglich. Die Abfassungszeit
des Sefer Jezira wird häufig tief angesetzt und schwankt zwischen dem 2. und 8. Jh. Mir scheint eine eher spätere Ansetzung plausibler. Sicherlich aber muss der Sefer Jezira vor Saadja Gaon angesetzt werden, der bereits eine Kommentar dazu schreibt.
Der Text:
Der Traktat ist kurz und hochkonzentriert. In seiner kurzen Version enthält er nur etwa 1300 Worte, die Langversion ist mit 2500 Worten immer
noch kurz. Eines der frühest gefundenen Fragmente bringt das ganze Buch immerhin auf nur eine einzige Seite. Manche spekulierten, dass der
Ursprung nur 240 Worte umfasst haben soll.
Der gegenwärtige Text hat 6 Kapitel, was in manchen Überlieferungen als Pendant zur Mischna interpretiert wurde. Saadja Gaon, der früheste
Kommentator, überliefert das Buch in 8 Kapiteln. Sicher ist, dass das Buch aus mehreren Teilen zusammengesetzt ist, wahrscheinlich aus vier.
Das erste Kapitel führt die Sefirot ein und behandelt sie ausführlich. In den nächsten Kapiteln ist davon keine Rede mehr.
„In 32 mystische Wege der Weisheit
Gravierte YAH
Der Gott der Heerscharen,
der Gott Israels,
der lebendige Gott,
König des Universums
El Shaddaj,
barmherzig und gnädig,
140
Grundkurs Judentum
Kabbala
hoch und erhaben,
der da ewig wohnt,
dessen Name heilig ist –
er ist hoch und erhaben –
und er schuf sein Universum
mit drei Büchern (Sefarim)
durch Text (Sefer)
durch Zahl (sefar)
und durch Mitteilung (Sippur).“
So heißen die ersten Worte des Buches. Diese 32 Wege der Weisheit sind die zehn Urzahlen und die 22 Konsonanten des hebräischen Alphabets, von denen Kapitel zwei ganz allgemein handelt und die in Kapitel drei bis sechs speziell in ihrer Bedeutung als Elemente und Bausteine des
Kosmos betrachtet werden.
Die zehn Urzahlen sind die Sefirot, abgeleitet von sfr, was eigentlich „zählen“ heißt. Als Zähleinheiten verwendet man im hebr. üblicherweise den
Begriff Mispar, was schon zeigt, dass hier nicht an normale Zahlen gedacht ist, sondern an metaphysische Weltprinzipien oder Schöpfungsstufen.
Die Wortverbindung „Sefirot beli ma“ in 1:2 unterstreicht diese Anschauung.
„Zehn Sefirot des Nichts (beli ma)
und 22 grundlegende Buchstaben:
drei Mütter,
sieben Doppelte
und zwölf Einfache.“
Was ist beli ma? Die einfache Übersetzung mit „Ohne was“ mag zwar Alpendeutsch sein, gibt aber auch wieder, was die Kabbalisten darunter verstanden haben mögen. Der Begriff kommt nur einmal in der Bibel vor, nämlich in Ijob 26,7. Hier interessanterweise im Kontext der Weltschöpfung.
Sefirot des Nichts soll zeigen, dass die Sefirot rein geistige und ideale Konzepte darstellen. Sie sind begrifflich. Andere Quellen wieder meinen,
dass belima aus der Wurzel balam abzuleiten sei, was „zügeln“ bedeute, so in Ps 32,9. Dies würde in 1:8 des Sefer Jezira einen Anklang finden,
wo es heißt:
„Zügle deinen Mund, von ihnen zu sprechen“.
Demnach würden die Sefirot als „unaussprechlich“ gelten. Sie sind unbeschreibbar. In jedem Fall werden die Sefirot von den Buchstaben unterschieden. Isaak von Akko hat im 13. Jh. festgestellt, dass der Begriff belima und der Begriff Elohim für Gott nur einen einzigen Unterschied im Zahlenwert haben. Elohim ist 86, belima 87. Er deutet dies als Hinweis, dass belima gleich nach der reinen Existenz Gottes existiert.
Jede der Urzahlen ist mit einer bestimmten Schöpfungskategorie verbunden. Die ersten vier Sefirot emanieren auseinander; die erste Sefira wird
mit „ruach elohim hajim“, mit dem Pneuma des Lebendigen Gottes identifiziert. Aus ihr geht die zweite Sefira hervor, das Urelement der Luft, das
in späteren Kapiteln mit dem Äther gleichgesetzt wird. Aus der Urluft emaniert das Wasser als dritte und aus dem Wasser das Feuer als vierte Sefira. Aus der Urluft schuf Gott auch die 22 Konsonanten, aus dem Urwasser das kosmische Chaos und aus dem Urfeuer den Thron der Herrlichkeit
und die Ordnungen der Engel.
141
Grundkurs Judentum
Kabbala
Die anderen sechs Sefirot stellen die sechs Richtungen des Raumes dar. Sie emanieren nicht aus den vier Urelementen, bilden aber mit ihnen
eine nicht näher bezeichnete Einheit.
Das zweite Kapitel besteht aus einer Besprechung der Buchstaben des Alphabets. Die fünf phonetischen Familien und die 231 Tore werden vorgestellt. Darauf werde ich noch näher eingehen.
Vorher aber noch allgemein:
Kapitel drei bis fünf behandeln die drei Klassen der Buchstaben: Mütter, Doppelte und Einfache. Diese drei verbunden mit dem „Universum, der
Seele und dem Jahr“ stellen ein ausführliches System dar. Kosmologie, Kosmogonie und Linguistik gehen in eins.
Die 22 Konsonanten sind Grundelemente des Kreatürlichen. Sie werden eben in drei Gruppen gefasst.
Die erste umfasst die drei Mütter, alef, mem und shin. Ihnen entsprechen die Elemente Luft, Wasser und Feuer. Auch die Jahreszeiten und Teile
des menschlichen Körpers werden mit Ihnen in Verbindung gebracht. Die zweite Gruppe bilden die sieben Doppelkonsonanten (bfdkfrt). Die sieben Planeten, Himmel, Wochentage, Öffnungen des Körpers und fundamentale Gegensätze des menschlichen Lebens (Leben/Tod, Frieden/Unheil, Weisheit/Torheit/, Reichtum/Armut, Anmut/Hässlichkeit, Aussaat/Verwüstung, Herrschaft/Knechtschaft) werden ihnen zugeordnet sowie die sechs Himmelsrichtungen mit dem Tempel der Welt, der alles trägt.
Die zwölf einfachen Konsonanten der dritten Gruppe entsprechen den 12 Tierkreiszeichen, Monaten, Haupttätigkeiten und Hauptorganen des
Menschen. Die Kombinationen all dieser Elemente enthalten die Wurzel aller Dinge, und je nach Anordnung der Elemente entsteht Gut oder Böse,
Nutzen oder Schaden.
Besonders bedeutsam ist schon hier, dass es eine ganz enge Verbindung zwischen der astronomischen Welt und dem Körperbau des Menschen
gibt.
Lassen Sie mich etwas genauer auf das Buch eingehen. Was ist sein Grundansatz?
Die Bibel sagt uns, Gott habe die Welt durch Sprechen erschaffen. Aber wie kann Gott sprechen, wenn er doch der transzendente Gott ist? Wie
kann immaterielle Rede eine materielle Welt schaffen? Der Sefer Jezira gibt eine Antwort darauf. Gott sprach nicht im Sinne einer menschlichen
Rede, sondern vielmehr eine Manipulation der Buchstaben des hebräischen Alphabets. Buchstaben sind nicht einfach linguistische Zeichen, sie
haben reale Existenz jenseits des menschlichen Verstandes. Sie bestehen aus einer eigenen geistigen Substanz und können von Gott geformt,
gewogen, geordnet werden. Schöpfung ist dann die spezielle Ordnung der Buchstaben, die Wirklichkeit schafft. Mehrere Ansätze dazu finden sich
im Buch selbst. So heißt es in Kapitel 2, Mischna 2ff:
Zweiundzwanzig grundlegende Buchstaben:
Er gravierte sie. Er meißelte sie,
Er permutierte sie. Er wog sie,
Er transformierte sie,
Und mit ihnen bildete Er alles, was geschaffen war,
und alles, was geschaffen wird.
142
Grundkurs Judentum
Kabbala
Zweiundzwanzig grundlegende Buchstaben:
Er gravierte sie mit Stimme
Er meißelte sie mit Geist
Er setzte sie in den Mund
An fünf Orte
Alef Chet He Ajin in die Kehle
Gimel Jod Kav Quf in den Gaumen
Dalet Tet Lamed Nun Tav in die Zunge
Sajin Samech Shin Resh Zade in die Zähne
Bet Vav Mem Pe in die Lippen.
Zweiundzwanzig grundlegende Buchstaben:
Er ordnete sie in einem Kreis
Wie eine Mauer mit 231 Toren.
Der Kreis schwingt vor und zurück.
Ein Zeichen dafür ist:
Es gibt im Guten nichts über Freude (´Oneg)
Es gibt im Bösen nichts unter Plage (Nega´)
Wie?
Er permutierte sie, wog sie, und transformierte sie,
Alef mit ihnen allen,
und sie alle mit Alef
Bet mit ihnen allen,
und sie alle mit Bet.
Sie wiederholen sich in einem Kreis
und existieren in 231 Toren.
Es findet sich, dass alles, was geschaffen war,
und alles, was gesprochen war,
aus einem Namen hervorging.
David Blumenthal, der große Wissenschaftler aus der Atlanta Emory University, hat den sehr verdienstvollen Versuch unternommen, per Computer den Sefer Jezira zu entschlüsseln. Ich versuche, Ihnen seine Ergebnisse zusammenzufassen:
Man kann sich bemühen, die grundlegende Sequenz der Buchstaben zu rekonstruieren. Nach 5 ist jeder Buchstabe mit allen anderen Buchstaben
zu kombinieren, nicht aber mit sich selbst. Das bringt 462 Buchstabenpaare (22 Buchstaben x 21 Buchstaben). Wenn man die Spiegelbilder weg
143
Grundkurs Judentum
Kabbala
lässt (also AB BA), bekommt man 231 Basispaare. Im Deutschen würde man folgende Sequenz erhalten: AB, AC, AD...BC, BD, BE... CD, CE,
CF... YZ.
Der Text sagt, dass diese Paare auf zweiwegig zu gestalten sind – vorwärts und rückwärts (Alef mit ihnen allen, und sie alle mit Alef). So ergeben
sich 2 Reihen von 231 Basispaaren. Die Basissequenz sind 2 Reihen von Basispaaren. Im Deutschen: AB, AC, AD...BC, BD, BE... CD, CE, CF...
YZ, umgekehrt: ZA, YA, XA... ZB, YB, XB... ZC, YC, XC... ZX.
Wie kommt man nun zu den zwei vorgeschlagenen Formen, nämlich dem Kreis und der Mauer. Das Wort Mauer lässt an eine Tafel oder ähnliches
denken. Dem entspricht Figure 1. Kreis oder auch Rad, in manchen Ausgaben auch im Plural, lässt an ein Rad mit Speichen oder einen Stern
denken. Man kann die Basissequenz in der Form von zwei solchen Sternen darstellen. Figure 2, 3 und 4 sowie 5.
Eleazar von Worms hatte eine andere Methode, um zu den 231 Paaren zu kommen. Jeder Buchstabe wird mit dem unmittelbar folgenden kombiniert, dann mit dem nächstfolgenden, dann mit dem Buchstaben, der 3 weiter ist, bis nur mehr der 1. und letzte Buchstabe kombiniert werden können. Im Deutschen: AB, BC, CD, DE... AC, BD, CE... AD, BE, CF... AZ.
Saadj und Pseudo-Abraham Ibn Daud verstanden das Hebr. Galgal (Rad, Kreis) als „Sphäre“, als himmlische Sphäre. Die 231 Basispaare wurden
auf die Oberfläche der Himmelssphäre mit seiner dauernden Rotation gestellt.
Wenn man nun die Basissequenz entziffert hat, bleibt die Frage. Was waren die „Tore“ und wie funktionierten sie?
Saadja verstand jedes Buchstabenpaar der Basissequenz als „Tor“. Eleazar von Worms meinte, die Tore seien eine Reihe von Buchstaben, angeordnet nach seinem magischen Alphabet. Er meinte, dass man diese alphabetischen Reihen in ihrer bestimmten Folge aufsagen muss, um einen
Golem zu erzeugen. Wollte man den Golem wieder zerstören, musste man die umgekehrte Reihenfolge einhalten. Aber diese Vorschläge sind alle
nur Beispiele.
David Blumenthal macht es wahrscheinlich, dass die 231 Basispaare der Rückwärtssequenz über die 231 Paare der Vorwärtssequenz zu setzen
sind, sodass der zweite Buchstabe der oberen Linie der Paare mit dem ersten Buchstaben der unteren Linie übereinstimmt. Figure 1. Jeder dieser
Gruppierungen formt dann ein Tor, sodass 231 Tore entstehen.
Das nächste Problem ist, welche Gruppen von Toren die Tafel der magischen Buchstaben konstituieren, mit denen Gott das Universum erschuf.
Die Lösung liegt in 4:
Ein Zeichen dafür ist:
Es gibt im Guten nichts über Freude (´Oneg)
Es gibt im Bösen nichts unter Plage (Nega´)
Die Kommentatoren hatten dieses Zeichen moralistisch gedeutet, in dem Sinne, dass man mit der richtigen Einstellung die Buchstaben kombinieren müsse. Die moralistische Sicht in einem magisch-spekulativen Text ist unbefriedigend.
Eher ist anzunehmen, dass die Formel als mechanisch-magischer Schlüssel fungiert, durch den die korrekte Anordnung der Tore ausfindig gemacht werden kann.
Die Zitation beinhaltet vier Schlüsselbegriffe: tova (Gutes), ra´a (das Böse), oneg (Freude), nega (Böses, Lepra). Drei der Schlüsselwärter haben
drei Buchstaben. Möglicherweise sollte auch tova mit nur drei Buchstaben gelesen werden, also tvh defektiv oder tov.
Mathematischer Theorie zufolge kann jede Vierereinheit in eine Dreiereinheit verwandelt werden, wenn sie die Form AB-BC enthält, also der mittlere Teil der beiden Einheiten gleich ist. So kann man folgende Tore eröffnen: tv-vb (oder tb-bh), ON-NG, RO-OH, NG-GO. Um dies zu erreichen,
144
Grundkurs Judentum
Kabbala
muss man die Tafel so bearbeiten, dass eine oder mehrere dieser Tore erscheinen. Man kann die Buchstaben der unteren Linie der Figure 1 beibehalten und die Buchstaben der oberen Linie nach links bewegen. Man nennt dies Bewegung dann Rotation. Alle 11 obere Linien der Tafel werden gleichzeitig bewegt. Nach jeder Rotation gibt es eine neue Tafel. So entstehen 21 Tafeln, die alle 231 Tore enthalten, also insgesamt 4851
mögliche Tore. Da man nicht weiß, welche Tafel die Schlüsselworte enthält, muss eine zusätzliche Operation geschehen. Man kann jede untere
Linie ein Feld nach oben schieben. Nach allen entsprechenden Vorgängen gibt es wieder 21 mögliche Rotationen für jeden dieser Zeilen. Da es
11 Zeilen gibt, die weitergeschoben werden können und 21 Rotationen, hat man 21 Tafeln. Jede Tafel hat 231 Tore, ergibt 53.361 Tore. Wenn
man das ganze auch noch umdreht, also die untere und obere Zeile vertauscht und die selben Vorgänge vornimmt, ergibt dies 462 Tafeln mit
106.722 Toren.
Um die richtigen Tore zu finden, welche den mechanischen Schlüssel oder das Zeichen bieten, musste man allerdings nur die untere Linie der ersten Operation festhalten und die obere Linie 17 Plätze nach links verschieben (Figure 6), wo die Tore NG-GO zweimal erscheinen (3.12 und 3.10).
Eine andere korrekte Tafel wird durch Verschieben der oberen Linie um 12 Plätze nach links erreicht (Figure 7). Hier erscheint TB-BH zweimal (2.3
und 2.7). Das Zitat aus Mischna 4 funktioniert also an bestimmten Stellen. Wenn das bestimmte Schlüsselwort erreicht ist, funktioniert es wie ein
Türöffner, der von der oberen in die untere Linie fällt und die Bewegung des Ganzen abschließt. Da die Stichworte sowohl richtig als auch verkehrt
sperren, ist eine doppelte Verriegelung merkbar. Natürlich gibt es auch für das Rad oder den Stern eine richtige Anordnung (Figure 8-10).
Die letzte Frage ist nun. Wie wurde diese Tafel oder die Tafeln angewendet?
Sefer Jezira erzählt davon nichts. Auch andere Quellen geben davon kein Zeugnis...
Was aber sollte überhaupt erschaffen werden?
Im Buch heißt Schöpfung stets yezur. Yezur aber meint nicht zuletzt die Schöpfung von Menschen. So beschreibt die Pesiqta Rabbati, dass Adam,
Jakob, Jes und Jer als yezurim erschaffen wurden. Im Nishmat-Gebet heißt es auch, dass es Pflicht aller yezurim sei, Gott zu preisen. Gerade der
intensive Zusammenhang von Buchstaben und Gliedern, der in Sefer Jezira eine große Rolle spielt, lässt den Schluss zu, dass nicht an irgend
eine Schöpfung, sondern an die Schöpfung eines Menschen gedacht war. Nur der Mensch wird mit der Zahl 22 in Verbindung gebracht. Diese
Verbindung begegnet auch in der Gnosis. Nach Irenäus Adversus Haereses I 14:1-3 habe Markos einen menschlichen Körper beschrieben, dessen Glieder dem göttlichen Namen korrespondieren. Auch jedes einzelne Glied entspricht den bei ihm – allerdings im Unterschied zum Sefer Jezira - zwei Buchstaben.
In jedem Fall ist die Annahme durchaus sinnvoll, dass der Sefer Jezira die Schöpfung des Menschen im Sinn hatte.
Noch ein wichtiger Aspekt taucht im Buch auf:
Am Ende des Kapitels 6 heißt es:
„Und als Abraham, unser Vater, - mag er in Frieden ruhen -,
schaute, sah verstand und forschte,
gravierte und meißelte
War er erfolgreich beim Erschaffen,
wie geschrieben steht:
„Und die Seelen, die sie in Haran gemacht hatten (Gen 12,5).
Unverzüglich war ihm der Herr von allem offenbar,
mag sein Name auf immer geheiligt sein,
145
Grundkurs Judentum
Kabbala
Er setzte ihn in seinen Busen, küsste ihn auf sein Haupt
und nannte ihn „Abraham mein Geliebter“ (Jes 41,8).
Er schloss einen Bund mit ihm
und mit den Kindern nach ihm auf ewig,
wie es geschrieben steht:
„Abraham glaubte Gott,
und er rechnete es ihm als Rechtschaffenheit an“ (Gen 15,6).
Er schloss einen Bund mit ihm
zwischen den zehn Fingern seiner Hände
– das ist der Bund der Zunge,
und zwischen den zehn Zehen seiner Füße
– das ist der Bund der Beschneidung,
und er band die zweiundzwanzig Buchstaben der Tora an seine Zunge
und enthüllte ihm seine Mysterien.
Er zeichnete sie in Wasser,
flammte sie mit Feuer,
erregte sie mit Geist.
Er brannte sie mit den sieben Planeten,
leitete sie mit den zwölf Sternbildern.“
In 1:4 heißt es:
„ Zehn Sefirot des Nichts: Zehn und nicht neun, zehn und nicht elf. Verstehe die Weisheit, und sei weise mit Verständnis. Prüfe mit ihnen und forsche aus ihnen, stelle jedes Ding auf seine Essenz, und lass den Schöpfer auf seinem Thron (makhon) sitzen.“
Was klingt hier an? Dass nämlich der Student der Sefirot zuerst deren Geheimnis verstehen und dann danach handeln soll. Das Handeln setzt
einen aktiven Vorgang voraus. Es ist verbunden mit dem Handeln Gottes und hat, wie der Sprachgebrauch deutlich nahelegt, auch Einfluss auf
Gott. Vor allem der verwendete Ausdruck Makhon ist von großer Bedeutung. In der Phrase „makhon shivto“ begegnet der Ausdruck deutlich als
Hinweis auf Gottes Thronen. Hier schlägt sich die Brücke zu der Mystik der Merkaba, zu den Hekhalot, den himmlischen Thronhallen. Hier wird
also nichts anderes ausgesagt, als dass ein unrichtiges, unwürdiges und unpassendes Verständnis des Geheimnisses dazu führen würde, dass
Gott selbst auf seinem Thron gefährdet wäre. Das steht in engem Zusammenhang mit der noch näher zu besprechenden kabbalistischen Grunderkenntnis, dass Gott und Mensch in einer engen Verbindung stehen, ja der Mensch geradezu notwendig ist, um Gott Gott sein zu lassen.
Abraham erscheint als jene biblische Figur, die es schafft, all die Zusammenhänge zu durchschauen. Er hat, so sagt Sefer Jezira, auch „Seelen in
Haran“ geschaffen. Dies hat man im MA immer als Schöpfung von Menschen verstanden. Im Unterschied zu den Götzendienern in Haran, die nur
tote Götzen aufzustellen vermochten, schafft es Abraham, Leben in den Menschen zu geben.
146
Grundkurs Judentum
Kabbala
Abraham steht auch in einer anderen Verbindung zu den Buchstaben. Er erhält schon in GenR den Buchstaben H, um seinen Namen von Abram
auf Abraham zu ändern. Er erhält dadurch den Gottesnamen, der im H repräsentiert ist. Wird Abraham dadurch zu einem potentiellen Weltenschöpfer?
GenR 63.19 redet davon, dass Gott Abraham als Weltenschöpfer akzeptierte, weil er den Menschen den Segen Gottes brachte, ihnen Gott näherbrachte. Abraham gilt ja als großer Proselytenmacher, vor allem im Kontext mit der Begegnung mit Melchizedeq in Gen 14. Hier hinein passt die
Gleichsetzung von babraham mit bhibaram in der Erzählung von der Weltschöpfung in GenR 12:9. Demnach könne man lesen: „Mithilfe von Abraham wurden sie geschaffen“, was der Midrasch so versteht, als wären sie wegen des positiven Wirkens Abrahams geschaffen worden. Hier treten
freilich die spirituellen Aspekte in den Vordergrund. Der Sprachgebrauch aber erlaubt, Abraham als ersten Erschaffer eines Menschen, eines Golem zu sehen. Gerade er zeichnet sich ja dadurch aus, dass er einen Geist bekommen muss, um nicht klobige Masse zu bleiben.
Jedenfalls wollte der Autor des Sefer Jezira eine Verbindung schaffen zwischen der Kenntnis des Buches, einer bestimmten Operation damit und
der Einheit Gottes. Gott ist der eine und einzige, der schaffen kann. Lediglich Abraham verstand es aufgrund seines Wissens, ihm nahe zu kommen. Jeder andere Mensch, so erkannten die Kabbalisten in ihren Büchern und Abhandlungen, braucht einen zweiten, einen Mitarbeiter. Allein
kann er keine Schöpfung zustande bringen. Jehuda Barcelonis Kommentar drückte es ganz deutlich aus. „ein Schwert steht über den Gelehrten,
die allein sitzen, jeder für sich selbst, und sich selbst mit der Tora befassen. Lass uns treffen und uns gemeinsam mit dem Sefer Jezira beschäftigen. Und so saßen sie und meditierten darüber über drei Jahre und verstanden es. Als sie so handelten, stand ein Kalb geschaffen bei ihnen und
sie schlachteten es, um damit den Abschluss ihrer Abhandlung zu feiern.“ Hier ist die Brücke geschlagen zum Text von San.
Das Buch Bahir
Sefer ha-Bahir: „Midrasch R. Nechunja b. ha-Kana“ (weil ihm von Nachmanides zugeschrieben) bzw. „Bahir“ nach Ijob 37,21. Um 1180 entstanden
In der jetzigen Form 12.000 Worte. Mischung aus hebr. und aram.
Kennt die Midraschim (auch PRE, Otijjot de R. Akiba).
Inhalt:
Bibelverse werden interpretiert, kurze Diskussionen zwischen Rabbinen. Zahlreiche Gleichnisse.
Mystische Bedeutung der Stellen an bestimmten Buchstaben orientiert, an Vokalen und liturgischen Zeichen, an heiligen Namen und Magie und
an der Verwendung des Sefer Jezira.
Esoterische Auslegung von Halakhot zu Zizit, Terumot, Tefillin, Lulav, Etrog etc.
Sprunghaft, kein roter Faden.
Dennoch Gliederung möglich:
1. Äußerungen, die auf dem Sefer Jezira basieren;
2. die zehn Sefirot, die hier zehn Ma´amarot (Äußerungen) heißen: auch „Logoi“, „Gefäße“, „Könige“, „Stimmen“ und „Kronen“ genannt. Sie bilden
auch die Begründungen für die Mizvot.
Neuplatonische Emanationssymbolik, Sexualsymbolik.
Die himmlischen Mächte konstituieren den geheimen Baum, auf dem die Seelen wachsen. Sie sind die Summe der heiligen Formen, die zusammen in der Gestalt des Adam qadmon erscheinen. Alles Heilige in der unteren Welt hat Teil an der oberen Welt. Noch existiert der Name En Sof
nicht, die erste Sefira („Keter eljon“) ist noch nicht genau definiert, ob sie der transzendente Gott oder eine erste Emanation ist.
147
Grundkurs Judentum
Kabbala
Das Buch erscheint Ende des 12. Jh. in Südfrankreich. Es übernahm den Sefer Raza Rabba, das vielfach ergänzt wurde. Stark gnostisch beeinflusst.
Man nahm das Buch bald als alte autoritative Quelle aus talmudischer Zeit an.
Kommentare dazu von Meir b. Solomon Abi-Sahula (1331: Or ha-Ganuz); David Havillo, Meir Poppers (Lurianer).
Erstedition 1651 (durch einen Christen in Amsterdam).
Die deutsche Mystik (die ersten sog. Chassidim)
Zentrum Speyr, Worms und Mainz: Kalonymiden, aus Italien kommend
Samuel he-Chassid
Juda he-Chassid (+ 1217)
Eleasar ben Juda (+ um 1232).
Sefer Chassidim wichtigste Quelle
Beeinflusst von Quellen aus der Merkaba-Mystik, von Saadja Gaon und Abraham ibn Esra und Abraham bar Chija (neuplatonisch), aber auch von
okkultem Dämonenglauben.
Die Frömmigkeit erhielt zwar eschatologische Elemente, war aber dem Messianismus gegenüber skeptisch:
„Siehst du, dass jemand über den Messias weissagt, so wisse, dass er sich mit Zauberei oder Dämonenspuk abgibt. Oder aber er gehört zu denen, die mit dem Gottesnamen Beschwörungen vornehmen. Weil sie nun die Engel oder Geister für sich bemühen, sagen die zu ihm: Verkünde es
nicht so, dass es aller Welt offenbar werde. Und am Ende wird er vor aller Welt zuschanden, weil er die Engel und Dämonen bemüht hat, und statt
dessen tritt ein Unglück ein... Die Dämonen kommen und lehren ihn ihre Berechnungen und apokalyptischen Geheimnisse, um ihn und die ihm
glauben zu beschämen, denn niemand weiß etwas über das Kommen des Messias“ (Sefer Chassidim § 212).
Naturrechtliche Sozialtheorien
Geschichtstheologie:
Von den Tagen der Schöpfung her gibt es sog. Gegenkräfte, wie Unkraut. Dornen und Disteln in Gen 3,18. Profaner Geschichtsverlauf steht dem
sakralen entgegen. Fall des ersten Menschen, Hinweis auf soziale Ungerechtigkeit, Menschen sollten bei der Landwirtschaft bleiben.
Wichtig ist Menschentyp des Chassid
Der Psalmensager wird zur chassidischen Legendenfigur: das Aufsagen von Psalmen verhindert die Vernichtung einer Gemeinde anlässlich der
Pest (1348-1351) (so zumindest nach einer von Naftali Bacharach 17. Jh. in emek ha melech15a zitierten Psalmauslegung zu Ps 150 von Avigdor
Kara 14. Jh.)
Drei Charakteristika: asketische Abwendung von den Dingen, vollkommener seelischer Gleichmut, prinzipieller Altruismus.
148
Grundkurs Judentum
Kabbala
Abwendung von profanem Leben und bürgerlicher Lebenshaltung
Soll Spott und Schande ertragen
„Wenn der Psalmist sagt: Um deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag lang, so meint er damit diejenigen, die Schmach und Schande und
Erniedrigungen bei der Ausübung der Gebote auf sich nehmen“ (Sefer Chassidim 976).
„Die Seele ist voll der Liebe zu Gott und mit Stricken der Liebe gebunden, in Freude und frohen Herzens. Er – der Chassid -ist nicht wie einer, der
seinem Herrn widerwillig dient, sondern selbst wenn man es ihm verwehren will, brennt in seinem Herzen die Liebe zu dienen, und er freut sich,
den Willen seines Schöpfers auszuführen... Denn wenn die Seele tief über die Gottesfurcht nachsinnt, so flammt die Lohe der Herzensliebe in ihr
auf, und der Jubel innerlicher Freude erquickt das Herz... Und der Liebende bedenkt nicht seinen Vorteil in dieser Welt, er sorgt ich nicht um die
Ergötzung seiner Frau, noch um seine Söhne und Töchter, vielmehr ist ihm alles ein Nichts, außer diesem, dass er den Willen seines Schöpfers
tue, an anderen Gutes tue, den Namen Gottes heilige... und alles Sinnen seiner Gedanken brennt im Feuer der Liebe zu ihm“ (Eleasar aus
Worms)
Juda he-Chassid hatte sich zwar gegen magische Praktiken gewandt, war aber in der Folge stark damit in Verbindung. gebracht worden. Chassid
wird zum Herrn der magischen Gewalten, der alles erlangen kann. Ausbildung der Idee des Golem
Wer sich in das Buch Jezira versenkte, konnte in einer Art ekstatischen Bewusstseinszustand einen Golem schaffen.
Gebetsmystik und Gebetsmagie zentrale Bedeutung
Erstaunliche Bußdisziplin:
Vier Kategorien der Buße:
Teschubat habaa: Gelegenheit zur gleichen Sünde werden verstreichen gelassen
Teschubat hagader: Enthaltung von Dingen, die zu Sünde führen könnten
Teschubat hamischkal: Maß der Askese bemisst sich am Genuss an der Sünde
Teschubat hakatub: Schwerste Kasteiungen
„Ein Chassid pflegte oft im Sommer auf der Erde zwischen Flöhen zu schlafen und im Winter die Füße in ein Gefäß mit Wasser zu tun, bis sie mit
dem Eis zusammenfroren. Ein Schüler fragte ihn: Warum tust du das? Warum, wo doch der Mensch für sein eigenes Leben verantwortlich ist,
setzt du dich sicherer Gefahr aus? Der Chassid antwortete: Gewiss habe ich keine Todsünde begangen, und wenn ich auch sicherlich leichtere
Sünden auf mir habe, brauchte ich mir deswegen noch nicht solche Qualen aufzuerlegen. Aber es heißt im Midrasch, der Messias leide für unsere
Sünden, wie es heißt: »er wurde wegen unserer Gesetztesübertretungen verwundet« (Jes 53,5), und auch die vollkommenen Gerechten nehmen
für ihre Generation Leiden auf sich. Ich will aber nicht, dass irgend jemand außer mir selber für meine Sünden leidet“ (Sefer Chassidim § 1556).
Gottesbild: absolute Geistigkeit und über alle Maßen hinausreichende Unendlichkeit. Gott ist Weltkraft und Weltgrund
149
Grundkurs Judentum
Kabbala
„Gott ist überall und sieht Gute und Schlechte. Sprichst du daher Gebete, so sammle deinen Sinn, denn es heißt: »Ich stelle Gott immer mir gegenüber«, und daher lautet der Anfang aller Benediktionen: Gelobt seist du, Gott – etwa wie ein Mensch, der zu seinem Freunde spricht“ (Eleazar
aus Worms, Sefer Chassidim § 549).
In den Gebetbüchern abgedruckter Einheitsgesang: „Alles ist in dir und du bist in allem; du umgibst das All und erfüllst das All; als das All entstand,
warst du im All; bevor das All entstand, warst du das All.“
Mose Azriel: „Er ist einer im Weltenäther, denn er erfüllt den Äther und ist in jedem Ding in der Welt, und da ist nirgends eine Scheidewand vor
ihm. Alles ist in ihm, und er sieht alles, denn er ist ganz und gar Sehen, ohne dass er doch Augen hätte, denn er hat die Kraft, in seinem eigenen
Wesen das All zu sehen“ (MS British Museum 752 78b).
Gott als „Seele der Seelen“
Dtn 7,21 übersetzt: „Denn der Herr, dein Gott, ist mitten in dir“.
Interesse geht nicht auf Schöpfung, sondern auf Offenbarung: Wie kann Gott dem Geschöpf erscheinen?
Lehre vom Kabod: Kabod ist erste Schöpfung, erschaffenes Licht (so nach Saadja). Ist identisch mit dem Heiligen Geist und der Schechina. Gott
selbst verharrt im Schweigen
Innere Glorie: Kabod penimi: Schechina, Gottes Willen
Sichtbare Glorie: Maße Gottes, Merkaba
Schau ist Belohnung für die Chassidim
Heiliger Cherub: Ez 10,4; vielleicht ein verwandelter Logos
Abraham bar Chija: Fünf geistige Welten: höchste ist Lichtwelt im Westen, die Heiligkeit. Dann Welt der Gottheit, des Intellekts, der Seele und der
geistigen Natur.
Wahre Intention des Gebets richtet sich auf die Heiligkeit, die in aller Kreatur verborgen ist. Schechina eigentliches Ziel des Gebets. Nur im eschaton, in der messianischen Zeit, wird sich das Gebet an Gott selbst richten.
Alles hat sein Urbild, eingewebt in den Vorhang vor dem Thron der Glorie. Sphäre der gottesnahen, unkörperlichen Existenz.
Die praktische oder prophetische Kabbala
Abraham ben Samuel Abulafia
geb. 1240 in Saragossa, Kindheit Tudela/Navarra. Mit 18 Vater verloren, verließ schon mit 20 Spanien, wollte den Fluss Sambation suchen, hinter
dem die 10 verlorenen Stämme wohnen sollten. Ging von Akko nach Europa und blieb in Griechenland und Italien.
150
Grundkurs Judentum
Kabbala
Verehrte Maimonides, schrieb Kommentare zum More Nebuchim.
1270 kehrt er nach Spanien/Barcelona zurück und vertieft sich in das Sefer Jezira und 12 Kommentare dazu.
Er ist von Baruch Togarmi beeinflusst, der einen „Schlüssel zur Kabbala“ zum Sefer Jezira schrieb.
Prophetischer Geist überkommt ihn, die Erkenntnis des wahren Namens Gottes, Visionen.
Wandte sich wieder nach Italien und Griechenland und beeinflusste Josef Gikatilla.
Schreibt prophetische Schriften unter Raziel oder Zecharija.
1280 begibt er sich nach Rom, um im Namen des Judentums beim Papst vorzusprechen (messianische Sendung). In der Disputation mit Pablo
Christiani verwendet Nachmanides 1263 die Vorstellung, dass der Messias am Ende zum Papst kommen und die Freiheit des Volkes verlangen
werde. Papst Nikolaus III. stirbt aber, Abulafia wird nach 28 Tagen im Kollegium der Franziskaner freigelassen. Um 1291 ist er gestorben. Wichtigeste Schriften entstehen zwischen 1279-1288.
Wichtigste Aussagen: Prophetische Erleuchtung und Erkenntnis des wahren Namens Gottes
Stellt hohe sittliche Anforderungen
Weg der Ekstase und prophetische Inspiration
Es geht um Entsiegelung der Knoten der Seele, damit diese wieder zu ihrem Ursprung zurücklaufe, der ohne Zweiheit ist und die unendliche Vielfalt in sich fasst. Seele ist aus den Fesseln der Sinnlichkeit zu befreien.
Versenkung braucht einen Gegenstand der Konzentration, der aber vom Ziel nicht ablenkt: er findet ihn im Alphabet.
Chochmat ha-Zeruf: Wissenschaft von den Kombinationen der Buchstaben
Wesen der Welt ist sprachlicher Natur
Alles besteht nur aufgrund des Anteils, den es am heiligen Namen Gottes hat.
Buchstaben der geistigen Sprache sind Elemente der Erkenntnis
„Wisse, dass die Methode des Zeruf dem Gehör vergleichbar ist, denn das Ohr hört Töne, und die Töne verbinden sich je nach Art der Melodie
und des Instrumentes. So verbinden sich etwa zwei verschiedene Instrumente, und wenn sich die Töne verbinden, wo wird das Ohr, das ihre Verschiedenheit wahrnimmt, auf schöne Weise gefesselt. Die Saiten, die die rechte oder linke Hand anschlägt, bewegen sich, und der Geschmack
der Töne ist den Ohren süß. Und von den Ohren geht der Ton ins Herz und vom Herzen in die Milz, das Gefühlszentrum, und durch den Genuss
an der Verschiedenheit der Melodien entsteht immer neue Freude. Es ist unmöglich, sie hervorzubringen, es sei denn durch die Kombination der
Töne. Und genau so verhält es sich auch mit der Kombination der Buchstaben. Sie schlägt an die erste Saite an, die dem ersten Buchstaben verglichen wird, und geht von da zu einer, zwei, drei, vier oder fünf Saiten über, und die verschiedenen Anschläge verbinden sich. Aus ihrer Verbindung entstehen Motive und Melodien und gelangen zum Herz. Und die Geheimnisse, die sich in diesen Verbindungen aussprechen, erfreuen das
Herz, das dadurch seinen Gott erkennt und sich mit immer neuer Freude erfüllt“ (Gan na´ul, Ms München 58 323b)
Die Welt der Buchstaben ist die wahre Welt der Seligkeit.
Dies gilt auch für andere Sprachen, nicht nur für das Hebräische. Allerdings sind alle Sprachen nur Ableitungen aus dem H.
Werke:
151
Grundkurs Judentum
Kabbala
Buch vom ewigen Leben
Das Licht des Intellektes
Die Worte der Schönheit
Das Buch der Kombinationen
Schildert die Verfahren: Aussprechen (mibta) Kombination und Niederschreiben (michtab) und Überdenken des Geschriebenen (machschab)
Versenken in die Verbindung der reinen Formen der Buchstaben, die sich als rein geistige Formen der Seele einprägen.
Wichtige Rolle spielt Gematria
Assoziationen als wichtiger Bereich der Konzeption: Dillug und kefiza (Springen und hüpfen)
Bericht auf Seite 148f. Mystik
Prophetie ist Begegnung zwischen menschlichem und göttlichem Intellekt. Einströmen des aktiven Intellekts aus der Welt der reinen Formen und
Intelligenzen ist Erleuchtung.
Ziel ist das Zusammentreffen von Gelehrsamkeit, Einsicht und Erkenntnis aus der Tiefe der Reflexion = Prophetie
Wer die göttliche Berührung spürt, wird er Lehrer genannt. „Denn er ist nun nicht mehr getrennt von seinem Lehrer, und siehe, er ist sein Lehrer,
und sein Lehrer ist er; denn er hängt mit ihm in einer so innigen Verbindung zusammen, dass er auf gar keine Weise von ihm getrennt werden
kann, denn er ist er. Und so wie sein von aller Materie abgelöster Lehrer stets in einem Schel, Maskil und Muskal genannt wird, das heißt Intellekt,
der Intellegierende und das Intelligierte, die alle drei in ihm eines sind, so wird auch dieser ausgezeichnete Mensch, der Meister des ausgezeichneten Namens, selbst Intellekt genannt, während er aktuell erkennt. Dann ist er auch das Intelligierte selbst wie sein Lehrer, und dann besteht kein
Unterschied zwischen ihnen außer dem, dass sein Lehrer seinen höchsten Rang durch sich selber und nicht von anderen Kreaturen her hat, dieser aber seinen Rang durch das Instrument der Kreatur erlangt hat“ (Die Erkenntnis des Messias und die Wissenschaft vom Erlöser MS München
285 26b).
Mensch und Tora werden hier eins.
In der Ekstase findet eine Art Erlösung statt. Der Kabbalist fühlt sich mit Öl gesalbt, wird sozusagen ein eigener Messias. Messias ist also zuerst
eine spirituelle Erfahrung, den der intellectus agens erreicht. Intellectus agens ist der nous poetikos der Griechen aus de anima des Aristoteles. Im
jüdisch (isl.) ma. Denken ist es die Perfektion der Aktualisation des Potentials des Intellekts, das von Gott emaniert.
Aufgabe ist es auch, die innere intellektuelle menschliche Seele von den körperlichen Einflüssen, den „Königen der Welt“ zu reinigen.
Das ist der erste Schritt. Der zweite ist die Anerkennung als König über die Erde
Mit 40, auf der Höhe seiner intellektuellen Kapazität, fühlt sich Abulafia selbst als Messias. Er nennt sich Raziel = 248 = Abraham. Jetzt ist der
Messias geboren.
Interessant ist in diesem Zusammenhang allerdings die Begegnung mit dem Papst. Im Zohar könnte darauf angespielt sein:
Einige dieser Dinge werden in der Zeit (Balaams) erfüllt, andere wiederum später, und wieder andere bleiben für die Zeit des Königs Messias... Wir
haben gelernt, dass der Heilige, Gepriesen sei Er, Jerusalem wieder aufbauen wird und einen Fixstern offenbaren wird, der 70 bewegliche Sterne
als Funken abschießen wird, und mit siebzig Funken, die von diesem Stern im Zentrum des Firmaments erleuchtet werden, und von ihm werden
152
Grundkurs Judentum
Kabbala
weitere 70 Sterne ihr Licht hell erstrahlen lassen für 70 Tage. Und am sechsten Tag des 25. Tages des sechsten Monats wird der Stern erscheinen und zum siebten Tag versammelt werden. Und nach 70 Tagen wird er bedeckt und nicht mehr zu sehen sein. Am ersten Tag wird er in der
Stadt Rom zu sehen sein, und an diesem Tag werden drei hohe Stadtmauern Roms fallen, und der große Palast wird einstürzen und der Herrscher der Stadt wird sterben. In dieser Zeit wird der Stern sich ausbreiten und über der Welt sichtbar werden, dann werden große Kriege erscheinen in den vier Ecken der Welt und der Glaube wird verschwinden. Zohar 3 212b
Nikolaus III starb am 22 August 1280, am 25. Elul, dem sechsten Monat.
Es gibt eine interessante Parallele zwischen dem Messias und dem 6. Tag und Jesus:
Kommentar zum Exodus: 6. und 7. Tag korrespondieren mit Jesus bzw. dem Messias ben Josef (nach anderen Quellen). Yom ha-schischi entspricht Yeschu ha-Notsri = 671
J 10 sch 300 w 6 h 5 n 50 ts 90 r 200 j 10 = 671
J m h sch sch j
Jom ha schiv´i = melek ha-maschiach = 453
J 10 w 6 m 40 h 5 sch 300 b 2 j 10 ajin 70 j 10 = 453
Auch Tammuz und guf ha-satan. Verbindung zwischen Messias und seiner Gegenseite.
Sein ganzes Leben nennt Idel eine „Messianic Timetable“
Er ist im jüd. Jahr 5000 geboren, also 1240. Das ist der Beginn des Milleniums der Prophetie. 1260 wollte er den Sambation überqueren, als die
Mongolen in Israel einfielen. 1270 erhielt er seine erste Offenbarung in Barcelona. 1280 kam die versuchte Papstaudienz und 1290 sagte er die
endgültig Befreiung an. Idel meint, er habe den Papst über die kabbalistische Bedeutung des Judentums aufklären wollen, denn das sei das wahre und einzig wirkliche Judentum. Bekehrung vielleicht, aber nebensächlich.
Praktische Konsequenz also wichtig, nicht Theorie. Auch die Frage der Weltentstehung und ihrer Ewigkeit ist nebensächlich.
Große Wirkung ausgeübt: auch auf praktische Magie und Thaumaturgik: Berit menucha; Werke des Josef ibn Sajjach
Abraham ben Elieser haLewi in Jerusalem (+ um 1530) gibt den Märtyrern den Rat, sich in der Stunde der letzten Prüfung auf den Großen Namen
Gottes zu konzentrieren, sich dessen leuchtende Buchstaben zwischen ihren Augen vorzustellen und ihre ganze Aufmerksamkeit darauf zu richten.
153
Grundkurs Judentum
Kabbala
Der Sefer ha-Zohar (Das Buch des Glanzes): wichtigstes Buch der Kabbala
Eigentlich eine Homilie: Gliederung
1. Hauptteil = Kommentare zum Wesen der Tora, Vorträge, Diskussionen.
2. Sifra di-Zeniuta = Buch der Verborgenheit, Kommentar zu Stücken aus den ersten 6 Kapiteln der Genesis. Keine Ausführung, Stichworte,
ohne Erklärungen (nur 6 Seiten).
3. Idra Rabba = Große Versammlung: Simon ben Jochai erklärt seinen Getreuen und enthüllt die verborgenen Geheimnisse. Alle tragen was
vor, der Lehrer lobt sie. Alle geraten in Ekstase und in der Schlussapotheose sterben drei von ihnen.
4. Idra Zuta = kleine Versammlung: Schildert den Tod Simon ben Jochais, Zusammenfassung seiner Geheimnisse.
5. Idra di-be-Maschkana = gebaut wie Idra Rabba. Versammlung um einen Vortrag: Toraabschnitt über das Stiftszelt, Gebetsmystik.
6. Hekhalot = Schilderung der sieben Paläste, die die Seele nach dem Tod (in der Ekstase) durchwandert – Vision.
7. Rasa de-Rasin = Geheimnis der Geheimnisse. Zwei Stücke über Physiognomie und Chiromantik (erster Teil anonym, zweiter benutzt Erzählung im Schülerkreis).
8. Saba = Der Greis, über die Geheimnisse der Seele und der Seelenwanderung (Vortrag eines verheirateten Mannes = Eseltreiber).
9. Jenuka = Das Kind = Vortrag über die Mysterien der Tora (gehalten von einem Wunderkind).
10. Rab Metibta = Das Haupt der Akademie. Schilderung vor den Schülern, Wanderung durchs Paradies und Vortrag über die Schicksale der
Seele (im Jenseits), über die Oberhäupter der himmlischen Akademien.
11. Sitre Tora = Geheimnisse der Tora (allegorische und mystische Deutungen der Toraabschnitte – Legendenform).
12. Matnitin = Nachahmung der Mischna und Tosefta, auf einer kabbalistischen Basis, pathetisch, mystische Mischna.
13. Zohar zum Schir-ha Schirim (Hoheslied). Kommentar zu den ersten Versen.
14. Kaw ha-Midda = Der mystische Maßstab. Deutung über den Sinn des Einheitsbekenntnisses der Tora (Dtn 6,4), das Schema Israel.
15. Sitre otiot = Geheimnisse der Buchstaben, die im Gottesnamen und in den Anfängen der Schöpfungsgeschichte vorkommen.
16. Kommentar über die Merkaba-Vision.
17. Midrasch ha-ne´elam = Mystischer Midrasch zur Tora. Simon bar Jochai und seine Schüler und viele Autoritäten (Talmud, Lehrer aus dem
2.-4. Jh.). Nach Scholem älteste Schicht.
18. Midrasch ha-ne´elam zum Buch Rut (teilw. H.).
19. Ra´ja mehemna = der treue Hirte. Kabbalistische Deutung der Gebote und Verbote der Tora.
20. Tikkune Zohar = Kommentar zu den ersten sechs Kapiteln der Tora (70 Abschnitte).
21. Weitere Text und Ausführungen zum Tikkune Zohar (in diesem Stil) u.a. neuer Kommentar zur Merkaba.
Ca. 2400 Seiten, zwei Gruppen 1-18 (aramäisch) und 19-21.
Quellen: Midrasch Rabba, bT, Pesiqtot, PRE, die Targumim.
Juda Halewi und Maimonides gekannt.
Setzt den Ginnat Egos („Nussgarten“) von Josef Gikatilla voraus.
Wahrscheinlicher Verfasser ist Mosche ben Schem Tob de Leon:
154
Grundkurs Judentum
Kabbala
Geb. 1240 in Leon in Kastilien, war beeinflusst von Maimonides, von der Geroneser Schule und den Gnostischen Zirkeln um Moses von Burgos
und Todros Abulafia. 1270 näherte er sich Josef Gikatilla an. Lebte bis 1291 in Guadelajara/Kastilien. Um diese Zeit entstand der Zohar. Die letzten Jahre seines Lebens lebte er in Avila, hatte Kontakte zu Isaak ibn Sahula. Widmete Bücher an Josef b. Todros Abulafia in Toledo, starb in Arevalo 1305. Die letzten Jahre widmete er sich der Verbreitung des Zohar.
Er soll 24 Werke geschrieben haben (nach Abraham B. Salomon von Torrutiel): darunter Schoschan Edut, Sefer ha Rimon (über die Tora aus
kabb. Sicht), Or Zaru´a (über die Schöpfung), ha-Nefesch ha Hokhma, Scheqel ha-Qodesch, Mischkan ha-Edut (über das Schicksal der Seele
nach dem Tod), Maskijot Kesef (zu den Gebeten), Sefer Pardes, Scha´are Tsedeq zu Kohelet; Maschal ha-kadmoni etc.
Lehnt die Vorstellung von den verschiedenen Schmittot ab, wonach die Tora nicht in allen Weltzeitaltern gleich gültig sei. Ebenso lehnte er eine
Vorstellung ab, wonach in dieser Weltzeit ein Buchstabe verschwunden sei, was natürlich das Verständnis der Tora verändere.
Zohar ist Theosophie, mystische Lehre, die ein verborgenes Leben der wirkenden Gottheit ahnen und beschreiben zu können glaubt und sich darin versenkt.
Josef ben Abraham Gikatilla
1248-1325
geb. in Medinaceli/Kastilien, lebte in Segovia. Studierte zw. 1272-74 bei Abulafia. 1274 den Ginnat Egoz geschrieben, über die Namen, die Vokale
und das Alphabet (Gematria, notarikon, temura). Schrieb einen oder mehr Kommentare zum Hohelied, in denen die Zeitenfolgen eine Rolle spielen (Schemittot). Er befasste sich mit Halakha (Kelalei ha-Mitzwot) und schrieb Sprichwörter (Sefer ha-Meschalim).
Einflussreichstes Werk ist Scha´are Ora: zu den Sefirot. Weiteres Werk dazu Sefer Scha´are Zedeq. Scha´ar ha-Niqud (zu den Vokalen), Perusch
Haggada schel Pesach (kabb. Kommentar zur Pesachhaggada), Kommentar zur Merkaba etc.
Die Safeder Kabbalisten
Moses ben Jacob Cordovero
1522-1570, spanischer Herkunft. Schüler von Josef Caro und Somonon Alkabez, Lehrer von Luria. Mit 27 den Pardes Rimmonim geschrieben, 10
Jahre später Elima Rabbati sowie einen Kommentar zum Zohar. Synthese und Zusammenfassung der Kabbala. Basiert hauptsächlich auf Ra´aja
Mehemna und Tikkune Zohar. Gott ist die Erstursache, von allem anderen Sein unterschieden. Kann nicht mit positiven Attributen beschrieben
werden. Die Sefirot überbrücken das Gefälle zwischen Gott und Schöpfung. Es geht also in erster Linie um die Beziehung zwischen En Sof und
den Sefirot. Die Sefirot sind Substanz und Kelim zugleich, emaniert und zugleich enthalten sie Gottes Substanz. Gottes Substanz gibt den Sefirot
Leben. Es war Gottes Wille, sein unveränderliches Sein mit der Welt in Verbindung zu bringen und sein Licht zu offenbaren, das durch die Sefirot
strahlt. Der aktive Gott ist der im Willen geeinte Gott. Durch Gottes Selbstbeschränkung werden die Sefirot möglich. Die erste Sefira ist bereits außerhalb von Gottes Substanz, darum ist Pantheismus ausgeschlossen. Dennoch erscheint bei ihm immer wieder eine Durchdringung von Gottes
155
Grundkurs Judentum
Kabbala
Gegenwart selbst in allen Ebenen. Für Cordovero ist die Gerechtigkeit (din) von entscheidender Bedeutung für das Leben der Kreatur. Ohne sie,
also nur aufgrund von Barmherzigkeit, könnte sie nicht existieren.
Isaak Luria
1534-1572, auch ha-Ari genannt (Ha Elohi Rabbi Jitzchaq). Vater Aschenazi, Mutter aus sefardischer Familie. Wuchs nach dem Tod des Vaters
beim Onkel in Ägypten auf. Studierte bei David b. Solomon ibn Abi Zimra und Bezalel Aschkenazi. Bei Kairo zog er sich zu esoterischen Studien
zurück, auf der seinem Onkel gehörenden Insel Jazirat al-Rawda. Studierte Zohar und frühe Kabbalisten sowie seinen Zeitgenossen Moses Cordovero. Ab 1570 siedelte er in Safed, um bei Cordovero zu studieren. Sammelte Schüler um sich. 30 seiner Anhänger sind bekannt. Man bezeichnete ihn als Mann, der den Heiligen Geist besitze und die Offenbarung des Elija. Lehrte das System der theoretischen Kabbala und Wege, mit den
Seelen der Zaddiqim eins zu werden, vor allem durch Kawwana (Mediatation und Reflexion durch Gebet und rel. Handlungen). Schrieb wenig, allerdings einen Kommentar zu den ersten Seiten des Zohar. Berühmt auch seine Gedichte (Jefe Nof, vor allem zum Sabbat); zu den Festen und
Gebeten auch Tikkune Teschuba und Sefer ha-Kawwanot. Er starb an einer Epedimie 1572 sehr früh und verstand sich auch zu Lebzeiten als
Messias aus dem Haus Josef.
Chajim Vital kommentiert ihn und schreibt über sein Leben. Schulchan Arukh schel R. Isaak Luria gibt Auskunft über ihn, ebenso die Orchot Zaddiqim. Legendenhaft sind die Sefer Haredim von Eliezer Azikr, der Sefer Reschit Hokhma von Elija de Vidas und die Bücher von Abraham Galante. Zwei Dokumente über das Leben des Ari erhielten besondere Berühmtheit. Eine Sammlung von drei Briefen von Solomon Dresnitz an seinen
Freund in Krakau und die Toldot ha-Ari. Von den von den Schülern (in deren Färbung) dargelegten Traditionen Lurias sind zu nennen:
a. Sefer Kanfe Jona von Moses Jona von Safed: keine Erwähnung des Zimzum, aber andere Lehren
b. Derusch Hefzi-Ba von Josef ibn Tabul: Zimzum
c. Schriften Chajim Vitals: Ez Chajim (in acht „Pforten“ gegliedert):
d. Hierzu existieren mehrere Varianten. Nach Scholem: a) Lurias gesammeltes Material, b) Scha´ar ha Deruschim, c) Scha´ar ha-Pesukim (Bibelauslegung), d) Scha´ar ha-Gilgulim (Seelenwanderung), e) Scha´ar ha-Kawwanot, f) Scha´ar ha-Mizwot, g) Tikkune Avonot, h) Jichudim (über
die mystische Vereinigung).
Andere Einteilung: a) Lurias gesammeltes Material, b) Scha´ar ha Hakdamot (Weltschöpfung), c) Scha´ar Maamare Raschbi we-Razal (Zoharkommentar von Luria), d) Scha´ar ha-Pesukim (Bibelauslegung), e) Tikkune Avonot, f) Scha´ar ha-Kawwanot, g) Scha´ar ha-Mizwot, h) Scha´ar
ha-Gilgulim.
e. Israel Sarugs Schriften beinhalten eine eigene Deutung des Zimzum (Sefer Limmude Azilut).
Die verschiedenen Versionen und Unstimmigkeiten beleben die „Exegeten“ in Nordafrika, Italien und der Türkei.
Ausschnitt aus dem biographisch-bibliographischen Kirchenlexikon V (1993) 447-440 von Bernd Kettern:
LURIA, Isaak, auch: ARI = Ha-'Älohi Rabbi Jitzchaq (»der göttliche Rabbi Isaak«), aber auch einfach: I. Aschkenasi (»der Deutsche«), bedeutender Vertreter der nachspanischen Kabbala, entwarf das letzte kabbalistische System (lurianische Kabbala), * 1534 in Jerusalem, + 1572 in Safed
(Galiläa). - Die Darstellung seines Lebens durch die Schüler ist bis ins Legendarische gesteigert (»Schibche ha-'Ari«, Lobpreisungen des ARI,
hrsg. von Schlomel Dresnitz, Livorno 1790). Nach dem frühen Tod des Vaters wurde L. in Kairo von einem Onkel erzogen. Bereits als junger Mann
war er für seine Kenntnis des Talmuds bekannt. Ab dem 22. Lebensjahr zog er sich jedoch in die Einsamkeit zurück und lebte 13 Jahre als Eremit.
156
Grundkurs Judentum
Kabbala
1569 siedelte er nach Safed zu Moses Cordovero (1522-1570 in Safed) über. Erst in den drei folgenden Jahren entwickelte er seine Lehre. Es hat
sich nur wenig authentisches Material in schriftlicher Form erhalten L. trug seine Lehre stets mündlich vor - lediglich drei aramäische Sabbatlieder
sowie einige Gedichte können ihm eindeutig zugeordnet werden. Die »Kithbe ha-'Ari«, die »Schriften (= Lehren) des heiligen Löwen« lassen sich
jedoch mit Hilfe der von den Schülern Chajim Vital Calabrese (1543-1620) und Joseph ibn Tabul überlieferten Nachrichten rekonstruieren. Besonders in Vitals »Ez Chajim« (»Baum des Lebens«, Warschau 1891) und seinen »Schemonah Sche'arim« (»Acht Pforten«, Jerusalem 1850-1898)
finden sich alle für das lurianische System charakteristischen Lehren. L.s Mythos antwortet auf die Katastrophe der Vertreibung der Juden aus
Spanien. Erneut stellte sich die Frage nach dem Sinn des Exils. Mit Hilfe einer in sich systematisch aufgebauten Kabbala versuchte L. eine Antwort auf diese Notsituation zu geben. Drei Elemente stehen dabei im Vordergrund: die Lehre vom Zimzum, die Vorstellung vom Bruch der Gefäße
und die Lehre vom Tikkun, der harmonischen Restauration des entstandenen Makels. Die Lehre vom Zimzum, der Selbstbeschränkung Gottes,
kehrt die gängige Vorstellung von der Erschaffung der Welt um: Gott tritt nicht am Anfang der Welt in einem Emanationsprozeß im Sinne einer
schöpferischen Selbstmitteilung aus sich heraus, er zieht sich auf sich selbst zurück, er beschränkt sich in einer Art selbstgewähltem Exil und
schafft damit einen pneumatischen Raum (»Tehiru«) für etwas, das nicht ganz und vollkommen Gott in seiner reinen Wesenheit darstellt. Zugleich
konzentriert Gott jedoch richtende Gewalten auf diesen Raum, sie werden als Schöpfungskräfte von den sich aus dem Rest des göttlichen Lichts
bildenden Gefäßen aufgenommen. Auch dem Bösen wird im Tehiru Raum gegeben. L. scheint das Böse als in Gott selbst mitgesetzt zu sehen,
eine Auffassung, die sein Schüler Vital wegen ihrer theologischen Brisanz abzuschwächen versuchte. Der gesamte Schöpfungsprozeß ist gekennzeichnet von der Spannung zwischen dem Zimzum und der schöpferischen Emanation Gottes. Im Urraum bilden sich die Urbilder allen Seins. Gott
schafft sie als Adam Kadmon, als Urmensch. Aus seinen Augen und Ohren, aus dem Mund und der Nase dringen die Lichter der Sepiroth in die
Gefäße ein. Nun kam es aber zur entscheidenden Krise in der Schöpfung: ein Teil der Gefäße zerbrach bei dem Aufprall des Lichtes. Das Sein
verkehrte sich in ein Chaos, die Grundsituation jedes Exils. Zur Begründung dieser Krise verweist L. lediglich auf einen Reinigungsakt Gottes, der
die Ausscheidung des Bösen aus Gott selber zum Ziel hatte. Entscheidend ist für die l.ianische Konzeption die Annahme der Exilsituation in Gott
selbst. Die Kritik an L., sein System entbehre der rationalen Nachvollziehbarkeit, scheiterte immer wieder an der emotionalen Kraft dieser Vorstellung. Das Chaos stellt nun aber nicht den Endpunkt dar. Aus der Stirn des Adam Kadmon erstrahlt ein heilendes Licht, um den Wiederaufbau der
zerstörten Ordnung zu ermöglichen. Der erste Adam hatte die Aufgabe, die Exilsituation zu beenden, den Wiederherstellungsprozeß zu vollenden.
Er ist, genau wie seine Nachkommen und unter ihnen besonders die Kinder Israels, gescheitert. Auf anthropologischer Ebene wiederholt sich der
Bruch der Gefäße. Das Paradies verkehrt sich immer mehr ins Exil. Die Heilsgeschichte wird zum Beleg des ständigen Scheiterns des Gottesvolkes in Situationen naher Erlösung. Allein die Torah kann dann noch als Instrument des Tikkun dienen. L. betont in seiner ganzen Lehre, daß gerade das Exil zur Bewährung, ja sogar zur Mission werden kann, zur Chance, einen der Funken der Schechina (Gottesherrlichkeit) neu zu entzünden. Eng verbunden mit dieser Auffassung von Schöpfung und Heilsgeschichte ist die Lehre von der Seelenwanderung, die diesen Exilsprozeß
auf die Seele überträgt. Der Mensch ist aufgefordert, an der Erlösung, d. h. am Tikkun, mitzuarbeiten. Er vermag durch Buße und Aszese, durch
eine religiöse Lebensführung und durch andächtiges Beten - es kann bisweilen magische Züge annehmen - den Eintritt des Messias beschleunigen. Es wird aber durch die Betonung der menschlichen Mithilfe deutlich, wie sehr bei L. die Messiasvorstellung fast rein symbolischen Charakter
gewinnt. Die Erlösung wird zur fast logischen Konsequenz der Geschichte. Sie ist nicht mehr jene Katastrophe, die alles Geschichtliche aufhebt
und beendet. - L.s Kabbala wurde, im Gegensatz zur sonstigen Arkandisziplin, weit verbreitet. Infolge ihrer Deutung des Exils fand sie Zuspruch in
weiten Teilen des Judentums. Zusammen mit dem ethischen Grundzug war der konkrete Messianismus wiederholt Grundlage zu weiteren Lehren
(z. B. Chassidismus).
157
Grundkurs Judentum
Kabbala
Lit.: Schlomel Dresnitz, Schibche ha-'Ari, Livorno 1790; - Chajim Vital, Pri'Ez Schajim, Dubrowno 1804; - Ders., Schemona sch'arim, 8 Tle., Jerusalem 1850-1898; - Ders., Sefer, ha-Gilgulim (vollst. Ausgabe), Przemysl 1875; - Ders., 'Ez Chajim, Warschau 1891; - Ders., Sefer Chesjonoth, hrsg.
von A. S. Eschkoly, Jerusalem 1954; - Philipp Bloch, Die Kabbala auf dem Höhepunkte und ihre Meister, Preßburg 1905; - Solomon Schechter,
Safed in the sixteenth century, in: Ders., Studies in Judaism, II, Philadelphia 1908, 202-306, 317-328; - Meir Wiener, Lyrik der Kabbala, Wien 1920,
- Josef ibn Tabul, Chefzi-bah (am Anfang des Werkes Simchath Kohen von Mass-'ud Kohen, Jerusalem 1921, irrtümlich Vital als Autor angegeben); - S. A. Horodezky, Hundert Jahre asket. Bewegung im Judentum (hebr.), in: Ha-Tekufa 22 (1924), 290-323, 24 (1928), 389-415; - Chajim
Bloch, Kabbalist. Sagen, Leipzig 1925; - Ders., Lebenserinnungen des Kabbalisten Vital, Leipzig 1927; - Gershom Scholem, Ein Dokument über
eine Vereinigung der Schüler L.s (hebr.), in: Zion 5 (1940), 133-160; - Jesaja Tishby, Die Lehre vom Bösen und den »Schalen« in der lurianischen
Kabbala (hebr.), Jerusalem 1942; - Gershom Scholem, Die authent. kabbalist. Schriften L.s (hebr.), in: Kirjath Sefer 19 (1943), 184-199; - S. A.
Horodezky, Torath Ha-Kabbalah schel R. J. L. (Die kabbalist. Lehre des I. L.), Tel Aviv 1947; - Gershom Scholem, Die jüd. Mystik in ihren Hauptströmungen, Frankfurt 1957, 267-314, - Ders., Schöpfung aus Nichts und Selbstbeschränkung Gottes, in: Eranos 25 (1957), 87-119; - Ders., Zur
Kabbala und ihrer Symbolik, Frankfurt 1973, 147-158 (zuerst Zürich 1960); - Alexander Altmann, Von der ma. zur modernen Aufklärung. Studien
zur jüd. Geistesgesch., unter Mitarb. von Bernd Kettern, Tübingen 1987, 172-205 (lurianische Kabbala bei Abraham Cohen Herrera); - EJud X,
1198-1212; - EncJud XI, 572-578; - JüdLex III, 1250 f.; - LThK 2VI, 1220 f.; - RGG 3IV, 479.
Bernd Kettern
Chajim ben Josef Vital
1542-1620, wahrscheinlich in Safed geb. Sein Vater war Josef Vital Calabrese, ein Schreiber in Safed. Schüler von Moses Alschekh. Studierte
auch das System von Cordovero und Alchemie. Als Luria eintraf, studierte er bei ihm. Wollte sich nach seinem Tod als alleiniger Interpret Lurias
durchsetzen, was nicht immer gelang. Dennoch unterzeichneten 1575 12 Schüler ein Vermächtnis, wonach sie nur von Vital lernen sowie die Geheimnisse von anderen fernhalten wollten. 1577-85 ging er nach Jerusalem und wurde dort Vorsitzender einer Jeschiwa. Kam nach Safed zurück
und wurde 87 von schwerem Leiden heimgesucht. 1590 wurde er von Moses Alschekh als Rabbi ordiniert, ging wieder nach Jerusalem und soll
von dort nach Damaskus weitergezogen sein. Er erblindete fast.
Vital war dreimal verheiratet und gab sein Wissen an seinen Sohn Samuel weiter, schrieb in Damaskus auch eine mit zahlreichen Abhandlungen
angereicherte Autobiografie, den Sefer ha-Hezjonot. Neben Talmudkommentaren und Responsen sind seine Hauptwerke in zwei großen Schriften
erhalten: Ez ha-Chajim und Ez ha-Da´at (von letzterem nur Teile erhalten – Bibelauslegung und Homilien: Psalmkommentar als Sefer Tehillim
1926 publiziert).
1653 edierte Meir Poppers aus den verschiedenen Ausgaben eine Letztausgabe von Vitals Schriften.
158
Grundkurs Judentum
Kabbala
Wichtiges Thema der Kabbala: vor allem im Zohar
Die Sefirot
Sefira bedeutet „Zählung“ (an zehn Finger gedacht). Nicht vom gr. Sphaira. Zehn Wirkungskräfte der Gottheit. Dynamisch, wirken aufeinander ein.
Früher benutzte man eher den Ausdruck „Midda“ (noch Gikatilla). Wichtig ist der emanatorische Vorgang von Oben nach Unten, von der Einheit
zur Vielheit. Ständige Selbstoffenbarung des gleichzeitig verborgen bleibenden Gottes.
Beliebt war die Rede von den „Worten“ (ma´amarot), Safirim, den „Strahlen“ (zachzachim), den „Lichtern“ (me´orot), „Emanationen“ (azilijot), „Kronen“ (ketarim), „Gewändern“ (lebuschim) oder „Stimmen“ (qolot). Sprach-, Buchstaben- und Zahlensymbolik gehen in eins. Auch ist die Rede vom
Weltenbaum, der von oben nach unten wächst.
Die Emanationsströme können überströmen (schäfa), weshalb die Rede ist von „Gefäßen“ (kelim), „Röhren“ (zinnorot), „Kanälen“. Was fließt da?
Wenn es die Gottheit ist, wie konnte man den Pantheismus vermeiden? Man versuchte meist eine seinsmäßige Trennung anzunehmen zwischen
der verborgenen Gottheit und den oberen emanierten Seinsstufen. Schäfa ist daher meist nicht „Überfluss“, sondern „Einfluss“ im Sinne von „Einwirkung“. Es geht um einen Wirkungszusammenhang, der auf das Denken oder den Willen Gottes als erste göttliche Manifestation zurückgeht.
Das bildhafte Element verfloss allerdings oft mit dem Seinsmäßigen, weshalb magische, gnostische und theurgische Elemente nicht voneinander
zu trennen sind.
Es ging vor allem um die Hierarchie der einzelnen Sefirot, um ihr Zusammenspiel, die Wirkungskräfte, die Art der Zuordnung. Es gab nicht nur Beeinflussung von oben nach unten, sondern auch umgekehrt. Kabbalistische Theurgie hatte im Bemühen Erfolg, die Einheit des Wesens Gottes
nicht nur in einem intellektuellen Erkenntnisakt herzustellen, sondern durch Einwirkung auf die Einigung der Wirkungskräfte mitzubestimmen.
Das Gesamtschema
Die Hierarchie der Sefirot:
Sefira I steht am höchsten, ist der wesenhaften Einheit Gottes noch am nächsten. Sefira X ist Vermittlerin aller von oben nach unten strömenden
Kräfte und aller Einwirkungen von unten nach oben.
Erst die Spätkabbalisten und vor allem christliche Kabbalisten machten Zeichnungen und Schemata.
Hier ein Versuch zur Verdeutlichung:
Oberste drei Sefirot bilden Gruppe für sich an der Grenze zur absoluten Transzendenz. Sefira III abgrenzende und vermittelnde Funktion. Untere
sieben ebenfalls Einheit für sich.
„Drei Säulen“: linke Säule (III,V) mit der negativen Funktion der Strenge und des Gerichts
rechte Säule (II,IV) mit der Sefira IV als extremer Güte
mittlere Säule (I,VI,IX,XI). Sie hat ausgleichende und vermittelnde Funktion. Absolute Güte und absolute Strenge Gottes werden in VI geeint und
ausgeglichen. Wird die Kraft von VI durch Einflüsse von unten oder außen beeinträchtigt, wirkt sich V extrem aus.
159
Grundkurs Judentum
Kabbala
Kraft der Welt des Körpers wurde auf VII-X ausgelegt, die Kraft der Welt der Seele auf IV-VI und die Kraft der Welt des Verstandes auf I-III.
I-III: Welt der Emanation = azilut
IV-VI: Welt der Schöpfung = beri`a
VII-IX: Welt der Formung = jezira
X: Welt der Durchführung = asija
In der späteren Kabbala erhält jede Welt eine eigene Sefirotkonfiguration, die Zehnerreihen werden damit vermehrt.
Anwendung der Nusssymbolik. Danach wird das En Sof als Nullpunkt im Inneren plaziert, X ist außen und damit am wenigsten verborgen.
Gottesnamen sind mit den Sefirot verbunden: In der Überlieferung ist der von 24, 48 und 72 buchstabigen Gottesnamen die Rede.
Die Sefira I trägt den Namen ehje. Erst VI trägt den Namen JHWH, was mit Sicherheit mit den oben angeführten Gründen zu tun hat. Sie repräsentiert auch Jakob. Aber aus JHWH werden eindeutig alle Namen abgeleitet.
Die Tora besteht aus Gottesnamen. Sprachsymbolik und Namensglaube der antiken Traiditon vermengen sich zu einem spekulativen Ganzen,
wobei der schriftlichen Tora eine besondere Bedeutung zukommt.
Bezeichnung der Sefirot geht auf Texte wie 1 Chr 29,11 zurück:
Dein, Herr, sind Größe und Kraft, Ruhm und Glanz und Hoheit; dein ist alles im Himmel und auf Erden. Herr, dein ist das Königtum. Du erhebst
dich als Haupt über alles.
Aussprechen eines Namens bewirkt auch Aktivierung der hinter ihm stehenden Potenz. Jeder Missbrauch, jeder Fehler, ist fatal.
b) Die Gottheit selber bleibt transzendent
Neuplatonische Tradition. Gottheit immer transzendent, völlig jenseitig, alle Eigenschaften, die man ihr zuschreibt, sind unzutreffend, entstammen
nur dem menschlichen Erfahrungsbereich.
Moses Maimonides, 2. Glaubensartikel:
Die zweite Grundlehre betrifft die Einheit Gottes – erhoben werde Er! Das heißt, dass Er, die Ursache von allem, EINER ist, und zwar einer von
einer Art und einer von einer Gattung und nicht wie ein Einzelding, das zusammengesetzt und in viele Teile teilbar ist, und auch nicht wie ein Einzelkörper einzig der Zahl nach ist und dabei unendlicher Teilbarkeit unterliegt, sondern Er – erhoben werde Er! – ist EINER nach einer Einheit, die
ihresgleichen nicht hat. Auf diese zweite Grundlehre weist der Vers (Dtn 6,4): Höre Israel, JHWH, unser Gott, JHWH ist EINER.
Wie wir aus der rabbinischen Tradition sahen, gibt es dort einen sehr menschlichen Gott, einen nahen und sich vermittelnden Gott. Man verstand
darunter nicht einfach nur Bilder, sondern reale Erscheinungsformen Gottes. Manche, darunter die Karäer, kritisierten massiv die anthropomorphe
Vorstellung von Gott.
Die Hohelieddeutung spielte eine wichtige Rolle. Sie verstärkte die Vorstellung von Gottes Gestalthaftigkeit.
Andererseits kennt die Bibel auch Aussagen von Gottes absoluter Transzendenz, wie in Jes 55,8ff.
160
Grundkurs Judentum
Kabbala
Im 12. und 13. Jh. tobte also eine Auseinandersetzung über diese Tendenzen, ausgelöst durch die Schriften des Maimonides, der dogmenhaft die
Unkörperlichkeit des göttlichen Wesens und seine absolute Transzendenz vermitteln wollte.
Die dritte Grundlehre betrifft den Ausschluss der Körperlichkeit in Bezug auf Ihn. Das heißt, dass jener EINE weder ein Körper ist noch eine Kraft
in einem Körper, und dass ihm Eigenschaften der Körper wie eine Bewegung und das Ruhen nicht zukommen, weder von Seiten des Wesens
noch als Akzidens. Darum verneinten sie – Friede mit ihnen! – in Hinblick auf Ihn auch Verbindung und Trennung und sagten (bChagiga 15a): Oben gibt es nicht Sitzen und nicht Stehen, kein oref und kein ippuj. Das heißt: Keine Teilung – das ist oref, und keine Verbindung – dass ist ippuj,
vom Ausdruck (in Jes 11,14): und fliegen Schulter an Schulter gegen Philister..., das heißt: Sie drängen aneinander heran mit der Schulter, um
sich zu verbinden. Und der Prophet sagt (Jes 40,18): Wem wollt ihr Gott vergleichen, etc.?, und (Jes 40,25): Wem wollt ihr vergleichen, dass ich
ähnlich sei? Nämlich, als wäre Er ein Körper gleich anderen Körpern. So klingt (zwar) auch all das, was in den Heiligen Schriften an Beschreibung
mit körperlichen Attributen vorkommt, wie Gehen und Stehen, Sitzen und Reden und dergleichen, aber das ist alles übertragene Rede, wie auch
(die Weisen) gesagt haben (bBerakot 31b): Die Tora spricht in der Sprache der Menschen; und überhaupt hat man über dieses Kapitel schon viel
gesagt. Auf diese dritte Grundlehre weist hin, was da gesagt ist (Dtn 4,15): Aber keinerlei Bild habt ihr gesehen; das heißt: Ihr habt Ihn nicht als
bildliche Erscheinung wahrgenommen, entsprechend dem, dass Er, wie wir gesagt haben, kein Körper ist und auch keine Kraft in einem Körper.
Dieser Streit ging mit wechselnden Verbannungen einher. Erst die Kabbalisten haben den Streit auf geniale Weise gelöst. Die strenge Auffassung
von einer absoluten Jenseitigkeit behielten sie bei. Sie ließen aber auch die wörtlichen Aussagen „anthropomorphistischer“ Art bestehen und bezogen sie allerdings nicht auf die verborgene Gottheit, sondern auf deren Manifestationen in den göttlichen Wirkungskräften, also auf die Sefirot.
Das En Sof:
Wörtlich „Nichtvorhandensein eines Endes“. Kommt nicht in der Bibel vor. Dieser Begriff kann vor allem im Einflussbereich des Sohar von der Sefira I abgehoben sein. Mitunter fällt er aber mit ihr in eins. „Erste Ursache“, „Wille“, „Gedanke“ und dergleichen sind dann Begriffe dafür.
„In jenem En Sof gibt es kein Ende, keine Willensäußerungen, keine Lichter und keine Leuchten. Alle die Leuchten und Lichter hängen von Ihm
ab, um zu existieren, doch sind sie nicht da, damit sich anhaftet, wer erkennt und doch nicht erkennt, ist doch der Oberste Wille nur Allverschlossenstes: Nichts“, sagt das Zohar II,239.
Kommen wir nun aber zu den einzelnen Sefirot: Ich beginne hierarchisch oben:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
die Sefira I: Keter/Krone, Gottesname: `Ehje
die Sefira II: Chokma/Weisheit, Gottesname: JH
die Sefira III: Bina/Einsicht, Gottesname: JHWH als Elohim gelesen
die Sefira IV: Chesed/Gnade, Gottesname: El
die Sefira V: Gebura/Macht, Gottesname: Elohim
die Sefira VI: Tif´eret/Pracht, Gottesname: JHWH
die Sefira VII: Netsach/Sieg, Gottesname: JHWH tsebaot
die Sefira VIII: Hod/Majestät, Gottesname: Elohe tsebaot
161
Grundkurs Judentum
Kabbala
9. die Sefira IX: Jesod/Fundament, Gottesname: El chaj
10. die Sefira X: Malkut/Herrschaft, Gottesname: Adonaj
1. Sefira I:
Für die Mehrzahl der Kabbalisten die Quelle des Willens, der sich in II repräsentiert, das göttliche Denken. Für Gikatilla, der I nicht vom En Sof
strikt absetzt, ist I das absolute Erbarmen.
2. Sefira II:
Gleichsetzung der Weisheit mit der Tora. Hier allerdings abstrakte ganzheitliche Tora.
3. Sefira III:
Vermittlung zwischen den oberen und den weiteren sieben. Großer Schritt im Sinne der emanatorischen Qualitätsveränderung des Seienden.
Prinzip der Individuation. Hier sind die einzelnen Konsonantenbuchstaben konzipiert. Geistige erste Sprach- und Schriftgestalt der Sefirot.
4. Die Sefira IV:
5. Die Sefira V:
Repräsentation des strengen Gerichts, das der linken Säule der Sefirotkonfiguration eine negative Bedeutung verleiht, eine besondere Rolle. Diese Kräfte wirken sich nach unten verheerend weiter, vor allem als Straffolgen für Israels Ungehorsam.
6. Die Sefira VI:
Die maßgeblichste Sefira. Gleicht die Wirkungskräfte aus, trägt daher den Gottesnamen. Enhält dadurch auch die Symbole der übrigen Sefirot.
Jakob ist damit verbunden, denn JHWH ist der Name, unter dem sich die Gottheit den Nachkommen Jakobs, allein dem auserwählten Volk Israel,
offenbarte. Dies ist die Zusage der schriftlichen Tora.
7. Die Sefira VII:
Gehört eng mit 8 zusammen
8. Die Sefira VIII:
9. Die Sefira IX:
10. Die Sefira X:
Die unterste Sefira hat natürlich am meisten Interesse geweckt, da man über sie zu den höheren Stufen gelangen kann und auf sie einwirken
kann. Außerdem wirken alle Sefirot auf sie ein. Besonders reich ausgeprägte Symbolik. Zum weiblichen Aspekt vgl. dazu Scholem. Von der mystischen Gestalt der Gottheit
Im Rahmen der Kabbala entwickelt sich auch eine Lehre von der Seelenwanderung, die zum Teil überaus komplex wird.
162
Grundkurs Judentum
Zionismus
Aus: Shlomo Avineri, Profile des Zionismus. Die geistigen Ursprünge des Staates Israel, Gütersloh 1998
Alkalai und Kalischer
Zwischen Tradition und Moderne
65-73
Aufklärung und Säkularisierung formten das Bewußtsein der ersten Generation emanzipierter Juden. Diese Kräfte führten zu der Suche nach einer
neuen Identität, zu dem Versuch, jüdische Geschichte in Hinblick auf den Nationalismus des 19.Jahrhunderts neu zu definieren. Das neue jüdische Nationalbewußtsein, das später Zionismus genannt werden sollte, war also eine der dialektischen Auswirkungen des Emanzipationsprozesses selbst. Verglichen mit dem traditionellen Verlauf jüdischer Geschichte war dieses Bewußtsein revolutionär und radikal, und tatsächlich wurde
es zunächst vom rabbinischen Establishment als gefährlich und häretisch abgelehnt.
Trotz dieser ersten Ablehnung zeigten sich sogar innerhalb der religiösen Orthodoxie selbst erste Anzeichen eines neuen Trends, der durchdrungen war von Ideen, die sich, wenn auch sehr indirekt und vorsichtig, aus der radikalisierten Wirklichkeit des 19. Jahrhunderts ableiteten. Die Mehrheit der rabbinischen Autoren näherte sich dem Thema der Erlösung weiterhin auf die traditionelle, passive Weise. In den Schriften wenigstens
zweier Rabbiner in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist jedoch ein geistiges Echo auf den modernen nichtjüdischen Nationalismus zu erkennen. Sie führten zu einen, tastenden Suchen nach einer aktiveren Haltung gegenüber den hergebrachten jüdischen messianischen Ideen. Rabbi
Jehuda Hai Alkalai, ein Sephardi, und Rabbi Zwi Hirsch Kalischer, ein Aschkenasi, ergänzten die traditionellen frommen messianischen Hoffnungen und Gebete um eine praxisorientierte und etwas weltlichere Note.
Beide Männer präsentieren ein außerordentlich komplexes Ideengebäude. Einerseits stehen sie fest auf dem Boden der Orthodoxie. Ihre Suche
nach Erlösung bleibt in der traditionellen messianischen Sehnsucht der jüdischen Religion verankert. Andererseits können die aktiven Elemente
ihrer Ideen eindeutig auf den Einfluß zurückgeführt werden, den die Entwicklungen in den umliegenden nichtjüdischen Gesellschaften auf ihre
Vorstellungen und auf die allgemeine Stellung der jüdischen Bevölkerung ihrer Heimatgebiete gleichermaßen hatten. Sowohl Alkalai als auch Kalischer stammten nämlich aus typischen Grenzgebieten, in denen eine Vielzahl ethnischer Gruppen lebte. Die verschiedenen nationalen Gruppen
bekämpften einander, und die jüdischen Gemeinden befanden sich im Kreuzfeuer dieses Konflikts.
Jehuda Hai Alkalai (1798-1878) wurde in Sarajewo geboren, das damals Teil des Türkischen Großreiches war. 1825 wurde er zum Rabbiner der
Stadt Semlin in Serbien berufen. Der gesamte Balkan wurde von beginnenden nationalen Konflikten überschwemmt; Serben, Kroaten, Griechen,
Bulgaren und Rumänen waren im Begriff, ihr eigenes nationales Selbstbewußtsein zu entwickeln und den multinationalen Großreichen Türkei und
Österreich ein eigenes nationales Heimatland zu entreißen. In Alkalais Jugend kämpften Griechen und Serben erfolgreich um ihre Unabhängigkeit.
Die jüdische Bevölkerung bestand aus aschkenasischen und sephardischen Juden.
Rabbi Zwi Hirsch Kalischer (1795-1874) war etwa zur gleichen Zeit in einem ähnlich multinationalen Gebiet tätig. Er wurde in Posen geboren, im
gleichen Grenzgebiet wie Heinrich Graetz. Es war das Gebiet Westpolens, das nach der Teilung Polens und als Folge der napoleonischen Kriege
unter preußische Herrschaft gekommen war. Die Mehrheit der Bevölkerung sprach Polnisch, aber die zumeist in den Städten lebenden Deutschen
bildeten die herrschende Minderheit. In einigen Fällen versuchte die preußische Obrigkeit, die deutschsprachige Minderheit größer erscheinen zu
lassen, indem sie jiddisch sprechende Juden statistisch zu den Deutschen zählte. Jiddisch gehörte schließlich zu den germanischen Sprachen.
Versuche wie diese wurden zwar von der jüdischen Führung, die Deutschland als emanzipatorische Kulturnation ansah, begrüßt, führten jedoch zu
Reibungen zwischen der jüdischen und der polnischen Bevölkerung und wurden daher von vielen Juden mit gemischten Gefühlen betrachtet. Die
verschiedenen polnischen Rebellionsversuche brachten die jüdische Bevölkerung in Hinblick auf ihre politische und sprachlich-kulturelle Identität
163
Grundkurs Judentum
Zionismus
Aus: Shlomo Avineri, Profile des Zionismus. Die geistigen Ursprünge des Staates Israel, Gütersloh 1998
immer wieder in zwiespältige Situationen. Die Juden dieser (Grenzgebiete waren also in bezug auf Kultur, Nationalismus und Sprachpolitik in
höchstem Maße sensibilisiert. Aus jüdischer Sicht war die Provinz Posen auch Grenzland zwischen den emanzipierten Juden der deutschen Herrschaftsgebiete und den traditionelleren orthodoxen Ostjuden des alten polnischen Staates.
Alkalai und Kalischer sind typische Beispiele dafür, was geschieht, wenn sich äußerer nationalistischer Druck in der nichtjüdischen Gesellschaft
aufbaut. Das empfindliche und komplexe Gleichgewicht zwischen der jüdischen Bevölkerung und ihrer Umwelt wird gestört, und sogar Traditionalisten in der jüdischen Gemeinde fangen an, nach neuen Lösungen zu suchen. Trotz ihres unterschiedlichen geographischen und kulturellen Hintergrundes teilten Alkalai und Kalischer aufgrund der ähnlichen Situation in ihren jeweiligen Gemeinden die gleichen Voraussetzungen und suchten nach neuen Antworten. Beide schrieben in traditionell-orthodoxer Manier in rabbinischem Hebräisch.1
In seinem Buch Minchat Jehuda (Die Gabe des Juda),2 zuerst 1845 veröffentlicht, versucht Alkalai, der traditionellen Erlösungsvision eine weltliche
Dimension zu verleihen. Er legt biblische Hinweise auf die Erlösung aus und vertritt auf dieser Basis die These, der Erlöser werde nicht plötzlich
erscheinen, sondern seinem Erscheinen werde eine Reihe von vorbereitenden Prozessen vorausgehen. Da das Land Israel zur Zeit fast unbewohnt sei, erklärt Alkalai, sei es auch praktisch unmöglich, daß alle Juden der Welt auf einmal dorthin kämen, um es zu besiedeln. Irgendwie müßten Vorbereitungen getroffen werden, sagt Alkalai und fügt hinzu »Der Herr will, daß wir in Würde erlöst werden sollen. Wir können daher nicht als
eine große Masse dorthin wandern, denn dann würden wir als Zeltbewohner über das ganze heilige Land verteilt leben müssen. Die Erlösung muß
langsam kommen. Das Land muß nach und nach aufgebaut und vorbereitet werden.« Er erklärt auch, daß einige anfangs noch in der Diaspora
bleiben müßten, »so daß sie den ersten Siedlern in Palästina helfen können, die zweifellos aus den Reihen der Armen kommen werden.«"3
In dieser behutsamen, praktischen Weise und mit Hilfe ständiger Untermauerung seiner Argumente durch biblische und talmudische Zitate gelingt
es Alkalai, den Prozeß der Erlösung - wenn auch natürlich nicht die Erlösung selbst - aus seiner mystischen Eindimensionalität zu lösen. Der Erlösungsprozeß ist somit keine rein göttliche Angelegenheit mehr, sondern wird zur Sache der Menschen. So vermeidet Alkalai den Vorwurf, er vertrete häretische Vorstellungen wie die »Beschleunigung des Endes der Tage« (Dechikat ha-Kez), während er gleichzeitig versucht, praktische
Bemühungen zur Besiedelung Palästinas innerhalb der religiösen Tradition zu legitimieren. Alkalai erweitert diese Entmystizifierung des Erlösungsprozesses zusätzlich um eine pragmatische Einstellung zur hebräischen Sprache. Die rabbinische Orthodoxie hatte Hebräisch zur ausschließlich sakralen Sprache erklärt, die nicht durch den täglichen Gebrauch für weltliche Dinge profanisiert werden sollte. Zweifellos veranlaßt
durch die literarische Wiederbelebung unbekannter Mundarten im Gefolge des nationalen Wiedererwachens auf dem Balkan, wird Alkalais Einstellung durch erheblich praktischere Erwägungen bestimmt. Alkalai erklärt, die Zerstreuung der Juden über die ganze Welt habe dazu geführt, daß
sie nicht länger ein und dieselbe Sprache sprächen, eine Überlegung, die für traditionelle Denker nicht von Interesse war:
Wir sind leider heute so zerstreut und geteilt, weil jede jüdische Gemeinde eine andere Sprache spricht und andere Bräuche pflegt. Diese Teilung
ist ein Hindernis für die Erlösung. Ich möchte dem Schmerz Ausdruck verleihen, den ich immer aufgrund des Irrtums unserer Vorfahren empfunden habe, denn sie haben es zugelassen, daß unsere heilige Sprache so in Vergessenheit geraten konnte. Deshalb war es möglich, daß unser
Volk in siebzig Völker geteilt und unsere eine Sprache durch die siebzig Sprachen der Länder unseres Exils ersetzt wurden.4
Dieses Fehlen einer Nationalsprache könnte sich bei der Ankunft des Messias als praktisches Problem erweisen:
Wenn der Allmächtige uns tatsächlich seine wunderbare Gunst zeigen und uns in unserem Lande versammeln sollte, wären wir nicht in der Lage,
miteinander zu sprechen, und eine so uneinige Gemeinde hätte keinen Bestand. ...Eine derartige Sache geschieht nicht durch ein Wunder, und es
ist fast unmöglich, sich eine wahre Wiederbelebung unserer hebräischen Sprache auf natürlichem Wege vorzustellen. Wir müssen jedoch darauf
vertrauen, daß es geschehen wird ...5
164
Grundkurs Judentum
Zionismus
Aus: Shlomo Avineri, Profile des Zionismus. Die geistigen Ursprünge des Staates Israel, Gütersloh 1998
Alkalais Schlußfolgerung ist praktisch orientiert und völlig neuartig: jeder sollte Hebräisch sprechen lernen. Ein einigendes Medium der Kommunikation sollte geschaffen und so ein weiterer Aspekt der Vorbereitung auf die Erlösung gefordert werden. »Da sollte man nicht verzweifeln, sondern
wir sollten mit aller Kraft versuchen, unsere Sprache wiedereinzuführen und sie in den Mittelpunkt zu stellen; und Gott der Allmächtige wird die
Lehrer und die Schüler, die Jungen und die Mädchen inspirieren, daß sie fließend Hebräisch sprechen.«6
Daraufhin präsentiert Alkalai ein pragmatisches Programm, das den Landkauf in Palästina und die Wiederbelebung der hebräischen Sprache als
Teile der menschlichen Vorbereitung auf die göttliche Erlösung vorsieht. Er schlägt auch vor, daß nicht nur die Rabbiner, sondern auch die reicheren Schichten der jüdischen Gesellschaft Hebräisch lernen sollten. Die Entstehung eines neuen jüdischen Bürgertums, ein Ergebnis der Emanzipation, deutet Alkalai als Beweis fur eine langsame Verbesserung der Stellung der Juden und als Vorbote noch weiterer Verbesserungen. Diese
Menschen sollten den Grundstein fur die organisierten Bemühungen bilden, Land in Palästina zu erwerben. Alkalai versteht genug von den Neuerungen des modernen Kapitalismus, um anzuregen, diese Organisation »analog zu der Feuerversicherungsgesellschaften oder Eisenbahngesellschaften« 7 aufzubauen. Obwohl Alkalai ein talmudischer Gelehrter ist, sind seine Vorschläge vom Geist seiner Zeit geprägt.
Die gleiche Einstellung zeigt sich auch in anderen Organisationsfragen. Alkalai schlägt die Wahl einer jüdischen verfassunggebenden Versammlung vor. Auch hier ist das Vorbild anderer entstehender Nationalbewegungen unverkennbar. Ihm ist jedoch bewußt, wie unorthodox ein derartiger
innovativer Schritt innerhalb der jüdischen rabbinischen Tradition ist. Daher kleidet er seine Vorstellungen in eine besonders traditionalistische exegetische Sprache, welche gelegentlich die Neuartigkeit seiner Ideen verschleiert.
Um derart moderne Vorstellungen zu legitimieren, bedient sich Alkalai eines besonders interessanten Aspekts der jüdischen messianischen Überlieferung. Eine Version dieser Überlieferung besagt, daß dem Erscheinen des Messias, Sohn des David, das Erscheinen eines Vorläufers vorausgehen wird, eines Messias, der Sohn des Josef genannt werden wird. Die Überlieferung besagt, daß dieser erste Messias (Maschiach ben Josef)
an den Kriegen von Gog und Magog teilnehmen, das Land Israel von den Ungläubigen befreien, jedoch in der Schlacht fallen wird. Erst danach
wird der endgültige Messias, Maschiach ben David, erscheinen und die Kinder Israels auf wunderbare Weise zurück in das Gelobte Land führen.
Alkalai argumentiert, daß bereits das Erscheinen des Messias, Sohn des Josef, dessen Taten durch weltliche Eroberungen und nicht durch Wunder gekennzeichnet sind, auf symbolische Weise die Notwendigkeit irdischer, praktischer Aktivitäten deutlich mache, die dem Erscheinen des
Messias, Sohn des David, vorausgehen müßten. Darüber hinaus erklärt Alkalai, daß es sich bei der Vorstellung eines Messias, Sohn des Josef,
nicht so sehr um eine Person handle, sondern vielmehr um einen Prozeß, der in der modernen Zeit die Form politischer Führerschaft unter den
Juden annehmen und den »Beginn der Erlösung« (atchalta di-geula, in der traditionellen aramäischen Version) vorbereiten werde. Die überlieferte
Vorstellung von einem »vorbereitenden« und handelnden Messias wird so in die Sprache relevanter moderner sozialer Entwicklungen und Institutionen übersetzt:
Die Erlösung beginnt mit den Anstrengungen der Juden selbst. Sie müssen sich vereinigen und organisieren, Führer wählen und ihr Exil verlassen.
Da keine Gemeinschaft ohne Regierungsorgan existieren kann, muß an allererster Stelle die Wahl von Ältesten aus jedem Bezirk stehen, frommen
und weisen Männern, die alle Angelegenheiten der Gemeinde überwachen. Ich möchte in aller Bescheidenheit anmerken, daß mit der Verheißung
des Messias, Sohn des Josef, wahrscheinlich diese gewählte Versammlung die Versammlung der Ältesten - gemeint ist.
Diese Ältesten sollten von unseren größten Magnaten gewählt werden, auf deren Einfluß wir alle angewiesen sind. Die Organisation einer internationalen jüdischen Körperschaft ist bereits der erste Schritt zur Erlösung, denn aus dieser Organisation wird eine bevollmächtigte Versammlung
von Ältesten, und aus der Mitte der Ältesten wird der Messias, Sohn des Josef, hervorgehen....8
165
Grundkurs Judentum
Zionismus
Aus: Shlomo Avineri, Profile des Zionismus. Die geistigen Ursprünge des Staates Israel, Gütersloh 1998
Diese Vorstellungen, ebenso wie die Idee, einen Dauerfonds (Keren Kajemet) für den Landkauf in Palästina einzurichten (wiederum legitimiert
durch Abrahams Kauf der Höhle von Machpela von Efron dem Hetiter), wurden zwar nicht mehr zu Alkalais Lebzeiten realisiert, sie enthaltenjedoch bereits einige Grundelemente späterer, aktiver zionistischer Organisation.
Im Alter emigrierte Alkalai nach Jerusalem, und dieser Schritt, ebenso wie die Fülle der von ihm propagierten Ideen, seine phantasievolle Mischung neuer Ideen innerhalb einer traditionellen normativen Ordnung zeichneten ihn in seiner Generation aus. Eine Nationalsprache und eine
repräsentative Versammlung waren beinahe häretische Vorstellungen für das orthodoxe Judentum. Sie zu formulieren und gleichzeitig innerhalb
der Traditionen zu verbleiben, war ein aufregend neuer Ansatz.
Zwi Hirsch Kalischer, der als Rabbiner für die Gemeinde Thorn in der Provinz Posen amtierte, präsentiert eine ähnliche Verbindung von Neu und
Alt. Der Einfluß nichtjüdischer Nationalbewegungen auf sein Denken zeigt sich am klarsten in seinem Buch Drischat Zion (Suche nach Zion), das
zuerst 1862 veröffentlicht und zu Lebzeiten Kalischers viele Male nachgedruckt wurde.
Warum opfern die Völker Italiens und anderer Länder ihr Leben für das Land ihrer Väter, während wir, wie Männer, die ihrer Stärke und ihres Mutes beraubt wurden, nichts tun? Sind wir weniger wert als andere Völker, die Leben und Gut gering achten im Vergleich zu der Liebe zu ihrem
Land und ihrer Nation? Laßt uns das Beispiel der Italiener, Polen und Ungarn zu Herzen nehmen, die ihr leben und ihren Besitz im Kampf für nationale Unabhängigkeit geben, während wir, die Kinder Israels, die wir das ruhmreichste und heiligste Land unser Erbe nennen, mutlos sind und
schweigen. Wir sollten uns schämen!9
Wie Alkalai glaubt auch Kalischer nicht, daß die Erlösung plötzlich kommen wird. Vorbereitende Schritte sind nötig, und Kalischer setzt den Prozeß, die Anfänge der Erlösung zu entmystifizieren, ganz im Sinne Alkalais fort:
Die Erlösung Israels, die wir ersehnen, mögest du, mein Israelit, Dir nicht in der Art vorstellen, daß plötzlich die Stimme Gottes von der Himmelshöhe ertönen und den Israeliten »Wohlan! nach Jerusalem hinauf!« zurufen werde; auch nicht so, daß plötzlich ein Messias von Gott auf die Erde
gesandt, in die Posaune stoßend, die überall Zerstreuten zusammenruft nach Jerusalem führt. Die heilige Stadt wird nicht unversehens von Mauern, nicht durch Menschenhände aufgeführt, umgeben sein und den heiligen Tempel, gleichsam durch ein Wunder, in sich bergen.10 Nein! nicht so
unvorbereitet und überraschend wird die Erlösung sich gestalten, sondern langsam und allmälig, bis dann zuletzt alle die göttlichen Verheißungen
durch seine heiligen Propheten buchstäblich in Erfüllung gehen werden.11
Kalischer bezieht sich auf einige Verse des Propheten Jesaja über die Erlösung, wo diese mit dem langsamen Kornsammeln auf dem Felde
gleichgesetzt wird:
So enthüllte er, daß nicht alle Kinder Israels zur gleichen Zeit aus dem Exil zurückkehren, sondern nach und nach versammelt werden würden, so
wie das Korn allmählich aus dem gedroschenen Getreide gesammelt wird. ...Es ist offensichtlich, daß sowohl ein erstes als auch ein zweites
Sammeln geplant ist. Die Aufgabe des ersten wird es sein, das Land zu erschließen, und danach wird Israel dann in größter Erhabenheit erblühen.12
Kalischer legt sogar voller Sehnsucht nahe, daß schon die Tatsache, daß einige Juden sich ohne offensichtliche göttliche Intervention in Jerusalem versammelten, die von der Vorsehung bestimmte endgültige Erlösung beschleunigen könnte:
166
Grundkurs Judentum
Zionismus
Aus: Shlomo Avineri, Profile des Zionismus. Die geistigen Ursprünge des Staates Israel, Gütersloh 1998
Wenn sich viele Juden [im Lande Israel] ansiedeln und ihre Gebete am heiligen Berg in Jerusalem sich mehren - dann wird der Schöpfer sie erhören und den Tag der Erlösung beschleunigen. Damit aber all dies geschehen kann, muß es zunächst eine jüdische Besiedlung des Landes geben
Wie kann ohne eine solche Besiedlung die Sammlung beginnen?13
Kalischer beschäftigt sich auch mit dem Problem der Beziehungen zu der bestehenden, wenn auch kleinen jüdisch-orthodoxen Gemeinde in Palästina. Kalischer weiß, daß in der Diaspora der Unwille, die finanzielle Hilfe für diese Gemeinde aufrechtzuerhalten, weit verbreitet ist. Sie ist weitgehend auf Almosen aus Übersee angewiesen und bekannt für ihren Widerwillen, sich selbst zu erhalten. »Es gibt viele«, so Kalischer, »die sich
weigern, die Armen des Heiligen Landes zu unterstützen, und sagen: >Warum sollten wir Menschen unterstützen, die den Müßiggang wählen, die
faul sind und nicht arbeiten wollen und die sich lieber darauf verlassen, daß die Juden in der Diaspora sie versorgen.«< 14 Kalischer nennt dies ein
falsches Argument. Die jüdische Gemeinschaft in Palästina sei zur Zeit zu klein, um für sich allein zu sorgen. Sobald einmal die Masseneinwanderung nach Palästina beginne, werde auch die Grundlage für eine selbständige Wirtschaftsstruktur geschaffen, und dann könne der Alte Jischuw
produktiv in diese neue Gesellschaft eingegliedert werden. Die Schaffung einer eigenen landwirtschaftlichen Gemeinschaft würde es den Juden
ermöglichen, wieder die religiösen Gebote zu befolgen, die die Bearbeitung des Bodens (mizwot ha-telujot ba-arez) betreffen. »In dem Maße, wie
wir dem Land auf diese weltliche Weise Erlösung bringen, wird sich auch der Schein der himmlischen Erlösung allmählich einstellen«,15 setzt Kalischer hinzu und stellt damit erneut die dialektische Beziehung zwischen menschlichem Handeln und göttlicher Vorsehung her.
Kalischer erläutert auch einige Einzelheiten seines Projektes zur Wiederbesiedlung Palästinas. Ähnlich wie Alkalai schlägt er vor, der üblichen jüdischen Praxis der Geldbeschaffung durch allgemeine Spenden zu folgen und einen Fonds für den Landkauf einzurichten. Dieser Fonds sollte in
erster Linie durch reiche jüdische Familien wie die Rothschilds, die Montefiores, die Foulds und die Albert Kahns finanziert werden. Diese Magnaten sollten auch die Möglichkeit erkunden, vom Sultan einen Schutzbrief für die jüdischen Treuhandsiedlungen zu erhalten. Das Siedlungsmodell
selbst gleicht den Strukturen späterer jüdischer Bemühungen, öffentliches und kooperatives Handeln mit privater Landwirtschaft zu verbinden:
Viele Juden aus Rußland, Polen und Deutschland sollten von der Gesellschaft, der sie sich anschließen müßten, unterstützt werden und unter der
Leitung solcher, die in, Feldbau unterrichtet worden sind (sofern sie den Ackerbau nicht schon selbst verstehen), Parzellen Landes zunächst unentgeltlich zugeteilt bekommen, bis sie im Stande sein würden, nachdem das Land mit Hilfe des Gesellschaftskapitals urbar gemacht worden, dasselbe als Pächter zu bestellen.16
Kalischer schlägt außerdem vor, in Palästina eine Landwirtschaftsschule einzurichten. Diese Idee wurde von der Alliance Israelite Universelle aufgegriffen, die 1870 die Landwirtschaftsschule Mikwe Israel in der Nähe von Jaffa gründete. Diese Schule spielte später bei der Entwicklung der
jüdischen Landwirtschaft in Palästina eine große Rolle.
Alkalai und Kalischer sind ein ungewöhnliches Phänomen unter den Rabbinern des 19. Jahrhunderts. Ihre Einzigartigkeit zeigt, welch tiefen Eindruck der Modernisierungsprozeß auf die Begriffswelt des traditionellen Judentums machte. Die emanzipierten Juden benötigten nach der Säkularisierung und dem Auftauchen des Nationalismus eine Neudefinition ihrer Identität. Für die Traditionalisten wie Alkalai und Kalischer gab es solche
Identitätsprobleme nicht, denn ihre Identität wurde auch weiterhin durch die Grenzen des orthodoxen, normativen Judentums bestimmt. Aber auch
sie erkannten die Notwendigkeit, auf die neuen Herausforderungen in den sie umgebenden Gesellschaften zu reagieren. So stellen sie in ihren
Schriften spezifische Bedingungen vor, die den modernen nationalistischen Bewegungen entstammten, und entmystifizieren den Erlösungsprozeß,
indem sie das Augenmerk auf die natürlichen Aspekte des messianischen Prozesses richten. Hierin zeigt sich der Einfluß, den die revolutionäre
Situation des 19. Jahrhunderts auf das jüdische Bewußtsein der postemanzipatorischen Ära hatte.
167
Grundkurs Judentum
Zionismus
Aus: Shlomo Avineri, Profile des Zionismus. Die geistigen Ursprünge des Staates Israel, Gütersloh 1998
Die Fähigkeit der traditionellen Strukturen, neuartige und moderne Ideen zu absorbieren, beweist die große Anpassungsfähigkeit des traditionellen
Judentums. Während Alkalai und Kalischer innerhalb des rabbinischen Establishments des 19. Jahrhunderts allein standen, war es diese Anpassungsfähigkeit, die einige Generationen später weite Kreise der orthodoxen Gemeinde in die Lage versetzte, den Zionismus anzunehmen. Dies
war möglich, obwohl die zionistischen Aktivisten zunächst einer negativen Reaktion der Traditionalisten gegenüberstanden. Diese Entwicklung
verhinderte einen Bruch zwischen der zionistischen Bewegung und den Orthodoxen. Zu ihm kam es erst viel später, als die jüdische Nationalidee
sich bereits herauskristallisiert hatte und als historische Kraft hervorgetreten war, und zwar aufgrund des intellektuellen und spirituellen Wirkens
von Menschen, deren Erfahrungen durch die Suche nach Identität unter den Bedingungen der Säkularisierung und durch einen Bruch mit der religiösen Tradition geprägt waren.
Anmerkungen:
1. Eine sehr frühe zweisprachige Ausgabe einer der Schriften Alkalais wurde unter dem Titel Harbinger of Good Tidings (London, 1852) auf Hebräisch und Englisch veröffentlichet.
2. In rabbinischer Tradition enthält der Titel des Buches Alkalais Vornamen (Jehuda-Judah).
3. Arthur Hertzberg, The Zionist Idea, rev.ed. (NewYork, 1969), S. 105.
4. Ebenda, S. 106. Die Zahl siebzig bezieht sich auf die traditionelle jüdische Redensart von den »siebzig Völkern und Sprachen«, was soviel bedeutet wie »die gesamte Welt außerhalb des Judentums«.
5. Ebenda.
6. Ebenda. Die Vorstellung, daß Mädchen ebenso wie Jungen, Hebräisch lernen sollten, war genauso revolutionär und neuartig wie die Vorstellung, daß Lehrer und Schüler sich in der Heiligen Sprache unterhalten sollten.
7. Ebenda, S.107.
8. Ebenda, S. 106f.
9. Ebenda,S.114.
10. Alle diese Bilder stammen aus der traditionellen jüdischen Literatur über die Ankunft des Messias.
11. Hertzberg, S. 111.
12. Ebenda, S. 111f.
13. Ebenda, S.112f.
14. Ebenda,S.113.
15. Ebenda,S.114.
16. Zitat aus Moses Hess, Rom und Jerusalem -Die letzte Nationalitätenfrage, überarb. Aufl. (Tel Aviv, 1935), S. 137f.
168
Grundkurs Judentum
Zionismus
Aus: Shlomo Avineri, Profile des Zionismus. Die geistigen Ursprünge des Staates Israel, Gütersloh 1998
Theodor Herzl
Der Durchbruch
111-123
Theodor Herzl, der den ersten Zionistenkongresses in Basel im Jahr 1897 einberief und die World Zionist Organization gründete, ist mehr als jede
andere Person mit dem Phänomen des politischen Zionismus in Zusammenhang gebracht worden. Sein Leben (1860-1904) erhielt legendäre Züge, sein Bildnis wurde zum Markenzeichen des Zionismus, und die Symbolträchtigkeit, die seiner Persönlichkeit anhaftete, wurde zu einem wirkungsvollen Grundzug der zionistischen Sache. Konsequenterweise ist sein Leben Gegenstand von Studien, Diskussionen und Analysen geworden, mehr als das der anderen zionistischen Gründerväter.1
Darauf soll hier jedoch nicht näher eingegangen werden, auch sollen weiterhin die offensichtlichen und bereits bekannten Fakten seines Wirkens
nicht wiederholt werden. Unsere Untersuchung beschränkt sich hauptsächlich auf einen Kernpunkt, auf die grundlegende Fragestellung in bezug
auf Herzl.
Jeder, der Herzls Werke liest - hauptsächlich Der Judenstaat (1896) und Altneuland (1902) -, wird eine Fülle an Ideen über die Dilemmata der jüdischen Existenz in der modernen Welt sowie einige praktische Lösungsvorschläge finden. Nur wenige dieser Ideen sind ungewöhnlich oder gar
originell. Herzls scharfsinnige Analyse der Wurzeln des Antisemitismus in der nach-emanzipatorischen Zeit nahmen bereits die analytisch noch
genaueren Schriften von Hess, Lilienblum und Pinsker vorweg; Herzls Ideen über die Gründung von nationalen jüdischen Einrichtungen zur Beschleunigung der zionistischen Ziele gingen ähnliche Ideen -und Institutionen -von Kalischer, Smolenskin und den Gründern der Chowewe ZionBewegung voraus. Außerdem waren jüdische Siedlungen Jahrzehnte vor Herzl in Palästina gegründet worden, und trotz ihres begrenzten Erfolgs
richtete sich die Aufmerksamkeit und Bewunderung zahlreicher jüdischer Organisationen in etlichen Ländern auf sie.
Worauf gründete dann aber die neuartige und historische Bedeutsamkeit von Herzls Tun? Lag diese doch weder in der Originalität seiner Gedanken noch in seinem organisatorischen Sachverstand, der eher beschränkt war; sie mußte also in etwas ganz anderem bestehen. Herzl war der
erste, der einen Durchbruch für den Zionismus in der jüdischen sowie der weltweiten Öffentlichkeit erreichte. Er trug die Suche nach einer nationalen Lösung der Misere des jüdischen Lebens, die in hebräischen Zeitschriften thematisiert und von einer Handvoll jüdischer Intellektueller in den
entfernten Ecken der russischen Siedlungsprovinzen ausführlich und in gelehrtem Ton debattiert wurde, in das Bewußtsein der Weltöffentlichkeit.
Diese Randerscheinung des jüdischen Lebens malte er als die zionistische Lösung hinsichtlich der Misere des jüdischen Volkes auf die weltpolitische Leinwand und seit damals hat diese sie nicht mehr verlassen.
Herzl besaß keine finanziellen Mittel und keine politische Macht, die ihm den Rücken stärkte. Das jüdische finanzielle und das rabbinische Establishment beobachtete ihn zumeist mit Misstrauen, wenn nicht sogar mit Bestürzung. Sein Auftreten in der Arena der Weltöffentlichkeit war zwar
wegen seiner eigenen kämpferischen - und oftmals manischen - Arbeit erfolgreich, aber im Laufe seines Lebens zeigte Herzl Anzeichen von unverantwortlichem, wenn nicht sogar gefährlichem Egoismus. Was Herzl jedoch beim Sprung ins öffentliche Rampenlicht half, waren sein Beruf und
seine Persönlichkeit: Er war ein brillanter, bisweilen oberflächlicher Journalist, hungrig nach öffentlicher Aufmerksamkeit, erfahren in der Öffentlichkeitsarbeit.
In diesem Sinne zeigte sich Herzl als wahres Kind seiner Gesellschaft. Sein intellektueller Eklektizismus und der Mangel von wirklich spiritueller
Tiefe, gepaart mit Brillanz und Wiener feuilletonistischen Bonmots, die gemeinhin seine Schriften kennzeichnen -alle diese Merkmale, welche auf
sein im Grunde leichtfüßiges Naturell hinzuweisen scheinen, waren genau die Momente, die ihn bei seinem einseitigen Bestreben unterstützten.
169
Grundkurs Judentum
Zionismus
Aus: Shlomo Avineri, Profile des Zionismus. Die geistigen Ursprünge des Staates Israel, Gütersloh 1998
Sorgsame und weniger oberflächliche Menschen hätten sich geängstigt, seinen Weg zu beschreiten. Aber von jenem Moment an, als Herzl die
Notwendigkeit einer nationalen Lösung der jüdischen Frage sah, bemerkte er richtigerweise, daß eine so folgenschwere und revolutionäre Aufgabe nicht in stiller Arbeit abseits der Welt bewältigt werden könne. Artikel in obskuren jüdischen Publikationen konnten jedenfalls nicht die massiven
Kräfte mobilisieren, die für einen enormen Umgestaltungsversuch gebraucht würden; ideologischer Richtungsstreit zwischen halbbeschäftigten
jüdischen Intellektuellen in unbekannten Traktaten würde nie die Botschaft vermitteln können. Nur ein kühner, abenteuerlicher Durchbruch könnte
erfolgreich die Botschaft ins Zentrum der Weltöffentlichkeit befördern.
Folglich war sein schriftstellerisches Werk - besonders der Judenstaat - oftmals pompös, bombastisch und theatralisch. Und seine Lösungsvorschläge sehen nicht nur so aus, als hätte sie ihr Autor erstmalig entdeckt, sondern auch, als sei er der erste gewesen, die Fragen überhaupt zu
stellen. So war auch sein Versuch, Hilfe von jüdischen Finanzmagnaten wie Edmund de Rothschild und Maurice de Hirsch zu erhalten, von der
prophetischen Chuzpe eines für das ganze jüdische Volk sprechenden Bettlers gekennzeichnet.
Alle seine dramatischen Annäherungsversuche an den Papst, den Deutschen Kaiser, den Sultan, den Erzherzog von Baden sowie den britischen
Kolonialminister wurden von seinem profunden Verständnis geleitet, daß die Anstrengungen eines kleinen und verfolgten Volkes nur Erfolg hätten,
wenn sie direkt, ohne Vermittlung und mit unerbittlicher Einfalt direkt in die Regierungsspitzen der Weltmacht und der internationalen Meinung getrieben würden. Er, Theodor Herzl, ein wohlbekannter, aber mittelloser Journalist, pflegte mit dem Sultan über die Gewährung eines Freibriefes für
die Juden in Palästina zu verhandeln; er, der assimilierte Jude, wollte Wege ins Herz des Papstes finden; er, dessen einzige Waffe der Stift war,
wollte den Deutschen Kaiser, die Königlich-Britische Regierung, den Innenminister des Zaren - kurz: all die Hohen und Mächtigen überzeugen.
Keine dieser Mühen hatte Erfolg. Der Sultan war nicht davon überzeugt, daß eine Allianz mit den Juden die weiseste politische Entscheidung sei;
die britische Regierung trat ihrerseits von der exotischen Idee zurück, Teile Ostafrikas jüdischen Siedlungen zuzuweisen; Kaiser Wilhelm II.
verstand wahrscheinlich noch nicht einmal die Zusammenhänge, die Herzl ihm vortrug; sogar Rothschild und Hirsch blieben letztlich unüberzeugt
und öffneten nicht ihre Tresore.
Und trotzdem konnte Herzl auf seine Bemühungen weisen: Beeinflussung und Beeindrucken der Höflinge, Bestechung auf seinem Weg durch das
Labyrinth des ottomanischen Hofes, seine Aufwartung bei Wilhelm II. anläßlich dessen Jerusalem-Besuchs, das Warten in den Vorzimmern der
Hohen Pforte - immerfort die Mächtigen der Weltpolitik bestürmend und bedrängend. Denn zu guter Letzt hatte Herzl trotz aller Fehlschläge doch
mit ihnen oder mit ihrer unmittelbaren Umgebung gesprochen und ihnen seine Ideen und Pläne vorstellen können. In diesen Dingen hatte er mehr
Erfolg als irgend jemand vor ihm. Während er dies zuwege brachte, trat er dabei jedesmal auf, als spräche er als bevollmächtigter Gesandter eines
mächtigen jüdischen Reiches, obwohl hinter ihm keine Bewegung und praktisch keine Organisation, kein Geld und kein Einfluß standen. Seine
einzige Geldquelle war manchmal nur der Pfandleiher.
All dies war die virtuose Darstellung eines Meisters der Öffentlichkeitsarbeit, eines Menschen, welcher der zukünftigen neuen Mächte des 20.
Jahrhunderts gewahr wurde: die öffentliche Meinung, Massenkommunikation und Taschenspielertricks, deren Bedeutung mehr in ihrer nachhaltigen Wirkung als in ihrer Substanz liegt. Dies erklärt die Überdramatisierung sowie sein Beharren, nur mit Menschen an der Spitze (Papst, Kaiser,
Sultan) sprechen zu wollen, aber ebenso die zahlreichen bühnenreifen Auftritte Herzls: Dazu gehören der Zylinder, der makellose Frack, die weißen Handschuhe, die zeremonielle Eröffnung des ersten Zionistenkongresses. Diese Äußerlichkeiten wurden von Herzls Zeitgenossen und Mitarbeitern oftmals kritisch beäugt. Einige bemerkten darin zurecht eine Kompensierung von psychologischen Defiziten, vielleicht sogar die Rasereien
einer leicht instabilen Seele. Einige akzeptierten diese Äußerlichkeiten als persönliche Eigenheiten, die gerechtfertigt schienen, als Herzl den erwählten Gipfel tatsächlich erklomm. Andere wiederum fanden es weitaus schwieriger, sich mit seinem grellen Stil anzufreunden (kein Wunder, war
Disraeli doch Herzls bevorzugter Politiker). Aber Freund und Feind mußten gleichermaßen einräumen, daß seit Herzl, kometenhaftem Erscheinen
170
Grundkurs Judentum
Zionismus
Aus: Shlomo Avineri, Profile des Zionismus. Die geistigen Ursprünge des Staates Israel, Gütersloh 1998
der Zionismus begonnen hatte, sich in eine andere Sphäre zu bewegen: Losgelöst von der engstirnigen Beschäftigung einiger jüdischer Intellektueller wurde dieser jetzt zu einer Angelegenheit der Weltpolitik und übertraf das bloße organisatorische Gründungsfaktum der zionistischen Bewegung.
Mit diesem Durchbruch schmiedete Herzl jene Waffe, die später die Hauptstütze des Zionismus für den Kampf eines schwachen Volkes wurde,
das anfänglich über keine militärische und politische Macht verfugte, die seinen Anspruch im Angesicht der überwältigenden Stärke von Politik und
Historie hätte unterstützen können, als eben die öffentliche Meinung. Sie war die einzige zionistische Waffe, die eingesetzt werden konnte, um den
Klauen der Weltgeschichte eine Heimstatt für das jüdische Volk zu entreißen.
Die Balfour-Deklaration von 1917, die Resolution der Vereinten Nationen von 1947, die einen jüdischen Staat in einem Teil des Mandatsgebiets
von Palästina forderte, und andere Meilensteine auf dem Weg zum jüdischen Staat sind nicht durch jüdische Wirtschafts- oder politische Macht,
sondern durch die Geschicklichkeit der zionistischen Bewegung an sich zustande gekommen. Diese verstand es immer wieder, die intellektuellen
und geistigen Reserven eines hochgebildeten, polemisch geschulten und auf den öffentlichen Diskurs eingestellten Volkes zu mobilisieren. Dies
waren die Waffen einer schwachen, drangsalierten und kleinen Nation in einem Kampf mit sehr unsicherem Ausgang. Herzl war der erste, der dieses Potential erkannte und es zur öffentlichen Macht schmiedete. Zu einem Großteil beruhen der Zionismus und der Staat Israel bis zum heutigen
Tag darauf.
Konsequenterweise ist es bei der Bewertung von Herzls Schriften notwendig, die begrenzte Originalität seiner Ideen mit jener immensen Wirkung
abzuwägen, als sie - zum ersten Mal im zionistischen Denken - tatsächliche Verkaufsschlager wurden.
Es ist ein allgemeines Mißverständnis, daß Herzl sich im Judenstaat zum ersten Mal der jüdischen Frage annahm und daß nur die Dreyfus-Affäre
ihn auf' dramatische Weise vor dem Erscheinen einer bösartigen Form des Antisemitismus warnte und davon überzeugte, die Emanzipation sei
fehlgeschlagen. In seiner Generation war Herzl ein typisches Produkt dieser Emanzipation: Geboren in Budapest als Sohn eines wohlhabenden
Kaufmanns, zog er als Kind nach Wien, promovierte später in Jura und wurde einer der bekanntesten und meistgelesenen Journalisten und Kolumnisten der liberalen Wiener Neuen Freien Presse. Er versuchte sich, wenngleich nicht sehr erfolgreich, auch als Bühnenautor, in dessen Werken die ersten Zweifel an der Emanzipation zur Sprache kamen. Die meisten seiner Stücke, die ans jüdisch-bourgeoise Wiener Theaterpublikum
gerichtet waren, handeln von den Problemen des modernen, emanzipierten jüdischen Intellektuellen. Eines der erfolgreicheren Stücke, Das neue
Ghetto (1894), drückt das Gefühl von Frustration aus, an einem toten Punkt angelangt zu sein, welches typisch für viele der erfolgreichen, emanzipierten Juden der Mittelklasse war. Als einer der Helden im Stück darauf besteht, aus diesem Gefängnis zu fliehen, bedeutet ihm ein weiterer Protagonist namens Rabbi Friedheimer:
Und ich antworte Ihnen. wir können nicht! Als das wirkliche Ghetto noch bestand, durften wir es ohne Erlaubnis nicht verlassen - bei schwerer Leibesgefahr. Jetzt sind die Mauern und Schranken unsichtbar... Aber auch dieses moralische Ghetto ist unser vorgeschriebener Aufenthaltsort. Wehe dem, der hinaus will!2
In Frankreich, wo er seit 1891 als Pariser Korrespondent der Neuen Freien Presse arbeitete, wurde Herzl sogar noch sensibler, was die Unklarheit
über den Status des modernen Juden betraf. Rührte der volkstümliche Antisemitismus in Wien zum Teil aus den Überbleibseln religiöser Gefühle
gegenüber den Juden in einer im Grunde traditionellen Gesellschaft, so lernte Herzl in Paris eine neue - populistische -Variante des Antisemitismus kennen, genährt von den Widersprüchen einer modernen, im höchsten Maße säkularisierten und parlamentarischen Gesellschaft. Viele von
Herzls Berichten aus Paris während dieser Zeit behandeln das Auftreten des sozialen Antisemitismus in Frankreich.3 Herzl verfolgte mit großer
Besorgnis die dortige öffentliche Debatte, die den wachsenden Vorsprung der Juden im wirtschaftlichen, intellektuellen und parlamentarischen Leben Frankreichs ins Auge zu fassen begann. Diskussionen über Wirtschaftskrisen und Finanzskandale sowie intellektuelle und parlamentarische
171
Grundkurs Judentum
Zionismus
Aus: Shlomo Avineri, Profile des Zionismus. Die geistigen Ursprünge des Staates Israel, Gütersloh 1998
Debatten wurden aufgrund der einseitigen Betonung der jüdischen Herkunft einiger bedeutender Personen zu einer heillos verworrenen, ablenkenden und unfeinen Angelegenheit. Herzl sieht darin ein neues Problem, welches in der Emanzipation selbst begründet liegt und deshalb nicht
durch diese überwunden werden kann. Der Widerspruch scheint Herzl offensichtlich: Gerade in dem Land, in welchem die erste Judenemanzipation gewährt wurde - im republikanischen Frankreich, dem Erben der Großen Revolution - tritt ein neu es und drohendes Problem auf, das seine
Ursprünge in den Spannungen und Belastungen der modernen Gesellschaft per se hat. Die Dreyfus-Affäre deutete Herzl richtig als den lediglich
dramatischen Ausdruck eines weitaus tiefergreifenden Unbehagens.
Das Auftreten des modernen Antisemitismus in einem für Universalismus und Brüderschaft einstehenden Land - wo zudem der jüdische Bevölkerungsanteil gering war -brachte Herzl die Ironie der herkömmlichen liberalen Weisheit ins Bewußtsein, daß nämlich Gleichstellung und Gleichberechtigung die jüdische Frage würden lösen können. Nicht nur, daß die Judenemanzipation sich dazu als unfähig erwies - das Problem in seinen
neuen Dimensionen lag in der Gleichstellung und dem Auftreten des modernen, weltlichen Juden selbst begründet. In seinem Judenstaat schreibt
Herzl:
In den Hauptländern des Antisemitismus ist dieser eine Folge der Judenemanzipation. Als die Kulturvölker die Unmenschlichkeit der Ausnahmegesetze einsahen und uns freiließen, kam die Freilassung zu spät. Wir waren gesetzlich in unseren bisherigen Wohnsitzen nicht mehr emanzipierbar. Wir hatten uns im Ghetto merkwürdigerweise zu einem Mittelstandsvolk entwickelt und kamen als eine fürchterliche Konkurrenz für den Mittelstand heraus. So standen wir nach der Emanzipation plötzlich in einem harten Wettstreit mit der Bourgeoisie und müssen da einen doppelten
Druck aushalten, von innen und von außen. Die christliche Bourgeoisie wäre wohl nicht abgeneigt, uns dem Sozialismus als Opfer hinzuwerfen;
freilich würde das wenig helfen...4
In Altneuland liefert Herzl einen treffenden Überblick darüber, wie das moderne Leben so viele Juden in die Mitte der unzähligen sozialen und wirtschaftlichen Kreuzfeuer stellt. Ähnliche Gedanken hatten vorher auch schon Lilienblum und Pinsker formuliert:
Die Verfolgungen waren sozialer und ökonomischer Art: Boykott im Geschäftsleben, Aushungerung der Arbeiter, Ächtung in den freien Berufen,
von den feineren, moralischen Leiden gar nicht zu sprechen, die ein feinsinniger Jude um die Jahrhundertwende zu erdulden hatte. Die Judenfeindschaft setzte die neuesten und auch ältesten Mittel ein. Das Blutmärchen wurde aufgefrischt, aber gleichzeitig hieß es auch, daß die Juden
die Presse - wie einst im Mittelalter den Brunnen - vergifteten. Die Juden wurden von den Arbeitern, wenn sie ihre Genossen waren, als Lohnverderber gehaßt; als Ausbeuter, wenn sie die Unternehmer waren. Sie wurden gehaßt, ob sie arm oder reich oder mittelständig waren. Man nahm
ihnen das Erwerben, aber auch das Geldausgeben übel. Sie sollten weder produzieren noch konsumieren. Von den Staatsämtern wurden sie zurückdrängt, vor den Gerichten hatten sie das Vorurteil gegen sich, überall im bürgerlichen Leben fanden sie Kränkungen. Unter diesen Umständen
war es klar, daß sie entweder die Todfeinde einer von Ungerechtigkeit strotzenden Gesellschaft werden oder nach einem Zufluchtsort ausblicken
mußten.5
Gemäß Herzl würden sich diese Prozesse intensivieren, und er sieht keine Garantien oder eingebauten Mechanismen, um diese Entwicklungen
für die Zukunft einzuschränken oder gar umzukehren. Darum lautet die schmerzvolle Erkenntnis, daß den Juden letztlich nur ein Weg offenbleibt der nach draußen.6
Als Herzl zu dieser radikalen Ansicht gelangte, beschleunigt sich seine Aktivität, um dieses Ziel zu verwirklichen, und seine journalistische Karriere
wird untrennbar verwoben mit seinen Bemühungen um eine neuartige Form der jüdischen diplomatischen Aktivität. Dies ist eine bekannte und oft
erzählte Geschichte; deshalb wird diese Untersuchung auf die Natur der zukünftigen jüdischen Gesellschaft begrenzt bleiben, wie sie Herzl in seinen programmatischen Büchern Der Judenstaat und Altneuland entwarf.
172
Grundkurs Judentum
Zionismus
Aus: Shlomo Avineri, Profile des Zionismus. Die geistigen Ursprünge des Staates Israel, Gütersloh 1998
In ihrer Form sind diese zwei Werke so unterschiedlich, wie sie nur sein können. Der Judenstaat ist eine Kombination aus politischem Mallifest und
juristischem Schriftsatz. Das Buch zählt die Probleme der jüdischen Existenz in der modernen Gesellschaft auf, um dann - im juristischen Detail
manchmal übertrieben - die Struktur der jüdischen Organisationen zur Schaffung einer jüdischen Gesellschaft in einem neuen Land zu beschreiben. Die Frage, ob diese neue Gesellschaft in Palästina oder in Argentinien (wie es vorher durch Baron Hirschs philanthropische Bestrebungen
empfohlen wurde) beheimatet sein soll, bleibt offen. Trotzdem scheint Herzl zu der historischen Heimat des jüdischen Volkes zu neigen.
Altueuland hingegen ist ein utopischer Roman, jene Art von Buch, Von der Herz im Judenstaat sagt, daß er es nicht schreiben werde, denn »nichts
beweist mir, daß sie [die utopische »Maschinerie«] in Betrieb gesetzt werden könne.«7 Altneuland, geschrieben 1902, ist die Beschreibung eines
jüdischen Palästina, projiziert ins Jahr 1923. Ungeachtet seiner didaktischen Form (die es mit den meisten utopischen Romanen gemein hat) sowie allzu offensichtlicher Handlung ist dieses Werk mit einer reichen Vorstellungskraft geschrieben, die tief in der Wirklichkeit der jüdischen Situation und den Lebensbedingungen in Palästina verwurzelt ist. Verglichen mit den später auftretenden israelischen Lebenswirklichkeiten ist es ein
interessanter Gradmesser, an dem sich der zionistische Traum messen läßt. Die dort vorgestellte Vision sollte im allgemeinen Kontext des utopischen Literaturgenres betrachtet werden. Es ist keine Frage, daß viel von seiner Faszination in der lebendigen und bewegenden Beschreibung
eines wiedererweckten Landes Israel liegt. Herzl hatte keine Zweifel mehr am Schauplatz der neuen Heimat. Es war ihm klar, daß die Wiederbelebung des jüdischen Volkes nur in dessen angestammten Land möglich sei.
Jedoch liegt diesen Büchern auch ein gemeinsames Muster zugrunde. In beiden Werken beschreibt Herzl nicht bloß eine Gesellschaft, die eine
Zuflucht für die Juden bedeutet, sondern er erschafft diese auch als ein Modell für soziale Gerechtigkeit, basierend auf der sozialistisch-utopischen
Literatur des 19.Jahrhunderts.
Das klingt zu einem großen Teil sehr paradox, denn Herzl ist für sich genommen das Urbild eines bourgeoisen, liberalen Denkers, und keine politisch extreme Veranlagung ist bei ihm zu entdecken. Seine politische Philosophie tendiert im allgemeinen sogar zum Konservativen. Im Judenstaat
etwa bemerkt er, daß die Idealform einer Regierung eine »aristokratische Republik« sei, und er zitiert dazu Venedig als Modellfall." Einen ähnlichen Hinweis gibt er in Altneuland.
Ungeachtet seiner moderaten, wenn nicht konservativen politischen Haltung ist sich Herzl allerdings bewußt, daß die Revolution, die notwendig mit
der Errichtung eines jüdischen Staates verbunden ist, zwangsläufig mit einer radikalen Un1gestaltung der jüdischen Sozialstruktur einhergeht. Und
weiter: Da Herzl begreift, daß die Juden im Grunde genommen ein Mittelklassevolk sind, würde die Schaffung eines nationalen jüdischen Staatswesens die Umwandlung der Juden von einer Klasse in ein Volk bedeuten, die sie vom alt-neuen Ghetto zu einer sozialen Gesamtstruktur hinführt,
in der alle Tätigkeiten von Juden ausgeführt würden. Ironischerweise erwähnt Herzl sogar, daß - während die Juden die industriellen, wissenschaftlichen und landwirtschaftlichen Positionen der Neuen Gesellschaft eroberten - in seinem Haifa des Jahres 1923 viele der dortigen Kaufleute
Griechen und Armenier seien.10 Eine Umwandlung der Sozialstruktur kann nicht durch die Marktmechanismen einer Laisser-faire-Gesellschaft zustande gebracht werden, stellt Herzl fest.
Im Judenstaat kristallisiert sich das Element des öffentlichen Landbesitzes folgendermaßen heraus: Das Land wird kollektiv in Besitz genommen,
und es wird kein privates Eigentum an Land und natürlichen Ressourcen geben. Eigenständige Farmer werden ihre Parzellen vom Nationalen
Fonds pachten. In Altneuland führt Herzl dies sorgfaltig aus und empfiehlt dabei, das alte mosaische Prinzip des Jubeljahres in den Nutzungsplänen der Neuen Gesellschaft als Einrichtung aufzunehmen. Zudem ist im neuen Staatsgebiet kein privater Landbesitz erlaubt. Diesem Prinzip folgte
später der Jüdische Nationalfonds, der Eigentümer jenes Landes wurde, das die Zionistische Organisation erstanden hatte.
Herzl faßt im Judenstaat die massive Besiedlung Palästinas durch die Einrichtung von staatlichen Häusern für Arbeiter und durch die Schaffung
eines umfassenden Netzwerks von sozialen Wohlfahrtsinstitutionen ins Auge, welche die Neue Gesellschaft als Wohlfahrtsstaat gliedern. Als Hö173
Grundkurs Judentum
Zionismus
Aus: Shlomo Avineri, Profile des Zionismus. Die geistigen Ursprünge des Staates Israel, Gütersloh 1998
hepunkte dieser sozialen Bestrebungen nennt Herzl den Sieben-Stunden-Arbeitstag und das Bereitstellen von allgemeiner Arbeit anstatt öffentlicher Unterstützung.11
Dieser Sieben-StundenTag ist so wichtig für ihn, daß diese Idee sich auch in der Flagge ausdrückt, die er für den jüdischen Staat vorschlägt: »Ich
denke mir eine weiße Fahne mit sieben goldenen Sternen. Das weiße Feld bedeutet das neue, reine Leben; die Sterne sind die sieben goldenen
Stunden unseres Arbeitstages. Denn im Zeichen der Arbeit gehen die Juden in das gelobte Land.«12
In Altneuland erscheint das soziale Element in einer weitaus stärkeren Form. Die Sozialstruktur des Landes wird hier als »gemeinschaftlich« und
»mutualistisch« - ein Ausdruck, der direkt aus dem französischen Sozialutopismus entlehnt ist – bezeichnet. Die Festlegung der Wirtschaft ist genossenschaftlich, aber der einzelne soll nicht von der Möglichkeit abgehalten werden, individuelle Initiativen einzubringen:
Und doch stellt unser Konzept die Mitte zwischen Individualismus und Kollektivismus dar. Der einzelne wird nicht der Anregungen und Freuden
des Privateigentums beraubt, und dennoch kann er sich im Zusammenstehen mit Genossen der kapitalistischen Übermacht erwehren. Der Jammer, der Fluch ist von unseren Armen genommen, daß sie am Erzeugnis weniger verdienen und den Verbrauch teurer bezahlen als die Reichen.13
Einer der dramatischen erzählerischen Höhepunkte von Altneuland ist die Gemeindeversammlung der Bauern in der neucn Kooperative Neudorf in
Galiläa.
Diese Versammlung wird von Herzl zu einem umfangreichen didaktischen Vortrag über die Prinzipien der sozialen Organisation der Neuen Gesellschaft genutzt, die von David Littwak, der Hauptfigur des Romans, vorgetragen werden. Im folgenden skizziert Littwak die Ursprünge der jüdischen
Genossenschaftsgesellschaft in Palästina:
Und ihr werdet es für einen Scherz halten, wenn ich euch sage, daß Neudorf gar nicht in Palästina gebaut worden ist, sondern anderswo. Es ist
gebaut worden in England und Amerika, in Frankreich und in Deutschland. Es ist entstanden aus Erfahrungen, Büchern und Träumen. Die
mißglückten Versuche von Praktikern wie von Phantasten mußten euch zur Lehre dienen - ihr wußtet es nur nicht. 14
Littwak fährt damit fort, die Vorgänger dieses genossenschaftlichen Gemeinwesens in Palästina aufzuzählen: Charles Fourier, der französische
sozialistische Utopist und Begründer des Phalanstère-Systems; Etienne Cabet, der französische kommunistische Utopist und Autor von Voyage
en Icarie; Theodor Hertzka, der Autor von Freiland; Edward Bellamy, »der in seinem Rückblicke aus dem Jahre 2000 auf das Jahr 1887 eine edle
kommunistische Gesellschaft darstellt«; und schließlich die Rochdale-Pioniere. Am Ende dieser Aufzählung sagt Littwak zu den Mitgliedern von
Neudorf:
Wenn ihr heute in euren Konsumverein geht und die besten Waren zum billigsten Preise bekommt, so habt ihr das den Pionieren von Rochdale zu
verdanken. Und wenn euer Neudorf heute eine blühende landwirtschaftliche Produktivgenossenschaft ist, so habt ihr das den armen Märtyrern von
Rahaline in Irland zu verdanken. ...
Die neue Gesellschaft beruht vielmehr auf den Ideen, die ein gemeinsames Produkt aller Kulturvölker sind.15
Es liegt auf der Hand, daß nicht der politische, revolutionäre Sozialismus der militanten Arbeiterklasse Herzls Vorbild ist, sondern der utopische,
humanitäre und reformistische, der später im zionistisch-sozialistischen Kontext »konstruktivistisch« genannt werden sollte. Es ist bezeichnend,
daß der Begründer des modernen politischen Zionismus, der selbst ein liberaler, wenn nicht gar ein gemäßigt konservativer Politiker war, die zukünftige jüdische Gesellschaft auf sozialistischen, genossenschaftlichen Grundzügen errichtet sah. Er erblickte im Neucn Israel die Verwirklichung
der Vision des europäischen Sozialutopismus des 19. Jahrhunderts. Herzl war sich bewußt, daß die Bedingungen für die Neue Gesellschaft in Palästina, die aus dem Nichts begonnen hatte, besonders geeignet für die Errichtung einer mutualistischen Gemeinschaft waren, da es »unser Gewinn ist, frei zu sein von inneren Lasten; wir brauchten nicht irgend jemanden ins Elend zu stürzen, um das Los der Massen zu erleichtern.« Solch
eine Gesellschaft kann - laut Herzl als ein Modell für eine parallele soziale Umgestaltung in Europa dienen.
174
Grundkurs Judentum
Zionismus
Aus: Shlomo Avineri, Profile des Zionismus. Die geistigen Ursprünge des Staates Israel, Gütersloh 1998
Diese sozialistischen Elemente in seiner Beschreibung der zukünftigen jüdischen Gesellschaft in Palästina werden von einer Vielzahl anderer Einrichtungen begleitet, die im Kontext der damaligen Zeit auffallend originell waren. Herzl selbst überschritt bei vielen dieser Innovationen, die er dieser utopischen Gesellschaft zuordnete, die Grenzen seines eigenen bürgerlich-liberalen Horizontes. Zu einer Zeit, als beispielsweise kein europäisches Land das Wahlrecht für Frauen garantierte, postulierte Herzl das allgemeine Wahlrecht als Grundlage der politischen Struktur der Neuen
Gesellschaft, und anhand vieler Details beschrieb er die volle Teilnahme der Frauen am politischen Leben der Gemeinschaft.16 Zu einer Zeit, als
praktisch jedes europäische Land immer noch das männliche Wahlrecht durch diverse Eigentumsbestimmungen einschränkte, reicht Herzls Vision
weit über seine allgemeine Vorliebe für eine »aristokratische Republik« hinaus.
Unter den weiteren radikalen und revolutionären Einrichtungen dieser Neuen Gesellschaft, die alle auf der sozialutopischen Literatur beruhen, ist
Herzls Beharren auf freien und universalen Unterricht, vom Kindergarten bis zur Universität, gleichfalls völlig neu in seiner Zeit um 1902. Zugleich
heißt es, daß alle Mitglieder der Gesellschaft, »die männlichen wie die weiblichen, ...zwei Jahre ihres Lebens dem öffentlichen Dienste widmen
müssen.17 Dieser nationale Dienst gilt nicht den militärischen Belangen. Die jungen Menschen, im allgemeinen zwischen 18 und 20 Jahren alt,
widmen diese zwei Jahre sozialen Diensten, welche die Gesellschaft ihren Mitgliedern anbietet: Kliniken, Kranken und Waisenhäuser, Ferienlager
und Altersheime. Diese und weitere soziale Wohlfahrtseinrichtungen werden somit von Leuten unterhalten, die ihren nationalen Dienst leisten. Und
ebenso sind alle Bewohner gegen Krankheit und Alter versichert, niemand wird von Armut und Schmerzen geplagt. Herzl meint, daß auch seine
Gesellschaft des 19. Jahrhunderts diese Einrichtungen hätte aufbauen können: »Die alte Gesellschaft war schon zur Jahrhundertwende reich genug, nur litt sie an ihrer unbeschreiblichen Verworrenheit. Sie war eine überfüllte Schatzkammer, in der man keinen Suppenlöffel fand, wenn man
ihn brauchte.«18
Städtisches Planungswesen ist gleichfa1ls ein Hauptelement für die Entwicklung der Neuen Gesellschaft. Die neuen Städte in Palästina würden
alle sehr sorgfaltig geplant sein und sich somit nicht so chaotisch entfalten wie das übliche städtischen Wachstum. Ihre Größe hänge nicht von
Grundstücksspekulationen ab. Es gäbe in allen Städten ein elektrifiziertes Massentransportsystem, überwiegend Hochbahnen; Schnellzüge und
erstklassige Straßenverbindungen verknüpften die Städte untereinander; Wasserkraftwerke, die mittels Kanäle das Gefälle zwischen Mittel- und
Toten Meer ausnützten, sorgten so für billige Elektrizität usw. Auf einen Punkt gebracht: Herzls Altneuland beinhaltet alle Bausteine einer utopischen Gese1lschaft, in der mutualistischer Sozialismus mit technologischem Fortschritt und zentralisierter Planung verbunden ist.
In Altneuland spricht Herzl aber auch die zukünftigen Beziehungen zwischen Juden und Arabern in der Neuen Gesellschaft an. Herzl ist deutlich
bewußt, daß das Land -wenngleich spärlich - bereits von Arabern besiedelt ist, und sein Lösungsvorschlag, der heute in Rückschau oberflächlich
naiv und simpel anmutet, ist nichtsdestoweniger von dem universalen, humanistischen Ethos motiviert, das den gesamten Roman durchzieht: Allen arabischen Bewohnern, die der Neuen Gesellschaft als gleichgestellte Mitglieder und Bürger beitreten wollen, steht es frei, dies zu tun. Eine
zentrale Figur des Romans, Reschid Bey, verkörpert den romantischen archetypischen Orientalen der europäischen Literatur des 19. Jahrhunderts: tief verwurzelt im den Wertvorstellungen seiner arabischen und muslimischen Gesellschaft, verbindet er doch im selben Atemzug die Höflichkeit und Toleranz des Orients mit der wissenschaftlichen Entfaltung und der Großzügigkeit des Okzidents. Reschid Bey und seinesgleichen
sind gleichgestellte Mitglieder dieser Gesellschaft, und einige Male erklärt er nachdrücklich, daß die Araber Palästinas beträchtlich von der jüdischen Immigration profitieren.19 Herzl macht jedoch auch darauf aufmerksam, daß die rasche Europäisierung Palästinas durch die Juden sich von
Toleranz leiten lassen und das kulturelle Erbe der arabischen Gesellschaft bewahren müsse. Auf diese Weise sollte sich ein Pluralismus im sozialen Verhalten entwickeln. Während arabische Frauen das gleiche Recht haben, zu wählen und genauso für ein öffentliches Amt gewählt zu werden, könnten die meisten von ihnen es gemäß der muslimischen Sitte vorziehen, innerhalb ihres traditionellen orientalischen Haushaltes zu bleiben, was ihr Vorrecht darstelle.
175
Grundkurs Judentum
Zionismus
Aus: Shlomo Avineri, Profile des Zionismus. Die geistigen Ursprünge des Staates Israel, Gütersloh 1998
Es ist von nicht unwesentlicher Bedeutung, daß die öffentliche Hauptdebatte, die Herzls Neue Gesellschaft im Jahr 1923 bewegt, die Beziehung
zwischen Juden und Arabern, mithin die Toleranzfrage behandelt. Im Roman findet zu jener Zeit eine Wahlkampagne für die Repräsentantenversammlung im Lande statt. Eine extremistische Partei, angeführt von einen, Rabbi namens Dr. Geyer, befürwortet die Mitgliedschaft in der Neuen
Gesellschaft nur für Juden sowie eingeschränkte Bürgerrechte; die gemäßigte Partei, der David Littwak vorsteht, besteht indes darauf, daß im
Lande lebende NichtJuden auch weiterhin ihre Gleichberechtigung behalten sollten. Es ist müßig anzufugen, daß die Söhne des Lichts über die
Söhne der Finsternis triumphieren: Littwaks Partei besiegt lautstark Geyer und seine Anhänger -Toleranz und Gleichberechtigung behalten die
Oberhand.
Interessant hierbei ist Herzls Weitblick beim Aufspüren von Intoleranz und national-religiösen, Fanatismus als eines jener Probleme, das die sozialen Errungenschaften der Neuen Gesellschaft im Land Israel heimsuchen würde. An diesem Punkt wie auch in seinen positiven Vorhersagen waren Herzls Vorstellungen überraschend zutreffend hinsichtlich der Natur jener Gesellschaft, die durch die zionistischen Anstrengungen erst geschaffen werden sollte.
Trotz seiner Toleranz und seinen, universalen Humanismus, die bezeichnend für seine mitteleuropäische Weltanschauung sind, sowie seiner untadeligen Vision der Bürgerrechte für die palästinensischen Araber übersah Herzl aber offensichtlich die Eventualität einer nationalen Bewegung
der arabischen Bevölkerung, die nicht zuletzt auch eine Antwort auf die jüdische Immigration und jene Versuche des Zionismus darstellt, das Land
in eine jüdische Heimstatt umzuwandeln. Es gibt keinen Zweifel, daß sich für Herzl das Problem daraufbegrenzte, die Menschen- und Bürgerrechte der Araber als Individuen zu sichern. Die Frage einer arabischen Nationalbewegung kam ihm niemals in den Sinn. Dies ist in der Tat ein bedenklicher Fehler, jedoch muß man sich den Kontext der Zeit, in der Herzl schrieb, vor Augen halten. Damals existierte so gut wie keine politische
Nationalbewegung unter der arabischen Bevölkerung in Palästina. Vielleicht hätten Menschen wie Herzl sich der Möglichkeit einer solchen Bewegung bewußt sein sollen. Aber von Herzl, der nach einer Lösung des jüdischen Nationalproblems suchte, zu verlangen, zugleich den Aufstieg einer
arabischen Nationalbewegung in Palästina ins Auge zu fassen (und das zu einer Zeit, als weder die herrschenden Ottomanen oder die westlichen
Mächte noch die arabische Bevölkerung selbst deren Bevorstehen ahnten), hieße wohlhistorisch gesprochen -, zuviel zu verlangen.
Bei jedem Versuch, Herzls Beitrag für die Entwicklung des zionistischen Denkens zu bewerten, stechen zwei Punkte deutlich hervor. Erstens: Er
war unglaublich erfolgreich darin, den Ideen, die eine lange Zeit geschlummert hatten, vor der Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit und dem allgemeinen Bewußtsein seiner Zeit jetzt Gehör zu verschaffen. Zweitens: Als ein Denker, der selbst weit vom sozialistischen oder radikalrevolutionärem Gedankengut entfernt war, berücksichtigte er trotzdem sozialutopische Elemente in der zionistischen Neugestaltung. Dabei prophezeite er zutreffend, wie die zionistische Unternehmung in der konkreten Organisation der neuenjüdischen Gemeinschaft in Palästina schließlich
verwirklicht werden würde.
Anmerkungen:
1. Eine faszinierende biographische Untersuchung über Herzls Wiener Umfeld bietet Amos Elon, Herzl. (NewYork, 1975). Für eine eher konventionelle Untersuchung siehe Alex Bein, Theodor Herzl. Eine Biographie (Berlin, 1983/Wien, 1934).
2. »Das neue Ghetto«, in. Theodor Herzl. Gesammelte zionistische Werke. In fünf Bänden. V. Band (Berlin: JüdischerVerlag, 1935), S. 1-124, hier
S. 37.
3. Siehe dazu in Herzl, Gesammelte zionistische Werke. In fünf Bänden. I. Band. Zionistische Schriften, Tel Aviv. Hozaah Ivrith, 3. Auflage 1934
(Berlin: JüdischerVerlag, 1905).
176
Grundkurs Judentum
Zionismus
Aus: Shlomo Avineri, Profile des Zionismus. Die geistigen Ursprünge des Staates Israel, Gütersloh 1998
4. »Der Judenstaat«, in Herzl, Werke. I. Band [s. Anm. 3], S. 17-105, hier S. 39f. 5. »Altneuland«, in Herzl, Werke. V. Band [s. Anm. 2]. S. 125-420,
hier S.189f.
6. Wie schmerzvoll diese Einsicht für eine Person aus Herzls Gesellschaftsschicht, geprägt von der europäisch-bourgeoisen Kultur, gewesen sein
muß, wird durch seine Bemerkung über die im jüdischen Staat gesprochenen Sprachen ersichtlich. Herzl hat keine mögliche Wiederbelebung des
Hebräischcn ins Auge gefaßt (»Wer von uns weiß genug Hebräisch, um in dieser Sprache ein Bahnbillet zu verlangen?«); dafür heißt es: »Jeder
behält seine Sprache, welche die liebe Heimat seiner Gedanken ist. ...Wir werden auch drüben bleiben, was wir jetzt sind, sowie wir nie aufhören
werden, unsere Vaterländer, aus denen wir verdrängt wurden, mit Wehmut zu lieben.« (Herzl, Judenstaat [s.Anm. 4], S. 94.).
7. Ebenda, S. 20.
8. Der Titel »Altneuland« ist ein Widerhall auf den utopisch-sozialistischen Roman »Freiland«, geschrieben von Herzls Wiener Zeitgenossen und
Kollegen Theodor Hertzka, herausgegeben im Jahr 1890. Die sozialen Übereinkünfte von Herzls Gesellschaft gehen eng auf jene in »Freiland«
zurück; Herzl erwähnt sogar Hertzkas Namen etliche Male im Judenstaat und in Altneuland. Herzl berichtet, daß dieser Titel ihm als eine Variation
des Namens der berühmten und ehrwürdigen Prager Synagoge »Altneuschul« erschien, die für viele emanzipierte Juden Mitteleuropas die Kontinuität und den mystischen Glanz der jüdischen Existenz symbolisierte.
9. Ebenda, S. 93 und 94.
10. Herzl, Altneuland [s.Anm. 5], S. 224.
11. Herzl, Judenstaat [s.Anm.4], S.54-57.
12. Ebenda, S. 96. Ursprünglich hatte Herzl dieses Design der »Sieben Goldenen Sterne« als Flagge der zionistischen Bewegung vorgeschlagen.
Aber eine Gruppe englischer Zionisten aus dem Wirtschaftsleben hatte wegen der sozialistischen Bezugnahme Einwände. Schließlich gab Herzl
nach, und das blauweiße Banner mit dem Davidsstern wurde als zionistische Flagge akzeptiert. Diese wurde später auch die Flagge des Staates
Israel.
13. Herzl, Altneuland[s.Anm.5],S.210.
14. Ebenda, S. 266.
15. Ebenda, S. 270f. und 274.
16. Ebenda, S. 198ff.
17. Ebenda, S. 203. 18. Ebenda, S. 202.
19. Ebenda, S. 245f und 248: »<Eine Frage, Reschid Bey! ...Sind die früheren Bewohner von Palästina durch die Einwanderung der Juden nicht
zugrunde gerichtet worden? Haben sie nicht wegziehen müssen? Ich meine: im großen und ganzen. Daß einzelne dabei gut fuhren, beweist ja
nichts.>
>Welche Frage!< entgegnete Reschid. >Für uns alle war es ein Segen. Selbstverständlich in erster Linie für die Besitzenden, die ihre Landstücke
zu hohen Preisen an die jüdische Gesellschaft verkaufen konnten oder auch weiter behielten, wenn sie noch höhere Preise abwarten wollten.
...Würden Sie den als einen Räuber betrachten, der Ihnen nichts nimmt, sondern etwas bringt? Die Juden haben uns bereichert, warum sollten wir
ihnen zürnen? Sie leben mit uns wie Brüder, warum sollten wir sie nicht lieben?«<
20. Ebenda S. 261-263. Dieser Dr. Geyer (»Geier«), bemerkt Herzl ironischerweise, war ursprünglich ein fanatischer Anti-Zionist, der sich später
mit dem Zionismus aussöhnte, aber dennoch seine unnachgiebige Einstellung in seine neue politische Überzeugung mit einbrachte. In der Charakterisierung Geyers tritt auch Herzls streng anti-klerikale Haltung lebhaft zutage.
177
Grundkurs Judentum
Zionismus
Aus: Shlomo Avineri, Profile des Zionismus. Die geistigen Ursprünge des Staates Israel, Gütersloh 1998
Achad Haam,
Die geistigen Dimensionen des Judentums
137-149
Ascher Ginsberg, der unter dem Pseudonym Achad Haam (»Einer aus diesem Volk«) schrieb, war einer der profiliertesten Schriftsteller der hebräischen Renaissance um die Jahrhundertwende in Rußland. Er war wie kein anderer Schriftsteller für die Gestaltung einer modernen hebräischen
Prosa verantwortlich, die er von der gestelzten quasi-biblischen Nachahmungssprache der Haskala befreite. Seine Wirkung auf die hebräische
Literatur ist nur von Chaim Nachman Bialik übertroffen worden.
Haam war der erste, der positivistische Elemente in die hebräische Publizistik einführte, die damals immer noch stark von den gefühlvollen
Schnörkeln der Neoromantik beeinflußt war. In diesem Kapitel wird die Diskussion jedoch auf seinen Beitrag zur zionistischen Debatte, in der sein
sogenannter spiritueller Zionismus als Antithese zu Herzls politischem Zionismus gesehen wurde, beschränkt bleiben.
Seine Biographie (1856-1927) ist typisch für die Haskala: chassidischer Familienhintergrund, Jeschiva-Studien, auswärtiger Unterricht an einer
russischen Oberschule und dann der erfolglose Versuch, eine Universität zu besuchen. Nach etlichen familiären Schicksalsschlägen ließ sich Ascher Ginsberg in Odessa nieder, wo er, wie jeder andere junge Jude seiner Generation, unter den emanzipatorischen Einfluß der vergleichsweise
weltlichen Atmosphäre dieser Stadt kam. Und über die Schriften des russischen Positivisten Dimitri Pisarew machte er die Bekanntschaft mit dem
Gedankengebäude John Stuart Mills.
Achad Haams erster Aufsatz »Falscher Weg« (1889) deutete in einem großen Maße seine einzigartige Rolle innerhalb der Chowewe ZionBewegung an.1 Es lag auf der Hand, daß er einer der sich am besten Gehör verschaffenden Sprecher dieser Bewegung wurde; andererseits war
er auf vielen ihrer öffentlichen Kundgebungen auch ihr strengster Kritiker. Diese Charakterzüge beschreiben ebenfalls seine Aktivitäten innerhalb
der zionistischen Bewegung, der er während des ersten Zionistenkongresses beitrat, bei deren Tagesgeschäften er aber stets ein wenig zurückhaltend blieb.
Zwei Aufsätze mit den Titeln »Judenstaat und Judennot« (1897) und »Fleisch und Geist« (1904) sind vielleicht die zentralen Schriften, in denen
sich seine Erkenntnis hinsichtlich einer modernen jüdischen Nationalbewegung formte.
»Judenstaat und Judennot« wurde unmittelbar nach Achad Haams Rückkehr vom ersten Zionistenkongreß geschrieben (welcher auch der einzige
derartige Kongreß blieb, den er jemals besuchte). Sein Aufsatz zielte in gewissem Maße darauf ab, jener unkritischen Euphorie entgegenzuwirken,
die viele jüdische Kreise im Kielwasser der fast königlichen und pompösen Umstände des Basler Kongresses ergriffen hatte. Getreu seiner positivistischen und rationalistischen Einstellung versuchte Haam, die Botschaft des Kongresses zusammenzufassen und leidenschaftslos die Herausforderungen anzusprechen, denen sich die neugeborene zionistische Bewegung gegenübergestellt sah.
Achad Haams Ausgangspunkt war dabei Nordaus programmatische Eröffnungsrede, welche die Delegierten nachhaltig beeindruckt hatte. Er resümierte Nordaus Bericht, indem er unterstrich, daß dieser zu Recht die zweifache Natur des damaligen jüdischen Problems betont habe: Für das
osteuropäische Judentum liege dieses hauptsächlich in der wirtschaftlichen Not begründet, während die Juden im Westen sich in einer moralischen Not befanden, sobald sie sich das Mißlingen der Emanzipation als einer angemessenen Antwort auf die Suche nach einer jüdischen Identität in der Moderne vergegenwärtigten. Folgerichtig wendeten sich beide Gemeinschaften der zionistischen Lösung zu - der Errichtung eines jüdischen Staates in Palästina.
178
Grundkurs Judentum
Zionismus
Aus: Shlomo Avineri, Profile des Zionismus. Die geistigen Ursprünge des Staates Israel, Gütersloh 1998
An dieser Stelle wirft Achad Haam mit seinem nüchternen Realismus eine Reihe von Fragen auf. Laßt uns annehmen, erörtert er, daß die zionistische Bewegung ihr Ziel erreicht hat. Ein Judenstaat ist in Palästina geschaffen worden, und dieser vereinnahmt nun Welle für Welle jüdischer Einwanderer. Wird damit das jüdische Problem in einer oder zwei Generationen gelöst sein? Können alle Juden der Welt - damals wurden um die
zehn Millionen gezählt - auf der Stelle ins Land Israel einwandern und so ihre Armut, sei sie wirtschaftlicher oder geistiger Natur, überwinden?
Wird die Errichtung eines Judenstaates tatsächlich eine Lösung für das Problem aller Juden sein?
Angenommen, so argumentiert Haam weiter, daß die Errichtung eines Judenstaates keine sofortige und gänzliche Zusammenführung der Exilierten bedeutet, sondern zu Anfang nur »die Ansiedlung eines kleinen Teiles des Volkes in Palästina, wie vermag er dann der physischen Not der
Majorität des Volkes in den Ländern der Diaspora abzuhelfen?«2 Achad Haam ist der Meinung, daß das wirtschaftliche Problem im wesentlichen
nur für einen Teil des Volks gelöst sein würde: nämlich für diejenigen, die in den jüdischen Staat emigriert sind. Aber für jene, die während der ersten Phasen des sicherlich Generationen andauernden Einwanderungsprozesses in der Diaspora verblieben, würden und könnten die wirtschaftlichen Probleme nicht durch die bloße Errichtung des jüdischen Staates gelöst werden.
Ihr wirtschaftliches und soziales Schicksal hinge vielmehr von den Bedingungen in ihren Aufenthaltsländern ab. Weil aber der Judenstaat nicht in
der Lage sein würde, das ökonomische Problem dieser jüdischen Massen zu lösen, die - selbst wenn nur vorübergehend - außerhalb seiner Landesgrenzen blieben, läge der einzige Beitrag dieses Staates darin, ihre Not auf einem Teilgebiet, dem spirituellen und kulturellen, zu lösen. Deshalb ist das Kardinalproblem, mit dem sich der Zionismus auseinandersetzen muß, nicht nur die Schaffung eines jüdischen Staates - vorausgesetzt, ein solcher könnte entstehen -, sondern es ist auch zwingend notwendig, daß der Zionismus sich fragt, inwieweit er mithelfen wird, die geistige Not und Zwangslage der riesigen Mehrheit des jüdischen Volkes zu lösen, das weiterhin für eine absehbare Zeit außerhalb des Landes Israel
lebt.
Für jemanden, der als einer der intellektuellsten visionärsten zionistischen Denker gilt, besaß Achad Haam dennoch gerade im Aufzeigen der praktischen Probleme, die dem Zionismus nach der Errichtung des Staates Israel gegenüberstehen würden, treffsicheres Gespür. Während viele der
sogenannten praktischen Zionisten lediglich in die unmittelbare Zukunft - die Ansiedlung von Einwanderern und Pionieren in Palästina sowie die
Errichtung eines unabhängigen Staates blickten, erkannte und erklärte Achad Haam jene Probleme, die von existentieller Bedeutung für Israel
nach seiner Gründung sein werden. Folglich ist die heutige Bedeutsamkeit vieler seiner Beobachtungen weitaus herausfordernder als die Vision
derjenigen, für die der Zionismus am 15. Mai 1948 zu seinem Ende kam.
Mit Nordau stimmte Achad Haam überein, daß das Problem für die Juden Westeuropas sich grundsätzlich verschieden von dem der Juden in den
engen osteuropäischen Siedlungsgebieten gestaltete. Durch seine bloße Existenz kann der Zionismus, so argumentierte Haam, das westliche
Problem immer noch weitaus besser als das östliche lösen.
Der Jude des Westens, von der jüdischen Kultur bereits abgenabelt, allerdings jener Gesellschaft, in der er lebt und arbeitet, noch entfremdet, wird
in der bloßen Existenz eines jüdischen Staates die Lösung für die Probleme seiner nationalen Identität finden. Dieser mag ihn für seine fehlende
Integration in die ihn umgebende nationale Kultur entschädigen. In einer Beobachtung, die mehr als 50 Jahre später ungewöhnlich bedeutsam für
viele westliche Juden aufgrund der realen Existenz Israels wurde, sagte Haam:
Und in dieser seiner Not richtet er [der westliche Jude; S.A.] den Blick nach dem Lande seiner Väter und träumt davon, wie gut es wäre, wenn dort
wieder ein Judenstaat errichtet würde, ein Staat wie die Staaten aller Völker mit all ihrer gesetzlichen Ordnung und ihren kulturellen Lebensformen.
Dann könnte er in seinem Volke voll und ganz sich ausleben, in seinem Hause das finden, was er jetzt bei anderen sieht und wonach er hascht,
ohne es zu erreichen. Freilich, nicht alle Juden werden ihren Wohnort verlassen, um nach ihrem Staate auszuwandern; aber schon das Bestehen
des jüdischen Staates wird das Ansehen der in der Zerstreuung Verbliebenen heben, und die Einheimischen werden sie nicht mehr verachten und
179
Grundkurs Judentum
Zionismus
Aus: Shlomo Avineri, Profile des Zionismus. Die geistigen Ursprünge des Staates Israel, Gütersloh 1998
zurückstoßen wie niedrige Knechte, die nach der fremden Tafel schielen; und da er sich diesem Phantasiegebilde seines Herzens hingibt, entdeckt er plötzlich tief in seinem Innern, daß schon der Staatsgedanke allein, noch bevor der Staat selbst gegründet würde, neun Zehntel der Not
beseitigt. Er eröffnet ihm die Möglichkeit zu öffentlicher Betätigung, zu politischem Enthusiasmus; das Herz kommt auf seine Rechnung, ohne daß
er vor Fremden im Staube liegen müßte; - und er fühlt deutlich, daß durch dieses Ideal sein Geist seine Niedrigkeit abschüttelt und seine Menschenwürde wieder erhält ohne allzu große Anstrengung und ohne jede Hilfe von außen. Und da widmet er sich diesem seinem Streben mit aller
Wärme seiner Gefühle, läßt seiner Phantasie die Zügel schießen, daß sie sich frei erhebe über die Wirklichkeit und beschränktes Menschenkönnen hinaus. Er braucht ja sein Ideal nicht zu erreichen, da die Jagd nach ihm allein genügt, um sein seelisches Leiden zu heilen und das Gefühl
der inneren Knechtschaft von ihm zu nehmen. Je höher das Ideal steigt, je weiter es in die Ferne strebt, um so mehr wächst sein Vermögen, die
Seele zu erheben.3
Andererseits war die Situation in Osteuropa grundlegend anders: Unter den Ostjuden stellte sich die Not kollektiv, nicht individuell dar. Und was
hier den Zweifel ausmachte, war nicht die Identität des einzelnen Juden, sondern die Existenz der gesamten Gemeinschaft. Was in Osteuropa laut
Achad Haam passierte, war nicht bloß die Tatsache, daß die Juden, sondern daß das Judentum als solches das Ghetto verlassen hatte.
Das traditionelle Ghetto-Leben hatte es demJudentumm ermöglicht, sich selbst in den Grenzen einer geschlossenen Gesellschaft am Leben zu
erhalten und somit ein Gleichgewicht zwischen der jüdischen und der nichtjüdischen Gesellschaft erlangt, das auf Trennung und Absonderung beruhte. Aber die moderne kulturelle Entwicklung, die alle Völker Osteuropas ergriffen hatte, zerstörte diese Isolation, ohne zugleich den enormen
jüdischen Massen zu gestatten, sich als eine Gemeinschaft mit eigener nationaler und kultureller Prägung zu fühlen. »In unserer Zeit hüllt sich die
Kultur überall in das nationale Gewand des betreffenden Volkes, und jeder Fremde, der sich ihr naht, muß seine Eigenart aufgeben und in der
Geistesart der herrschenden Nation aufgehen.«4 Im Westen war es der Liberalismus, der eine Kampfansage an die jüdische Existenz stellte, im
Osten der Nationalismus.
Diese Kampfansage veranlaßte das osteuropäische Judentum, für seine Identität einen neuen Mittelpunkt zu formen. In seinem Positivismus beharrte Achad Haam unerbittlich darauf, daß diese neue Mitte weder eine Rückkehr zum traditionellen religiösen Symbolismus der Vergangenheit
noch eine erneute Hinwendung zur Isolierung in einer abgeschotteten Ghetto-Gesellschaft sein könnte. Es war dieser neue Mittelpunkt, der das
osteuropäische Judentum, auf eine neue, in Palästina zu errichtende Gesellschaft blicken ließ:
So strebt das Judentum danach, zu seinem historischen Mittelpunkte zurückzukehren, dort naturgemäß sich auszuleben und zu entwickeln, auf
allen Gebieten der menschlichen Kultur die in ihm lebenden Kräfte zu betätigen, seine eigenen nationalen Güter, die es sich bisher erworben, zu
mehren und auszugestalten und so auch künftig wie einst in vergangenen Tagen die Schatzkammer der Menschheit durch eine große nationale
Kultur zu bereichern, die Frucht freier Arbeit eines im eigenen Geiste schaffenden Volkes. Für einen solchen Zweck könnten vorläufig weit geringere Mittel genügen, man brauchte nicht ein politisches Staatswesen zu gründen - sondern nur jene Vorbedingungen im Vaterlande zu schaffen, die
eine weitere Entwicklung in dieser Richtung ermöglichen würden: die Ansiedlung einer größeren Zahl von Juden, die ungestört in allen Zweigen
menschlicher Kultur von Ackerbau und Handwerk bis zu Wissenschaft und Literatur sich betätigen. Diese Ansiedlung, die nach und nach entstehen wird, wird mit der Zeit ein Zentrum des Volkes werden, in ihr wird der Volksgeist ungetrübt zur Geltung kommen und sich allseitig zur größtmöglichen Vollkommenheit entfalten. Aus diesem Mittelpunkt wird dann der Geist des Judentums zu allen Punkten der weiten Peripherie dringen,
zu allen Gemeinden der Diaspora, um sie zu beleben und alle zu einer Einheit zusammenzuhalten. Dann, wenn die nationale Kultur in Palästina
diese Höhe erreicht haben wird, dann wird sie uns sicherlich selbst aus ihrer Mitte jene Männer geben, die es verstehen werden, den geeigneten
Moment zu nützen, um dort auch einen Staat und nicht nur einen Judenstaat, sondern einen tatsächlich jüdischen Staat zu gründen.5
180
Grundkurs Judentum
Zionismus
Aus: Shlomo Avineri, Profile des Zionismus. Die geistigen Ursprünge des Staates Israel, Gütersloh 1998
Anklänge an Herder und Hegel sind deutlich vernehmbar, wenn Achad Haam die Schaffung eines Staatskörpers als Gipfel der kulturellen und
geistigen Kräfte eines Volkes darstellt: Ein Staat wird somit nicht etwa aus dünner Luft geschaffen oder durch einen bloßen diplomatischen Handstreich. Solch ein Staat würde sich nämlich als kurzlebiges Phänomen erweisen, denn die soziokulturelle Infrastruktur ist eine notwendige Bedingung für das politische Leben. Daher rührt auch Haams Opposition zu Herzls diplomatischem Bestreben, einen jüdischen Staat durch einen
Schutzbrief oder einen ähnlichen Plan zu sichern. Solch ein Staat würde nach Haams Worten die solide Grundlage vermissen lassen, würde ohne
Kultur, ohne Wurzeln sein. Zudem könnte er sich als kaum lebensfähig erweisen. Tatsächlich sei die kulturelle Seichtheit und spirituelle Eindimensionalität von Herzls politischer Konstruktion auffallend.
Haam argumentiert, daß Herzls Staat vielleicht einen Judenstaat darstellen könnte (und so nennt Herzl ja auch seine Schrift); aber er würde kein
jüdischer Staat sein - und es ist ein jüdisches Staatswesen, das Achad Haam sich wünscht. Da ein großer Teil des jüdischen Volkes für eine lange
Zeit auch nach Schaffung dieses Staates außerhalb seiner Grenzen bleiben würde - zudem dauerte es ja seine Zeit, bis ein solcher Staat aufgebaut sein würde -, ist es deshalb zwingend notwendig, daß das neue Israel ein Identifikations-Brennpunkt für das gesamte jüdische Volk werden
muß. Wegen des nationalistischen Kontextes der kulturellen Entwicklung im modernen Europa ist eine Renaissance der jüdischen Kultur in der
Diaspora nicht länger möglich. Deshalb ist für die Aufrechterhaltung einer nationalen jüdischen Identität außerhalb Palästinas eine jüdische Gemeinschaft in Palästina vonnöten, deren Kultur bis in die Diaspora ausstrahlt und die dortige moderne jüdische Existenz erträglich macht. Andernfalls wird jeder Jude, der nicht nach Palästina auswandert, seine jüdische Identität früher oder später verlieren. Ein politischer Zionismus, der sich
ausschließlich auf die Errichtung eines Judenstaates versteift, übersieht jene kulturelle Dimension, die lebenswichtig ist für eine fortdauernde jüdische Existenz.
Für Achad Haam liegt die traditionelle Kraft des Judentums in der Tatsache begründet, daß die Propheten den Wert nicht nur der materiellen, sondern auch der spirituellen Stärke lehrten. Ein jüdischer Staat bar jeder geistigen jüdischen Werte, die für das Diaspora-Leben von Bedeutung sind,
wird die Bindung mit den außerhalb beheimateten Juden verlieren. In dieser Hinsicht tritt Haam als Kritiker der Herzlschen Vision eines Judenstaates auf, in dem jedermann gemäß seinem Ursprungsland Deutsch, Französisch oder Russisch spricht und in dem eine italienische Oper oder ein
deutsches Theater blühen. Ein Staat »von Deutschen oder Franzosen der jüdischen Rasse« ist kein lebensfähiger Staat, meint Haam, denn
ein Staatsgedanke, der sich nicht auf die Basis der nationalen Kultur stellt, vermag den Sinn des Volkes den Idealen seines Geistes abspenstig zu
machen und in ihm die Ambition zu erwecken, seinen Stolz in das Erreichen materieller Macht und politischer Herrschaft zu setzen.6
Dies ist nicht nur für den jüdischen Nationalismus eine Herausforderung. Für Haam ist dies ein Dilemma, das allen europäischen Nationalbewegungen gemeinsam ist. Der nationale Geist - der Volksgeist - dieser Nationalbewegungen zeigt sich in seinen spirituellen, kulturellen und materiellen Äußerungen ebenso wie im Staat.
Der Mangel an einer spirituellen Dimension würde im Falle eines jüdischen Staates doppelt schädlich sein. Er könnte am Ende politische Macht zu
einem Selbstzweck verkehren, was die Bande mit den auswärtigen Juden durchschneiden würde. Haam fürchtet einen hohlen und sterilen Etatismus, der das Mittel - den Staat - zum Wesen nationaler Existenz macht. In einem originellen historischen Exkurs gebraucht er den Staat von Herodes dem Großen als Beispiel für einen Staat ohne jeglichen geistigen und kulturellen Inhalt:
Wie die Geschichte lehrt, war auch unter der Regierung des Herodianischen Königshauses Palästina wohl ein Judenstaat, die nationale Kultur aber war verachtet und verfolgt; die Dynastie tat ihr Möglichstes, um im Lande die römische Kultur zu fordern, und vergeudete die Kraft des Volkes
für die Errichtung von Götzentempeln, Zirkusbauten usw. Ein solcher Judenstaat wäre ein Verderben für unser Volk und eine schwere Erniedrigung für seinen Geist: nicht stark genug, als politischer Faktor sich geltend zu machen, würde es sich der in seinem Innern lebenden sittlichen
Kraft nicht bewußt werden; sein kleiner Staat, »ein Spielball für seine mächtigen Nachbarn, der nur durch diplomatische Ränke und fortwährende
181
Grundkurs Judentum
Zionismus
Aus: Shlomo Avineri, Profile des Zionismus. Die geistigen Ursprünge des Staates Israel, Gütersloh 1998
Erniedrigung vor der jeweils tonangebenden Großmacht besteht«, wird der Seele des Volkes nationalen Stolz nicht geben können, der nationalen
Kultur aber, in der das Volk seinen Stolz hätte finden können, hat es in seinem Staate keine Stätte gewährt und hört nicht auf ihre Stimme. Und so
wird es dann noch weit mehr als heute »ein kleines und niedriges Volk« sein, ein geistiger Knecht dessen, der im politischen Leben die Oberhand
hat, neidisch blickend auf die »starke Faust seiner mächtigen Nachbarn«. Sein Bestand als politisches Staatswesen wird dem Buche seiner Geschichte kein Ruhmesblatt einfügen.7
Achad Haam hält es auch für eine Illusion, der jüdische Staat hätte eine dritte Wahl - im Sinne einer »Schweiz des Nahen Ostens«, wie es Lilienblum meinte. Gelassen deutet Haam an, daß eine solche Alternative leider außer Frage stünde. Und hier ist wieder sein kühler Realismus anzumerken, der im Gegensatz zur selbstberauschenden Ausdrucksweise steht, die viele Schriften anderer Zionisten in jenen und späteren Zeiten
zierte:
Aber wer Palästina [mit] solchen kleinen Ländern vergleicht wie der Schweiz, vergißt seine geographische Lage und seinen religiösen Wert für alle
Völker. Diese beiden Umstände werden den mächtigen Nachbarn ...unter keiner Bedingung gestatten, ihre Ansprüche auf Palästina vollständig
aufzugeben, und auch wenn es ein Judenstaat geworden sein wird, werden die Blicke aller Völker darauf gerichtet sein, und jede Macht wird notwendigerweise auf die Politik des Staates geistigen Einfluß nehmen wollen, wie dies gegenüber anderen machtlosen Staaten (wie der Türkei und
anderen) der Fall ist, in denen die großen Völker Europas Interessen zu wahren haben.8
Geographisch hat das Land Israel immer im Zentrum der Weltpolitik gestanden, warnt Haam, und das wird auch immer so bleiben. Der zionistischen Bewegung stünde es gut an, sich darüber keine Illusionen zu machen sowie über die Möglichkeit, das Ziel ohne die Konfrontation mit starken und mächtigen Interessen in dieser Region erreichen zu können.
Politische Unabhängigkeit wird »das jüdische Problem« nicht von der weltpolitischen Tagesordnung verbannen. Aufgrund seiner Geschichte und
seiner Geographie können das jüdische Volk das Land Israel nicht in der glückseligen Rumpelkammer der kleinen und unwichtigen Nationen verschwinden. Deshalb dringt Haam darauf, sich diesen Problemen von Anfang an zu stellen. Ein rein politischer Judenstaat (oder um die Ausdrucksweise vor dem Ersten Weltkrieg zu benutzen: ein jüdisches Serbien oder jüdisches Montenegro) wäre nicht fähig, diese Fragen ausreichend
zu beantworten.
Achad Haams Ansicht über die Notwendigkeit eines spirituellen Inhalts jüdischer Existenz entstammte nicht bloß einem taktischen oder bloß einem
Bedürfnis nach innerer Stabilität; sie bezieht sich vielmehr auf ein fundamentales Verständnis der jüdischen Geschichte, das stark von Krochmal
und Graetz beeinflußt war. In Haams Aufsatz »Fleisch und Geist« wird diese Sichtweise innerhalb einer historischen Perspektive dargestellt, die
im Judentum zwei Grundzüge erkennt: einen materiellen und einen spirituellen.
Zur Zeit des Ersten Tempels waren diese zwei Grundzüge - die zugleich auch realpolitisch und ideal genannt werden können - noch miteinander
verflochten. Erst während der Periode des Zweiten Tempels entfernten sie sich voneinander. Achad Haam benennt die historischen Konflikte zwischen Sadduzäern und Pharisäern als Dreh- und Angelpunkte dieser zwei Aspekte im jüdischen Leben: Die Sadduzäer sahen die bloße Existenz
des jüdischen Staates als Kern nationalen Lebens; die Pharisäer hingegen erkannten den spirituellen Gehalt als Hauptstütze jüdischer Existenz
und waren deshalb auch zu weitreichenden Kompromissen mit den Römern bereit, solange diese nicht die nationale Existenz gefährdeten, sondern den spirituellen Wert des Judentums förderten.
Für Achad Haam verkörperten die Pharisäer die wahre Synthese von Spirituellem und Materiellem. Daher betrachteten sie ihre dialektische Verteidigung der politischen Macht als notwendiges Instrumentarium, aber nicht als Selbstzweck:
Anders als die Essener liefen die Pharisäer nicht vor dem Leben davon und wollten den Staat keineswegs vernichten. Ganz im Gegenteil, denn sie
standen im dichtesten Getümmel des Lebenskampfs auf ihrem Posten und versuchten dabei mit aller Kraft, den Staat vor dem moralischen Zerfall
182
Grundkurs Judentum
Zionismus
Aus: Shlomo Avineri, Profile des Zionismus. Die geistigen Ursprünge des Staates Israel, Gütersloh 1998
zu bewahren und gemäß dem Geist des Judentums zu formen. Sie wußten sehr wohl, daß der Geist ohne das Fleisch bloß ein wesenloser Schatten ist, und daß der Geist des Judentums sich ohne einen politischen Körper, in dem er seinen konkreten Ausdruck findet, nicht entwickeln und
seine Vollendung nicht erreichen kann. Aus diesem Grund kämpften die Pharisäer stets eine doppelte Schlacht: Auf der einen Seite bekämpften
sie den innewohnenden politischen Materialismus, für den der Staat bloß ein Körper ohne den lebenswichtigen Geist darstellte; auf der anderen
Seite kämpften sie zusammen mit diesen Gegnern gegen den äußeren Feind, um den Staat vor der Vernichtung zu bewahren.9
Die Zerstörung des Zweiten Tempels durch die Römer stellte die pharisäische Betrachtungsweise auf ihre härteste Belastungsprobe, denn sie bewies die Fähigkeit des Judentums, ohne den materiellen Unterbau eines Staatskörpers weiterzuexistieren. Hier schlug die großartigste historische
Stunde der Pharisäer: Denn hätte erst einmal die sadduzäisch-zelotische Seite mit ihrer Auffassung, daß der Staat ein Selbstzweck sei, die Oberhand gewonnen, so wäre das jüdische Volk letzten Endes verschwunden, sobald seine Unabhängigkeit zerstört, sein Heimatland besetzt, sein
Tempel niedergebrannt und fast die gesamte jüdische Bevölkerung durch die Römer ins Exil getrieben worden war. Das jüdische Schicksal wäre in
so einem Fall analog dem Schicksal aller anderen von Rom besiegten Nationen gewesen. Aber die jüdische Geschichte nahm einen anderen
Weg:
Die politischen Materialisten, für die die Existenz des Staates alles bedeutete, hatten in der Zeit nach der politischen Katastrophe [die Zerstörung
des Tempels durch die Römer] nichts mehr, wofür es sich zu leben lohnte. Und deshalb kämpften sie verzweifelt und bewegten sich nicht vom
Fleck, bis sie inmitten der so geliebten Trümmer tot umfielen. Aber die Pharisäer erinnerten sich sogar in diesem furchtbaren Moment, daß der
politische Körper nur wegen des nationalen Geistes, der darin seinen Ausdruck gefunden hatte und nun Hilfe brauchte, ihre Zuneigung erforderte.
Von da ab hegten sie niemals mehr die sonderbare Idee, daß die Zerstörung des Staates den Tod des Volkes mit einschließe und daß das Leben
nicht länger lebenswert sei. Im Gegenteil: Nun erkannten sie die absolute Notwendigkeit, einige vorläufige Hilfsmittel auszumachen, um die Nation
und deren Geist sogar ohne einen Staat zu erhalten, bis zu jenem Zeitpunkt, an dem Gott Mitleid mit Seinem Volk haben würde und es in sein
Land und seinen Frieden zurückbrächte. So waren die Bande zerbrochen. Die politischen Zeloten verblieben mit dem Schwert in der Hand auf den
Mauern Jerusalems, während die Pharisäer die Schriftrollen des Gesetzes nahmen und nach Jabne gingen.10
Jabne, das neue Zentrum jüdischen Lernens, wurde folglich zu einem neuartigen, quasi-politischen Mittelpunkt jüdischer Existenz, trotz des Mangels an politischer Unabhängigkeit:
Und die Arbeit der Pharisäer trug Früchte. Es gelang ihnen die Bildung eines freischwebenden Nationalkörpers, ohne jegliche Fundamentierung im
festen Boden. In diesem Körper hatte der hebräische Nationalgeist seinen Wohnsitz und überdauerte für zweitausend Jahre. Der Aufbau des
Ghettos, dessen Grundlagen durch die nach der Zerstörung des Tempels folgenden Generationen gelegt wurden, ist eine erstaunliche und äußerst einzigartige Angelegenheit. Ihm lag die Idee zugrunde, daß das Ziel des Lebens die Vervollkommnung des Geistes ist, allerdings braucht
dieser Geist einen ihm als Instrument dienenden Körper. Die Pharisäer dachten zu ihrer Zeit, daß - solange bis die Nation in einem einzigen, vollständigen und freien politischen Körper einen erneuten geistigen Wohnsitz gefunden haben wird - diese Lücke durch die Konzentration des Geistes auf viele kleine und zerstreute soziale Körperschaften künstlich gestopft werden müsse. Diese Körperschaften sind allesamt nach seinem Ebenbild geformt, existieren nach einer gemeinsamen Lebensweise und sind alle trotz ihrer jeweiligen örtlichen Abgeschiedenheit durch die gemeinsame Kenntnis ihrer ursprünglichen Einheit sowie ihres Strebens nach einem einzigen Ziele und einer zukünftigen vollständigen Nation vereint.11
Nach Achad Haams Worten muß diese Synthese des Materiellen mit dem Spirituellen auch dann die Zukunft bestimmen, wenn einjüdischer Staat
entstanden ist, da ja das Ghetto verschwunden und somit die materielle Grundlage für jüdisches Leben in der Diaspora zerstört wäre. Eine politische Heimstatt auf einer wie Haam sagen würde -»materialistischen« oder »sadduzäischen« Grundlage zu errichten (also ohne spirituellen Inhalt),
183
Grundkurs Judentum
Zionismus
Aus: Shlomo Avineri, Profile des Zionismus. Die geistigen Ursprünge des Staates Israel, Gütersloh 1998
würde jeder jüdischen sowie universalgeschichtlichen Entwicklung zuwider laufen. Denn für Achad Haam, darin Hegel folgend, ist ein Staat kein
Selbstzweck, sondern bloß das erforderliche Fundament für die spirituelle Äußerung des Nationalgeistes -dem Volksgeist.
Achad Haams kritische Bewertung der Probleme des Zionismus in Palästina wird nirgends so augenfällig wie in seinem Aufsatz »Wahrheit aus
dem Land Israel«, den er nach seinem ersten Besuch der neuen jüdischen Siedlungen geschrieben hat. Haams Reise geschah im Auftrag der
Chowewe Zion, und seine Notizen sind zutiefst erfüllt von den unmittelbaren Eindrücken dieser ersten Versuche, jüdische Dörfer im Land aufzubauen. Ungleich anderer Besucher idealisierte Haam allerdings nicht die dortige sehr komplexe Situation. So beklagte er etwa die weitverbreitete
Landspekulation, die sich bereits zu diesem frühen Stadium zeigte, und forderte die Chowewe Zion auf, diese Erscheinung sofort zu stoppen, bevor sie eine unheilbare Wunde am sozialen und wirtschaftlichen Gebilde der neuen Gesellschaft hinterließe.
Sein Realismus war zum einen tief verwurzelt im Verständnis jenes historischen Zusammenhangs, in dem die jüdische Nationalbewegung ihre
politischen und intellektuellen Ziele suchte, andererseits aber auch in der quälenden Erkenntnis jener Zwickmühlen, in denen der Zionismus wegen
der Existenz einer arabischen Bevölkerung in der jüdischen Heimat steckte.
Was Achad Haams Aufsatz auszeichnet, ist das Bewußtsein der Notwendigkeit, sich mit dem arabischen Problem in Palästina auseinanderzusetzen. Dabei äußert er einige sehr unerfreuliche Worte über die Einstellungen einiger der ersten Siedler gegenüber der arabischen Bevölkerung. Es
ist häufig behauptet worden, daß der Zionismus die Existenz der Araber in dem, was er als jüdische Heimat bezeichnete, übersehen habe. Historisch betrachtet ist dies ein völlig falscher Vorwurf. Für Moses Hess etwa verlief das Auftauchen eines jüdischen Gemeinwesens in Palästina Hand
in Hand mit der Renaissance des arabischen Nationalismus und der Wiedererrichtung von unabhängigen Staaten in Syrien und Ägypten. Herzl
machte seinerseits den humanitären, wenngleich auch etwas naiven Vorschlag, die arabische Bevölkerung an den universalen humanistischen
Werten seines Altneulands teilhaben zu lassen.
Achad Haam ging sogar noch weiter. Sein Aufsatz war vor Herzls Roman verfaßt, und er ist sich darin bewußt, daß nicht bloß eine beträchtliche
arabische Bevölkerung im Lande Israel existiert, sondern betont auch sehr nachdrücklich das Potential für das Entstehen einer arabischpalästinensischen Nationalbewegung. Geschrieben 1891, zu einer Zeit, als sich noch kaum irgendwelche Bekenntnisse eines arabischen Nationalismus in Palästina zu Worte meldeten, zeugt Achad Haams Wahrnehmung des sich dem zukünftigen Zionismus entgegenstellenden Konflikts von
einer für zionistische Gelehrte außergewöhnlichen Sensibilität gegenüber jener Tragik, die ein möglicher Zusammenprall dieser zwei nationalen
Bewegungen mit sich brächte.
Am Anfang von »Wahrheit aus dem Land Israel« warnt Haam, daß man nicht der Illusion anheimfallen soll, Palästina wäre ein leeres Land:
Wir neigen gern zu glauben, daß Palästina in diesen Tagen beinahe vollständig unbewohnt und eine unkultivierte Wildnis ist, in die jeder gehen
und soviel Land erwerben kann, wie er möchte. Aber dies ist in Wirklichkeit nicht der Fall. Es ist schwer, irgendwo in diesem Land arabischen
Grundbesitz zu finden, der brachliegt; die einzigen nichtkultivierten Gegenden sind Sanddünen und Steinfelsen, die lediglich mit Bäumen bepflanzt
werden können. Und dies sogar nur, wenn viel Mühe und Kapital in Räumung und Aufbereitung gesteckt werden.12
Eine weitere Illusion sei laut Haam die Annahme, daß die türkische Regierung sich weder darum kümmere noch darüber Bescheid wisse, was eigentlich in Palästina auf der Tagesordnung steht. Ebenso, was die vorherrschende Mentalität des »Mit-ein-bißchen-Geld-können-wir-tun-wasimmer-wir-wollen« betrifft, besonders durch die Protektion der europäischen Konsuln.
Achad Haam gibt zu, daß »Bakschisch eine große Macht in der Türkei« ist, aber er weist auch daraufhin, daß »wir wissen sollten, daß die staatlichen Würdenträger zugleich allesamt große Patrioten sind, die an ihre Religion und ihre Regierung glauben. In diesen Zusammenhängen werden
sie ihre Pflichten ehrenvoll erfüllen - kein Bestechungsgeld würde sie beeinflussen.«13 Zudem behauptet er, daß allzu viel Vertrauen auf die europäischen Konsuln ins Auge gehen könnte.
184
Grundkurs Judentum
Zionismus
Aus: Shlomo Avineri, Profile des Zionismus. Die geistigen Ursprünge des Staates Israel, Gütersloh 1998
Wie auch in anderen Aufsätzen fordert Achad Haam eine realistische Haltung gegenüber der arabischen Bevölkerung. Eine auf Überheblichkeit
beruhende Einstellung ihnen und ihrer Kultur gegenüber würde die Beziehungen zwischen beiden Völkern nur verschlimmern. Einzig in der ehrlichen Bestandsaufnahme der realen Situation werde es dem Zionismus möglich sein, jene Werkzeuge zu entwickeln, die gebraucht würden, um
erfolgreich an die ihm gestellten Fragen heranzugehen:
Wir neigen gern zu dem Glauben, daß alle Araber Wüstenbarbaren sind ein Volk von Eseln, das nicht erkennt oder versteht, was um es herum
vorgeht. Dies ist ein grundlegender Fehler. Der Araber besitzt wie alle Semiten einen scharfen Verstand und ist voller List. ...Die Araber, und hier
vor allem die Bewohner der Städte, verstehen sehr wohl, was wir wollen und was wir in diesem Land vorhaben; aber sie verhalten sich so, als ob
sie es nicht bemerken, da sie im Augenblick keine Gefahr für sich oder die Zukunft in dem erblicken, was wir tun. Deshalb versuchen sie den besten Nutzen aus diesen neuen [ins Land kommenden] Gästen zu ziehen. ...
Aber wenn der Tag kommt, an dem der Lebensstandard unseres Volkes im Lande Israel eine derartig hohe Stufe erreicht, der die örtliche Bevölkerung mehr oder minder verdrängt, dann wird diese nicht so einfach ihren Wohnsitz aufgeben.14
Ebenfalls warnte Haam vor einem gewalttätigen oder demütigenden Verhalten gegenüber der arabischen Bevölkerung. In seinem Aufsatz verwies
er auf jene jüdischen Siedler, die sich in typische Streitereien mit arabischen Dorfbewohnern um Ackergrenzen oder Wasserrechte verwickelten
und, um den Streit zu beenden, nicht selten gewaltsame Mittel anwendeten. Einige der jüdischen Siedler behaupteten sogar, »daß die einzige
Sprache, welche die Araber verstehen, die der Stärke ist.«
Achad Haam schrieb diese Zeilen vor fast 90 Jahren, und seine Vorausschau des tragischen Aspekts im aufkommenden Zionismus ist äußerst
beeindruckend:
Eine Sache sollten wir aus unserer vergangenen und gegenwärtigen Geschichte gelernt haben: nämlich keinen gegen uns selbst gerichteten Zorn
unter der ansässigen Bevölkerung zu entfachen. ...Wir müssen die dortige Bevölkerung auf angemessene und gerechte Weise mit Liebe und Respekt behandeln. Aber was tun unsere Brüder im Lande Israel? Genau das Gegenteil! Sklaven, die sie in ihrem Exilland waren, befinden sie sich
plötzlich inmitten einer grenzenlosen und anarchischen Freiheit, so wie es immer bei Sklaven ist, die Könige wurden. Gegenüber den Arabern treten sie mit Feindseligkeit und Grausamkeit auf, verletzen deren Grenzen, schlagen auf beschämende Weise grundlos auf sie ein und brüsten sich
sogar noch damit. Unsere Brüder liegen richtig, wenn sie sagen, daß der Araber nur jene als ehrenhaft bezeichnet, die Tapferkeit und Mut beweisen; aber dies ist bloß der Fall, wenn er fühlt, daß die anderen die Rechtmäßigkeit auf ihrer Seite haben. Es sieht indes ganz anders aus, wenn er
[der Araber] vermutet, daß die Handlungen seines Gegners frevelhaft und rechtswidrig sind. In solch einem Fall könnte er seinen Unmut auf lange
Sicht hin für sich behalten. Dieser Unmut aber wird sich fest in seinem Herzen einnisten; und auf die Dauer wird er sich als rachsüchtig und voller
Vergeltung erweisen.13
Achad Haam unterstrich stets die geistigen, moralischen und kulturellen Elemente des jüdischen Nationalismus, aber er war auch in der Lage gewesen, zu einem sehr frühen Zeitpunkt einige der eher bestürzenden praktischen Probleme zu erkennen, welche die Entwicklung der zionistischen
Bewegung in den kommenden Jahren bedrücken sollten.
Er war ein politischer Philosoph und stellte als solcher die praktischen Probleme vor einen moralischen und theoretischen Hintergrund. Letztlich
war es dieser Weitblick, der Achad Haams Beschreibung der Schwierigkeiten, denen sich das heutige Israel gegenübersieht, so zutreffend machte.
Anmerkungen:
185
Grundkurs Judentum
Zionismus
Aus: Shlomo Avineri, Profile des Zionismus. Die geistigen Ursprünge des Staates Israel, Gütersloh 1998
1. Achad Haam, Nationalism and the Jewish Ethic,Hrsg. und mit einer Einführung versehen von Hans Kohn (New York, 1962) S.34-43.
2. Achad Haam, Judenstaat und Judennot, in: Ders., Am Scheidewege. Zweiter Band. Aus dem Hebräischen von Harry Torczyner (Berlin 1916) S.
7-28, hier S. 13.
3. Ebenda, S. 15f.
4. Ebenda, S. 17.
5. Ebenda, S. 18f.
6. Ebenda, S. 19.
7. Ebenda, S. 20f. Achad Haam merkt in einer Fußnote an, daß die zitierten Äußerungen von seinen Mitschriften einiger Reden stammen, welche
anläßlich des ersten Zionistenkongresses in Basel gehalten wurden.
8. Ebenda, S. 21.
9. »Flesh and Spirit«, in. Nationalisn1 [s.Anm. 1], S. 202f.
10. Ebenda, S. 203. Der Verweis geht auf Rabban Yochanan Ben Zakkai zurück, der Jerusalem verließ, als es durch die Römer unter Vespasian
und Titus belagert wurde. Von ihnen erhielt er die Erlaubnis, ein Zentrum für jüdische Gelehrsamkeit in der Stadt Jabne zu unterhalten, das damit
zum Brennpunkt für die jüdische Kultur nach der Zerstörung des Tempels wurde. Der Name wurde gleichbedeutend mit dem spirituellen Inhalt des
Judentums, indes weniger mit dem politischen.
11. Ebenda, S. 203-204. Siehe auch Hans Kohns »Introduction«, in: Nationalism [s.Anm. 1], S. 7-33, sowie Leon Simons »Introduction« von Achad
Haams Selected Essays, rev.ed. (Philadelphia und Cleveland 1962), S. 11-40.
12. »Emet me-Eretz Israel«, in: Kol Kitvei Achad Haam [Achad Haam: Complete Works], hrsg. von H.Y. Roth (Tel Aviv, 1946) S.23.
13. Ebenda, S. 24.
14. Ebenda.
15. Ebenda, S. 29.
186