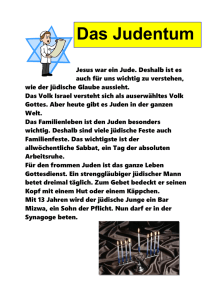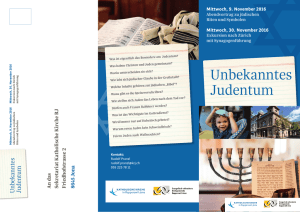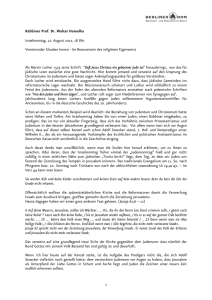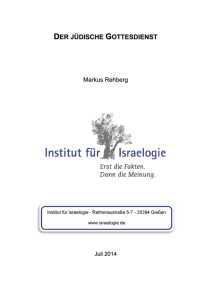Hype um den Davidstern
Werbung
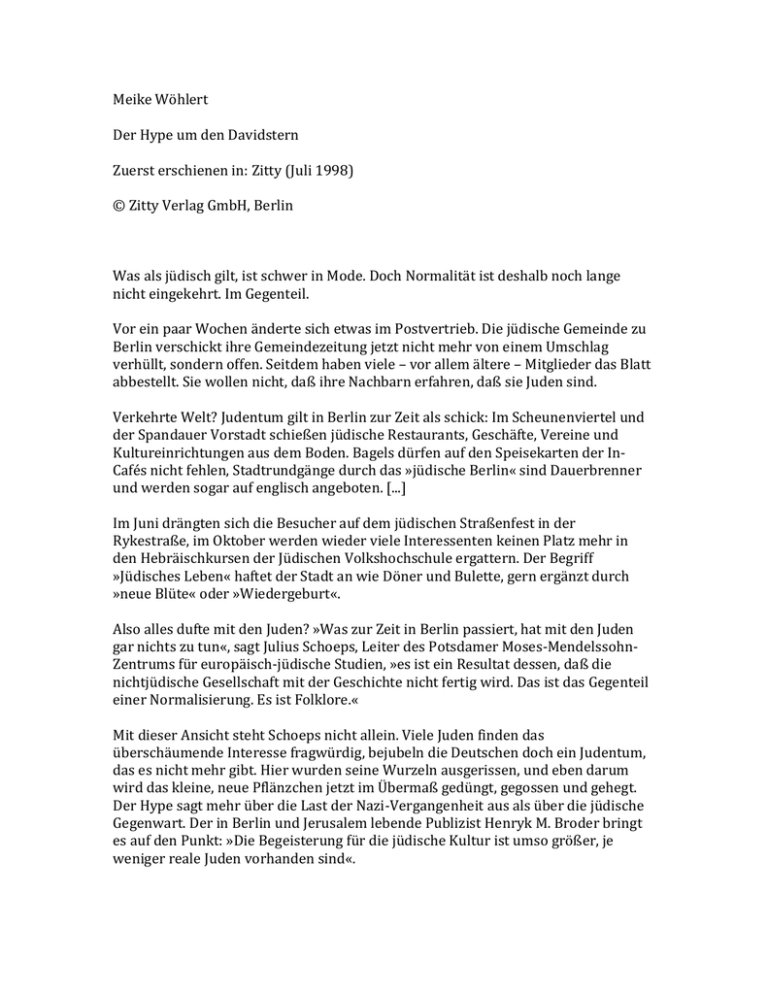
Meike Wöhlert Der Hype um den Davidstern Zuerst erschienen in: Zitty (Juli 1998) © Zitty Verlag GmbH, Berlin Was als jüdisch gilt, ist schwer in Mode. Doch Normalität ist deshalb noch lange nicht eingekehrt. Im Gegenteil. Vor ein paar Wochen änderte sich etwas im Postvertrieb. Die jüdische Gemeinde zu Berlin verschickt ihre Gemeindezeitung jetzt nicht mehr von einem Umschlag verhüllt, sondern offen. Seitdem haben viele – vor allem ältere – Mitglieder das Blatt abbestellt. Sie wollen nicht, daß ihre Nachbarn erfahren, daß sie Juden sind. Verkehrte Welt? Judentum gilt in Berlin zur Zeit als schick: Im Scheunenviertel und der Spandauer Vorstadt schießen jüdische Restaurants, Geschäfte, Vereine und Kultureinrichtungen aus dem Boden. Bagels dürfen auf den Speisekarten der InCafés nicht fehlen, Stadtrundgänge durch das »jüdische Berlin« sind Dauerbrenner und werden sogar auf englisch angeboten. [...] Im Juni drängten sich die Besucher auf dem jüdischen Straßenfest in der Rykestraße, im Oktober werden wieder viele Interessenten keinen Platz mehr in den Hebräischkursen der Jüdischen Volkshochschule ergattern. Der Begriff »Jüdisches Leben« haftet der Stadt an wie Döner und Bulette, gern ergänzt durch »neue Blüte« oder »Wiedergeburt«. Also alles dufte mit den Juden? »Was zur Zeit in Berlin passiert, hat mit den Juden gar nichts zu tun«, sagt Julius Schoeps, Leiter des Potsdamer Moses-MendelssohnZentrums für europäisch-jüdische Studien, »es ist ein Resultat dessen, daß die nichtjüdische Gesellschaft mit der Geschichte nicht fertig wird. Das ist das Gegenteil einer Normalisierung. Es ist Folklore.« Mit dieser Ansicht steht Schoeps nicht allein. Viele Juden finden das überschäumende Interesse fragwürdig, bejubeln die Deutschen doch ein Judentum, das es nicht mehr gibt. Hier wurden seine Wurzeln ausgerissen, und eben darum wird das kleine, neue Pflänzchen jetzt im Übermaß gedüngt, gegossen und gehegt. Der Hype sagt mehr über die Last der Nazi-Vergangenheit aus als über die jüdische Gegenwart. Der in Berlin und Jerusalem lebende Publizist Henryk M. Broder bringt es auf den Punkt: »Die Begeisterung für die jüdische Kultur ist umso größer, je weniger reale Juden vorhanden sind«. Vor dem Krieg gab es 160.000 Juden in Berlin, 1945 waren noch 5.000 übrig. Bis zur Wiedervereinigung wuchs die Zahl in West-Berlin auf nicht mehr als 6.000 an, im Ostteil lebten gerade mal 200. Seitdem hat sich ihre Zahl – vor allem durch die Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion – auf rund 12.000 verdoppelt. [...] Zwar sind das Holocaust-Mahnmal oder das Jüdische Museum tatsächlich zentrale stadtpolitische Themen, die eine öffentliche Diskussion erfordern. Doch selbst als die Leiterin der Jüdischen Volkshochschule vor ein paar Monaten wegen gemeindeinterner Rangeleien erst ab- dann wieder eingesetzt wurde, nahm das Thema in den Berliner Zeitungen mehr Platz als Senatsbeschlüsse ein. In London, Paris, Amsterdam oder New York würde sich für so etwas kein Schwein interessieren. Aber im Vergleich mit diesen Städten ist das vielbeschworene jüdische Leben in Berlin auch nur ein dürftiges Rinnsal. Zur Entlastung unseres Gewissens schreiben, geigen und essen wir es uns herbei. Andrew Roth[, Mitautor des englischsprachigen Reiseführers Jewish Life in Berlin,] denkt, daß »viele Leute in jüdische Restaurants gehen, um zu zeigen, daß sie die ›anderen‹ Deutschen sind.« Diejenigen, die »damals einen Juden im Keller gehabt hätten.« [...] Der Begeisterung für die Fassade des Judentums steht Hartmut Bomhoff besonders skeptisch gegenüber: »Es ist leichter, im Tabuna essen zu gehen, als sich mit den Großeltern über die vierziger Jahre zu unterhalten«. Und wenn die Leute »zu Klezmerkonzerten rennen und ihre Kinder Sarah und David nennen, haben die Juden auch nichts davon«. Bomhoff, der früher im jüdisch-christlichen Dialog sehr aktiv war, zieht sich daraus zurück: »Je mehr das Jüdische vereinnahmt wird, desto größer wird für mich die Kluft.« Der Potsdamer Professor Schoeps geht noch einen Schritt weiter. Er hält die Mode sogar für »ausgesprochen bedenklich«, weil er in ihr die Kehrseite des Antisemitismus sieht. Zwar sei alles, was als jüdisch gilt, »im Moment positiv besetzt, aber das kann schnell ins Gegenteil umschlagen. Das übertriebene Bekenntnis zum Judentum entspricht der übertriebenen Ablehnung.« Und der Maler und Meshulash-Mitbegründer Gabriel Heimler nennt die Besetzung des Judentums mit gesellschaftlich genehmen Klischees sogar eine »kulturelle Shoah«. So hart fällt nicht einmal das Urteil von Henryk M. Broder aus: »Klezmer ist so jüdisch wie Lederhosen deutsch sind. Das ist okay, die Leute brauchen Symbole«. Trotzdem findet er den Hype »teilweise unanständig.« [...] Broder erlebe ständig Konvertiten, »die mir sagen, ich soll koscher essen und darf am Samstag nicht ins Café gehen. Ich finde das teilweise sehr witzig, wenn diese Leute mir sagen, was das richtige Judentum ist. Ich weiß, was das richtige Judentum ist. Ich mußte meinen Vater immer wecken, wenn er vom KZ träumte.« Auch in Berlin grassiert das Übertrittsfieber. Seit zwei Jahren lebt der New Yorker Rabbiner Yehuda Tiechtel hier, und er ist davon immer wieder überrascht: »Ich war in vielen Ländern und Kontinenten, aber nirgends sind mir so viele Leute begegnet, die konvertieren wollen.« Die Gründe, so Tiechtel, fielen meist recht vage aus: »Sie sagen, sie interessieren sich dafür. Manche sagen, sie wollen ein Teil des jüdischen Volkes sein, vielleicht, weil sie Gemeinschaft suchen. Aber oft wissen die Leute gar nicht, was Jüdischsein bedeutet.« Rabbi Tiechtel hat wenig Zeit für die Konvertiten – mit den vorhandenen Juden ist er ausgelastet. [...] Für Tiechtel hat Berlin eine ganz besondere Bedeutung: »Von dieser Stadt haben Hitler und die Nazis versucht, das Judentum auszulöschen. Und hier bringen wir jüdisches Wissen und Selbstbewußtsein zurück. Das ist die größte Rache, die wie an Hitler üben können!« Er sagt es erfreut, richtig begeistert. Daß er in seinem schwarzen Anzug auf der Straße angestarrt und angesprochen wird, trägt er mit Gelassenheit: »In Berlin zu leben, ist schon sehr viel anders als in New York oder Israel.« Aber er sei ein sehr offener Mensch, »wenn mich Leute auf meine Kleidung ansprechen, dann erkläre ich ihnen, wofür der Hut da ist oder die Bänder. Es ist doch gut, wenn die Leute interessiert sind«. [...] Freitag abend. Vor dem Portal der Synagoge an der Rykestraße steht ein Mann in grüner Uniform. Ein anderer versperrt den Eingang, einen lupenförmigen Metalldetektor in der Hand, wie man ihn von Flughäfen kennt. Einmal Ganzkörperkontrolle, einmal Handtasche ausräumen. Warum er das macht? Der Mann guckt verständnislos. »Weil das hier eine Synagoge ist«, sagt er kopfschüttelnd. »Normalität? Vor dem Gemeindehaus in der Fasanenstraße sieht es doch aus wie bei den Stammheim-Prozessen! Das haben Sie in keinem anderen Land«, sagt der Professor für jüdisch-europäische Studien, Julius Schoeps. Hetz- und Drohbriefe in seiner Post sind für ihn Alltag, genau wie für Andreas Nachama, den Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Sie machen den größten Teil der rund 100 antisemitischen Straftaten in Berlin pro Jahr aus – neben Sachbeschädigungen, Landfriedensbruch, Störung der Totenruhe und anderen Delikten. Für sie ist nicht die »normale« Kriminalpolizei zuständig, sondern der Staatsschutz. Abteilungsleiter Peter-Michael Haeberer erklärt, warum: »Der Staat ist nicht dadurch gefährdet, daß der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde ein Schmähschreiben bekommt. Die Gefährdung kommt durch die Existenz des Gedankengutes. Man sollte ja davon ausgehen, daß das 50 Jahre danach mal langsam aufhört. Aber es hört nicht auf.« Wie viele andere Gemeindemitglieder fand Meshulash-Mitglied Hartmut Bomhoff am 8. Mai 1995 das »Deutsche Manifest« in seinem Briefkasten. Es war der 50. Jahrestag des Kriegsendes. Zitat: »Wenn du bis 9. Mai nicht ausgewandert bist, geht es dir an den Kragen«. Er blieb und ließ sich aus dem Telefonbuch streichen. [...] Nicola Galliner, die Leiterin der Jüdischen Volkshochschule, gibt sich Fremden gegenüber nicht immer als Jüdin zu erkennen: »Wenn ich meine Ruhe haben will, sage ich lieber nichts. Sobald die Leute Bescheid wissen, behandeln sie einen anders«. Oder wie Michael Blumenthal, der zukünftige Direktor des Jüdischen Museums, es in Newsweek gesagt hat: »Bei jedem Deutschlandbesuch komme ich als Amerikaner an und reise als Jude ab«. Das Phänomen, anders behandelt zu werden: Es ist eine ambivalente Mischung aus Ablehnung, Gehemmtheit, schwärmerischer Bewunderung und Erklärungszwang. [...] Nur, was sollen junge Deutsche machen, deren Interesse nicht mit einem Biß in einen Bagel zu befriedigen ist – wenn nicht fragen? Sie konnten jüdisches Leben im Straßenbild nicht kennenlernen, dafür haben ihre Großeltern gesorgt. Und in der Schule haben sie zwar viel über tote, aber nicht über lebende Juden erfahren. Gerade in einem Wissensvakuum können sich Stereotypen hervorragend ausbreiten. Für November ’98 plant die Künstlergruppe Meshulash eine Ausstellung mit dem Titel »Jüdisches Leben in Berlin – Traditionen und Visionen«. In der Projektbeschreibung heißt es: »Wir laden Künstler und Künstlerinnen ... ein, uns ihre Vorstellungen zu präsentieren: zukunftsgewandt, ohne falsches Pathos und folkloristischen Touch.«