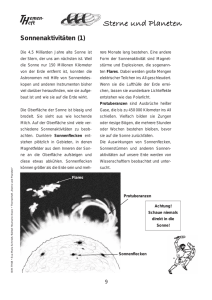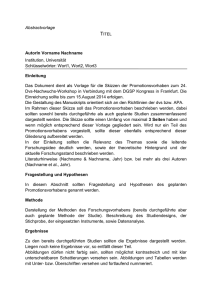Einfache astronomische Beobachtungen mit
Werbung

Bernd LACKNER
Einfache astronomische
Beobachtungen mit lichtoptischen
Mitteln
visuell-fotografisch-theoretisch
Diplomarbeit
zur Erlangung des akademischen Grades eines
Magisters der Naturwissenschaften
Studienrichtung: Physik Lehramt
Karl-Franzens-Universität Graz
Institut für Theoretische Physik
im August 2000
Begutachter: Univ. Prof. Dr. Heimo LATAL
erstes Exemplar
Das erste Exemplar, mit den Originalbildern, verbleibt
in der Fachbibliothek Didaktik am Institut für
Experimentalphysik.
1
Vorwort
Licht ist ein erstaunliches Phänomen. Es trägt Informationen und Energie über größte
Entfernungen mit der größtmöglichen Geschwindigkeit. Es ermöglicht uns, die großen
Distanzen zu den entferntesten Regionen des Universums zu überwinden. Ob mit den Augen,
fotografisch oder mit elektronischen Sensoren beobachtet wird, das Licht überträgt die
Informationen und ist das Objekt der Begierde. Astronomen können fast nie genug davon
bekommen.
Bilder, die das Licht malt, sprechen uns besonders an. Wir können sie mit unseren
eigenen Augen sehen. Etwas zu sehen heißt schon fast etwas zu glauben. Nur wer mit seinen
eigenen Augen den Himmel beobachtet oder wer ihn selbst fotografiert kann dieses gewisse
Gefühl für Astronomie erlangen. Dabei spielen auch die Umgebung und die scheinbar
nebensächlichen Dinge eine Rolle. So kann ein "Bücherastronom" über keine
Sternschnuppen, plötzlich aufblitzende Satellitensegel oder die Geräusche der nachtaktiven
Tiere, die seinen Weg kreuzen, berichten. Die Verhältnisse in Ausdehnung, Helligkeit und
Farbe können nur durch aktive Beobachtung erfaßt werden.
Auf den folgenden Seiten spielt Licht die Hauptrolle. Zum richtigen Umgang mit Licht
gehört etwa die Beobachtung bei Nacht. Man nützt die Schattenseite der Erde, um das
Streulicht zu minimieren. Nächte sind meist kalt. Trotzdem kann die beobachtende
Astronomie so fesselnd sein, daß man ein Leben lang nicht mehr davon loskommt. Viele
Aufnahmen in dieser Arbeit entstanden in kalten, klaren Nächten um die Mitternachtsstunde.
Diese Arbeit soll einen Teil meiner Erfahrungen in einfacher Weise darstellen, für
jeden, der an diesem faszinierenden Gebiet interessiert ist oder es unterrichten will.
Graz, im Sommer 2000
Bernd Lackner
2
Inhalt
VORWORT
2
INHALT
3
EINLEITUNG
5
ALLGEMEINES
DIE BEHANDELTEN METHODEN (ÜBERSICHT)
ASTRONOMISCHE BEOBACHTUNGEN IN DER SCHULE
1 VISUELLE BEOBACHTUNG
1.1 DAS AUGE ALS DETEKTOR
1.1.1 DIE PUPILLEN
1.1.2 DIE SPEKTRALE EMPFINDLICHKEIT
1.1.3 FEHLINTERPRETATIONEN
1.1.4 VORTEILE DER VISUELLEN BEOBACHTUNG
1.2 ÜBERSICHT ÜBER DIE VISUELLEN EINDRÜCKE
1.2.1 STERNKARTEN
1.2.2 STERNE UND DOPPELSTERNE
1.2.3 DEEP-SKY-OBJEKTE (AUßERHALB DES SONNENSYSTEMS)
1.2.4 OFFENE STERNHAUFEN
1.2.5 KUGELSTERNHAUFEN
1.2.6 GALAKTISCHE UND EXTRAGALAKTISCHE NEBEL
5
6
7
9
9
9
10
11
11
12
12
13
14
15
15
16
2 ASTROFOTOGRAFIE
17
MIT BRENNWEITEN VON 50 UND 200 MM
17
2.1 EINLEITUNG
2.2 MINIMALAUSRÜSTUNG
2.3 DIE SCHOTTISCHE MONTIERUNG
2.3.1 BAUANLEITUNG
2.3.2 SCHRITT FÜR SCHRITT ANLEITUNG
2.3.3 DER ERSTE EINSATZ
2.3.4 LEISTUNGSVERMÖGEN UND GRENZEN
2.3.5 FEHLER DURCH EINE SCHLECHT AUSGERICHTETE POLACHSE (SCHARNIER)
2.3.6 VERBESSERUNGEN, TIPS UND TRICKS
2.4 FILME UND BELICHTUNGSZEITEN
2.4.1 GRUNDLAGEN
2.4.2 DER SCHWARZSCHILDEFFEKT
2.4.3 VERWENDBARES FILMMATERIAL
2.4.4 BELICHTUNGSZEITEN
2.5 MÖGLICHE ERGEBNISSE (DEEP-SKY)
2.5.1 EINLEITUNG
2.5.2 DIE OBJEKTE DER MILCHSTRAßE
2.5.3 GALAXIEN
2.5.4 KOMETEN
2.5.5 RESÜMEE
17
18
19
20
21
24
25
29
32
36
36
38
40
40
41
41
41
57
63
65
3
3 MOND UND PLANETEN
3.1 DER MOND
3.1.1 ALLGEMEINES
3.1.2 MONDFOTOGRAFIE
3.1.3 MONDFINSTERNISSE
3.2 DIE PLANETEN
3.2.1 BEOBACHTUNG
3.2.2 DIE INNEREN PLANETEN - MERKUR UND VENUS
3.2.3 MARS, DER ROTE PLANET
3.2.4 DIE GASRIESEN JUPITER UND SATURN
3.2.5 URANUS UND NEPTUN, AM RANDE DES SONNENSYSTEMS
3.2.6 PLUTO, DER EXTREME
3.2.7 PLANETENFOTOS
4 DIE SONNE
4.1 DIE SICHTBARE SONNE
4.1.1 GEFÄHRLICHE SONNE
4.1.1 WAS IST ZU SEHEN
4.2 SONNENBEOBACHTUNG MIT DEM TELESKOP
4.2.1 DIE SONNENPROJEKTION
4.2.2 SONNENFILTER
4.2.3 DAS SONNENPENTAPRISMA
4.2.4 DIE WAHL DES BEOBACHTUNGSORTES
4.3 DIE PHOTOSPHÄRE
4.3.1 DIE DÜNNE SONNENOBERFLÄCHE
4.3.2 PHOTOSPHÄRISCHE GRANULATION
4.4 DIE WASSERSTOFFKONVEKTIONSZONE
4.5.1 SONNENFLECKEN UND MAGNETFELD
4.5.2 TYPISCHE ENTWICKLUNG EINES AKTIVITÄTSGEBIETES
4.5.3 ROTATION
4.5.4 FLECKENZYKLUS
4.5.5 DIE UMKEHRUNG DER POLARITÄT
4.5.6 DAS ENDE DER FLECKENAKTIVITÄT
4.5.7 URSPRUNG DES MAGNETFELDES
4.6 OBERHALB DER PHOTOSPHÄRE
4.6.1 DIE HERRSCHAFT DER MAGNETFELDER
4.6.2 DIE AKTIVE CHROMOSPHÄRE
4.6.3 STATIONÄRE PROTUBERANZEN
4.6.4 AKTIVE PROTUBERANZEN
4.6.5 TYPISIERUNG DER PROTUBERANZEN NACH VÖLKER
4.6.6 DIE HOHEN TEMPERATUREN IN DER CHROMOSPHÄRE UND KORONA
4.7 SONNENFOTOGRAFIE
4.7.1 SONNENFOTOS IM WEIßEN INTEGRALLICHT
4.7.2 BESTIMMUNG DER SONNENROTATION
4.8 DIE TOTALE SONNENFINSTERNIS AM 11. AUGUST 1999
4.8.1 AUSWERTUNG DER ERHALTENEN FOTOS
VERZEICHNIS DER VERWENDETEN LITERATUR
66
66
66
73
75
77
77
80
81
82
86
88
89
91
91
91
93
95
95
98
100
100
102
102
103
104
105
107
109
109
110
111
111
112
112
114
114
115
115
116
117
117
121
126
132
135
4
Einleitung
Allgemeines
Die vorliegende Diplomarbeit soll einfache Möglichkeiten aufzeigen, den Weltraum zu
beobachten und kennenzulernen. Durch ein Fenster, einen wolkenlosen Himmel, des
Raumschiffs Erde sind wir ständig mit den Weiten des Alls in Kontakt. Es liegt an uns, sie zu
beobachten.
Die Mannigfaltigkeit an Objekten ist groß. Viele von ihnen sind klein und winzig; manche
sind riesig und schwach; andere sind klein und gleißend; nur wenige sind groß und
schmerzend; und wieder andere sind kaum zu sehen. Sie alle liegen in einem unvorstellbar
großen Raum, den man nur erahnen kann.
Diese Vielzahl von Unterschieden macht es notwendig, für jede Objektklasse andere
Beobachtungsmethoden und Techniken einzusetzen. Objekte wie Sonne und Mond leuchten
so hell, daß ihr Licht gedämpft werden muß, um sie sinnvoll zu beobachten. Im Kontrast dazu
sind die meisten Objekte des Nachthimmels so lichtschwach, daß man lichtverstärkende
Optiken benötigt, um sie nachzuweisen. Viele Objekte wie Planeten oder weit entfernte
Galaxien sind sehr klein (in ihrer Winkelausdehnung), so daß man sie vergrößern sollte. Man
muß sich schon des Teleskops bedienen, um sie nicht nur als winzigen Lichtpunkt zu
erkennen. Sterne lassen sich leider gar nicht auflösen. Manche Objekte leuchten in Farben
(rot oder blau), für die das menschliche Auge nicht besonders empfindlich ist. Sie müssen mit
anderen Mitteln nachgewiesen werden.
In dieser Arbeit werden Techniken vorgestellt, mit denen man die verschiedensten Objekte
beobachten und fotografieren kann. Bei der Auswahl dieser Techniken wurde darauf Wert
gelegt, daß sie möglichst einfach und vergleichsweise günstig sind. Der Erfolg sollte sich
relativ rasch einstellen. Ferner wurden davon nur jene weiterverfolgt, die vom Autor auch
selbst durchgeführt werden konnten. Es sollte vermieden werden, daß nur von "anderen"
übernommen wird.
Weiters werden nicht nur die Techniken vorgestellt, sondern auch mögliche Resultate (Fotos),
damit der Leser einen Eindruck von der Leistungsfähigkeit der vorgestellten Technik
bekommt. Dabei muß darauf hingewiesen werden, daß die vorgestellten Resultate nicht durch
lange Versuchsreihen entstanden sind, sondern meist die ersten Bilder sind, die mit der
jeweiligen Technik vom Autor erreicht wurden. Das bedeutet, daß mit entsprechender
Sorgfalt durchaus noch erhebliche Verbesserungen möglich sind.
Die dazu herangezogenen Objekte wurden nach mehreren Gesichtspunkten ausgewählt.
Natürlich mußten sie erreichbar sein. Das heißt, daß sie in dem vorgegebenen Zeitraum am
Himmel zu finden waren und daß sie groß und hell genug sind, um mit der jeweiligen
Methode erreicht werden zu können. Weiters wurde darauf geachtet, daß die Objekte
didaktisch einigermaßen wertvoll sind. So wurde z. B. darauf verzichtet, einzelne Sterne oder
Doppelsterne zu fotografieren, da sie nur kleine Kreisscheibchen und nichts weiter zeigen. Sie
wurden aber visuell erwähnt. Sterne sind zwar physikalisch interessant, können aber fast nur
nach längeren Aufzeichnungen (Doppelsterne oder Veränderliche) oder mit großem Aufwand
(Spektrograf) erforscht werden. Als Ausgleich dazu wurde die Sonne besonders ausführlich
behandelt, da sie im Gegensatz zu den anderen Sternen so nahe ist, daß Details auf ihr
sichtbar werden. Sie hat zudem den Vorteil (besonders im Schulunterricht), daß sie am Tag(!)
beobachtet wird. Als glücklicher Zufall kommt die totale Sonnenfinsternis vom 11. 8. 1999
hinzu, die das Bild der Sonne abrundet.
Damit die behandelnden Objekte nicht nur als "Versuchskaninchen" erscheinen, wurden sie
ausführlich theoretsch behandelt.
Die Reihenfolge der behandelten Methoden wurde nach Schwierigkeitsgrad und Aufwand
(auch finanzieller) gewählt. So ist zum Beispiel eher zu erwarten, daß ein Fotoapparat mit
5
Normalobjektiv zur Verfügung steht als ein relativ teures Teleskop mit Nachführung zur
Planetenbeobachtung. Dadurch entsteht eine, im Gegensatz zu vielen anderern Publikationen,
in denen Himmelsobjekte aufgelistet werden, Umkehrung der Reihenfolge zugunsten der
Deep-Sky-Objekte, die den Objekten des Sonnensystems, wegen ihrer größeren Ausdehnung,
vorgezogen wurden. Dies wird vom Autor nicht als Nachteil betrachtet, da eine Umkehrung
der üblichen Reihenfolge die Deep-Sky-Objekte nicht in die Unendlichkeit verbannt, sondern
vielmehr die relative Nähe der Planeten und der Sonne betont.
Wird dieser Text in der Schule verwendet, so sollte darauf Rücksicht genommen werden und
eventuell die Reihenfolge gestürzt werden.
Da in dieser Arbeit die Ergebnisse und die Methoden denselben Stellenwert haben, werden
die Ergebnisse bewußt direkt nach den jeweiligen Methoden behandelt. Dies ist eine der
Hauptaufgaben dieser Arbeit.
Es sei noch erwähnt, daß auch ohne optische Hilfsmittel, also mit bloßem Auge beobachtet
werden kann. Dies führt jedoch, bis auf wenige Ausnahmen, zu keinen schnellen Resultaten.
Die Beobachtung mit dem unbewaffneten Auge wird meist erst interessant, wenn mit dem
Teleskop Erfahrung gesammelt werden konnte. Man kann dann die Leistung des Teleskops
erst so richtig einschätzen. Es zeigt sich, daß einiges auch ohne Teleskop beobachtet hätte
werden können. Aber nicht ohne Grund wurden die meisten wichtigen Entdeckungen in der
Astronomie erst nach der Erfindung des Fernrohrs gemacht.
In der Schule ist die Verwendung von optischen Hilfsmitteln nicht nur wegen der schnellen
Resultate zu empfehlen, sondern auch deswegen, weil heute viele Schüler Sehschwächen
zeigen. Brillen- oder Kontaktlinsenträger besitzen oft im Unendlichen keine Akkommodation,
da diese Hilfsmittel meist so eingestellt werden, daß sie die volle Akkommodation im
Unendlichen gerade nicht herstellen (damit eine weitere Verschlechterung der Sehkraft
hinausgezögert wird). Schwache Sterne zum Beispiel können deswegen nicht gesehen
werden.
Zuletzt sei noch erwähnt, daß der Autor möglichst viele Fotos beigegeben hat, damit der
Leser bereits vorweg einen Eindruck von dem gewinnt, was er selbst beobachten kann. Bis
auf wenige Ausnahmen stammen alle Fotos vom Autor selbst.
Das Anfertigen der Fotografien ist ein wesentlicher Teil dieser Arbeit und hat viel Zeit und
viele kalte Nächte in Anspruch genommen.
Die behandelten Methoden (Übersicht)
Gleich anschließend wird die visuelle Beobachtung des dunklen Nachthimmels behandelt.
Visuell sind mit geeigneten optischen Hilfsmitteln beinahe alle Objekte des Nachthimmels
beobachtbar. Je nach Winkelausdehnung wird man einen Feldstecher oder ein Teleskop
benötigen, das eine entsprechende Vergrößerung erlaubt. Sind die Objekte relativ
lichtschwach, so wird eine große Öffnung des Teleskops immer wichtiger. Die visuellen
Methoden für die Sonne und die Planeten werden dann in den entsprechenden Kapiteln
gesondert behandelt. Vor allem die Beobachtung der Sonne ist sehr gefährlich und bedarf
spezieller Behandlung. Prinzipiell kommt man mit dem Auge als Detektor bereits sehr weit.
Einzig die unterschiedlichen Farben können bei lichtschwachen Objekten nicht
wahrgenommen werden. Für manche Farben ist das Auge viel zu unempfindlich.
Man braucht einen alternativen Detektor, der auch dort empfindlich ist.
Hierfür eignet sich der fotografische Film sehr gut. Jeder weiß wie ein Foto die Wirklichkeit
wiedergibt. Das erleichtert die Interpretation der Ergebnisse sehr. Die Farbwiedergabe
entspricht weitgehend der Realität. Zudem ist der fotografische Film vergleichsweise billig.
Elektronische Kameras liefern viel ungewöhnlichere Bilder und es erfordert viel Geschick, sie
so zu steuern, daß ihre Ergebnisse denen eines Auges mit höherer Empfindlichkeit
entsprechen. Meist sieht ein solches Ergebnis wieder "schlechter" aus, als wenn man die
6
erhaltene Falschfarbenaufnahme weiter verfremdet, was in der Bildbearbeitung gerne
gemacht wird. Die meisten Bücher sind voll von solchen Bildern. Falschfarbenaufnahmen
sind in der Tat weit verbreitet. Sie sind aber eher für Profis gedacht. Sie erschweren nämlich
den Vergleich zu anderen Objekten erheblich. Zudem wird meist der Himmelshintergrund
stark unterdrückt, so daß man den Anschein erweckt, als würde der Nachthimmel schwarz
sein, was er nicht ist.
Aus obigen Gründen enthält die vorliegende Arbeit einen großen Teil an fotografischen
Techniken. Wieder wurden solche Techniken bevorzugt beschrieben, welche schnelle
Resultate liefern. Kapitel 2 enthält eine ausführliche Beschreibung einer einfachen
Nachführung, die es erlaubt, den Film so einzusetzen, daß er, durch eine entsprechend lange
Belichtungszeit, das Auge an Empfindlichkeit weit übertrifft. Die fotografischen und
visuellen Techniken für die Objekte des Sonnensystems sind in den dazugehörigen Kapiteln
einzeln beschrieben.
Zuletzt sei noch darauf hingewiesen, daß eine gewisse Vertrautheit im Umgang mit
Teleskopen und mit fotografischer Ausrüstung vorausgesetzt wird.
Astronomische Beobachtungen in der Schule
Wie wir nicht fragen, zu welch nützlichem Zweck
die Vögel singen, da sie zum Singen erschaffen worden und der Gesang für sie eine
Lust;
so sollten wir auch nicht fragen, warum sich der menschliche Geist damit müht,
die Geheimnisse des Himmels auszuloten ...
Sind doch die Naturerscheinungen deshalb so mannigfaltig
und die am Himmel verborgenen Schätze so reich,
damit es dem menschlichen Geiste nie an frischer Nahrung mangle.
Johannes Kepler, Mysterium Cosmographicum [aus Unser Kosmos von Carl Sagan, 1980]
Es gibt viele Rechtfertigungen, die Astronomie in den Schulunterricht miteinzubeziehen. Der
obige Gedanke scheint mir einer der besten zu sein. Viel rationalere Gründe erörtert und listet
W. Winnenburg [Astronomie Heute, Friedrich Verlag 1995] auf, wenn er schreibt:
- Asronomie ist ein faszinierendes Abenteuer
- Astronomie ist ein Basiselement unserer Kultur
- Astronomie weist den Übergang von naiv-magischer zu rationaler Weltanschauung
- Astronomie durchleuchtet die räumliche und zeitliche Stellung des Menschen in der Welt
- Astronomie eröffnet Perspektiven zur naturphilosophischen Welterschließung
- Astronomie öffnet den Blick für die Vielschichtigkeit erfahrbarer Realität
- Astronomie weist auf die Einheit von Mensch und Natur
- Astronomie wirft die Fragen nach verantwortlichem Handeln auf
- Astronomie betont die Bedeutung internationaler Kooperation
- Astronomie lenkt den Blick auf die Ästhetik
- Astronomie klärt die Beeinflussung des Menschen durch kosmische Vorgänge
Es gibt also eine Reihe von Gründen, Astronomie zu unterrichten. Trotzdem wird Astronomie
in der Schule eher stiefmütterlich behandelt. Gerade der Physikunterricht würde aber eine
gute Ausgangsbasis für einen Astronomieunterricht bieten. Die Astrophysik bietet ja ein
großes Feld, um die erworbenen physikalischen Kenntnisse >> relativ << einfach
anzuwenden.
Es ist aber nur zu verständlich, wenn angesichts der starken Konkurrenz um die knappe
Unterrichtszeit darauf verzichtet wird. Zudem ist die Astronomie nicht eindeutig dem
Physikunterricht untergeordnet. Geographie und Mathematik können ebenfalls einen Beitrag
7
zur astronomischen Bildung leisten. Aus verschiedenen Gründen unterbleibt dies aber
zumeist. Nicht zuletzt wegen der mangelnden astronomischen Vorbildung vieler Lehrer. Ein
Lehrer, der sich fachlich unsicher fühlt, bietet nicht so schnell einen Astronomiekurs an.
Zudem ist Astronomie unterrichtsmethodisch kein einfaches Gebiet. An die Stelle des
Experiments tritt die Himmelsbeobachtung. Sie ist, weil sie vorzugsweise Nachts stattfindet,
nur schwer zu organisiern. Die Unsicherheiten des Wetters und die starke
Lichtverschmutzung in den Städten tun ein übriges dazu bei. Wie einige andere Gebiete des
Physikunterrichts erfordert auch der Astronomieunterricht eine eigene apparative Ausrüstung.
Teleskope sind leider sehr teuer und zählen nicht zur Ausstattung so mancher Schule.
Es wäre aber falsch, auf die Beobachtung zu verzichten. Der Astronomieunterricht würde
dadurch seinen größten Trumpf verlieren. Es ist die Faszination, die vom Anblick des
gestirnten Himmels ausgeht und Schüler wie Lehrer in ihren Bann zieht. Selbst Laien
interesseieren sich für Astronomie. Das ist in jedem Buchladen zu erkennen. Dort findet man
mehr populäre Werke zur Astronomie als zu allen physikalischen Gebieten zusammen. Auch
die Wissenschaftsberichterstattungen überregionaler Zeitungen zeigen das deutliche
öffentliche Interesse an Astronomie. Etwa die Hälfte aller naturwissenschaftlicher Berichte
entfallen auf Astronomie und Weltraumforschung. Zu erwähnen ist auch die ansehnliche
Gruppe von Amateuren, die sich in ihrer Freizeit mit Astronomie beschäftigen. Solche
Interessensgruppen findet man in keinen anderen Teilbereichen der Physik.
Wer noch nicht verlernt hat zu schauen, dem holen erste staunende Blicke zum Himmel die
fernen Himmelsobjekte "auf die Erde" und schaffen zudem eine Nähe der ergriffenen
Beobachter zueinander. [Zitat: W. Winnenburg, Astronomie + Raumfahrt 34 (1997) 3]
Das Ergriffensein und Staunen stimuliert zum Vergleichen, Fragen und Nachdenken. Hier ist
es für den Lehrer einfach, die Schüler zum Lernen zu motivieren.
Inhaltlich sollte ein Einstieg in die Astronomie von alltäglichen Phänomenen ausgehen, die
uns seit unserer Kindheit vertraut sind. So sind Tag und Nacht Erscheinungen, die unseren
Lebensrhythmus von den ersten "Tagen" an bestimmen. Das didaktische Problem liegt nun
darin, diese alltäglichen Erscheinungnen aus der Selbstverständlichkeit zu lösen und wieder
fragwürdig zu machen.
Unter dem Ziel "Erleben und Beobachten von Himmelsphänomenen" sind der "Himmel zu
öffnen" und "die Gestirne auf die Erde zu holen". Ein derartig emotional befriedigender
Einstieg würgt im gegensatzt zu den häufig fachüberladenen theoretischen Einführungen das
Interesse an kosmischen Erscheinungne nicht ab, sondern fördert es.
[ Zitat: W. Winnenburg, Astronomie Heute, Friedrich Verlag 1995]
Leider sind Naturgesetze fast immer nicht durch unmittelbare Beobachtung auffindbar.
Deshalb sollte der Lehrer nicht mit den Beobachtungstechniken überfordert sein, damit er den
Blick seiner Schüler auf das Wesentliche richten kann. Dabei soll diese Arbeit helfen. Der
Leser kann Erfahrungen übernehmen und muß sie nicht erst mühsam selbst sammeln.
Im Speziellen kann eventuell die im zweiten Kapitel vorgestellte schottische Montierung
fächerübergreifend für den Nacherfindenden Unterricht gewählt werden. Dabei können alle
Unterrichtsphasen für den Nacherfindenden Unterricht, von der Entwicklung der technischen
Aufgabenstellung bis zur Anwendung, relativ einfach nachvollzogen werden. Diese
Unterrichtsform ist dabei besonders motivierend, weil am Ende zwei Unterrichtsergebnisse
vorliegen. Zum einen das funktionstüchtige Gerät und zum anderen die Bilder, die damit
gewonnen werden können.
Aber auch die Bedienung eines Teleskops oder der Kamera sind für den Unterricht wertvoll.
Sie gehören eher zum Nachmachenden Unterricht. Das Umsetzen von Arbeitsanweisungen
und das Übersetzen in ein sachgerechtes Handeln sind Fähigkeiten, die dabei geübt werden.
Sie spielen im Leben der modernen Gesellschaft eine beträchtliche Rolle, denn es muß
sowohl im privaten als auch im beruflichen Bereich oft die Bedienung und Benutzung neuer
Geräte und Materialien anhand von Gebrauchsanweisungen erfolgen.
8
[vgl. Bleichroth, Fachdidaktik Physik, Aulis Verlag Deubner & Co KG, 1991]
1 Visuelle Beobachtung
Wir hatten den Himmel da droben,
übersät mit Sternen, und legten uns oft auf den Rücken
und schauten zu ihnen hinauf und unterhielten uns darüber,
ob sie erschaffen oder nur zufällig da wären.
Mark Twain, Huckleberry Finn [aus Unser Kosmos von Carl Sagan, 1980]
1.1 Das Auge als Detektor
Bis vor eineinhalb Jahrhunderten wurden alle astronomischen Beobachtungen mit dem Auge
durchgeführt. Auch heute noch spielt das Auge in der Astronomie eine große Rolle. Viele
Kometen, Supernovae und Sternschnuppenströme werden heute noch mit dem Auge entdeckt.
Es ist also gut, etwas über die Eigenschaften des Auges zu wissen.
Das Auge ist nahezu kugelförmig. Das Licht durchdringt die Linse, die von der
Regenbogenhaut (Iris) begrenzt wird, und gelangt in das Innere, den Glaskörper. Am Ende
des Glaskörpers entsteht das Bild auf der Netzhaut (Retina). Auf der Netzhaut findet man
zwei Sorten von Strahlungsempfängern. Etwa 125 Millionen Stäbchen und 6 Millionen
Zäpfchen. Die Zäpfchen sind etwas weniger lichtempfindlich und sind für das Farbsehen bei
Tag verantwortlich. Diese Zäpfchen sind besonders dicht auf der optischen Achse der Linse,
dem gelben Fleck. Dort sorgen sie für die höchste Auflösung von bis zu einer halben
Bogenminute. Die Stäbchen sind etwa 10 000 mal empfindlicher als die Zäpfchen. Mit ihnen
ist nur ein "Schwarz-Weiß-Sehen" möglich. Die Stäbchen kann man aktiv zum Einsatz
bringen und somit das Auge viel empfindlicher machen. Dazu sieht man etwas an dem zu
beobachtenden Objekt vorbei, konzentriert sich aber darauf. Man nennt diese Vorgehensweise
"das indirekte Sehen". Es ist am Anfang nicht gerade leicht und bedarf einiger Übung. Mit
dieser Technik gelingt es Objekte zu sehen, die beim direkten Blick unsichtbar erscheinen.
Die Adaptionszeit des Auges von hell nach dunkel beträgt zwischen 30 und 45 Minuten. Erst
nach dieser Zeit in der Dunkelheit kann man die volle Leistung des Auges erwarten. Natürlich
spielen auch die physische und psychische Verfassung eine wichtige Rolle. Für alle
Tätigkeiten, die zumindest reduziertes Licht erfordern, hat sich die Verwendung von rotem
Licht als vorteilhaft herausgestellt. Ist die Intensität des roten Lichts nicht zu hoch, so bleibt
die Dunkeladaption erhalten und muß nicht erneut abgewartet werden.
Die Quantenausbeute des Auges liegt bestenfalls bei etwa 15%, was die Quantenausbeute der
Photoemulsion (etwa 1%) weit übertrifft. Die schwächsten noch mit unbewaffnetem Auge
beobachtbaren Sterne schicken etwa 200 Photonen pro Zwanzigstel Sekunde durch ein
dunkeladaptiertes Auge. Das heißt, daß eigentlich weit schwächere Sterne beobachtet werden
könnten. Die Helligkeit des Himmelshintergrundes setzt hier aber Grenzen. Würde der
Himmel wirklich schwarz sein, so würde man eventuell noch 10 mal schwächere Sterne
erkennen können.
1.1.1 Die Pupillen
Eine wichtige Größe für die visuelle Beobachtung ist der Pupillendurchmesser. Er bestimmt
wieviel Licht in das Auge dringt. Der Pupillendurchmesser des dunkeladaptierten Auges
beträgt maximal etwas über 8 Millimeter. Er nimmt mit fortschreitendem Alter beständig ab
9
und sollte im Zweifelsfall fotografisch bestimmt werden. Dazu adaptiert man das Auge in der
Dunkelheit und fotografiert es zusammen mit einem Millimetermaßstab ab. Mit geringer
Ungenauigkeit kann man von einem linearen Abfall von 8 mm im Alter von 20 Jahren auf
etwa 2.5 mm im Alter von 80 Jahren ausgehen.
Die Austrittspupille des Teleskops ist daher sinnvollerweise nicht größer als die
Pupillengröße des Beobachters zu wählen, da sonst die Pupille des Auges den Strahlengang
begrenzt. Die Austrittspupille ist wie üblich die Abbildung der Aperturblende im Bildraum.
Wobei die Aperturblende im Falle eines Teleskops meist die Objektivöffnung und ihr
Durchmesser der Objektivdurchmesser ist. Der Durchmesser der Austrittspupille dAP
errechnet sich aus dem Durchmesser der Aperturblende dAB (Öffnung) und der Vergrößerung:
d AB
d AP =
V ergröß eru ng
Der Pupillendurchmesser begrenzt also in gewisser Weise die Mindestvergrößerung.
Verwendet man eine geringere Vergrößerung, d. h. eine größere Austrittspupille, so wird das
Bild wieder lichtschwächer. Da es den Astronomen ohnehin immer an Licht mangelt, wird
üblicherweise die Mindestvergrößerung so gewählt, daß die maximale Austrittspupille mit
einem Durchmesser von 5 bis 8 mm erreicht wird.
Es ist nicht immer ratsam die maximale Austrittspupille mit 8 mm anzusetzen, selbst wenn
der Pupillendurchmesser des Beobachters 8 mm beträgt. Um die volle Austrittspupille
ausnützen zu können, müßte der Beobachter sein Auge und damit seinen Kopf äußerst präzise
in die optimale Lage auf der optischen Achse bringen. Kleine Zitterbewegungen des Kopfes
führen dann schon zu Vignettierungen. Es ist also kein Fehler, eine kleine Toleranz von ein
bis zwei Millimeter einzuplanen.
Eine weitere wichtige Größe ist das Auflösungsvermögen des Auges, das bereits bei einem
Pupillendurchmesser von 2 mm (helladaptiertes Auge) erreicht wird. Nach den physikalischen
Gesetzmäßigkeiten liegt es deshalb im Bereich einer Bogenminute. Es hat deshalb kaum Sinn,
Austrittspupillen unter einem Millimeter zu verwenden, da diese Vergrößerungen keinen
zusätzlichen Informationsgewinn mehr bringen. Man spricht von sogenannten "leeren"
Vergrößerungen. Als Faustregel verwendet man deshalb für die maximale sinnvolle
Vergrößerung am Teleskop den Objektivdurchmesser in Millimeter.
1.1.2 Die spektrale Empfindlichkeit
Die Lichtempfindlichkeit des Auges hängt von der Frequenz des betrachteten Lichtes ab. Am
Tag, wenn die farbempfindlichen Zäpfchen aktiv sind, liegt die maximale spektrale
Empfindlichkeit bei etwa 555 nm (grünes Licht). Das entspricht etwa dem Maximum der
Strahlungsenergiedichte eines Schwarzen Strahlers bei 5200 K. Dies ist in etwa die
Farbtemperatur bei mittlerem Tageslicht. Die lichtempfindlicheren Stäbchen erreichen ihre
maximale Empfindlichkeit bereits bei 507 nm, was gelbem Licht entspricht.
10
Das Nachtsehen ist ein monochromes
Sehen. Es können keine Farben
wahrgenommen werden. Nur relativ helle
Objekte wie Planeten und Sterne leuchten
in Farbe. Gasnebel und weit entfernte
Sternhaufen sind farblos. Die schönen
Farben, die von langbelichteten
Astrofotos suggeriert werden, sind visuell
unsichtbar.
Die spektrale Empfindlichkeitsverteilung
hat auch zur Folge, daß Sternhelligkeiten
nicht ohne weiteres miteinander
verglichen werden können, da das Auge
auf die verschiedenen Farben verschieden
stark anspricht. Beim Vergleichen von
Sternhelligkeiten ist zudem noch die
unterschiedliche Empfindlichkeit von
Abb. 1.1: Spektrale Empfindlichkeitskurve des Auges, auf Stäbchen und Zäpfchen zu beachten. So
den Maximalwert normiert. Nachtsehen strichliert; darf man nicht versuchen, zwei
Tagsehen durchgehend. Aus dem Handbuch für
Sternhelligkeiten zu vergleichen indem
Sternfreunde Band 1 Seite 81.
man einen Stern fixiert und den anderen
nur indirekt erfaßt. Der zweite Stern wird dann immer heller erscheinen, da sein Licht
vermehrt auf die empfindlicheren Stäbchen fällt. Man muß versuchen, sich die Helligkeit des
einen Sterns zu merken und erst dann den zweiten Stern zu beobachten.
Wie bei den Sternen verhält es sich auch bei den anderen Objekten des nächtlichen Himmels.
1.1.3 Fehlinterpretationen
Das Auge ist konstruktionsbedingt mit Abbildunsfehlern übersät. Durch seine enge
Verbindung zum Gehirn ist es dem System Auge-Gehirn möglich, diese Fehler fast völlig
auszuschalten. Es handelt sich dabei um eine Art hochgezüchteter Bildverarbeitung, die an
das Leben auf der Erde angepaßt wurde. Zahlreiche optische Täuschungen gehen darauf
zurück. In der Astronomie verarbeitet das Gehirn aber keine bekannten irdischen Bilder. Ein
Beispiel: Bei der Beobachtung feinster Details auf dem Mond kommt es hin und wieder vor,
daß der Beobachter glaubt eine Rille zu erkennen, bei der es sich in Wirklichkeit um ein
Reihe von dunklen Flecken handelt, die das Gehirn einfach verbindet.
Ähnlich erging es Giovanni Schiaparelli als er 1877 den Mars beobachtete. Er berichtete, ein
ganzes Netzwerk von geraden Linien auf dem Mars beobachtet zu haben. Spätere Aufnahmen
der Mariner- und Viking-Mars-Sonden konnten Schiaparellis Beobachtungen aber nicht
bestätigen. Auch heute noch haben Beobachter mit sehr großen Teleskopen den Eindruck
diese Gebilde zu erkennen. Es war also keine Einbildung Schiaparellis sondern eine
Fehlleistung des Auge-Gehirn-Systems.
1.1.4 Vorteile der visuellen Beobachtung
Die visuelle Beobachtung ist in Summe allen anderen Arten der Registrierung des Himmels
überlegen. Wohl mögen einzelne Techniken in speziellen Bereichen dem menschlichen Auge
überlegen sein, doch in der Vielzahl von Hochleistungen ist das Auge scheinbar unschlagbar.
Visuell heißt live, ohne Zeitverzögerung. Es vermittelt ein ganz besonderes Gefühl, live bei
einem Himmelsschauspiel dabei zu sein. Bei einer Wiederholung im Fernsehen sieht ja auch
niemand so richtig genau hin. Zudem kommt, daß wir mit dem Auge vertraut sind. Es
begleitet uns jeden Tag und zu jeder Stunde. Was wir mit dem eigenen Auge sehen, daß ist
11
schon etwas ganz anderes, als wenn man es nur erzählt bekommt. Keine noch so gute
Fotografie oder ein Video kann das ersetzen. Dazu kommen noch die anderen Eindrücke, die
Geräusche und Gerüche, der Luftzug und die Dunkelheit. Dies kann eine Aufzeichnung nicht
liefern.
Den größten Vorteil bietet das Auge aber wegen seines großartigen Kontrastumfangs. Keine
Fotoplatte und kein Sensor hat eine derartig große Dynamik. Man denke nur an den
immensen Helligkeitsunterschied von Tag und Nacht. In der Fotografie braucht man einen
großen Unterschied in der Belichtungszeit, um diesen Unterschied zu überbrücken. Das
gelingt meist gar nicht. Man muß noch zusätzlich die Blende verstellen und in der
Dämmerung empfindlicheres Filmmaterial verwenden. Die hochempfindlichen Sensoren der
modernen Astronomie auf der anderen Seite sind bei Tageslicht hoffnungslos geblendet und
bringen kein nur irgendwie brauchbares Bild zustande. Das Auge überblickt diesen
Helligkeitsunterschied mit scheinbar spielerischer Leichtigkeit.
Der Kontrastumfang aller gängigen bilderzeugenden Fototechniken und elektronischen
Sensoren ist sogar so gering, daß sie es unmöglich schaffen, den Kontrast zwischen den
hellsten Sternen und den gerade noch sichtbaren wiederzugeben. Von weiteren im Teleskop
noch sichtbaren Sternen ganz zu schweigen. Dieser Intensitätsunterschied ist es aber, der
einen gewissen Entfernungseindruck hinterläßt.
Ebenfalls großartig ist der große Blickwinkel des Auges in Kombination mit seiner dazu
relativ
hohen Auflösung. Es gibt nur wenige Kameras, die Vergleichbares schaffen.
1.2 Übersicht über die visuellen Eindrücke
1.2.1 Sternkarten
Abgesehen vom Wetter ist das größte Problem bei der visuellen Beobachtung das Auffinden
der Objekte. Sonne und Mond sind wegen ihrer Helligkeit relativ einfach zu finden. Alle
anderen Objekte sind da wesentlich problematischer. Glücklicherweise wird der Nachthimmel
von einem Netzwerk von Sternbildern überdeckt, das eine gute Orientierung erlaubt. Anhand
dieser Sternkonstellationen ist es relativ einfach, hellere Objekte zu finden. Für schwächere
Destinationen benötigt man eine entsprechend genauere Sternkarte, die auch noch schwächere
Sterne enthält.
Sternkarten sind vergleichbar mit den Straßenkarten auf der Erde. Üblicherweise werden sie
in einem sich mit den Sternen mitbewegenden sphärischen Koordinatensystem gezeichnet. Es
wäre günstig Sternengloben zu verwenden, aber die Globen sind sehr unhandlich und bei
entsprechender Genauigkeit bald unbezahlbar. Man begnügt sich deshalb mit Sternkarten, die
natürlich Verzerrungen aufweisen müssen. Das ist kein wirkliches Problem, da wir schon
lange mit Karten der Erde umgehen, die ebenfalls solche Verzerrungen aufweisen.
Je größer der Himmelsausschnitt, den die Karte zeigt, desto größer ist auch die Verzerrung.
Zum Beispiel zeigen die üblichen monatlichen Sternkarten, wie sie in den Jahrbüchern und
Zeitschriften abgedruckt sind, die halbe Himmelskugel und weisen deshalb relativ starke
Verzerrungen an den Rändern auf.
Meist sind sie für 21:00 Ortszeit und mittlere nördliche Breite gezeichnet. Die große
Verzerrung an den Kartenrändern spielt meist keine Rolle, da man kaum Objekte beobachtet,
die so tief am Himmel stehen. Man verwendet die Karte indem man sie über dem Kopf hält,
nach Norden ausrichtet und sie mit den Sternen vergleicht, die man sieht. Wenn man das tut,
so ist die Verzerrung, die man durch den steilen Blick nach oben am Horizont erhält etwa
gleich wie die Verzerrung auf der Karte und fällt anfangs gar nicht auf.
Wenn man vor 21:00 beobachtet, kann man die Karte vom Vormonat benutzen. Entsprechend
kann man die Karte vom nächsten Monat für Beobachtungen, die zwei Stunden später als
12
21:00 stattfinden sollen, verwenden. Wenn man die Karte vom nächsten Monat nicht hat, da
man die Karte aus einer Zeitschrift verwendet, kann man die entsprechende Karte vom
Vorjahr benutzen. Die Planetenpositionen sind zwar verändert aber die Sternpositionen sind
dieselben.
Genauere Sternkarten zeigen meist nur einen kleinen Ausschnitt des Himmels. Die
Verzeichnung ist schon relativ klein. Es finden nur mehr wenige Sternbilder auf den
einzelnen Karten Platz. Manchmal, wenn die Karte schon sehr genau ist, sind auch nur Teile
von einzelnen Sternbildern aufgezeichnet. Solche Karten werden üblicherweise zu einem
Himmelsatlas zusammengefaßt, der meist den gesamten Himmel erfaßt und mindestens alle
mit bloßem Auge sichtbaren Sterne zeigt. Solche Karten sind für den jahrelangen Gebrauch
gedacht und enthalten deshalb keine Planetenpositionen. Enthält der Atlas auch schwächere
Sterne als jene, die noch mit bloßem Auge sichtbar sind, so wird er schnell unübersichtlich
und es bedarf schon einer, meist beigelegten Übersichtskarte, um sich im Atlas
zurechtzufinden. Ein Atlas, der alle Sterne enthält, die man in einem normalen Feldstecher
sehen kann, umfaßt mehrere hunderttausend Sternpositionen. Es handelt sich dabei um recht
große schwere Bücher, die für den Teleskopgebrauch gedacht sind. Solche Atlanten sind recht
hilfreich, wenn man schwache Objekte sucht, die sich weit weg von bekannten
Sternkonstellationen befinden. Mit dem Bild vom Atlas im Kopf kann man sich langsam bis
zum Ziel vorhanteln.
1.2.2 Sterne und Doppelsterne
Sterne sind im allgemeinen keine beliebten Beobachtungsobjekte. Wahrscheinlich gibt es zu
viele. Dennoch sollte man wenigstens einige aktiv beobachten. Es lohnt sich.
Im Teleskop können die hellsten Sterne sogar blenden. Bei dunklem Himmel ist ihre Brillianz
überwältigend. Kein Foto kann so etwas zeigen. Das helle Leuchten wird durch das Flimmern
der Atmosphäre zum Leben erweckt. Selbst wenn die Luft einmal ganz ruhig ist, brennt sich
das Sternenlicht in die Netzhaut und erzeugt einen Wischeffekt, wenn man den Kopf bewegt.
Erst bei einem solchen Anblick kann man verstehen, daß die Sterne so unvorstellbar weit
entfernt sein müssen und es liegt nahe, daß es Sonnen sind. Aus unserer Erfahrung kennen wir
nur die Sonne, die am Himmel einen derartigen Kontrast zu erzeugen vermag. Es ist also
durchaus didaktisch wertvoll, einzelne Sterne zu beobachten.
Zunächst wählt man eine niedrige Vergrößerung, um den Stern in seinem Umfeld zu
betrachten. Er wird von vielen schwächeren Sternen umgeben. Manchmal sind auch mehrere
helle Sterne in einem Blickfeld, das ist aber selten. Wenn man dann die Vergrößerung bis auf
das Maximum steigert, so stellt man fest, daß der Stern nur ein Beugungsmuster erzeugt und
keinerlei Detail zeigt. Er ist viel zu weit entfernt. Das Teleskop ist zu schwach. Nicht einmal
die großen Teleskope dieser Welt sind ohne Tricks in der Lage, mehr von einem Stern zu
zeigen.
Meistens wird man kein Beugungsmuster erkennen, sondern der Stern wird verschmiert einen
viel größeren Bereich einnehmen. Die Szintillationen der Luft, das Seeing, ist dafür
verantwortlich. Es begrenzt das Auflösungsvermögen des Teleskops sehr schnell.
Vergrößerungen über 200-fach sind kaum sinnvoll.
Solange die Sterne einigermaßen hell sind, können ihre Farben wahrgenommen werden. Es ist
ihre Oberfläche, von der das Sternenlicht kommt, also ist es auch die Farbe der Oberfläche,
die man sieht.
Die Farbe ist meist auf das Maximum der emittierten Wellenlänge zurückzuführen, die vom
kontinuierlichen Spektrum des Sterns herrührt. Dieses ist ausschließlich von der Temperatur
abhängig. Sehr heiße Sterne leuchten deshalb violett oder blau (z.B. Rigel im Orion oder
Spica in der Jungfrau; Oberflächentemp. über 20 000 K). Ist die Oberfläche des Sterns relativ
kühl, so leuchtet er rot (z. B. die Überriesen Beteigeuze im Orion und Antares im Skorpion;
13
Oberflächentemperatur etwa 3000 K). Da es sich um kein Strahlungsgleichgewicht handelt,
ist das Planksche Strahlungsgesetz nur bedingt verwendbar.
Stehen zwei Sterne vergleichbarer Helligkeit einander relativ nahe, so werden sie
Doppelsterne genannt. Oft handelt es sich dabei um zwei Sterne, die nur entlang ihrer
Sichtlinie einander nahe stehen. In Wirklichkeit sind sie hunderte Lichtjahre entfernt. In etwa
der Hälfte aller Fälle handelt es sich aber um Sterne, die ihren gemeinsamen Schwerpunkt
umkreisen. Solche Paare nennt man physische Doppelsterne. Nur lange Meßreihen können
zeigen, ob ein Sternenpaar ein physischer oder nur ein scheinbarer Doppelstern ist. Der Blick
durch das Teleskop kann so etwas nicht entscheiden. Prinzipiell liegt aber die
Wahrscheinlichkeit für einen physischen Doppelstern um so höher, je näher die Sterne
beieinander liegen.
Doppelsterne sind besonders schöne Objekte. Doch nur das Teleskop vermag ihren Glanz zu
zeigen. Keine Fotografie kann den visuellen Eindruck auch nur im entferntesten
widerspiegeln.
Besonders schön sind Mehrfachsterne. Es handelt sich dabei um scheinbare oder physische
Sternsysteme, die aus mehr als zwei Sternen bestehen.
Auflistungen von Doppel- und Mehrfachsternen findet man zum Beispiel in Burnhams
Celestial Handbook von Robert Burnham jun. in The Night Sky Observers Guide von Kepple
& Sanner oder im Sky Catalogue 2000.0 von Hirshfeld & Sinnot, Band 2.
1.2.3 Deep-Sky-Objekte (außerhalb des Sonnensystems)
Auf Sternkarten sind nicht nur Sterne verzeichnet. Eine ganze Reihe von weiteren Objekten
ist dort zu finden. Es sind im wesentlichen diffuse Nebel und Planetarische Nebel, Gasnebel,
offene Sternhaufen, Kugelsternhaufen und Galaxien. Von all diesen Objekten gibt es einige
prominente Vertreter, die bereits im Feldstecher gut zu sehen sind. Spezialisten können sie
auch mit bloßem Auge erfassen. Für den Anfang ist eine Öffnung von mindestens 40 mm
empfehlenswert. Diese nichtstellaren Objekte wurden ursprünglich katalogisiert, um sie nicht
mit Kometen zu verwechseln. So entstand die erste Liste nichtstellarer Objekte, die Charles
Messier 1784 veröffentlichte. Sie enthält 39 extragalaktische Nebel, je 29 offene und
kugelförmige Sternhaufen, vier Planetarische Nebel und sieben diffuse galaktische Nebel. Zu
Messier´s Zeit war die Natur dieser Objekte noch nicht bekannt. Die Messier-Liste enthält mit
wenigen Ausnahmen die schönsten und hellsten deep-sky-Objekte der nördlichen
Hemisphäre. Die Messier-Liste ist in allen guten und einführenden Sternatlanten abgedruckt.
Wesentlich umfangreicher ist der "General Catalogue", den Sir John Herschel bereits 1864
zusammengestellt hatte. Er umfaßt 5079 Objekte. 1888 gab J.L.E. Dreyer eine überarbeitete
Auflage des "General Catalogue" heraus, den "New General Catalogue" (abgekürzt NGC),
der 7840 Objekte umfaßt und noch heute in Verwendung ist. Die Objekte werden mit
Nummern versehen und heißen dann etwa NGC 1976 (bzw. M 42 im Messier Catalogue) - die
Nummer des großen Orion-Nebels im NGC. Ergänzungen zum NGC sind im "Index
Catalogue" (abgekürzt IC) und im "Second Index Catalogue", ebenfalls von Dreyer,
herausgegeben worden (1895 und 1908). Erst 1973 ist eine überarbeitete Version des NGC
erschienen, als "Revised New General Catalogue". Der NGC umfaßt bereits viele sehr
schwache Nebel und Sternhaufen, die selbst mit moderaten Teleskopöffnungen schwer zu
sehen sind. Dennoch muß man sich vor Augen halten, daß der NGC und der IC fast
ausschließlich auf visuellen Beobachtungen beruht. Heutzutage ist die Meinung ziemlich
verbreitet, daß schwache Nebel nur auf fotografischem Wege sichtbar gemacht werden
können. Angesichts der vielen lichtschwachen Nebel im NGC sollte der mit einem
lichtstarken Teleskop ausgestattete Beobachter es durchaus riskieren, einmal einen ihm
unbekannten unscheinbaren Nebel zu beobachten.
14
Da man aber nicht nur etwas sehen sondern auch wissen will, was man da beobachtet,
empfiehlt sich zusätzliche Literatur. Die schon etwas betagte (1978) aber noch immer beste
und ausführlichste Auflistung an Objekten des nächtlichen Himmels ist in dem dreibändigen
Werk von Robert Burham jun. zu finden. Burhams Celestial Handbook bietet nicht nur Daten
sondern vor allem hervorragende Beschreibungen zu fast jedem verzeichnetem Objekt.
Gute Beschreibungen des visuellen Eindrucks findet man in " The Night Sky Observer´s
Guide" von Kepple & Sanner. Dieses Werk beinhaltet 5541 Objekte, von denen der visuelle
Eindruck durch verschiedene Teleskopöffnungen beschrieben ist.
1.2.4 Offene Sternhaufen
Offene Sternhaufen nehmen einen relativ großen Platz am Himmel ein. Ihr Durchmesser
beträgt typischerweise einige zehn Bogenminuten. Die Sterndichte ist größer als in der
unmittelbaren Umgebung. Manche Sternhaufen sind dadurch auch schon beschrieben.
Trotzdem sind sie, dunkler Himmel vorausgesetzt, ein schöner Anblick. Oft glitzern ihre
Sterne wie Diamanten auf schwarzem Samt.
Manche Sternhaufen zeigen auch Besonderheiten. Manchmal sind die Mitgliedssterne
verschiedenfarbig und haben verschiedene Helligkeit. Manche Sternhaufen sind so dicht, daß
man bei fortschreitender Vergrößerung immer mehr Sterne zu sehen bekommt. Kleine
Teleskope können nur die größten Sternhaufen in Einzelsterne auflösen. Kleinere
lichtschwächere Sternhaufen, die weiter entfernt sind, erscheinen als verwaschenes
Fleckchen. Durch indirektes Schauen kann man eventuell einzelne Sterne erkennen.
Manche offene Sternhaufen sind noch sehr jung und ihre Sterne sind noch von Gas umgeben,
das ebenfalls durch indirektes Schauen beobachtet werden kann. Offene Sternhaufen kann
man mit allen Vergrößerungen beobachten. Üblicherweise beginnt man mit der
Mindestvergrößerung und steigert die Vergrößerung dann allmählich bis der Sternhaufen
gerade noch zur Gänze ins Gesichtsfeld paßt. Durch das Steigern der Vergrößerung wird
auch der Himmelshintergrund dunkler und es können eventuell schwächere Sterne gesehen
werden. Die hellen großen Sterne sind oft nahe dem Zentrum, während weiter draußen nur die
schwächeren Sterne leuchten. Es ist daher schwierig zu sagen welche Sterne noch zum
Haufen gehören und welche nicht. Prinzipiell kann man rein visuell nicht zwischen Vorderoder Hintergrundsternen und Haufensternen unterscheiden. Es ist nur sehr wahrscheinlich,
daß die meisten Sterne in der Umgebung wirklich zum Haufen gehören.
1.2.5 Kugelsternhaufen
Kugelsternhaufen sind viel dichter als offene Sternhaufen und enthalten eine viel größere
Zahl an Sternen. Im Teleskop bieten sie deshalb einen überwältigenden Anblick. Da sie aber
viel weiter entfernt sind als viele offene Sternhaufen, sind sie mit kleinen Teleskopen nur
schwer in Einzelsterne auflösbar. Erst ab etwa 15 cm Teleskopöffnung sind sie diesbezüglich
kein Problem mehr. Kugelsternhaufen sind in ihrem Zentrum so dicht, daß sie nicht in
Einzelsterne aufgelöst werden können. Sogar die großen Teleskope sind dabei überfordert.
Wie bei offenen Sternhaufen ist es schwierig zu entscheiden, wo der Haufen aufhört. Wenn
man von niedrigen Vergrößerungen (etwa 50-fach) zu höheren wechselt, wird der
Kugelsternhaufen scheinbar immer größer, da der Kontrast der Mitgliedssterne in den äußeren
Regionen des Clusters gegenüber dem Himmelshintergrund zunimmt und so immer
schwächere Sterne sichtbar werden.
In kleinen Teleskopen sehen Kugelsternhaufen aus wie Kometen, die sich im Anflug auf die
Sonne befinden und noch keinen Schweif entwickelt haben. Kein Wunder also, daß viele von
ihnen in Messiers Liste auftauchen.
Die hellsten Vertreter der Spezies der Kugelsternhaufen, die von unseren Breiten aus sichtbar
sind, sind M 13, M 5 und M 22. Kugelsternhaufen sehen aus wie riesige Bienenschwärme, die
15
kugelförmig um einen Bienenstock schwärmen. Von innen nach außen hat man den Eindruck
als wären viele Sterne wie Perlen auf einem seidenen unsichtbaren Faden aufgefädelt. Das ist
nur eine Täuschung, da das Gehirn versucht, Strukturen in diesem Durcheinander zu finden.
Sterne, offene Sternhaufen und Kugelsternhaufen können auch bei nicht einwandfrei dunklem
Himmel bzw. bei Mondlicht beobachtet werden. Sie zeigen zwar nicht den gewohnten hohen
Kontrast, aber sie sind dennoch eine Alternative.
1.2.6 galaktische und extragalaktische Nebel
Unter Nebel versteht man in der Astronomie alle Arten von Objekten, die etwas verschmiert,
eben nebelhaft aussehen. Dazu gehören Gas- und Staubwolken ebenso wie weit entfernte
Sternensysteme, die nur deshalb nebelhaft aussehen, weil sie so weit entfernt sind und nicht
oder nur sehr schwer in Einzelsterne auflösbar sind.
Nebel sind bei weitem nicht so kontrastreich wie Sterne oder Sternhaufen. Sie erfordern zu
ihrer Beobachtung vor allem einen dunklen Himmel. Bei Mondschein sind Nebel daher nur
sehr eingeschränkt beobachtbar, wenn überhaupt. Auch Straßen- und Hofbeleuchtung sind
tunlichst zu vermeiden. Wegen ihrer geringen Helligkeit sollte man die Dunkeladaptionszeit
des Auges abwarten und erst dann mit der Beobachtung beginnen. Selbst mit
dunkeladaptierten Augen ist ihre Beobachtung nicht einfach. Nur die hellsten Vertreter sind
so zugänglich. Erst das indirekte Schauen eröffnet die Welt der galaktischen und
extragalaktischen Nebel. Plötzlich tritt der Nebel deutlich hervor und Einzelheiten werden
sichtbar. Äußerst lichtschwache Gebilde werden dem Auge zugänglich: abgestoßene
Sternhüllen und riesige von Sternen ionisierte Wolken aus Wasserstoff und komplexen
Molekülen; Sternentstehungsgebiete und Sternenfriedhöfe. Am beeindruckendsten sind aber
die großen extragalaktischen Nebel, die Galaxien. Ihr Licht hat den weitesten Weg zu uns
hinter sich. Kaum vorstellbar, daß es die unglaubliche Strecke geschafft hat.
Nebel beobachtet man am besten mit niedrigen Vergrößerungen. Erst wenn man sich daran
sattgesehen hat, kann man höhere Vergrößerungen wagen. Meist bringen höhere
Vergrößerungen keinen Gewinn. Manchmal aber sind sie sehr erfolgreich anwendbar. Beim
indirekten Schauen gilt die Regel mit der minimalen Austrittspupille bzw. mit der höchsten
Vergrößerung nicht mehr. Sie ging davon aus, daß man durch größere Vergrößerungen das
Auflösungsvermögen des Auges nicht ausnutzt. Beim indirekten Schauen ist das
Auflösungsvermögen des Auges sehr herabgesetzt, weshalb man durchaus höhere
Vergrößerungen verwenden könnte. Trotzdem sind diese nur in Ausnahmefällen wirklich
wertvoll, da man bei fortschreitender Vergrößerung viel schneller an Licht verliert, als man an
Auflösung gewinnt.
Beim indirekten Sehen leidet der Kontrast ein wenig. Deswegen sind kaum Strukturen in den
Nebeln erkennbar. Jedenfalls nicht so viele, wie sie die prächtigen Bilder suggerieren, die in
den diversen Büchern und Magazinen abgedruckt sind.
Noch ein Manko hat das indirekte Schauen. Alles ist farblos. Manchmal hat man auch den
Einruck,daß alles etwas grünlich grau wäre. Das ist natürlich falsch und der Preis für die hohe
Lichtempfindlichkeit, die man beim indirekten Schauen gewinnt.
Wenn man länger indirekt beobachtet, sollte man einmal den visuellen Eindruck mit einem
Foto vergleichen, um zu sehen wie viel man mit dieser Methode erreicht. Man wird
feststellen, daß die schwachen Objekte auf den stundenlang belichteten Bildern durchaus
noch zu beobachten sind. Vorausgesetzt man benutzt dasselbe Instrument wie für das Foto!
Eine gewaltige Leistung, die für das Auge spricht, das in Sekunden das schafft, wozu die
Fotoplatte Stunden braucht.
Galaktische und extragalaktische Nebel sind manchmal recht groß und überdecken einen
großen Teil des Himmels (bis zu einigen Quadratgrad). Wenn man welche hat , dann sollte
man hier Weitwinkelokulare einsetzen. Sie sind prädestiniert für große Sternfelder. Außerdem
16
erleichtern sie das Auffinden der Nebel, die wegen ihrer geringen Helligkeit manchmal nur
schwer zu finden sind.
2 Astrofotografie
mit Brennweiten von 50 und 200 mm
2.1 Einleitung
Die Fotografie ist eine ideale Ergänzung zur visuellen Beobachtung. Es lassen sich bereits mit
einfachen Mitteln beachtliche Ergebnisse erzielen, die die visuelle Beobachtung unterstützen
und besser verstehen helfen.
Im Folgenden soll nur auf die Benützung fotografischer Emulsionen eingegangen werden,
weil sie bereits besonders ausgereift sind und einen hohen Standard, auch in der
Astrofotografie, erreicht haben. Der Benützung von elektronischen Bildverstärkern und
Kameras gehört zweifelsohne die Zukunft. Vor allem die CCD-Kameras sind auf dem Gebiet
der Astrofotografie auf einem Siegeszug. Es wird aber noch einige Zeit dauern bis die
Elektronik den Film verdrängen wird. Vor allem der hohe Preis ist für den Anfänger sehr
abschreckend, weshalb der Einstieg mit der bewährten und preiswerten Fotoemulsion noch
lange vorzuziehen sein wird. Er ist auch der Grund weshalb sich der Autor noch nicht auf die
CCD-Fotografie eingelassen hat. Zudem sind die Ergebnisse, die moderne fotografische
Emulsionen liefern, mit keinen dem Amateur zugänglichen CCD-Kameras zu erreichen. Die
wesentlichen Nachteile der CCD-Kameras sind die zur Zeit noch sehr kleinen
Aufnahmeformate, die äußerst geringe Dynamik, die großen Schwierigkeiten bei der
Farbfotografie, die meist nur mit aufwendigen Tricks möglich ist, sowie die fehlende
Möglichkeit einer hochwertigen Bildausgabe (vergleichbar mit einem Fotoabzug) zu
erschwinglichen Preisen.
Aber es gibt ja noch die fotografische Schicht, die auf Silberhalogenidkristallen basiert und
schon seit über 150 Jahren in Gebrauch ist. Sie hat gegenüber der visuellen Beobachtung
wesentliche Vorteile:
- Sie erstellt ein objektives Zeitdokument.
- Sie kann Lichtquanten über lange Zeiträume sammeln und so Objekte darstellen, die das
Auge trotz seiner höheren Empfindlichkeit nicht mehr wahrnehmen kann.
- Sie kann Spektralbereiche wahrnehmen, für die das Auge nicht mehr empfänglich ist (z.B.
Infrarot).
Eine fotografische Aufnahme erstellt ein bleibendes Dokument eines Objekts oder einer
Himmelsregion und kann, sofern alle wichtigen Aufnahmedaten registriert und archiviert
sind, auch Jahre oder Jahrzehnte später zu einem Vergleich oder einer Auswertung
herangezogen werden.
Fotografische Emulsionen sind nicht so empfindlich wie das Auge, dennoch lassen sich mit
entsprechend langen Belichtungszeiten schwache, ja schwächste Objekte nachweisen. Man
kann mit der fotografischen Schicht also tief in den Weltraum vordringen. Wesentlich tiefer
als mit dem Auge. Bereits mit einem Normalobjektiv sind viele Objekte in der Milchstraße
erreichbar, sofern sie nur eine große Fläche am Himmel einnehmen. Ihre Helligkeit kann
dabei so gering sein, daß nur wenige Photonen pro Sekunde auf den Film auftreffen. Es lassen
sich Galaxien nachweisen, die etwa 3 Millionen Lichtjahre von uns entfernt sind, die also ihr
Licht aussandten als es noch keinen Menschen auf der Erde gab.
17
Zudem lassen sich Farben und Formen erst auf einem Bild erkennen. Mit dem Auge ist es
schon schwierig, die Farben der Sterne zu erkennen, geschweige denn die Farben der anderen
lichtschwachen Objekte des nächtlichen Himmels.
Für den Anfang ist das größte Hindernis für einen Astrofotografen die Rotation der Erde. Sie
verursacht nicht nur, daß Sonne und Mond jeden Tag scheinbar auf- und untergehen, auch
alle Sterne und alle nonstellaren Objekte vollführen einen Bogen am Himmel. Für die langen
Belichtungszeiten in der Astrofotografie ist diese Bewegung einfach zu schnell und muß
kompensiert werden. In den folgenden Kapiteln soll eine sehr einfache, für den Einstieg gut
geeignete Methode dafür vorgestellt werden.
2.2 Minimalausrüstung
Eine normale Kleinbildkamera, wie sie fast jeder zuhause hat, kann, wenn sie eine
Dauerbelichtung gestattet, mit ein wenig zusätzlicher Ausrüstung für die Astrofotografie
verwendet werden. Es muß nicht unbedingt eine Spiegelreflexkamera sein, Sucherkameras
sind genauso geeignet. Leider ist nicht jede Kamera dafür geeignet. Die Kamera muß über
eine Beliebig-Einstellung (B-,T- oder bulb-Einstellung) verfügen, an ein Stativ anschließbar
sein und einen Drahtauslöser- oder einen Fernauslöseranschluß besitzen.
Des weiteren wird ein Drahtauslöser (bzw. Fernauslöser), ein Stativ, ein Objektiv (falls
keines an der Kamera befestigt ist), ein empfindlicher Schwarzweiß- oder Farbfilm (200 1600 ASA), eine Taschenlampe, eine Sternkarte, Bleistift und Notizblock und ein günstiger
Standort mit klarer mondloser Nacht, der möglichst keinen Autoverkehr in der Nähe aufweist,
benötigt.
Abb. 2.1: Schütze über dem Görtschitztal, 20 s, Bl 1.2, Kodak Panther 1600
Mit einem Normalobjektiv (Brennweite = 50 mm) lassen sich damit bereits die meisten
Sternbilder erfolgreich fotografieren, ohne daß sie zu Strichspuren infolge der Erdrotation
verwischt werden, solange man die Belichtungszeit unter 15 Sekunden läßt und die größte
Blende des Objektivs groß genug ist (Bl. 2 sollte ausreichen). Man befestigt die Kamera
einfach auf dem Stativ, damit sie nicht verwackeln kann, stellt die Schärfe manuell auf
18
unendlich, die Blende auf ihren höchsten Wert (Bl. 2 ist höher als Bl 16 !), richtet die Kamera
auf den gewünschten Himmelsausschnitt und drückt den Auslöser. Nach etwa 15 Sekunden
löst man ihn und das Bild ist im Kasten sofern man nicht verwackelt hat.
Es ist ratsam seine ersten Erfahrungen mit der Astrofotorafie auf diese Art zu machen. Man
lernt dabei auch jene Aspekte kennen, die nicht durch Worte vermittelt werden können.
Belichtet man länger als besagte 15 Sekunden, so bemerkt man eine scheinbare Bewegung der
Sterne in Kreisbögen. Macht man genügend Fotos so erkannt man, daß sie sich scheinbar um
den Polarstern drehen. Genauer gesagt drehen sie sich um den Himmelsnordpol, in dessen
Nähe sich der Polarstern befindet. Es ist die 24-stündige Erdrotation um die eigene Achse, die
diese scheinbare Bewegung verursacht. Denkt man sich die Erdachse ins Unendliche
verlängert, so durchstößt sie den Himmelsnordpol und den Himmelssüdpol, der von Europa
aus nicht zu sehen ist, da der dicke Bauch der Erde ihn verdeckt. Einmal in 24 Stunden
beschreiben die Sterne einen vollen Kreis. Er ist am größten, wenn der Stern auf dem
Himmelsäquator steht, man sagt auch der Stern hat 0° Deklination. Je näher der Stern dem
Himmelsnordpol ist, desto kleiner ist der von ihm gezogene Kreis und desto größer ist seine
Deklination. Am Himmlesnordpol erreicht sie schließlich 90°. In Richtung Himmelssüdpol
zählt man die Deklination negativ. Je näher das Sternbild, das man fotografieren will, dem
Himmelspol ist, desto länger kann man belichten ohne daß man Strichspuren bekommt. Die
folgende Tabelle gibt die maximale Zeit an, die man belichten kann, damit die Sternbilder
nicht zu Strichspuren werden, sondern exakte Punkte bleiben, wenn man mit einem 50 mm Normalobjektiv - fotografiert:
Deklination
max. Belichtungszeit
0°
7s
15°
7s
30°
8s
45°
10 s
60°
14 s
75°
26 s
90°
-
Möchte man vermeiden, daß die Erdrotation die Sternbilder bei längeren Belichtungszeiten zu
Strichspuren verwischt, so muß man die Erdrotation irgendwie ausgleichen. Eine einfache
Möglichkeit bietet die Klappmontierung, die auch Schottische Montierung genannt wird (weil
sie sehr günstig selbst hergestellt werden kann).
2.3 Die schottische Montierung
Ihr Prinzip ist denkbar einfach: Mit ihr dreht man die Kamera um eine der Erdachse parallele
Achse mit der genau gleichen Winkelgeschwindigkeit aber in die andere Richtung. Die
Kamera ist damit in einem Bezugssystem, in dem die Sterne scheinbar stillstehen.
19
Die Konstruktion ist sehr einfach, denn es werden einige Näherungen gemacht: So wird die
Kreisbewegung durch einen Tangentialarm angenähert, die Drehachse ist ein einfaches
Scharnier, der Tangentialantrieb wird per Hand bewerkstelligt und die Parallelstellung der
Scharnierachse zur Erdachse ist eher eine Schätzarbeit.
Dennoch lassen sich mit dieser Montierung schon recht beeindruckende Bilder des
Sternenhimmels gewinnen - zumindest im Vergleich zur nicht nachgeführten Kamera.
Die wesentlichen Bestandteile der Montierung sind zwei Holzbretter, die über ein Scharnier
miteinander verbunden sind.
Die Kamera wird so auf dem oberen Brett montiert, daß sie auf jede Stelle des Himmels
geschwenkt werden kann und trotzdem eine gewisse Stabilität aufweist. Die beiden Bretter
sind über ein Scharnier auf ihrer Schmalseite miteinander verbunden, so daß sich das obere
Brett in einer Kreisbewegung um die Scharnierachse drehen kann. Im Einsatz zeigt die
Scharnierachse dann auf den Himmelspol. Das untere Brett soll möglichst stabil irgendwo so
befestigt werden können, daß die Scharnierachse auf den Himmlespol zeigt. Eine
Gewindestange (oder lange Schraube) drückt über das untere Brett (Grundbrett) auf das obere
(bewegliches Brett) und zwingt dieses über das Scharnier in eine Kreisbewegung
(Tangentialantrieb). Zum Gegendruck und zur Stabilisierung werden ein oder mehrere starke
Gummibänder über die Bretter gezogen, damit diese zusammengehalten werden und nicht
etwa durch das Gewicht der Kamera auseinanderfallen. Die geometrischen Ausmaße werden
dabei genau so gewählt, daß bei gleichmäßiger Drehung der Gewindestange
(Nachführschraube) die Kamera von der Erdrotation befreit wird, und das innerhalb der
erforderlichen Genauigkeit.
2.3.1 Bauanleitung
Es gibt die Klappmontierung in vielen verschiedenen Varianten, wie man sie immer wieder in
Abb. 2.2: Die schottische Montierung (aus P. Seymor, Astronomie ganz einfach)
20
den diversen Amateurzeitschriften findet. Manche davon sind schon recht professionell und
man braucht schon einige Erfahrung, um sie nachzubauen. Eine recht einfache Bauanleitung
gibt Percy Seymour [Astronomie ganz einfach, Verlag Franckh Kosmos 1985], nach der ich
mich im folgenden halten werde. Sie ist obgleich ihrer Einfachheit ein Präzisionsinstrument
obwohl keine besonderen Fähigkeiten für ihren erfolgreichen Nachbau erforderlich sind. Die
Materialliste ist etwas umfangreich.
Gebraucht werden:
2 Sperrholzbretter, 270 x 130 x 9 mm (Es muß nicht unbedingt Sperrholz sein, aber
es verzieht sich weniger bei Feuchtigkeit, deswegen ist Hartholz als
Alternative zu bevorzugen.)
1 Holzblock, 380 x 90 x 50 mm (Polblock)
1 Holzleiste, 170 x 35 x 25 mm (Kameraarm)
2 Flacheisen, 40 x 15 x 2 mm
1 Flacheisen, 50 x 15 x 2 mm (Antriebsmarkierung)
1 Winkeleisen, etwa 80 x 20 x 3 mm (für die Kamerabefestigung)
1 Scharnier, etwa 100 mm lang
1 M-6 Schraube 100 mm lang, 1mm Steigung (Nachführschraube)
1 Schraube zur Kamerabefestigung etwa 50 mm lang mit Mutter und Flügelmutter,
bei den meisten Kameras ein ¼ " UNC-Gewinde (20 Gänge pro inch)
3 M-6 Sechskantmuttern
4 Senkkopfschrauben zur Scharnierbefestigung (M 4.5 oder M 5) mit Muttern
4 Holzschrauben 10 x 6 mm
2 Holzschrauben 20 x 8 mm
1 oder mehrere Gummibänder
Werkstattausrüstung zum Zuschneiden und Bohren der Einzelstücke und zum
Zusammenschrauben der vorgefertigten Teile (siehe z.B.: [2])
2.3.2 Schritt für Schritt Anleitung
1 Den Polblock schräg zusägen, so daß der Winkel ϕ gleich der geographischen Breite des
Beobachtungsorts ist (Abb. 2.3).
2 In das Grundbrett entlang der Mittellinie, jeweils 30 mm vom Rand entfernt, zwei Löcher
mit 8 mm Durchmesser bohren (Abb. 2.4). Sie dienen zur Montage auf dem Polblock.
3 Das Scharnier an der Schmalseite des Grundbrettes so befestigen, daß es gut mit der
Schmalseite fluchtet (Abb. 2.5). Hierzu sind die M-4.5 Senkkopfschrauben gedacht, die an
der Rückseite mit den Muttern festgezogen werden.
4 Der heikelste Teil ist das Anbringen der Antriebsspindel und ihrer Verankerung. Dazu auf
dem Grundbrett 30 mm vom oberen Rand und genau 229 mm vom der Mitte der
Scharnierachse gemessen ein 6 mm Loch bohren (Abb 2.6).
21
Seymour seite 60 unten
5 Über dieser Bohrung nun sehr genau mit einem Hammer eine M-6 Sechskantmutter so weit
in das Holz treiben, daß ihre Oberkante mit dem Brett abschließt. Dabei darauf achten, daß
der Mittelpunkt der Sechskantmutter von der Scharnierachse obige 229 mm genau einhält.
6 In die beiden 40 x 15 mm Flacheisen jeweils zwei 6.5 mm Löcher bohren (für die 6 mm
Senkkopfschrauben). In eines der
beiden Flacheisen genau in der
Mitte ein weiteres Loch mit etwa 7
seymour abb. 21.10 b
mm Durchmesser bohren.
7 Das letztere Flacheisen mit dem
Mittelloch genau über der in das
Holz getriebenen M-6 Mutter auf
das Grundbrett schrauben (hierzu
sind die 10 mm Holzschrauben;
Abb. 2.7).
8 Das bewegliche Brett symmetrisch
zum Grundbrett an das Scharnier
befestigen (mit den M4.5
Abb. 2.7
Schrauben; Abb. 2.8).
9 Das zweite 40x15 mm Flacheisen genau symmetrisch zur 6 mm Bohrung auf dem
Grundbrett auf dem beweglichen Brett anbringen. Am besten die beiden Bretter
zusammenklappen und dann anreißen. Dieses Flacheisen dient als Widerlager zum
Spindelantrieb. Zur Verbesserung der Stabilität sollte man genau in der Mitte eine starke
Körnung - also eine Vertiefung - anbringen. (Abb. 2.9)
22
seymour abb.21. 11-13
10 Für die Kamerabefestigung in einen Arm des Winkeleisens zwei Löcher bohren. Sie
werden so angebracht, daß die Schrauben für das Scharnier genau durchpassen. Am anderen
Ende des Winkeleisens ein 6.5 mm Loch bohren. Dieses Winkeleisen dann zusammen mit
dem Scharnier auf das bewegliche Brett schrauben. (Abb. 2.10 und 2.11)
abb.21.14
Abb. 2.11
11 Das 50 x 15 mm Flacheisen zu einem Zeiger zufeilen und am unteren Ende ein 6.5 mm
Loch bohren. Die Nachführschraube wird nun am Gewindeanfang spitz zugeschliffen, so
daß an der Spitze ein kleines (etwa 1 mm Durchmesser) kugelförmiges Lager entsteht. Das
Flacheisen nun auf die Schraube schieben und mit der Mutter festziehen. Dann die
Nachführschraube in die in das Grundbrett getriebene Mutter drehen, so daß sie deutlich auf
der anderen Seite herausragt. (Abb. 2. 12)
12 Das Grundbrett nun auf das abgeschrägte Schmalende des Polblocks schrauben. Es soll mit
der Achse des Polblocks einen exakten rechten Winkel bilden - damit die Scharnierachse
dann auch wirklich auf den Himmelspol zeigt (Abb. 2.13).
13 An den Enden der Holzleiste (170 x 35 x 25) zwei senkrecht zueinander verlaufende
Bohrungen mit einem Durchmesser von 6.5 mm bohren.
23
abb 21.15 und 21.16
14 Durch eine der beiden obigen Bohrungen wird die Leiste mit dem Winkeleisen auf dem
beweglichen Brett verbunden. Durch die andere Bohrung wird die Schraube zur
Kamerabefestigung getragen. Beide Schrauben werden mit Flügelmuttern fixiert.
15 Die beiden Bretter werden nun soweit zusammengeklappt, bis die Nachführschraube in die
Vertiefung des Flacheisens drückt. Das Gummiband um die beiden Bretter spannen, so daß
diese ständig in Kontakt bleiben.
16 Zuletzt die Nachführschraube an der Spitze und an der Mutter mit einem dicken Fett
schmieren, damit sie weich und geschmeidig läuft.
17 Nach einem erfolgreichen Test kann man daran denken, die Konstruktion mit einem
Holzschutzmittel oder einem Lack zu konservieren und so gegen die hohe Feuchtigkeit in
den eingesetzten Nächten zu schützen.
2.3.3 Der erste Einsatz
In einer klaren mondlosen Nacht kann die neue Montierung zum ersten Mal zeigen, was sie
zu leisten imstande ist. Erst sucht man sich einen Standort, der eine gute Rundumsicht bietet,
die nicht von Bäumen oder Häusern gestört ist. Der Polblock muß nun gut fixiert werden
können. Am besten man klemmt ihn mit einer Schraubzwinge auf einem kleinen aber stabilen
Tisch fest. Dabei muß die Längsachse des Polblocks genau in Nord- Süd Richtung verlaufen.
Man kann die Ausrichtung mit einem Kompaß vornehmen, oder man versucht den Polarstern
über die Scharnierachse anzuvisieren. Die Scharnierseite weist dabei nach Süden, so daß das
Scharnier auf den Himmelspol zeigt. Die Nachführschraube so weit zurückdrehen, daß das
24
Gummiband noch genügend spannt. Nun kann man daran gehen, die Kamera auf den
gewünschten Himmelsausschnitt auszurichten, indem man die Flügelmuttern lockert und dann
wieder gut festzieht. Den Verschluß spannen, darauf achten, daß der Objektivdeckel
abgenommen ist, die Entfernung auf unendlich, die Belichtungszeit auf beliebig gestellt und
die Blende offen ist. Den Drahtauslöser anbringen und den Zeiger der Nachführschraube auf
12 Uhr stellen. Mit einer abgeblendeten Taschenlampe den Sekundenzeiger der Armbanduhr
verfolgen und bei der nächsten vollen Minute den Auslöser drücken, so daß der Verschluß
offenbleibt. Dann die Nachführschraube synchron mit dem Sekundenzeiger der Uhr drehen.
Nach etwa fünf Minuten den Verschluß wieder schließen. Das erste Fotoobjekt sollte man
mit weiteren Aufnahmen mit kleineren Blenden und verschiedenen Belichtungszeiten
ergänzen. Sie lassen etwaige Fehler besser eingrenzen.
2.3.4 Leistungsvermögen und Grenzen
Das Leistungsvermögen einer Astromontierung wird im wesentlichen durch drei Kenngrößen
bestimmt: die maximale Kamera- oder Instrumentenlast, die maximale sinnvolle
Belichtungszeit und die maximale verwendbare Brennweite.
Die maximale Kameralast wird bei der schottischen Montierung vor allem durch das
Scharnier bestimmt und dürfte bei etwa 2 kg liegen.
Die maximale Brennweite und die maximale Belichtungszeit sind miteinander verwoben. Wie
schon bei der nicht nachgeführten Kamera kann man bei kleinerer Brennweite wesentlich
länger belichten, weil sich Fehler viel weniger auswirken.
Welche Fehler treten nun bei der schottischen Montierung auf ?
Da ist einmal der Fehler in der Kontinuität der Nachführbewegung, der vom Bediener
abhängt. Er dürfte im kleinsten Fall bei etwa 3 Sekunden oder 18 ° liegen. Das limitiert die
maximal verwendbare Brennweite auf maximal 200 mm. Über längere Zeit ist ein so kleiner
Kontinuitätsfehler aber nicht leicht zu halten.
α
Abb. 2.14: Geometrische Verhältnisse der schottischen Montierung
Der Fehler, der durch die Annäherung der Kreisbewegung durch den Tangentialantrieb
gemacht wird, errechnet sich aus den geometrischen Verhältnissen:
25
Den Zusammenhang zwischen dem Winkel
α und den drei Längen L, R und R'
erhält man aus dem Kosinussatz: cosα (t ) =
R 2 + R '2 − L( t ) 2
2 R R'
R 2 + R ' 2 − L( t ) 2
Der Winkelfehler wird nun zu : F (t ) = ω (t ) − α (t ) = ω t − arccos
2 R R'
2π
und L(t) die
1436 min
Vorschublängenänderung der Nachführschraube ist, die sich aus der konstanten
Vorschubgeschwindigkeit v zu L(t ) = v t ergibt. Im Fall einer M-6 Schraube - wie sie in
obiger Bauanleitung verwendet wurde - mit einer genormten Steigung von 1 mm ist
mm
1
Setzt man R = R' = = 228.5 mm , so drückt die Nachführschraube im ersten
v =1
ω
min
Moment normal auf das bewegliche Brett und später in immer steilerem Winkel. Dadurch
wächst der Fehler immer mehr an, weil die dadurch erreichte Winkel-geschwindigkeit immer
größer wird.
Wie groß ist nun
Winkelfehler
der maximal
Nachführzeit erträgliche
10
20
30
40
50
60
Winkelfehler?
-0.0001
Ist der
-0.0002
verwendete Film
von durch-0.0003
schnittlichem
-0.0004
Auflösungsvermögen, so
-0.0005
wird ein Fehler
-0.0006
von 0.03 mm
-0.0007
verziehen.
Daraus ergibt
sich der
Abb. 2. 15: Nachführfehler in rad (ideale Verhältnisse)
Winkelfehler zu:
0.03
Also ist für ein Normalobjektiv mit 50 mm Brennweite:
∆ϕ = arctan
f Objektiv
∆ϕ max = 0.0006 rad .
Nach obiger Graphik ist dann die erlaubte maximale Nachführzeit immerhin etwa 50 min.
Das ist ausreichend, um selbst bei dunkelstem Himmel den Himmelshintergrund (Streulicht
aus der Hochatmosphäre) auf Film zu bannen.
Es fällt auf, daß der Fehler immer negativ ist, was bedeutet, daß die Winkelgeschwindigkeit
der Nachführung zu groß ist.
Dies sind die idealen Verhältnisse, die beim Bau der Montierung verständlicherweise nicht
erreicht werden können.
wobei ω die konstante Winkelgeschwindigkeit der Erde
26
Winkelfehler
10
20
30
40
50
60
Nachführzeit
-0.0005
-0.001
-0.0015
Abb. 2.16:
Bei einer Ungenauigkeit von nur einem Millimeter hat sich das Fehlerverhalten bereits deutlich verschlechtert.
(In diesem Fall sind R und R' zu kurz)
Überlegt man sich, daß man beim Bau der Nachführung kleine Fehler gemacht hat, also
eventuell die 228.5 mm nicht genau eingehalten hat, sondern vielleicht einen Millimeter zu
kurz erwischt hat, so sieht der Fehler bereits ganz anders aus. Man erreicht den maximalen
Winkelfehler bereits nach nur 20 Minuten.
Interessanterweise verbessern sich die Verhältnisse, wenn der Fehler in der Länge positiv ist,
also die beiden Radien R und R' etwas zu lang ausgefallen sind. In diesem Fall ist die
Nachführung anfangs in der Winkelgeschwindigkeit langsamer als die Erde und wird mit
steigendem Winkel α erst schneller und überholt die Winkelgeschwindigkeit der Erde sogar,
wenn der Fehler nicht zu groß war.
Winkelfehler
0.0005
0.0004
0.0003
0.0002
0.0001
10
20
30
40
50
60
Nachführzeit
Abb. 2.17: R und R' um
1 mm zu lang
Die Nachführung bleibt während der ganzen 60 Minuten innerhalb der Toleranz für ein 50
mm Objektiv. Es ist also wesentlich besser, die beiden Radien R und R' einen halben oder
einen ganzen Millimeter länger auszuführen.
Der Umkehrpunkt wird dort erreicht, wo die Nachführschraube tangential auf den gedachten
Kreisbogen liegt, den das bewegliche Brett vollführen würde, wenn es mit dem exakten Maß
versehen wäre. Gibt man also einen gewissen Vorlauf, bis kurz vor diesem Punkt, sagen wir 5
Minuten, so wird die Nachführung in den folgenden 10 Minuten, in denen sie über den
Umkehrpunkt läuft, sehr präzise funktionieren.
27
Man kann diesen Punkt auch errechnen, wenn man die obige Fehlerfunktion ableitet und Null
2
setzt. Man erhält: t u =
(r ω − v ) (r ω + v )
vω
Ähnliche Verhältnisse erreicht man, wenn man nur einen Arm - z. B. das Grundbrett, also R' absichtlich so verlängert, daß der Stoß der Nachführschraube erst ab einem gewissen Winkel,
1
sagen wir α 0 = 20° , tangential verläuft (Verlängerungsfaktor
). Im Gegensatz zum
cos α 0
obigen Fall ist hier die Steigung des Fehlers aber immer negativ, da die Nachführschraube vor
dem Wendepunkt immer zu flach und danach immer zu steil auf das bewegliche Brett, das
nun aber im richtigen Radius ausgeführt ist, stößt,
d. h. die erreichte Winkelgeschwindigkeit ist immer zu hoch.
Legt man die
Winkelfehler
Belichtung
gerade in diesen
Bereich erhält
0.0001
man wiederum
für eine lange
Zeit eine sehr
0.00005
präzise
Nachführung
Nachführzeit
(Abb.: 2. 18).
-20
-10
10
20
Kombiniert man
beide Fälle und
-0.00005
verlängert das
untere Brett nicht
-0.0001
nur um den
1
Abb. 2.18: Grundbrett (R') um 1/cos( α 0 = 20° ) verlängert
Faktor
cos α 0
sondern noch zusätzlich das bewegliche Brett um ein kleines Stück, z. B. 0.3 mm, so ergeben
sich die Verhältnisse in Abb.: 2.19:
In diesem Fall
Winkelfehler
bleibt der
0.00015
Nachführfehler
über einen
Zeitraum von
0.0001
mehr als 40 min
kleiner als 0.0001
0.00005
rad, was bedeutet,
Nachführzeit daß ein 200 mm
-20
-10
10
20
30
Teleobjektiv über
diesen Zeitraum
-0.00005
gut nachgeführt
werden könnte.
-0.0001
Leider ist es nicht
leicht jenen Punkt
herauszufinden, in
Abb. 2.19: R' um 1/cos( α 0 = 20° ) + 0.3 mm verlängert
dem die Steigung
der Fehlerkurve
verschwindet. In der Praxis sind obige Werte leider beinahe unerreichbar.
28
Vor allem weil noch andere Fehler sich aufaddieren und die maximale Nachführzeit erheblich
verkürzen. So ist die Befestigung der Antriebsspindel durch eine in das Holz getriebene
Mutter wegen ihrer geringen Maßhaltigkeit ein Problem u. s. w..
2.3.5 Fehler durch eine schlecht ausgerichtete Polachse (Scharnier)
Das größte Problem der Schottischen Montierung ist ihre genaue Aufstellung. Die Forderung
wäre, daß die Scharnierachse exakt auf den Himmelspol gerichtet wird. Im Einsatz peilt man
meist über das Scharnier den Polarstern an. Dadurch hat man alleine durch die Abweichung
des Polarsterns vom Himmelspol einen Fehler von mehr als einem halben Grad. Wenn man
noch berücksichtigt, daß man die Peilung im Dunkeln mit einer relativ kurzen Scharnierachse
durchführt, so ist anzunehmen, daß der dabei gemachte Fehler etwa ein Grad betragen wird.
Wie groß ist nun der dadurch verursachte Winkelfehler während einer Belichtung? Die
Verhältnisse sind nicht ganz einfach. Man nimmt zunächst an, die Richtung des
Himmelsnordpols wäre die z-Richtung in einem kartesischen Koordinatensystem. Die
Scharnierachse sei gegen den Himmelspol um den Winkel γ geneigt, und sei dabei, ohne
Einschränkung, in der y-z-Ebene. Die Winkel zwischen zwei weit entfernten Sternen
verhalten sich wie die entsprechenden Kreisbögen auf der Einheitskugel.
Wir betrachten nun einen beliebigen Punkt P auf der Einheitskugel, der eine gewisse Zeit t
mit einer konstanten Winkelgeschwindigkeit ω um die z-Achse gedreht wird und vergleichen
seine Endposition P' mit der Endposition P'' für den Fall, in dem er um die Scharnierachse
(N') in der gleichen Zeit t mit der gleichen Winkelgschwindigkeit ω gelangt (Abb.:2.20).
Der Punkt P entspricht dabei einem beliebigen Stern, der infolge der Erdrotation scheinbar
um den Himmelspol kreist. Der Kreisbogen von P nach P' entspricht also der scheinbaren
Bahn des Sterns am Himmel. Eine falsch ausgerichtete Montierung dreht einen Bildpunkt
während der gleichen Zeit von P nach P'', der von P' abweicht.
Der Winkel zwischen P' und P'' ist dann der Winkelfehler, der von der falschen Ausrichtung
der Scharnierachse herrührt. Es gilt:
cos(ω t ) sin(ω t ) 0
sin(ϑ ) cos(ϕ )
v
v
v
P ′ = − sin(ω t ) cos(ω t ) 0 P; wobei: P = sin(ϑ ) sin(ϕ ) gesetzt wird und der
0
0
1
cos(ϑ )
v
v
Ortsvektor von P ist. Ebenso sind P ′ und P ′′ die Ortsvektoren von P' und P''.
Die Position des Punktes P (bzw. eines Sterns) wird durch zwei Winkel ( ϕ und ϑ )
angegeben.
v
Die Berechnung von P ′′ verläuft etwas komplizierter: Die Drehung um die N'-Achse kann
man auf die Drehung um die z-Achse zurückführen, wenn man die N'-Achse in die z-Achse
v
dreht und dann wieder rückgängig macht. P ′′ ergibt sich dann als Bild von drei
v
v
hintereinander ausgeführten Abbildungen: P ′′ = D1−1 o D3 o D1 P wobei:
(
)
0
0
1
D1 = 0 cos(γ ) sin(γ ) die N'-Achse in die N-Achse überführt und
0 − sin(γ ) cos(γ )
cos(ω t ) sin(ω t ) 0
D3 = − sin(ω t ) cos(ω t ) 0 die Drehung vornimmt.
0
0
1
29
γ
ϑ
ϕ
Abb 2.20: Eine falsch ausgerichtete Montierung verschiebt einen Stern von P' nach P''
r v
Der Kosinus des Fehlerwinkels σ ist dann: cos(σ ) = P ′ ⋅ P ′′ ;
r v
Also ist der Fehlerwinkel σ = arccos( P ′ ⋅ P ′′)
Wie leicht zu vermuten ist, ist der Winkelfehler von der Position des Punktes P bzw. von der
Position des Sterns abhängig. Da natürlich im Einsatz die Scharnierachse nicht in der y-zEbene liegt, sondern ihre Position zur Nordrichtung unbekannt ist, kann die Abhängigkeit in
ϕ nicht berücksichtigt werden. Die Abhängigkeit vom Winkel ϑ ist - wie folgendes
Beispiel zeigt - nicht sehr groß.
30
.
Abb 2.21: P'' geht aus P als Bild dreier Drehungen hervor
Bsp.: Angenommen der Ausrichtungsfehler γ des Scharniers beträgt 1° und die
Belichtungszeit t = 10 Minuten. Den Fehlerwinkel σ in Abhängigkeit von den beiden
Winkeln ϕ und ϑ zeigt folgende Grafik:
σ
ϕ
ϑ
Abb 2.22: Fehlerwinkel in Abhängigkeit von der Sternposition bei 10 Minuten Belichtungszeit
und einem Ausrichtungsfehler von 1° (Alle Winkel in rad).
31
Man erkennt, daß der maximale Fehlerwinkel eines Sterns nahe dem Äquator beinahe gleich
groß ist als der eines Sterns nahe dem Pol. Ferner überschreitet der Fehlerwinkel bereits die
erlaubten 0.0006 rad für ein Normalobjektiv, so daß man bei einer 10 minütigen
Belichtungszeit keine Punktabbildungen mehr erwarten kann. Es ist also erforderlich, die
Montierung genauer auszurichten.
Ein genaueres Ausrichten der Montierung ist meist mit erheblichen Umständen verbunden,
weshalb man dazu übergehen wird, eine kürzere Belichtungszeit zu verwenden, vor allem,
weil sich zum obigen Fehler durch die schlecht ausgerichtete Scharnierachse die anderen
Fehler hinzuaddieren.
Um dem Justierfehler zu begegnen, kann man einen kleinen Polsucher auf das bewegliche
Brett anbringen. Ein Polsucher ist ein kleines, sehr billiges Sucherfernrohr mit etwa 4-6
facher Vergrößerung und einem Fadenkreuz. Diesen Sucher justiert man so, daß ein
angepeiltes Objekt beim Aufklappen der Montierung immer genau im Fadenkreuz bleibt.
Wenn man das erreicht hat ist der Polsucher zur Scharnierachse parallel (Taumeltest). Es
reicht nun aber nicht mit dem Polsucher den Polarstern anzuvisieren, sondern man muß den
Abstand des Polarsterns vom Himmelspol beachten. Dazu kann man beispielsweise
folgendermaßen vorgehen: Man bringt auf das Fadenkreuz des Polsuchers eine Markierung
an, die rund 50 Bogenminuten entspricht (das ist etwa der Abstand des Polarsterns vom
Himmelspol). Gute im Handel erhältliche Polsucher haben diese Markierung bereits. Dann
sucht man auf einer Sternkarte die Position des Polarsterns relativ zum Himmelsnordpol und
visiert mit dem verbesserten Polsucher den Himmelspol an. Damit ist es möglich, die
Montierung auf mindestens 10 Bogenminuten genau auszurichten. Das bedeutet, daß der
Ausrichtungsfehler keine Rolle mehr spielt!
2.3.6 Verbesserungen, Tips und Tricks
Die schottische Montierung wie sie oben beschrieben ist, ist relativ einfach zu verbessern.
Wesentliche Kritikpunkte sind: Die in das Holz getriebene Mutter, die sich unregelmäßig
bewegt und dadurch Fehler verursachen kann, die relativ umständliche Aufstellungsart und
die filigrane Kamerabefestigung.
Tip 1: Eine Möglichkeit, die in das Holz getriebene Mutter zu vermeiden, ist die Mutter
zwischen Spitzen zu lagern. Dazu bohrt man die Sechskantmutter auf zwei
gegenüberliegenden Flächen möglichst symmetrisch an - nur etwa 1 mm. Als Spitzen können
zum Beispiel zwei spitze Madenschrauben dienen, die in einer Metallgabel befestigt werden,
indem man einfach zwei genau gegenüberliegende Gewinde hineinschneidet und die
Madenschrauben hineindreht. Wenn man diese Vorrichtung mit ein wenig Hochdruckfett
versorgt, gelangt man so relativ einfach zu einer sehr genauen und leichtgängigen Lagerung.
Diese muß man dann entsprechend auf das bewegliche Brett montieren (vgl. Abb 2.23)
Der Abstand zwischen dem Muttermittelpunkt zum Scharnier muß die bekannten 229 mm
betragen oder je nach Vorlaufwinkel etwas größer sein.
Tip 2: Der relativ umständlichen Aufstellung mit dem Polblock kann man dadurch begegnen,
indem man das Grundbrett nicht auf einen Polblock, sondern direkt auf ein Fotostativ mit
einem neigbaren Stativkopf befestigt. In Abb 2.23 wurde dazu auf das Grundbrett eine
Metallplatte geschraubt, die ein Stativgewinde enthält. In diesem Fall wurde es vom Autor
geschnitten, bestimmt hilft aber der Fotohandel weiter. Die Aufstellung geschieht dann
einfach dadurch, daß man die Scharnierachse mit dem Stativkopf auf den Himmelspol
schwenkt. Es ist darauf zu achten, daß die Verbindung eine hohe Steifigkeit aufweist und
nicht wackeln kann.
Tip 3: Die etwas filigrane Kamerabefestigung reicht zwar für leichte Kameras ohne weiteres
aus, wenn man etwas stabileres bevorzugt, kann man einen Kugelkopf oder einen leichten
Stativkopf (Abb 2.24) auf dem beweglichen Brett befestigen. Das erleichtert die
32
Kameraausrichtung und verbessert die Steifigkeit. Das höhere Gewicht trägt dabei durchaus
zur Schwingungsreduzierung bei.
Abb 2.23: modifizierte schottische Montierung mit Spitzenlagerung
Um herauszufinden ob die oben angestellten Betrachtungen über das Leistungsvermögen der
Montierung zutreffen, muß man sie einfach ausprobieren und dabei verschiedene
Belichtungszeiten und Brennweiten verwenden. Auf den erhaltenen Fotos kann man dann mit
Abb 2.24: Ein Stativkopf als Kamerabefestigung als Alternative. Die Scharnierachse zeigt auf den
Himmelspol.
33
einer Lupe erkennen ob die abgebildeten Sterne kleine Kreisscheiben oder in die Länge
gezogen sind. Dabei muß man aber auf die Abbildungsqualität der verwendeten Optik achten,
die nicht immer lupenrein sein muß.
Tip 4: Meist verbessert sich die Abbildungsleistung des verwendeten Objektivs, wenn man es
um ein bis zwei Stufen abblendet. Vor allem bei älteren Objektiven oder bei Billigware
erkennt man einen starken Randabfall sowohl in der Schärfe als auch in der Helligkeit. Der
Helligkeitsabfall wird auch Vignettierung genannt und ist auch bei den besten Objektiven
nicht ganz auszuschalten. Aus rein geometrischen Gründen ist der Durchmesser eines schief
einfallenden Bündels geringer als ein auf der optischen Achse einfallendes, da die
Objektivöffnung, oder besser die Blende des Objektivs, von einem schiefen Winkel betrachtet
nicht mehr als Kreis sondern als Ellipse erscheint, deren große Halbachse der
Kreisdurchmesser ist. Die Ellipsenfläche ist daher kleiner und läßt weniger Licht passieren.
Dieser Randhelligkeitsabfall wird als natürliche Vignettierung bezeichnet und ändert sich mit
der vierten Potenz des Kosinus des Einfallswinkels. Die natürliche Vignettierung ist kein
Abbildungsfehler sondern rein geometrisch bedingt. Sichtbar störend wird sie nur bei
Weitwinkelobjektiven, wenn die Brennweite weniger als 24 mm beträgt. Viel schlimmer
wirkt sich hingegen die künstliche Vignettierung aus, die entsteht, wenn ein Objektiv aus
mehreren Linsen aufgebaut ist, was immer der Fall ist. Bedingt durch die Linsenfassungen
wird ein beträchtlicher Teil des schiefen Bündels zusätzlich zur natürlichen Vignettierung
beschnitten. Tip 5: Die künstliche Vignettierung läßt sich durch Abblenden mildern bzw.
sogar ganz beheben.
Der Randabfall in der Schärfe wird durch Abblenden auch meist verbessert, aber nur bis zu
einem gewissen Maß. Ist das Ergebnis trotzdem nicht zufriedenstellend, so ist der Fehler
konstruktionsbedingt und nur durch Auswechseln des Objektivs durch ein besseres zu
beheben.
Hat man mit Objektivfehlern zu kämpfen, so ist es oft nicht möglich die Funktion der
Montierung zu überprüfen, weil man den Fehler nicht zuordnen kann.
Tip 6: Für diesen Fall kann man statt der Kamera ein kleines Teleskop auf der Montierung
befestigen und mit einem Fadenkreuzokular (min 100fache Vergrößerung) einen eingestellten
Stern beobachten und dabei die Montierung bedienen (vgl. Abb. 2.25). Am auffälligsten ist
dabei die unregelmäßige Bewegung der Montierung durch den händischen Antrieb.
Wenn man das Fadenkreuz in Nord-Süd-Richtung ausrichtet, kann man grob zwischen
Antriebsfehler und Aufstellungsfehler unterscheiden. Wandert der Stern nach Norden oder
Süden aus, so ist die Montierung schlecht justiert. Wandert er hingen nach Osten oder Westen
aus, so ist der Antrieb zu schnell bzw. zu langsam. Tip 7: Um ein Gefühl dafür zu bekommen,
wie groß die zulässige Toleranz von 0.006 rad ist, kann man einen Stern am Himmelsäquator
verwenden und die Montierung für 7 Sekunden ruhen lassen. In dieser Zeit hat der Stern den
maximal erlaubten Fehler überstrichen. Er ist relativ klein!
Es fallen auch die zitternden Bewegungen auf, die von der Hand des Bedieners herrühren. So
bekommt man auch ein Gefühl dafür welche Stöße die Montierung im Betrieb bestenfalls
verkraften kann.
Manchmal rühren die Schwingungen auch vom Boden her, von einem vorbeifahrenden Auto
oder von den eigenen Bewegungen.
Mit dem aufgeschnallten Teleskop läßt sich auch eine genauere Einnordung vornehmen, weil
man den Fehler beobachten kann. Hierzu möchte ich nur auf die Scheinermethode verweisen
wie sie zum Beispiel im Handbuch für Astrofotografie von B. Koch im Kapitel 5.2.1
beschrieben ist.
In manchen Nächten kann hohe Luftfeuchtigkeit die Objektive zum Beschlagen bringen.
Dieser Tauniederschlag tritt vorzugsweise an den Frontlinsen von Photoobjektiven auf , wenn
sich diese Flächen bei hoher Luftfeuchtigkeit durch Abstrahlung gegen den kalten Himmel
unter den Taupunkt abkühlen. Die Abkühlung unter die Temperatur der Umgebungsluft ist
34
ein reiner Strahlungseffekt. Wäre dies nicht der Fall, würde dichter Nebel den Beobachter
umgeben und er würde seine Kamera nicht gegen den Himmel richten.
Tip 8: Den Taubeschlag
kann man meist durch das
Anbringen einer Taukappe,
das ist eine Sonnenblende
mit innenliegendem
Filzbelag weitgehend
unterbinden (vgl. Abb 2.24).
Die Taukappe vermindert
die Abstrahlung gegen den
kalten Himmelshintergrund.
Reicht das nicht aus, kann
man versuchen durch eine
kleine elektrische Heizung
die verbleibende
Wärmeabstrahlung zu
kompensieren. Eine Reihe
in Serie geschalteter
Widerstände geschickt
angebracht kann als
primitive Heizung dienen.
Sie wird rund um die
Frontlinse angebracht.
Tip 9: Der Autor bevorzugt
das Anbringen von einigen
Gramm Silikagel (SiO2)
nahe dem Objektiv.
Silikagel ist ein sehr gutes
Trocknungsmittel und wird
in der Regel elektronischen
Geräten in der
Originalverpackung
beigelegt, um bei dem
Abb. 2.25: Überprüfen der Montierung mit einem Teleskop. Das
Transport und der Lagerung
Fadenkreuzokular läßt kleinste Abweichungen eines Sterns erkennen.
eine zu hohe
Luftfeuchtigkeit zu vermeiden. Um einmal mit Wasser gesättigte Päckchen Silikagel wieder
verwenden zu können, reicht es sie für ein paar Minuten in die Mikrowelle zu geben und die
Feuchtigkeit entweichen zu lassen. Für ein Normalobjektiv sollten etwa 50 g für eine Stunde
bei starker Luftfeuchtigkeit reichen.
Sollte das nicht ausreichen ist es besser seine Kamera vor dem Regen zu schützen.
Tip 10: Vor allem bei elektronischen Kameras ist Vorsicht geboten. Sie sind meist sehr
feuchtigkeitsempfindlich und können leicht Schaden nehmen. Bei hoher Luftfeuchtigkeit ist
von ihrem Einsatz daher abzuraten.
Tip 11: Ist trotz aller Vorsicht das erhaltene Bild nicht scharf, so kann es daran liegen, daß
nicht richtig fokussiert wurde. Das kann geschehen obwohl die Entfernungsskala des
Objektivs auf Unendlich gestellt wurde. Bei viel gebrauchten Objektiven kann sich durch so
manche Erschütterung schon einmal die eine oder andere Linse im Objektiv verschieben, so
daß die Entfernungsskala nicht mehr stimmt. In diesem Fall empfiehlt es sich bei ruhender
Kamera Testaufnahmen bei verschiedenen Entfernungseinstellungen zu manchen. Man kann
35
zum Beispiel ein Stück Millimeterpapier über die Entfernungsskala kleben und bei jedem
Millimeter eine Belichtung machen. Meist wird man alle Belichtungen auf ein einziges
Negativ vornehmen, indem man für etwa 30 Sekunden den Objektivdeckel entfernt, dann
wieder das Objektiv abdeckt, die Schärfe verstellt und wieder das Objektiv freigibt u. s. w..
All das macht man während der Kameraverschluß geöffnet ist. Jene Entfernungseinstellung,
bei der die Sternstrichspuren am dünnsten sind, ist die optimale.
Tip 12: Es gibt noch eine Möglichkeit keine scharfen Bilder zu bekommen: Während der
relativ langen Belichtungszeiten kann es dazu kommen, daß sich der Film in der Filmbühne
bewegt, weil er zu stark oder zu schwach gespannt ist, oder weil er sich aufgrund zu hoher
Luftfeuchtigkeit zu krümmen beginnt. Solche Fehler kommen vor allem bei sehr dünnen
Filmen vor, da sie von der Filmbühne nicht gut genug gehalten werden bzw. besonders dazu
neigen sich zu verwerfen. Starke Temperaturschwankungen können auch zu solchen Fehlern
beitragen.
Tip 13: Kameras mit elektrisch gesteuertem Verschluß benötigen viel Batteriestrom, um den
Verschluß offen zu halten. Ist es kalt, so verlieren die Batterien besonders schnell an
Spannung. Man kann dem begegnen, indem man eine externe Stromversorgung verwendet
oder auf rein mechanische Kameras umsteigt. Bewährt haben sich NiCd-Akkus, weil sie
weniger temperaturempfindlich sind.
Tip 14: Um Schwingungen zu vermeiden, sollte man, falls die Montierung auf einem Stativ
befestigt ist, das Stativ möglichst niedrig lassen. Die langen meist dünnen Stativbeine sind
besonders schwingungsanfällig. Außerdem kann man einen Sessel verwenden, der nicht nur
bequem ist, sondern auch als Ablage dienen kann.
Tip 15: Vewendet man eine Uhr mit selbstleuchtendem Sekundenzeiger, so braucht man
keine Taschenlampe.
2.4 Filme und Belichtungszeiten
2.4.1 Grundlagen
Filme sind in mehreren Schichten aufgebaut. Die eigentliche lichtempfindliche Schicht ist die
Emulsion. Sie besteht aus Silberhalogenid-Mischkristallen (die genaue Zusammensetzung
und Form ist Firmengeheimnis), die in eine Gelatine eingebettet sind. Ihre Zusammensetzung,
Größe, Form und Verteilung bestimmt die fotografische Eigenschaft des Films, wobei die Art
des Bindemittels und sonstiger Zusätze eine weitere Rolle spielt. Die Silberhalogenidkristalle
sind etwa 1/1000 mm groß, die Dicke der Emulsionsschicht beträgt weniger als 1/100 mm
und ein Quadratmeter Film enthält zwischen 1 und 10 g Silber. Die Emulsion befindet sich
auf einem Schichtträger, aus Cellulose-Acetat oder Polyester bei Negativfilmen, dessen Dicke
zwischen 7/100 und 20/100 mm beträgt. Eine Schutzschicht auf der Emulsion schützt diese
vor mechanischen Schäden. Direkt unter der Emulsion befindet sich ein Gelatine-Substrat,
das der Emulsion eine gute Haftfähigkeit auf dem Träger ermöglicht. Unter dem Träger
befindet sich eine eingefärbte Gelatineschicht, deren Färbung als Lichthofschutzschicht dient.
Sie absorbiert das gestreute, durch den Träger dringende Licht und verhindert die Entstehung
eines Reflexionslichthofes. Damit keine Totalreflexion entsteht, ist der Brechungsindex des
Rückgusses gleich wie der des Trägermaterials. Zudem setzt der Rückguß den
Oberflächenwiderstand des Filmes herab und verhindert weitestgehend statische Aufladung,
die zu Verblitzungen führen würden.
36
Wie moderne
Schwarzweißfilme haben
Farbfilme mehrere
Emulsionsschichten
unterschiedlicher
Empfindlichkeit.
Zudem haben
Farbfilme direkt
unter der
Schutzschicht eine
UV-Filter-Schicht
auf die die
blauempfindlichen
Emulsionen
folgen, darauf
folgt eine
Gelbfilterschicht
gefolgt von den
Abb 2. 26: Prinzipieller Schichtaufbau eines Schwarzweißfilmes (Marchesi Bd.1 S96)
grünempfindliche
n Emulsionsschichten, die über einer Rot- oder Magentafilterschicht liegen, die wiederum von
den rotempfindlichen Schichten gefolgt wird. Zuletzt sei noch erwähnt, daß die
Lichthofschutzschicht bei Farbfilmen meist über dem Träger liegt.
Je größer die Oberfläche eines Silberhalogenidkristalls, desto größer ist seine
Empfindlichkeit, aber leider auch die Körnigkeit des Films. Die Körnigkeit ist die
Kornstruktur eines fotografischen Materials, die bei der Entwicklung durch die Reduktion der
Silberhalogenidkristalle zu metallischem Silber entsteht. Sie ist daher nicht nur vom Film
sondern auch von der Belichtung und der Entwicklung abhängig.
Unter Lichteinwirkung wird ein Silberhalogenidkristall atomar verändert: Die einfallenden
Photonen werden von den Elektronen im Valenzband des Silberhalogenidkristalls absorbiert,
dabei nehmen sie genügend Energie auf, um in das Leitungsband zu gelangen. Das freie
Elektron und das zurückgebliebene Loch sind frei beweglich. Elektron und Loch müssen nun
durch jeweilige Reaktionen voneinander getrennt werden um eine Rekombination zu
verhindern, was eine Auslöschung der Bildinformation bedeuten würde. Elektronen werden
durch bewußt erzeugte Fehlstellen im Kristall eingefangen. Höchstreine
Silberhalogenidkristalle sind nicht in der Lage, die Bildinformation oder das latente Bild, wie
es auch genannt wird, zu speichern, denn Elektronen und Löcher würden binnen 1 Millionstel
Sekunde rekombinieren. Das positive Loch wandert an die Oberfläche und reagiert mit der
Gelatine. So kommt der Gelatine eine große Bedeutung zu. Bis heute konnte keine gut
funktionierende Alternative gefunden werden.
Das eingefangene Elektron neutralisiert ein Silberion, das in einer Gitterfehlstelle sitzt, und
läßt ein Silberatom zurück. Durch die Anwesenheit eines Silberatoms wird die
Elektronenfalle weiter verstärkt und es häufen sich mehr und mehr Silberatome an.
Bei der Entwicklung reichen vier Silberatome, die sich zu einem Cluster verbunden haben
(Entwicklungskeim), um ein ganzes Silberhalogenidkristall zu reinem Silber zu reduzieren.
So wird bei der Entwicklung aus dem latenten Bild ein sichtbares, indem alle Kristalle, die
einen Entwicklungskeim besitzen, in metallisches Silber umgewandelt werden, alle anderen
jedoch bei der folgenden Fixierung herausgeschwemmt werden. Die zufällige Reduktion
eines unbelichteten Filmkorns geschieht durch statistische Prozesse und ist für den
sogenannten Grundschleier verantwortlich.
37
Der oben beschriebene Prozeß läuft bei jeder Filmentwicklung ab. In Farbfilmen wird vor
dem Fixieren die Farbentwicklung durchgeführt, bei der sich Farbkuppler an die belichteten
Stellen heften. Danach, im Bleichbad, wird das ganze metallische Silber komplexiert, so daß
im anschließenden Fixierbad nicht nur das unbelichtete Silberhalogenid sondern auch das
nach dem Entwickeln zurückgebliebene metallische Silber aus der Gelatine herausgelöst wird.
Dadurch bleiben im Farbfilm nur mehr die Farbstoffe zurück, im Gegensatz zum SW-Film,
der noch Silber enthält. Die hier angeführten Vorgänge bei der Entstehung des latenten Bildes
und der anschließenden Entwicklung sind nur skizzenhaft zu verstehen. In Wirklichkeit sind
die Vorgänge wesentlich komplizierter.
2.4.2 Der Schwarzschildeffekt
In der Astrofotografie ist die einfallende Lichtintensität viel geringer als bei der normalen
bildmäßigen Fotografie, so daß sich bei der Entstehung des latenten Bildes Schwierigkeiten
ergeben.
Damit in einem Silberhalogenidkristall ein entwicklungsfähiger Keim entstehen kann,
müssen eine Vielzahl quantenmechanischer Prozesse vonstatten gehen. Wie oben beschrieben
entsteht bei der Belichtung im Silberhalogenid elementares Silber. Das entspricht dem
latenten Bild. Eine Langzeitbelichtung bei geringen Beleuchtungsstärken bedeutet für den
einzelnen Silberhalogenidkristall, daß das Zeitintervall zwischen zwei Lichtquanttreffern
relativ groß wird. Die Lebensdauer des einmal gebildeten einzelnen Silberatoms liegt bei
Zimmertemperatur nur im Bereich von Sekundenbruchteilen. Es zerfällt thermisch. Aus dem
Urkeim entsteht dadurch wieder ein Silberion und ein Elektron. Bei Langzeitbelichtung tritt
der Zerfall des Urkeims ein, noch bevor ein weiteres Photoelektron und ein
Zwischengittersilberion den Urkeim zum Subkeim anwachsen lassen. Der wesentlich
stabilere Subkeim kann auf diese Weise nur durch statistische Effekte entstehen. Ist aber der
Subkeim einmal entstanden, so ist die Entstehung des Entwicklungskeimes nicht mehr so
kritisch.
Die Lebensdauer des Urkeims ist von der Temperatur abhängig. Mit fallender Temperatur
nimmt die Ionenleitfähigkeit des Silberhalogenids ab und die instabilen Subkeime werden
beständiger. Ihre Lebensdauer wird bei einer Verringerung der Temperatur auf -78°
(Trockeneis) um den Faktor 1000 verlängert und so der Reziprozitätsfehler ausgeschaltet.
Leider ist die Tiefkühlfotografie mit zu großem Aufwand verbunden, so daß sich heute nur
noch ausgesprochene Spezialisten damit beschäftigen.
Bei den im Handel erhältlichen Filmen ist dieser Reziprozitätsfehler oft beträchtlich, so daß
sich eine genaue Auswahl lohnt. Leider sind gerade höherempfindliche Filme mit einem
beträchtlichen Reziprozitätsfehler versehen, was ihre in der Astrofotografie erzielbare
effektive Empfindlichkeit deutlich herabsetzt. Der Autor hat schon diverse Wunder erlebt.
Dabei konnte auf zwei identisch belichteten Aufnahmen mit unterschiedlich empfindlichen
Filmen auf dem höherempfindlichen kaum das erwünschte Objekt ausgemacht werden,
während es auf dem niedrigempfindlicheren Filmmaterial deutlich zu sehen war.
Bei Farbfilmen kommt noch hinzu, daß die verschiedenen Farbschichten unterschiedliche
Langzeitfehler aufweisen und es dadurch zu Farbverfälschungen kommt. Daher ist in der
Astrofotografie von höchstempfindlichem Filmmaterial abzuraten. Man muß einen
Kompromiß zwischen Empfindlichkeit und Langzeitverhalten finden. Leider finden sich auf
keiner Filmpackung Hinweise auf den Langzeitfehler. Er muß in speziellen Datenblättern
nachgesehen werden.
Um in der Praxis zur richtigen Belichtungszeit zu kommen, wird man erst einmal eine
Testreihe anfertigen. Am besten man belichtet dasselbe Objekt mit demselben Film,
demselben Objektiv und bei gleicher Blende mit verschiedenen Belichtungszeiten, wobei man
die Belichtungszeiten jeweils verdoppelt, oder wenn man genauer vorgehen will jeweils um
38
den Faktor 2 verlängert. Will man nun die Belichtungszeit desselben Objekts mit
demselben Film, demselben Objektiv aber anderer Blende wissen, so verwendet man das
Gesetz von Schwarzschild:
Die Belichtung H ist jene Energie, die während der Belichtungszeit t und pro Fläche auf den
Film fällt. In der normalen bildmäßigen Fotografie, bei der genug Licht vorhanden ist, wird
auf dem Film die gleiche Schwärzung erreicht, sobald dieselbe Belichtung auf den Film fällt.
Die Reziprozität ist erfüllt. D.h. bei halber Intensität, bzw. einer Blendenstufe tiefer, muß man
doppelt so lange belichten um dieselbe Schwärzung zu erreichen. Es gilt also, daß bei
H = I ⋅ t = const . dieselbe Schwärzung auf dem Film erreicht wird, wobei I die Intensität
des einfallenden Lichts ist und in Lux (lx) gemessen wird [1 lx = 1 W/m2] und t die
Belichtungszeit ist. Dieses Gesetz ist in der Regel für Belichtungszeiten von 1/1000 s bis 1/10
s erfüllt. Bei längeren Belichtungszeiten gilt näherungsweise das Schwarzschild´sche Gesetz:
p
Bei einer Belichtung von I ⋅ t = const . erhält man dieselbe Filmschwärzung. p heißt der
Schwarzschildexponent. Er ist näherungsweise konstant und für lange Belichtungszeiten
immer kleiner als eins.
Bsp.: Eine Himmelsregion wurde mit einem Normalobjektiv bei Blende 2 fünf Minuten
belichtet und hat eine optimale Schwärzung erreicht. Es wird ein SW-Film mit
Schwarzschildexponent p = 0.72 verwendet. Wie lange muß man bei Blende 2.8 belichten,
um dieselbe Schwärzung zu erreichen?
Blende 2.8 ist eine Blendenstufe tiefer als Blende 2, d. h. die Lichtintensität wird bei Blende
p
p
2.8 nur halb so groß sein wie bei Blende 2 (2 I2 = I1). Nun gilt: I 1 ⋅ t1 = I 2 ⋅ t 2 woraus:
1
p
I
t 2 = 1 ⋅ t1 p = 13.1 min folgt. Man muß also deutlich länger als die doppelte Zeit
I2
belichten, um dasselbe Ergebnis zu erlangen.
Man kann nun natürlich auch die Belichtungszeiten für andere Filme auf obige Weise
errechnen, wenn der Schwarzschildexponent bekannt ist. Es hat sich aber gezeigt, daß der
erhaltene Wert nur ein Anhaltswert ist, da die verschiedenen Filme für unterschiedliche
Wellenlängen unterschiedlich empfindlich sind. Die Rechnung wäre also nur dann richtig,
wenn die beiden Filme dieselbe spektrale Empfindlichkeit haben. Soweit dem Autor bekannt
ist, gibt es aber keine zwei Filme mit dieser Eigenschaft.
Der numerische Wert für den Schwarzschildexponent wird von den Filmherstellern nicht
angegeben. Meist wird nur angegeben ab welcher Belichtungszeit eine Belichtungskorrektur
erforderlich ist oder ab welcher Belichtungszeit eine Aufnahme nicht mehr empfohlen wird.
Vor allem bei Farbfilmen liegt die maximal empfohlenen Belichtungszeit mit wenigen
Ausnahmen unter 10 s, was aber nicht bedeutet, daß der Film nicht für die Astrofotografie
geeignet ist. Es heißt nur, daß ab diesen Belichtungszeiten Farbabweichungen auftreten, die in
der professionellen Fotografie nicht mehr toleriert werden. Sieht man sich aber die Farbstiche
von Billigfilmen an, wie man sie in Supermärkten bekommt, so währe für sie überhaupt keine
Belichtungszeit empfehlenswert.
Grundsätzlich kann man sagen, daß Negativfilme immer weiter entwickelt sind als Diafilme
oder SW-Filme und daß gerade in letzter Zeit einige Verbesserungen auf dem Gebiet der
Reziprozitätsfehler gemacht wurden. Deshalb sind Negativfilme fast immer zu bevorzugen.
Es ist aber ebenfalls zu erwarten, daß auch die Diafilme diesbezüglich bald nachziehen
werden.
Heute sind hochempfindliche Negativfilme (400 ASA) fast ebenso feinkörnig und haben
dasselbe Auflösungsvermögen wie normalempfindliche Diafilme (100 ASA).
39
Der Vorteil der Diafilme ist ihr hohe Kontrast, die hohe Farbsättigung und die Möglichkeit
der Projektion, um die Ergebnisse für ein großes Publikum zugänglich zu machen. Vor allem
ein hoher Kontrast ist in der Astrofotografie erwünscht.
2.4.3 Verwendbares Filmmaterial
Bei kurzen und mittleren Brennweiten (bis 200 mm ) wirkt sich das atmosphärische Seeing
(Luftturbulenzen) nicht auf die Abbildungsqualität aus. Deswegen ist der Einsatz von
feinkönigem Filmmaterial möglich und wünschenswert. Nur so kann das
Auflösungsvermögen der verwendeten Optik ausgeschöpft werden. In der SW-Fotografie ist
der Kodak Technical Pan die erste Wahl. Sein Schwarzschildexponent kann durch eine
spezielle Behandlung mit Wasserstoff auf 0.99 gesteigert werden, so daß der
Schwarzschildeffekt praktisch keine Rolle mehr spielt (vgl. Handbuch für Sternfreunde Bd. 1
Kap. 4.7.11). Der Agfa Ortho 25 wird leider nicht mehr hergestellt obwohl er ein
ausgezeichnetes Auflösungsvermögen besitzt.
Weitere brauchbare SW-Filme sind der Kodak T-Max 400 mit einem sehr hohen
Schwarzschildexponenten und der Ilford HP 5.
Bei den Farbdiafilmen sind vor allem die Neuentwicklungen von Kodak und Fuji
bemerkenswert. Besonders zu erwähnen ist der Ektachrome 200, der sich ausgezeichnet
puschen läßt und eine gute Rotempfindlichkeit aufweist. Weitere hochempfindliche Filme
sind der Ektachrome 400 und der Fujichrome Provia 400. Nur in Ausnahmefällen (z.B. zur
Registrierung von Meteoren) sollte man höchstempfindliche Filme wie den Kodak
Ektachrome Panther 1600 oder den Fujichrome Provia 1600 verwenden.
Die Entwicklung auf dem Negativsekotr geht zur Zeit dermaßen rasant, daß es für den Autor
nicht leicht ist den richtigen Film zu empfehlen. Die lange Zeit hervorragenden Pro-GoldEmulsionen gibt es nicht mehr und ihre Nachfolger wurden eher auf Porträtfotografie
getrimmt, wodurch ihre Rotempfindlichkeit stark gelitten hat. Gut sind nach wie vor der
Kodak Royal Gold 400 und die Fuji Super G 400 und Super G 800 Filme. Neu und gut ist,
wenn man dem Bericht im Sky & Telescope vom Jänner 1999 glauben darf, der Kodak
Ektapress 400. Bei den Negativfilmen kann man auch zu den höchstempfindlichen Ektacolor
Pro Gold 1000 und Fujicolor Superia 800 greifen ohne allzustark an Auflösung zu verlieren.
2.4.4 Belichtungszeiten
Im Normalfall wird man danach trachten solange wie möglich zu belichten, um die
lichtschwächsten Ausläufer des fotografierten Objekts abzubilden. Die ideale Belichtungszeit
hierfür ist jene, bei der der Himmelshintergrund gerade beginnt sich auf dem Film
abzuzeichnen. Belichtet man länger so beginnt der Himmelshintergrund langsam alles zu
überstrahlen und die schwachen Nebel beginnen wieder im Hintergrund unterzugehen. Die
Maximalbelichtungszeit ist proportional zum Quadrat des Öffnungsverhältnisses N. Unter
Berücksichtigung des Schwarzschildeffektes gilt t max = C N 2/p, wobei C ein
Proportionalitätsfaktor ist, der von der Helligkeit des Himmelshintertgrundes abhängt. Die
Helligkeit des Himmelshintergrundes nimmt ab mit der Höhe über dem Horizont, mit der
Entfernung zu allen Lichtquellen, wie großen Städten und Straßen, und mit der Reinheit der
Luft.
Beispiel: Bei Blende 2.8 ist der Ektachrome 200 im ländlichen Bereich nach maximal 10
Minuten und in den Alpen nach etwa 20 Minuten ausbelichtet. Die Angaben gelten für den
Zenitbereich. Starke Schwankungen aufgrund von örtlichen Streulichtquellen und der sich
immer weiter verbreitenden Luftverschmutzung sind möglich.
40
2.5 Mögliche Ergebnisse (Deep-Sky)
2.5.1 Einleitung
Die Fotografie des nächtlichen Himmels mit Brennweiten bis 200 mm, wie es die schottische
Montierung maximal erlaubt, ist ein beinahe idealer Einstieg in die Astrofotografie, da sich
sehr bald gute Ergebnisse einstellen und man wichtige Erfahrungen sammeln kann.
Zusätzlich zur fotografischen Ausrüstung sollte man einen Sternatlas benutzen, damit man
gezielt vorgehen und jene Objekte aussuchen kann, für die man sich interessiert. Zudem lernt
man sich am nächtlichen Himmel zu orientieren und kann sich mit den Größenverhältnissen
vertraut machen.
Der verwendete Atlas sollte mindestens alle sichtbaren Sterne und alle Messier-Objekte
beinhalten. Besser ist ein weiterführender Atlas.
Mit Brennweiten bis 200 mm lassen sich vor allem ausgedehnte Objekte gut fotografieren.
Aber auch die kleineren Objekte des gestirnten Himmels lassen sich zumindest nachweisen.
2.5.2 Die Objekte der Milchstraße
Schütze bis Schwan
Das Zentrum der Milchstraße befindet sich im Sternbild des Schützen (lat. Sagittarius) nahe
dem Stern 3-X Sgr. Hier ist die Milchstraße besonders breit und enthält die größte
Sternendichte (Abb. 2.27). Daneben beinhaltet das Sternbild des Schützen noch die größte
Vielfalt an nonstellaren Objekten (außer fernen Galaxien). Die dichten Staub - und
Gaswolken der Milchstraße erlauben es nicht, bis tief in den Weltraum zu sehen. Sie sind
sogar so dicht, daß es nicht möglich ist, bis zum relativ nahen Zentrum der Milchstraße
(Entf. etwa
33 000 Lj) zu sehen. Obwohl ihre Dichte auf der Erde immer noch als gutes Vakuum
bezeichnet würde, beinhalten die weit ausgedehnten Gas- und Staubwolken einen großen Teil
der Masse der Milchstraße, weil sie sich über Lichtjahre erstrecken. Eine Gaswolke mit "nur"
ein bis zwei Lichtjahren Dicke reicht, um das gesamte Licht der Sterne die sich hinter ihr
befinden abzublocken. Solche Gas- und Staubwolken werden Dunkelnebel genannt, wenn
sie nicht selbst leuchten und das Licht der dahinterliegenden Sterne blockieren. Die
Milchstraße ist übersäht von solchen Dunkelnebeln wie sie auch Abb. 2.27 zeigt. Der Blick
Richtung Galaxienzentrum zeigt uns also nicht das Innerste der Milchstraße sondern nur ihren
innersten Spiralarm, den Sagittariusarm. Astronomen haben errechnet, daß das Sternenlicht
vom galaktischen Zentrum durch die Gas- und Staubwolken, die uns von ihm trennen, um den
Faktor 60 Milliarden abgeschwächt wird. Im Sagittariusarm befindet sich der galaktische
Nebel M 8 (auch Lagunennebel). In ihm eingebettet liegt der junge Sternhaufen NGC 6530,
der einige massereiche junge Sterne beinhaltet, die noch nicht einmal 2 Millionen Jahre alt
sind. Drei von ihnen sind besonders hell und strahlen so stark im UV-Bereich, daß sie den
gesamten Nebel zum Leuchten anregen. Im sichtbaren Bereich leuchtet er am hellsten in der
ersten Balmer Linie (rot), die auch Hα Linie genannt wird. Den größten Anteil an
Ionisierungsarbeit leistet der Stern 9 Sgr. Er strahlt im UV-Bereich 44 mal heller als im
Visuellen, wo er
23 000 mal heller strahlt als die Sonne.
Innerhalb dieses Gebietes ist nahezu das gesamte Gas ionisiert, und es besteht ein enges
Gleichgewicht zwischen der Anzahl der Rekombinationen zwischen Elektronen und Ionen
und der Anzahl der dabei entstehenden neutralen Atome, die erneut ionisiert werden.
41
Zwischen dem H+ Gebiet (so wird das Gebiet des ionisierten Wasserstoffs auch genannt;
auch HII-Gebiet) und dem umgebenden neutralen Gas gibt es häufig eine recht scharfe
Grenze, die Ionisationsfront. Die Temperatur des ionisierten Gases ist immer nahe bei
10 000 K, während die Dichte zwischen 107 und 1012 Ionen je Kubikmeter schwankt. Im
konkreten Fall des Lagunennebels beträgt die Temperatur etwa 8000 K und die
Elektronendichte beträgt etwa 600 Millionen pro Kubikmeter. Die ionisierte Masse beträgt
etwa 200 Sonnenmassen, die sich in einer Entfernung von 4500 Lichtjahren erstreckt und
einen linearen Durchmesser von 20 Lj aufweist.
Abb. 2.27: Sternbild Schütze; 50 mm, Bl. 2.8, 5 min auf Ektachrome Panther 1600
Etwa ein Grad nordöstlich von M 8 liegt M 20 (Trifidnebel), ebenfalls ein H+-Gebiet. Im
Norden des Nebels leuchtet ein kleiner blauer Nebel, dessen Zentralstern nicht heiß genug ist,
um den Nebel zu ionisieren. Das blaue Licht ist gestreutes und reflektiertes Sternenlicht.
Vor einigen Jahren haben Radioastronomen eine riesige, den sichtbaren Nebel umgebende
Molekülwolke entdeckt, die sich ungefähr 100 Lichtjahre erstreckt und mehr als 10 Millionen
Sonnenmassen hat. Ihr Hauptbestandteil ist Formaldehyd (H2CO).
Weiter oben fallen zwei weitere rot leuchtende Nebel auf. Es sind dies M 16 und M 17. M 16
liegt bereits im Sternbild der Schlange, genauer im Schwanz der Schlange (Serpens
Cauda).
M 16 ist eine Mischung aus Staub und Gas, die von dem eingebetteten jungen Sternhaufen
NGC 6611 angeregt wird. Es wurden dunkle röhrenförmige Gebilde (sogenannte
Elefantenrüssel) entdeckt, die als Anzeichen für die Sternentwicklung gelten. Auch M 17 ist
ein Sternentstehungsgebiet und wird gelegentlich auch als Omeganebel bezeichnet, weil der
Nebel im Visuellen, durch das Teleskop betrachtet, an den griechischen Buchstaben Omega
erinnert. Der Omeganebel wird von einer Gruppe sehr heißer Sterne angeregt, die noch von
den Gas- und Staubmassen umgeben sind, aus denen sie entstanden. Deshalb kann man die
Sterne auch im Teleskop nicht sehen. Sie strahlen aber stark im Infrarot. M 17 grenzt an eine
riesige Molekülwolke, die in südlicher Richtung bis hinunter zu M 8 reicht und auch
westlich vorbei an M 17 bis zu M 16 reicht. Diese Molekülwolke hat eine geschätzte Masse
von
42
300 000 Sonnenmassen und enthält viel CO.
Nachdem Sterne in einer Gaswolke entstanden sind, blasen ihre Sternwinde die Gasmassen
fort und zurück bleiben offene Sternhaufen wie M 23, M 24 und M 25 im Schützen. M 23
ist etwa 300 Millionen Jahre alt und 2100 Lichtjahre entfernt. Seine Leuchtkraft entspricht der
von mehr als 6000 Sonnen. M 25 ist etwas weiter entfernt (3000 Lj) und noch leuchtkräftiger
(etwa 33 000 Sonnen).
Nordwestlich von ϕ -Sgr liegt noch ein diffuses Objekt. Es ist ein Kugelsternhaufen, der
uns, verglichen mit anderen Kugelsternhaufen, sehr nahe liegt (10 000 Lj). Kugelsternhaufen
bestehen aus sonnenähnlichen Sternen oder eher noch kleineren. Sie sind uralt und liegen sehr
dicht. Selbst große Teleskope sind nicht in der Lage ihr Zentrum in Einzelsterne aufzulösen.
M 22 hat einen Durchmesser von 70 Lichtjahren und besteht aus mehr als 200 000 Sternen.
Etwas weiter oben, wo der dicke Bulk der Milchstraße langsam dünner wird, erstrecken sich
die Sternbilder Adler, Schlange und Schlangenträger. Die Milchstraße scheint hier durch
eine riesige Gas- und Staubwolke entlang ihres Äquators getrennt. Hier sind bereits deutlich
weniger Objekte, vor allem kaum HII Regionen zu sehen (Abb. 2.28).
Abb. 2.28: Über dem Schützen erstrecken sich der Adler und der Schlangenträger. 50 mm, Bl. 2.8, 5
min auf EPH 1600
Im westlichen Teil der Milchstraße liegt der große offene Sternhaufen IC 4756. Er besitzt
keine zentrale Konzentration, möglicherweise ist er in Auflösung begriffen. Ein Schicksal,
das die meisten Sternhaufen erleiden. Auch der etwa 2° westlich liegende Sternhaufen NGC
6633 ist bereits weit ausgedehnt und erstreckt sich über einen großen Teil des Himmels.
Der Milchstraße entlang weiter nach Norden gelangt man erst in das kleine Sternbild des
Pfeils und dann in das Sternbild des Füchschens. In ihm befindet sich auch eine kleine
rötlich leuchtende Wolke. Sie ist aber nicht so ausgeprägt rot wie die HII-Regionen sondern
beinhaltet auch andere Farben wie grün, gelb und blau. Der Nebel ist sehr klein, und genau in
seinem Zentrum befindet sich ein heißer Stern. Früher wurden solche Nebel wegen ihrer
geringen Größe mit Planeten verwechselt, weshalb man sie heute noch planetarische
Nebel nennt. Heute weiß man, daß planetarische Nebel von alternden Sternen abgestoßene
Gashüllen sind, die mit großen Geschwindigkeiten expandieren.
43
Im Stadium des Roten Riesen verdampft die Oberfläche eines Sterns und die Teilchen
entweichen mit einer Geschwindigkeit von etwa 10 - 30 km/s. Pro Jahr verliert der Stern so
zirka ein Millionstel Sonnenmasse, das sind mehrere tausend Milliarden Gigatonnen Gas. Der
Stern umgibt sich also mit einer Hülle. In einem späteren Stadium führen Instabilitäten des
Sterns zu heftigen Explosionen, deren Wind den inneren Bereich des Nebels leerfegt und die
äußeren Teile verdichtet. So bildet sich die sichtbare Hülle aus ionisiertem Gas.
Abb. 2.29: Der Hantelnebel (M 27) im Sternbild Füchschen; 200 mm, Bl. 4, 10 min belichtet auf
Ektachrome Panther 1600
Viele planetarische Nebel sehen deshalb kugelschalenförmig aus wie zum Beispiel der
berühmte Ringnebel im Sternbild der Leier. Besitzt der Zentralstern ein starkes Magnetfeld,
Abb. 2.30: SNR im Schwan (Zirrusnebel); 200 mm, Bl. 4, 12 min auf Ektachrome Panther 1600
44
so bilden sich bipolare Strukturen, da das Gas in einer bevorzugten Richtung stärker
abgestoßen wird. Wie in der Sonnenkorona folgt das Gas den Magnetfeldlinien und gibt dem
Nebel eine ovale Form, je nach Blickrichtung des Beobachters (vgl. Abb. 2.29). Bis heute
kennt man etwa 1500 planetarische Nebel, wovon die meisten von ihnen innerhalb weniger
Grad von der galaktischen Ebene liegen. Sie konzentrieren sich weder in den Spiralarmen
noch in den interstellaren Wolken. Sie nehmen einen Bereich in der Milchstraße ein, der vor
allem von älteren, entwickelten Sternen bevölkert wird. Ein Indiz dafür, daß es sich dabei um
die späten Stadien der Sternentwicklung handelt.
Der Zentralstern der planetarischen Nebel ist der heiße ausgebrannte Überrest des einstigen
Sterns, der nun beinahe seinen gesamten Wasserstoffvorrat zurück ins All geblasen hat. Der
hohe UV-Anteil der Strahlung des zurückgebliebenen Weißen Zwerges, wie solche Sterne
auch genannt werden, ionisiert die expandierende Hülle und regt sie so zum Leuchten an.
Nach zirka 100 000 Jahren ist der Zentralstern ausgekühlt und verloschen. Zurück bleibt ein
schwarzer Zwergstern. Lange bevor der Stern so weit abgekühlt ist, hat sich das
expandierende Gas so weit verdünnt und von dem Stern entfernt, daß es nicht mehr
nachzuweisen ist. Es hat sich mit dem interstellaren Medium vermischt und kann wieder in
einer Sternentstehung involviert werden. Die gesamte Masse des interstellaren Gases in
unserer Galaxis, die von planetarischen Nebeln stammt, macht etwa 5 Sonnenmassen pro Jahr
aus. Das sind etwa 15 Prozent der gesamten Materie, die von allen Sternen der Milchstraße
abgegeben werden. Die planetarischen Nebel spielen daher eine wichtige Rolle in der
Entwicklung der Milchstraße.
Planetarische Nebel entstehen, wenn sich das Leben eines Sterns mit bis zu vier
Sonnenmassen dem Ende neigt.
Wenn größere Sterne aus dem Leben treten, so hinterlassen sie Plätze der Verwüstung. Ihre
Gravitation ist so groß, daß keine Atome den gewaltigen Drücken standhalten. Nachdem sie
alle Arten der Energiegewinnung durch Kernverschmelzung ausgeschöpft haben, um einen
Gegendruck zu erzeugen, gewinnt schließlich die Gravitation und läßt den Stern wie im freien
Fall innerhalb weniger Stunden in sich zusammenfallen. Dabei wird so viel
Gravitationsenergie frei, daß der Stern die ganze Galaxis an Leuchtkraft weit übertrifft - eine
Supernovaexplosion. Auch dieser Stern bläst seine Hülle in den Raum. Es sieht aber eher
nach einer Explosionswolke als nach einer gleichmäßig expandierenden Gashülle aus. Das
Gas breitet sich auch mit viel größerer Geschwindigkeit aus und enthält daher viel mehr
Energie als jenes der planetarischen Nebel. Die Anfangsgeschwindigkeit der Sternhülle ist
mit bis zu 20 000 km/s wesentlich höher als bei planetarischen Nebeln. Nach etwa 100 Jahren
beginnt die Expansionsgeschwindigkeit infolge des Staudruckes des interstellaren Gases zu
sinken, welches zu einer Schale zusammengedrückt wird. Instabilitäten in dieser Schale
führen zu einem ungleichmäßigen Ring, der stark Synchrotronstrahlung emittiert. Nach
einigen 10 000 Jahren kühlt die Schale auf unter 1 Million Grad ab und beginnt dadurch seine
Energieabstrahlung in Emissionslinien zu verlagern, wodurch die Abkühlung verstärkt wird.
Der Zirrennebel im Sternbild des Schwan ist gerade in dieser Phase (Abb. 2.30). Er
expandiert nur noch mit 50 km/s. Die Zentralsterne von solchen Supernovaüberresten
(SNR) sind viel schwerer aufzuspüren. Der sternförmige Rest des Zirrennebels wurde erst
1977 entdeckt. Er ist selbst in den größten Teleskopen nur fotografisch nachweisbar. Es ist
ein Pulsar, der sich 11 mal in der Sekunde um seine Achse dreht. Ein Pulsar ist ein
Neutronenstern, dessen starkes Magnetfeld in Zusammenwirkung mit der schnellen
Rotation an den Polen zu einer hochintensiven Synchrotronstrahlung führt.
Der Zirrennebel erstreckt sich in einer Entfernung von mehr als 2000 Lichtjahren mit einem
linearen Durchmesser von mehr als 100 Lichtjahren. Sein Alter wird auf 30 000 Jahre
geschätzt. Trotz der großen Entfernung nimmt er auch am Nachthimmel einen imposanten
Raum ein und erstreckt sich über mehr als 2.7 °. Sein hellstes Segment (das östliche) ist
45
bereits im Feldstecher (8x50) zu sehen. Der Zirrennebel liegt etwa 3 Grad südlich von ε Cyg.
Das Sternbild Schwan ist im Sommer gut zu sehen. In ihm liegen riesige Flächen chaotisch
verstreuter Mengen von Gas, Staub und Sternen. Dieser Bereich gehört zum Rand eines
Spiralarms der Milchstraße (Abb. 2.31). Am auffälligsten und bekanntesten sind der
Nordamerikanebel und der Pelikannebel, die durch eine Dunkelwolke scheinbar getrennt
sind.
Abb. 2.31: Nebelchaos im Schwan. Östlich des Sterns α - Cygni oder Deneb (Bild Mitte) befindet sich
der Nordamerikanebel; Südwestlich von Deneb liegt γ - Cyg. der ebenfalls mit einem
Nebelkomplex umgeben ist; 50 mm, Bl. 2.8, 10 min auf Ektachrome 200 prof.
Der gesamte Nebelkomplex hat eine Masse von etwa 18 000 Sonnenmassen bei nur 10
Millionen Teilchen pro Kubikmeter.
Beide Nebel befinden sich in einer Entfernung von etwa 3000 Lichtjahren. Wieder handelt es
sich um HII-Regionen, die von wenigen heißen, blauen Sternen zum Leuchten angeregt
werden. Der Nordamerikanebel und der Pelikannebel haben beide eine relativ geringe
Flächenhelligkeit, weshalb sie im Feldstecher recht schwer auszumachen sind. Im Teleskop
sind sie wegen ihrer Größe visuell erst recht nicht zu beobachten. Schuld daran ist nicht
zuletzt die riesige Anzahl von Sternen, die in die Nebel scheinbar eingebettet sind.
Auch der Stern γ - Cygni ist von einem Nebelkomplex umgeben. Wegen seiner
symmetrischen Form wird er manchmal als Schmetterlingsnebel bezeichnet.
46
Abb. 2.32: Zwischen Perseus und Cassiopeia liegt der Doppelsternhaufen
min auf Ektachrome Panther 1600
h & χ ; 50 mm, Bl. 2.8,
5
Cassiopeia bis Stier
Weiter entlang der Milchstraße führt uns unser Streifzug durch das Sternbild des Cepheus
über die Cassiopeia in das Sternbild des Perseus. Hier befindet sich eine Rarität. Der
Doppelsternhaufen h & χ . Es handelt sich dabei um zwei offene Sternhaufen. Offene
Sternhaufen enthalten einige dutzend bis einige hundert Sterne, die alle aus derselben Gasund Staubwolke geboren wurden, sich ihrer "Kinderdecke" entledigt haben und nun als
"Jugendliche" durch die Milchstraße wandern. Entlang der Spiralarme der Milchstraße bilden
sich offene Haufen, die deshalb voll davon sind. h & χ sind besonders sternreiche Haufen.
Sie sind aus einer gemeinsamen Urwolke entstanden, die sich um zwei Zentren konzentriert
hat. Sie enthalten beide über 300 junge, sehr massereiche und leuchtkräftige Sterne. Manche
übertreffen die Sonnenleuchtkraft um das 50 000 fache. Obwohl die Sternhaufen noch sehr
jung sind, nur etwa 12 Millionen Jahre, haben die massereichsten Sterne bereits die Phase der
Stabilität verlassen und sind zu roten Riesensternen geworden (vgl. Abb. 2.33). Die
Gesamtmassen der Haufen belaufen sich auf je über 3000 Sonnenmassen und ihre Entfernung
liegt bei ca. 7000 Lj
Nordöstlich von h & χ (etwa 5°) befinden sich zwei große HII-Regionen: IC 1805 und
IC 1848 (Abb. 2.32 und Abb. 2.33), die beide noch im Sternbild der Cassiopeia liegen. Der
größere der beiden Nebel (IC 1805) umgibt den jungen Sternhaufen Mel 15 und ist
6000 Lj entfernt. Seine Gesamtmasse beläuft sich auf einige hundert Sonnenmassen, die er
auf 250 Lj linearen Durchmesser verteilt hat.
In Abb. 2.32 ist noch der offene Sternhaufen M 34 zusehen. Er besteht ebenfalls aus hellen
Sternen, ist aber nur 1500 Lichtjahre entfernt. Dafür ist er mit 180 Millionen Jahren
wesentlich älter als h & χ .
Weiter südlich im Perseus befindet sich eine weitere bekannte asymmetrische HII-Region:
Der Californianebel. Dieser Nebel wird von dem Stern χ - Persei zum Leuchten angeregt,
47
der am Südrand des Nebels steht. Der Nebel ist nur ein kleiner Teil eines viel größeren
unsichtbaren Gasnebels. Bis zum Californianebel sind es immerhin 2000 Lj Trotz dieser
Entfernung ist seine Winkelausdehnung relativ groß für einen Nebel, der nur von einem
einzigen Stern angeregt wird. Immerhin ist die ionisierte Masse geschätzte 250
Sonnenmassen groß (Abb. 2.34).
Nach dem Sternbild Perseus folgt entlang der Milchstraße das Sternbild des Fuhrmann. Auch
hier finden sich zwei große HII-Regionen (IC 405 und IC 410) und drei prächtige offene
Sternhaufen (M 36, M 37, M 38). Sie scheinen alle in Verbindung zu stehen und sind etwa
4000 Lichtjahre entfernt. M 36 ist ein sehr junger Sternhaufen mit vielen blauen
Riesensternen. M 37 ist dichter und enthält mehr Sterne als M 36. Zudem wird er von einem
Halo von ca. 8000 Sternen umgeben. Die 150 Sterne von M 37 sind etwa 8000 Sonnen
schwer. Weniger dicht ist M 38. Er enthält aber auch ca. 120 massereiche blaue und gelbe
Sterne.
Am rechten Rand von Abb. 2.34 ist ein besonders heller Sternhaufen zu sehen. Es sind die
Plejaden, die bereits mit bloßem Auge als Sternhaufen mit sieben Mitgliedern sichtbar sind.
Die Plejaden werden sogar in der Bibel erwähnt. Der Sternhaufen beherbergt insgesamt 1421
junge Sterne die vor etwa 50 Millionen Jahren ihr nukleares Feuer zündeten. Die hellsten
Plejadensterne sind heiß und blau und werden von blau leuchtenden Nebeln umgeben. Diese
Nebel sind der kümmerliche Rest der Gaswolke aus dem die Plejaden einst entstanden.
Einige der Sterne rotieren sehr rasch (ca. 200 km/s) und schleudern von Zeit zu Zeit
Gaswolken aus.
Die Plejaden sind etwa 400 Lj entfernt und in einem Areal von 15 Lj versammelt. Ihre
Gesamtmasse beträgt annähernd 500 Sonnenmassen. Die Plejaden gehören zum Sternbild des
Stier.
Abb. 2.33: h & χ im Perseus und die HII-Regionen IC 1805 und IC 1848; 200 mm, Bl. 4, 10 min auf
Kodak Ektapress Multispeed (640 ASA)
48
Abb. 2.34: Fuhrmann bis Stier; 50 mm, Bl. 2.8, 5 min auf Kodak Panther 1600
Orion und Einhorn
Weiter südlich findet man das wohl bekannteste Sternbild des Nachthimmels, den Orion
(Abb. 2.35).
Der Orion ist vor allem wegen seines leicht zu findenden großen Emissionsnebels im
Schwertgehänge, der Orionnebel genannt wird, bekannt.Der Orionnebel ist bestimmt die
bekannteste, hellste und meistfotografierte HII-Region. Sie ist vor allem im Teleskop noch
sehr hell und beeindruckend, im Vergleich zu anderen HII-Regionen, die äußerst schwach
leuchten und nur noch indirekt zu sehen sind.
Der Orionnebel wird von vier einander nahen, heißen Sternen in seinem Zentrum angeregt,
die von uns aus die Form eines Trapezes annehmen und deshalb Trapezsterne genannt werden
(Sie sind in den Abbildungen nicht sichtbar).
Von den Trapezsternen geht ein heftiger Sternwind aus, der Hohlräume in die sie umgebende
dunkle Wolke bläst und die Staubmassen in Form einer expandierenden Blase zurückdrängt.
Die Trapezsterne sind nur 10 000 bis eine Million Jahre alt und es gibt Hinweise darauf, daß
zumindest einer von ihnen von einer CO-Molekülwolke umgeben wird. Möglicherweise ein
entstehendes Planetensystem. Das Hubble Weltraumteleskop hat im Orionnebel
sogenannte Protosterne entdeckt, also jene Vorläufer von Sternen, die gerade dabei sind,
sich zu verdichten. Man hat quasi alle Stadien der Sternentstehung gefunden: von großen,
kalten Molekülwolken über Infrarotsterne bis hin zu jungen Sternen, die noch von Wolken
ionisierten Gases eingehüllt sind.
49
Abb. 2.35: Das Sternbild Orion mit seinen bekannten Objekten; 50 mm, Bl. 2, 5 min auf
Kodak Ektachrome 200 professional
Der große Orionnebel befindet sich in einer Entfernung von etwa 1500 Lj und die ionisierte
Masse beläuft sich auf 10 000 Sonnenmassen. Mit einer Elektronendichte von 5 Mrd. pro
Kubikmeter ist er zu den dichteren Nebeln zu zählen. Nördlich des Orionnebels sieht man
einen Komplex aus Reflexionsnebeln, der die Objekte NGC 1973, NGC 1975, NGC 1977
und
Abb. 2.36: Im Schwertgehänge des Orion befindet sich der große Orionnebel;
200 mm, Bl. 4, 10 min auf Kodak Ektachrome 200 professional (push auf 320 ASA)
50
NGC 1981 umfaßt. Eigentlich ist der Orionnebel nur ein kleiner Teil eines von zwei großen
Wolkenkomplexen, deren scheinbare längste Ausdehnung von Radioastronomen auf über
fünf Grad angegeben wird. Auch ein kleiner Teil der zweiten Molekülwolke ist auf Abb. 2.35
zu erkennen. Es sind die HII-Regionen, die den östlichsten Gürtelstern ζ -Orionis
umgeben. Sie werden wegen ihrer Gestalt Flammnebel und Pferdekopfnebel (IC 434)
genannt. IC 434 ist ein heller Nebel, der von dem Mehrfachsternensystem σ - Orionis
ionisiert wird. Der mit 3500 K relativ kühle Nebel befindet sich in Expansion. Er wird sich
schließlich mit den ihn umgebenden Gasen vermischen und auflösen. Der Nebel wird quasi
von den Sternwinden des σ - Orionis-Systems weggeblasen. Mindestens ein Stern dieses
Komplexes besitzt ein sehr starkes Magnetfeld, das die Materieflüsse lenkt und an die
Feldlinien fesselt.
Der Orionnebel und der Pferdekopfnebel sind die uns am nächsten liegenden HII-Regionen
und daher am besten untersucht worden.
Der riesige Molekülwolkenkomplex, der vom Orionnebel und dem Pferdekopfnebel angezeigt
wird, wird von einer großen Blase umgeben, die schön in Abb. 2.35 zu erkennen ist und
deren sichtbarer Teil Barnard´s Loop genannt wird. Dabei handelt es sich um die Überreste
einer oder mehrerer Sternexplosionen. Die Hülle hat einen Durchmesser von über 300
Lichtjahren. Auch der Stern λ - Orionis wird von einer riesigen kreisförmigen Gaswolke
umgeben.
Östlich des Orion befindet sich das etwas unscheinbare Sternbild des Einhorn. In ihm finden
sich weitere große HII-Gebiete. Der hellste Nebel wird Rosettennebel genannt (Abb. 2.35 &
Abb. 2.37). Er wird durch die ultraviolette Strahlung eines Sternhaufens angeregt, der sich ein
bißchen südlich versetzt zum Zentrum des Nebels befindet. Der Rosettennebel besitzt einen
zentralen Hohlraum von etwa 12 Lj Durchmesser. Wahrscheinlich wurde dieser Hohlraum bei
der Entstehung des Sternhaufens im Inneren des Nebels vom Strahlungsdruck und den
Sternenwinden leergefegt. Jedenfalls ist der Sternenwind dieser jungen Sterne so stark, daß
das Gas weiter weggeblasen wird und sich der Hohlraum weiter vergrößert. Es ist aber
anzunehmen, daß der Hohlraum wegen der turbulenten Bewegung der Gase und dem
zunehmenden Alter der Sterne, die dann etwas ruhiger werden, wieder aufgefüllt werden
wird. Dies sollte in ungefähr 500 000 Jahren der Fall sein. Das Vorhandensein eines zentralen
Hohlraumes ist ein Zeichen von "Jugend".
Der Rosettennebel befindet sich in einer Entfernung von 4500 Lj, ist etwa 11 000
Sonnenmassen schwer, hat eine Elektronendichte von 16 Millionen pro Kubikmeter und ist
8000 K heiß. Sein Alter wird auf 100 000 Jahre geschätzt.
Bilder mit höherer Vergrößerung zeigen im Rosettennebel dunkle Streifen staubhaltiger
Materie, die die dahinterliegenden Sterne verbirgt. Am Rand dieser Staubstreifen, im
Grenzbereich zum ionisiertem Gas, fanden Astronomen staubreiche Gebiete hoher Dichte, die
von der ionisierten Materie umschlossen werden. Es entstehen isolierte Kugeln aus neutralem
Wasserstoff, die unter dem Einfluß der Gravitation neue Sterne bilden. Solche sogenannte
Bok-Globulen haben einen Durchmesser von 0.1 bis 4 Sonnenmassen. Solche Gebilde finden
sich auch im benachbarten Konusnebel (NGC 2264).
51
Abb. 2. 37: Der Rosettennebel im Sternbild des Einhorn; 200 mm, Bl. 4, 10 min auf
Ektachrome 200 professional (push auf 320 ASA)
Der Nebel NGC 2264 wird vom Stern S Monocerotis zum Leuchten angeregt. Er wird wegen
einer kleinen merkwürdigen, konischen Einbuchtung am südöstlichen Rand des Nebels
Konusnebl genannt.
Abb. 2.38: Nördlich des Rosettennebels um den Stern S Monocerotis befindet sich NGC 2264;
200 mm, Bl. 4, 10 min auf Ektachrome 200 professional (push auf 320 ASA)
Der leuchtende Nebel, der sich nur schwach vom Himmelshintergrund abhebt, ist nur ein
kleiner Teil einer der riesigen Wolken neutralen Wasserstoffs in unserer Galaxis. NGC 2264
52
befindet sich in einer Entfernung von 2800 Lj und besitzt eine ionisierte Masse von etwa 8000
Sonnenmassen.
Abb. 2.39: Nahe dem Stern β - Ophiuchi befindet sich Barnard´s Stern, der Stern mit der größten
Eigenbewegung am Himmel; 50 mm, Bl. 2, 5 min auf Ektachrome 200 prof. (push auf 320 ASA)
Besonderheiten
Bevor wir unseren Blick aus der galaktischen Ebene leiten noch zwei Besonderheiten. Zum
einen: Der schnellste Stern am Himmel. Wir haben bereits gesehen, daß das
Weltall in ständiger Bewegung und Veränderung ist. Auch die Sterne und unsere Sonne, die
sich ja um das Zentrum der Milchstraße dreht, sind in Bewegung. Je weiter innen ein Stern
ist, desto schneller bewegt er sich, das ist wie bei den Planeten. Manche Sterne bewegen sich
auf uns zu, manche bewegen sich von uns weg und manche passieren uns einfach in einer
bestimmten Richtung. Normalerweise braucht es Jahrzehnte, um diese Bewegungen mit sehr
präzisen Instrumenten zu vermessen. Aber es gibt auch Sterne, die uns sehr nahe sind und ihre
Bewegung ist daher viel einfacher festzustellen. Im Sternbild des Schlangenträgers nahe
dem Stern β - Ophiuchi findet sich ein kleiner Zwergstern, auch Barnard´s Stern, der die
größte scheinbare Eigenbewegung (Geschwindigkeit im rechten Winkel zur Sichtlinie) besitzt
(vgl. Abb. 2.39). Innerhalb eines Jahres legt er scheinbar 10.25 Bogensekunden zurück, die
leicht mit einem Teleskop feststellbar sind. Seit seiner Entdeckung 1916 hat er sich über 12
Bogenminuten weit, fast genau in Richtung Norden, bewegt. Das ist fast der halbe
Monddurchmesser!
Dieser schwache und relativ kalte Stern hat nur 1/2500 der Leuchtkraft der Sonne und ist
nicht einmal doppelt so groß wie Jupiter (im Durchmesser). Trotzdem ist er wahrscheinlich
sehr dicht. Ein Grund für seine hohe Eigengeschwindigkeit ist seine Nähe. Mit nur sechs
Lichtjahren Entfernung ist er der zweitnächste Stern nach dem von unseren Breiten aus nicht
sichtbaren System Alpha/Beta/Proxima-Centauri. Dazu hat er eine ungewöhnlich hohe
Geschwindigkeit relativ zu der übrigen lokalen Sternengruppe. Barnard´s Stern bewegt sich
mit 167 Kilometer pro Sekunde, davon 141 km/s in Richtung Erde und 89 km/s im rechten
Winkel zur Sichtlinie. Wegen der großen Annäherungsgeschwindigkeit an die Erde wird er in
53
8 Millionen Jahren mit nur 4 Lichtjahren Entfernung der näheste Stern sein. Danach wird er
an uns vorbeifliegen und unser System verlassen. Barnard´s Stern hat nicht genug
Geschwindigkeit, um die Milchstraße zu verlassen, weshalb er sehr wahrscheinlich kein
Besucher einer anderen Galaxie ist.
Würden alle Sterne sich mit einer vergleichbar hohen Geschwindigkeit bewegen, so würden
sich die Sternbilder innerhalb eines Menschenlebens merklich verändern. Glücklicherweise
ist die durchschnittliche Eigenbewegung der Sterne, die mit bloßem Auge sichtbar sind,
kleiner als eine zehntel Bogensekunde pro Jahr.
Barnard´s Stern hat neben seiner hohen Eigengeschwindigkeit noch eine interessante
Eigenschaft: Seine Trajektorie ist nicht gerade sondern wobbelt ein kleines bißchen, was die
Astronomen auf die Präsenz zweier Begleiter von der Größe des Jupiter und des Saturn
schließen ließ.
Die zweite Besonderheit ist ein riesiger Komplex aus Gas und Staub, der sich über
1000 Quadratgrad erstreckt. Er liegt ebenfalls, zumindest teilweise, im Sternbild des
Schlangenträgers und umgibt vor allem den Stern ρ - Ophiuchi. Der andere Teil liegt im
Sternbild Skorpion und ist am hellsten bei Antares (Abb. 2.40 und Abb. 2.41). Die große
Winkelausdehnung liegt an der geringen Entfernung von nur 700 Lichtjahren. Der Nebelteil
um Antares ist ein Reflexionsnebel und leuchtet gelblich, der Nebelteil um σ - Scorpionis ist
eher rot und der größte Teil des Nebelkomplexes um ρ - Ophiuchi schimmert leicht blau.
Diese Gebilde reichen bis zum Pfeifennebel, ein Dunkelnebel der sich um ϑ - Ophiuchi
windet.
Der dichteste Teil des Nebels ist der um ρ - Ophiuchi. Die zwischen dem Gas verteilten
Staubmassen schwächen das Licht der Sterne in dieser Gegend um den Faktor 10 000. Mit
Abb. 2.40: Der riesige Nebelkomplex um ρ - Ophiuchi und Antares steht tief am Himmel und ist daher
schwer auszumachen; 50 mm, Bl. 2.8, 10 min auf Ektachrome 200 prof. (push auf 320 ASA)
Hilfe von Infrarotbeobachtungen, die den Staub durchdringen, konnte man etwa 50 Sterne
feststellen. Sie bilden einen Haufen, der einige Millionen Jahre alt ist.
Nahe dem Hauptstern des Skorpion (Antares) befindet sich der Kugelsternhaufen
54
M 4. Er ist mit 7500 Lichtjahren der uns am nächsten gelegene Kugelsternhaufen und mit nur
rund 60 000 Sternen ist er einer der kleinsten seiner Spezies. Wegen seiner Nähe kann er
bereits in Abb. 2.41 deutlich als Kugelsternhaufen ausgemacht werden. In Abb. 2.41 ist auch
noch der Kugelsternhaufen NGC 6144 zu erkennen.
Abb. 2.41: Antares im Skorpion wird von einem Reflexionsnebel umgeben;
200 mm, Bl. 4, 10 min auf Ektachrome 200 prof. (push auf 320 ASA)
Kugelsternhaufen bestehen aus relativ kleinen und uralten Sternen. Sie sind so alt wie die
Milchstraße und nicht auf die galaktische Ebene beschränkt. Viele von ihnen findet man weit
Abb. 2.42: M5 im Kopf der Schlange; 200 mm, Bl. 4, 5 min auf Ektachrome 200 prof.
55
außerhalb des galaktischen Äquators, wie z. B. M 5 im Kopf der Schlange (Abb. 2.42).
M 5 ist 27 000 Lichtjahre von uns entfernt und hat einen tatsächlichen Durchmesser von etwa
260 Lichtjahren. M 5 ist der größte Kugelsternhaufen in der nördlichen Hemisphäre.
Neben M 13 im Herkules zählt er zu den schönsten Kugelsternhaufen, die von unseren
Breiten aus sichtbar sind.
Abb. 2.43: Der große Andromedanebel und die Galaxie M 33 im Dreieck; 50 mm, Bl. 2.8, 10 min auf
Ektachrome 200 prof.
56
2.5.3 Galaxien
Wenden wir unseren Blick nun endgültig aus der galaktischen Ebene den außergalaktischen
Abb. 2. 44: Der große Andromedanebel (M31) mit seinen Begleitgalaxie M 32 und NGC 205;
200 mm, Bl. 4, 10 min auf Kodak Ektapress Multispeed PJM
Objekten zu. Die wohl bekannteste, uns nahe, große Galaxie ist der große
Andromedanebel (Abb. 2.43 und Abb. 2.44).
Er ist der am weitesten entfernte Himmelskörper, der noch deutlich mit bloßem Auge
erkennbar ist. M 31, wie die Galaxie auch genannt wird, wird von zwei kleineren Galaxien
umgeben, die durch die Gravitation an M31 gebunden sind. Es sind dies M 32 und NGC 205
(manchmal auch M 110 genannt), beides elliptische Zwerggalaxien. In etwas größerer
Entfernung sind da noch NGC 185 und NGC 147, sie sind aber nicht auf Abb. 2.44, da sie
sich bereits im Sternbild der Cassiopeia befinden und ihr Winkelabstand viel zu groß ist.
Wie die Milchstraße ist auch M 31 eine Spiralgalaxie. Man hat sieben Spiralarme gezählt,
die äußersten sind sogar auf Ab 2.44 zu erkennen. Wie in jeder Spiralgalaxie sind auch in M
31 die jungen Sterne in den Spiralarmen versammelt, während der dicke Kern der Galaxie alte
Sterne beherbergt, die in einem viel kleinerem Volumen zusammengepackt sind.
M 31 ist so weit von uns entfernt, daß selbst im Teleskop keine Einzelsterne erkennbar sind.
Nur in Großteleskopen können Einzelsterne aufgelöst werden. Das Licht, welches wir von
M 31 empfangen trat seine Reise an, als es noch keine Menschen auf der Erde gab, vor
beinahe 3 Millionen Jahren. M 31 ist mit fast 200 000 Lichtjahren Durchmesser wesentlich
größer als unsere Milchstraße. M 31 strahlt so hell wie 40 Milliarden Sonnen und besitzt eine
Masse von etwa 300 Milliarden Sonnenmassen. M 31 ist eine der wenigen Galaxien, die sich
auf uns zu bewegt. Das tut sie mit 68 km/s.
In M 31 hat man all jene Objekte gefunden, die man auch in der Milchstraße findet: Gas und
Staubmassen, HII-Regionen, offene Sternhaufen, Kugelsternhaufen, planetarische Nebel, ja
sogar eine Supernovaexplosion im Jahre 1885.
Aber vor allem in den nicht sichtbaren Wellenlängenbereichen hat man Entdeckungen
gemacht. Im Infraroten erkennt man eine Art leuchtenden Ring. Es handelt sich dabei um
Sternentstehungsgebiete, die große Mengen von Protosternen enthalten, die aber noch von so
57
viel Staub umgeben sind, daß sie im Visuellen nicht erkannt werden können. Auch im
Radiobereich wurde ein Ring gefunden, der den Galaxienkern umgibt. Es handelt sich dabei
vermutlich um Synchrotronstrahlung von Elektronen, die von Supernovaschockwellen
beschleunigt und im galaktischen Magnetfeld abgelenkt werden.
Im Sternbild des Dreieck gibt es eine weitere Spiralgalaxie ( M 33) in ähnlicher Entfernung
wie M 31 (siehe Abb. 2.43 und Abb. 2.45). Im Gegensatz zu M 31 sieht man auf M 33 fast
von oben, weshalb die Spiralarme noch besser sichtbar sind. Sie gehen von einem relativ
kleinen Kern aus und winden sich gegen den Uhrzeigersinn um die Galaxis.
Auch M 33 kann von Großteleskopen in Einzelsterne aufgelöst werden und beinhaltet
zahlreiche Nebel. Es sind über 100 HII-Regionen gezählt worden. Die größte von ihnen hat
einen Durchmesser von mehr als 1000 Lichtjahren. Im Radiobereich wurde in M 33 die erste
extragalaktische Linie des Wassermoleküls gefunden.
Die Spiralarme sind reich an jungen Sternen und blauen, heißen Überriesen, die nur ein
kurzes Leben fristen und einen starken Sternenwind erzeugen. Diese starken Sternenwinde
schieben das interstellare Gas in Blasen zusammen. Andere Sterne sind bereits explodiert und
bilden weitere interstellare Blasen, die man in M 33 entdeckte. Das Zentrum von M 33 ist
sehr dicht und eine Mischung aus sehr alten ( zirka 10 Milliarden Jahre), kleinen und sehr
jungen, heißen Riesensternen (zirka 10 Millionen Jahre).
M 33 ist die drittgrößte Spiralgalaxie in der lokalen Gruppe (neben M 31 und der
Milchstraße). Mit einer Masse von nur 10 Milliarden Sonnenmassen ist sie aber wesentlich
leichter als die Milchstraße und etwa so schwer wie die große Magellansche Wolke.
Wie M 31 bewegt sich auch M 33 auf uns zu, aber mit nur 11 km/s.
Alle anderen Galaxien am Himmel sind wesentlich kleiner als M 31, M 33 und die
Magellanschen Wolken, die nur von der südlichen Halbkugel aus zu beobachten sind.
Dennoch sind mit Amateurmitteln noch über zweitausend Galaxien zu erreichen.
Einige von ihnen findet man im Großen Bären. Hier befinden sich mehrere Galaxien in etwa
10 Millionen Lichtjahren Entfernung. Der gesamte Galaxienkomplex ist etwa
Abb. 2.45: M33 im Dreieck; 200 mm, Bl. 2.8, 10 min auf Kodak Ektapress Multispeed (640 ASA)
7 x 3 Millionen Lichtjahre groß, das entspricht 20° x 40°. Zwei von ihnen sind M 81 und
58
Abb. 2.46: M 81 und M 82 im Großen Bären; 200 mm, Bl. 4, 10 min auf Ektachrome 200 prof.
M 82, die über eine Materiebrücke miteinander verbunden sind (Abb. 2.46). M 81 ist eine
große Spiralgalaxie mit etwa 100 000 Lichtjahren Durchmesser. Sie ist beinahe so schwer wie
M 31 und ist in ihrem Zentrum reich an roten Sternen. Die Spiralarme dieser Galaxie werden
von neutralem Wasserstoff umgeben und dehnen den Halo der Galaxie weit in den
intergalaktischen Raum aus. M 81 ist etwa 12 Millionen Lichtjahre entfernt und ist
physikalisch an M 82 gebunden. Vor einigen zehn Millionen Jahren, im astronomischen Sinn
vor sehr kurzer Zeit also, kamen sich beide Galaxien extrem nahe, so daß die auftretenden
Gezeitenkräfte der größeren und massiveren Galaxie M 81 die kleinere M 82 verformte und
Materie aus ihr herausriß.
Radioastronomen haben herausgefunden, daß eine riesige asymmetrische Wolke aus
neutralem Wasserstoff M 82 umgibt und bis zur Nachbargalaxie M 81 reicht. Dies Gaswolke
ist wahrscheinlich bei der Begegnung der beiden Galaxien aus M 82 herausgerissen worden
und fällt nun wieder zurück. Dabei beschleunigt sie die Bildung neuer Sterne in M 82.
Die Kerne der beiden Galaxien sind auch heute nur 150 000 Lichtjahre voneinander entfernt.
M 82 ist nur halb so groß und mit nur 50 Milliarden Sonnenmassen leichter als M 81. Im
Teleskop bietet M 82 einen chaotischen Anblick. Das Zentrum der Galaxie ist reich an
Sternhaufen und ionisiertem Gas. Im innersten Kern fand man eine Art Scheibe, die sehr
junge und teils heiße Sterne beinhaltet (Alter etwa 50 Millionen Jahre). Dieser Kern besitzt
alleine eine Leuchtkraft von 500 Millionen Sonnen. Beobachtungen zeigen zahlreiche
Hinweise auf Explosionen im Zentrum. Man nimmt an, daß vor vielleicht einer Million
Jahren zahlreiche Explosionen Gasmassen aus dem Zentrum mit 500 bis 1000 km/s
herausgeschleudert haben, deren Gesamtmasse einige Millionen Sonnenmassen ausmacht. Sie
bilden wahrscheinlich die Filamente, die man gegenwärtig beobachtet und die über einen
Bereich von 10 000 Lichtjahren verstreut sind. Bei diesen Explosionen haben die
Schockwellen die umgebende Materie stark zusammengepreßt und die Sternentstehung
beschleunigt. Es wird angenommen, daß sich gleichzeitig mehrere Millionen Sterne gebildet
haben. Im Radiobereich beobachtet man eine sehr intensive Synchrotronstrahlung, die von M
82 ausgeht. Wahrscheinlich ist, daß sie von zahlreichen Supernovaexplosionen stammt,
59
die im Inneren der Galaxie stattfinden. Man fand nämlich 100 000 sehr aktive HII-Gebiete,
die darauf schließen lassen, daß es im Mittel alle drei Jahre zu einer Supernovaexplosion
kommen könnte. M 81 und M 82 entfernen sich beide von uns. M 81 mit 88 km/s und M 82
mit bereits 322 km/s.
Nahe dem Schwanz des Bären findet man noch zwei weitere Herzeigegalaxien: M 101 und
M 52. Von uns aus sieht man M 101 von oben, so daß man ihre Spiralarme deutlich erkennen
kann (Abb. 2.47). Sie ist nach neueren Erkenntnissen mit 27 Millionen Lichtjahren wesentlich
weiter entfernt als bisher angenommen. Daher ist sie nun größer als M 31 und gehört zu den
ganz großen Spiralgalaxien. Ihre Spiralarme sind relativ weit auseinander und beherbergen
viele große HII-Gebiete. Ihr Kern ist sehr klein und wird von Staubwolken verdeckt. Auf
Aufnahmen mit sehr hoher Auflösung sieht man in der Zentralregion mehrere helle Gebiete
und Radiobeobachtungen haben darin die Anwesenheit von CO-Wolken gezeigt. Auch M 101
flüchtet scheinbar von uns mit 415 km/s.
M 52 gehört eigentlich schon in das Sternbild der Jagdhunde. Sie ist mit etwa 37 Millionen
Lichtjahren noch weiter entfernt als M 101 und mit 100 000 Lichtjahren Durchmesser gehört
sie auch zu den großen Spiralgalaxien (Abb. 2.48). Wie bei M 101 kann man sie von oben
betrachten und deutlich ihre beiden Spiralarme sehen. Sie ist die erste Galaxie, bei der man
eine Spiralstruktur nachweisen konnte. Es war Earl of Ross (Irland), der sie mit seinem
riesigen 1.8 m Metallspiegel als erster beobachtete. Mit heutigen Teleskopen sind die
Spiralarme bereits ab einer Teleskopöffnung von 30 cm und weniger zu erkennen. Man kann
sich aber vorstellen, daß ein derart schwaches Leuchten in der Wissenschaft nicht als
Nachweis angesehen werden kann. Nicht nur die schöne Spiralstruktur macht M 51 zum
herausragenden Objekt, es ist vor allem die Begleitgalaxie NGC 5195, die dichter ist als M
51 und der größeren Galaxie Materie entreißt. Möglicherweise umläuft die kleinere
Begleitgalaxie M 51 in einer weiten Bahn. Die beiden Galaxien sind von einem gemeinsamen
Halo umgeben, der durch die Gezeitenkräfte der Galaxien verformt wird. Die Gezeitenkräfte
sind auch für die hohe Sternentstehungsrate in M 51 verantwortlich.
Abb. 2.47: M 101 im großen Bären ist eine der ganz großen Spiralgalaxien;
200 mm, Bl. 2.8, 10 min auf Ektachrome 200 prof. (push auf 320 ASA)
60
In den Spiralarmen findet man reichlich HII-Regionen und junge blaue Sterne. Die
Spiralarme besitzen eine Kompressionszone die reich an dunklen Staubwolken ist. Dieser
Kompressionszone folgen HII-Regionen und blaue Riesensterne.
Abb. 2.48: M 51 in den Jagdhunden; 200 mm, Bl. 2.8, 10 min auf Ektachrome 200
Der recht helle Kern der Galaxie ist gekennzeichnet von hoher Aktivität. Hier entweichen
Gase die 30 000 K heiß sind mit 200 km/s. Dabei wird intensive UV-Strahlung ausgesandt.
M 51 hat eine Masse von etwa 160 Millionen Sonnenmassen und entfernt sich mit 552 km/s.
Wie die Sterne gruppieren sich die Galaxien in Haufen. In der Umgebung der Lokalen
Gruppe gibt es hunderte von Galaxienhaufen. Diese wiederum bilden Superhaufen, in
denen sich tausende von Galaxien vereinigen. Dabei ist der intergalaktische Raum aber gar
nicht leer.
Radio und Infrarotstrahlung verraten, daß die Galaxien und die Galaxienhaufen von Halos aus
heißen Gasen umgeben sind, die auch die Galaxienhaufen miteinander verbinden.
Gleich drei solcher Superhaufen befinden sich im Sternbild der Jungfrau (Virgo) und dem
Haar der Berenike. Hier befindet sich auch eine der größten mit Amateurmitteln
beobachtbaren Galaxien M 87 (Abb. 2.49). In ihrem Umfeld gibt es mehr Galaxien als
Sterne! Viele von ihnen sind bereits in bescheidenen Teleskopen zu sehen. Es ist keine
Seltenheit, wenn man im ohnehin kleinen teleskopischen Gesichtsfeld gleich mehr als fünf
Galaxien zugleich sehen kann.
M 87 besitzt einen Durchmesser von etwa 140 000 Lichtjahren. Außerhalb dieses
Durchmessers liegt ein ausgedehnter Halo, der sehr viele Sterne enthält und der Galaxie zu
einer unglaublichen Masse von 10 000 Milliarden Sonnenmassen verhilft. Damit ist sie die
größte und hellste Galaxie im Virgohaufen, der etwa 60 Millionen Lj entfernt ist. Bei M 87
handelt es sich um eine elliptische Riesengalaxie, deren Form beinahe kugelförmig ist, so
daß sie aussieht wie ein überdimensionaler Kugelsternhaufen.
61
Abb. 2.49: Das Zentrum des Coma-Virgo Superclusters; 200 mm, Bl. 2.8 auf Ektachrome 200 prof.
In Wirklichkeit enthält die Galaxie selbst eine große Zahl (etwa 13 000) von
Kugelsternhaufen, die auf guten und langbelichteten Aufnahmen als diffuse Fleckchen zu
sehen sind. M 87 ist nicht nur eine der größten Galaxien die wir kennen, sie zeigt auch starke
Aktivität. Auf kurzbelichteten Aufnahmen (bei min. 2 m Brennweite) erkennt man einen
spektakulären Materieauswurf, der direkt aus dem Zentrum der Galaxie zu stammen scheint.
Dieser im optischen beobachtbare Jet ist über 6000 Lichtjahre lang. Die ausgesandte
Radiostrahlung ist Synchrotronstrahlung, die ein hochenergetischer Strahl von Elektronen
(1 Millionen MeV), der aus dem Zentrum der Galaxie ausgeschleudert wird, erzeugt. Das
Hubble Weltraumteleskop konnte die Radialgeschwindigkeit einer im Zentrum rotierenden
Gaswolke messen. Die Astronomen schlossen daraus auf eine Rotationsgeschwindigkeit der
Gasscheibe von 550 km/s. Dieser hohe Wert ist nur zu erklären, wenn man ein massereiches
Schwarzes Loch im Zentrum der Galaxie annimmt. Zumindest müßte in einem kleinen
Bereich von etwa 60 Lichtjahren eine Masse von zwei bis drei Milliarden Sonnenmassen
komprimiert sein.
In Abb. 2.49 sind noch zahlreiche andere Galaxien zu sehen. Unter ihnen ist auch M 88, eine
Spiralgalaxie (ähnlich M 31), die sich mit 2000 km/s von uns fortbewegt. M 90 ist eine
Spiralgalaxie, in deren Spiralarmen es kaum junge Sterne und HII-Regionen gibt. Sie
scheint aus dem Virgocluster auszubrechen und nähert sich uns wie auch M 86 mit mehr als
400 km/s. M 86 ist eine elliptische Galaxie die mit M 84 und einigen NGC´s eine kleine
Gruppe bildet, die sehr wahrscheinlich miteinander wechselwirkt. M 84 hat in ihrem Zentrum
wie M 87 ein gigantisches massives Objekt mit etwa 300 Millionen Sonnenmassen, das auf
einen Raum von höchstens 26 Lichtjahren zusammengedrängt ist.
M 98 ist eine eher kleine Spiralgalaxie, die wir von der Seite sehen (edge-on). Sie zeigt eine
chaotische diffuse Scheibe, die einige Gebiete mit jungen Sternen aufweist. Sie beinhaltet
entlang der galaktischen Ebene eine große Menge Staub, welcher den kleinen aber hellen
Galaxienkern etwas rötlich erscheinen läßt. In der Nähe davon ist M 99 eine große aber
asymmetrische Spiralgalaxie, deren Asymmetrie wahrscheinlich auf eine
Wechselwirkung mit einer weiteren Galaxie des Coma-Virgo-Superclusters
62
(möglicherweise mit M 98) hindeutet. Dafür spricht auch die sehr hohe
Fluchtgeschwindigkeit von 2324 km/s.
Etwas weiter nördlich finden wir M 100, eine der größten Spiralgalaxien im Virgo-ComaSupercluster. Wir sehen fast genau von oben (face on) auf ihre blauen Spiralarme, die reich an
Sternentstehungsgebieten sind und viele junge heiße Sterne enthalten. Die Sternentstehung
wurde wahrscheinlich durch intensive Wechselwirkung mit anderen Galaxien im Haufen
angeregt, welche einen Ring der Sternentstehung (starburst) entstehen ließ.
Abb. 2.49 zeigt noch M 58 (eine Balkenspiralgalaxie), M 59, M 60 (beides elliptische
Galaxien) und eine weitere Zahl von NGC-Galaxien. Jedes etwas verwaschene oder unscharf
erscheinende Nebelfleckchen in Abb. 2.49 ist eine Galaxie!
2.5.4 Kometen
Die Schottische Montierung kann auch zur Beobachtung von Kometen eingesetzt werden:
Abb. 2.50 zeigt den Kometen Hyakutake, der die Erde in einer relativ geringen Entfernung
von nur 15 Millionen km (etwa 40-fache Monddistanz) passierte. Hyakutake´s Schweif
erreichte eine Länge von über 150 Millionen km, was dem Abstand Erde-Sonne entspricht.
Kometen sollte man möglichst kurz belichten, weil sie sich mitunter relativ schnell gegenüber
dem Fixsternhimmel bewegen und manchmal gibt es kurze Ausbrüche des Kometenkerns, die
zu Strukturänderungen in Koma und Schweif führen. Im Falle des Kometen Hale-Bopp war
das anders, denn er war weiter entfernt als die Sonne und somit konnte auch seine
Sonnennähe (Komet erreicht seine höchste Geschwindigkeit) sich nicht störend auswirken.
Abb. 2.50: Komet Hyakutake am 28 März 1996. Die grün leuchtende Koma umgibt den Kometenkern;
200 mm, Bl. 2.8, 4 min auf Kodak Ektachrome Panther 1600
63
Abb. 2.51: Komet Hale Bopp am
29. März 1997; 50 mm, Bl. 2.8, 25 min
auf Kodak Ektachrome 64 T
Beide Kometen waren absolute
Ausnahmen in Größe und
Helligkeit. Es kommt
normalerweise nur alle paar
Jahrzehnte vor, daß ein derart
großer Komet den Nachthimmel
erhellt. Im Falle Hyakutake und
Hale-Bopp waren es gleich zwei
Kometen in nur einem Jahr
Abstand.
Wie schon erwähnt war uns der
Komet Hale-Bopp nie näher als
die Sonne. Trotzdem scheint
sogar der Kopf des Kometen
größer als die Sonne (man
beachte, daß Abb. 2.51 eine
Normalobjektivaufnahme ist !).
Beachtet man auch noch den
Kometenschweif, so wird klar,
daß Kometen die größten
Objekte im Sonnensystem sind.
Trotz ihrer Größe gehören
Kometen zu den leichten Objekten im Sonnensystem mit einer vernachlässigbaren Masse
(vernachlässigbar im Vergleich zu den Planetenmassen; Kometen haben nur bis zu
1012 Tonnen), die fast zur Gänze in ihrem Kern (bis 100 km Durchmesser) vereinigt ist.
Kometenkerne sind i. a. so klein, daß sie auch mit großen Teleskopen nur als
Punktlichtquelle gesehen werden können. Je näher ein Komet der Sonne kommt, desto mehr
beginnt er sich in seine Bestandteile aufzulösen. Kometen sind nicht etwa große Felsblöcke
wie Planetoiden, es sind vielmehr aus kleineren Blöcken (1/1000 mm bis 1 m Durchmesser)
zusammengesetzte Himmelskörper. Als Bindemittel dient dabei Eis aus Ammoniak, Methan
oder Kohlendioxid (aber auch Wassereis kann vorkommen), was die anderen Bestandteile des
Kometen, wie Stein, Staub und Eisenmeteoriten, zusammenhält. Sobald der Komet ins innere
Sonnensystem vordringt, bildet sich durch die Wirkung der Sonnenstrahlung eine Gaswolke
die den Kometen umgibt, die sogenannte Koma ( etwa 1015 Teilchen pro Kubikmeter). Die
Koma besteht aus einfachen Molekülen, die meist aus Sauerstoff, Kohlenstoff, Stickstoff und
Wasserstoff aufgebaut sind. Sie werden von der UV-Strahlung der Sonne zum Fluoreszieren
angeregt. Die grüne Farbe in der Koma von Hyakutake in Abb. 2.50 kommt vom Kohlenstoff
(C2-Bande).
Die Fluoreszenzhelligkeit hängt stark von der Sonnenaktivität ab, weshalb Eruptionen auf der
Sonne zu Helligkeitsausbrüchen der Kometenkoma führen können.
Satellitenmessungen haben gezeigt, daß die Kometenkoma von einem Halo aus Wasserstoff
umgeben ist, dessen Durchmesser typischerweise den zehnfachen Sonnendurchmesser
entspricht! In Sonnennähe beginnt der Sonnenwind und der Strahlungsdruck immer stärker zu
werden und die von der Sonne ausgehenden geladenen Teilchen reißen die Gase der Koma
64
vom Kometenkern weg. Es entsteht der charakteristische Plasmaschweif, der deswegen
meist von der Sonne weggerichtet ist. Die Schweiflänge kann in Ausnahmefällen sogar bis
300 Millionen km betragen (weiter also als der Abstand Erde-Sonne). Der Plasmaschweif
besteht Großteils aus CO+, CO2+, CH+, N2+, OH+ und freien Elektronen. Die Dichte im
Schweif beträgt nur 10 bis 100 Millionen Teilchen pro Kubikmeter, ein äußerst gutes
Hochvakuum. Wegen der geringen Dichte beträgt die Gesamtmasse des Schweifes nur 100
Millionen Tonnen, das ist nicht einmal ein Billionstel der Erdmasse. Der Plasmaschweif hat
eine charakteristische blaue Farbe, die von der CO+-Linie (426 nm) stammt. Nachdem der
Plasmaschweif aus geladenen Teilchen besteht, reagiert er empfindlich auf Magnetfelder. So
erklären sich die manchmal auftretenden korkenzieherartigen gedrehten Kometenschweife,
die sich im interplanetaren Magnetfeld winden.
In Abb. 2.51 ist noch ein zweiter fast weiß leuchtender Schweif erkennbar. Er ist deutlich
vom Plasmaschweif getrennt. Es handelt sich dabei um den sogenannten Staubschweif, der
aus Staubartikeln besteht, die das Sonnenlicht streuen und reflektieren, weshalb dieser
Schweif in etwa die Farbe der Sonne hat. Die Staubteilchen sind im Vergleich zu den
Molekülen des Plasmaschweifes ungleich schwerer, weshalb sie den Kometen mit einer viel
geringeren Geschwindigkeit verlassen und dabei ein klein wenig von der Kometenbahn
nachzeichnen.
Die Staubteilchen die die Kometen auf ihren Bahnen verlieren, können, wenn die Erde ihre
Bahn stört, großartige Sternschnuppenströme auslösen.
2.5.5 Resümee
Die letzten Seiten sollten zeigen wie weit man mit einer bescheidenen fotografischen
Ausrüstung in den Weltraum vordringen kann. Prinzipiell sind alle Aufnahmen mit der in den
vorigen Kapiteln beschriebenen Schottischen Montierung machbar. Die 200 mm -Aufnahmen
sind aber bereits eine Herausforderung und etwas Glückssache, weshalb die hier gezeigten
200 mm - Aufnahmen, bis auf eine Ausnahme (Abb. 2.30), nicht mit der Schottischen
Montierung gemacht wurden. Mit ein Grund ist auch das hohe Gewicht des 200 mm
Objektivs des Autors, für das die Schottische Montierung einfach zu schwach ist. Alle
anderen Aufnahmen wurden aber mit der Schottischen Montierung nachgeführt.
Noch ein Wort zu den 200 mm Objektiven, die man normalerweise nicht in der Astronomie
findet, da ihre Brennweite zu kurz ist. Am 23 Januar 1999 konnte mit einer automatischen
Roboterkamera in Los Alamos, die mit 4 Stk. 200 mm Objektiven ausgestattet war, zum
ersten Mal ein richtig helles Gegenstück zu einem Gammastrahlenausbruch, jener noch immer
rätselhaften Erscheinung im Universum, sichtbar gemacht werden. Das gelang nur, weil die
Kamera so schnell auf die Messungen des Röntgensatelliten reagieren konnte und man nicht
erst warten mußte, bis eines der großen Teleskope Beobachtungszeit übrig hatte. Das optische
Gegenstück des Gamma-Ray-Bursts war so hell, daß man es im Feldstecher hätte sehen
können. Spätere Messungen zeigten eine große Rotverschiebung, was auf eine Entfernung
von Milliarden Lichtjahren schließen läßt.
Zitat aus Sterne und Weltraum 4/99, Seite 328:
65
"Dieses Licht wurde ausgesandt, als das Universum weniger als 40 % seiner heutigen Größe
erreicht hatte. Dieser Lichtblitz mußte mehr als hunderttausendmal so hell gewesen sein wie
eine Supernova. Das Hellste was man bisher am Himmel beobachten konnte. Wäre der Blitz
zum Beispiel aus dem Sternhaufen der Plejaden gekommen (Entf. 400 Lj), wäre er auf der
Erde als winziger Lichtblitz so hell gewesen wie die Sonne. Ein irdischer Beobachter hätte
augenblicklich ein irreparables Loch in der Netzhaut eingebrannt bekommen (er hätte daran
aber nicht lange leiden müssen, denn er wäre nur kurze Zeit später an den Folgen der
Gammastrahlenbelastung gestorben). "
3 Mond und Planeten
3.1 Der Mond
3.1.1 Allgemeines
Die Erde ist eigentlich ein Doppelplanet, denn sie besitzt relativ zum Hauptplaneten einen der
größten Trabanten im Sonnensystem (Neben dem Pluto-System der zweitgrößte Mond).
Beide Himmelskörper umkreisen ihren gemeinsamen Schwerpunkt in 27.32 Tagen (in Bezug
auf die Fixsterne). Von der Erde aus gesehen dauert ein Mondumlauf im Mittel 29.5 Tage,
also beinahe einen vollen Monat. Der Mond ist uns mit einer mittleren Entfernung von 384
400 km so nahe, daß schon mit bloßem Auge Oberflächendetails erkennbar sind. Auffällig
sind die dunklen Mare, die sich gegen die hellen Hochländer als sogenanntes Mondgesicht
abzeichnen. Die Mondkrater hingegen sind bereits im kleinen Feldstecher sichtbar. Mehr
Details liefert natürlich das Teleskop.
Bevor man sich jedoch aufmacht, um den Mond zu beobachten, sollte man sich fragen wo er
gerade zu finden ist. Nach ein paar Monaten der Mondbeobachtung wird jeder einen Sinn
dafür entwickeln, wo der Mond zu finden ist, genauso wie man einen Sinn dafür hat wo die
Sonne gerade ist. Bis es soweit ist kann man die Position des Mondes in einem Jahrbuch oder
in einer astronomischen Zeitschrift nachschlagen. Auch die meisten Tageszeitungen drucken
die Zeiten für Sonnenauf- und -untergang und Mondauf- und -untergang auf ihren
Wetterseiten ab.
66
Der Mond ist so hell, daß er leicht aus der Großstadt beobachtet werden kann. Er ist das
empfehlenswerteste Objekt für den Anfänger, weil er zudem leicht zu finden ist und eine
Abb. 3.1: Der aufgehende Vollmond am 25 August 1999. Die scheinbar dunkle Wolke über dem
Horizont ist der aufgehende Erdschatten. 105 mm Tele, Bl 2.8, automatisch belichtet auf
Fujichrome Velvia.
Fülle von unbekannten Details zeigt. Bereits ohne optische Hilfsmittel kann man das
aschgraue Mondlicht beobachten, welches entsteht, wenn der unbeleuchtete Teil des Mondes
von der Erde beleuchtet wird. Das aschgraue Mondlicht ist deshalb nur bis zum ersten Viertel
und ab dem letzten Viertel bis Neumond beobachtbar. Das aschgraue Mondlicht variiert nicht
nur mit der Stellung des Mondes sondern auch mit der Großwetterlage auf der Erde. Je mehr
weiße Wolken, die das Sonnenlicht reflektieren, sich auf der Tagseite der Erde befinden,
desto heller ist die Erde vom Mond aus gesehen und desto heller ist deshalb auch das
aschgraue Mondlicht.
67
Auch die von Tag zu Tag sich ändernde
Lichtgestalt (Phase) kann ohne optische
Hilfsmittel verfolgt werden. Mit dem
Feldstecher wächst die Zahl der sichtbaren
Objekte wie: Krater, Gebirge, helle Strahlen
etc. Alle Mondformationen können am
besten an der Tag-Nacht-Grenze, an der
Grenze zwischen dem beleuchteten und
unbeleuchteten Teil des Mondes, dem
sogenannten Terminator beobachtet werden.
Alle Erhebungen werfen hier deutliche und
weite Schatten, weil für diese Teile des
Mondes die Sonne sehr tief steht.
Der Mond bewegt sich um die Erde
synchron zu seiner Rotation, d. h. daß wir
immer nur dieselbe Seite des Mondes sehen
Abb. 3.2: Das aschgraue Mondlicht am 12. Nov. 1999.
können. Diese Synchronität entstand wegen
Der Mond ist gerade vier Tage alt. 105 mm,
der starken Gezeitenwirkung der Erde auf
Bl 2.8, 6 s auf Fujichrome Velvia.
den Mond, die seine Eigenrotation zum
Stillstand brachte und ihn in ein
Rotationsellipsoid verwandelte, dessen längste Achse in Richtung Erde gerichtet ist.
Die auffälligsten Oberflächenerscheinungen, die bereits im Feldstecher ausgemacht werden
können sind die Mondkrater. Es sind sowohl Einschlagskrater als auch Krater vulkanischen
Ursprungs. Es wurden allein auf der Vorderseite des Mondes über 33 000 von ihnen
kartografiert. Es gibt Krater in allen Größen, von über 100 km Durchmesser (die sogenannten
Wallebenen) bis zu wenigen Mikrometer großen, die man auf Mondgestein fand, das die
Apollo Missionen mit auf die Erde brachten. Der Mond hat keine schützende Atmosphäre,
weshalb auch die kleinsten Meteoriten einen Krater schlagen können.
Die großen Mondkrater wurden nach berühmten Menschen benannt. Auf Mondkarten findet
man Namen wie Kopernikus, Archimedes, Tycho oder Aristach. Für Newton oder Einstein
blieben vergleichsweise nur bescheidene Krater, weil man vor ihnen bereits den Mond zu
kartografieren begann. Erst als man die Mondrückseite kartografierte wurde wieder Platz für
Schrödinger, Planck, Boltzmann, Mach, Sommerfeld und so weiter.
Die dunklen Ebenen werden auch Meere (lat. Maria, singular: Mare) genannt, weil sie
entfernt an große Wasserflächen erinnern. Es sind riesige mit Lava gefüllte Becken. Sie
entstanden wahrscheinlich nach dem letzten großen Meteoritenbombardement auf dem Mond.
Die größten von den steinernen Geschossen haben dabei die gigantischen Krater geschaffen,
die dann mit flüssiger Lava aus dem Mondinneren gefüllt wurden und die auch die
umgebende tiefliegende Mondoberfläche überflutete. Der Mond war zu dieser Zeit noch
wesentlich heißer als er es heute ist, denn sein Inneres wurde von radioaktiv zerfallenden
Substanzen aufgeheizt. Die Maria sind deshalb aus anderem Material als die Hochländer. Die
Lava hat alle Oberflächenmerkmale, die sich vorher in dem Gebiet der Maria befanden,
überflutet und dadurch eine glatte Oberfläche erzeugt. Seither sind etwa 4 Milliarden Jahre
vergangen. Und kleinere Meteoriteneinschläge haben ihre Spuren in den sonst so glatten
Maria hinterlassen. In Abb. 3.3 und Abb. 3.4 findet man das Mare Crisium (Meer der Krisen)
und das Mare Fecunditat (Meer der Fruchtbarkeit). Beide haben eine glatte Oberfläche, die
nur sehr wenige Krater zeigt. Man findet auch einige Verwerfungen die bei der Erstarrung der
Lava entstanden sein dürften.
Sowohl vulkanische Aktivität als auch Meteoriteneinschläge haben die Mondoberfläche so
bizarr geformt. Aber es ist schwierig zu entscheiden, welcher Mechanismus vorherrschend
war. Da gibt es zum Beispiel die sogenannten Kraterketten, das sind Reihen von
68
Mondkratern, die eine Ketten bilden. Ein Beispiel ist die große Kraterkette, die von den
Mondkratern: Endymion, Cleomedes, Langrenus, Vendelinus, Petavius und Janssen gebildet
wird. (Wahrscheinlich gehört sogar das Mare Crisium zu der Kraterkette.) Sie könnten
entstanden sein, als ein großer Meteorit durch die Gezeitenwirkung des Mondes zerbrach und
seine Trümmer auf dem Mond wie eine Kette einschlugen. Es scheint aber wahrscheinlicher,
daß diese Krater entlang eines Risses in der Mondkruste entstanden sind, wobei Material aus
dem Mondinneren hervorquoll, abkühlte und dann zu einem Krater zusammenbrach.
Langrenus hat ein kompliziertes
Zentralgebirge und reichlich
strukturierte Kraterwände. Diese
erheben sich 3000 m über die
tiefste Stelle seines Bodens.
Vendelinus scheint der älteste
Krater der Kette zu sein, denn
seine Wände sind
unregelmäßiger und scheinen
weit weniger gut erhalten zu sein
als jene von Petavius und
Langrenus.
Es ist aber auch möglich, da
Vendelinus keinen Zentralberg
besitzt, daß dieser Krater von
den vom Mare Fecunditat
ausströmenden Lavamassen
überflutet wurde und so zu einer
sogenannten Wallebene wurde.
Eine der schönsten Wallebenen
befindet sich am nördlichen
Rande des Mare Imbrium und
wird Plato genannt (Abb. 3.5 und
Abb. 3.6). Plato hat einen
Durchmesser von knapp 100 km.
Mit etwa 1200 m ragen seine
Wände relativ wenig über das
Innere empor. Der Boden von
Plato ist besonders dunkel,
weswegen er besonders leicht zu
finden ist. Wie Vendelinus hat
Abb. 3.3: Fünf Tage alte Mondsichel; am 14 Sep. 1999, im
auch Plato keinen Zentralberg
Primärfokus eines 12 " SCT bei 3 m Brennweite, ¼ s auf
Agfa CTx 100
und der Boden weist außer
einigen kleinen Einschlagskratern keine besonderen Merkmale auf. Von der Erde aus scheint
Plato elliptisch verzerrt. In Wirklichkeit bildet er einen beinahe perfekten Kreis. Auch
Archimedes, eine Wallebene von 80 km Durchmesser, fällt im Mare Imbrium (Regenmeer)
sofort auf.
Zu den eindrucksvollsten Objekten auf dem Mond gehört das große Tal, welches am Rande
des Mare Imbrium die Alpen durchschneidet (Abb. 3.5 und 3.6). Es ist 13 km lang und sicher
durch einen Bruch entstanden. Frühere Erwägungen, daß es durch einen Meteorit in das
Gebirge gefräst sei, sind damit abgetan. Es gibt noch eine Anzahl anderer Täler, aber keines
ist so regelmäßig und auffällig wie das Tal der Alpen.
Stark gebogen und gewunden ist das Schrötertal (Abb. 3.7) in der Nähe des leuchtenden
Kraters Aristachus. Schröters Tal wird auch oft als Rille bezeichnet, weil es bereits relativ
69
schmal ist. Rillen und Spalten sind zwar i. a. nicht so imposant, deswegen sind sie aber nicht
weniger interessant. Oberflächlich sehen sie wie Risse aus, die in getrocknetem Schlamm
entstanden sind. Es gibt aber keine echte Entsprechung. Es sind vielmehr kollabierte
Lavaröhren, die übriggeblieben sind aus der Zeit als das geschmolzene Gestein die
Mondoberfläche flutete. Einige dieser Rillen kann man schon in kleinen Fernrohren sehen. So
zum Beispiel die Hyginus-Rille und die Ariadeus-Rille, die das Mare Vaporum (Meer der
Dämpfe) und das Mare Tranquillitatis (Meer der Ruhe) verbindet. Die Hyginus-Rille stellte
sich auf einer Orbiter-3-Aufnahme teilweise als Kraterkette heraus. Andere Rillen haben
keine kraterartigen Ausweitungen und können eine sehr verwickelte Netzstruktur aufweisen.
Manche Krater wie Gassendi (Abb. 3.8) haben ganze Rillensysteme auf ihren Böden. Manche
Rillen haben konvexe Böden und recht steile Wände.
Rillen zählen zu den
eindrucksvollsten Gebilden auf
dem Mond. Scott und Irwin von
Apollo 15 sind mit ihrem
Mondfahrzeug bis unmittelbar
an den Rand der Hadley-Rille in
den Vorbergen der Apenninen
gefahren. Echte Verwerfungen
sind auf dem Mond weniger
häufig. Das bei weitem beste
Beispiel ist die Gerade Wand im
Mare Nubium (Meer der
Wolken). Sie liegt zwischen den
Kratern Thebit und Birt
(eventuell Abb. 3.8). Ihr Name
ist etwas unzutreffend, da sie
weder eine Wand noch gerade
ist. Diese Verwerfung ist 130
km lang und überwindet einen
Höhenunterschied von 240 m.
Auch der Böschungswinkel ist
mit 40° nicht so steil wie
ursprünglich angenommen
(70°). Vor Vollmond erscheint
die Gerade Wand als dunkler
Strich. Nach Vollmond, wenn
sie von der anderen Seite
beleuchtet wird, erscheint sie als
helle Linie.
Aristachus ist die hellste
Formation auf dem Mond und
Abb. 3.4: Ausschnitt aus Abb. 3.3 (Mare Crisium bis Petavius);
hat knapp 40 km Durchmesser
Okularprojektion (20 mm Weitwinkelobjektiv in
(Abb. 3.7). In der Nähe von
Retrostellung) bei etwa 12 m Brennweite,
1
Aristachus befindet sich auch
s auf Agfa CTx 100
der Phantomkrater Prinz, eine
Wallebene, die nur zur Hälfte aus dem Lavameer des Oceanus Procellarum (Ozean der
Stürme) herausragt.
Es gibt auch einige Krater auf dem Mond die unverkennbar durch Meteoriteneinschläge
entstanden sind. So zum Beispiel die Krater Kopernikus und Tycho (Abb. 3.5).
70
Abb. 3.5: Der schon fast volle Mond; am 15 Mai 2000,
3 m Brennweite, 1/20 s auf Fujichrome Velvia
Es sind sogenannte
Strahlenkrater, von denen man
über 60 kennt. Die Strahlen, die
von diesen Kratern ausgehen,
sind ausgeworfenes Material, das
wesentlich heller ist als seine
Umgebung. Die Strahlen sind
besonders zu Vollmond gut zu
sehen. Möglicherweise enthalten
sie eine Art winziger
Glasmurmeln, die durch die
enorme Hitze beim Einschlag des
Meteoriten entstanden sind. Die
meisten Strahlensysteme sind
wenig auffällig.
Bei Tycho reichen die Strahlen
bis in eine Entfernung von
1000 km von dem Krater
(Abb. 3.5). Bei anderen sieht
man nur einen hellen Hof um den
Kraterwall herum. Die Strahlen
sind mehrere Kilometer breit und
verlaufen völlig geradlinig. Sie
werden durch
dazwischentretende
Oberflächengebilde nicht gestört.
Sie zeigen auch keinerlei
Schatten, weshalb es sich um
eine dünne Aufschichtung
feinerer Materialien höherer
Abb. 3.6: Das Mare Imbrium mit Archimedes und Plato; links unten ist das Schrötertal zu erkennen;
am 15 Mai 2000, ½ s auf Fuji Velvia, sonst wie Abb. 3.4.
71
Reflexionseigenschaft handeln
muß. Die Wände von
Copernicus und Tycho sind
terrassenartig abgestuft.
Copernicus ist für einen Krater
seiner Größe mit etwa 3
Kilometer außergewöhnlich tief.
Im Vergleich zu seinem
Durchmesser von über 90 km ist
das aber relativ.
In Abb. 3.8 erkennt man das
Hochland von Fra Mauro, wo
die verunglückte Apollo 13
Mission ihren Höhepunkt hätte
finden sollen. Statt dessen wurde
Fra Mauro von Apollo 14
besucht.
Dieses Bergland war viel rauher
als die Landepositionen der
Apollo-Missionen zuvor.
Neben den runden
Gebirgsformen gibt es auch
langgestreckte Kettengebirge,
die zum Teil Namen bekannter
irdischer Gebirge erhalten
haben. Auf der Süd-, Ost und
Nordseite des Mare Imbrium
Abb. 3.7: Schröters Tal, Aristach und Prinz;
liegen etwa im Halbkreis
Daten wie Abb. 3.6;
angeordnet die Karpaten,
Apenninen, der Kaukasus, die Alpen und der Jura. Die größte Spannweite haben die
Apenninen mit 1000 km, deren größte Höhen 6500 m erreichen. Viel höher, mit maximal 10
72
Abb. 3.8: Im Fra Mauro Hochland landete Apollo 14; links ist der Krater Gassendi zu erkennen;
Daten wie Abb. 3.6;
000 m, ist das Dörfel-Gebirge und das Leibnitz Gebirge mit maximal 11 350 m. Beide
Formationen liegen in der Nähe des Südpols des Mondes, von der Erde aus randnah, weshalb
sie mit Fernrohren nur ungenau beobachtet werden können. Auf der Mondrückseite gibt es
nur die Cordilleren und das Rook-Gebirge als konzentrische Begrenzungen des Mare
Orientale, das noch teilweise auf die Mondvorderseite herüberragt. Typische Gebirge, vor
allem Kettengebirge, fehlen auf der erdabgewandten Seite des Mondes. Es fehlen dort auch
die Maria, an deren Rand sich die Gebirge befinden, fast völlig.
Es gibt zwar auf dem Mond keine Erosion wie auf der Erde, aber die Strahlung der Sonne, die
kosmische Strahlung sowie Mikrometeorite setzen dem Mondgestein zu. Es entstand eine
mehrere Meter dicke Trümmerschicht aus lockerem Mondstaub. Die eigentliche Staubschicht
ist dabei nur einige cm dick. Darunter sind die Gesteinstrümmer deutlich verkrustet. Diese
Erosion auf dem Mond geht nur sehr langsam vor sich (etwa 2 cm pro Milliarde Jahre), so daß
die Fußabdrücke der Apollo-Astronauten noch lange erhalten bleiben werden.
Die meisten der gerade beschriebenen Oberflächenformationen sind mit relativ kleinen
Teleskopen zu beobachten. Dabei kann man am Mond die Handhabung eines Teleskops gut
erlernen. Es macht nichts, wenn man einmal ungewollt am Teleskop anstößt und dabei den
Mond aus dem Gesichtsfeld verliert. Er ist leicht wieder zu finden. Man lernt wie feinfühlig
man das Teleskop bewegen muß, um nicht von einem Ort zum anderen zu hüpfen, sondern
vielmehr über die Mondoberfläche zu gleiten. Man erkennt wie empfindlich die Fokussierung
des Teleskops reagiert, wenn man unterschiedliche Vergrößerungen wählt und immer wieder
neu scharfstellen muß. Jeder Beobachter muß für sich die richtige Vergrößerung finden, damit
die Oberflächendetails nicht wieder durch eine zu hohe Vergrößerung verschwinden. Als
Faustregel hat sich gut bewährt als Vergrößerung den Objektivdurchmesser in mm zu
verwenden. Manchmal, wenn es die Luft erlaubt, kann man auch darüber hinaus gehen. Der
Mond im Teleskop ist für viele eine völlig neue Welt. Man kann die Mondoberfläche
stundenlang absuchen, ohne je dieselbe Stelle zu beobachten. Jede Nacht, wenn der dunkle
Schatten des Terminators sich seinen Weg entlang über das Gesicht des Mondes bahnt, zeigt
sich ein anderer Anblick im Okular. Die Schatten werden länger oder kürzer und feine
kontrastarme Details erscheinen und verschwinden. Selbst wenn man die untere ApolloLandestufe nicht sehen kann - sie ist viel zu klein - so ist es dennoch ein erhebendes Gefühl
einmal das Mare Tranquillitatis aufzusuchen und das Landeareal von Apollo 11 ausfündig zu
machen - "where the Eagle has landed".
In größeren Teleskopen kann der Mond schon so hell erscheinen, daß es besser ist ein
Dämpfglas zu verwenden, um das grelle Mondlicht zu mildern. Manche Beobachter
verwenden dazu zwei stufenlos gegeneinander drehbare Polfilter, um die Helligkeit an die
jeweilige Mondphase anzupassen. Verschiedene Details lassen sich durch das Dämpfglas
besser erkennen, ja ihr Kontrast steigt scheinbar an. Das hat mit der "Bildverarbeitung" im
Auge und Gehirn zu tun. Viele Mondbeobachter beschreiben auch den erfolgreichen Einsatz
von Binokularansätzen, die die Rechenleistung des Gehirns erst so richtig ausnützen.
3.1.2 Mondfotografie
Beinahe jedes Teleskop eignet sich zur Fotografie des Mondes, sofern man nicht allzu hohe
Erwartungen stellt. Pro Meter Brennweite erzeugt das Teleskop ein Bild der Mondscheibe
von etwa 10 mm Durchmesser. Das bedeutet, daß bis zu einer Brennweite von 2.5 Meter der
ganze Mond auf dem Kleinbildformat Platz findet. Darüber hinaus muß man sich mit
Ausschnitten zufriedengeben. Zur Brennweitenverlängerung können handelsübliche
Telekonverter ebenso verwendet werden wie die gängige Methode der Okularprojektion
(siehe Kapitel über Sonnenfotografie). Die mit der Verlängerung der Brennweite
einhergehende Verringerung der Lichtstärke erfordert auch längere Belichtungszeiten. Das
73
hat den Nachteil, daß sich bei längeren Belichtungszeiten die Luftunruhe stärker auswirken
kann und dabei das Bild trotz guter Fokusierung unscharf wird. Man wird daher
optimalerweise einen Kompromiß zwischen Belichtungszeit und Brennweite schließen.
Manchmal ist es besser mit kürzeren Brennweiten und kürzeren Verschlußzeiten zu
fotografieren und dann einen Ausschnitt aus dem erhaltenen Negativ anzufertigen. Man
gelangt so eventuell zu schärferen Bildern. Als Kamera kann man einäugige
Spiegelreflexkameras ebenso verwenden wie CCD-Kameras oder Videokameras. Letztere
haben den Vorteil einer sofortigen Kontrolle des Ergebnisses sind aber in der Kontrastleistung
etwas hinterher.
Die großen Unterschiede in der scheinbaren Helligkeit des Mondes während der einzelnen
Phasen stellen den Fotografen vor ein spürbares Problem. Die Helligkeit nimmt leider nicht
proportional mit der beleuchteten Fläche zu oder ab. Gegenüber Vollmondaufnahmen ist die
Belichtungszeit für Aufnahmen während des Ersten und Letzten Viertels etwa um den Faktor
4 zu verlängern, für die 3 bzw. 24 Tage alte Mondsichel gar um den Faktor 12. Es ist günstig,
die richtige Belichtung in die Nähe des Terminators zu legen, so daß die Gegenden steileren
Lichteinfalls erheblich überbelichtet sind. Während man bei Vollmond mit
Intensitätsunterschieden von etwa 1:50 zu kämpfen hat, steigern sich diese bei anderen
Phasen auf bis zu 1:1000. Man hat also mit der Wahl der richtigen Belichtungszeit zu
kämpfen und man kommt so oder so um einige Probebelichtungen nicht herum. Einen
Anhaltswert für die Belichtungszeit liefert der Belichtungsmesser der Kamera. Ist der Mond
deutlich kleiner als das Meßfeld, so erhält man logischerweise überbelichtete Aufnahmen.
Hier bewährt sich die Spotmessung, sofern die verwendete Kamera eine besitzt. Es kann auch
passieren, speziell bei kleinem Öffnungsverhältnis in der Projektionsfotografie, daß die
richtige Belichtungszeit außerhalb des Meßbereichs der verwendeten Kamera liegt. Für solche
Fälle kann man die Kamera überlisten indem man einfach die Filmempfindlichkeit höher
einstellt und dann die gemessene Belichtungszeit entsprechend verlängert. Man kann zu
Beginn einmal versuchen, die von der Kamera gezeigte Belichtungszeit und einmal die
doppelte, die halbe und ein viertel dieser Verschlußzeit zu verwenden. Meist sind die etwas
unterbelichteten Aufnahmen die besseren.
In Projektion können die Belichtungszeiten schon einmal einige Sekunden erreichen, so daß
eine gute Nachführung unumgänglich ist. Es ist aber nicht unbedingt nötig, die
Nachführgeschwindigkeit auf die scheinbar etwas geringere Geschwindigkeit des Mondes
einzustellen. In den wenigen Sekunden der Belichtung spielt diese Differenz keine Rolle. Die
Mondgeschwindigkeit ist jedoch sinnvoll, wenn man mehrere Minuten mit gespanntem
Auslöser und dem Auge am Sucherokular klebend auf einen Moment besonders ruhiger Luft
wartet, da sonst bei entsprechend hoher Vergrößerung, der eingestellte Krater immer wieder
aus dem Blickfeld wandert.
Fotografiert man im Primärfokus so hat man den Vorteil kurze Belichtungszeiten selbst mit
niedrigempfindlichen, feinkörnigen und kontrastreichen Filmen zu erreichen. Dafür ist die
Scharfstellung ein gewisses Problem. Die Mattscheiben der Kameras sind nicht für
Öffnungsverhältnisse kleiner als 1:5.6 ausgelegt und zeigen kein klares Bild mehr. Es ist
vielmehr mit groben dunklen Körnern übersät. Noch weniger funktioniert der
Mikroprismenraster oder der Schnittbildindikator. Dieser ist meist auf einer Seite abgedunkelt
und zeigt auf der anderen Seite ein scharfes Bild durch welches man sich aber keinesfalls
täuschen lassen darf. Man muß also wohl oder übel mit der Mattscheibe fokussieren.
Modernere Spiegelreflexkameras oder Profikameras besitzen bereits sehr gute Mattscheiben,
mit denen es sich gut leben läßt. Trotzdem ist die Verwendung einer Sucherlupe sehr
hilfreich. In Okularprojektion treten diese Probleme der richtigen Schärfe bei weitem nicht so
gravierend in Erscheinung, trotzdem ist es recht schwierig, den richtigen Fokus zu erwischen.
Aus Gründen der Statistik hat es sich als lohnenswert erwiesen bei jedem Foto neu scharf zu
stellen. So kann man wenigstens auf einen Zufallstreffer hoffen.
74
Alte Hasen verwenden für die Mondfotografie bevorzugt Schwarzweißfilme - hier am
liebsten den Kodak Technical Pan. Dem Anfänger kann man ruhigen Gewissens Farbfilme
empfehlen, dadurch ist er nicht mit den Techniken der Filmentwicklung und Vergrößerung
belastet.
Der Diafilm ist unbedingt richtig zu belichten, er erlaubt keinen Belichtungsspielraum wie der
Negativfilm, der durch seinen Belichtungsspielraum die Gefahr einer Über- bzw.
Unterbelichtung verringert. Farbnegativfilme weisen zudem bei gleicher Empfindlichkeit ein
erheblich feineres Korn auf als Diafilme. Es ist nahezu unmöglich, zu einem gewissen
Fabrikat zu raten, da die Hersteller die Zusammensetzung ihrer Emulsionen häufig ändern,
was meist zu einer Veränderung der Farbwiedergabe und des Schwarzschildverhaltens führt.
Letzteres ist in der Mondfotografie längst nicht so kritisch wie in der Deep-Sky-Fotografie.
Man ist jedoch gut beraten, sich in den einschlägigen Zeitschriften umzusehen und eventuell
einige der angegeben Filme auszuprobieren.
Der Autor verwendet gerne kontrastreiche Diafilme der Professional-Klasse, da sie am
ehesten farbneutral sind. Zudem lassen sich Dias einem größeren Publikum vorführen.
Zuletzt sei noch erwähnt, daß bei hohen Vergrößerungen kleine Farbsäume an allen "Kanten"
auf der Mondoberfläche aufzutreten scheinen, die schlußendlich die maximale Auflösung
begrenzen. Es handelt sich dabei um einen atmosphärischen Effekt. Das Licht vom Mond
oder einem anderen Himmelskörper durchdringt die Erdatmosphäre und wird von ihr
gebrochen. Nachdem auch die Luft eine kleine Dispersion aufweist, blaues Licht wird stärker
gebrochen als rotes, kommt es zu diesem atmosphärischen Spektrum oder
Refraktionsspektrum. Dieser Effekt zeichnet sich dadurch aus, daß alle tiefstehenden Objekte
in Richtung Zenit einen blauen Rand und zum Horizont hin einen roten Rand aufweisen.
Schon in Höhen von weniger als 30° über dem Horizont und gerade an hellen Lichtquellen
macht sich die atmosphärische Dispersion störend bemerkbar. Ein Stern oder Planet in einer
Höhe von 10° über dem Horizont ist bereits auf eine Strecke von ca. 7 Bogensekunden
senkrecht zum Horizont strichförmig verschmiert. Dieser Effekt ist in diesen geringen Höhen
über dem Horizont aber meist nicht der einzige. Dadurch, daß man in dieser geringen Höhe
durch weit mehr Luft blickt, machen sich hier Luftturbulenzen weit schlimmer bemerkbar und
begrenzen das Auflösungsvermögen dadurch beträchtlich. Will man das atmosphärische
Spektrum unterdrücken, so kann man mit Farbfiltern einen kleinen Teil des Spektrums des
einfallenden Lichts herausfiltern und erhält so eine höhere Auflösung.
3.1.3 Mondfinsternisse
Partielle oder Totale Mondfinsternisse können von jedem Teil der Erdoberfläche gesehen
werden, sofern der Mond zum entsprechenden Zeitpunkt über dem Horizont steht und das
Wetter mitspielt. Wenn der Mond in den Halbschatten der Erde eintritt, ist er nur etwa halb so
hell wie vor dem Eintritt. Der Helligkeitsunterschied ist kaum merkbar und auch fotografisch
nicht relevant. Erst mit dem Eintritt in den Kernschatten beginnt der Mond sich merklich
rötlich zu verfinstern. Das rötliche Licht in der Kernschattenzone ist von der Erdatmosphäre
gebrochenes Sonnenlicht, das durch Rayleigh-Streuung und (in niedrigen
Atmosphärenschichten) durch Extinktion, deren hauptsächliche Ursache die molekulare
Streuung des Lichts ist, gefärbt wird. Die Extinktion wird aber auch durch die Bewölkung am
Terminator der Erde und durch Staub in der Atmosphäre verursacht. Jede meteorologische
Erscheinung am Erdterminator, also dort, von wo die Sonnenstrahlen in den
Kernschattenkegel hineingebrochen werden, hat mehr oder weniger großen Einfluß auf das
Aussehen der Finsternis. Dieses ändert sich natürlich in dem Maße, als die Erde weiter rotiert
und immer neue Zonen mit anderen Wetterverhältnissen auf den Mond projiziert. Auch die
wolkenlose Atmosphäre zeigt jahreszeitliche und geographische Effekte. Am Pol ist zum
75
Beispiel die Brechung stärker und die Wolkenschicht reicht nicht so hoch. Daraus resultiert
eine stärkere Aufhellung des Schattenzentrums. Auch Vulkanausbrüche und Staub von
Meteoriten haben einen Einfluß auf das Aussehen einer Mondfinsternis. Nach dem Ausbruch
des Vulkans Pinatubo 1991 waren die darauffolgenden Mondfinsternisse deutlich dunkler als
sie bei ungestörter Atmosphäre sind. Auch frühere Beobachtungen zeigen, daß infolge
größerer vulkanischer Eruptionen, bei denen die Vulkanasche in die Stratosphäre transportiert
wird und durch Zirkulation über den ganzen Erdball verteilt wird, Mondfinsternisse mit
extremer Dunkelheit auftreten.
In anderer Weise wirkt der beim Einfall von Meteoriten erzeugte Meteorstaub, weil sich
dieser in wesentlich größerer Höhe befindet (100 - 150 km). Er bewirkt dadurch eine
Vergrößerung des Schattens. Die größeren Meteorströme scheinen auch ein Absinken der
Helligkeit des verfinsterten Mondes zur Folge zu haben.
Abb. 3.9: Totale Mondfinsternis am 21 Jänner 2000; das 4. Bild von links zeigt den
3.
Kontakt; Reihenbelichtung mit Belichtungszeiten von 6 s bis 2 s in je 5 min Abstand,
105 mm Brennweite, Blende 2.8, feststehende Kamera (6:11 bis 6:50 MEZ)
Die spektrale Verteilung des auf den Mond fallenden Lichts wird auch durch das
atmosphärische Ozon maßgeblich beeinflußt. Es erzeugt nämlich Absorptionen im Spektrum,
die ein empfindliches Maß für die Gesamtmenge des in 20 bis 25 km Höhe vorhandenen
Ozons sind. Die Ozonabsorption ist der Grund für das Auftreten einer schmalen, grünlich
verfärbten Zone am Schattenrand.
Mit einer stationären Kamera lassen sich sehr schön Reihenaufnahmen einer Finsternis
anfertigen (vgl. Abb. 3.9). Bei ruhender Kamera legt der Mond in einer Zeitspanne von einer
Stunde etwas weniger als 15° zurück. D.h. bei einem Monddurchmesser von etwas mehr als
einem halben Winkelgrad kann man zwei Belichtungen nach fünf Minuten Zwischenzeit auf
ein Bild machen, ohne daß sich die Mondscheiben überlappen. Wenn man die Zeitdauer einer
Mondfinsternis einem Astronomischen Jahrbuch entnimmt, kann man eine obere Grenze für
die zurückgelegte Strecke des Mondes am Himmel mit obiger Abschätzung ermitteln und
danach ein Objektiv mit entsprechend großem Bildwinkel wählen, um den gesamten
Finsternisverlauf festzuhalten.
76
Um die Finsternis korrekt wiederzugeben, sollte man jedes Bild gleich lang belichten. Das hat
aber zur Folge, daß entweder der beleuchtete Teil des Mondes während der partiellen Phase
alles überstrahlt, oder der verfinsterte Mond überhaupt nicht zu sehen ist. Die andere
Möglichkeit ist für jeden Teil der Finsternis eine geeignetere Belichtungszeit zu wählen. Der
Helligkeitsunterschied zwischen Vollmond und total verfinstertem Mond beträgt dabei
maximal 1:6000. Also ein Unterschied in der Belichtungszeit von 1:6000. Während man für
den vollen Mond z.B. mit einer 1/60 s auskommt, muß man den total verfinsterten Mond mit
100 s belichten, um dieselbe Filmschwärzung zu erreichen. Das wird man in der Praxis aber
gar nicht wollen, weil dann kein Unterschied in der Helligkeit der beiden Mondbilder besteht
(nur ein Farbunterschied). Man wird also mit einem weit weniger gravierenden
Belichtungszeitenunterschied auskommen. Meist wird man dabei den hellen Teil des Mondes
ordentlich überbelichten, um auch den in den Kernschatten eingetauchten Mondteil noch
sichtbar zu machen. Für eine Belichtungsmessung ist die Spotmessung wieder sehr
empfehlenswert. Sie liefert meist gute Resultate.
Einen guten Anhaltswert für die richtige Belichtungszeit t erhält man nach folgender Formel:
N2
t=
; dabei ist N die Blendenzahl, E die Filmempfindlichkeit in ASA und C die
CE
Belichtungskonstante, die man der folgenden Tabelle entnimmt:
Teil der Finsternis
Vollmond
Mond im Halbschatten
Mond halb im Kernschatten, korrekt für
Mondteil im Halbschatten
Mond halb im Kernschatten, korrekt für
Mondteil im Kernschatten
Totalität, Beginn und Ende
Totalität, Mitte der Finsternis, zentral
Belichtungskonstante C
120
60
3
0.10
0.06
0.02
3.2 Die Planeten
3.2.1 Beobachtung
Bevor man einen Planeten beobachten kann, muß man ihn erst einmal finden und das ist nicht
einmal so einfach. Man kann einen Planeten finden wie es die alten Griechen taten, indem
man jede Nacht nach Objekten sucht die sich langsam gegen den Fixsternhimmel bewegen.
Auf diese Art wurden fünf Planeten entdeckt - Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn.
Es gibt noch einen anderen Anhaltspunkt. Er bezieht sich auf das Blinken der Sterne. Die
Sterne sind so weit von uns entfernt, daß sie für alle Anwendungen als Punktlichtquellen
betrachtet werden können. Wenn nun das Sternenlicht die Atmosphäre durchdringt, wird es
durch kleine Fluktuationen in Dichte und Temperatur der Luft und durch die unregelmäßigen
Strömungen der Hochatmosphärenwinde, die wie kleine Linsen wirken, von einem Moment
auf den anderen fokussiert und defokussiert. Es scheint als würde die Helligkeit der Sterne
fluktuieren. Ebenso fluktuiert scheinbar ihre Position am Himmel, wenn man die Stern durch
ein Teleskop betrachtet, was bewirkt, das die Sterne im Teleskop wie verwaschene
Lichtflecken aussehen. Das ist das atmosphärische Seeing.
Andererseits können Planeten nicht als Punktlichtquellen angesehen werden. Sie haben zwar
einen sehr kleinen aber durchaus meßbaren Winkeldurchmesser. Das hat zur Folge, daß das
Licht von einer Seite des Planeten nicht denselben Weg durch die Atmosphäre nimmt als das
von der anderen Seite. Jede atmosphärische Turbulenz wirkt nur auf einen kleinen Teil des
vom Planeten ausgehenden Lichts. Folglich tendieren die vielen statistisch verteilten
77
Störungen einander auszulöschen, wenn man einen Planeten mit bloßem Auge beobachtet.
Das ist der Grund warum Planeten nicht wie die Sterne blinken und funkeln. (Es sei denn die
Luftturbulenzen sind zu groß, was selten vorkommt).
Wenn man nur weiß wann ein Planet über dem Horizont steht, so hat man schon halb
gewonnen. Die Auf- und Untergangszeiten von Planeten findet man in astronomischen
Zeitschriften und Jahrbüchern. Die meisten Planeten (außer Uranus, Neptun und Pluto) sind
heller oder etwa gleich hell wie die hellsten Sterne. Ein Blick in eine aktuelle Sternkarte, wie
man sie auch in Jahrbüchern findet, reicht nun, um den Planeten zu finden. Es gibt auch gute
Computerprogramme, die für jeden Tag Aufsuchungskarten zeichnen. Für die lichtschwachen
Planeten wie Uranus und Neptun reicht das bloße Auge nicht mehr. Obwohl man Uranus
noch mit dem unbewaffneten Auge sehen sollte, ist es dennoch wesentlich einfacher das
Sucherfernrohr oder zumindest einen Feldstecher zu benutzen. Für den äußerst
lichtschwachen Pluto braucht man schon ein recht großes Teleskop mit mindestens 30 cm
Öffnung und genügend Erfahrung, um ihn zu sichten. Er ist fast nur auf fotografischem Wege
beobachtbar.
Die Planeten sind so weit von uns entfernt, daß sie mit bloßem Auge wie Sterne erscheinen
(außer daß sie nicht funkeln). Man muß auf jeden Fall ein Teleskop oder zumindest einen
Feldstecher verwenden, um sie zu beobachten. Einzig die Farbe der Planeten kann man
eventuell mit bloßem Auge beobachten. Für ungeübte Beobachter ist selbst das ein Problem.
Hat man einmal den gesuchten Planeten anvisiert und ins Okular gebracht, was dann? Mars,
Jupiter und etwas weniger ausgeprägt auch Saturn zeigen veränderliche Wettermuster auf
ihrer Oberfläche. Sie rotieren relativ schnell und zeigen nach ein paar Stunden eine komplett
veränderte Ansicht. Das Wetter auf diesen Planeten ändert sich wie auf der Erde von Nacht zu
Nacht. Die großen Gasplaneten, Jupiter und Saturn, haben mehrere Monde, wovon die
größten schon mit bescheidenen Mitteln beobachtet werden können. Bei den schwächeren
Monden muß man schon ein paar Stunden beobachten, um ihre Bewegung zu verifizieren und
sie sicher von schwachen Hintergrundsternen zu unterscheiden.
Der Planetenbeobachter will feine und feinste Einzelheiten auf den Planetenoberflächen
sehen. Doch das Sehen durch das Fernrohr muß man lernen. Die Vorstellungen von dem, was
ein Fernrohr vor die Augen zaubern soll, sind nahezu phantastisch. Allenfalls der Mond kann
diese Wünsche noch einigermaßen erfüllen. Die im Vergleich winzigen Planetenscheibchen
bringen diese hochgeschraubten Erwartungen schnell zu Fall. Zumindest für den Anfänger
kommt schnell das "optische Erwachen". Einige der Faktoren, die die Qualität des in jedem
Fall recht keinen Planetenbildes bestimmen, sind folgende:
1. das persönliche Befinden des Beobachters, speziell seiner Augen;
2. die Qualität des Fernrohrs;
3. der Zeitpunkt des Beobachtens;
4. der Zustand der Atmosphäre;
5. der Zustand des beobachteten Objekts (Erdferne etc.);
Planeten sind am besten in der Dämmerung zu beobachten. Das ist eine subjektive
Empfindung und wird unter Planetenbeobachtern viel diskutiert. Ein Grund dafür ist, daß die
Luftturbulenzen, die die Planetenscheibe in einen leichten Schleier hüllen, während der
Dämmerung dem noch recht hellen Himmelshintergrund zum Opfer fallen. Auch die nicht zu
vernachlässigende Blendung des Beobachters wird merklich unterdrückt. Dadurch lassen sich
mehr Oberflächendetails erkennen. Zudem sind während dieser Zeit sowohl die
"nachtsehenden" Stäbchen als auch die "tagsehenden" Zäpfchen im Auge aktiv.
Ein anderer guter Grund ist, daß während der Dämmerung die Pupillen noch nicht so weit
geöffnet sind und dadurch Randabbildungsfehler der Augenoptik noch nicht voll zur Geltung
kommen. Dazu kommt noch, daß auf vielen Standorten die Luftruhe während der
Morgendämmerung am besten ist. Dieses Phänomen kann sehr lokal sein und muß bei weitem
nicht auf jeden Standort zutreffen. Aber es lohnt sich früh aufzustehen und dem auf den
78
Grund zu gehen. Möglicherweise wartet ein Augenblick ganz besonders ruhiger Luft auf den
Beobachter.
Tricks:
Eine sehr bemerkenswerte Erscheinung ist das "indirekte Sehen". Viele Beobachter wenden
es auch in der Planetenbeobachtung mit Erfolg an. Wer indirekt sieht, schaut nicht direkt auf
das Objekt, sondern sieht etwas an ihm vorbei und konzentriert sich dabei aber auf das
Objekt. Dadurch fällt das Bild des Objekts nicht direkt auf den Gelben Fleck; jenem Gebiet
auf der Netzhaut, das nur mit Zäpfchen bevölkert ist. Diese sind nicht so lichtempfindlich wie
die Stäbchen und außerdem bei Nacht außer Betrieb. Gute Beobachter üben das indirekte
Sehen bis zur Vollkommenheit.
Das Auge ist zudem großen Schwankungen in seiner Leistungsfähigkeit unterworfen. Es
ermüdet schnell. Körperliche Anstrengung, Streß, Alkohol und Drogen sowie Hunger und
Schlafbedürfnis reduzieren die Leistung des Auges erheblich. Auch das intensive,
konzentrierte Schauen durch das Okular strengt den Beobachter an und führt zur
Verschlechterung der Augenleistung. Das scharfe Auge des geübten Beobachters hat eine
Reihe von Ursachen, die zusammenwirken. Neben dem optischen Augenzustand spielt die
psychische Verfassung des Beobachters eine große Rolle. Es gibt Untersuchungen die
bestätigen, daß der Zwang, sorgfältig zu beobachten, zur besseren Auswertung der
Netzhautbilder und der peripheren Gesichtsfeldteile erzieht.
Brillenträger sollten wenn möglich ohne ihre Sehhilfe durchs Okular blicken. Die Brille führt
zu unnötig großem Augenabstand zum Okular. Wer nicht auf seine Brille verzichten kann
sollte mit Okularen mit großem Augenabstand (long eye relief) beobachten.
Die Sehschärfe der Augen nimmt mit dem Alter ab und macht sich besonders bei schlechten
Lichtverhältnissen bemerkbar. Auch die Pupille weitet sich nicht mehr so wie in der Jugend.
Ab etwa 40 Jahren machen sich diese Schwächen bei jedem Beobachter bemerkbar. Das heißt
aber nicht, daß man ab diesem Alter ein schlechter Beobachter ist. Man sollte nur seine
Grenzen kennen. Dann ist es nicht so schwer entsprechende Hilfsmittel erfolgreich
einzusetzen.
Ein nicht zu vernachlässigendes Hilfsmittel bei der Beobachtung ist ein höhenverstellbarer
Sitz oder etwas ähnliches. Es ist erstaunlich wie wenig viele Beobachter von einer bequemen
Körperhaltung am Teleskop halten. Die Körperhaltung hat deutliche Auswirkungen auf das
Sehen durch das Fernrohr. Eine gebückte Stellung ist ebenso schlecht wie eine gestreckte
Sitzposition, bei der man einen Giraffenhals bekommt. Solche Haltungen führen zu
Muskelschmerzen und vor allem zu einer Sauerstoffunterversorgung des Gehirns und der
Netzhaut. Am besten wäre eine höhenverstellbare Liege mit weicher Kopfauflage, die ein
Verwackeln des Kopfes verhindert und es zudem erlaubt eine bequeme Körperhaltung
einzunehmen.
Manche Beobachter atmen reinen Sauerstoff um ihre Sehleistung auf die Spitze zu treiben.
Dabei handelt es sich aber um Ausnahmekönner, die zudem meist auf sehr hohen Bergen
beobachten, wo es an Sauerstoff mangelt. Für den Gelegenheitsbeobachter wird es ein
Karottensaft und eine Mütze voll Schlaf, vor der Beobachtung, auch tun. Kleine
Aufwärmübungen können auch erfolgreich zur Erhöhung der Sehleistung beitragen, da sie die
Sauerstoffversorgung des Gehirns und der Netzhaut verbessern.
Für den Beobachtungszeitpunkt ist es weiter lohnend, Wetterlagen und Jahreszeiten zu
berücksichtigen. Erfahrungsgemäß herrscht nach Abziehen einer Regenfront oder eines
Tiefdruckgebietes besonders gute Durchsicht, weil die Luft sozusagen reingewaschen wurde.
Auch die Luftunruhe ist dann sehr gering. Dies gilt vor allem im Sommer und im Herbst. Die
Luftunruhe unterliegt zusätzlich stündlichen Schwankungen. Die Luft beruhigt sich deutlich
nach Sonnenuntergang, weil die starke Energiequelle fehlt, die die meisten Luftturbulenzen
verursacht. Gegen Mitternacht verschlechtert sich dieser Zustand, da die Erdkruste durch die
79
Wärmeabstrahlung in den Weltraum deutlich abkühlt. Zum Morgen hin verbessern sich dann
die Bedingungen wieder zusehends. Zu diesem rein atmosphärischen kommt noch das
teleskopische Seeing. Das Teleskop braucht eine gewisse Zeit, um sich an die neue
Umgebungstemperatur zu gewöhnen und bis dorthin bringt es, wie ein in Wasser getauchter
Heizstab das Wasser, die Luft zum zirkulieren. Der Zustand der Luft hat seine eigenen
Gesetze. Jeder Ort ist anders. Kein Beobachter darf sich durch momentane Mißerfolge
abschrecken lassen. Man kann die Beobachtungsbedingungen an einem Ort nicht nach ein
paar Stunden beurteilen. Wer genug Erfahrung hat weiß, daß man auf die wirklich scharfen
Bilder warten muß. Sie kommen plötzlich und verschwinden leider ebenso schnell. Sie dauern
oft nur wenige Sekunden, sind dann aber für den Beobachter beinahe unvergeßlich.
Die Planeten stehen nicht immer am selben Ort und ändern daher ständig ihren
Winkeldurchmesser. Deswegen ist es auch nicht möglich dieselben feinen Oberflächdetails
auf einem erdfernen Planeten zu sehen, die man auf ihm in Erdnähe ausgemacht hat. Angaben
über die scheinbare Größe (Winkeldurchmesser) findet man ebenso wie die
Sichtbarkeitsperioden in den astronomischen Jahrbüchern.
Hat man es geschafft die drei Faktoren Beobachter, Fernrohr und Umwelt möglichst gut
aufeinander abzustimmen, so wird man die besten Resultate erzielen. Viele persönliche
Einzelerfahrungen und so manches Lehrgeld sind dazu notwendig, um ein kleines Stück
Beobachtungskunst zu erhaschen.
3.2.2 Die inneren Planeten - Merkur und Venus
Die unteren Planeten zeigen Phasen wie der Mond. Man kann sie fast nur während der
Dämmerung beobachten. Sie bieten sich als erste Beobachtungsziele an, sobald man sein
Teleskop aufgestellt hat und der Himmel für andere Ziele noch zu hell ist.
Venus und Merkur
haben keine Monde
wie alle anderen
Planeten. Merkur ist
weit entfernt, was es
schwer macht
Oberflächendetails
zu erkennen. Der
Hauptgrund liegt
aber daran, das er
wegen seiner
Abb. 3.10: Die Entstehung der Lichtphasen von Merkur und Venus.
(aus G. D. Roth, Planeten beobachten)
Sonnenähe meist
sehr tief am Himmel
steht und seine Beobachtungsbedingungen daher naturgemäß nicht besonders gut sein
können.
Dennoch können hartnäckige Beobachter Gebiete mit verschiedenem Albedo
(Reflexionsvermögen) auf dem Merkur wahrnehmen. Es ist aber nicht möglich die Krater,
Täler oder Berge auf Merkur zu sehen, die die Mariner-Sonden entdeckt haben. Merkur hat
eine Umlaufzeit von 88 Tagen (115.8 von der Erde aus) und seine Rotationszeit verhält sich
zur Umlaufzeit wie 3:2. D.h. daß auf Merkur während zweier Sonnenumläufe gerade 3 Tage
vergangen sind. Für den erdgebundenen Beobachter bedeutet das, daß man nach zwei
Merkurumläufen wieder dieselben Oberflächenerscheinungen erwarten darf. Die
Oberflächenmerkmale sind nicht so ausgeprägt wie die Albedomerkmale auf Mars oder die
Wolkenbänder des Jupiter. Sie sind eher sehr, sehr schwach und sind aufgrund der
80
Sonnennähe des Planeten sehr schwierig wahrzunehmen. In den meisten Fällen wird der
Beobachter sich also mit dem Auffinden des Planeten und mit der Bestimmung seiner Phase
zufrieden geben müssen. Dennoch sollte man sich deswegen nicht enttäuschen lassen, denn es
gibt nicht viele Menschen die das chromgelbe Leuchten des sonnennächsten Planeten schon
gesehen haben.
Das Merkurscheibchen verändert seine Größe von 4.8" ( " ... Bogensekunden) in Erdferne bis
13.3 " in Erdnähe.
Der Planet Venus ist jener der unserer Erde am ähnlichsten ist (in Masse und Größe). Die
Venus kommt der Erde mit nur 0.27 AE (1 AE = Entfernung Erde-Sonne) auch am Nächsten,
weshalb ihr scheinbarer Durchmesser von 10" in Erdferne bis auf 62" in Erdnähe anwächst.
Die Phasen der Venus sind deshalb bereits im Feldstecher erkennbar. Venus erreicht wegen
ihrer größeren Sonnendistanz auch einen verglichen mit Merkur (28°) viel größeren
Winkelabstand von der Sonne von etwa 47°. Die dichten Venuswolken reflektieren das
auftreffende Sonnenlicht äußerst gut, weshalb Venus eine beträchtliche Helligkeit erreicht.
Venus ist daher das auffälligste Objekt am Morgen- oder Abendhimmel und wird daher
Morgen- oder Abendstern genannt. Venus ist nach Sonne und Mond das hellste Gestirn am
Himmel.
Venus hat eine so dichte und strukturlose CO2- Atmosphäre, daß es sehr schwierig ist außer
der Phase weitere Einzelheiten zu beobachten. Zumal es die dichten Wolken überhaupt nicht
zulassen auf die eigentliche Oberfläche hinunterzublicken.
Mit verschiedenen Farbfiltern (violett-blau, blau, gelb und rot) ist es möglich den Kontrast
der Schwefelsäurewolken in der Venusatmosphäre zu erhöhen und mit etwas Glück Struktur
auf der Oberfläche zu erkennen. Solche Beobachtungen erfordern sehr viel Geduld.
Daß Venus eine Atmosphäre hat, läßt sich durch visuelle Beobachtung in Amateurfernrohren
nachweisen. Wenn die Phasengestalt der Venus eine sehr schmale Sichel geworden ist, kann
der aufmerksame Beobachter ein Übergreifen der Sichelspitzen hinüber in den unbeleuchteten
Teil des Planetenscheibchens wahrnehmen. Die Verlängerung der Sichelspitzen kann so weit
gehen, daß der Eindruck eines geschlossenen, hauchzarten Kreises entsteht. Was hier zu
sehen ist, ist nichts anderes als Sonnenlicht, das von hinten durch die dichte Atmosphäre des
Planeten kommt und dort gebrochen und zerstreut wird.
Wegen der großen Helligkeit des Planeten kann er auch am Tag beobachtet werden. Die
Tagbeobachtung ist sogar etwas vielversprechender als die Beobachtung bei Nacht, da die
recht starke Blendung durch die Venusscheibe fehlt.
3.2.3 Mars, der rote Planet
Das Hauptmerkmal des Planeten Mars ist seine rote Färbung. Sie ist schon mit bloßem Auge
deutlich zu erkennen. Es sind Eisenoxyde (Rost) oder Oxyhydroxide die dem Mars seine
charakteristische Färbung verleihen.
Einmal alle zwei Jahre überholt die Erde den Mars in ihrer viel schnelleren Umlaufbahn. Für
einige Monate steht Mars dann hoch und hell am Himmel. Mit mittleren und hohen
Vergrößerungen zeigt Mars eine große Vielfalt an Oberflächendetails, die von polarem Eis bis
zu merkwürdigen Oberflächenschattierungen reichen, die sich von Woche zu Woche
verändern. Als zweitnächster Planet hat der Mars schon seit Erfindung des Teleskops das
Interesse der Erdlinge erweckt. Die verlockende Aussicht auf eine komplett neue Welt,
getrübt durch die Grenzen des atmosphärischen Seeings, hat viele Beobachter dazu veranlaßt,
sich wesentlich mehr Details vorzustellen als wirklich auf der Marsoberfläche existieren.
Zwar haben einige Raumsonden den Mars mit hochauflösenden Kameraaugen erforscht,
dennoch lassen sich von der Erde aus noch nützliche Beobachtungen, vor allem über das
Wetter auf dem Mars tätigen. Große den ganzen Marsglobus umrundende Staubstürme
81
tauchen plötzlich auf, wehen in der dünnen Marsatmosphäre und verdunkeln Teile des
Planeten. Manchmal hinterlassen solche Staubstürme auch Veränderungen auf dem Mars,
dann nämlich, wenn sich heller Staub über dunkleren legt oder umgekehrt. Ebenso wie die
staubige Marsoberfläche verändern sich die Polkappen des Planeten in einem Marsjahr. Ihre
Größe und Form verändert sich deutlich. Auf Mars gibt es auch Jahreszeiten wie auf der Erde,
Winter und Sommer die sich die Marshalbkugeln abwechselnd aufteilen. Auch der Mars
rotiert wie die Erde mit etwas mehr als 24 Stunden (24 h, 37 min) und zwar in dieselbe
Richtung. Das heißt, daß der irdische Beobachter über eine Woche hinweg fast immer
dieselbe Marsseite beobachten kann. Erst nach wenigen Wochen kann man dann die andere
Seite sehen. Obwohl man auf dem Mars einige Oberflächendetails beobachten kann, so sind
die berühmten Vulkane und Schluchten des roten Planeten, mit Ausnahme der besten
Beobachtungsplätze der Erde in sehr seltenen Nächten mit exzellentem Seeing, den
Raumschiffen vorbehalten. Sie sind viel zu klein und zu kontrastarm um in normalen
Teleskopen gesehen zu werden. Auch wenn sie ein Beobachter in einem großen Teleskop
erhascht, so kann er über ihre Identität nur spekulieren. Nur aufgrund der Bilder von den
Raumsonden wissen wir, worum es sich dabei handelt. Trotz der Seeingprobleme zeichnet
Mars ein sich interessant veränderndes Bild. Wenn der Sommer in einer Hemisphäre
fortschreitet, so schrumpfen die Polkappen und die angrenzenden Gebiete scheinen sich zu
verdunkeln. Für viele Jahre dachten Beobachter es handle sich dabei um Anzeichen der
Marsvegetation, die durch das geschmolzene Eis zum Wachstum angeregt würde. Leider
wissen wir heute, daß es keine Pflanzen auf dem Mars gibt, die diese Veränderungen
verursacht haben könnten. Es waren vielmehr saisonale Staubstürme die die hellen
Staubpartikel von einem Ort zum anderen trugen.
In den frühen Tagen der Marsbeobachtung skizzierten die Astronomen den Mars von Hand
auf ein Zeichenbrett, indem sie ihn vor dem Okular abzeichneten. Für viele Minuten blieb der
Beobachter regungslos an dem Okular kleben, um auf jenen Augenblick vollkommener
Luftruhe zu warten, der ihn die Geheimnisse des roten Planeten preis geben sollte. Die
Auswertung der Bilder geschah später. Während der Stunden am Teleskop war der Astronom
nur eine Art "Rekorder". In der Tat gab und gibt es sogar Angestellte die für diesen Job des
"Rekorders" eingestellt wurden. Auch das Aufkommen der Fotografie konnte daran nichts
ändern, denn die wirklich feinen Details konnten nur mit dem Auge beobachtet werden. Erst
mit der Einführung der CCD-Kamera und einer leistungsfähigen Bildbearbeitung durch den
Computer änderte sich die Lage zugunsten der Technik. Dabei wird der Einfluß der
Atmosphäre mit großem Aufwand aus dem Rohbild herausgerechnet. Eine Leistung die das
Gehirn in Sekundenbruchteilen erbringt.
Die beiden Monde des Mars, Phobos und Diemos, sind so klein, daß ihr schwaches Leuchten
in dem hellen Licht des Planeten untergeht. Nur mit Tricks (Ausblenden des
Marsscheibchens) lassen sie sich beobachten.
3.2.4 Die Gasriesen Jupiter und Saturn
Jupiter ist nach der Venus der zweithellste Planet am Nachthimmel (es sei denn Mars ist in
Erdnähe). Bereits im Feldstecher oder im Sucherfernrohr kann er leicht als Scheibchen
erkannt werden, das von drei oder vier Monden umgeben wird, die wie aufgefädelt
erscheinen. Der Anblick im Feldstecher entspricht etwa jenem, den Galileo Galilei mit seinem
Originalteleskop (6-fache oder 8-fache- Vergrößerung) gehabt haben muß. Diesen Anblick
sollte man erst einmal studieren, um die Probleme besser zu verstehen die Galileo damals
gehabt haben muß. Dazu kommt noch, daß jedes heutige Sucherfernrohr oder gar ein
Feldstecher eine viel bessere optische Leistung erbringt, als das damals noch wenig
transparente Glas Galileos.
82
Die vier Monde, Ganymed, Kallisto, Io und Europa, sind eigentlich hell genug, um sie mit
bloßem Auge zu sehen, wäre da nicht die strahlende Jupiterkugel, die sie verschwinden läßt.
Manchmal sieht man nur drei oder zwei Monde, wenn einer oder zwei von ihnen hinter oder
vor der Jupiterscheibe versteckt sind oder im Schatten des Riesenplaneten verschwinden.
Diese Ereignisse sind in den meisten astronomischen Jahrbüchern verzeichnet. Man kann also
auch systematisch an die Sache herangehen und ein Mondfinsternis oder Sonnenfinsternis
(der Schatten des Mondes ist dann auf der Planetenscheibe erkennbar) im Jupitersystem
beobachten. Allerdings muß man schon ein gutes Auge haben um diese Ereignisse im
Feldstecher zu sehen. Hier empfiehlt sich schon ein Teleskop, es kann aber durchaus ein recht
bescheidenes sein. Wenn ein Mond vor der Jupiterscheibe vorbeigeht, hat man schon seine
Schwierigkeiten ihn von den Oberflächendetails zu unterscheiden. Erst ein ordentliches
Teleskop mit mindestens 10 cm Öffnung vermag den Mond deutlich von der
Jupiteroberfläche zu trennen. Mit sehr hoher Vergrößerung und in Nächten mit
außergewöhnlich gutem Seeing kann man die Monde des Jupiter als kleine Scheibchen
erkennen und so von den Hintergrundsternen unterscheiden. Die zwölf weiteren Monde des
Jupiter sind so klein, daß sie nur schwer mit Amateurteleskopen beobachtet werden können.
Abb. 3.11: Jupiter am 13. Sept. 1999, 0:10 MEZ, in Okularprojektion bei 12 m effektiver Brennweite,
1 s auf Agfa Ctx 100 (30 cm Schmidt-Cassegrain-Teleskop), auf der Planetenscheibe erkennt
man den großen roten Fleck und links vom Planeten seine Monde: v. l. n. r. Europa,
Ganymed, Io und Kallisto
Abb. 3.12: Jupiter am 12. Sept. 1999, 0:30 MEZ, in Okularprojektion bei 27 m effektiver Brennweite,
Belichtungsreihe v. l. n. r.: 2 s, 4 s, 6 s, auf Agfa CTx 100; Bei unterschiedlichen
Lichtverhältnissen werden unterschiedliche Details sichtbar.
83
Es ist durchaus lohnenswert das Jupitersystem für einige Tage zu beobachten und
aufzuzeichnen, um herauszufinden welcher Mond den Planeten in einer nahen und welcher
ihn in einer fernen Umlaufbahn umkreist. Diese vier hellsten Jupitermonde werden nach
ihrem Entdecker die Galileischen Monde genannt. Wenn man das Jupitersystem zum ersten
Mal sieht, hat man den Eindruck ein Miniatursonnensystem zu erblicken. Es ist also nicht
verwunderlich, wenn Galileo das kopernikanische Weltbild bevorzugte.
Jupiter selbst bietet im Teleskop eine recht ordentliche Größe. Man beobachtet ihn am besten
ab etwa 100-facher Vergrößerung. Normalerweise sieht man mindestens zwei dunkle
Wolkenbänder oder Gürtel auf der Planetenoberfläche, die parallel zum Äquator verlaufen.
Meist sind noch einige kleinere Bänder und Flecken zu erkennen. Auch der berühmte große
rote Fleck ist recht einfach auszumachen, obwohl er in den letzten Jahrzehnten etwas an Farbe
verloren hat. Je länger man Jupiter beobachtet, desto mehr kann man auf ihm entdecken.
Jupiter hat ähnlich wie Saturn ein System von Ringen, das den Planeten innerhalb der
Mondbahnen umgibt. Diese Ringe wurden von den Voyager-Raumsonden entdeckt und sind
von der Erde aus nicht zu erkennen, außer in den großen Teleskopen der Welt. Diese schaffen
das Kunststück nur mit enormem Aufwand in der Bildbearbeitung.
Die Ringe und die Monde umkreisen den Riesenplaneten in derselben Ebene. Wie eine
Miniaturekliptik in einem Modellsonnensystem. Diese Ebene ist nur 3° gegen die
Umlaufebene des Jupiter gekippt. Was bedeutet, daß wir das Jupitersystem ziemlich genau
von der Seite sehen und es sogar relativ häufig vorkommt, daß die Jupitermonde einander
verdecken oder sogar ihre Schatten aufeinander werfen.
Jupiter ist ein Gasplanet, der hauptsächlich aus Wasserstoff, Helium, Methan und Ammoniak
besteht und wahrscheinlich einen relativ kleinen festen Kern besitzt. Von der Erde aus können
wir nur die hochliegenden Wolken sehen. Die meisten Geheimnisse des Planeten sind also
verborgen. Jupiter zeigt eine ganze Reihe von Wirbelstürmen in seiner Atmosphäre. Der
größte unter ihnen wird bereits seit 300 Jahren beobachtet und heißt der Große Rote Fleck. Er
ist so groß, daß er allein sechs Erden aufnehmen könnte. Der Große Rote Fleck ist am
einfachsten zu beobachten, wenn er Jupiters Zentralmeridian passiert (vgl. Abb. 3.11).
Jupiter rotiert in nur 10 Stunden einmal um seine eigene Achse. Man kann also in langen
Nächten die ganze Jupiteroberfläche beobachten, so es die Sichtbarkeit des Planeten und das
Wetter zuläßt. Diese hohe Rotationsgeschwindigkeit führt zu einer deutlichen Abplattung der
Pole, die leicht erkennbar ist (vgl. Abb. 3.12). Zudem ist die Jupiterrotation wie auch die der
Sonne differentiell. Sein Äquator rotiert etwa 1% schneller als die mittleren Breiten.
Wenn man einmal eine ganze Jupiterrotation beobachtet hat, so heißt das nicht, daß man den
Planeten abhaken kann. Die Wetterformationen in der Jupiteratmosphäre ändern sich von Tag
zu Tag. Ganze Wolkenbänder verschwinden und tauchen wieder auf. Sie verändern ihre Farbe
oder Breite. Es bilden sich Verbindungen zwischen den Bändern und ständig entstehen neue
kleine oder große, weiße oder bläuliche Wirbelstürme. Der Große Rote Fleck kann an Farbe
zulegen oder sogar völlig verblassen. Es gab eine Zeit in der er völlig verschwunden schien.
Farbfilter helfen auch in Jupiters Atmosphäre den Kontrast zu erhöhen. Die Filter hellgelb
und orange eignen sich für Betrachtungen des schwach gefärbten Wolkengürtels. Um weiße
Gebiete mit rotem Hintergrund hervorzuheben benutzt man Grünfilter. Dieses Filter sperrt rot
und blau und arbeitet so den Kontrast heraus. Ein Blaufilter ist optimal bei der Betrachtung
von Wolkenformationen und des Großen Roten Fleckes.
Jupiter ist wegen seiner Größe der König unter den Planeten. Seine gewaltige Gravitation
führte dazu, daß sich sein Inneres stark aufheizte und er heute noch Wärmestrahlung im
Infrarotbereich abgibt. Er gibt etwa doppelt so viel Energie an den Weltraum ab wie er von
der Sonne auffängt. Auch Saturn gibt mehr Energie an den Weltraum ab als er von der Sonne
auffängt. Bei ihm ist es wegen der größeren Sonnendistanz gleich das 3.5-fache. Um ein
nukleares Feuer in seinem Inneren zu zünden reichte die Masse des Jupiter nicht aus. Dazu
84
hätte er noch um das 10-fache massiver sein müssen. Jupiter ist sozusagen ein verfehlter
Zwergstern.
Auch Saturn ist ein beeindruckender Gasriese, der seine Bahn in weit größerer Entfernung (er
ist doppelt so weit von der Sonne entfernt wie Jupiter) zieht. Deswegen erscheint sein Licht
viel flauer und sternähnlicher. Ab etwa 30-facher Vergrößerung ist sein berühmter Ring zu
erkennen. Im Teleskop ab etwa 10 cm Öffnung kann man im Ring eine kleine, dunkle Lücke
erkennen. Sie wird Cassinische Teilung genannt. Man kann sie am besten an den Ost und
Westseiten des Rings erkennen. Die Ringe bestehen aus unzähligen Eis und Staubteilchen,
etwa so groß wie Würfelzucker. Manche erreichen die Größe von Häusern, die meisten sind
aber nur so groß wie Zuckerkristalle. Jeder dieser Partikel umkreist den Planeten in einer
separaten, ihm eigenen Umlaufbahn. Obwohl die Ringe einen recht soliden Eindruck machen
sind sie in Wirklichkeit eine Trümmerwolke.
Im allgemeinen werden die Ringe grob unterteilt in den Äußeren Ring, außerhalb der CassiniTeilung, den Mittleren Ring oder den Hellen Ring, und den Inneren Ring. Der Innere Ring ist
recht schwach und ist schwer vom Mittleren Ring abzugrenzen. Bei sehr guter Luft ist noch
eine weitere Teilung, die Encke-Teilung, in der Mitte des Äußeren Rings zu erkennen. Sie ist
wirklich schwer zu sehen und erfordert viel Erfahrung, vor allem wenn man zugeben muß, sie
nicht gesehen zu haben. Der Autor hat sie jedenfalls noch nie gesehen. Die Voyager-Bilder
zeigen ein regelrechtes System von Teilungen in den Ringen. Der im Okular so kompakt
aussehende Saturnring sieht eher aus wie eine Schallplatte mit ihren vielen Rillen. Diese
Teilungen entstehen eigentlich aus einem chaotischen Vorgang: Steht die Umlaufzeit eines
Ringfragments in einem einfachem Verhältnis zu einer Umlaufzeit eines Mondes oder zur
Rotationszeit des Planeten, so kommt es zu Resonazeffekten, die schließlich das jeweilige
Ringstück aus seiner Umlaufbahn wirft. Solche Bahnen sind im höchsten Maße instabil. Im
Bereich der Instabilitäten gibt es weitere Überraschungen. Untersucht man die Lücken in den
Saturnringen im Detail, so findet man mit mathematischen Hilfsmitteln eine Merkwürdigkeit:
Innerhalb der Lücken gibt es wiederum Lücken- wie eine Kaskade von Spiegelungen eines
Gegenstandes, der zwischen zwei Spiegeln steht. Großräumige Lücken zwischen den Monden
und den Saturnringen finden sich auf kleinerer Skala wieder als Lücken zwischen den
Abschnitten des Ringmaterials. Zwischen stabilen Bereichen liegen stets auch instabile!
Sehr interessant ist es einen Stern zu beobachten, der hinter den Saturnringen verschwindet
und durch die Ringe abgeschwächt wird. Dabei blinkt er immer wieder auf, wenn er durch
eine der Lücken geht. Leider sind solche Ereignisse sehr selten und kommen nur zwei bis drei
Mal pro Jahrzehnt vor.
Saturn hat aber nicht nur seine großartigen Ringe zu bieten. Er besitzt ein ähnliches
Wettersystem wie Jupiter, wenn auch die Kontraste weitaus geringer sind. Wie auf Jupiter
sind auch auf Saturn Wolkenbänder und große weiße Flecken zu sehen. Hier ist die
Verwendung von Farbfiltern besonders nützlich.
Da es sich fast um die gleichen Oberflächenmerkmale handelt sind dieselben Filter wie bei
Jupiter empfehlenswert. Abhängig von der relativen Position zur Erde und zur Sonne kann
man den Schatten der Ringe auf der Oberfläche des Saturn sehen. Oder den Schatten des
Saturn auf den Ringen (Abb. 3.13).
Um eine Vorstellung davon zu bekommen wie groß die Ringe sind, kann man sich leicht die
Erde zwischen Innerem Ring und den Planeten denken. Die Ringe erstrecken sich auf etwa
275 000 Kilometer.
Wie Jupiter hat auch Saturn eine ganze Reihe von Monden um sich versammelt. In
Amateurteleskopen von etwa 20 cm Öffnung sind neun(!) von ihnen beobachtbar. Es sind
Mimas, Enceladus, Tethys, Dione, Rhea, Titan, Hyperion, Iapetus und Poebe. Sie sind aber
nicht so leicht zu erkennen wie die Monde des Jupiter, da sie in wesentlich größeren Bahnen
den Planeten umkreisen und ihre Bahnebene viel stärker gegen die Ekliptik geneigt ist. Die
Pionieer- und Voyager-Missionen haben insgesamt 23 Monde gezählt, das ist Rekord im
85
Sonnensystem. Im Teleskop sehen die Saturnmonde wie Sterne aus. Die einzige Möglichkeit
herauszufinden ob man einen Mond oder einen Stern beobachtet ist zu beobachten ob sich das
Objekt mit dem Planeten mitbewegt oder nicht. Es sei denn man verwendet
Aufsuchungskärtchen, die in den jeweiligen Jahrbüchern abgedruckt sind.
Titan ist der größte Mond
Saturns und ist sogar größer als
Merkur oder Pluto. Er ist nur ein
wenig kleiner als Ganymed, der
damit der größte Mond des
Sonnensystems ist. Titan besitzt
eine Atmosphäre mit hohem
Druck (1600 hPa), der den
Luftdruck der Erde sogar
übersteigt. Titan ist damit der
einzige Mond im Sonnensystem,
der eine Atmosphäre besitzt.
Seine Atmosphäre setzt sich
hauptsächlich aus Wasserstoff,
Stickstoff (90%), Methan,
Kohlenwasserstoffen sowie
Cyanverbindungen zusammen,
allerdings bei ziemlich frostigen
Temperaturen von -180°C.
Was die Wahrscheinlichkeit für
Leben ziemlich herabsetzt. Aber
wer weiß, vielleicht befinden
sich im Inneren des
Saturnmondes Energiequellen,
die angenehme Temperaturen
ermöglichen, und wir sind doch
nicht allein im Sonnensystem.
Auf jeden Fall sollte man sich
das in Erinnerung rufen, während
man sein Bild im Teleskop
betrachtet.
Abb. 3.13: Saturn am 12 Sept. 1999, Reihenbelichtung mit 1.5 s, 3 s, Japetus wechselt seine Helligkeit
4 s, 6 s, 0:20 MEZ, Okularprojektion mit 12 m effektiver
relativ stark während er den
Brennweite auf Agfa CTx 100, die Cassini-Teilung ist in
Saturn umkreist. Wie der
der untersten Belichtung am besten zu erkennen.
Erdmond hat auch Japetus eine
gebundene Rotation (d.h. er rotiert genau einmal um seine Achse während er den Saturn
umrundet.). Das kann aber nur bedeuten, daß eine Seite des Japetus wesentlich dunkler sein
muß als die andere.
Phoebe zeigt eine ungewöhnliche Umlaufbahn und umkreist den Planeten in entgegengesetzt
zur Umlaufrichtung aller anderen Monde. Möglicherweise ist Phoebe ein Asteroid den Saturn
durch seine große Gravitation eingefangen hat, so daß Phoebe nicht zur gleichen Zeit gebildet
wurde als das Saturnsystem entstand.
3.2.5 Uranus und Neptun, am Rande des Sonnensystems
Uranus wurde von William Herschel 1781 entdeckt, als er den Himmel systematisch mit
seinem selbstgebauten Teleskop absuchte. Es war eines seiner besten Instrumente, ein 6.5-
86
Zoll Newton-Reflektor. Dieser Stern fiel dadurch auf, daß er nicht genauso punktförmig und
gestochen scharf erschien wie die übrigen Fixsterne, sondern wie ein kleiner verwaschener
Lichtfleck. Herschel hatte in solchen Fällen die Angewohnheit, zunächst die Vergrößerung zu
steigern. Dabei bleiben Fixsterne klein und punktförmig bis auf das winzige
Beugunsscheibchen. Objekte, die der Erde näher stehen, wachsen entsprechend der
Vergrößerungszunahme. Dies war auch bei diesem Objekt der Fall. Herschel dachte
ursprünglich einen Kometen entdeckt zu haben, doch als bald überall die Astronomen ihre
Fernrohre auf den vermeintlichen Kometen ausrichteten und man Bahnberechnungen
anstellte, bemerkte man, daß es sich nicht um einen Kometen handeln konnte. Ein neuer
Planet war entdeckt. Es ist etwas seltsam, daß niemand zuvor diesen Planeten entdeckt hatte,
da er durchaus noch mit freiem Auge zu sehen ist. Trotzdem braucht man normalerweise eine
gute Sternkarte um ihn zu finden und man weiß schließlich wonach man sucht. Zwischen der
Erfindung des Fernrohrs und der Entdeckung des Uranus vergingen über 150 Jahre, in denen
über 20 Beobachter den Planeten als Stern in ihren Logbüchern verzeichneten. Uranus zeigt
eine kleine aber feine Scheibe von 3 bis 4 Bogensekunden Durchmesser. Wahrscheinlich
mußte die Entdeckung solange warten bis es Teleskope gab, die solche kleinen Scheibchen
aufzulösen imstande waren. Wenn man Uranus beobachtet, so ist es nicht gerade leicht ihn
richtig zu fokussieren. Es ist einfacher auf einen Hintergrundstern scharfzustellen und dann
auf den Planeten zu schwenken, um die kleine grüne Planetenscheibe zu beobachten. Einige
Uranus-Beobachter haben davon berichtet, daß sie helle Flecken und Bänder auf dem
Planeten gesichtet haben. Bei einem solch winzigem Ziel ist allerdings schon ein äußerst
gutes Seeing, erhebliche Geduld und ein hervorragendes Teleskop mit mindestens 30 cm
Öffnung notwendig. Der Einsatz von Farbfilter ist angeblich nicht so erfolgversprechend wie
bei den näheren Planeten.
Uranus hat zwei Monde die man noch im Teleskop (min. 20 cm Öffnung) sehen sollte. Es
sind dies Titania und Oberon. Drei weitere sind relativ einfach zu fotografieren: Miranda,
Ariel und Umbriel. Wie schon bei Saturn sehen diese Monde zusammen mit Uranus aus wie
ein Miniatursonnensystem. Es gibt allerdings einen markanten Unterschied: Die
Rotationsachse des Planeten und die Ebene der Mondbahnen ist um beinahe 90° gegen die
Ebene der Umlaufbahn des Planeten gekippt. Das bedeutet, daß er alle 84 Jahre (Umlaufzeit
des Uranus) einmal den Nordpol und einmal den Südpol in Richtung Sonne weist, und seine
Monde beinahe perfekte Kreisbahnen um den Planeten ziehen. Uranus besitzt noch 10 weitere
Monde, die die Raumsonde Voyager II entdecke. Wie alle Gasriesen hat auch Uranus einige
dünne Ringe, die nicht von der Erde aus sichtbar sind. Sie können aber von der Erde aus
bereits mit kleinen Teleskopen nachgewiesen werden, wenn ein Stern den Planeten passiert
und die Ringe den Stern für kurze Zeit verdunkeln. So wurden die Ringe des Uranus auch
ursprünglich entdeckt.
Im Gegensatz zu Uranus wurde Neptun auf dem Papier entdeckt und nur per Teleskop
verifiziert. Die Entdeckung des Neptun gehört zu den großen Dramen in der
Astronomiegeschichte. Unabhängig voneinander berechneten der französische Astronom Jean
Joseph Leverrier und der Engländer John Couch Adams die Umlaufbahn von Uranus, die
nicht mit den gemessenen Positionen übereinstimmen wollte. Daher postulierten sie Anfang
des 19. Jahrhunderts einen Störkörper, einen weiteren Planeten, der Uranus durch seine
Gravitation beeinflußt. Mehr noch, sie berechneten die mögliche Position dieses Körpers.
Beide versuchten den Planeten zu finden, hatten aber große Probleme ein Teleskop zu finden,
mit dem die Entdeckung gemacht werden konnte (Sie hätten Neptun leicht mit einem heute
handelsüblichen 20 cm Teleskop entdeckt !). Das Rennen gewann schließlich Leverrier. Er
schickte dem deutsch Astronomen Johann Gottfried Galle einen Brief, in dem er ihm seine
Vermutung mitteilte. Dieser entdeckte Neptun am 23 September 1846 nahe der
vorhergesagten Position im Sternbild Steinbock mit dem 24.4 cm Fraunhofer-Refraktor der
87
königlichen Sternwarte Berlin. Das Teleskop steht heute im Deutschen Museum in München.
Übrigens hatte bereits Galileo Galilei Neptun beobachtet, ihn aber nicht als Planeten erkannt.
Neptun ist so weit von der Sonne entfernt (mittlere Entfernung 30 AE), daß diese aus seiner
Position nur mehr wie ein besonders heller Stern aussieht. Neptun war lange Zeit der
sonnenfernste Planet, da der "äußerste" Planet Pluto eine so exzentrische Umlaufbahn besitzt,
daß er zwischen Ende Januar 1979 und dem 9. Februar 1999 der Sonne näher war als Neptun.
Das wenige Licht, das Neptun reflektiert, reicht nicht aus um ihn mit bloßem Auge zu sehen.
Ein Feldstecher genügt aber. Im Teleskop sieht der Planet bei geringer Vergrößerung erst wie
ein bläuliches Sternchen aus. Erst ab etwa 200-facher Vergrößerung erkennt man ein kleines
mattes Scheibchen mit dunkelblauer Färbung. Auch in den größten Teleskopen ist visuell
kaum mehr zu sehen. Trotzdem ist es ein erhebendes Gefühl das schwache Leuchten eines so
weit entfernten Himmelskörpers zu beobachten.
Die grünlich-blaue Farbe wird, wie auch bei Uranus, durch eine starke Absorption von rotem
Licht hervorgerufen, für die hauptsächlich das Methan in der Neptunatmosphäre
verantwortlich ist. Uranus und Neptun sind etwa gleich groß, gleich schwer und besitzen
keine nennenswerte Energiequelle wie Jupiter und Saturn.
Neptun besitzt insgesamt acht Monde, von denen aber nur der größte, Triton, visuell
zugänglich ist. Ab einer Öffnung von 15 cm. Triton ist größer als unser Mond und somit einer
der großen Monde im Sonnensystem. Triton hat eine Umlaufzeit von etwa 6 Tagen und hat,
wegen seines großen Reflexionsvermögens, mit 40-50 K die kälteste Oberfläche im
Sonnensystem.
3.2.6 Pluto, der Extreme
Pluto ist mit einer mittleren Sonnenentfernung von fast 40 AE der fernste der großen
Planeten. Seine Bahn ist exzentrischer als die aller anderen Planeten. Dadurch erreicht er eine
maximale Sonnenentfernung von über 49 AE. Aber Pluto hat noch andere Extreme. Er ist von
allen Planeten derjenige mit dem kleinsten Durchmesser (nur halb so groß wie Merkur oder
2/3 des Monddurchmessers), er hat die am stärksten geneigte Rotationsachse, und im
Vergleich zu seiner Größe besitzt er den größten Mond (Durchmesserverhältnis 2:1). Pluto ist
somit ein echter Doppelplanet. Zudem hat die Plutobahn die größte Neigung gegen die
Ekliptik (17°) und der Planet die längste Umlaufzeit aller Planeten. Fast ein
Vierteljahrtausend ist die eisig isolierte Welt des Pluto unterwegs um einmal die Sonne zu
umrunden. Pluto bewegt sich mit einer mittleren Bahngeschwindigkeit von knapp fünf
Kilometern pro Sekunde am langsamsten, ist am spätesten entdeckt worden und ist der
einzige Planet der noch von keiner irdischen Raumsonde erforscht wurde.
Pluto wurde 1930 im Sternbild Zwillinge von Clyde Tombaugh, einem damals erst 23jährigen
Amateurastronomen, mit dem 13-Zoll Astrographen des Lowell-Observatoriums in Arizona,
fotografisch entdeckt. Der neu entdeckte Planet erhielt zu Ehren von Percival Lowell den
Namen Pluto, dessen Initialen repräsentierend. Lowell hatte ihn 1905 als Transneptun
vorhergesagt, lange nachdem Camille Flammarion einen weiteren Planeten vermutete (1879).
Wieder waren Bahnstörungen des Uranus dafür verantwortlich, die durch Neptun alleine nicht
erklärt werden konnten. Erst 1978 hat James Christy in Flagstaff, am Naval-Observatorium,
den Mond Charon entdeckt. Dieser umkreist Pluto in 6.4 Tagen und machte sich als
Ausbuchtung in den Aufnahmen bemerkbar. Andere Astronomen hielten diese
Ausbuchtungen für Nachführfehler, doch Christy fand eine gewisse zeitliche Systematik. Erst
das Hubble Weltraumteleskop lieferte erste Bilder von der Pluto-Oberfläche, die zumindest
einige Details erkennen lassen. Sie sind aber nicht besser als Merkurbeobachtungen von der
Erde aus!
88
Das Charon-Pluto -System hat eine doppelt gebundene Rotation. D. h., die Rotationszeiten
von Pluto und Charon sind so lang wie der Umlauf von Charon um Pluto. Die beiden wenden
sich somit immer die gleich Seiten zu.
Trotz der Schwierigkeiten ist es schon an sich interessant Pluto zu beobachten. Das
Aufsuchen unter den Sternen bereitet aber bereits Probleme. Man braucht dazu schon sehr
gute Sternkarten. Zudem wird die Beobachtung in den nächsten Jahren immer schwieriger
werden, weil sich Pluto in die dichten Sternfelder der Milchstraße hineinbewegt und sich
immer mehr von der Erde entfernt. Für eine erfolgreiche Beobachtung reicht zwar angeblich
ein Teleskop mit 12 cm Öffnung, der Autor empfiehlt aber mindestens 30 cm.
3.2.7 Planetenfotos
Die Planetenfotografie ist ähnlich der Mondfotografie. Auch hier müssen große Brennweiten
eingesetzt werden, um zu brauchbaren Ergebnissen zu kommen. Allerdings sind die
Mindestbrennweiten etwas größer als beim Mond. So ist es überhaupt erst sinnvoll ab etwa
2 m Brennweite zu fotografieren um Oberflächendetails zu erreichen. So richtig los geht's
aber erst ab 10 m Brennweite und endet so bei über 100 m, weil die minimalste Luftunruhe
die Grenzen etwa dort ansetzt.
Die Belichtungszeiten sind in der Regel so lang, daß man nicht darüber zu spekulieren
braucht ob man mit einem höherempfindlichen Film und kürzerer Verschlußzeit dem Seeing
ein Schnäppchen schlagen kann. Für die Planetenfotografie braucht man also immer beste
Seeingverhältnisse. Die Belichtungszeiten betragen etwa ¼ s bis 30 s und mehr. Will man
Planetenmonde fotografieren, z. B. jene des Uranus, so wird man unter 10 min nicht
durchkommen.
Die Planetenscheibchen sind sehr klein, so daß man selbst bei Jupiter pro Meter Brennweite
nur ein Scheibchen von 0.24 mm Durchmesser in der Bildebene erhält. Der Durchmesser D
des Planetenscheibchens im Fokus errechnet sich nach:
ϕ
D = 2 f tan wobei f die verwendete Brennweite und ϕ der Winkeldurchmesser des
2
Planeten ist.
Die ungefähren Winkeldurchmesser der Planeten gibt folgende Tabelle:
Planet
ϕ
Merkur
Venus
Mars
Jupiter
Saturn
Saturnring
Uranus
Neptun
Pluto
4.8"-13.3"
10"-60"
13"-25"
50"
ca. 20"
ca. 47"
3.6"
2.5"
0.1"
in Bogensekunden
Durchmesser D pro m Brennweite
0.02-0.06 mm
0.05-0.29 mm
0.06-0.12 mm
0.24 mm
0.11 mm
0.22 mm
0.02 mm
0.01 mm
0.0005 mm
Die Belichtungszeiten richten sich nach der jeweiligen Helligkeit der Planeten und nach der
Ö ffnung
effektiven Blende N eff =
effektiveBrennweite
Anhaltswerte für die Belichtungszeit t erhält man wieder mit der Formel: t =
N eff
2
wobei E
CE
die Filmempfindlichkeit in ASA und C die Belichtungskonstante ist, die man folgender
Tabelle entnimmt:
Planet
Belichtungskonstante C
89
Venus (Viertel-)
Venus (Halb-)
Venus (Voll-)
Mars
Jupiter
Saturn
250
500
1000
110
10-40
6-10
Die erhaltenen Werte sind nur als Anhaltswerte zu verstehen. Mann sollte jedesmal mehrere
Aufnahmen mit unterschiedlichen Belichtungszeiten machen, da sich nicht nur die
Lichtverhältnisse von Mal zu Mal ändern, sondern die unterschiedlichen Details bei
verschiedenen Belichtungen unterschiedlich stark hervorkommen. Je mehr man, bei
Diafilmen, unterbelichtet, desto höher wird der Kontrast, da die Belichtung in den Anfang der
Dichtekurve gelegt wird, wo sie i. a. steiler verläuft. Bei Negativfilmen ist dies meist
umgekehrt, da die Schwärzungskurve meist flacher beginnt und dann immer steiler wird. Die
maximale Farbsättigung wird bei beiden Filmtypen erst bei recht kräftiger Belichtung erreicht
und die höchste Schärfe liegt irgendwo dazwischen. Schon aus diesen Gründen ist es reizvoll
die ganze Dichtekurve auszunützen. Jedes Bild wird verschiedene Aspekte mehr betonen als
das andere (vgl. Abb. 3.12 und Abb. 3.13).
Bei der Planetenfotografie spielt eine gute Montierung eine entscheidende Rolle. Sie muß
sehr genau nachführen und zudem die Schwingungen bei der Auslösung der Kamera gut
aufnehmen und so schnell wie möglich zum Abklingen bringen. Ein Resonanz wäre fatal.
Wichtig ist auch das Ausbalancieren der Montierung wenn man eine Kamera, meist in
Okularprojektion, an dem Teleskop befestigt hat. Es schont nicht nur den Antrieb sondern
verbessert die Antriebsruhe meist erheblich.
90
4 Die Sonne
4.1 Die sichtbare Sonne
Die Sonne ist der einzige Stern der uns nah genug ist, um ihn genauer untersuchen zu können.
Alle anderen Sterne sind so weit von uns entfernt, daß wir nicht einmal in den stärksten
Teleskopen ein kleines Scheibchen zu sehen bekommen. Sie bleiben bei allen
Vergrößerungen punktförmige Objekte. Die Sonne hingegen wartet mit einer Vielzahl von
Erscheinungen auf, die sich sogar teilweise recht schnell, verändern.
4.1.1 Gefährliche Sonne
Die Sonne ist das einzige astronomische Objekt, dessen enorme Lichtfülle ein Problem bei
der Beobachtung darstellt. Es ist unbedingt zu unterlassen, die Sonne mit bloßem Auge oder
durch ein Fernglas oder Teleskop ohne geeignete Schutzmaßnahmen zu beobachten. Man
riskiert schwere Augenschäden, die bis zur Erblindung führen können. Fehler bei der
Sonnenbeobachtung ziehen fast immer einen Verlust der Sehkraft mit sich. Die Augenlinsen
fokussieren die Sonnenstrahlen auf die Netzhaut. Vor allem der infrarote und der ultraviolette
Anteil des Sonnenlichts erzeugt Brennflecken auf der Netzhaut und zerstört irreparabel einen
Teil der Stäbchen und Zapfen in der Netzhaut, deren photochemische Reaktionen den
angeschlossenen Nerven erst den Seheindruck vermitteln. Die Netzhaut ist
schmerzunempfindlich, weshalb die Gefahr auch besonders groß ist, denn man bemerkt den
schädlichen Lichteinfall nicht sofort. Wenn man feststellt, daß etwas nicht stimmt, dann ist es
schon zu spät. Vor allem Kinder sind besonders gefährdet, da sie sehr sorglos mit der Gefahr
umgehen. Bei der totalen Sonnenfinsternis vom 7. März 1970 wurden in den USA 145 Fälle
bekannt, bei denen Menschen durch ihre unvorsichtigen Sonnenbeobachtungen das
Augenlicht ganz oder fast vollständig verloren haben.
Zur sicheren Sonnenbeobachtung dürfen keine Kompromisse eingegangen werden, das Risiko
ist einfach zu groß. So sollte man keinesfalls starke Sonnenbrillen, dunkle Filmstreifen oder
berußtes Fensterglas oder ähnliches verwenden. Sie alle lassen entweder zu viel sichtbares
Licht oder zuviel Licht einer bestimmten unsichtbaren Wellenlänge, wie zum Beispiel UV
oder Infrarotstrahlung, durch. Auch dichte Wolken sind kein geeignetes Mittel. Zur sicheren
Sonnenbeobachtung muß gewährleistet sein, daß die Lichtintensität aller Wellenlängen auf
etwa ein Hunderttausendstel oder weniger reduziert wird. Eine Möglichkeit, wenn auch eine
etwas notdürftige, sind Schweißerbrillen oder Schweißerhelme. Letztere bieten durch ihre
abgeschlossene Form, die das Gesicht vollständig abdeckt, einen sehr guten Schutz. Sie
nehmen vor allem Kindern die Möglichkeit, zwischen den Brillengläsern hindurchzuschauen.
Bei Schweißerbrillen sollte man noch zusätzlich darauf achten, daß sie nicht zu wenig
abdunkeln, wie dies Autogenschutzbrillen tun. Speziell bei Sonnenfinsternissen werden recht
billige Schutzbrillen angeboten, die mit einer speziellen reflektierenden Folie ausgestattet
sind, die das Licht sehr gut dämpft. Sie haben allerdings den Nachteil, daß sie nicht auf kleine
Kinderköpfe passen und diese dann zwischen den schützenden Brillen durchschauen. Weitere
91
Nachteile sind die geringe Reißfestigkeit der Filterfolie und der Umstand, daß viele
Filterfolien das Umgebungslicht in die Augen reflektieren. Das hat nicht nur zur Folge, daß
das Auge durch die zusätzlichen Bilder irritiert wird, sondern daß auch UV-Licht von hinten
in die nun recht weit geöffnete Pupille eintreten kann. Hier wäre es nötig wie beim
Schweißerschirm eine komplette Gesichtsmaske anzufertigen, die auch über den Hinterkopf
geht. Manche Schutzbrillen bestehen aus zwei Folien, die hintereinander angeordnet sind. Die
erste ist dabei die reflektierende, die zweite ist eine zusätzliche Filterschicht, die das ohnehin
fast zu helle Sonnenbild der ersten Schicht abdunkelt und zusätzlich Streulicht vermeidet. Sie
hat allerdings den Nachteil, durch Reflexion an den Filterschichten, mehrfache Sonnenbilder
zu liefern. Man könnte nun meinen, man solle einfach keine reflektierende Folie, sondern nur
eine stark dämpfende dunkle Filterfolie verwenden. Diese erhitzen sich aber in der Sonne
stark und können sich verziehen. Die visuelle Sonnenbeobachtung ist gar nicht so einfach wie
man meinen möchte, vor allem wenn man Ansprüche an das gelieferte Sonnenbild stellt.
Es gibt jedoch auch Situationen, in denen man völlig ohne Hilfsmittel die Sonne beobachten
kann. Nämlich dann, wenn sie im Sommer blutrot auf oder untergeht. Bei solchen
Gelegenheiten kann man sogar mit dem Feldstecher auf Sonnenfleckenjagd gehen, ohne eine
Beeinträchtigung des Augenlichts befürchten zu müssen. Wohlgemerkt, die Sonne muß
wirklich rot erscheinen. Leider sind solche Sonnenuntergänge selten.
Eine weitere Möglichkeit die Sonne ohne optische Vergrößerung zu beobachten ist das
Guckson. Es besteht aus zwei planen Glasplatten, die in knappem Abstand leicht verschoben
aber parallel zueinander
angeordnet sind. Die
Lichtdämpfung erfolgt
dabei durch mehrfache
Reflexion an den
Glasoberflächen. Dabei
wird nur ein geringer
Teil des Sonnenlichtes etwa 4 % - reflektiert.
Damit die
Glashinterseite nicht
reflektiert, wird sie mit
entsprechender
mattschwarzer Farbe
Abb. 4.1: Konstruktionsskizze für das Guckson (aus: Die Sonne beobachten,
geschwärzt. Das Gerät
von Reinisch, Beck, Hilbrecht und Völker).
wird unter einem
bestimmten Winkel gegen die Sonne gehalten und dabei die Reflexion der Sonne betrachtet,
die zwei, vier oder sechsfach sein kann, je nach benötigter Lichtdämpfung. Durch die
Mehrfachreflexion kommt es sehr auf die Oberflächengüte des Glases an, da sich
entsprechende Fehler vervielfachen. Die zweifache Reflexion wirkt wie eine dunkle
Sonnenbrille und ist nur dann zu verwenden, wenn die Sonne hinter dichtem Nebel steht.
92
Das Gerät ist,
richtig ausgeführt,
von hoher Güte,
aber für Kinder
eher nicht zu
empfehlen, da die
Gefahr besteht,
daß sie zwischen
den Glasscheiben
hindurch blicken.
Versierte Bastler
können aber
bestimmt
entsprechende
Abb. 4.2: Strahlengang bei der Sonnenbeobachtung mit dem Guckson. (aus: Die Sonne
Blenden
beobachten, von Reinisch, Beck, Hilbrecht und Völker).
anbringen, so daß
ein direktes Beobachten der Sonne unmöglich wird.
4.1.1 Was ist zu sehen
Bereits ohne optische Vergrößerung kann die Sonne ein lohnendes Beobachtungsobjekt sein.
Deutlich kann die Randverdunkelung ( engl. limb darkening ) beobachtet werden. Durch
diesen Effekt erscheint die Sonne plastischer und kugelförmig, nicht unbedingt mehr als
Scheibe.
Abb. 4.3: Zur Erklärung der Randverdunkelung der Sonne. (aus dem
dtv-Atlas zur Astronomie).
93
Die Randverdunkelung ist ein erster direkter Beweis für einen starken
Temperaturgradienten in der Sonnenatmosphäre. In der Mitte erscheint die Sonnenscheibe
deutlich heller und folglich heißer, als am Rand. In der Mitte der Sonnenscheibe sehen wir
normal auf die Oberfläche und daher deutlich in tiefere, also heißere, Schichten. Am
Sonnenrand hingegen schließt der Sehstrahl einen großen Winkel mit der Flächennormalen
ein und muß daher einen viel größeren Weg durch die Sonnenatmosphäre zurücklegen, um in
tiefere Schichten vorzudringen. Auf diesem längeren Weg wird ein Lichtstrahl nun deutlich
geschwächt, so daß ihn die entsprechend seichteren Schichten an Leuchtkraft übertreffen
können.
Zur Beobachtung dieses Phänomens ist es wichtig, daß die Sonne sehr stark durch den
verwendeten Filter abgedunkelt wird und sie nicht gleißend hell erscheint, wo kaum eine
Randabdunkelung feststellbar wäre. Die oben erwähnten Sonnenfinsternisbrillen sind dazu
eher schlecht geeignet.
In Maximumszeiten der Sonnenaktivität sind manchmal auch ohne optische Vergrößerung
schwarze Flecken auf der Sonnenscheibe zu sehen. Es sind dies die sogenannten
Sonnenflecken, die deshalb so schwarz erscheinen, weil es sich dabei um Bereiche der
Sonnenatmosphäre handelt, die wesentlich kühler sind als ihre Umgebung. Der
Temperaturunterschied beträgt etwa 2000 Kelvin.
Abb. 4.4: Fotos der ganzen Sonne zeigen die Randabdunkelung recht deutlich. Am 14 1. 2000 waren im
Teleskop auch einige Sonnenflecken zu erkennen. Foto von Siegfried Hold mit einem 70 mm
Refraktor in Okularprojektion mit Sonnenpentaprisma und Gelbfilter W 58, 1/1000 s auf
Kodak Technical Pan.
Nach dem Gesetz von Stefan-Boltzmann erhält man einen Intensitätsabfall auf etwa 30 % .
94
P = σ A T4;
P
I= ;
A
4
I Fleck TFleck
=
; mit TFleck ≈ 4300 K ; TSonne ≈ 5800 K ;
I Sonne TSonne
Das ist bereits ein enormer Kontrastunterschied, der die Sonnenflecken schwarz erscheinen
läßt.
Ohne optische Vergrößerung erscheinen die Flecken aber ohne Gestalt und sind höchstens für
Spekulationen gut. Für etwas sind sie aber noch zu gebrauchen:
Wenn sich ein großer Fleck für einige Tage hält, so kann man mit ihm die Sonnenrotation
nachweisen und vielleicht sogar eine grobe Schätzung für die
Rotationsdauer erhalten.
4.2 Sonnenbeobachtung mit dem Teleskop
Wesentlich besser funktioniert das mit dem Teleskop. Am 8. Dezember 1610 hat Thomas
Harriot (1560 - 1621) die erste teleskopische Beobachtung von Sonnenflecken durchgeführt.
Die Sonne wurde direkt durch das Fernrohr beobachtet, was sehr ngefährlich ist.
Vorzugsweise wurde bei tiefstehender Sonne oder bei leicht verschleiertem Himmel
beobachtet. Nur gelegentlich wird die Benutzung von Farbgläsern erwähnt.
Damals war die Herstellung eines Sonnenfilters bestimmt keine Kleinigkeit. Schon bald
erkannte man, daß die Sonne hell genug war, um sie mit dem Fernrohr auf ein Blatt Papier zu
projizieren.
4.2.1 Die Sonnenprojektion
Die Sonnenprojektion ist die einfachste Art, ungefährdet die gleißend helle Sonnenscheibe zu
beobachten. Bereits ein auf ein Stativ montierter Feldstecher ist dazu in der Lage. Wenn man
mit einem weißen Karton etwa 30 cm hinter dem Okular das Sonnenbild auffängt, können
sogar mehrere Personen gleichzeitig die Sonne betrachten. Es erweist sich als günstig dabei
mit einem zweiten Karton, der ein Loch, das genau über das Objektiv paßt, einen Schatten zu
erzeugen, damit das projizierte Sonnenbild einen höheren Kontrast erhält. Die
Projektionsmethode ist bestimmt die preiswerteste und für den Anfang die
empfehlenswerteste Methode der Sonnenbeobachtung. Doch auch
hier sind wegen der enormen Lichtfülle einige Dinge zu beachten. Das Auffinden der Sonne,
damit ihr Bild auf den Projektionsschirm fällt, darf keinesfalls mit dem
95
Abb. 4.5: Skizze für die einfachste Methode der Sonnenbeobachtung, der Sonnenprojektion. (aus: Astronomie
ganz einfach von Percy Seymor)
Auge hinter dem Okular erfolgen. Man schwenkt das Teleskop so, daß sein Schatten minimal
wird. Bei nicht allzu starker Vergrößerung ist spätestens nach ein paar Versuchen die Sonne
im Visier. Das Fernrohrobjektiv - auch Feldstecher sind Fernrohre - sammelt nun das
Sonnenlicht und erzeugt in seinem Inneren eine nicht zu unterschätzende Strahlungsdichte.
Aus diesem Grund ist nicht jeder Fernrohrtyp für die Projektionsmethode geeignet. Für
Refraktoren ist diese Beobachtungsart uneingeschränkt zu empfehlen. Von der
Projektionsbeobachtung mit Reflektoren, insbesondere mit Schmidt-Cassegrain-Systemen
oder anderen geschlossenen Systemen ist eher abzuraten, da der Fangspiegel bereits sehr nahe
dem Brennpunkt des Hauptspiegels sitzt und daher wegen der Hitzeeinwirkung nicht nur
seine exakte Form verliert sondern auch zu platzen droht. Ferner ist darauf zu achten, daß das
Sonnenlicht auch zur Gänze wieder das Teleskop verläßt, da es sonst im Inneren an Blenden
oder sonstigen Einrichtungen Schaden anrichten kann. Zudem erzeugt es starke
Luftturbulenzen, die die Beobachtungsqualität deutlich verschlechtern. Deshalb sollte man bei
der Projektionsmethode keine Okulare mit zu kleinem wahrem Gesichtsfeld anwenden, damit
auch die ganze Sonnenscheibe durch das Okular paßt. Da trotzdem das Okular stark erhitzt
wird ist unbedingt zu beachten, daß bei Beobachtung mit dem Projektionsschirm
ausschließlich einfache unverkittete Okulare ( z. B. Huygens oder Mittenzwey Typen ) zum
Einsatz kommen. Bei anderen Okularen können die Kittschichten der einzelnen optischen
Komponenten schmelzen und dadurch die Okulare zerstört werden.
Trotz aller Vorsicht wird es dazu kommen, daß sich das Fernrohr in der Sonne aufheizt.
Deshalb empfiehlt es sich von Zeit zu Zeit das Teleskop von der Sonne abzuwenden und
auskühlen zu lassen. Die Abbildungsleistung wird bei der anschließenden Wiederaufnahme
der Beobachtungen deutlich verbessert sein.
Will man die Sonne nicht nur beobachten, sondern auch Zeichnungen anfertigen, so sollte auf
eine gewisse Stabilität den Projektionsschirms nicht verzichtet werden. Zudem sollte sein
Abstand vom Okular variabel sein, damit die Größe des Sonnenbildes eingestellt werden
96
kann, damit es auf etwaige Schablonen paßt. Denn die Sonne ändert, bedingt durch die
Ellipsenbahn der Erde, ihre scheinbare Größe am Himmel. Der Schirm selbst kann aus einer
runden oder quadratischen Platte ( am besten Aluminium ) bestehen. Wichtig ist, daß die
Platte rechtwinkelig zur optischen Achse des austretenden Lichtbündels steht. Andernfalls
tritt nicht nur eine Unschärfe sondern auch eine grobe Verzerrung des Projektionsbildes auf.
Als Projektionsfläche
verwendet man einfach
weißes Papier, das mit
Klammern auf der
Projektionsplatte befestigt
wird. Als Durchmesser des
projizierten Sonnenbildes
reichen etwa 10 bis 15 cm aus
- am besten gleich
ausprobieren. Zu einer
Kontraststeigerung gibt es
neben dem oben erwähnten
Karton noch die Möglichkeit,
ein schwarzes Tuch (z.B.
Tischdecke, schwarzes
Bettlaken ) über sich und den
Projektionsschirm zu hüllen.
Starke Kontraststeigerung und
Detailfülle sind die Folge.
Vorsicht ist dabei geboten, da
das Tuch in den Strahlengang
geraten und Feuer fangen
kann. Für den Schulgebrauch
ist der
Abb. 4.6: Der Projektionskasten erhöht den Kontrast des Sonnenbildes.
Projektionskasten eine
(aus Der Kosmos Sternatlas von Dunlop und Tirion)
Alternative. Es handelt sich
dabei um einen mit
geschwärzter Kupferfolie, zur Wärmeableitung an den Seiten, verkleideten Kasten, der den
Projektionsschirm trägt. Eine seitliche Öffnung geeigneter Größe ermöglicht den Blick auf
das Sonnenbild. Je nach Intensität der Sonnenstrahlung kann es 5 bis 10 Minuten dauern, bis
sich die Luft im Kasten gleichmäßig erwärmt und sich die Qualität des Sonnenbildes deutlich
verbessert.
Nun zu den geometrischen Verhältnissen:
Das Sonnenbild hat in der Brennebene des Objektivs den Durchmesser:
DF = f Opj . tan Φ
wobei f Opj. die Brennweite des Objektivs und Φ der scheinbare Winkeldurchmesser der
Sonne am Himmel ist.
Das nachgeschaltete Okular funktioniert im Prinzip wie das Objektiv eines Diaprojektors.
Aus der Abbildungsgleichung folgt sofort der Projektionsdurchmesser der Sonne ( DP ):
DP B b d p
= = =
DF G g
g
97
wobei d P der Projektionsabstand, also der Abstand des Projektionsschirms von dem Okular
und g der Abstand vom Okular zum Brennpunkt des Objektivs ist, in dessen Ebene sich
das Fokalbild der Sonne befindet.
In den meisten Fällen ist die Okularbrennweite wesentlich kleiner als die Projektionsweite, so
daß g durch die Okularbrennweite ersetzt werden kann.
Φ
Abb. 4.7: Geometrische Verhältnisse bei der Sonnenprojektion.
Bei vorgegebenem Projektionsdurchmesser wird der Projektionsabstand dann zu:
dP =
f Ok DP
f Obj . tan Φ
Beispiel: Zur Sonnenprojektion wird ein Fraunhoferrefraktor mit 1.5 m Brennweite
verwendet. Der Projektionsdurchmesser der Sonne soll 20 cm betragen, wobei ein HuygensOkular mit 20 mm Brennweite eingesetzt werden soll. Es werde mit einem mittleren
Sonnendurchmesser von 32 Bogenminuten gerechnet.
dP
=
20 200
32 π
1500. tan
60 180
=
286 mm
Obige Formeln gelten natürlich nur für dünne Linsen und sollen nur als Hilfestellung zu
verstehen sein. Keineswegs geben sie die wirklichen Verhältnisse bei mehrlinsigen Okularen
wieder.
Weiters sei darauf hingewiesen, daß das Sonnenbild am Projektionsschirm auf jeden Fall
fokussiert werden kann, sobald der Projektionsabstand mehr als die doppelte Brennweite des
Okulars beträgt, vorausgesetzt der Okularauszug erlaubt den erforderlichen Verstellweg.
Die nächstgehobenere Möglichkeit der Sonnenbeobachtung besteht in der Verwendung von
Filtern, die das Sonnenlicht geeignet abschwächen.
Üblicherweise wird die Intensität auf das 10 −5 - fache abgeschwächt.
4.2.2 Sonnenfilter
Bei den Sonnenfiltern unterscheidet man zwischen Okularfilter und Objektivfilter. Die
Okularfilter werden im Strahlengang des Teleskops erst kurz vor dem Okular eingesetzt. Sie
müssen die enorme Hitze der gebündelten Sonnenstrahlung aushalten. Nur allzuoft zerspringt
ein solcher Filter dann und setzt das beobachtete Auge der gefährlichen Sonnenstrahlung aus.
Aus diesem Grund möchte soll hier nicht weiter auf Okularfilter eingegangen werden. Sie
sollten in jedem Fall, auch wenn man nur einen kurzen Blick riskieren will, vermieden
werden.
Die sicherste Art der Sonnenbeobachtung und daher auch die empfehlenswerteste ist die
Sonnenbeobachtung mit Objektivsonnenfilter. Es handelt sich dabei um mit dünnen
98
Metallschichten bedampfte Filter, die vor das Objektiv angebracht werden. Man kann sie mit
Spiegeln vergleichen, die einen Bruchteil des einfallenden Lichts durchlassen. Durch die
Lichtreflexion absorbieren diese Filter kaum Energie und werden deshalb auch nicht heiß.
Ebenso werden dadurch Luftturbulenzen im Teleskop reduziert. Objektivfilter können bei
allen Teleskopen uneingeschränkt verwendet werden und es sind alle Okulartypen
verwendbar. Objektivfilter bieten einen zuverlässigen Schutz für das Auge, da sie bei der
Beobachtung nicht plötzlich durch zu hohe Temperatur zerspringen können. Auch die für das
Auge schädliche Infrarotstrahlung gelangt nicht in das Okular. Hochwertige Objektivfilter
erlauben es, feine und feinste Details auf der Sonne beobachten zu können. Allerdings müssen
Objektivfilter hochpräzise gefertigt sein und haben daher einen stolzen Preis.
Objektivfilter müssen einige schwierige Kriterien erfüllen:
Einerseits gibt es hohe Anforderungen an den Schichtträger, der meist aus Glas oder besser
aus optischem Glas besteht und andererseits an die Filterschicht selbst. Das Filterglas muß
äußerst genau sein und darf weder als Linse noch als Prisma wirken. Weiters muß die Oberund Unterseite des Filters zueinander planparallel sein mit einem äußerst kleinen zulässigem
Keilfehler. Die minimal zulässige Brennweite die der Filterträger haben darf beträgt über 10
Kilometer. Die Planparallelität, die dafür sorgt, daß die durch den Filter laufenden
Lichtstrahlen nicht gestört werden, muß weit unterhalb der Lichtwellenlänge liegen - etwa ein
achtel der Lichtwellenlänge. Weiters darf die maximale Dickendifferenz zweier am Rand des
Filters gegenüberliegenden Stellen nur wenige Tausendstel Millimeter betragen. Die
Filterschicht selbst muß möglichst homogen, also frei von Fehlstellen sein. Fehlstellen wirken
wie Lichtquellen, die den Kontrast enorm mindern.
Eine Reihe von Anforderungen, die hohe Präzision erfordern und damit einen Teil des hohen
Preises erklären.
Eine Alternative zum Glasfilter ist der Objektivfilter aus Folie. Das ist eine hauchdünne
Polyesterfolie, die aluminiumbedampft ist. Die Folien sind extrem dünn und beeinflussen
durchlaufende Lichtstrahlen nur wenig. Sie erlauben visuelle Beobachtung bis etwa 70-fache
Vergrößerung. Allerdings gibt es große Unterschiede bei den angebotenen Filterfolien.
Vorsicht ist beim Erwerb von Billigglasfiltern aus den USA geboten. Sie bestehen aus
Floatglas. Floatglas wird hergestellt, indem die flüssige Glasschmelze auf eine glatte
Wasseroberfläche gebracht wird. Es ist zwar wesentlich besser als Fensterglas, kann aber die
oben angeführten hohen Anforderungen nicht erfüllen.
Ferner sollte man noch auf die Filterfassung achten. Sie sollte möglichst stark reflektierend
sein damit sie keine Luftturbulenzen verursacht.
99
4.2.3 Das Sonnenpentaprisma
Für Spezialisten gedacht ist das Sonnenpentaprisma. Es handelt sich dabei um ein
Glasprisma, welches das Sonnenlicht durch Reflexion, ähnlich wie beim Guckson, dämpft.
Der Großteil des
Sonnenlichts
gelangt dabei
durch das Prisma
und durch eine
Öffnung des
Prismengehäuses
ins Freie. Nur
wenige zehntel
Prozent gelangen
in das Okular. Das
Sonnenpentaprism
a wird kurz vor
dem Okular
eingesetzt wo
keine so großen
Anforderungen an
die Genauigkeit
der optischen
Abb. 4.8: Das Sonnenpentaprisma (aus: Die Sonne beobachten, von Reinisch, Beck,
Flächen herrschen
Hilbrecht und Völker).
als in
Ojektivnähe. Dazu können Prismen relativ einfach mit hoher Genauigkeit erzeugt werden
weswegen das Sonnenpentaprisma wahrscheinlich das schärfste Sonnenbild zeichnet. Ein
weiterer Grund für das saubere Bild des Prismas ist die völlig neutrale Farbwiedergabe, da
keine Filterung stattfindet. Im Gegensatz zum Sonnenfilter, der die Sonne charakteristisch
färbt - meist gelb - entsteht im Pentaprisma ein weißes sehr kontrastreiches Sonnenbild. Das
Sonnenpentaprisma hat zudem eine wesentlich höhere Transmission - Lichtdurchlässigkeit so daß es vor allem in der Fotografie höchst erfolgreich eingesetzt werden kann.
Für die visuelle Beobachtung muß ein zusätzlicher Okulargraufilter verwendet werden. Oft
verwendet man zwei Polfilter die man gegeneinander verdrehen und so die Bildhelligkeit, in
gewissen Grenzen, kontinuierlich verändern kann.
Nachteilig wirkt sich die Lichtfülle im Teleskop aus, wie bei der Sonnenprojektion. Deshalb
ist das Sonnenprisma für Schmidt-Cassegrain-Systeme und andere geschlossene Teleskope
nicht verwendbar. Am häufigsten wird es in Kombination mit Refraktoren eingesetzt. Im
Gegensatz zur Sonnenprojektion gibt es beim Pentaprisma keine Einschränkung an die
Okularwahl. Es kann jede Bauart verwendet werden. Ein gewisses Problem bei
Gruppenvorführungen kann das aus dem Prisma nach unten austretende gebündelte
Sonnenlicht sein. Hier ist Vorsicht geboten.
Mit einem Feldstecher oder einem kleinem Teleskop kann man mit einem der oben genannten
Mittel bereits Beobachtungen der Sonnenflecken durchführen. Ab 10 cm Öffnung ist das
Auflösungsvermögen des Teleskops schon beträchtlich, so daß sich Luftturbulenzen bereits
sehr störend auswirken. Deshalb ist die Wahl des Beobachtungsortes von entscheidender
Bedeutung.
4.2.4 Die Wahl des Beobachtungsortes
Anders als bei nächtlichen Beobachtungen, wo sich die Erdatmosphäre nach
Sonnenuntergang immer mehr beruhigt und das Teleskop ein immer schärferes Bild zeichnet,
100
verschlechtert sich die Situation tagsüber dramatisch. Die enorme Strahlungsintensität der
Sonne erwärmt die unteren atmosphärischen Schichten schnell und stark. Es entstehen
unregelmäßige Luftströmungen, die ein atmosphärisches Flimmern verursachen. Man nennt
dies auch ein schlechtes Seeing. Nachdem die Erdkruste unterschiedlich erwärmt wird gibt es
Orte mit besserem Seeing. Der Beobachtungsort hat großen Einfluß auf die Qualität der
Beobachtung, da Beobachtungen unter schlechten Bedingungen bei aller Sorgfalt und bester
technischer Ausführung nicht verbessert werden können.
Grundsätzlich soll der Sehstrahl über homogenes Gelände führen, das heißt über sich
gleichmäßig erwärmendes beziehungsweise abkühlendes Gebiet. Sehr ungünstig sind bebaute
Flächen ( Häuser und Straßen ), da sie sich schnell erwärmen und abkühlen und sich speziell
im Winter mit der heißen Luft aus Schornsteinen vermischen und dadurch das bekannte
"Flirren" der Luft erzeugen.
Ebenso ungünstig sind Getreidefelder, da sie Wärme nur geringfügig speichern können und
daher raschen Temperaturwechseln ausgeliefert sind. Die größten Turbulenzen entstehen in
den bodennahen Luftschichten. In der Ebene herrschen deshalb nur in den frühen
Morgenstunden gute Beobachtungsbedingungen (Abb. 4.8 a). In etwa 10 bis 20 m Höhe über
einer Ebene hat sich die Luft bereits beruhigt, so daß dort die Beobachtungsbedingungen
bereits wesentlich besser sind (Abb. 4.8 b). Deshalb gibt es auch so viele Turmteleskope für
die Sonnenbeobachtung.
Abb. 4.9: Verschiedene Standorte von Sonnenteleskopen (aus dem Handbuch für Sternfreunde
von G. D. Roth, Band 2).
Der beste Standort für ein erdgebundenes Sonnenteleskop liegt in der Nähe eines großen
effektiven Wärmespeichers, wie zum Beispiel ein großer See einer ist (vgl. das berühmte
Sonnenteleskop am big bear lake in Californien). Auch große Waldgebiete mindern durch
Verdunstung die Luftunruhe deutlich (Abb. 4.8 c). Mittel- und Hochgebirgslagen bieten
wegen der aufsteigenden warmen Luftmassen nur in den frühen Morgenstunden gute
Bedingungen
(Abb. 4.8 d und e). Der Standort in Abb. 4.8 f ist eine interessante Möglichkeit. Aufsteigende
Luftmassen sorgen an einem mindestens 50 m über der Ebene befindlichen Standort an einem
Süd- oder Südwesthang für gleichmäßige Aufwinde, die für sehr gute
Beobachtungsbedingungen sorgen.
Besonderes Augenmerk sollte man auf die unmittelbare Umgebung des Teleskops richten.
Erwärmung sollte weitgehend unterbunden werden.
Bei Gruppenbeobachtungen ist es besser, wenn die Teilnehmer sich nicht gerade unter dem
Sehstrahl aufhalten.
101
Die Wärmequellen werden um so störender, je näher sie dem Teleskop sind. Schwarze Teile
an der Ausrüstung und in der unmittelbaren Umgebung sind daher zu vermeiden. Die meiste
Luftunruhe entsteht am und im Teleskop. Wirkungsvoll ist hier eine ringförmige Blende im
Objektivbereich. Der Autor dreht etwa alle 10 bis 20 Minuten das Teleskop von der Sonne ab
und versucht es möglichst gut abzuschatten. Nach einer kleinen Schattenpause ist dann das
Sonnenbild meist wesentlich besser als zuvor. Interessanterweise hilft der eine oder andere
Trick, der noch am Vortag eine deutliche Verbesserung brachte, am nachfolgenden Tag nicht
mehr oder umgekehrt. Jeder, der nicht nur gelegentlich die Sonne beobachten will, muß
ohnehin selbst Erfahrung am Gerät machen und wird mit Sicherheit die eine oder andere
Kuriosität erleben.
4.3 Die Photosphäre
4.3.1 Die dünne Sonnenoberfläche
Die auffälligsten Oberflächenerscheinungen, die die Sonne zu bieten hat, sind Sonnenflecken.
Sie scheinen auf den ersten Blick ziemlich wahllos über die Sonne verstreut zu sein. Es kann
auch passieren, daß sich auf der Sonne über lange Zeit hinweg, in Minimumszeiten der
Sonnenaktivität, überhaupt keine Flecken zeigen. Die Sonne ist dann ziemlich unspektakulär
und für Vorführungen kaum geeignet. Gut wenn man Fotos von der aktiven Sonne zeigen
kann.
Die im weißen Integrallicht sichtbare Sonne ist in Wirklichkeit nur ein winziger Teil der
Sonne, eine dünne Schale, die man Photosphäre nennt. Sie ist nur etwas mehr als 100 km
dick. In dieser dünnen Schicht ändert das solare Gas seine Durchsichtigkeit - Transparenz rapide von beinahe undurchsichtig, unterhalb der Photosphäre, bis transparent, über der
Photosphäre. Diese Schicht ist so dünn, daß sie von der Erde aus, selbst mit großen
Teleskopen nicht aufgelöst werden kann. Deshalb erscheint die Sonne, die ja eigentlich ein
riesiger Gasball ist, so scharf begrenzt. Beinahe das gesamte beobachtbare Sonnenlicht
stammt aus dieser dünnen Photosphäre. Der Grund warum die Photosphäre so dünn ist, ist im
Verhalten des Wasserstoffs zu finden. Von innen nach außen nimmt die Temperatur und der
Druck der Sonne stetig ab. Man spricht von Temperatur- und Druckgradienten. Im sichtbaren
Spektralbereich trägt das negative Wasserstoffion, das ist ein Wasserstoffatom, das zeitweilig
ein weiteres Elektron eingefangen hat, wesentlich zur Emission und Absorption von
Strahlung bei. Die Dichte dieses Wasserstoffions ist äußerst empfindlich gegenüber
Temperaturänderung und nimmt oberhalb der Photosphäre überdurchschnittlich stark ab. Die
Randverdunkelung, die bereits weiter oben erwähnt wurde, spielt sich nur in dieser dünnen
Schicht ab. Umgangssprachlich wird die Photosphäre auch als Sonnenoberfläche bezeichnet,
obwohl ein Gasball keine Oberfläche haben kann.
102
4.3.2 Photosphärische Granulation
In guten Teleskopen kann, auch zu Minimunszeiten, die Sonnengranulation
(granulum, lat. das Korn) beobachtet werden. Bei schlechtem Seeing macht sie sich
zumindest als rauhe feingesprenkelte Oberflächenstruktur bemerkbar. Bei gutem Seeing kann
man die Sonnengranulation als feine Zellen der Photosphäre erkennen. Die photosphärische
Granulation zählt zu den schwierigsten Beobachtungsobjekten auf der Sonne und ist
besonders für kleine Teleskope eine Herausforderung. Die Beobachtungen sind auf eine hohe
Winkelauflösung an der Grenze der theoretischen Auflösung angewiesen, die durch die
Leistungsfähigkeit des Teleskops und die Luftbedingungen bestimmt wird. Die
Sonnengranulation ist nicht besonders kontrastreich, was ihre visuelle Beobachtung
erschwert.
Es gibt allerdings einen kleinen Trick: Wenn man leicht an das Teleskop tippt, so daß das
Bild etwas schwingt, erhöht sich scheinbar der Kontrast und das Bild wird etwas schärfer,
weil das Auge eigentlich auf bewegte Bilder trainiert ist.
Der Durchmesser der Granulen liegt meist zwischen 0.5 und 2.5 Bogensekunden.
Die einzelnen Granula mit ihrer individuellen Form werden erst dann sichtbar, wenn der
intergranulare Raum in der Größenordnung von einer Bogensekunde aufgelöst wird.
Abb. 4.10: Siegfried Hold fotografierte die Sonnengranulation am 5. Feb. 2000; 1/500 s auf Kodak
Technical Pan, 300 mm Schiefspiegler, Okularprojektion mit Sonnenpentaprisma
und Filter W 58.
Es ist anerkannt, daß es sich bei der Granulation um Zellen thermischer Konvektion handelt.
Hierfür sprechen vor allem drei Beobachtungen:
1. Das Muster der Granulation ist vergleichbar mit demjenigen Muster, das sich bildet, wenn
man eine flache Flüssigkeitsschicht von unten erwärmt.
103
2. Geschwindigkeitsmessungen haben gezeigt, daß sich das helle (und damit heißere) Gas in
der Sonne nach oben, das dunklere (kühlere) nach unten bewegt.
3. In der Photosphäre wird durch den Aufstieg von ionisiertem Wasserstoff in Bereiche, wo
keine Ionisation vorliegt, genügend Ionisationsenergie gewonnen, um eine permanente
Konvektionsbewegung aufrecht zu erhalten.
4.4 Die Wasserstoffkonvektionszone
Wie entsteht Konvektion überhaupt? Betrachten wir einmal eine Sternatmosphäre im
Strahlungsgleichgewicht, d.h. Temperatur und Druckabnahme nach außen, in der eine
Gasmasse (Volumelement) zufällig, durch eine lokale Störung, ein kleines Wegstück
aufsteigt. Der Einfachheit halber nehmen wir an, daß die Gasmasse während sie um das kleine
Wegstück aufsteigt, keinen Wärmeaustausch mit ihrer Umgebung hat. Der Aufstieg sei also
adiabatisch. Ist das Gasvolumen nun an einem höheren Ort angekommen, so expandiert es,
weil an seinem neuen Ort, gemäß der barometrischen Höhenformel, ein geringerer Druck
herrscht. Durch die adiabatische Expansion kühlt die Gasmasse ab.
Wenn sie dabei kühler wird als ihre neue Umgebung, so ist sie dichter und damit schwerer als
ihre Umgebung und sinkt wieder ab. Die Schichtung bleibt stabil und die Materie im
wesentlichen in Ruhe.
Wenn die Gasmasse aber trotz der adiabatischen Abkühlung wärmer bleibt als ihre neue
Umgebung, so ist sie weniger dicht, also leichter, und steigt weiter auf. Es bildet sich eine
stabile Konvektionszone.
Abb. 4.11: Energietransport im Sonneninneren: Nach der Strahlungszone folgt die Konvektionszone.
(aus dem Star Observer Spezial: Die Sonnenfinsternis 1999)
Im Sonneninneren ist die Materie stark ionisiert, weswegen sie für Strahlung fast
undurchlässig wird (Elektron-Photon-Streuung). Infolgedessen benötigt die
elektromagnetische Energie etwa eine Million Jahre, um aus dem Kern an die Oberfläche zu
gelangen. Die große Opazität (Absorption über alle Wellenlängen gemittelt) hat auch zur
Folge, daß der Temperaturgradient des Strahlungsgleichgewichtes kleiner ist als der
adiabatische Temperaturgradient. Es kann also keine stabile Konvektion aufrechterhalten
104
bleiben. Der Energietransport erfolgt nur durch Strahlung - Wärmeleitung ist
vernachlässigbar. Die fehlende Konvektion verhindert, daß das Helium, das durch die
Kernreaktionen entsteht, aus dem Sonnenkern herausgetragen wird.
Von den tieferen photosphärischen Schichten (Gasdruck: Pg =15 hPa und Temperatur T =
7000 K) abwärts bis etwa 150000 km Tiefe ( Pg = 1 Mrd. Pa, T = 1 Mill. K ) ist die
Sonnenatmosphäre konvektiv instabil. Oberhalb dieser Schicht ist Wasserstoff (das häufigste
Element) praktisch neutral, innerhalb ist er teilweise, unterhalb vollständig ionisiert. Nun
geschieht folgendes: Wenn ein Volumelement mit teilweise ionisiertem Gas aufsteigt, so
beginnt der Wasserstoff zu rekombinieren, und bei jedem Rekombinationsprozeß werden 13.6
eV der thermischen Energie zugefügt. Dadurch wird die adiabatische Abkühlung so sehr
verringert, daß das aufsteigende Gasvolumen wärmer wird als seine neue Umgebung im
Strahlungsgleichgewicht. Das Volumelement steigt also weiter auf. Genau umgekehrt verhält
es sich mit einem absinkenden Volumelement.
Dieser Effekt wird noch verstärkt durch den entgegengesetzten Einfluß der Ionisation auf den
Strahlungs-Temperaturgradienten.
In dieser Konvektionsschicht übernimmt die Konvektion praktisch den gesamten
Energietransport. Die Sonnengranulation läßt sich nun der besonders starken Instabilität einer
wenige hundert Kilometer dicken Oberflächenschicht der Wasserstoffkonvektionszone
zuordnen. Es handelt sich bei der Granulation jedoch um eine turbulente und nicht wie man
meinen möchte um eine stabile zellulare Konvektion. Nach Cloutman bilden sich keine
stationären Konvektionszellen, wie wir sie vom Kochtopf oder der Kaffeetasse kennen,
sondern aufsteigende, torusartige Gasvolumina, ähnlich einem Kringel im Zigarettenrauch
oder in einem Atompilz. Die Temperaturdifferenz der Granula zu ihren dunkleren
Zwischenräumen beträgt etwa 200 K. Spektroskopisch wurden Auf- und Abwärtsströmungen
mit rund 500 m/s gemessen.
4.5.1 Sonnenflecken und Magnetfeld
Die Wasserstoffkonvektionszone ist eine riesige thermodynamische Maschine, die zusammen
mit der hohen Leitfähigkeit der ionisierten Materie wie ein Dynamo starke Magnetfelder
erzeugt. Die Sonne besitzt jedoch kein allgemeines Magnetfeld wie die Erde. Vielmehr wurde
durch hochaufgelöste Beobachtungen deutlich, daß die Magnetfelder in dünnen Flußröhren
(Durchmesser etwa 300 km) konzentriert sind. Ihre Stärke beträgt etwa 0.2 Tesla. Diese in die
Photosphäre eingebetteten, senkrecht nach oben stehenden Flußröhren verteilen sich über die
ganze Sonne und nehmen etwa 1 % der Sonnenoberfläche ein.
Die heißen Plasmen der Sonne verhalten sich in Magnetfeldern ganz anders als Gase oder
Flüssigkeiten auf der Erde. Die Sonnenmaterie ist stark ionisiert und deshalb ein sehr guter
elektrischer Leiter. Die Leitfähigkeit beträgt etwa 1/10 des metallischen Kupfers. Im weiteren
hat dies zur Folge, daß Magnetfelder sozusagen in Materie eingefroren sind. D. h. wenn
einmal ein Magnetfeld existiert, so dauert es sehr lange, bis die ohmschen Verluste das
Magnetfeld aufgezehrt haben. Auch die Materie wird dadurch in ihrer Bewegungsfreiheit
stark eingeschränkt. Sie kann sich dann im wesentlichen nur entlang der magnetischen
Kraftlinien bewegen.
Zudem üben die Feldlinien aufeinander einen Druck aus, sie versuchen sich gegenseitig
abzustoßen. Dieser magnetische Druck wirkt nur senkrecht zu den Feldlinien und
verschwindet parallel dazu. Er ist im Gegensatz zum Gasdruck anisotrop. Im Inneren eines
Magnetfeldes muß daher der Gasdruck kleiner sein als außerhalb, da er sich mit dem
magnetischen Druck zum äußeren Gasdruck addieren muß, damit das Gas im Gleichgewicht
bleibt. Tritt ein solches Magnetfeld in der Wasserstoffkonvektionszone auf, so wird dadurch
der Energietransport beeinflußt. Denn der Energietransportmechanismus - Konvektion - muß
dafür sorgen, daß der Gasdruck im Inneren des Feldes kleiner ist als außerhalb. Der
105
konvektive Energiestrom wird stark gebremst wodurch die darüberliegenden Schichten nicht
soviel Energie erhalten wie die umgebende Photosphäre. Das Gas innerhalb des Magnetfeldes
wird dadurch kühler sein als seine Umgebung und erscheint dunkel.
Solche Gebiete auf der Sonne können mehrfachen Erddurchmesser erreichen und heißen
Sonnenflecken. Sind sie nur 1 bis 10 Bogensekunden groß, dann nennt man sie Poren. Große
Sonnenflecken sind zweigeteilt in ein dunkles Zentrum, das man Umbra nennt, und einen
helleren Kranz der die Umbra umgibt, die Penumbra.
Bei guten Sichtverhältnissen kann man in der Penumbra helle und dunkle Filamente auflösen,
die radial zur Umbra verlaufen. Die Breite der Filamente liegt etwa an der Auflösungsgrenze
bei etwa 0.5 Bogensekunden. Bei den Filamenten handelt es sich um Strömungen von einigen
km/s die zur Umbra hin (dunkle Filamente) und von ihr weglaufen (helle Filamente). Es
handelt sich um Konvektion entlang der Magnetfeldlinien, die fast horizontal verläuft.
Abb. 4.12: Großer Sonnenfleck am 27. Mai 1999; 1/1000 s auf Fujichrome Velvia, 3000 mm Brennweite
( Primärfokus eines 12" SCT) und Objektivsonnefilter Dichte 4.
106
Abb 4.13: Sonnenfleck mit Struktur in der Penumbra. Foto von Siegfried Hold; 1/500 s auf Kodak
Technical Pan, 300 mm Schiefspiegler, Okularprojektion mit Sonnenpentaprisma und
Filter W 58.
4.5.2 Typische Entwicklung eines Aktivitätsgebietes
Sonnenflecken sind nur ein Teil eines Aktivitätsgebietes auf der Sonne, dessen Ursache aber
immer ein starkes Magnetfeld ist. Es treten auch Fackeln, Filamente und Flares auf. Fackeln
sind Gebiete auf der Sonne, in denen sich Flecken bilden können, aber nicht müssen. Man
kann sie fast immer auf der Sonne beobachten. Sie sind über die ganze Sonne verteilt, aber
wegen ihres geringen Kontrastes nur im Bereich der Randverdunkelung sichtbar - es sei denn
man verwendet Spezialfilter. Sie erscheinen heller als die umgebende obere
Photosphärenschicht und in den verschiedensten Formen und Kombinationen: als Flächen,
verästelt, netzartig, zusammenhängend, zerteilt oder punktförmig.
Filamente sind Erscheinungen der Chromosphäre (etwa 8000 km dicke Schicht über der
Photosphäre) die weit in die Korona (Schicht über der Chromosphäre) ragen. Wenn sie über
den Sonnenrand hinausragen, nennt man sie Protuberanzen.
Flares wiederum sind Strahlenausbrüche innerhalb der Chromosphäre, die meist nur im
monochromatischen Licht jedoch manchmal auch im Weißlicht als helle Flecken beobachtet
werden können.
Im folgenden soll ein kleiner Überblick der typischen Entwicklung eines Aktivitätsgebietes
auf der Sonne gegeben werden (Auszug aus dem Handbuch für Sternfreunde von
G.D. Roth Band 2):
1. Tag: Ein Magnetfeldbündel erreicht die Photosphäre. Überschreitet die Feldstärke 0.1
Tesla so wird eine Fackel sichtbar.
2. Tag: Der erste kleine Sonnenfleck erscheint am Westrand der Fackel. Die Fackel nimmt an
Größe und Helligkeit zu. Das Magnetfeldbündel steigt weiter auf, die Feldstärke
nimmt zu.
107
3. Tag: Ein oder mehrere Flecken erscheinen am Ostrand der Fackel, mit entgegengesetzter
magnetischer Polarität zum ersten Fleck. Die vom Magnetfeld und der Fackel
eingenommene Fläche nimmt weiter zu.
Abb. 4.14: Zwei Fleckengruppen mit jeweils einem ausgeprägtm p-Fleck und mehreren f-Flecken. Am 5.
Juni 1999; 1/1000 s auf Fujichrome Velvia, 3000 mm Brennweite ( Primärfokus eines 12"
SCT) und Objektivsonnefilter Dichte 4.
4. Tag: Kleine Flecken verschmelzen zu größeren. Der westliche Fleck - auch p-Fleck
genannt (preceding), weil er in Rotationsrichtung voran liegt - bildet eine Penumbra.
Die Fackel umschließt die Fleckengruppe, bleibt aber weiterhin kompakt. Das
Magnetfeld zeigt eine deutliche bipolare Struktur. Es können die ersten Flares
auftreten.
5. - 13. Tag: Am fünften Tag bildet auch der östliche Fleck - auch f- Fleck (following) - eine
Penumbra. Danach entstehen zahlreiche kleine Flecken zwischen den beiden
Hauptflecken, bis die Gruppe ihre größte Ausdehnung erreicht. Die Helligkeit der
Fackel steigt weiter an, ebenso die vom Magnetfeld eingenommene Fläche. Die
Flarehäufigkeit nimmt zu.
14. - 30. Tag: Alle Flecken außer dem p-Hauptfleck verschwinden. Die Fackel ist sehr
ausgedehnt, beginnt aber zu schrumpfen. Die Flarehäufigkeit nimmt wieder ab. Die
Magnetfeldstärke ist maximal, jedoch nimmt die eingenommene Fläche ab. Ein
stabiles Filament entsteht.
30. - 60. Tag: Auch der p-Fleck schrumpft und verschwindet. Die Helligkeit der Fackel nimmt
ab. Sie wird in kleinere Einzelflächen aufgespalten. Das Magnetfeld wird schwächer
und irregulär. Das Filament nimmt an Länge zu (etwa 100000 km pro
Sonnenrotation) und teilt das Aktivitätsgebiet in zwei Hälften.
60. - 100. Tag: Die chromosphärische Fackel verschwindet. Die photosphärische Fackel löst
sich weiter auf. Das Filament erreicht seine größte Länge und verläuft fast parallel
zum Sonnenäquator.
100. - 250. Tag: Es sind keine Fackeln mehr nachzuweisen. Das Filament löst sich zusammen
mit dem Magnetfeld weiter auf.
108
Außer den Sonnenflecken und den Fackeln am Rand sind die obigen Erscheinungen nur mit
Spezialfilter zu beobachten. Das Magnetfeld kann nur mit hochauflösenden Spektrographen
mit Hilfe des Zeeman-Effektes gemessen werden (selbst bei hohen Feldstärken von etwa 0.4
Tesla beträgt die Linienaufspaltung nur 0.2 Angström). Sonnenflecken entstehen bevorzugt in
Äquatornähe, niemals jedoch an den Polen der Sonne. Ihre Zahl steigt und sinkt in einem
elfjährigen Zyklus, während dessen das bevorzugte Entstehungsgebiet sich dem Äquator
immer mehr nähert. Die Magnetfeldmessungen zeigen, daß der p-Fleck die umgekehrte
Polarität des f-Flecks hat. Mehr noch: Alle p-Flecke auf der Nordhalbkugel haben dieselbe
Polarität. Entsprechendes gilt auch für die Südhalbkugel. Nach Ablauf eines Zyklus kehren
sich die Polaritätsverhältnisse um, so daß man eigentlich von einem 22-jährigen
Aktivitätszyklus sprechen muß.
4.5.3 Rotation
Mit Hilfe der Flecken kann man die Rotation der Sonne studieren. In genaueren Messungen
zeigt sich, daß die Sonne nicht wie ein starrer Körper rotiert, sondern daß die höheren Breiten
gegenüber dem Äquator zurückbleiben. Das ist möglich, weil die Sonne kein starrer Körper
sondern vielmehr ein riesiger Gasball ist. Die Polargebiete der Photosphäre benötigen 37
Tage, um in bezug auf die weit entfernten Sterne einmal zu rotieren, während der Äquator 26
Tage braucht. Von der Erde aus gesehen, die sich ja um die Sonne bewegt, betragen die
entsprechenden synodischen Perioden 41 und 27 Tage.
Verschiedene
Quellen geben
Rotationsperioden
an, die etwas kürzer
sind als diese. Die
Perioden, die hier
angegeben wurden,
beruhen auf den
beobachteten
Dopplerverschiebung
en photosphärischer
Linien und nicht wie
dies öfter der Fall ist,
Abb. 4.15: Differentielle Sonnenrotation (aus: Die Sonne beobachten, von Reinisch,
auf der beobachteten
Beck, Hilbrecht und Völker).
Fleckengeschwindig
keit, da diese wahrscheinlich durch das Magnetfeld der Sonne beeinflußt ist. Weil die Materie
mit abnehmender heliographischer Breite weniger Zeit benötigt, einmal um die Sonne zu
kreisen, sagt man die Sonne rotiere differentiell.
Die durch das Magnetfeld angezeigte schnellere Rotation ist vielleicht durch einen schnell
rotierenden Kern verursacht. Eine schnelle Rotation des Sonneninneren könnte
Scherungskräfte auslösen und zu einer schnelleren Rotation am Äquator der sichtbaren
Oberfläche führen.
Ein schnell rotierender Sonnenkern könnte sich bei der Entstehung der Sonne herausgebildet
haben, da wegen der Drehimpulserhaltung stärker kontrahierte Teile der Sonne, wie der
Sonnenkern, schneller rotieren müssen.
4.5.4 Fleckenzyklus
Noch gibt es keine endgültige Theorie über die Entstehung von Sonnenflecken, doch derzeit
wird das Leighton-Babcock-Modell favorisiert. Dieses geht davon aus, daß die äußeren
109
Schichten der Sonne bis hinunter zur Konvektionszone über ein schwaches Magnetfeld
verfügen. Dessen Feldlinien verlaufen entlang der Meridiane vom Nord- zum Südpol und sind
wegen der hohen elektrischen Leitfähigkeit der Sonnenmaterie gewissermaßen eingefroren.
Aufgrund der differentiellen Rotation der Sonne werden diese Feldlinien um die Sonne
gewickelt und zusammengequetscht. Dort wo der Übergang von einem Rotationstyp zum
anderen sitzt, treten starke Scherströmungen auf, die als Ursprung der Magnetfelder
angesehen werden. Bei den Wickelprozessen nimmt die Feldstärke beträchtlich zu und die
Feldlinien bilden magnetische Flußröhren von einigen hundert Kilometern Durchmesser.
Durch die Konvektion werden diese zu seilähnlichen Strukturen zusammengedrillt, was
schließlich zu Feldstärken zwischen 0.2 und 0.4 Tesla führt, die also einige tausendmal
stärker sind als das irdische Magnetfeld. Zudem bewirkt der magnetische Druck im Inneren
der Flußröhren, daß diese einen geringeren Innendruck aufweisen als die umgebenden
Gasmassen. Das Magnetfeld bewirkt dadurch einen Auftrieb, der die Röhrenbündel an die
Sonnenoberfläche steigen läßt. Zudem stoßen sich die benachbarten Feldlinien immer stärker
ab und unterstützen so die Aufwärtstendenz der magnetischen Röhrenbündel. An der
Sonnenoberfläche bilden sie Schlaufen und durchstoßen an manchen Stellen die Photosphäre.
Eine Gruppe von Sonnenflecken entsteht. Dies erklärt auch die bipolare Natur der
Sonnenflecken und ist der Grund dafür, daß die Polaritäten auf der Nord und Südhalbkugel
entgegengesetzt sind.
Bei einem Aktivitätsmaximum sind die Feldlinien extrem verflochten, bis Gaswirbel
Feldlinien unterschiedlicher Polarität zusammenbringen und die Aktivität beenden. Die
Beobachtungen zeigen, daß sich die Sonnenaktivität mit einer charakteristischen Zeit von 22
Jahren wiederholt. In diesem Zeitraum schwillt der innere Magnetismus zu einem Maximum
an und bricht dann zusammen. Das geschieht in etwa 11 Jahren. Nach der Abnahme kehrt
sich das Feld um, und während der zweiten elfjährigen Phase windet die differentielle
Rotation die Stärke erneut empor, bis sich das Feld neuerlich kurzschließt und eine neue
Polaritätsumkehr eintritt.
4.5.5 Die Umkehrung der Polarität
Die p-Flecken einer (z.B. der nördlichen) Hemisphäre der Sonne haben für die Dauer eines
Zyklus mit wenigen Ausnahmen alle dieselbe magnetische Polarität
(z. B. N). Die p-Flecken der anderen Hemisphäre haben in der selben Zeit entgegengesetzte
Polarität (S). Im nächsten 11-jährigen Zyklus sind die Polaritäten dann umgekehrt verteilt
u. s. w..
Wegen des Wechsels der Polaritäten zwischen zwei Zyklen spricht man auch von einem 22jährigen vollständigen magnetischen Zyklus, nach dem die ursprüngliche Polarität wieder
Abb. 4.16: Umkehr des Feldes: Am Beginndes Zyklus (A) positive Polarität am Nordpol und
negative am Südpol. Um das Maximum sind die polaren Felder neutral (B), im
nächsten Zyklus sind sie umgepolt (C). (aus: Iain Nicolson, Die Sonne )
hergestellt ist (Hale´scher Zyklus). Die Sonne hat kein allgemeines Dipolfeld wie die Erde,
110
sondern statt dessen ein aus einer großen Zahl von lokalen Flußelementen aufgebautes
Magnetfeld. Trotzdem gibt es in den Polgebieten große Flächen, in denen eine magnetische
Polarität überwiegt, dabei ist die Polarität am Sonnennordpol "gewöhnlich" entgegengesetzt
zur Polarität des Südpols. Die polaren magnetischen Polaritäten kehren sich ungefähr ein Jahr
nach dem Fleckenmaximum um. Im allgemeinen findet der Wechsel an den beiden Polen
nicht zur gleichen Zeit statt. Es kommt durchaus vor, daß sich die eine Polarität ein oder zwei
Jahre vor der anderen ändert.
Bedingt durch den Aufwickelprozeß hat der p-Fleck einer auftretenden Fleckengruppe eine
etwas niedrigere heliographische Breite als der f-Fleck (d.h. der p-Fleck ist dem Äquator
näher). Nach dem Auftauchen einer Fleckengruppe wird viel magnetische in kinetische
Energie umgewandelt und dadurch das Feld schwächer. Die Konvektion und die differentielle
Rotation verbreitern den magnetischen Fluß dann und führen ihn weg.
Da der f-Fleck in jedem Fall dem Pol näher ist als der p-Fleck, wird seine magnetische
Polarität vorzugsweise in die polaren Gebiete seiner Hemisphäre getragen. Dadurch wird dort
bis zum Fleckenmaximum so viel magnetischer Fluß angesammelt, daß die vorhandene
Polarität umgekehrt wird.
4.5.6 Das Ende der Fleckenaktivität
Man glaubt, daß sich bei der Änderung der Polarität in einem Polgebiet die örtliche Neigung
der Feldlinien zu ändern beginnt und mit der allmählichen Verstärkung des polaren Feldes
durch die fortgesetzte Diffusion der f-Fleck-Polarität in die Zone, in der sich die Neigung
umkehrt, immer näher zum Äquator rückt. Wenn sich die Neigung der Feldlinien (im Sinne
der Sonnenrotation) von abwärts zu aufwärts ändert, bewirkt die differentielle Rotation ein
Abwickeln (anstatt Aufwickeln) der Feldlinien. Die für die Fleckenbildung erforderlichen
starken Magnetfelder werden schwächer und die Sonnenaktivität sinkt. Schließlich wird ein
Stadium erreicht, in dem die Feldlinien wieder von Nord nach Süd laufen, und der
Aufwickelprozeß beginnt von neuem. Da das Feld jetzt die entgegengesetzte Richtung hat,
sind die Polaritäten der p- und f-Flecken im Vergleich zum vorherigen Zyklus umgekehrt.
Es wird angenommen, daß die Sonne auf diese Weise ihre Magnetfelder periodisch verstärkt
und entspannt. Die während eines Zyklus aufgebaute magnetische Energie wird in den
verschiedensten Formen der Sonnenaktivität freigesetzt.
4.5.7 Ursprung des Magnetfeldes
Die plausibelste Erklärung gibt ein modifiziertes Dynamomodell ( αω − Dynamo ). Der in der
Rotation der Sonne steckende Energievorrat ist gegenüber der Energie der beobachteten
Magnetfelder praktisch unendlich groß. Die Rotation der Sonne reicht allerdings nicht, um
das solare Magnetfeld zu erklären, denn es gilt der Cowlingsche Satz:
Es gibt kein Geschwindigkeitsfeld, das ein axialsymmetrisches Magnetfeld gegen reine
ohmsche Verluste aufrecht erhalten kann.
(D.h. Magnetfelder in stabil geschichteten, rotierenden Sternen können nicht durch einen
Dynamo erklärt werden.)
Die Situation ändert sich, wenn man Konvektionszonen mit ihren unregelmäßigen
Geschwindigkeitsfeldern in die Betrachtungen einbezieht. Sie verletzen die Symmetrie des
ursprünglichen Magnetfeldes, so daß es nicht mehr dem Cowlingschen Satz unterliegt. Man
spricht nun von einem turbulenten Dynamo, der lokale Magnetfelder erzeugen kann.
Die differentielle Rotation sorgt dann für eine großräumige Verstärkung der Magnetfelder, da
die Magnetfeldlinien sozusagen in der Materie eingefroren sind und sich infolge des
Aufwickelprozesses immer näher kommen. (Eine hohe Liniendichte ist gleichbedeutend mit
einem stärkeren Feld.) In Wahrheit sorgt die elektromagnetische Induktion dafür, daß quer
zum Magnetfeld strömende leitfähige Materie zu einer elektromotorischen Kraft führt,
111
derzufolge schließlich ein magnetisches Zusatzfeld entsteht, welches die Verstärkung der
magnetischen Feldstärke bewirkt. Dieses Zusatzfeld überlagert sich dem ursprünglichen Feld
so, als würde das Gesamtfeld an der Materie festhängen.
Die differentielle Rotation produziert aus einem meridionalen Magnetfeld ein azimutales und
der turbulente Dynamo erzeugt in einem azimutalen mittleren Magnetfeld azimutale mittlere
Ströme, welche wieder ein meridionales Magnetfeld erzeugen. Dabei ist besonders
interessant, daß sich ein magnetisches Wechselfeld ergeben kann. Der turbulente Dynamo in
der Wasserstoffkonvektionszone der Sonne kann also den Sonnenzyklus zwanglos erklären.
4.6 Oberhalb der Photosphäre
4.6.1 Die Herrschaft der Magnetfelder
Haben in der Wasserstoffkonvektionszone (bis in die obere Photosphäre) die strömenden
Plasmen die Magnetfelder beherrscht, so beherrschen diese in den viel dünneren (Dichte)
oberen Schichten der Sonne die Bewegung der Materie.
Die Magnetfeldlinien, die aus der Wasserstoffkonvektionszone über die Photosphäre
hinausragen, haben wegen der viel geringeren Dichte und der hohen Leitfähigkeit in diesen
Schichten leichtes Spiel und zwingen die Materie, sich entlang der Magnetfeldlinien zu
bewegen.
Der Photosphäre überlagert ist die Chromosphäre, eine Schicht mit wesentlich geringerer
Dichte. Sie fällt dramatisch von 10 21 Teilchen pro Kubikmeter auf etwa 1015 Teilchen pro
Kubikmeter. (Das ist die 10 −4 bzw. 10 −10 -fache Dichte der Erdatmosphäre in Meereshöhe.)
Die Chromosphäre hat ihren Namen wegen ihrer rosa Farbe (vorwiegend die H-alpha Linie
des Wasserstoffs), die sie in den wenigen Sekunden vor und nach einer totalen
Sonnenfinsternis zeigt. Die Chromosphäre ist nur wenige tausend Kilometer dünn (etwa
4000). Innerhalb dieser fällt die Temperatur erst von rund 6000 K an der Basis der
Photosphäre auf 4200 K in 500 km Höhe ab, um dann sehr rasch an der Obergrenze der
Chromosphäre etwa 500 000K zu erreichen.
Nach einer dünnen Übergangszone (transition region), mit sehr steilem
Temperaturgradienten, kommt die bis zu einigen Sonnenradien Abstand reichende Korona.
Diese hat eine noch wesentlich geringere Dichte von rund 10 −11 Kilogramm pro Kubikmeter
an ihrer Basis, die mit der Entfernung zur Sonne stark sinkt.
Man kann die Korona eher mit einem äußerst guten Vakuum vergleichen denn mit der
Erdatmosphäre. Dennoch läßt sie mit einer fast unglaublichen Temperatur von 1-5 Millionen
K aufhorchen. Da die Dichte der Korona so gering ist, ist die in ihr enthaltene Wärmeenergie
im Vergleich zur Photosphäre sehr gering. Nur rund ein Millionstel des sichtbaren Lichts der
Sonne kommt von der Korona, und selbst das ist hauptsächlich photosphärisches Licht,
welches in der Korona gestreut wird. Unter gewöhnlichen Bedingungen können deshalb
Chromosphäre und Korona vom Erdboden aus nur mit Spezialinstrumenten beobachtet
werden.
112
Die Chromosphäre, die deutlich heller als die Korona ist, kann mit speziellen Filtern, zum
Beispiel mit einem sehr schmalbandigen H-alpha Filter (Halbwertsbreite < 0.1 nm), schon
recht gut beobachtet werden. Die Preise solcher Filter liegen dennoch sehr hoch, weshalb der
Autor die H-alpha-Beobachtung der Sonne hier nicht weiter verfolgen wollte und konnte.
Ein weiterer Nachteil der bei Amateuren üblichen H-alpha-Filter ist die geringe Haltbarkeit
und die hohe Empfindlichkeit gegen Feuchtigkeit und Hitze. Sie können nur mit
Energiereduktionsfiltern eingesetzt werden.
Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung eines Protuberanzenansatzes. Dieser wird wie
ein Zusatzgerät hinter dem Teleskop angebracht. Im Inneren des Protuberanzenansatzes wird
die viel hellere Sonnenscheibe durch eine Kegelblende im Brennpunkt ausgeblendet. Ein
weiteres Blendensystem verringert das anfallende Streulicht und eine abbildende Optik
erzeugt dann das Sonnenbild, welches mit einem, diesmal wesentlich weniger
schmalbandigerem (0.5 - 1 nm) und daher günstigeren, H-alpha-Filter beobachtet werden
kann. Der Protuberanzenansatz zeigt nur die Chromosphäre am Sonnenrand und nicht auf der
Sonnenscheibe.
Die Sonnenkorona ist noch wesentlich schwieriger zu beobachten. Sie wird mit einem
Abb. 4.17: Druck und Temperaturverlauf in der Chromosphäre und Korona. (aus dem dtv-Atlas zur
Astronomie)
Koronagraphen beobachtet, der ähnlich funktioniert wie der Protuberanzenansatz, nur ohne
Filter. Um das Streulicht loszuwerden, muß der Koronagraph auf hohe Berge gebracht
113
werden, die von der Umweltverschmutzung verschont worden sind. Heute bedient sich die
Wissenschaft der Raumfahrt, um das störende atmosphärische Streulicht loszuwerden.
Abb. 4.18: Schemazeichnung eines Protuberanzenfernrohrs. (aus: Die Sonne beobachten, von Reinisch,
Beck, Hilbrecht und Völker)
Normalsterbliche haben aber noch die Möglichkeit, die Sonnenkorona und die Chromosphäre
bei einer totalen Sonnenfinsternis zu beobachten. Bei diesem Ereignis sind die beiden
Schichten wesentlich besser zu beobachten als mit allen Spezialinstrumenten (Satelliten
ausgenommen).
4.6.2 Die aktive Chromosphäre
Während sich die ruhige Chromosphäre nur einige tausend Kilometer über die Photosphäre
erhebt können Magnetfelder Teile der Chromosphäre einige
100 000 km über die Photosphäre katapultieren oder die koronale Materie so weit abkühlen,
daß diese "kondensiert". Diese Phänomene nennt man Protuberanzen, wenn sie über den
Sonnenrand hinausragen, beziehungsweise Filamente, wenn sie sich nur auf der Sonnescheibe
befinden. Physikalisch handelt es sich bei Protuberanzen und Filamenten um dasselbe
Phänomen. So großartig Protuberanzen über den Sonnenrand hinausragen, ihre Länge als
Filament ist noch beeindruckender. Manche erreichen mehr als den halben Sonnenradius !
Dennoch sind es die Protuberanzen, die die Dynamik der Filamente zeigen. Protuberanzen
bilden am Sonnenrand flammenähnliche Wolken in der oberen Chromosphäre und der unteren
Korona und haben niedrigere Temperatur, aber höhere Dichte als ihre Umgebung. Die
typischen Temperaturen im Inneren sind 10 000 bis 30 000 K, also ein Hundertstel der
Koronatemperatur, während die typischen Dichten das 100-fache der umgebenden Korona
betragen. Der Gasdruck innerhalb der Protuberanzen ist daher ungefähr gleich wie der
Gasdruck in ihrer Umgebung, obwohl die Masse der Protuberanz rund 100mal größer ist als
ein gleiches Koronavolumen in derselben Höhe. Es gibt sehr viele verschiedene Typen und
Formen von Protuberanzen. Einige davon werden durch Material gebildet, das aus der
Chromosphäre hochsteigt, bei den meisten allerdings kondensiert das Material aus der Korona
und fließt mehr oder weniger in die Chromosphäre ab.
4.6.3 Stationäre Protuberanzen
Stationäre Protuberanzen gehören zu den stabilsten und langlebigsten solaren Phänomenen,
die ihre Grundform und Struktur über einige Monate bis zu einem Jahr unverändert
beibehalten können ehe sie zerfallen, plötzlich verschwinden oder manchmal eruptionsartig
aufsteigen und sich auflösen.
Typische Abmessungen sind: Dicke: 5000 - 8000 km, Länge: 200 000 km
Höhe: 40 000 km.
Filamente bilden lange, dünne, vertikale Blätter , die öfter die Form eines Viadukts mit vielen
Bögen annehmen, in denen eine beträchtliche Abwärtsströmung von Material stattfindet,
wobei aber die Gesamtform der Protuberanz bemerkenswert unverändert bleibt. Die
114
stationären Protuberanzen befinden sich in älteren, fleckenlosen Aktivitätsgebieten über der
magnetischen neutralen Linie, also zwischen Gebieten entgegengesetzter magnetischer
Polarität.
Die diese Gebiete verbindenden Feldlinien überbrücken die Neutrallinie in Form von Bögen
und durchsetzen mit ihrem obersten Teil etwa horizontal die Protuberanz. Unter dem Gewicht
der Protuberanz werden die eingefrorenen Feldlinien nach unten gedehnt, dadurch die
magnetische Spannung erhöht und das Feld verstärkt. Die Feldlinien widerstehen einer
weiteren Abwärtsbewegung und stützen so die Protuberanz. Diese erscheint auf diese Weise
in den Feldlinien aufgehängt. Die Unterstützung des Materials erfolgt durch eine Kraft, die
von einem Strom erzeugt wird, der senkrecht zu den magnetischen Feldlinien fließt. Dieser
Strom erzeugt seinerseits ein Magnetfeld, das die ursprünglichen Feldlinien verformt.
Durch das Kondensieren
von Materie aus der viel
heißeren Korona auf die
Protuberanzen wird das
koronale Plasma an diesen
Stellen dünner und damit
auch dunkler, was auf
Sonnenfinsternisfotos gut
zu beobachten ist.
Abb. 4.19: Das relativ dichte Protuberanzenmaterial wird durch das örtliche
Magnetfeld getragen (aus: Iain Nicolson, Die Sonne).
4.6.4 Aktive Protuberanzen
Die aktiven Protuberanzen sind eine Gruppe sehr verschiedener, rasch veränderlicher,
kurzlebiger Erscheinungen mit verschiedenen Formen und Entstehungsmechanismen. Nach
dem Ursprung der Protuberanzenmaterie kann man drei Hauptgruppen unterscheiden: die
bogenförmigen Loopprotuberanzen, die aus der Korona heraus kondensieren, die Surges und
Sprays, die aus der Chromosphäre herausgeschleudert werden und schließlich die eruptiven
Protuberanzen, die sich aus stationären Formen entwickeln.
4.6.5 Typisierung der Protuberanzen nach Völker
115
Nachdem die Klassifizierung der Protuberanzen normalerweise nach ihrer dynamischen
Entwicklung geschieht, kann ein kurzer Blick durch einen Protuberanzenansatz oder gar nur
die wenigen Sekunden bei einer totalen Sonnenfinsternis nicht zu einer Klasseneinteilung
führen. Um dennoch einen Überblick der sichtbaren Protuberanzenerscheinungen geben zu
können, soll hier die Typisierung nach Peter Völker angeführt werden. Ihm fiel auf, daß sich
die kleinen
Einzelerscheinungen
innerhalb der
Protuberanzenherde relativ
gut in drei Grundformen
fassen lassen: stabförmige,
bogenförmige und
flächenförmige
Einzelerscheinungen mit
den möglichen
Größenvariationen.
Daraufhin entstand ein
Typisierungsschema und
nicht eine echte
Klassifikation. Es dient
unter anderem der
statistischen Erfassung der
Protuberanzenaktivität.
Abb. 4.20: Typisierung der Protuberanzen nach Völker. Die vor die
Typenbezeichnung gesetzte Ziffer bezeichnet die Anzahl der
offenbar zu einem gemeinsamen >>Herd<< gehörenden
Einzelobjekte gleicher Art. (aus: Die Sonne beobachten, von
Reinisch, Beck, Hilbrecht und Völker)
4.6.6 Die hohen Temperaturen in der Chromosphäre und Korona
Chromosphäre und Korona werden nicht direkt durch Strahlung der Photosphäre aufgeheizt,
denn die Atmosphäre über der Photosphäre ist für sichtbare und infrarote Strahlung höchst
durchlässig. Es ist mechanische und magnetische Energie, welche den oberen Schichten der
Sonne zu solchen Temperaturen verhilft. Man glaubte erst, das Problem durch rein
116
mechanische Energie gelöst zu haben: Die turbulente Wasserstoffkonvektionszone erzeugt
niederfrequente Schallwellen mit einer Frequenz von etwa 1/30 bis 1/60 Hz , welche durch
die Photosphäre zuerst in die Chromosphäre und dann in die Korona gelangen. Der
Energiestrom einer Schallwelle ist proportional zum Produkt: ρ v cs wobei ρ die Dichte, v
die Teilchengeschwindigkeit und cs die Schallgeschwindigkeit ist. Die Chromosphäre ist so
dünn, daß die Abstrahlung, also die Energie, die aus der Schallwelle in die Materie übergeht,
2
sehr gering ist, so daß näherungsweise gilt: v ∝
1
ρ cs
. Da nun aber die Dichte rapide mit
der Höhe abnimmt, wächst die Teilchengeschwindigkeit extrem an. Die Wellen werden stark
beschleunigt und entwickeln sich zu Stoßwellen, deren Energie verhältnismäßig rasch, durch
heftige mikroskopische Zusammenstöße zwischen den Gasteilchen, in Wärme verwandelt
wird. Diese einfache Vorstellung akustischer Wellen reicht jedoch nicht zur Erklärung der
Aufheizung der Korona.
Außer den rein mechanisch-thermischen Vorgängen tragen auch dynamische Magnetfelder
zur Erzeugung dieser hohen Temperaturen bei. Die Magnetfelder erzeugen im Plasma der
Sonnenatmosphäre magnetohydrodynamische Wellen, in denen mit den Schwingungen der
Materie ein entsprechend veränderliches Magnetfeld gekoppelt ist. Auch diese Wellen
erzeugen Stoßfronten und tragen damit zur Aufheizung der oberen Schichten bei. Da nun das
Abstrahlungsvermögen der Solarmaterie mit der Höhe über der Photosphäre immer schlechter
wird, steigt die Temperatur übermäßig hoch an.Schließlich findet die Atmosphäre einen
neuen Modus des Energietransportes. Dieser besteht darin, daß bei hinreichend hoher
Temperatur und steilem Temperaturgefälle nach innen (!) die Wärmeleitung durch die freien
Elektronen des Plasmas (ähnlich dem hohen Wärmeleitvermögen der Metalle) ausreicht, um
die Energie nach innen abzuführen, wo sie schließlich abgestrahlt wird.
Für die Heizung der Chromosphäre werden etwa 5 kWm-2 und für die Korona etwa 0.4 kWm2
benötigt, das entspricht nur dem 10-4 bzw. 10-5 -fachen des Gesamtenergiestroms der Sonne,
welche letzten Endes aus der Konvektionszone abgezweigt werden.
So kann die Aufheizung der höchsten Atmosphärenschichten der Sonne, entgegen dem
natürlichen, d.h. entropieerzeugenden Temperaturgefälle von innen nach außen nur durch
mechanische und magnetische "geordnete" Energieformen großer negativer Entropie
erfolgen. So verlangt es der 2. Hauptsatz der Thermodynamik.
4.7 Sonnenfotografie
4.7.1 Sonnenfotos im weißen Integrallicht
Die Sonnenfotografie ist ein reizvolles und schwieriges Betätigungsfeld, das viel Erfahrung
erfordert. Die Fokussierung des Sonnenbildes ist genauso schwierig wie die Beurteilung der
Güte der Luft im Kamerasucher. Auch die Wahl der Kamera, des Filmes und des Standortes
ist von großer Bedeutung. Dennoch lassen sich mit relativ kleinen aber guten Instrumenten
bereits aussagekräftige Ergebnisse erzielen. Es sind prinzipiell alle im Kapitel über
teleskopische Sonnenbeobachtung angegebenen Instrumente geeignet. Immer wird eine
Lichtdämpfung benötigt. Man sollte niemals versuchen, ohne Filterung und nur mit kurzen Belichtungszeiten zu fotografieren. Die Wärmeentwicklung würde den Kameraverschluß
sofort zerstören. Als Kamera eignen sich fast nur Spiegelreflexkameras, da sie es erlauben,
das Sucherbild direkt zu beobachten. Video oder CCD-Kameras sind wegen ihres geringen
Kontrastes eher ungeeignet. Die Kamera wird über einen geeigneten Adapter (T2) an den
Okularauszug des Teleskops befestigt. Alle handelsüblichen Spiegelreflexkameras sind für
117
die Sonnenfotografie geeignet, wobei es doch einige Unterschiede in der Ausstattung gibt.
Eine gute Mattscheibe kann beim Scharfstellen von großem Nutzen sein und einigen Ärger
ersparen. Fokussiert wird übrigens mit dem Teleskop und nicht über Autofokus! Bei älteren
Spiegelreflexkameras ist darauf zu achten, daß der Verschluß vor allem bei kurzen Zeiten
gleichmäßig abläuft, damit keine Streifen auf dem Bild entstehen.
Die Forderung nach einer manuell steuerbaren Kamera ist bei der Sonnenfotografie nicht so
wesentlich wie bei der Nachtfotografie, wo sich die Batterien der automatischen Kamera sehr
schnell entladen. Die automatische Belichtungsmessung durch die Kamera hat aber so ihre
Tücken. Durch das Teleskop kommen die bilderzeugenden Lichtstrahlen in einem anderen
Winkel und mit anderem Konvergenzverhalten als durch "normale" Fotoobjektive. Dies hat
zur Folge, daß nicht das ganze Bildfeld eingesehen werden kann, daß eventuell wegen eines
zu engen Lichtdurchlasses des Adapters Vignettierung auftritt und daß die
Belichtungsmessung nicht richtig funktioniert. Der Belichtungsmesser liefert jedoch einen
Anhaltswert mit dem man durch eine entsprechende Korrektur, die man durch Probieren
herausfindet, auf die richtige Belichtungszeit kommt. Es gibt auch Formeln mit denen man
die richtige Belichtungszeit errechnen kann, sie gelten aber nur für bestimmte Bedingungen,
d.h. für völlig klaren Himmel und hochstehender Sonne. Deshalb ist der zwar etwas
fehlerhafte aber korrigierbare Belichtungsmesser vorzuziehen.
(Bsp.: Der Belichtungsmesser liefert eine Belichtungszeit von 1/750 s; daraufhin probiert man
einige Einstellungen wie: 1/750 s, 1/1000 s (+1/2 Blende), 1/1500 s
(+1 Bl), 1/2000 s (+1.5 Bl), 1/3000 s (+ 2 Bl), 1/4000 s (+2.5 Bl), 1/500 s
(-1/2 Bl), 1/350 s (- 1Bl), 1/250 s (-1.5 Bl); Die Ergebnisse zeigen dann die richtige
Belichtungszeit. Meist sind die etwas unterbelichteten Bilder von größerem Kontrast und
Detailreichtum. In jedem Fall wird man jedesmal mehrere Bilder mit unterschiedlichen
Belichtungszeiten probieren. Eine automatische Belichtung wird problematisch, wenn man
den Sonnenrand fotografieren will. Hier kann es auf Grund der unterschiedlichen Lagen der
Belichtungsmeßfenster zu Fehlbelichtungen kommen. Deshalb sollte man sich gut mit seiner
Kamera vertraut machen und eventuell die Belichtungszeit in der Sonnenmitte bestimmen.
Für die Sonnenfotografie im Integrallicht sind zwei Methoden gebräuchlich: die
Fokalfotografie und die Okularprojektion. Bei der Fokalfotografie wird das normale
Kameraobjektiv entfernt und durch das Teleskop (ohne Okular) ersetzt.
Bei der
Projektionsfotografie
(ebenfalls ohne
Kameraobjektiv) arbeitet
man wie bei der visuellen
Beobachtung mit dem
Sonnenprojektionsschirm,
nur sitzt an der Stelle des
Schirmes die
Filmoberfläche im
Kameragehäuse. Die
mechanischen Teile für die
Okularprojektion werden
von den meisten
Teleskopherstellern
angeboten. Da der Autor
selbst kein geeignetes
Abb. 4.21: Fokal- und Projektionsfotografie (aus: Die Sonne beobachten,
Okular zur Verfügung hat,
von Reinisch, Beck, Hilbrecht und Völker).
verwendet er statt dessen
118
ein Weitwinkelobjektiv in Retrostellung, d.h. es ist um 180° gedreht. Das erlaubt ihm, die
erreichte Brennweite relativ leicht zu berechnen.
Abb. 4.22: Die Projektionsmethode des Autors: Ein 20 mm Weitwinkelobjektiv (schwarz)wird in
Retrostellung (verkehrt eingebaut) als Projektionsokular verwendet. Ferner ist die
Stromversorgung für die Kamera (Spiralkabel) und das Fernauslösekabel zu sehen.
Die Brennweite erhöht sich nämlich einfach um den Abbildungsmaßstab, den die KameraRetroobjektivkombination ergibt. Den Abbildungsmaßstab errechnet man wiederum leicht
dadurch, indem man einfach ein Lineal mit Millimetereinteilung abfotografiert. Der
Abbildungsmaßstab ist dann einfach die Länge des Lineals auf dem Negativ dividiert durch
die Anzahl der abfotografierten Millimeter. Bei der Okularprojektion muß man zur
Bestimmung der effektiven Brennweite den Abstand der bildseitigen Hauptebene des Okulars
zur Filmebene d bestimmen, was näherungsweise der Abstand von der ersten Linse des
Okulars (von der Kamera aus gesehen) zur Filmebene ist. Dann ergibt sich die effektive
Brennweite zu: f eff = f Teleskop
d
f Okular
− 1
Bis zu einer Brennweite von etwa 2300 mm wird die Sonnenscheibe zur Gänze auf dem
Kleinbildformat (24x36 mm) abgebildet, bei größeren Brennweiten nur ein Ausschnitt. Die
Fokalfotografie wird verwendet für Übersichtsaufnahmen, für die Verfolgung der
Entwicklung großer Sonnenfleckengruppen oder für die fotografische Positionsbestimmung.
Sie stellt keine besonderen Anforderungen an die Stabilität des Fernrohrs und seine
Montierung. Durch die kurzen Belichtungszeiten (meist kürzer als 1/1000 s) werden viele
Nachführfehler verziehen. Die Projektionsfotografie ist für die Erfassung von
Strukturveränderungen in Sonnenflecken und andere Detailforschungen einzusetzen.
Zur Verhinderung von Verwacklungen sollte auf jeden Fall ein Fernauslöser verwendet
werden (Drahtauslöser oder ähnliches). Wenn die Möglichkeit der Spiegelvorauslösung
besteht, so sollte man diese auch in Betracht ziehen, weil dadurch der recht harte
Spiegelschlag bei Spiegelreflexkameras vermieden wird. Er hat allerdings auch den Nachteil,
daß man nach dem Hochklappen des Spiegels einige Sekunden warten muß bis sich das
119
Teleskop und die Kamera beruhigt haben und erst danach auslösen kann, so daß man die
inzwischen möglicherweise wieder schlechter gewordene Luft nicht sieht. Der Autor
verwendet deshalb die Spiegelvorauslösung nicht, damit er den günstigsten Moment der
Luftruhe abwarten kann, um dann mit möglichst kurzer Belichtungszeit zu belichten.
Die Beurteilung der Schärfe und die Fokussierung sind das Schwierigste bei der
Sonnenfotografie. Je heller das Sucherbild der Kamera ist, desto einfacher wird das
Scharfstellen. Bei älteren Kameras mit grob gerasterten Mattscheiben kann man mit einem
sorgfältig verteilten Tropfen Nähmaschinenöl das Sucherbild wesentlich feinkörniger und
heller machen. Moderne Mattscheiben mit großem Klarfleck in der Mitte sind optimal, bergen
aber für ungeübte Beobachter folgende Gefahr: Ein auf eine Mattscheibe projiziertes Bild
steht für das Auge in einer festen Ebene, das auf dem Klarfleck projizierte Bild steht für das
Auge frei im Raum. Dieses gleicht hier unbemerkt Fokusdifferenzen selbständig aus. Deshalb
ist es für das Auge wichtig, die Ebene des Klarflecks eindeutig zu definieren. Dies wird mit
einem in das Glas eingravierten Fadenkreuz erreicht. Einige größere Staubkörner oder eine
Markierung mit dem Filzstift erfüllen den gleichen Zweck. Nur wenn das Auge gleichzeitig
Sonnendetails und Markierung scharf sieht, wird auch das Negativ eine scharfe Abbildung
zeigen.
Hochkontrastreiche Filme sind für die Weißlichtfotografie am besten geeignet, da vor allem
die Sonnengranulation einen sehr schwachen Kontrast hat. Farbfilme sind in der
Sonnenfotografie eigentlich verpönt, da sie keinen Gewinn an Bildinformation bringen, sie
zeigen im Gegenteil nur die Farbe des Filters. Der Autor verwende sie aber trotzdem gerne,
da sie dem Anblick im Teleskop am nähesten kommen und überall entwickelt werden können.
Der eigentliche Film für die Sonnenfotografie ist ein extraharter (kontrastreicher)
Schwarzweißfilm. Der zur Zeit beste unter ihnen ist der Kodak Technical Pan, der zudem mit
der höchsten Auflösung aller mir bekannten Filme aufwartet (außer Holografiefilmen).
Weiters ist er enorm hart entwickelbar, was man jedoch besser selbst machen sollte, um
optimale Ergebnisse zu erzielen.
120
4.7.2 Bestimmung der Sonnenrotation
Hat man die Sonne an hintereinanderfolgenden Tagen fotografiert oder mit der
Projektionsmethode auf Papier gezeichnet so fällt auf, daß sich die Flecken weiterbewegen,
von der Erde aus gesehen von Ost nach West. Das ist eine Folge der Sonnenrotation. Nun
sollte es doch relativ einfach möglich sein, daraus die Rotationsdauer der Sonne zu
bestimmen. Da wir die Sonne von der Erde aus betrachten und diese sich im gleichen
Drehsinn, aber langsamer, um die Sonne bewegt, müssen wir zwischen der Rotation der
Sonne im "absoluten Raum" (siderische Rotation), also im Bezug zu den Fixsternen, und der
scheinbaren Rotation der Sonne (synodische), wie wir sie von der Erde aus sehen,
unterscheiden.
Während sich ein Fleck von Tag 1 zu Tag 2 mit der siderischen Winkelgeschwindigkeit
ω Sonne siderisch dreht, folgt die Erde mit der kleineren Winkelgeschwindigkeit ω Erde . Diese
beträgt im Durchschnitt natürlich 360° dividiert durch die Anzahl der Tage pro Jahr (365.3)
ω Sonne siderisch
ω Sonne synodisch
ω Erde
Abb. 4.23: Zusammenhang zwischen synodischer und siderischer Sonnenrotation
also 0.985 °/Tag. Von der Erde aus gesehen scheint sich der Fleck also nur mit der
synodischen Winkelgeschwindigkeit ω Sonne synodisch zu bewegen. Natürlich gilt nun:
ω Sonne synodisch = ω Sonne siderisch − ω Erde
Nun ist die Bewegung der Erde um die Sonne ja nicht konstant (Ellipsenform), aber die
Abweichungen vom Mittelwert bleiben unter 0.03 °/Tag, weshalb wir sie im folgenden
121
vernachlässigen werden. Das nächste Problem ist die Lage der Rotationsachse, die leider
nicht zur Erdrotationsachse parallel ist, aber für zumindest einige Tage ihre scheinbare
Orientierung am Himmel kaum verändert. Die Lage der Sonnenrotationsachse wird mit zwei
Winkeln beschrieben. Der Sonnenäquator ist um den Winkel i = 7° 15 ' gegen die Ekliptik,
das ist die Bahnebene der Erde, geneigt. Die Sonnenflecken bewegen sich daher scheinbar
nicht geradlinig, sondern auf halben Ellipsenbahnen über die Sonnenscheibe. Im Laufe des
Jahres ist uns einmal (Frühjahr) der südliche und einmal (Herbst) der nördliche Sonnenpol
zugewandt. Daher schwankt auch die heliographische Breite des Sonnenscheibenmittelpunkts
B0 zwischen + 7° 15 ' und - 7° 15 '.
Der Winkel zwischen der Sonnenrotationsachse und der Nord-Süd-Richtung am irdischen
Himmel wird Positionswinkel genannt. Er resultiert aus der Überlagerung zwischen der
Neigung der Erdachse zur Ekliptik (23° 26 ') und der Neigung des Sonnenäquators zur
Ekliptik ( 7° 15 '). Sein Bereich liegt zwischen + 26° 22 ' (mathematischer Drehsinn; d.h. der
Winkel ist positiv, wenn der Sonnenrotationsnordpol links von der Nord-Süd-Richtung liegt)
und - 26° 22 '. Da der Winkel i relativ klein ist, kann er für eine Abschätzung der
Sonnenrotation vernachlässigt werden. Will man zusätzlich die differentielle Rotation der
Sonne nachweisen, so ist er nicht mehr vernachlässigbar. Es sei denn in Ausnahmefällen wie
am 6. Juni oder 8. Dezember, wo die heliographische Breite des Sonnenscheibenmittelpunkts
verschwindet.
Abb. 4.24: Notdürftig können auch Fleckenbilder, deren Orientierung nicht bekannt ist,
überlagert werden. Bei falscher Überlagerung (A) verschieben sich die Flecken
nicht parallel und zu weit. Man dreht einfach eines der Bilder, bis sich die richtige
Überlagerung (B) ergibt: die Flecken laufen parallel und verschieben sich um den
kleinsten Betrag. Diese Art der Überlagerung funktioniert nicht, wenn eine
Hemisphäre fleckenlos ist. (aus SuW 2/1999. S 147)
122
Normalerweise ist es sehr vorteilhaft, wenn man die Orientierung, also die Nord-SüdRichtung, der Sonnenfotos kennt, die man zur Rotationsbestimmung verwendet. Man kann
aber auch versuchen, den Positionswinkel durch geschickte Überlagerung der beiden Bilder
(z.B. mit einem Diaprojektor oder digitalisiert im Computer) zu umgehen.
Bei falscher Überlagerung verschieben sich die Flecken nicht parallel und zu weit. Man dreht
einfach eines der beiden Bilder so lange bis sich die richtige Überlagerung ergibt, bei der die
Flecken parallel laufen und sich um den kleinsten Betrag verschieben. Diese Methode
funktioniert nur, wenn genügend Flecken auf der Sonne zu sehen sind. Sie kommt aber ohne
Zusatzinformation (P und B0) aus, die eigentlich nur aus langjähriger Sonnenbeobachtung zu
bekommen ist.
Diese langjährige Sonnenbeobachtung ist ein Verdienst der Astronomen und deshalb konnte
der Autor die Winkel P und B0 in einem astronomischem Jahrbuch nachschlagen und sich
damit am Computer (mit Mathematica) ein Gradnetz zeichnen. Dazu hat er einfach
ausgenützt, daß es Mathematica erlaubt, eine 3D-Grafik (Parametrisierte Kugel) von einer
beliebigen Position im Raum zu betrachten:
Einfache Gradnetzschablonen für die Sonne
in Mathematica (mit Hilfe der 3-D-Plots)
Ausgangspunkt ist eine parametrisierte Kugel die ohne Shading gezeichnet wird.
Um die nötige Anzahl von Breiten und Längenkreisen zu erhalten verwende die Option
PlotPoints -> {n, m}. Hier ist n die Anzahl der Stützstellen für die x-Richtung, also für die
Längenkreise und m die Anzahl der Stützstellen für die y-Richtung also für die Breitenkreise.
n = 37 = 36 + 1; liefert 36 Längenkreise und
m = 19 = 18 + 1; liefert 18 Breitenkreise (10 ° - Unterteilung).
Die Neigung der Sonnenachse zur Erde wird mit Hilfe der Option ViewPoint erreicht.
Sie beschreibt die Position des Augpunktes relativ zum Mittelpunkt des dreidimensionalen
Rahmens. Ist die Neigung der Sonnenachse (Winkel b0) positiv, so muß die z-Koordinate des
Augpunktes auch positiv sein und umgekehrt. Weiters wählt man den Augpunkt sehr weit
weg von der Kugel, damit keine Verzerrungen auftreten. Man wählt den Augpunkt in der xzEbene und erhält seine Koordinaten mit: {r Cos[b0], 0, r Sin[b0]}, wobei der Autor r = 1000
gesetzt hat (r in relativen Längeneinheiten; d.h. längste Seite des Rahmens = 1). Zum Schluß
noch der Positionswinkel, also der Winkel zwischen Sonnenachse und Nord-Süd-Richtung
am Himmel. Mit ViewVertical kann man die Graphik so drehen, daß der angegebene
Einheitsvektor als neue Vertikale dient. Also schreibt man {0, Sin[p], Cos[p]} als
Einheitsvektor der neuen Vertikalen, wobei p der Positionswinkel ist.
Beispiel: Gradnetz für die Sonne am 31. Oktober 1999
b0 = 4.5 Pi/180; r = 1000;
p = 24.8 Pi/180;
ParametricPlot3D[
{Cos[t] Cos[u], Sin[t] Cos[u], Sin[u]},
{t, -Pi, Pi}, {u, -Pi/2, Pi/2},
PlotPoints->{73, 37},
ViewPoint->{r Cos[b0],0,r Sin[b0]},
ViewVertical->{0,Sin[p],Cos[p]},
Shading->False,
Boxed->False, Axes->False]
Grafik siehe nächste Seite.
123
124
Abb. 4.24: Bestimmung der Sonnenrotation mit der Gradnetzschablone. Es wurden die Fleckenpositionen vom
27. 10 1999 und vom 31. 10 1999 eingezeichnet und vermessen. Es ergeben sich bereits Anzeichen
für eine differentielle Rotation (vgl. Abb. 4.15).
Um die Nord-Süd-Richtung auf den Fotos zu bekommen, gibt es einige Methoden. Viele von
ihnen beruhen darauf, daß sich die Sonne bei ausgeschalteter Nachführung scheinbar von
Osten nach Westen bewegt. Hat die Sonnenscheibe leicht zur Gänze auf dem Negativ Platz,
so verwendet man mit gutem Erfolg die Durchlaufmethode. Dabei wird eine
Doppelbelichtung vorgenommen, d.h. zweimal derselbe Filmausschnitt belichtet, und zwar
bei ausgeschalteter Nachführung, so daß die Sonne von Ost nach West läuft und die NordSüd-Richtung dann normal zur Verbindungslinie eines zweimal fotografierten Sonnenflecks
steht. Dabei ist zu beachten, daß während der beiden Aufnahmen der Film in der Filmbühne
nicht bewegt wird, wie das oft der Fall ist, wenn man einen manuellen Verschluß nach der
ersten Belichtung aufzieht. Kameras mit eingebauten Motoren zur Verschlußspannung sind
hier von großem Nutzen.
Die Nord-Süd-Richtung wurde vom Autor etwas anders bestimmt, da mit dem verwendetem
Teleskop nicht die ganze Sonne auf das Kleinbildformat abgebildet werden konnte. Daher
wurde die Kamera so ausgerichtet, daß ein ausgewählter Sonnenfleck bei abgeschalteter
Nachführung entlang der fünf horizontal angeordneten Autofokussensoren der verwendeten
Kamera wanderten. Diese Methode ist etwas weniger genau und auch aufwendiger, da das
Justieren der Kamera eine langwierige Angelegenheit ist. Die erhaltenen Dias habe wurden
dann mit einem Diaprojektor auf die vorgefertigte Gradnetzschablone projiziert und die
Sonnenflecken eingezeichnet. Aus der Längendifferenz und dem zeitlichen Abstand der
beiden Aufnahmen ergibt sich dann die synodische Rotationsgeschwindigkeit. Bei einem
Intervall von 4 Tagen lassen sich auch schon erste Anzeichen für die differentielle Rotation
entdecken.
Vorausgesetzt, es sind Sonnenflecken in verschiedenen helio-graphischen Breiten vorhanden.
Da fast immer Fleckengruppen auftreten, ist es sehr sinnvoll für die Messungen den p-Fleck
zu verwenden, da er am beständigsten ist. Oft hat man am nächsten und übernächsten Tag
nach dem ersten Foto kein Sichtfenster (Schlechtwetter), so daß sich die f-Flecken schon
deutlich verändert haben oder sogar verschwunden sind. Eventuell sind auch neue
aufgetaucht. Für eine genauere Bestimmung der differentiellen Sonnenrotation ist es aber
unbedingt erforderlich, eine ganze Reihe von Bildern zu machen und auszuwerten. Für
Demonstrationszwecke ist dies aber nicht erforderlich. Die Meßgenauigkeit sollte mindestens
bei einem Grad (auf der Sonne) oder besser noch genauer sein, was mit dem ersten Anlauf gar
nicht so einfach zu schaffen ist. Man sollte deshalb am besten nur Sonnenflecken verwenden,
die nicht weiter als 60° vom Zentralmeridian entfernt sind.
Wenn ein transportables Teleskop verwendet wird, ist es wichtig, daß die Polachse genau
ausgerichtet ist, da sonst während der Ausrichtung der Kamera (oder während der beiden
Fotos bei der Durchlaufmethode) eine ungewollte Bildfelddrehung die Meßgenauigkeit
herabsetzt. Es ist daher immer gut, die Fotos so schnell wie möglich zu machen, aber sich
auch genug Zeit zu lassen, um nichts falsch zu machen.
125
4.8 Die totale Sonnenfinsternis am 11. August 1999
Sonnenfinsternisse zählen zu den seltenen astronomischen Ereignissen, vor allem totale.
Zwar ereignen sich jedes Jahr bis zu drei totale oder ringförmige Sonnenfinsternisse, der
maximal 273 km Durchmesser erreichende Kernschatten des Mondes überstreicht jedoch nur
einen vergleichsweise winzigen Teil der Erdoberfläche, so daß im Durchschnitt an ein und
demselben Ort auf der Erdoberfläche nur alle 375 Jahre eine totale Sonnenfinsternis auftritt.
Die Seltenheit allein macht aber nicht den Reiz einer totalen Sonnenfinsternis aus. Alle
anderen Formen von Sonnenfinsternissen, es sind dies die partielle und die ringförmige,
verblassen völlig im Vergleich mit einer totalen. Jeder, der nur irgendwann in seinem Leben
das Glück hatte, eine totale Sonnenfinsternis miterleben zu dürfen, wird sie wohl nie
vergessen.
Während der Totalität, wenn die gleißend helle Sonnenscheibe zur Gänze durch den Mond
verdeckt ist, kann man die purpurfarbenen Sonnenprotuberanzen und die Sonnenkorona, die
Sonnenatmosphäre also, sehen. Keine noch so schönen Fotos können das Abenteuer einer
totalen Sonnenfinsternis auch nur im entferntesten wiedergeben.
Schon Jahre zuvor habe ich mich auf dieses Ereignis am 11. August 1999 vorbereitet, vor
allem deshalb, weil ich die SOFI, wie sie von den Insidern liebevoll genannt wird, auch mit
meinem Teleskop fotografisch festhalten wollte. Ich wußte, ich würde nie mehr in meinem
Leben mit einer derart schweren Ausrüstung eine Sonnenfinsternis beobachten können. Die
Sonnenfinsternis am 11. August würde nur 2 Minuten und 20 Sekunden dauern, ich mußte
mich also auf ein einziges Phänomen konzentrieren und konnte nicht alles fotografieren. So
entschied ich mich logischerweise mit meinem schwersten Geschütz aufzufahren und durch
das Teleskop die Protuberanzen und vielleicht die innere Korona zu fotografieren. Noch
etwas war möglich: Wenn kurz vor dem zweiten Kontakt der Mond die Sonne zur Gänze
verdeckte, würden die letzten Sonnenstrahlen zu einem Punkt am äußersten östlichen Rand
verkümmern, dieses Stadium nennt man den Diamantring, und schließlich nur mehr durch
einzelne Mondtäler hindurch sichtbar sein. Zu diesem Zeitpunkt bricht die superschmale
Sonnensichel in einzelne Fragmente auf, man nennt dies das Perlschnurphänomen. Wenn es
mir im richtigen Moment gelänge den Auslöser zu drücken, so würde ich auch dieses
fotografisch festhalten können.
Schließlich wollte ich aber nicht die gesamte Dauer der Totalität nur zum Fotografieren
nutzen, um keinen Preis wollte ich mir den visuellen Eindruck entgehen lassen.
Damit ich alle meine Vorhaben auch während der knapp bemessenen Zeit durchbringen
konnte, mußte ich bereits Monate zuvor mit der Planung beginnen.
Obwohl die Totalität auch von Graz aus zu sehen war, habe ich mich entschlossen weiter
nördlich zu fahren, um die maximale Totalitätsdauer auszunützen.
Mir standen zwei - vielleicht drei - Kameras zur Verfügung. Eine am Teleskop, eine mit
einem 200 mm Teleobjektiv und eventuell eine Sucherkamera mit Normalobjektiv allerdings
ohne funktionierenden Belichtungsmesser.
126
Mit dem Normalobjektiv wollte ich den total verfinsterten Himmel fotografieren auf dem sich
vielleicht einige helle Sterne zumindest aber Venus und Merkur zeigen sollten. Es war eine
vollmechanische Kamera von Voigthländer die mich, wegen ihres Alters im Stich lassen
sollte. Die beiden anderen Kameras waren SLR´s (single lens reflex). Nur mit
Spiegelreflexkameras kann man sinnvoll durch ein Teleskop oder Teleobjektiv fotografieren.
Die Fujica AX-1 bestückte ich mit einem 2.8/200 mm Tele, für Übersichtsaufnahmen der
äußeren Sonnenkorona, und die EOS 5 adaptierte ich an das Teleskop. Ich wollte mit
Primärbrennweite meines 12" SCT´s fotografieren. Dazu baute ich mir selbst einen
geeigneten Adapter, denn die im Handel angebotenen erzeugen eine Abschattung Vignettierung - an den Bildrändern. Der freie Lichtdurchlaß ist einfach zu klein.
Die Frage nach dem geeigneten Filmmaterial war nicht so einfach zu klären.
Empfindlicher Film hätte den Vorteil, daß man kurze Belichtungszeiten verwenden und
dadurch die immer störende Luftunruhe möglicherweise einfrieren kann. Bei längeren
Belichtungszeiten verursacht die Luftunruhe ein Verschmieren des Bildes. Der empfindliche
Film ist vor allem dann unumgänglich, wenn ohne Nachführung, also ohne Ausgleich der
scheinbaren Bewegung der Sonne am Himmel, fotografiert werden soll. Seine Nachteile sind
eine geringere Auflösung, eine gröbere Körnigkeit ein geringerer Dichteumfang, ein
geringerer Kontrast und eine geringere Farbsättigung.
Vor allem einen hohen Kontrast und eine hohe Farbsättigung brauchte ich aber, um feinste
Details darzustellen. Das Argument mit der durch Luftunruhe bedingten Unschärfe ist nicht
so gravierend, denn der höherempfindliche Film ist von vornherein weniger scharf. Sollte die
Luft eine hohe Schärfe zulassen so ist sie nur mit dem niederempfindlichen Material zu
erreichen, in diesem Fall würde ein höherempfindlicher Film eine deutliche Verschlechterung
mit sich bringen. Bei schlechter Luft sind die Chancen durch eine kurze Belichtungszeit die
Luftunruhe einzufrieren nicht besonders groß, außerdem macht der geringe Kontrast das Bild
flau. Mit ein Grund sich für einen Diafilm zu entscheiden, er hat einen noch höheren
Kontrast. So entschied ich mich für einen 50 ASA Diafilm, den Fujichrome Velvia mit seiner
hervorragenden Farbsättigung obwohl seine Farbtontreue nicht gerade überragend ist. Für die
Sucherkamera jedoch wollte ich einen 200 ASA Ektachrome von Kodak versuchen.
Die nächste Frage war die nach der richtigen Belichtungszeit.
Ich habe sie nach durchsehen unzähliger Fotos in diversen Zeitschriften wie Sterne und
Weltraum, Sky&Telescope und dem Star-Observer zusammengestellt. Dabei viel mir auf, daß
die in den Büchern angegebenen Zeiten etwas zu kurz waren. Sie sind wohl eher für ideale
atmosphärische Bedingungen gedacht. Eines war allerdings leicht festzustellen: Es gibt fast
keine falschen Belichtungszeiten. Die bei einer Sonnenfinsternis auftretenden Phänomene
schwanken in ihrer Helligkeit derart stark, daß man mit einer fast beliebig eingestellten
Belichtungszeit schon irgendeines erwischt.
So nahm ich mir die folgenden Belichtungszeiten vor:
Für das Normalobjektiv bei Blende 2.8 etwa 10 - 20 Sekunden auf 200 ASA Film. Für das
200 mm Tele bei Blende 4 etwa 10 Sekunden auf 50 ASA Film. So wollte ich auch die
äußersten Ausläufer der Sonnenkorona einfangen.
Mit dem Teleskop für das Perlschnurphänomen 1/180 s beim 2. Kontakt und 1/250 s für den
3. Kontakt. Hier wollte ich den Film mit 3 Bildern pro Sekunde durch die Kamera jagen. Die
Protuberanzen und die innere Korona erforderten längere Belichtungszeiten. Ich entschloß
mich für eine Belichtungsvariantenreihe, die meine EOS 5 automatisch durchführen sollte,
das heißt eine Mittenbelichtungszeit von 1/45 s bei einer Blende von 10 und
Randbelichtungen die um 1.5 Blendenstufen nach oben beziehungsweise nach unten
abweichen sollten. D. h. 1/125 s für die Protuberanzen und 1/15 s für die innere Korona.
Bald wurde mir klar, daß mein Vorhaben einer intensiven Vorbereitung und die Hilfe meiner
Freundin Berit bedurfte.
127
Ich traf mich immer wieder mit Freunden aus meiner Umgebung - Robert Klein, Siegfried
Hold und Hubert Zeiler, der einzige der bereits eine totale Sonnenfinsternis miterlebt hatte - ,
die auch ähnliches vor hatten, um mich mit ihnen zu beraten. Robert hatte das geeignete Gerät
für die Korona - ein Profi Teleobjektiv - , Sigi hatte einen kleinen Refraktor für den er eigens
für die Sonnenfinsternis eine Montierung gebaut hatte und Hubert wollte unbedingt die sich
verändernde Landschaft aufs Korn nehmen. Hubert wollte aber noch die starke Polarisation
der Sonnenkorona mittels seines 400 mm Tele in Kombination mit einem Polfilter
nachweisen. Er brauchte dazu eine relativ lange Belichtungszeit und deshalb eine
Nachführung. Wir beschlossen deshalb zusammenzuarbeiten, denn ich hatte noch Platz auf
meiner Montierung. Eine Woche vor der Finsternis legten wir uns einen Aktionsplan fest und
simulierten ihn einige Male mit voller Ausrüstung und Stoppuhr. Das sah etwa
folgendermaßen aus:
Nachdem die Geräte aufgestellt und die Montierung ausgerichtet war wurde der Hauptstrom
der Nachführung eingeschaltet. Dann justierten wir unsere Kameras und richteten sie auf die
Sonne aus. Die Achsenkupplungen der Montierung wurden festgezogen, damit nichts mehr
verrutschen konnte, alle Kameras wurden aufgezogen und eingeschaltet. Fünf Minuten vor
dem simulierten zweiten Kontakt schalteten wir ein Diktiergerät ein und machten eine
Zeitansage. Ich legte eine Taschenlampe auf das Stativ und richtete sie auf die Kamera um sie
in der Dunkelheit bedienen zu können und stellte die richtige Belichtungszeit ein. Dann
wurde noch einmal scharfgestellt, um einer etwaigen Fokustrift zu begegnen. Kurz vor dem
zweiten Kontakt widmete sich Hubert mit seinem Weitwinkelobjektiv bereits den
herrannahenden Mondschatten und Berit hob den Objektivfilter vom Teleskop. Jetzt konnte
ich nur hoffen nicht zu früh abzudrücken, damit noch etwas Film für die Protuberanzen
übrigblieb. Wenn die Sonnenscheibe hinter dem Mond verschwunden war, stellte ich die EOS
5 auf Belichtungsvariantenreihe um und noch einmal neu scharf. Dann wollte ich die
Sonnenprotuberanzen fotografieren und die Sonnenpole abfahren, weil ich mit der großen
Brennweite des Teleskops nicht die ganze Sonne auf einmal abbilden kann. Dann
positionierte ich das Teleskop auf die Stelle des dritten Kontaktes und entfernte die
Sonnenfolie, die eigentlich eine Rettungsfolie war, vom 200 mm Tele und löste die
daranhängende Fujica für etwa 10 s aus. All das dauerte weniger als eine Minute. Nun
begann Huberts-Teil. Er wollte die Objektivfilter von den beiden anderen Kameras heben und
die Voightländer mit dem Normalobjektiv auslösen und dann gleich seine Minolta SRT 101
mit dem 400 mm Teleobjektiv und Polfilter. Nach etwa zwei Sekunden den Verschluß wieder
schließen und den Polfilter um 90 ° drehen um dann erneut zwei Sekunden belichten.
Nachdem er die Polfilteraufnahmen gemacht hatte, schloß er den Verschluß der Voigtländer
und war damit fertig. Es war eine weitere Minute vergangen und ich machte erneut eine
Belichtungsvariantenreihe. Dann mußte ich schnell die Belichtungszeit auf 1/250 s stellten
und den dritten Kontakt abwarten, um erneut die Perlschnur mit einer Reihenbelichtung
einzufangen.
Soweit die Theorie, wir ahnten aber schon, daß sowieso alles anders kommen würde.
Weiteres Kopfzerbrechen bereitete uns die Frage nach dem Standort. Da im Sommer im
Gebirge um die Mittagszeit sehr leicht Quellbewölkung auftritt, entschlossen wir uns
schweren Herzens auf eine bergige Lage zu verzichten, denn wir hätten zu gerne den mit
mehrfacher Schallgeschwindigkeit herannahenden Mondschatten von hohem Standpunkt aus
gesehen. Wir entschieden uns, in das Burgenland nach Unterschützen zu fahren wo wir von
Familie Weikmann mit offenen Armen empfangen wurden. Den Tip bekamen wir von einem
altem Haudegen der Grazer-Amateurastronomie, Herrn Alfred Schneider, der auch die
Familie Weikmann kannte. Martin Weikmann, der auch ein Programm mit Kindern plante,
hatte schon einen Beobachtungsplatz reserviert. Der Platz lag auf einer kleinen Anhöhe mit
einem Weg in Nord-Süd-Richtung und Feldern auf beiden Seiten. Wir waren schon am 7.
August zu einer Inspektion hingefahren, um zu sehen ob der Platz auch unseren
128
Anforderungen genügen würde. Ich hatte Bedenken wegen der Felder und vor allem wegen
dem Weg, der sich in der Sonne stark erhitzen und Schlieren verursachen würde. Etwas
weiter südlich war es besser, der Weg hörte auf und etwas Gebüsch würde zumindest am
Vormittag Schatten werfen, so daß die angrenzende Wiese nicht so stark erhitzt sein würde.
Trotzdem fuhren wir noch einige andere Standplätze ab, um nach besserem Seeing zu suchen
- erfolglos. An diesem Tag war es wolkenlos bis in den späten Nachmittag, erst als wir wieder
in die Steiermark kamen zog ein großes Gewitter auf.
Ab nun war das Wetter unsere größte Sorge - berechtigterweise.
Bis zum Vorabend der Finsternis verschlechterten sich die Prognosen zunehmend, trotzdem
mußten wir unser Glück versuchen, wir würden nie mehr eine solche Chance bekommen.
Robert war bereits am Vorabend abgereist, um dem prognostizierten Verkehrsstau zu
entgehen. Der Rest von uns, das waren Sigi, sein Sohn, Sigi jun., Hubert, Berit und ich,
fuhren in den frühen Morgenstunden um etwa halb vier Uhr früh im Konvoi nach.
Der Himmel war völlig bewölkt. Hubert fuhr voraus, um uns bei eventuellen
Bodenunebenheiten zu warnen. Ich hatte Angst, daß sich die Optik des Teleskops dejustieren
könnte. Ich hatte zwar eine Laserdiode mitgenommen, um eventuell nachjustieren zu können,
war aber nicht sehr glücklich damit.
Wir fuhren bei Laßnitzhöhe auf die Autobahn auf. Bereits kurz vorher setzte Regen ein, der
immer stärker werden sollte und gewaltige Blitze zuckten über das Firmament. Wir fuhren
nur etwa 80 - 90 km/h bei teils heftigem Regen und grellem Blitzlicht. Etwas mehr als eine
Stunde später waren wir in Unterschützen angekommen. Die Intensität des Regens hatte
nachgelassen, aber es schien kein Ende in Sicht. Robert stand schon mit seinem Auto auf der
anderen Seite der Anhöhe. Auch einige Italiener mit schwerem Gerät waren bereits in ihren
Bussen und Zelten auf Posten. Sie hatten ihre Montierung bereits in der zuvor noch
sternklaren Nacht ausgerichtet, wie sie uns später berichteten.
Eine halbe Stunde später war Sonnenaufgang, der von einem tollen Regenbogen begleitet
war. Ich hatte keine Chance an meine Kamera zu gelangen, sie war viel zu tief im Kofferraum
vergraben. So überredeten wir Hubert, den Regenbogen zu fotografieren was er dann
schließlich auch zu tun glaubte. Doch als ich ihn dann mit seiner Kamera mit dem
Regenbogen fotografieren wollte bemerkte ich, daß kein Film in der Kamera war. Solch ein
Fehler durfte uns später nicht passieren.
Kurz nachdem die Sonne über Bad Tatzmannsdorf hinter dem Geschriebenstein aufgegangen
war, verschwand sie auch schon wieder hinter den Wolken.
Plötzlich bemerkten wir, daß Sigi´s Hinterreifen verdammt wenig Luft hatte und als wir ihn
wieder aufpumpten erkannten wir, daß wir auf einem alten Feuerplatz standen, auf dem es
von rostigen Eisenteilen nur so wimmelte.
Später begann es wieder stärker zu regnen. Die Italiener waren bereits beunruhigt und
schmiedeten Abreisepläne, vorallem weil sie eine andere Reisegruppe über Handy informiert
hatte, daß es in Salzburg entgegen allen Vorhersagen strahlend blauen Himmel gab. Um etwa
9:00 hörte der Regen auf und in der Ferne erblickten wir ein Wolkenloch an das wir unsere
Hoffnungen klammerten. Die Anhöhe war bereits reichlich mit Autos verstellt. Von überall
her kamen die Schaulustigen, aus Slowenien, Italien, Deutschland und vor allem aus Wien.
Einige hatten ihre Geräte bereits aufgebaut, um sich die Wolken anzusehen. Wir begannen um
halb zehn mit dem Aufbau unserer Geräte. Ich mußte erst mein bis auf die letzte Schraube
zerlegtes Stativ zusammenstellen. Das Einnorden mit dem Kompaß bereitete einige Probleme
wegen der vielen Autos, deren Blech die Kompaßnadel reichlich beeinflußte.
Die Anhöhe war von einem Auto- und Menschenmeer übersät. Auf der Autobahn hat es sich
bereits gegen 10:00 zu stauen begonnen, vor allem in Richtung Wien.
Auch Robert stieß nun zu uns und stellte sich weiter draußen mitten ins Grüne. Sigi hatte
wesentlich schneller aufgebaut als ich und als die Sonne zum ersten Mal in das Wolkenloch
trat rief er: "Die g`hört scho mir !", und drückte den Auslöser. Er verwendete keinen
129
Objektivfilter, sondern ein Sonnenpentaprisma, das ein völlig farbneutrales und hervorragend
scharfes Bild der Sonne zeigte.
Kurze Zeit später hatte auch ich die Sonne ins Visier genommen. Die Granulation war nur
andeutungsweise sichtbar, denn das Seeing war nicht gerade besonders.
Die erste partielle Phase, in der die Mondscheibe die Sonnenflecken langsam überdecken
sollte, fotografierte ich mit dem hochauflösenden Technical Pan Film von Kodak, was
angesichts der schlechten Luft aber nicht viel brachte.
Der erste Kontakt war für 11:47 vorausberechnet. Zufällig schwenkte ich mein Teleskop auf
die andere Seite der Sonnenscheibe und bemerkte, daß der Mond bereits ordentlich an der
Sonnenscheibe knabberte. Es war jetzt 11:44 und ich rief: "Erster Kontakt ! " Plötzlich
rannten viele wie von Sinnen an ihre Geräte, Sigi war der erste der abdrückte. Ich hatte noch
Schwierigkeiten mit der Schärfe.
Während der partiellen Phase war die Wolkendecke aufgerissen und ich hatte ein gutes
Gefühl. Die Mondberge waren deutlich als Schatten zu erkennen. Mit hoher Geschwindigkeit
verschluckte der Mond einen Sonnenfleck nach dem anderen. Sehr viele Leute kamen vorbei,
um durch das Teleskop zu sehen. Doch langsam kamen immer mehr Wolken und bedeckten
den Himmel. In Richtung Süden war der Himmel wolkenlos nur über uns wurde die
Bewölkung immer dichter. Robert entschloß sich dem Wolkenloch hinterherzujagen, packte
sein Teleobjektiv ins Auto und fuhr ab. Um etwa 12:15 mußte ich meine Montierung
umschwenken, da sonst das Teleskop Gefahr lief durch den Antrieb mit dem Stativ zu
kollidieren.
Es war bereits merkbar düster geworden, das konnten nicht die Wolken gewesen sein. Alles
war so sonderbar. Hubert beschloß, die Fotos von der Sonnenkorona nicht zu machen, bei den
vielen Wolken schien es nicht viel Sinn zu machen.
Um 12:31 tauschte ich den Technical Pan in der EOS 5 gegen den Velvia und schoß noch ein
paar Fotos von der nun schon sehr schmalen Sonnensichel bis sie dann völlig hinter den
Wolken verschwand. Wir alle waren ganz aufgeregt, man konnte die Spannung in der Luft
spüren. Zeitweise bat ich Berit den Sonnenfilter zu entfernen, denn ich konnte die Sonne nicht
mehr im Kamerasucher sehen. 12:43 der zweite Kontakt konnte nicht mehr fern sein. Wieder
wurde es dunkel im Sucher und ich sagte: " Weg ! ", und meinte damit die Sonne. Berit
dachte, ich meinte den Filter und zog ihn weg. Ein Mißverständnis, also Filter wieder drauf.
Ein unheimlich stählernes blaues Dämmerlicht setzte ein. Sigi rief: " Schau wie schwarz es da
hinten ist. " Es war enorm dunkel geworden, ein ganz eigenartiges sehr dunkles blaugrau, als
würde ein fürchterliches Donnerwetter auf uns hereinbrechen. Kurz vor dem zweiten Kontakt
war die Sonnensichel wieder etwas besser sichtbar, trotzdem stellte ich die Belichtungszeit
um etwa eine Blende länger ein als ich vor gehabt hatte. Plötzlich war alles ringsherum still
geworden. Berit zog den Filter weg, deutlich konnte ich sehen wie sich der Sonnenrand in
Strukturen auflöste und dann drückte ich den Auslöser, solange bis kein Teil der Photosphäre
mehr sichtbar war. Der Film schoß dabei mit 3 Bildern pro Sekunde durch die Kamera, es
hörte sich ein bißchen wie ein Maschinengewehr an. Ich bemerkte meine Umgebung nicht
mehr. Die innere Korona und die Protuberanzen wurden sichtbar.
Es hatte sich ein kleines Wolkenloch zwischen den Schäfchenwolken aufgetan. Es war ein
überwältigender Anblick. Aus dem Augenwinkel konnte ich Blitzlichter erkennen, die
vergebens versuchten, die Sonne zu ersetzen. Die Protuberanzen waren von wunderschön
zartem Purpur und von überraschendem Detailreichtum. Ich konnte feinste Filamente und
sogar deutlich einige Schleifen erkennen, sie sahen oft aus wie zerzauste Haare und hatten
bezaubernde Farbnuancen. Zuckerlrosa, wie Sigi sich später ausdrückte, trifft es wohl am
besten. Ich machte einige Fotos und fuhr schließlich mit dem Teleskop an die Stelle des 3.
Kontaktes. Ich hatte kaum Zeit, die Korona zu beobachten, so gefangen war ich vom Anblick
der Protuberanzen. Die Korona sah eher aus wie ein blasser wolkiger Hintergrund in
seltsamen Grün bis Blautönen. Eine große Protuberanz auf der Ostseite erinnerte mich an
130
Struwwelpeters Haare. Überwältigend war vor allem der enorme Kontrastunterschied in den
einzelnen Strukturen, den ich auf keiner noch so guten Fotografie einfangen konnte.
Dann löste ich die Fujica mit dem 200 mm Tele aus, allerdings vergaß ich den Sonnenfilter
abzunehmen - ich war viel zu aufgeregt. Hubert kam nicht wie abgesprochen zum 400 mm
mit Polfilter und plötzlich blitzte Venus zwischen den Wolken hervor. Der Morgenstern
schien mir enorm hell, ich hatte gar nicht richtig mitbekommen wie dunkel es eigentlich war.
Ich wollte daher unbedingt die Voigtländer auslösen und lief nach vorn. Wieder vergaß ich
erst den Sonnenschutz abzunehmen, aber das war nicht so tragisch, denn eine dichte Wolke
hatte Venus schon längst wieder verdeckt. Zudem bemerkte ich später, daß mich der
Verschluß der Voigtländer sowieso im Stich gelassen hatte. Der Himmel war in ein
furchterregendes dunkles Graublau getaucht. Der Horizont leuchtete in grellem Gelb. Ich
hatte den Eindruck nicht mehr auf der Erde zu sein. Es war wie auf einem fremden Planeten,
der um einen sonderbaren Stern kreist:
Ein Loch im Himmel, umgeben von einem weißen Strahlenkranz, der mit rosa Flecken
gespickt ist und der die Wolken färbte.
Die Landschaft, die Menschen, die Autos und Geräte alles war in dieses sonderbare,
furchterregende stahlblaue Licht getaucht.
Ich ging wieder zurück auf meinen Platz, der dritte Kontakt stand unmittelbar bevor. Berit
schaute noch durch den Kamerasucher, also drückte ich blind den Auslöser für das letzte
Foto, der Film war nämlich schon zu Ende. Ich blickte zum Himmel und sah die Sonne
wieder hervortreten, wie ein Stern der plötzlich aufblitzt, so ähnlich mußte eine Supernova
aussehen. Dieser helle Lichtpunkt stand da am Rand des diffusen Rings der Korona. Jetzt erst
erkannte ich warum dies der Diamantring genannt wurde. Auf all den Fotos die ich schon
gesehen hatte war er für mich nicht zu erkennen, aber hier stand er plötzlich am Himmel. So
etwas muß man gesehen haben. Plötzlich jubelte die Menge auf, Sektkorken knallten,
Applaus brach aus und Vögel flogen auf, wie mir Berit später berichtete. Wir waren alle total
fertig, tief berührt und den Tränen nahe. Wir hatten einen kurzen Ausflug in eine fremde Welt
gemacht. Ich war von Sinnen, stand auf und irrte planlos umher. Sigi und ich schlugen
einander in die Hände, deutlich konnte ich seine Betroffenheit spüren. Hubert saß total
geschlaucht im Sessel und Berit stand starr vor dem Teleskop mit rot unterlaufenen Augen.
Ringsum wurde gefeiert und man konnte eine tiefe Befangenheit spüren. Ich glaube nicht, daß
es viele gegeben hat, die diese Minuten kalt gelassen haben. Nachdem der Zauber vorbei war,
waren alle so beseelt von dem wunderbaren Ereignis, daß jeder unbedingt noch eine
Sonnenfinsternis sehen wollte.
Die zweite partielle Phase wurde gar nicht mehr beachtet und wenig später fuhren die ersten
ab. Wir blieben noch, um auch die zweite partielle Phase zu dokumentieren. Immer noch
kamen Leute, die durchs Teleskop blicken wollten. Sie waren meist sehr verwirrt von dem
was sie da sahen, denn sie mußten ja durch die Kamera schauen - ich konnte sie nicht jedes
mal herunternehmen.
Durch den Kamerasucher fällt der Blick erst einmal auf die strukturierte Mattscheibe mit
ihren fünf Autofokussensorenmarkierungen und einem zentralen Klarfleck, den viele für die
Sonne hielten, weil er doch wesentlich heller war als seine Umgebung. Komischerweise
wurde diese Sonne durch den wesentlich größeren Mond verschlungen, so meinten zumindest
viele. Es war sehr schwierig die Besucher davon zu überzeugen, daß das nur der Klarfleck
war.
Die an unseren Standort angrenzende Böschung hatte zwar nichts zu einem besserem Seeing
beigetragen, dazu waren die Turbulenzen in der Hochatmosphäre viel zu groß, fungierte aber
als notdürftige sanitäre Anlage...
Als wir schließlich den vierten Kontakt erlebt hatten und begannen unsere Geräte abzubauen
waren wir bereits allein auf weiter Flur. Im Radio konnte man außer Berichten zur
Sonnenfinsternis fast nur Staunachrichten hören. Gegen halb vier hatten wir dann alles wieder
131
zerlegt und im Auto verstaut. Eigentlich wollten wir über die Autobahn wieder zurückfahren,
aber bereits in Oberwart, lange vor der Autobahnauffahrt, standen wir in einer langen
Autoschlange. Wir haben uns dann geeinigt, über die Landstraße über Fürstenfeld und
Feldbach nach Hause zu fahren. Robert, der eigentlich einen wolkenfreien Standort gesucht
hat, hat leider nicht viel Glück gehabt. Er ist mit seinem Auto Richtung Süden gerast, wo der
Himmel ganz klar war, allerdings hat ihn eine Wolke verfolgt und ihn dreimal von seinem
jeweils neuen Standort vertrieben. Erst während der Totalität hat er seinen Wagen mitten auf
der Straße angehalten und doch noch einige schöne Aufnahmen, jedoch durch die Wolken,
gemacht. Zuhause und in Graz war ein viel besseres Wetter, fast wolkenlos. Trotzdem bereue
ich es nicht, ins Burgenland gefahren zu sein, denn das was ich eigentlich gefürchtet hatte
nämlich die vielen Menschen, machten die Sonnenfinsternis zu einem meiner
beeindruckendsten Erlebnisse.
Wir hatten alle zusammen keine Beobachtungen über die Auswirkungen der Sonnenfinsternis
auf Flora und Fauna gemacht, eine Geschichte, die mir Robert später erzählte, macht aber
sehr deutlich, daß die SOFI sehr großen Einfluß zumindest auf die Tierwelt hat: Genau
während der Totalität hatte ein Fuchs, ein Räuber der Nacht, eine Bruthenne gestohlen.
4.8.1 Auswertung der erhaltenen Fotos
132
Die Größe der sichtbaren Strukturen: Um die Höhe der Protuberanzen zu bestimmen, setze
ich ihre Größe einfach in Verhältnis zum Sonnenradius, den ich allerdings etwas umständlich
ausmessen muß, da die Sonne nicht zur Gänze auf dem Foto Platz findet. Dazu lege ich ein
großes Stück transparentes Papier über die Vergrößerung (Format 50x70) und markiere zwei
Punkte P1 und P2 auf dem Kreisumfang der Sonne. Diese ergeben eine Sehne, deren Normale
auf den Kreismittelpunkt
sun1.cdr
zeigt. Die Konstruktion mache
ich noch mal mit zwei anderen
Punkten und erhalte so als
Schnittpunkt der beiden
Normalen den
Sonnenmittelpunkt. Der
scheinbare Sonnenradius
beträgt somit 335 mm.
Verglichen mit dem
wirklichen Sonnenradius von
rsun= (6.9626 ± 0.0007) 10 8 m
ergibt sich ein Maßstab von
etwa
1: 2 Mrd.
Die Chromosphäre, jene rot
leuchtende schmale Schicht,
die auf die weiß strahlende
Photosphäre folgt, zeigt eine
Ausdehnung von 1 bis 2 mm
was etwa zwei bis viertausend
Kilometern entspricht. In recht
guter Übereinstimmung mit
der in der Literatur
angegebenen mittleren
Schichtdicke. Die höchste
Protuberanz auf der
westlichen Seite der Sonne
ragt etwa 48 mm über die
Photosphäre was einer wahren
Größe von nahezu 100 000 km
entspricht. Das ist beinahe der achtfache Erddurchmesser. In dieser Darstellung hätte die Erde
einen Durchmesser von etwas mehr als 6 mm.
Die projizierte Breite der scheinbar breitesten Protuberanz, ergibt sich zu beinahe 300 000
km. Die höchsten Mondberge erheben sich etwa 1 mm vom Fuß bis zum Gipfel. Bei einem
wahren Monddurchmesser von 3476 km ergibt das etwa 5 km wahre Höhe.
Die Auflösung: Die Vergrößerung zeigt noch feinste Details bis etwa einen halben
Millimeter oder besser. Am 11. August hatte die Sonne, wie man aus den Astronomischen
Jahrbüchern entnehmen kann, einen scheinbaren Durchmesser von 31.6 Bogenminuten.
Daraus folgt sofort ein Abbildungsmaßstab von 2.8 Bogensekunden pro Millimeter. Das
heißt, daß die Auflösung des erhaltenen Bildes unter 1.5 Bogensekunden beträgt. Was
angesichts des nicht sehr überragenden Seeings keinen schlechten Wert darstellt.
Was ist zu sehen ? Nun da sind einmal alle Strukturen mit auffälliger Rotfärbung. Sie alle
gehören zur Chromosphäre (chromos, griechisch: Farbe), die in den ungestörten Regionen die
Photosphäre in einer dünnen Schicht überzieht. An einigen Stellen sind Spiculen erkennbar,
133
die wie kleine Flammen über die Chromosphäre ragen. Die viel größeren Protuberanzen
zählen ebenfalls noch als Chromosphärenerscheinung. Sie können, da mir nur ihre Form und
nicht ihre Evolution, ihre Geschwindigkeit und ihre photosphärische Umgebung bekannt sind,
nur nach Völker typisiert werden.
Am östlichen Sonnenrand sind einige große flächenförmige Protuberanzen sichtbar. Die
größte von ihnen schien im Teleskop deutliche Struktur aufzuweisen, ja es schien so als
würde sie sich aus vielen Schleifen zusammensetzen, die ähnlich einer Spule aufgewickelt
waren. Am nordöstlichen Sonnenrand ist eine besonders aktive Region sichtbar, die einige
losgelöste stabförmige und auch eine bogenförmige Protuberanz zeigt. Die westliche
Sonnenseite ist nicht weniger spektakulär. Auch sie zeigt vier große flächenförmige
Protuberanzen, von denen eine deutlich losgelöst ist. Weiters ist auch eine kleine losgelöste
Protuberanz zu sehen, deren Größe etwa der der Erde entspricht. Nordwestlich ist wieder eine
besoders aktive Region zu erkennen, die eine Vielzahl sehr kleiner wahrscheinlich schneller
stabförmiger Protuberanzen enthält, die wie Spritzer aussehen. Schließlich ist am
südwestlichen Sonnenrand die höchste Protuberanz zu erkennen, die deutlich losgelöst und
eine bogenförmige Struktur aufweist. Auffallend ist, daß die Polregionen keine Protuberanzen
aufweisen.
Doch viel aufregender als die ohnehin sehr interessanten Protuberanzen scheinen mir die
Strukturen in der inneren Sonnenkorona zu sein. An den Polen kann man senkrechte,
sogenannte Polarstrahlen erkennnen, die weit in den Weltraum reichen. Viel stärkere Struktur
zeigt die Korona allerdings über den aktiven Gebieten. Sie zeigt sehr starke Strahlen und vor
allem Bögen, die wie Magnetfeldlinien aussehen. So etwas habe ich bisher noch auf keinem
Foto gesehen.
Deutlich ist die Korona in den aktiven, strukturierteren Gebieten heller als in den ruhigeren,
besonders am nordöstlichen Sonnenrand.
134
Verzeichnis der verwendeten Literatur
Bleichroth/Dahncke/Jung/Kuhn/Merzyn/Weltner: Fachdidaktik der Physik,Verlag Deubner &
Co KG, 1991.
W. Winnenburg: Ziele Inhalte und Aufgaben astronomischer Bildung, Astronomie heute,
Friedrich Verlag, 1995.
Klaus Lindner: Astronomieunterricht in der gymnasialen Oberstufe, Astronomie + Raumfahrt,
33 (1996) 2.
W. Winnenburg: Schulastronomische Beobachtungen im Erkenntnisprozess der Schüler,
Astronomie + Raumfahrt, 34 (1997) 3.
Gottfried Merzyn: Astronomie und Physikunterricht, NiU-Physik, 4 (1993) Nr. 20.
Uwe Walther und Hans Peter Schneider: Astronomieunterricht in der DDR und in den neuen
Bundesländern, NiU-Physik, 4 (1993) Nr. 20.
Percy Seymour: Astronomie ganz einfach, Bauen und Beobachten-von der Sonnenuhr zum
Spiegelfernrohr; Verlag Franckh Kosmos, 1985.
James Summers und Mark Ramuz: Holzarbeiten leicht gemacht; Collins & Brown, 1997.
Bernd Koch: Handbuch der Astrofotografie, Springer-Verlag, 1994.
Wolfgang Paech und Thomas Baader: Tips & Tricks für Sternfreunde, Sterne und Weltraum,
1998.
Peter L. Manly: The 20-cm Schmidt-Cassegrain Telescope, Cambridge University Press,1994
Agnes Acker: Praxis der Astronomie, Ein Leitfaden für Astrofotografen, Springer, 1991.
Storm Dunlop/ Wil Tirion: Der Kosmos Sternatlas, Franckh, 1985.
Tirion, Rappaport, Lovi: Uranometria 2000.0 Volume I + II, Willmann-Bell, Inc., 1998.
Cragin, Lucyk, Rappaport: The Deep Sky Field Guide to Uranometria 2000.0, WillmannBell, Inc., 1996.
Robert Jr. Burnham: Burnham´s Celestial Handbook, Band 1 - 3, Dover Publications, New
York, 1978.
G. R. Kepple & G. W. Sanner: The Nicht Sky Observers Guide Volume 1 + 2, Willmann-Bell,
Inc, 1998.
Urs Tillmann: Foto Lexikon,Verlag Photografie, 1991.
Jost J. Marchesi: Handbuch der Fotografie, Band 1 - 3, Verlag Photografie, 1993.
Canon Inc.: Astrofotografie, Fototips und Motivideen für Hobbyfotografen, vwi Verlag, 1981.
A. Unsöld, B. Bascheck: Der neue Kosmos, 6. Auflage, Springer Verlag 1999.
H. H: Voigt: Abriss der Astronomie: 5. Auflage, B I -Wissenschaftsverlag, 1991.
G. D. Roth: Handbuch für Sternfreunde, Band 1 + 2, Springer-Verlag, 1989.
Joachim Herrmann: dtv- Atlas zur Astronomie, Deutscher Taschenbuch Verlag, 1983.
Kurt Wenske: Spiegeloptik, Verlag Sterne und Weltraum, 1988.
G. D. Roth: Planeten beobachten, Verlag Sterne und Weltraum, 1998.
K. Reinisch, R. Beck, H. Hilrecht, P. Völker: Die Sonne beobachten, Verlag Sterne und
Weltraum, 1999.
Michael Stix: The Sun, Astronomy and Astrophysics Library, Springer, 1989.
Cambridge Enzyklopädie der Astronomie, Orbis Verlag, 1989.
Patrick Moore: Das Weltall, Orbis Verlag, 1980.
Iain Nicolson: Die Sonne, Herder, 1982.
John Briggs, F. David Peat: Die Entdeckung des Chaos, Hanser, 1989.
Bergmann, Schaefer: Lehrbuch der Experimentalphysik, Band 1- 8, Walter de Gruyter, 1993.
Jeremy Cook, The Hatfield photographic Lunar Atlas, Springer, 1999.
R. Rieker: Fernrohre und ihre Meister, Verlag Technik GmbH, Berlin 1990.
Carl Sagan: Unser Komos, Droemersche Verlagsanstalt, 1982.
Hans Ulrich Keller: Kosmos Himmels-Jahr 1999, Franckh-Kosmos, 1998.
135
Michale Disney: Quasare-die kosmischen Mahlströme, Spektrum der Wissenschaft, Dossier
Kosmologie, 2000.
Alan M. McRobert: Mastering the Virgo Cluster, Sky & Telescope, May 1994.
George Bothun: Beyond the Hubble Sequence, Sky & Telescope, May 2000.
Star Observer Special: Sonnenfinsternis 99
Alan Dyer: News from the Front, Sky & Telescope, January 1999.
Pál Virág: A "Magic Box" Solar Telescope, Sky & Telescope, January 2000.
Jürgen Alean: Photographische Bestimmung der differentiellen Sonnenrotation, Sterne und
Weltraum, 2/1999.
Nicht im Raume darf ich meine Würde suchen,
sondern in der Ordnung meiner Gedanken. Ich wäre nicht größer, wenn ich Länder besäße.
Durch die Ausdehnung umgreift mich das Weltall
und verschlingt mich wie einen Punkt; durch den Gedanken umgreife ich es.
Blaise Pascal, Gedanken [aus Unser Kosmos von Carl Sagan, 1980]
136