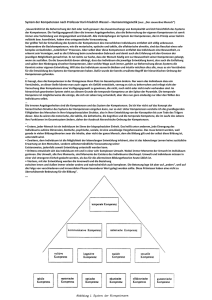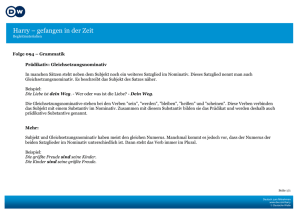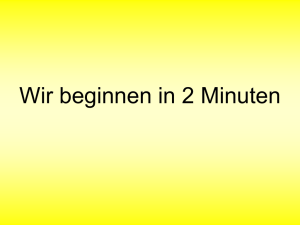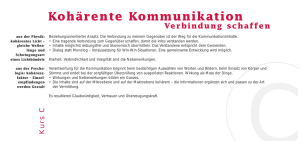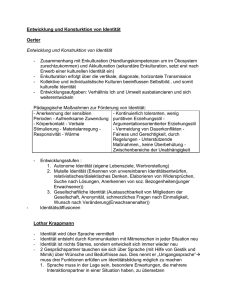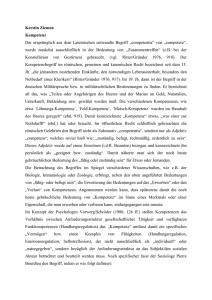Document
Werbung

Vorwort „Verunsicherungen – Das Subjekt im gesellschaftlichen Wandel“ (Keupp/Bilden 1989) heißt ein Sammelband, der sich aus sozialpsychologischer Sicht sowohl mit realen Entwicklungen auf der Ebene des Individuums, aber auch mit Irritationen bei seiner wissenschaftlichen und philosophischen Erfassung beschäftigt und der daher ein neues, zeitgemäßes Konzept des Einzelnen in seiner gesellschaftlichen Eingebundenheit, also von Individualität und Identität, entwickeln will. Verunsichert ist jedoch nicht nur der Einzelne jeder für sich, sondern sind auch diejenigen, die es beruflich mit Menschen zu tun haben. Denn inzwischen sind die vielfältigen Nachrichten vom Ende oder Tod des Subjekts, des Individuums etc. in Philosophie und Soziologie auch in der Praxis angekommen. Auch wissenschaftliche Vorstellungen von einer Gesellschaft, die nur noch aus Systemen und Strukturen besteht, die sich in einem mysteriösen Eigenleben selber schaffen, weiterentwickeln, in Beziehung zu anderen Systemen und Strukturen setzen, scheinen inzwischen Praxis geworden zu sein. Die Praxis, um die es mir geht, ist eine pädagogische und politische Praxis im weiten Feld von Kunst und Kultur. Dieser Praxis kann es nicht gleichgültig sein, welche Vorstellungen von Person, Subjektivität und Identität relevant sind, da sich die Menschen aus dieser Praxis nicht so einfach wegargumentieren lassen, wie es in philosophischen oder soziologischen Theoriekonstruktionen gelegentlich der Fall ist. Zudem verwendet man in dieser Praxis ständig – zu ihrer Beschreibung, ihrer Begründung oder bei dem Versuch, sie zu begreifen – Begriffe, Thesen und Argumente, die auf eine Konzeption von Persönlichkeit hinweisen, die eine historische Tradition bzw. systematische Kontexte haben, aus denen sie stammen. Diese Verwendungsweise ist jedoch oft eher alltagssprachlich, trotz der Intention, eine Praxis theoretisch faßbar machen zu wollen. Im vorliegenden Buch werde ich daher historische Entwicklungen und systematische Kontexte aufzeigen, zu denen unsere Vorstellungen von „Ich“, „Selbst“ oder „Person“ gehören. Ich setze damit meine Studien zur realen Entwicklung des Menschen und den Bildern, die sich Wissenschaft, Philosophie und Künste von dieser gemacht haben, fort. Langfristiges Ziel dieser Arbeiten ist eine Persönlichkeitstheorie in pragmatischer Absicht. Beiträge zu einer solchen Theorie versuche ich in historischen und systematischen Durchgängen durch Geschichte und relevante Einzelwissenschaften zu finden. Daß diese Suchbewegungen nicht ohne Willkür verlaufen können, wird sofort klar, wenn man sich daran erinnert, daß dem Menschen immer schon – seit seinem Auftauchen auf der Welt – nichts wichtiger war als er selbst. Entsprechend zahlreich und unüberschaubar sind die Funde an Selbstvergewisserungen, die für ein solches Projekt zugezogen werden könnten. So hat der amerikanische Psychologe G. W. Allport kurz nach dem Zweiten Weltkrieg ca. 50 7 ausformulierte Theorien der Persönlichkeit in seinem Fachgebiet identifiziert (vgl. etwa Allport 1970, Teil I), und Krewer/Eckensberger (in Hurrelmann/Ulich 1995, S. 573) sprechen von über 2000 Arbeiten zum „Selbst“, die schon 1968 nicht mehr zu integrieren waren. Es ist jedoch nicht nur die Bewältigung all dieser Wissensberge unmöglich: Thematisch und methodisch eingeengt wird mein Vorhaben auch durch Grundüberzeugungen und den Anwendungsbereich. Diese Grundüberzeugungen über Menschsein schlechthin, über grundsätzliche Möglichkeiten seiner Entwicklung und Ausprägung sind (zumindest teilweise) anderenorts ausführlicher entwickelt und begründet worden (Fuchs 1999). Sie werden an betreffenden Stellen in diesem Text daher nur knapp eingeführt und erläutert. Das anvisierte Anwendungsfeld bezieht sich auf meinen eigenen Erfahrungshorizont, und dieser ist ein entwickeltes europäisches Land, das in seiner Geschichte gerade zu dem Thema dieses Buches eine Fülle an Literatur hervorgebracht hat. Weitere Einschränkungen ergeben sich zudem aus dem Geschlecht und der Generationserfahrung des Autors. Vor diesem Hintergrund ist es daher auch kein Zufall, daß es nicht das „Ich“ oder das „Selbst“, sondern das Konzept der „Person“ ist, das im Mittelpunkt steht, da dieses traditionell auf der Nahtstelle zwischen Individuum und Gesellschaft angesiedelt war, etwa im Vergleich mit den eher auf das (partikulare) Ich bezogenen Konzepten. Solche Konzepte gibt es allerdings in großer Fülle, die sich hier – wie erläutert werden wird: auch aus systematischen Gründen – überhaupt nicht abbildet. Trotz all dieser Begrenzungen erscheint mir die Unternehmung einer Persönlichkeitstheorie unverzichtbar. Es gilt für sie dasselbe, was ein kluger Mensch einmal zur Ethik gesagt hat: Jeder Versuch eines Theorieentwurfs kann eigentlich nur scheitern. Doch auf solche Entwürfe schlechthin zu verzichten, wäre in jedem Fall ein noch größeres Scheitern. Der hier unternommene Versuch will daher bewußt machen, was in der Praxis zwar immer wirkt, jedoch häufig unausgesprochen und verborgen ist. Damit liegt der Text in einem neuen, allerdings erst beginnenden Trend, der durch verschiedene gesellschaftliche Felder – national und international – verläuft: Nämlich „das Subjekt im Mittelpunkt“ zu sehen. Sicherlich ist ein Grund für diese Konjunktur, daß nicht nur in der Pädagogik, sondern auch im Management und in der Politik erkannt wird, daß all die großen Pläne, Strategien und Konzepte letztlich von dem einzelnen Menschen mit seinen je aktuellen Bedürfnissen und Möglichkeiten, mit seinen emotionalen, sinnlichen, kognitiven und sozialen Fähigkeiten und Bedürfnissen verstanden und umgesetzt werden müssen. Es ist daher unverzichtbar und lohnenswert, sich mit den Bildern vom Menschen und ihren jeweiligen Begründungen zu befassen. 8 Remscheid, im Frühjahr 2001 9 1. Einleitung Es gibt eine ganze Reihe von Begriffen, die man bei der Thematik dieses Buches in den Mittelpunkt stellen könnte und die im Text auch alle auftauchen werden: der Einzelne, die Person, das Selbst, das Ich, das Subjekt, das Besondere, das Individuum, aber auch Identität, Individualität oder Individualismus, vielleicht aber auch Privatheit oder Egoismus. All diese Begriffe haben ihre eigene philosophische oder fachwissenschaftliche Tradition. Einige spielen – mit unterschiedlichen Bedeutungen – sogar in verschiedenen Diskursen eine zentrale Rolle: So ist „Identität“ ein traditionsreicher Begriff der philosophischen Logik und der Ontologie. Irgendwann übernahmen ihn jedoch Psychologie und Soziologie und später auch die Pädagogik. In Wort-Kombination wie „kulturelle“ oder „nationale Identität“ entstehen rasch politische Kampfbegriffe. Und in bezug auf Störungen und Beschädigungen von Identitäten leben ganze Heerscharen von Therapeuten von diesem Begriff und finden darin ihre „berufliche Identität“. All die genannten Begriffe haben zudem eine historische Tradition, über die etwa das „Historische Wörterbuch der Philosophie“ oder ähnliche Standardwerke informieren. Es gibt in der Geschichte Situationen, in denen möglicherweise der von den genannten Begriffen erfaßte Sachverhalt erst entsteht oder entdeckt wird. Es gibt ein Ringen um die geeignete sprachliche Form, mit der ein vielleicht zunächst nur erahnter Sachverhalt erfaßt werden soll, und immer wieder werden traditionelle philosophische (oder theologische) Begriffe umgedeutet und auf neu entstehende Sachverhalte bezogen. Die realen Prozesse, um die es geht, sind zudem vielfältig mit anderen Prozessen, vor allem mit konkret-historischen Entwicklungen verbunden. Ich gehe davon aus, daß Konzepte, die es mit dem Individuum zu tun haben, gerade nicht individualistisch aufgefaßt werden können: Auch der Einzelmensch in seiner Entwicklung ist immer schon ein soziales Wesen. Ein Ziel dieses Textes wird daher sein, die Geschichtlichkeit und Gesellschaftlichkeit des Individuums und der Formen seiner Beschreibung vorzustellen. An anderer Stelle (Fuchs 1999) habe ich anthropologische Wissensbestände danach durchforstet, was heute für ein fundiertes Bild vom Menschen Bestand hat. Diese Studie orientiert sich an einem schon klassischen methodischen Dreischritt: der Mensch (als Gattungswesen) in seiner naturgeschichtlichen Gewordenheit; der je historisch konkrete Mensch in seiner sozial- und kulturgeschichtlichen Konstitution und der einzelne Mensch in seiner Ontogenese. Steht in meinem Buch „Mensch und Kultur“ der erste der drei Schritte im Mittelpunkt, so werde ich in der vorliegenden Untersuchung den zweiten und dritten Schritt konkretisieren. Hierbei stehen eine Fülle von wissenschaftlichen Einzeldisziplinen und Forschungsansätze zur Verfügung: die Mentalitätsgeschichte der französischen Annales-Gruppe (vgl. etwa die 10 Schriften von Ph. Ariès), die Historische Psychologie und Sozialisationsforschung (vgl. Jüttemann 1986/1990 oder Jaeger/Staeuble 1988), die Geschichtswissenschaft (Dülmen 1997), die Geschichte der Philosophie (vgl. etwa die einschlägigen Artikel im Historischen Wörterbuch der Philosophie), die einzelnen Kunstwissenschaften (Bürger 1998, Abels 1985). Von besonderer Bedeutung ist dabei das Handbuch Historische Anthropologie „Vom Menschen“ (Wulf 1997). Von besonderer Bedeutung sind historische und systematische Studien zu den normativen und kulturellen Grundlagen der Moderne. Denn „Gesellschaft“ funktioniert nur dadurch, daß geteilte Überzeugungen, gemeinschaftliche Werte und Normen je individuell gelebt werden. Der vorliegende Text bezieht sich daher immer wieder auf Studien, die sich mit der „Kultur der Moderne“ befassen, stellt jedoch die individuelle Seite in den Mittelpunkt. An anderer Stelle (Fuchs 1998 – Macht) habe ich mich ausführlicher mit der gesellschaftlichen Seite der „Kultur“ befaßt, wobei als eindrucksvoller aktueller Versuch, komplexe soziale und kulturelle Entwicklungen „auf den Begriff“ zu bringen, die Schriften von Richard Münch zu nennen sind, der als konstitutive Wert-Ideen der Moderne Solidarität, Freiheit, Rationalität und aktive Weltgestaltung herausarbeitet und in unterschiedlichen Gesellschaften in ihrer – ebenfalls sehr unterschiedlichen – Ausprägung verfolgt. Andere große Entwürfe wie die von Max Weber oder Norbert Elias spielen ebenfalls – wenn auch hier nur am Rande – eine Rolle. In diesem – hier nur angedeuteten – Dschungel von relevantem Wissen und in dieser Vielzahl verwandter Begriffe „Ich“, „Selbst“, „Subjekt“ etc. versuche ich, eine Schneise mit dem Konzept der „Persönlichkeit“ zu schlagen, das meiner human- und kulturwissenschaftlichen Fragestellung in besonderer Weise entgegenzukommen scheint. Wie dieses Konzept verstanden werden soll und welche Bezüge zu Fachwissenschaften und zur Geschichte sich ergeben, will ich in diesem Einleitungskapitel eher narrativ beschreiben. In späteren Kapiteln wird es historisch und systematisch konkretisiert, so daß der gesamte Text schließlich als „Definition“ und Beschreibung dessen gelten kann, was aktuell als „Persönlichkeit“ im Kontext kultureller, sozialer, politischer und ökonomischer, aber auch individueller Entwicklungen m. E. zu verstehen ist. Diese Studien liegen im Überschneidungsbereich von Philosophie, Psychologie, Soziologie und Kulturgeschichte. Sie fassen daher ihren Gegenstand weiter als es entsprechende einzelwissenschaftliche Theorien und Konzeptionen tun. Allerdings geht dies zu Lasten der Tiefe. Es ist daher in jedem Fall ein lohnendes Unterfangen, sich zumindest eine ausformulierte klassische Theorie der Persönlichkeit genauer anzusehen (etwa Allport 1970, Kon 1983 oder Fromm 1979). In der Soziologie ist es vor allem die Sozialisationsforschung, wo man im Hinblick auf Persönlichkeitskonzeptionen fündig wird (Hurrelmann/Ulich 1984), in der Psychologie heißt die entsprechende Disziplin „Persönlichkeits11 oder differentielle Psychologie“ (Schneewind 1992), in der Geschichtswissenschaft sind es solche Ausrichtungen, die sich auf das Geschehen jenseits der „Haupt- und Staatsaktionen“ beziehen (Dülmen 1997), und in der Philosophie gibt es aktuell geradezu eine Renaissance einer „Philosophie der Person“, die sich zwischen der theoretischen Philosophie des Ich-Bewußtseins und der praktischen Moralphilosophie bewegt (Sturma 1997). „Persönlichkeit“, so Tillmann (1997, S. 11), läßt sich „bezeichnen als das spezifische Gefüge von Merkmalen, Eigenschaften, Einstellungen und Handlungskompetenzen, das einen einzelnen Menschen kennzeichnet. Entstanden ist dieses organisierte Gefüge auf der biographischen Lebensgrundlage der Menschen durch die Erfahrungen, die der einzelne im Laufe seiner Lebensgeschichte gemacht hat.“ Systematisch gehören also zur „Persönlichkeit“ Wissen und Werthaltungen, Gefühle und Motivationen, Sprache und Handlungen. Als „Sozialisation“ wird der „Prozeß der Entstehung und Entwicklung der Persönlichkeit (verstanden) in wechselseitiger Abhängigkeit von der gesellschaftlich vermittelten sozialen und materiellen Umwelt. Vorrangig thematisch ist dabei, wie sich der Mensch zu einem gesellschaftlich handlungsfähigen Subjekt bildet.“ (Ebd., S. 10) Vor dem Hintergrund dieser Annäherung an wichtige Grundbegriffe will ich knapp das Verständnis der anderen genannten Begriffe skizzieren. Ausführlicher werden sie im Text behandelt. Der „Einzelne“ oder das „Individuum“ – wörtlich das Unteilbare – soll ohne weitere starke Annahmen über vorhandene Fähigkeiten den je einzelnen konkreten Menschen erfassen. Eine „Person“ ist ein solcher Einzelner bereits als Träger bestimmter Rechte. „Subjektivität“ zielt auf die Gestaltungskompetenz dieses Einzelnen hin. Ein „Ich“ wird zum „Selbst“ infolge eines Reflexionsprozesses, wobei das Ich sich in seinem sozialen Kontext zum Gegenstand der Reflexion macht. Dieses so verstandene „Selbst“ ist Moment einer sowohl philosophisch wie sozialpsychologisch verstandenen Identität, sicherlich einer der umstrittenen Begriffe zwischen Moderne und Postmoderne (Keupp/Höfer 1997). Wie vorläufig diese erste Annäherung an zentrale Begriffe an dieser Stelle nur sein kann, mag man sich an der Tatsache verdeutlichen, daß alle diese Begriffe im Brennpunkt des aktuellen Meinungsstreites stehen. Zwischen philosophischem Liberalismus und Kommunitarismus spielt etwa die Frage eine entscheidende Rolle, was in der Ethik und Politik Vorrang haben soll: das Individuum oder die Gemeinschaft (Honneth 1994). Die Denkfigur eines handlungsfähigen autonomen Individuums, das sich in der Sozialisationsforschung etwa im Topos des „produktiv realitätsverarbeitenden 12 Subjekts“ (Hurrelmann/Ulich 1998, S. 9ff.) wiederfindet, wird sowohl philosophisch (Frank/Raulet/van Reijen 1988) wie auch sozialisationstheoretisch (Breyvogel 1989, S. 16ff.) bestritten. Eine gesellschaftstheoretische Kritik (Keupp/Bilden 1998) bezieht sich zudem auf all zu geradlinige Entwicklungsvorstellungen zum Menschen, so wie sie etwa das äußerst einflußreiche Identitäts-Konzept von Erikson (1973) unterstellte. Zudem wird diskutiert, ob die Pluralisierung der Gesellschaft überhaupt noch starke Vorstellungen von Kohärenz und Stabilität in der Identität zuläßt. Immerhin wird auch in dieser letztgenannten Kontroverse nicht bestritten, wie eng gesellschaftliche und individuelle Entwicklung zusammenhängen. In der Tat ist es meines Erachtens unverzichtbar, diesen Zusammenhängen historisch nachzugehen, da erst dadurch deutlich wird, daß zum einen die kulturelle „Selbstschöpfung des Menschen“ (Cassirer 1990) noch nicht abgeschlossen ist. Zum anderen wird dadurch deutlich, daß auch unsere aktuellen Kategorien zur Erfassung des Einzelnen in seinem sozialkulturellen Kontext und die damit erfaßten Dimensionen von Menschsein keine anthropologischen Konstanten sind, sondern in einem Wechselspiel mit gesellschaftlichen Herausforderungen entstanden sind. Historisch konkrete gesellschaftliche „Typen“, „Charaktermasken“ oder „Individualitätsformen“ sind also wesentlich mitzuberücksichtigen, wenn man über eine Theorie der Persönlichkeit nachdenkt. Denn dieses sind die jeweils vorhandenen gesellschaftlichen Angebote, mit denen sich der Einzelne dann auseinander zu setzen hat. Neben dem Blick in die Geschichte ist – quasi als Regulativ – ein Blick in andere Kulturen hilfreich: „Die abendländische Vorstellung von der Person als einem fest umrissenen, einzigartigen, mehr oder weniger integrierten motivationalen und kognitiven Universum, einem dynamischen Zentrum des Bewußtseins, Fühlens, Urteilens und Handelns, das als unterscheidbares Ganzes organisiert ist und sich sowohl von anderen solchen Ganzheiten als auch von einem sozialen und natürlichen Hintergrund abhebt, erweist sich ... im Kontext der anderen Weltkulturen als eine recht sonderbare Idee.“ (Geertz 1987, S. 294; vgl. dazu Wulff 1978 und in Fuchs 1993). Diese ethnologische Sensibilisierung gegenüber einer borniert eurozentrischen Sichtweise liefert uns zugleich weitere Bestimmungsmerkmale unseres Zentralbegriffs der „Person“. Im folgenden will ich die Thematisierung von „Person“/“Persönlichkeit“ – und verwandter Begriffe – aus der Sicht von Philosophie, Psychologie und Soziologie verfolgen. Die Genese von Subjektivität wird als innerer Entwicklungsprozeß verstanden, der unter konkreten gesellschaftlichen Bedingungen stattfindet und der über ein aktives Tätigwerden des Einzelnen in seinem Kontext vorangetrieben wird. „Tätigkeit“ ist daher eine zentrale 13 Kategorie zum Verständnis dieses Geschehens. Ein Stück weit wird die Kategorie der Tätigkeit systematisch in Kapitel 2 entfaltet. Die Ontogenese (3.2) wird dann als Prozeß der Entfaltung des Systems der Tätigkeiten begriffen. Ein historischer Blick in die Genese des Ich-Konzepts wird mit einer kleinen Fallstudie zu Comenius abgeschlossen. Möglichkeiten der Entwicklung von Persönlichkeit in der heutigen Gesellschaft (in einem „entwickelten“ Land) werden in den verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen Produktion, Konsum und Zirkulation gesucht. Hier finden aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen – etwa die von der Arbeits- zur Tätigkeitsgesellschaft – ihren systematischen Ort. In besonderer Weise fokussieren sich all diese Tendenzen und Prozesse der Persönlichkeitsentwicklung heute in der Stadt, die daher gesondert behandelt wird. Den Abschluß des Buches bildet ein kurzes Kapitel, das eine Brücke schlagen soll zwischen den hier vorgetragenen historischen und systematischen Überlegungen zur Persönlichkeit und den letztlich anvisierten Arbeitsfeldern (Kultur)-Politik und (Kultur)-Pädagogik. „Bildung“ wird dabei zu jenem Konzept, das diesen Brückenschlag leisten soll. Ein entsprechendes anschlußfähiges Konzept von „(Kultureller) Bildung“ wird daher abschließend skizziert. 14 2. Der Mensch als Gegenstand der Philosophie 2.1 Der Mensch als kulturell verfaßtes Wesen In einem weiten Verständnis hat es Philosophie ausschließlich mit dem Menschen zu tun, was sofort einleuchtet, wenn man etwa die berühmten Kantschen Fragen betrachtet: Was kann ich wissen? Was kann ich hoffen? Was soll ich tun? Und schließlich: Was ist der Mensch? Die klassischen philosophischen Disziplinen behandeln also – jeweils bezogen auf den Menschen – seine Erkenntnisfähigkeit, die Fragen nach Gut und Böse und nach dem geeigneten politischen Handeln, nach ästhetischen und moralischen Urteilen. Sie fragen nach dem Platz des Menschen in der Welt – und auch danach, was möglicherweise jenseits dieser Welt ist. Der Fokus „Mensch“ führt daher in der Philosophie kaum zu notwendigen Begrenzungen des Interessengebietes. Auch in einem engeren Verständnis dessen, was eine philosophische Thematisierung des Menschen ausmacht, bleibt ein weites Feld, auf das ich hier nur punktuell eingehen will. Ich beginne mit der Anthropologie, die zeigt, daß der Mensch – und nur der Mensch – ein kulturell verfaßtes Wesen ist. Was heißt dies? Es bedeutet, daß der Mensch, der in seiner Vorgeschichte wie jede andere Art den biologischen Gesetzen der Evolution unterworfen war, ab einem bestimmten Punkt beginnt, selber seine Geschichte zu machen. Wie genau dieser qualitative „Sprung“, der sich über eine lange Zeit hinwegzieht, abgelaufen ist, muß hier nicht interessieren und ist mit letzter Sicherheit noch nicht erforscht. Heberer (in Mann/Heuß 1991, Bd. 1, S. 87 ff.) hat für diesen Zeitraum den Begriff „Tier – Mensch – Übergangsfeld“ eingeführt. Wenn also die Untersuchung dieses Prozesses noch ein weitgehend offenes Forschungsfeld bleibt (Schurig 1975/1976), so kann man jedoch alles, was zu diesem Vorgang gehört und was die besondere Stellung des Menschen in der Natur ausmacht, systematisch beschreiben. So zu tun, als ginge es gar nicht um einen selbst: In dieser saloppen Formulierung steckt eine tiefgründige anthropologische Erkenntnis, die am präzisesten Helmut Plessner zum Gegenstand seiner Überlegungen gemacht hat. Der Mensch ist dasjenige Wesen, das aus seiner Mitte, in der er unproblematisch und unbewußt mit seiner Welt verzahnt wäre, heraustritt und sich selbst zum Gegenstand einer Reflexion über seine Position in dieser Welt machen kann. Diese „exzentrische Positionalität“ – so nennt Plessner dies – ist mit einer Reihe gravierender Bestimmungsmerkmale des Menschen verbunden, die immer wieder auf diesen Prozeß der Reflexivität hinführen: Der Mensch als Gegenstand seines Fragens, was er eigentlich ist, woher er kommt, wohin er geht. Und diesen Prozeß der Reflexivität gibt es nicht erst bei der rationalen Stufe des 15 Erkennens: Bereits unsere Sinne sind reflexiv angelegt. Denn bei dem Sehen, Hören, Tasten oder Riechen nehme ich nicht nur die Erscheinungen, die Wahrnehmungsobjekte, also die Gegenstände, die Düfte, die Töne wahr, sondern ich erlebe mich zugleich selbst in diesem Prozeß des Wahrnehmens, nämlich als Subjekt des Wahrnehmungsprozesses. Das heißt, ich erlebe mich sehend, hörend, tastend, fühlend. Und oft genug läßt sich gar nicht unterscheiden, ob es wirklich der Wahrnehmungsgegenstand ist, der etwa einen „Sinnesrausch“ auslöst, oder nicht doch dieses Selbstgefühl des Wahrnehmens. Bereits das Wahrnehmen hat also eine vielschichtige und komplizierte reflexive Struktur. Der Mensch, der sich handelnd mit der Welt verbindet und sich dadurch auch von sich selbst entfremdet; der Mensch, der aufgrund dieses Prozesses „Ich“ sagen kann! Selbstbewußtsein, Selbstgestaltung, Selbstzuständigkeit, Selbststeuerung, Selbstorganisation: all diese Begriffe bringen die Selbstbezüglichkeit zum Ausdruck, haben sie zur Voraussetzung und werden sehr bald politisch aufgeladen, werden also soziale und politische Begriffe, da sie zu den politischen Konzepten der Autonomie und Freiheit in der Moderne führen. Die naturgeschichtlich mitgegebene Möglichkeit zur Schaffung von Distanz zu sich ermöglicht auch die Entwicklung von Bildern von sich. Überaus einflußreich ist das dualistische Bild von Descartes: die Trennung in Körper und Geist. Nimmt man zu diesen beiden Polen die Seele hinzu, dann hat man nicht bloß einen Katalog möglicher Beeinträchtigungsformen, die die heutige Sonderpädagogik, die Medizin und Psychotherapie bestimmen, man hat auch zugleich einen zentralen Legitimationstopos der Kulturarbeit. Denn diese Trennung menschlicher Lebensdimensionen erzwingt geradezu den Ruf nach Ganzheitlichkeit als zentralem politischen und pädagogischen Ziel. Und diese Ganzheitlichkeit äußert sich in der Realität als Ruf nach einer Rehabilitation des Sinnlichen – das mit dem Körper verbunden ist –, weil dieses tatsächlich oder auch nur angeblich von dem Geist, dem Verstand in unserer angeblich rationalen Welt verdrängt wurde. Die Rettung der Sinnlichkeit, des Körpers oder des Leibes: all dies ist immer wieder ein zentraler Topos der Kultur- und Zivilisationskritik, wie sie in Deutschland seit der Romantik über Nietzsche, die Lebensphilosophie und den Existentialismus bis zur heutigen Postmoderne betrieben wird (vgl. Fuchs 1998 – Macht). Es scheint jedoch so zu sein, daß bei aller Proklamation von Ganzheitlichkeit der Mensch doch immer wieder in dualistisches Denken verfällt: Denn im Namen der Ganzheitlichkeit werden – auch in den genannten Strömungen – immer wieder Kopf gegen Bauch, Herz gegen Verstand, der Einzelne gegen die Gesellschaft ausgespielt. Hierauf komme ich später zurück. Distanz und Reflexivität sind also zentrale Mechanismen, die notwendig sind für all jene Bestimmungen, die in einer Theorie der Persönlichkeit relevant sind: daß sich nämlich menschliches Leben in der Form lebendiger Einzelmenschen 16 realisiert. Das Individuum, also das Unteilbare, der Einzelne, der sich unterscheidet von anderen, Ego und Alter, Peter und Paul – dies ist menschliche Lebensform selbst dort, wo die Horde, die Gens, der Stamm im Vordergrund steht und der einzelne Mensch lediglich als Teil eines Ganzen bewußt wird. Wir werden später sehen, daß dies im wesentlichen die Auffassung des Menschen bis zum Mittelalter ist. Und wer heutige Gesellschaftsanalysen betrachtet, kann zu der Vermutung gelangen, daß die Anthropologie bei der Erkenntnis der Distanz und Verschiedenheit stehen geblieben ist. Denn einmal entdeckt, daß menschliches Leben ein Leben in Individualität ist, werden sogleich Bilder von Menschen entworfen, die diesen nur noch als abstrakt-isoliertes Individuum sehen. Die Entstehung der bürgerlichen Gesellschaft, der Gedanke, daß der Einzelne Träger von Rechten – also Person – ist, der entstehende Kapitalismus, der die Idee eines „Besitzindividualismus“ (MacPherson 1967) fördert, bis zu heutigen Gesellschaftsanalysen, die die Individuen nahezu ausschließlich mit Wahlentscheidungen beschäftigt sehen, die sie von anderen Individuen abgrenzen sollen – all dies sind Bilder, mit denen der Mensch (reflexiv) sich selber verstehen wollte und will (vgl. hierzu etwa Taylor 1994 sowie die Artikel „Subjekt“ und „Individualität“ in Wulf 1997). In wenigen Zeilen beschreibt Kon die Etappen der philosophischen Reflexion des Ich von Descartes bis Marx: „Bei Descartes ist das Ich abstraktes Subjekt der Erkenntnis, bei Locke inneres Empfinden, bei Hume die Gesamtheit sich ablösender Selbstwahrnehmungen, bei Fichte universales Subjekt der Tätigkeit. Kant verbindet das Selbstbewußtsein mit dem sittlichen Ideal, Hegel verfolgt dessen Aufstieg vom Einzelnen zum Allgemeinen. Feuerbach setzt die sinnlich-leibliche Natur des Ich wieder in ihre Rechte ein und unterstreicht zugleich dessen dialogisches Wesen. Marx schließlich setzt das individuelle Ich in Beziehung zum konkreten Prozeß der Lebenstätigkeit des Individuums und über diese zur Gesamtheit der gesellschaftlichen Verhältnisse, deren Produkt und Subjekt das Individuum ist. So wird das Ich zum Angelpunkt der Umwandlung des Sozialen in das Individuelle und umgekehrt.“ (Kon 1983, S. 22). Bekanntlich wird der Beginn der neuzeitlichen systematischen Philosophie mit Descartes (1596–1650) angesetzt („cogito ergo sum“), wobei kulturgeschichtlich die Zeit der Renaissance – freilich eher mit künstlerischen Mitteln – den Boden für dieses neuartige Philosophieren bereitet hat. Die Verankerung des Lebens und der Sicherheit des Wirklichkeitsbezugs des Wissens setzt Descartes nicht bloß am Ich an, so wie es in der ersten Person Singular in seinem berühmten Satz zum Ausdruck kommt: Es ist vielmehr das denkende Ich. Dies war überhaupt nicht selbstverständlich, auch wenn Descartes älterer Zeitgenosse, Francis Bacon (1561–1626; „Wissen ist Macht“) seine gesellschaftliche Utopie des Neuen Atlantis auch als Wissens- und Gelehrtenrepublik gedacht hat. 17 Die Renaissance hat nämlich ganz andere Zugangsweisen zum Menschen diskutiert. So beschreibt Descartes' Landsmann, Michel de Montaigne (1533– 1592), in seinen „Essais“ den Menschen – psychologisch facettenreicher – als genießerisches und leidendes Wesen, stellt also gegenüber der Erkenntnisfunktion die Fähigkeit zur Emotion – in der Tradition griechisch-römischer Schulen der Lebenskunst – in den Mittelpunkt. Vielleicht war es das Chaos des 30jährigen Krieges, das Toben der „Leidenschaften“, das zu einer kritischen Bewertung dieser emotionalen Seite des menschlichen Lebens führte. Norbert Elias verfolgt in seinen Studien zur Zivilisation den Prozeß der zunehmenden Affektbeherrschung seit dem Mittelalter. Diese Domestizierung geht einher mit ökonomischen und politischen Prozessen (s. u.), denn auch die entstehende Staatslehre (etwa Th. Hobbes, 1588 – 1679) will den Wolf im Menschen zähmen (vgl. König 1992). Die „Entdeckung des Individuums“ im Ausgang des Mittelalters (Dülmen 1997) – Muchembled (1990) spricht sogar von „Erfindung“ – brachte zwar einen Anthropozentrismus in der Weltsicht, jedoch mit stark kognitiver Ausrichtung. Dülmen (1997, S. 64 ff.) benennt fünf relevante Themen dieser Zeit: das Verhältnis Mensch – Tier, weil durch die Entdeckungsreisen und das Auffinden anders aussehender Menschen Grenzen neu bestimmt werden mußten; das Verhältnis des Menschen zu Gott; das Verhältnis des Körpers zur Seele; das Verhältnis von Verstand und Leidenschaft das Verhältnis von Wildheit und Zivilisation. Man kann also feststellen, daß seit dieser Zeit in den Hierarchien des menschlichen Vermögens die intellektuellen Fähigkeiten dominieren, zumal die neuen Naturwissenschaften („experimentelle Philosophie“ hießen sie) ein großes Vertrauen in die menschlichen Erkenntniskräfte hervorrufen. Erst in der Romantik des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts gewinnt eine Gegenbewegung an Einfluß, die das Mündliche gegenüber dem Schriftlichen, das Besondere gegenüber dem Allgemeinen, das Lokale gegenüber dem Globalen und das Zeitgebundene gegenüber dem Überzeitlichen wiederentdeckt (Toulmin 1991, Kap. 5). 18 Fünf Formen von Individualismus unterscheidet Hasted (1998, S. 14 ff.), die alle seit Beginn der Neuzeit anzutreffen sind: den erkenntnistheoretischen Individualismus, so wie er mit Descartes seinen Anfang nahm, den ökonomischen Individualismus, wie er schließlich von Adam Smith („Wealth of the Nations“) als Theorie des (Früh-)Kapitalismus formuliert wurde, den politischen Individualismus mit seinem Vertragsgedanken, so wie er etwa von J. Locke beschrieben wurde, den psychischen Individualismus, so wie er in der Romantik und ihrer Konzentration auf die Binnenstruktur der Psyche einen Höhepunkt erreichte, den existentiellen Individualismus, für den Hasted S. Kierkegaard als Vertreter anführt. Die systematische Gegenposition zum Individualismus nennt Hasted „Holismus“, eine „Position, die einer Ganzheit unter Vernachlässigung oder Unterordnung des menschlichen Individuums die zentrale Bedeutung beimißt“ (ebd., S. 22). Gehen wir zunächst wieder zurück an den anthropologischen Ausgangspunkt. Mit Plessner war der Gedanke der Distanz des Ich von sich selbst („exzentrische Positionalität“) eingeführt worden. Es wurde angedeutet, wie weit dieses Distanz-Denken philosophisch trägt, insofern es die Möglichkeit der Erkenntnis von Individualität und Partikularität darstellt. Der Mensch überlebt jedoch nicht als einsamer Robinson, und selbst dieser hatte seinen Freitag. Daher muß der Gedankengang von Plessner ergänzt werden durch eine einsichtige Antwort auf die Frage: Wie schafft sich der distanzierte Mensch seine Vermittlung mit der Außenwelt, mit anderen Menschen und letztlich mit sich selber? Eine erste Antwort wurde bereits oben skizziert: Über Tätigkeit und Handeln wird das Subjekt mit dem Objekt vermittelt. Dies ist der Grundgedanke der klassischen Figur Subjekt – Tätigkeit – Objekt. Man kann sogar sagen: erst in der durch Tätigkeit vermittelten Beziehung werden Objekt und Subjekt wechselseitig konstituiert. Diese sind also keine „Dinge“, sondern entstehen erst in einem prozeßhaften Beziehungsgeflecht. Hinter dieser Formulierung steckt ein Prozeß der Entontologisierung, der mit Beginn der Neuzeit eine immer größere Schwungkraft erhält und schließlich in der Wende zum 19. Jahrhundert einen epistemologischen Paradigmenwechsel verursacht (vgl. Fuchs 1998 – Macht). Seit dieser Zeit sind „Relationalität“, „Operativität“ und „Prozeßhaftigkeit“ Leitlinien quer durch alle Disziplinen bis hin zu aktuellen Neuansätzen der Sozialisationsforschung, bei der eher dinghafte Vorstellungen von „Subjekt“ und „Objekt“ nunmehr auch von dieser Art von 19 Beziehungsdenken abgelöst werden (Leu/Krappmann 1999). Der Siegeszug dieser Denkweise läßt sich etwa daran erkennen, daß eine Ausblendung von Beziehungs- und Prozeßhaftigkeit als Denkweise der „Verdinglichung“, also als Verschleierung und Manipulation entlarvt wurde (Lukacs). Eine Theorie der Tätigkeit, des Handelns oder der Arbeit gibt es sowohl auf der philosophischen Ebene – ich nenne hier nur so unterschiedliche Denker wie Marx (MEW 1956 f.) und Arendt (1960). Dieser Tätigkeitsgedanke läßt sich jedoch auch bis in die konkret psychologische Ebene herunterdeklinieren (vgl. etwa Ulich 1991). Ein weiterer Weg, der meines Erachtens kompatibel ist mit einer solchen Tätigkeitstheorie (Fuchs 2000), ist die Kulturphilosophie von Ernst Cassirer, die ich daher kurz skizziere (vgl. Fuchs 1999, 2.2). „Der Mensch hat eine neue Art des Ausdrucks entdeckt: den symbolischen Ausdruck. Dies ist der gemeinsame Nenner all seiner kulturellen Tätigkeiten: in Mythos und Poesie, in Sprachen, in Kunst, in Religion und in Wissenschaft. Diese Betätigungen sind sehr unterschiedlich, aber sie erfüllen alle ein und dieselbe Aufgabe: die Aufgabe der Objektivierung. In der Sprache objektivieren wir unsere Sinneswahrnehmungen“ (Cassirer 1949, S. 63). In diesen Ausführungen sind einige, in meinem Kontext wesentliche Bestimmungen des Verhältnisses Mensch – Kultur angesprochen: Der Mensch ist ein aktives Wesen, das – indem es in die Welt eingreift – sich selbst konstituiert. Der Mensch erschafft sich, indem er die Welt gestaltet, und umgekehrt. Dies kommt sehr schön in einer komprimierten Bestimmung von „Kultur“ – es ist quasi eine systematische Zusammenfassung des „Versuchs über den Menschen“ –, zum Ausdruck: „Im ganzen genommen könnte man die Kultur als den Prozeß der fortschreitenden Selbstbefreiung des Menschen beschreiben. Sprache, Kunst, Religion bilden unterschiedliche Phasen in diesem Prozeß. In ihnen allen entdeckt und erweist der Mensch eine neue Kraft – die Kraft, sich eine eigene, eine „ideale“ Welt zu errichten“ (Cassirer 1990, S. 345). Der Mensch begegnet der Welt also keinesfalls unmittelbar, sondern er schafft sich eine Vielzahl „symbolischer Formen“. Neben den bereits genannten gehören noch die Wirtschaft, die Technik und der Staat dazu. All dies sind „symbolische Formen“, und Kultur kann als das Universum dieser symbolischen Formen betrachtet werden. Jede dieser Formen hat eine eigene Logik, hat eigene Möglichkeiten und Grenzen, kann jedoch grundsätzlich das Ganze zum Inhalt haben. Es gibt also keine Hierarchie der symbolischen Formen, kein automatisches Bewegungsgesetz, etwa vom Mythos zur Wissenschaft. Allerdings haben im Universum der symbolischen Formen Mythos und Sprache 20 – auch entwicklungsgeschichtlich – eine gewisse grundlegende Bedeutung, was auch im Aufbau und in der Gliederung der „Philosophie der symbolischen Formen“ abzulesen ist. Die Tatsache jedoch, daß jede der symbolischen Formen das Ganze zum Gegenstand haben kann, daß jede für sich eine spezifische Weltzugangsweise, eine Lebensform darstellt, ist insbesondere dort ein Problem, wo die spezifische symbolische Form nicht zur Humanität, sondern zur Barbarei führt, wie er es in seinem letzten Buch über den „Mythus des Staates“ beschreibt. Eine Einheit in dieser Pluralität symbolischer Formen ist daher auch nicht in ihrem Gegenstands- und Anwendungsbereich zu finden, sondern diese sucht Cassirer im handelnden Subjekt und in der gemeinsamen Funktion all dieser Formen: der Selbstbefreiung durch die Schaffung einer eigenen „idealen“ Welt. Dies ist zugleich das Bestimmungsmoment von „Menschsein“ schlechthin (ebd., S. 114), das Ziel, auf das alle verschiedenen Formen von „Menschsein“ trotz aller Unterschiede und Gegensätze hinarbeiten (ebd.). Charakteristisches Kennzeichen dieser geschaffenen „idealen Welt“ ist Ordnung. Dies ist daher quasi eine grundlegende anthropologische Konstante: der Bedarf, Ordnung zu schaffen in den Empfindungen, Wünschen und Gedanken. Dazu schafft sich der Mensch die symbolischen Formen. Und alle diese Formen lösen ihre Ordnungsaufgabe, und sie leisten dies durch eine Vermittlung von Subjekt und Objekt, von Sinn und Sinnlichkeit, nämlich durch je spezifische Symbole: „Unter einer „symbolischen Form“ soll jede Energie des Geistes verstanden werden, durch welche ein geistiger Bedeutungsgehalt an ein konkretes sinnliches Zeichen geknüpft und diesem Zeichen innerlich zugeeignet wird.“ (Cassirer 1990, S. 175). Erkennen – im weiten Sinn eines Umgangs mit allen symbolischen Formen – ist daher kein passiver Prozeß des bloßen Aufnehmens von Eindrücken, sondern ein produktiver, tätiger Schöpfungsprozeß von Zeichen und Bildern, die diese Vermittlungsaufgabe zwischen Subjekt und Objekt leisten. Das Symbol löst das zentrale Problem nicht nur der Erkenntnistheorie (also die Vermittlung zwischen Denken und Sein), sondern jeglicher Beziehung zwischen Mensch und Welt. Die symbolische Beziehung des Meinens und Bedeutens ist eine nicht weiter hintergehbare, ursprüngliche Beziehung. Sie ist weder ontologisch nur im Sein noch psychologisch nur im Subjekt zu begründen: „Das Symbolische ist vielmehr Immanenz und Transzendenz in Einem: sofern in ihm ein prinzipiell überanschaulicher Gehalt in anschaulicher Form sich äußert.“ (Cassirer 1954, S. 370 und 450). Die Frage nach der Entstehung der Symbolfunktion ist jedoch „mit wissenschaftlichen Mitteln nicht lösbar“. (Cassirer 1961, S. 100). 21 Für jede der genannten symbolischen Formen lassen sich die Ausdrucks-, Darstellungs- und Bedeutungsfunktion unterscheiden, wobei es bei jeder symbolischen Form in jeder dieser Funktionen Stufen der Entwicklung gibt. Dies hat Cassirer jedoch nicht mehr systematisch für jede symbolische Form untersucht. Lediglich über die Ausdrucksfunktion hat er die Stufenfolge: mimetisch, analogisch, symbolisch (Cassirer 1953, 134 –148) unterschieden. Der Mensch im Verständnis von Cassirer braucht also Mittel im Zugang zu sich und der Welt: Der Mensch ist mittelverwendendes Wesen. Diese Mittel („Symbole“) beginnen bei wirklichen Gegenständen wie Werkzeugen und reichen bis zu abstrakten begrifflichen Mitteln. Der Mensch ist insofern Kulturwesen, als er seinem Ausdruck Form verleihen kann (vgl. Schwemmer 1997, S. 31 f.) Hierin steckt ein für die Theorie der Persönlichkeit entscheidender Gedanke: nämlich die Lösung des Widerspruches zwischen Freiheit, Kreativität und Schöpfung auf der einen Seite und Form, Gestalt, Grenze und Gesetz auf der anderen Seite. Dies ist ein Widerspruch, der gerade für die bürgerliche Philosophie seit der Renaissance von besonderer – auch politischer – Bedeutung ist: Wie läßt sich die notwendige Freiheit des Menschen (auch und gerade als Freiheit gegenüber den absolutistischen Fürsten) gleichzeitig begründen mit der Vorstellung einer gesetzmäßig funktionierenden Natur, die ohne willkürliche Einmischung von außen regelgeleitet funktioniert. Gesetzmäßigkeit und Form sind also in emanzipatorischer Absicht gleichzeitig zu denken mit Freiheit und Autonomie. Die dualistische Lösung einer Aufspaltung in eine gesetzmäßige Natur und in eine „Kultur“ als Reich der Freiheit, so wie sie Descartes vorgezeichnet hat, bedeutet letztlich einen Bruch im Denken, der insbesondere dann nicht zu akzeptieren ist, wenn der Mensch in seiner doppelten Bindung an Natur und Kultur begriffen werden soll. Dies ist auch ein zentrales Problem bei Cassirer, wie schon Überschriften seiner Bücher verraten: „Freiheit und Form“ (1961) oder „Idee und Gestalt“ (1924). Immer wieder kommt Cassirer hier auf Goethe zurück, und es ist gerade im pädagogischen Kontext meines Beitrages von hohem Interesse, daß er dieses philosophische (und letztlich politisch-ideologische) Grundproblem in engem Zusammenhang mit Bildung, nämlich mit Goethes Konzept einer Bildung als Lebensform, behandelt: die Vermittlung von Geist und Natur, die zugleich eine Vermittlung von schöpferischer, kreativer Entfaltung und Form ist. Der Gedanke, der immer auftaucht, ist der: daß sich Freiheit nur in der Begrenzung entfalten kann. Form und Gestalt, also auf den ersten Blick Einengung und Begrenzung, sind Bedingungen der Möglichkeit von Freiheit. Dies ist geradezu ein universelles Prinzip, gültig für Geist und Natur, gültig aber auch für das soziale Zusammenleben der Menschen, für Sittlichkeit und Politik. Der Mensch ist also deshalb ein „Kulturwesen“, weil er seinem Ausdruck eine Form geben kann, weil er ein tätiges Wesen ist, das für seine Tätigkeit und seine 22 schöpferischen Gestaltungsprozesse Formen schafft. Und die je individuelle Schaffung dieser Formen: dies macht zugleich die „Bildung“ aus. In diesem Sinne referiert Cassirer mit großer Zustimmung Goethe am Beispiel der Pandora: „Aber das Reich, das sie (die Pandora; M.F.) jetzt gründet, die Herrschaft der Form, die sie aufrichtet, gehört nicht mehr dem Epimetheus allein. Sie gehört nicht dem Sinnenden und Schauenden, sondern dem Wertenden und Schaffenden: den Landleuten und Hirten, den Fischern, den Schmieden. Nur dem gibt sich die Form in ihrem realsten Wesen zu eigen, nur der vermag sie festzuhalten, der sie täglich aufs neue schafft und hervorbringt. Und diese Art des Schöpfertums geht nicht ins Weite, ins Unbestimmte, sondern sie hält und bewährt sich im engsten Kreise. Nur wenn jeder Einzelne in seiner eng begrenzten Sphäre eine solche Erfüllung sucht und leistet, erfüllt sich in ihm und durch ihn das Ganze – wird er zum Träger der echten und wesenhaften Form des Seins.“ (Cassirer 1993, S. 109). Kultivierung ist also ein Akt des Wirkens, des Schaffens von Werken, ein Akt der gleichzeitigen Selbstbegrenzung durch Formen, ein Akt der Präsentation von sich gegenüber anderen (Objektivation), ein Akt des Versprechens der Verläßlichkeit (Schwemmer 1997, S. 173). Auch wenn Cassirer seine Priorität stets auf den geistigen Akt der Formgebung legt – auch in den Naturwissenschaften –, auch wenn das Geistige und Allgemeine stets Priorität gegenüber dem Materiellen und je (zufällig) Einzelnen und Besonderen hat, sind viele seiner Aussagen paßfähig zu Anthropologien, die in einem materialistischen Grundverständnis formuliert werden (vgl. Fuchs 1999, 2.1): der Gedanke der Objektivierung des Geistigen, das daraus entstehende „soziale Gedächtnis“, das erst eine kumulative Entwicklung des Menschen gestattet, seine tätigkeitsorientierte Auffassung des Menschen, seine humanistische Grundposition einer Selbst-Befreiung des Menschen und sein ethisch-moralischer Grundton in seiner gesamten Philosophie, die Versuche einer dialektischen Vermittlung Subjekt/Objekt; Geist/Natur; Individuum/Allgemeines. der Gegensätze Diese philosophische Konzeption vom Menschen und Kultur auf der Basis des Symbolbegriffs ist vielfältig anschlußfähig an einzelwissenschaftliche 23 Unternehmungen, auf die ich später zurückkomme. Bourdieu (1987) transformiert etwa diese Symboltheorie des Kulturellen um in eine aussagekräftige Kultursoziologie und liefert eine eindrucksvolle Empirie zum sozialen Gebrauch der (v. a. ästhetischen) Symbole. Die Kulturgeschichte (des Alltags und der Künste) schließt unmittelbar an Cassirer an und definiert „Kultur: (als) das überindividuell kommunizierte „Geflecht von Begriffen“, der verbalen und nonverbalen Zeichen, von Deutungsmustern, bildlichen Vorstellungen und ästhetischen Chiffren, von mentalen Handlungspraktiken, Gefühlen und Ritualen. Hierzu gehören gleichfalls die gestalteten materiellen Objekte, die Formen der Kultur, ferner die symbolischen Ordnungen der Gesellschaft, ihrer Schichten und Gruppen sowie die der Individuen.“ (Ruppert 1998, S. 46). Dies ist also die – vom Menschen geschaffene – Objektivität, die dem Einzelnen gegenübersteht, die er – zumindest teilweise – rekonstruiert und weiterentwickelt. Es wird deutlich, daß mit dieser „Komplexität des Objekts“ (der „Kultur“) ein entsprechend komplex zu begreifendes Subjekt korrespondiert. Hierzu greife ich auf einen breit diskutierten anthropologischen Vorschlag zurück, der aus dem politischen Kontext der UNO (Nussbaum/Sen 1993) stammt: der Vorschlag einer „schwachen Anthropologie“ (Nussbaum 1993), der anschlußfähig ist an die hier vertretene Grundkonzeption von Mensch und Kultur und der die Dimensionen der Persönlichkeit präzisiert: „Die Gestalt der menschlichen Lebensform – Sterblichkeit: Alle Menschen haben den Tod vor sich und wissen nach einem bestimmten Alter auch, daß sie ihn vor sich haben. Dieses Faktum überformt mehr oder weniger jedes andere Element des menschlichen Lebens. Außerdem haben alle Menschen eine Abneigung gegen den Tod. Auch wenn unter bestimmten Umständen der Tod gegenüber verfügbaren Alternativen vorgezogen wird, ist der Tod eines geliebten Menschen oder die Aussicht auf den eigenen Tod ein Anlaß zu Kummer und/oder Angst. Der menschliche Körper: Wir alle leben unser Leben in Körpern einer bestimmten Art, deren Möglichkeiten und Verletzbarkeiten als solche keiner einzelnen menschlichen Gesellschaft mehr angehören als einer anderen. Diese Körper, die (angesichts des enormen Spektrums von Möglichkeiten) weitaus ähnlicher als unähnlich sind, sind gewissermaßen unsere Heimstatt, indem sie uns bestimmte Optionen zugleich machen und andere verwehren, und indem sie uns nicht nur bestimmte Bedürfnisse, sondern auch bestimmte Möglichkeiten zu außergewöhnlichen Leistungen verschaffen. Die Tatsache, daß jeder Mensch irgendwo hätte leben und jeder Kultur hätte angehören können, macht einen großen Teil dessen aus, was unsere wechselseitige Anerkennung begründet; diese Tatsache hängt wiederum in hohem Maße mit der allgemeinen Menschlichkeit des Körpers, mit seiner großen Verschiedenheit gegenüber anderen Körpern zusammen. Die Körpererfahrung ist sicherlich kulturell geprägt, aber der Körper selbst, der in seinen Anforderungen der Ernährung und 24 anderen damit zusammenhängenden Anforderungen kulturell invariant ist, legt Grenzen für das Erfahrbare fest und garantiert eine weitgehende Überschneidung. Unter „Körper“ lassen sich mehrere weitere Eigenschaften aufzählen, die ich hier nicht weiter erörtern kann: Hunger und Durst, das Bedürfnis nach fester und flüssiger Nahrung; ein Bedürfnis nach Behausung; sexuelles Bedürfnis und Begehren; die Fähigkeit, sich zu bewegen und die Lust an der Mobilität; die Fähigkeit zur Lust und die Abneigung gegen Schmerz. Kognitive Fähigkeit – Wahrnehmen, Vorstellen, Denken: Alle Menschen haben diese Fähigkeit, zumindest in einer gewissen Form, und sie wird als überaus wichtig angesehen. Frühkindliche Entwicklung: Alle Menschen fangen ihr Leben als hungrige Säuglinge an, die sich ihrer Hilflosigkeit bewußt sind und ihre wechselnde Nähe und Distanz sowohl davon als auch von denjenigen erleben, von denen sie abhängig sind. Diese gemeinsame Struktur des Lebensanfangs, so verschieden sie durch unterschiedliche gesellschaftliche Gegebenheiten auch gestaltet sein mag, gewährt eine Gemeinsamkeit der Erfahrung im Bereich von Gefühlen wie Kummer, Liebe und Zorn. Und dies ist wiederum eine Hauptquelle unserer Fähigkeit, uns in den Leben anderer wiederzuerkennen, die sich von uns in mannigfacher Hinsicht unterscheiden. Praktische Vernunft: Alle Menschen beteiligen sich (oder versuchen es) an der Planung und Führung ihres eigenen Lebens, indem sie bewerten und diese Bewertungen dann in ihrem Leben zu verwirklichen suchen. Zugehörigkeit zu anderen Menschen (Affiliation; soziale Bindung): Alle Menschen anerkennen und verspüren ein gewisses Gefühl der Zugehörigkeit oder der sozialen Bindung zu anderen Menschen und ein Gefühl der Anteilnahme ihnen gegenüber. Außerdem wertschätzen wir die Lebensform, die durch diese Anerkennung und Zugehörigkeit gebildet wird. Bezug zu anderen Spezies und zur Natur: Die Menschen erkennen, daß sie nicht die einzigen lebenden Wesen in ihrer Welt sind: daß sie Tiere neben anderen Tieren und auch neben Pflanzen sind, in einem Universum, das als komplexe Verkettungsordnung sie sowohl unterstützt als auch begrenzt. Von dieser Ordnung sind wir in zahllosen Hinsichten abhängig, und wir empfinden auch, daß wir dieser Ordnung eine gewisse Achtung und Anteilnahme schulden, sosehr wir uns auch darin unterscheiden mögen, was genau wir schulden, wem gegenüber und auf welcher Basis. Humor und Spiel: Menschliches Leben räumt überall, wo es gelebt wird, Platz für Erholung und für das Lachen ein. Die Formen, die das Spiel annimmt, sind zwar überaus vielfältig, trotzdem erkennen wir andere Menschen über kulturelle Schranken hinweg als die Lebewesen, die lachen. Vereinzelung: Sosehr wir auch in Bezug zu anderen und für andere leben, so sind wir, ist jeder von uns „der Zahl nach einer“, der von Geburt an bis zum Tod die Welt auf einem separaten Weg durchläuft. Jede Person empfindet ihren eigenen Schmerz und nicht den einer anderen. Selbst die intensivsten Formen 25 menschlicher Interaktion sind Erfahrungen des wechselseitigen Reagierens oder Antwortens (responsiveness) und nicht der Verschmelzung. Diese offenkundigen Tatsachen müssen erwähnt werden, besonders dann, wenn wir von einem Fehlen des „Individualismus“ in anderen Gesellschaften hören. 26 Starke Vereinzelung: Aufgrund der Vereinzelung hat jedes menschliche Leben sozusagen seinen eigenen Kontext und seine Umgebung – Gegenstände, Orte, eine Geschichte, besondere Freundschaften, Standorte, sexuelle Bindungen –, die nicht genau die gleichen sind wie die von jemand anderem und aufgrund derer die Person sich in einem gewissen Maß selbst identifiziert. Auch wenn die Gesellschaften sich in Grad und Art der strengen Vereinzelung unterscheiden, die sie jeweils zulassen und fördern, ist bisher noch kein Leben bekannt, das es tatsächlich (wie Platon es wünschte) unterläßt, die Wörter „mein“ und „nicht mein“ in einem persönlichen und ungeteilten Sinn zu verwenden.“ Martha Nussbaum weist darauf hin, daß diese Liste Fähigkeiten und Grenzen enthält. Im Hinblick auf die Fähigkeiten beschreibt sie eine „Minimalkonzeption des Guten“. Die Grenzen wiederum sind ständige Herausforderung ihrer Überschreitung. Wichtig ist die Unterscheidung zweier Schwellen: die Schwelle zum menschlichen Leben und die Schwelle zum guten menschlichen Leben – auch als Ziel für die politische Gestaltung und als Meßlatte zur Beurteilung bestimmter Gesellschaften. Diese zweite Schwelle wird durch die folgende Liste beschrieben: Fähig zu sein, bis zum Ende eines vollständigen menschlichen Lebens zu leben, soweit, wie es möglich ist; nicht frühzeitig zu sterben, bevor das Leben so vermindert ist, daß es nicht mehr lebenswert ist. Fähig zu sein, eine gute Gesundheit zu haben; angemessen ernährt zu werden; angemessene Unterkunft zu haben; Gelegenheit zur sexuellen Befriedigung zu haben; fähig zu sein zur Ortsveränderung. Fähig zu sein, unnötigen und unnützen Schmerz zu vermeiden und lustvolle Erlebnisse zu haben. Fähig zu sein, die fünf Sinne zu benutzen; fähig zu sein, zu phantasieren, zu denken und zu schlußfolgern. Fähig zu sein, Bindungen zu Dingen und Personen außerhalb unserer selbst zu unterhalten; diejenigen zu lieben, die uns lieben und sich um uns kümmern; über ihre Abwesenheit zu trauern; in einem allgemeinen Sinne lieben und trauern sowie Sehnsucht und Dankbarkeit empfinden zu können. Fähig zu sein, sich eine Auffassung des Guten zu bilden und sich auf kritische Überlegungen zur Planung des eigenen Lebens einzulassen. Fähig zu sein, für und mit anderen leben zu können, Interesse für andere Menschen zu zeigen, sich auf verschiedene Formen familialer und gesellschaftlicher Interaktionen einzulassen. Fähig zu sein, in Anteilnahme für und in Beziehung zu Tieren, Pflanzen und zur Welt der Natur zu leben. Fähig zu sein, zu lachen, zu spielen und erholsame Tätigkeiten zu genießen. 27 Fähig zu sein, das eigene Leben und nicht das von irgend jemand anderem zu leben. Fähig zu sein, das eigene Leben in seiner eigenen Umwelt und in seinem eigenen Kontext zu leben.“ Auf dieser Ebene der Anthropologie (und Persönlichkeitstheorie) können einige, zum Teil klassische Probleme diskutiert werden, zumal sich durch die Entwicklung von Einzelwissenschaften neue Einsichten ergeben haben. So hat in den letzten Jahren die Neurobiologie eine starke Entwicklung erlebt, die aus philosophischer Sicht die Fragen nach den „natürlichen Bedingungen des Einzelnen“ (Hasted 1998, Kap. 8) neu stellen: das Leib-Seele-Problem, die Frage nach dem Gehirn als Träger des Geistes (vgl. auch Schwemmer 1997). Die Entwicklung der Computerindustrie stellt die Frage nach der künstlichen Intelligenz und die Frage nach der Wirklichkeit (vgl. Krämer 1998). Ich verweise an dieser Stelle insbesondere auf die Studie von Schwemmer (1997), der auf der Basis der Symboltheorie von Cassirer klassische philosophische Probleme rekonstruiert: Das Symbol mit seiner „Zentraleigenschaft“ der Prägnanz (ebd., S. 85 ff.) verbindet ein sinnliches Wahrnehmungserlebnis mit einem dahinterstehenden Sinn. Der Mensch entwirft („konstruiert“) eine geordnete Symbolwelt mit ihrem Bezug zur Realität: „Die Welt der Dinge und Ereignisse, die wir als unsere Wirklichkeit erfassen, entwickelt sich erst über ihre Repräsentation... . Unsere Wirklichkeit ist deren Vergegenwärtigung.“ (Ebd., S. 86; vgl. Fuchs 1999, 2.5). Unterstellt man, daß dieser Umgang mit Symbolen – und somit der symbolvermittelte Umgang mit sich, der Welt und mit anderen – immer aktiv geschieht, also eine Tätigkeit darstellt, so ergibt sich die hier unterstellte Kombination einer symbolbezogenen Tätigkeitstheorie als Basis auch einer Theorie der Persönlichkeit. Ich werde daher in den folgenden Abschnitten auf das Konzept der Tätigkeit vertieft eingehen. Doch bleiben wir noch eine Weile bei dem philosophischen Diskurs rund um das Ich. Das Ich in der Philosophie, das Subjekt, das angeblich verschwindet, ist zu differenzieren (Schrödter 1994). Eine Alternative zu den vorgestellten Formen des Individuums von Hasted (1998) erarbeitet Baumgartner („Welches Subjekt ist verschwunden?“ in Schrödter 1994). 1. Zunächst identifiziert er das „Ich“ als eines der Personalpronomina „ich“, „du“, „er/sie/es“. Hier ist das „Ich“ eine unverzichtbare Selbstreferenz der Gedanken, ganz so wie es die Kommunikationsphilosophie (Apel, Habermas) als unhintergehbare Voraussetzung vernünftiger Kommunikation vorgestellt hat: Ohne Unterscheidung zwischen dem Ich, das redet, und dem Partner, mit dem gesprochen wird – und der in der Regel Nicht-Ich ist –, wird 28 Kommunikation obsolet. 2. Dasselbe muß dann sinnvollerweise aus Gründen der Symmetrie dem Kommunikationspartner unterstellt werden. 3. Das Ich des „Ich denke“ ist ebenfalls unverzichtbar. Das bringt etwa ein folgender Scherz zum Ausdruck: Dort wird einem Professor von seinem Studenten sorgenvoll mitgeteilt: Ich bin nicht mehr sicher, ob ich überhaupt existiere. Darauf der Professor: Wer ist es, der nicht mehr sicher ist? 4. Das Konzept der „Persönlichkeit“. Kant hat in seiner Schrift zur „Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft“ (Werke Band VI) drei Elemente „Elemente zur Bestimmung des Menschen“ unterschieden: - die Anlage für die Tierheit des Menschen als eines lebenden, - für die Menschheit desselben als eines lebenden und vernünftigen und - für seine Persönlichkeit als eines vernünftigen und zugleich der Zurechnung fähigen Wesens. „Persönlichkeit“ ist also Naturwesen plus Vernunft plus Verantwortlichkeit in einem sozialen Normgefüge. Neben diesen unverzichtbaren Dimensionen der Rede vom Ich gelten für Baumgartner (ebd.) solche Übersteigerungen des Subjektgedankens obsolet, die nur noch ein Ich – sei es bei Fichte oder auch bei Hegel – als absolutes Wirkungsprinzip des Ganzen sehen, also eine „totalisierende Ich-Struktur“ auch der Natur und Geschichte (ebd., S. 25): „Verschwunden ist das Subjekt als Vorschein der Versöhnung. Wir sind nicht das Bild des Absoluten in der Welt. Verschwunden ist damit auch die Einschätzung der Anthropologie als einer vermeintlich wahrhaften Theologie. Verschwunden ist das Subjekt als Interpretament für Natur und Geschichte. Verschwunden ist die Vorstellung von Geschichte als einer einsehbaren Totalität. Und schließlich: Verschwunden ist auch das universelle Subjekt des Intellektuellen, das uns auch in anderer Hinsicht des öfteren in Schwierigkeiten gebracht hat... . Hingegen nicht verschwunden, weil dies noch die Bedingung jeder sinnvollen Rede, auch eines möglichen Verschwindens, ist: 1. die Selbstreferenz des Ich, 2. das Subjekt als individuell erkennendes Bewußtsein, 3. das Subjekt als verantwortliche Person in rechtlicher und moralischer Sicht und 4. das kommunikative Ich als Bezugspunkt jeder gemeinsamen Rede über die Welt und das Leben der Menschen in ihr: auch über das Absolute.“ (Ebd., S. 26 f.) 29 In philosophischen Disziplinen gedacht sind es also Kommunikations- und Sprachphilosophie (insbesondere dann, wenn in Kommunikation/Sprache das Fundament menschlichen Lebens gesehen wird), Erkenntnistheorie und praktische Philosophie (Ethik/Politik/Pädagogik), die auch weiterhin ein Ich als handelndes, verantwortungsvolles Subjekt benötigen. Allerdings sind hier auch die wirkungsvollsten Angriffe gestartet worden: in Erkenntnistheorie und Ontologie die Problematik eines Konzeptes von Realität und Wirklichkeit, etwa im Zuge der Diskussion der Neuen Medien (Krämer); in Ethik und Politikphilosophie die Frage nach dem Fundament von individuellem Handeln und von staatlicher und zwischenstaatlicher Ordnung, etwa in der kritischen Diskussion der Menschenrechte. „Autonomie“ und „moralische Würde“, so Sturma (1997, S. 26) sind zwei zentrale Bestimmungen neuzeitlicher Subjektivität, die im Begriff der Person miteinander verschränkt sind. Die umfangreiche Studie von Sturma will eine – bislang noch nicht in dieser Form als philosophische Disziplin existierende – „Philosophie der Person“ konstituieren. Sturma rezipiert dabei sorgfältig die – insbesondere anglo-amerikanische – analytische Philosophie des Ich, vernachlässigt jedoch vollständig die mit dem Namen Max Scheler verbundene Theorie der Person (im Rahmen der Phänomenologie und der „materiellen Wertethik“) sowie die bis in das frühe Mittelalter zurückreichende PersonKonzeption im Rahmen einer „Metaphysik der Freiheit“. Diese wiederum reicht bis in die griechische Aufteilung der Philosophie in ein Reich der Natur, der Logik und der Moral zurück, wobei der Mensch als „Person“ mit seiner „Würde“ das natürliche, logische und moralische Sein integriert (vgl. Kobusch 1993). Der Hinweis auf das Personenkonzept von Scheler ist noch in anderer Hinsicht ertragreich: Dieser führt nämlich das Konzept der Solidarität als emotionale Bindung innerhalb kollektiver Subjekte, also als „sozialer Kitt“ von Gruppen, in die Moralphilosophie ein und erinnert – gegen die verbreitete individuumsbezogene Ethik der Neuzeit (etwa bei Kant) – an die Rolle von Gemeinschaften, so daß dieser Ansatz fast den aktuellen Kommunitarismus vorwegnimmt (vgl. Bayertz 1998). Eine „Person“ ist also nicht bloß Trägerin individueller Rechte, muß nicht nur geschützt werden gegen Angriffe von anderen, sondern ist als Teil einer Gemeinschaft auch zur aktiven Verantwortung für andere verpflichtet. (Ich komme am Ende dieses Abschnitts darauf zurück). Für Sturma (1997) beginnt die eigentliche Wirkungsgeschichte des Personenkonzepts mit der moralischen und politischen Diskussion der Menschenrechte (ebd., S. 27). Seine „Philosophie der Person“ versteht sich daher als (antizyklischer) Gegenentwurf zu aktuellen neostrukturalistischen und 30 neopragmatischen, aber auch subjektskeptischen Ansätzen (R. Rorty) der neueren Philosophie. Sie muß den weiten Bogen von systematischen Grundsatzentscheidungen bis zur alltäglichen Lebensführung spannen (Sturma 1997, S. 32), wodurch sich vielfach Überschneidungen sowohl mit einer Philosophie der Lebenskunst (Schmid 1998) als auch zur Philosophie des Alltags (Heller 1978) ergeben. Diese heutige Renaissance des guten, glücklichen und gelungenen Lebens (Seel 1995) hat gesamtgesellschaftlich sicherlich mit Orientierungsproblemen in der aktuellen Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft zu tun, möglicherweise auch mit einer Fin-de-siècle-Stimmung am Ende des Jahrhunderts und Jahrtausends (Deppe 1997, Hobsbawm 1995). Es gibt also durchaus entgegengesetzte philosophische Strömungen: von einer Verabschiedung von Subjekt und Person bis zu ihrer erneuten Fundierung, wobei ein gemeinsamer gesellschaftlicher Nenner die Empfindung der Krisenhaftigkeit der gesellschaftlichen Entwicklung ist. Hier hat die aktuelle (positive oder negative) Philosophie des Subjekts durchaus Parallelen zu der Entwicklung am Ende des 19. Jahrhunderts, als es ebenfalls zu einer Konjunktur des Nachdenkens über die Person (etwa im Kontext der Lebensphilosophie von Dilthey oder Simmel) gekommen ist. Eine Übersteigerung des Subjektiven war auch – wie oben erwähnt – die IchPhilosophie von Fichte, eingebettet in die Romantik als Retterin des Gefühls, des Lebens und des Besonderen gegen ein Aufklärungsdenken, das mit der Französischen Revolution eine nicht gewollte politische Dynamik erhalten hat. Dieser Zusammenhang zwischen „Geist“ und Leben ist kein Zufall. Denn Philosophie, so meine Überzeugung, spielt sich nicht im luftleeren Raum bloß innerphilosophischer Ableitungszusammenhänge ab, sondern ist immer – wie Hegel sagte – ihre Zeit in Gedanken gefaßt. Heute bedeutet dies, im Zuge der Globalisierung Verantwortlichkeit für alle Menschen empfinden zu müssen, was die Anstrengung für eine „globale Ethik“ auf der Ebene der UNO – auch als erneute Fundierung und Weiterentwicklung der Menschenrechte – verständlich macht, die erneute Konfrontation mit regionalen Kriegen, die nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes leichter möglich sind und die eine politische Herausforderung darstellen, die fast an den Beginn der bürgerlichen Gesellschaft zurückreicht: dort war Frieden ein erstes zu erreichendes Ziel, das ein bürgerlicher Staat zu garantieren hatte, damit stellt sich erneut die Legitimationsfrage für die politische, soziale und ökonomische Ordnung, allerdings nunmehr zusätzlich auf der Ebene überstaatlicher Organisationen (EU, OECD, UNO), die Rückkehr der Ethik und der Politischen Philosophie – also insgesamt der Praktischen Philosophie – ist also plausibel, da der Handlungsdruck sehr 31 groß geworden ist, und dies gilt für eine weitere Grundfrage menschlichen Lebens: nämlich den Aspekt der Beherrschbarkeit des naturwissenschaftlichen (heute v. a.: biologischen) Erfindungsreichtums, der nunmehr in den Kernbereich der menschlichen Gattung (Genmanipulationen) hineinreicht und der – mit Hilfe der Informationstechnologie – die bisher anerkannten Kriterien von Menschsein (Phantasie, Bewußtsein, Gefühl etc.) durch die moderne Technik angreift. „Was soll ich tun?“, „Was kann ich wissen?“, „Was kann ich hoffen?“, und letztlich „Was ist der Mensch?“: die Kantschen Fragen haben geradezu eine brennende Aktualität. Für Sturma hat das Konzept der Person eine Schlüsselstellung bei der Beantwortung dieser Fragen. Ohne sein äußerst ambitioniertes Werk referieren zu können, will ich einige Positionen und Ergebnisse, die in unserem Kontext relevant sind, hier wiedergeben: Seine letzte These lautet: „Ein menschenwürdiges Leben, das den Ansprüchen genügt, kann nur als Person geführt werden“ (S. 36). Eine solche „Person“ handelt durchaus so, daß sie „das eigene Wohlergehen und den eigenen Nutzen am besten fördert“ (ebd.), wobei dieser Eigennutz gerade nicht der neoliberale Ellbogenmensch ist, sondern auf einer unsymmetrischen Wechselseitigkeit beruht: „Personen sind auch denjenigen gegenüber zu moralischem Respekt verpflichtet, die über kein Selbstbewußtsein und keinen praktischen Subjektgedanken verfügen“ (Sturma 1997, S. 357). Bei der – auch anthropologischen – Bestimmung dessen, was eine „Person“ ist, tauchen die bereits vorgestellten Topoi wie Distanz, Reflexivität, Bewußtheit des Verhaltens, auch sich selber gegenüber, tauchen also Cassirer und Plessner auf. Insbesondere ist eine zeitliche Perspektive grundlegend, nämlich die eines „vernünftigen Lebensplanes“ (als „Entfaltung von Vernunft und Moralität im Leben einer Person“; ebd., S. 360). Im Hinblick auf das in diesem Text entwickelte Konzept einer Persönlichkeit (das freilich nicht auf eine philosophische Persönlichkeitstheorie hinzielt), liefert die Arbeit von Sturma in ihrem Ergebnis anschlußfähige Aussagen: nämlich die Rehabilitation eines handlungsfähigen Individuums, das sich seiner Verantwortlichkeit sich selbst und anderen gegenüber bewußt ist – und das eben nicht im Hier und Jetzt, sondern perspektivisch, nämlich im Kontext seines ganzen Lebens denkt, fühlt und handelt. Allerdings ist die Arbeit eine philosophische Arbeit, die ihre Ableitungen aus der Diskussion von philosophischen Lehrsystemen gewinnt. Und auch diese bewegen sich im Mainstream der bürgerlichen Philosophie: Die „Person“ von Sturma muß ihre Soziabilität, ihre soziale und historische Eingebundenheit 32 mühsam theoretisch aus einem individualistischen Verständnis von sich selbst entwickeln. Damit steht die Arbeit in der Tradition des „abstrakt isolierten Individuums“, geht also nicht von einer grundsätzlichen Gesellschaftlichkeit des Individuums aus. Und dieser Einzelne, der um seine Persönlichkeit ringt, ist insofern abstrakt, weil sein konkreter Platz in der Gesellschaft und Geschichte gleichgültig für die theoretischen Ableitungen ist. Dies mag kein Vorwurf an einer philosophischen Arbeit sein, allerdings gehen etwa Heller (1978) oder Schmid (1998) hier sehr viel weiter, verlassen damit aber auch das traditionelle philosophische Terrain. Für die Zwecke dieser Arbeit ist daher das Untersuchungsgebiet zu erweitern im Hinblick darauf, wie konkrete gesellschaftliche Rahmenbedingungen bei der Genese der Subjektivität des Einzelnen (oder von Gruppen) wirksam werden oder sogar wirksam von diesen Einzelnen (oder den Gruppen) gestaltet werden können. Nicht unwichtig bei dieser Beziehung Einzelner/Gesellschaft ist zudem die Tatsache, daß selbst die prononciertesten Konzeptionen von Individualität bei den Individuen eine – meist wenig explizierte – gefühlsmäßige Bindung zum Ganzen, zu allen Menschen oder zumindest den Menschen einer engeren „Gemeinschaft“ unterstellen. Kant führt etwa aus diesen Gründen das Konzept des „Gemeinsinns“ an, einer verinnerlichten Präsenz der anderen Menschen, die bei allen persönlichen Entscheidungen immer schon als Kontrollinstanz mitwirken. Dieser Gemeinschaftsbezug findet sich auch als drittes Leitziel der französischen Revolution, als „Brüderlichkeit“ oder – moderner – „Solidarität“ (Bayertz 1998), die heute vielfach benötigt wird, um den Prozeß der Integration, der gesellschaftlichen Kohäsion und Bindung zu erklären. Dies leitet über zu dem aktuellen Streit darüber, was letztlich das Primat hat in Fragen der praktischen Philosophie: der Einzelne oder die Gemeinschaft. Dieses Spannungsverhältnis zwischen Einzelnen und Gemeinschaft kommt in besonderer Weise in dem für unsere Themenstellung hochrelevanten Streit zwischen philosophischem Liberalismus und Kommunitarismus zum Ausdruck (vgl. etwa Honneth 1994, Brumlik/Brunkhorst 1993). Dieser Streit und viele Facetten (Reese-Schäfer 1997): Es geht zum einen um Fragen der Ethik und Moral, insbesondere um Fragen der Normbegründung innerhalb der Politischen und Moralphilosophie; es geht jedoch auch ganz konkret um politisches und moralisch-ethisches Handeln des Einzelnen und der Gemeinschaft, speziell geht es darum, was „soziale Gerechtigkeit“ und was „Sozialstaat“ heute noch bedeuten könnte. Ich kann an dieser Stelle diese inzwischen ausgedehnte Diskussion, die sich mit der philosophischen Arbeit von J. R. Rawls über eine „Theorie der Gerechtigkeit“ seit 1971(hier: 1994) lebhaft entfaltet hat, nicht referieren, 33 sondern will lediglich zum einen das Grundproblem skizzieren, so wie es in unserem Kontext relevant ist, und einen Diskussionsvorschlag präsentieren, der uns im Hinblick auf das Konzept der „Person“ weiterführt. Das Grundthema, um das es geht, ist das bereits oben angesprochene spannungsvolle Verhältnis von Individuum und Gesellschaft. Man muß sich verdeutlichen, daß dieses Verhältnis nicht anders als spannungsvoll sein kann: Denn die Konzepte von Individualität und Individuum, so wie sie in der Renaissance entwickelt wurden, werden in der Folgezeit zum Fundament des philosophischen und politischen Denkens. Mehr und mehr wird dabei die Autonomie, die Selbstgesetzgebung des Einzelnen das zentrale Moment der Freiheit, wobei dies notwendig kollidieren muß mit der ebenfalls seit dieser Zeit erarbeiteten Wissenschaft von der Naturgesetzlichkeit, also der Erkenntnis der Notwendigkeit. Der Behelf von Descartes, Natur und Geist – also das „Reich der Notwendigkeit“ und das „Reich der Freiheit“ – zu trennen, hilft nur begrenzt weiter, da der Mensch offensichtlich beiden Reichen angehört. Die Wiederentdeckung der Antike, so wie sie der Renaissance-Humanismus betreibt, hilft dabei ebenfalls nur begrenzt weiter. Zwar ist die Frage nach dem „guten Leben“, ist also die ethisch-moralische Grundfrage nach dem individuellen und gemeinschaftlichen Handeln seit Sokrates der Kern des Philosophierens. Auch denken Platon und Aristoteles intensiv und systematisch über geeignete Formen des Gemeinwesens nach, in denen sich der freie Polisbürger entfalten kann. Doch realisiert sich „Freiheit“ hier immer als selbstverständliches Einfügen in die Polis, ist also individuell „gutes Leben“ immer dasjenige Leben, das sich verantwortungsvoll um die Polis kümmert und das entsprechend soziale und politische Tugenden mit individuellen Glücksansprüchen vermittelt. Man muß sich bloß einmal die Nikomachische Ethik des Aristoteles anschauen, in der er seine Tugendlehre entfaltet. Er dehnt zum einen die – ohnehin schon auf die Gemeinschaft bezogenen – vier Kardinaltugenden (Weisheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit, Besonnenheit) erheblich aus und verhandelt seitenlang eine Auflistung von Gegensatzpaaren menschlicher Dispositionen, bei denen er eine optimal sozialverträgliche Mitte sucht (Beispiele: Lust versus Unlust – Mäßigkeit; Geiz versus Verschwendung – Freigebigkeit; Ehre versus Schande – Hochsinn etc.). Die Freiheit des Polismenschen war das tugendhafte Leben in der Polis, wobei allerdings die in der Frühzeit des Griechentums noch vorhandene Selbstverständlichkeit der Unterordnung des Einzelnen unter das Ganze nunmehr so zum Problem wird, daß sich seit Sokrates die Philosophen verstärkt um die Frage bemühen, wie sichergestellt werden kann, daß der Einzelne freiwillig das tut, was er in bezug auf das Ganze tun soll. Erst die beginnende Neuzeit macht den Einzelnen als zunächst bindungsloses Atom denkbar, für das man sich daher überlegen muß, wie der Zusammenhalt 34 vieler Einzelner erklärt werden kann. Und dies geht nicht ohne Abstriche an der Vorstellung einer totalen Willens- und Handlungsfreiheit. Die aktuelle Diskussion zwischen Liberalismus und Kommunitarismus behandelt eben dieses Thema: Geht man, so der Liberalismus, von unabhängigen Individuen aus, bei denen einsichtige allgemeingültige Regeln des sozialen Zusammenschlusses entwickelt und begründet werden müssen? Oder ist, so der Kommunitarismus, nicht vielmehr die begrenzte Gemeinschaft das Vorgängige, das der Einzelne immer schon findet, so daß er innerhalb dieser normativen Vorgaben seine Freiheitlichkeit entfalten muß. Hier also der Einzelne mit seiner individuellen Suche nach dem Guten (als Frage einer individuumsbezogenen Ethik), dort die „Sittlichkeit“, das Netz gemeinschaftlicher Bräuche und Normen, bei denen es um das normentsprechende Handeln des Einzelnen, also um das Richtige, geht. Dieser Dualismus in der Moralphilosophie, nämlich die Trennung der Person mit ihrer Binnensteuerung ihres Wollens, das autonome Steuern ihres Handelns, das an inneren Maßstäben gemessen wird und für das man selber unmittelbar Verantwortung übernimmt, auf der einen Seite, und das Einfügen in ein System von äußeren Gesetzen des Sollens, die man bei Strafe befolgen muß, auf der anderen Seite, wurde spätestens bei Kant zementiert. Wie ist dieser Gegensatz von Subjektivem und Objektivem zu überwinden? Man erinnere sich daran, daß dieser Gegensatz – wenngleich aus notwendigen systematischen Gründen – in der Neuzeit konstruiert worden ist, quasi als notwendiger Preis, der für die Erfindung des autonomen Individuums zu zahlen war. Eine – auch philosophische – Lösung dieses Hiatus wird heute darin gesehen, daß sowohl „der Einzelne“ als auch „die Gesellschaft“ plural und komplex verstanden werden. Was heißt dies? Der Mensch handelt zwar stets als Ganzheit. Doch lassen sich verschiedene Dimensionen des Personseins ebenso unterscheiden, wie es verschiedene Dimensionen von „Gesellschaft“ zu unterscheiden gilt. In jedem Augenblick bezieht sich daher der Einzelne zwar auf das Soziale, da jede individuelle Lebensäußerung mit Prozessen der sozialen Anerkennung verbunden ist. Aber diese sozialen Bezüge geschehen innerhalb bestimmter Dimensionen mit je unterschiedlichen Rationalitäten, Zielen, Regeln. Die Person, so Forst (1994), ist daher auszudifferenzieren in eine ethische Person, der es um personale Selbstverwirklichung geht, Rechtsperson, die persönliche Handlungsfreiheit genießen will, moralische Person, für die moralische Normen gelten, und in einen Staatsbürger, der politische Mitwirkung verlangt. 35 Es geht also entsprechend um eine jeweils unterscheidbare ethische, rechtlichpersönliche, moralische und politische Autonomie, mit denen entsprechende gesellschaftliche Anerkennungsverhältnisse korrespondieren. Wichtig ist nun der Gedanke, daß diese „Kontexte“ (Forst 1994) oder „Sphären der Gerechtigkeit“ (Walzer 1992) je eigene Konzepte von Gerechtigkeit entfalten. Im Hinblick auf stattfindende Integrationsprozesse kann dieser Gedanke ergänzt werden durch Studien von Peters (1993), der aus der Sicht der Gesellschaft unterschiedliche Modi der Integration unterscheidet, die jeweils verschiedene Anforderungen an Strenge und Homogenität haben. Die politische und rechtliche Integration der Person läßt in modernen Verfassungsstaaten keinen Spielraum: Alle müssen formell gleiche Rechte und Beteiligungsmöglichkeiten haben. In ökonomischer Hinsicht sind verschiedene Grade an Güterausstattung möglich, wobei hier die entscheidende Frage ist, welche Ungleichverteilung des Reichtums die Bevölkerung nicht mehr akzeptiert, sie als „ungerecht“ empfindet und dem politischen und ökonomischen System daher irgendwann die Legitimation entzieht. In Prozessen der kulturellen Integration ist Pluralität nicht bloß möglich, sondern notwendig. Hier geht es darum, die Vielfalt von Kulturen zu akzeptieren, sich in dieser Vielfalt nicht zu verlieren, vielleicht sogar – entsprechend dem UNO-Slogan „Celebrate the Diversity“ – diese Vielfalt als Reichtum zu genießen. Es wird sich zeigen, inwieweit dieses philosophische Angebot eines pluralen Konzeptes von „Person“ und „Gesellschaft“ im folgenden nutzbar gemacht werden kann. Es ist dazu zunächst zu thematisieren, daß all diese Prozesse der Persongenese und Integration handelnd geschehen. 2.2 Tätigkeit und Entwicklung Daß der Mensch nur handelnd und tätig sein Leben bewältigen kann, wird hier als methodischer Schlüssel zum Verstehen der historischen und systematischen Zusammenhänge bei der Entwicklung der Persönlichkeit genommen (vgl. Fuchs 1999). Die Kategorie der gegenständlichen Tätigkeit soll daher ein Stück weit systematisch entfaltet werden. (An Bezugsautoren für eine derartige Herangehensweise lassen sich auf der hier benötigten allgemeinen Ebene so unterschiedliche Personen wie Holzkamp (1983), Arendt (1960) und Kwant (1964) angeben; vgl. auch die Ausführungen zur Arbeit in 6.1). In jeder Tätigkeitsform sind als „einfache Strukturmomente“ Subjekt, Mittel und Objekt unterscheidbar. Berücksichtigt man ferner die Orientierung an einem Tätigkeitsziel sowie die Tatsache der gesellschaftlichen Geformtheit der jeweiligen Strukturmomente, so entsteht ein methodisches Instrumentarium, das 36 man – auch wenn man nicht davon überzeugt ist, daß „Tätigkeit“ bereits eine Theoretisierung des untersuchten Sachverhaltes darstellt – zumindest in seinen heuristischen Potenzen ausloten kann. Zugleich mit der Einführung des Tätigkeitsbegriffs sind weitere Begriffe „gesetzt“. Tätigkeit als zielorientiertes, mittelverwendendes und sozial geformtes menschliches Handeln setzt zum einen eine bestimmte Handlungskompetenz voraus, die sich in Handlungsvollzug erweitert. Diese Erweiterung von Handlungskompetenzen macht den Handlungsvollzug zu einem Entwicklungsprozeß. „Entwicklung“ ist daher eine unmittelbar mit „Tätigkeit“ verbundene Kategorie (eben weil aktuale Tätigkeiten mit aktualen Entwicklungen verbunden sind). Das Ziel der Tätigkeit ist somit mit einem bestimmen Entwicklungsziel verbunden (wenngleich beide nicht miteinander identisch sind). Realisiert werden komplexere Ziele durch konkrete Aufgabenstellungen. „Aufgaben“ konkretisieren das Intentionale des Tätigkeitsvorhabens. Sie sind bestimmt durch überschau- und realisierbare Ergebnisse auf der Grundlage vorhandener oder beschaffbarer Mittel. Aufgaben unter der Perspektive der Entwicklung (als ein Aspekt des Tätigkeitsvollzuges) zu sehen, führt zu ihrer Bestimmung als „Entwicklungsaufgabe“. „Entwicklungsaufgaben“ sind also solche herausfordernde konkrete Zielstellungen, die Tätigkeitsprozesse organisieren und die im Hinblick auf die Entwicklung von Handlungskompetenz ausgewählt worden sind (im Anschluß an Havinghurst; vgl. Montada in Oerter/Montada 1995, S. 66f; s. auch Abschnitt 3.2). Bisher nur implizit gebliebener Grundgedanke bei den Überlegungen zu Tätigkeit, Entwicklung und Aufgabe war die Tatsache, daß durch die Tätigkeit noch nicht vorliegende, jedoch realistisch erreichbare Zustandsformen von Gegenständen, Personen, Beziehungen und Prozessen angestrebt werden. Es besteht also ein Widerspruch zwischen aktual bereits Vorhandenem und potentiell bloß Möglichem, das bislang erst antizipiert wird. Die Kategorie des „Widerspruchs“ muß daher das bisher entwickelte System notwendiger Kategorien ergänzen. Tätigkeit entwickelt jedoch nicht nur die Handlungskompetenzen (offensichtlich ist hiermit das einfache Strukturmoment „Subjekt“ angesprochen), sondern wesentlich im Tätigkeitsprozeß ist ebenso die Tatsache der Vergegenständlichung menschlicher Wesenskräfte. Der Mensch erfüllt die gestellten Aufgaben, indem er Gegenstände, Prozesse und Beziehungen entsprechend seinen produktiven Fähigkeiten gestaltet (und diese – wie gesehen – dabei weiterentwickelt). Durch diesen Tätigkeits- und Gestaltungsprozeß entsteht das oftmals beschriebene soziale Gedächtnis, da die ziel- und zweckorientierte Gestaltung eben auch Vergegenständlichung von Handlungskompetenzen ist. Es entsteht 37 eine für den Lebensvollzug bedeutungsvolle Umwelt: Es wird im Tätigkeitsprozeß „Bedeutung“ produziert (wobei im Prozeß bereits früher gestaltete „bedeutungsvolle“ Mittel verwendet werden). Neben „Tätigkeit“ und „Entwicklung“ tritt als gleichberechtigte Kategorie daher die den Inhaltsbezug einholende Kategorie der „Bedeutung“. Schematisch dargestellt sieht das bislang entwickelte Kategoriengerüst aus wie folgt: Abb. 1: Dimensionen von „Tätigkeit“ – 1 Entwicklung Tätigkeit (Subjekt-Mittel-Objekt) Widerspruch Bedeutung Bei diesem Schema ist vor allem die Interdependenz aller angeführten Kategorien zu berücksichtigen; jede einzelne setzt die anderen voraus und bestimmt und beeinflußt sie wiederum. Es ist ferner zu berücksichtigen, daß jede einzelne Dimension wiederum für ein komplexes, vielfältig gegliedertes Geschehen steht. So werden bei „Tätigkeit“ die einfachen Strukturmomente Subjekt, Objekt und Mittel unterschieden. Diese drei Momente stehen auch in einem sich wechselseitig bestimmenden Zusammenhang, der schematisch wie folgt angedeutet werden kann: Abb. 2: Dimensionen von „Tätigkeit“ – 2 Widerspruch Mittel Subjekt Entwicklung 38 Objekt Bedeutung Um die angeführte Interdependenz etwas zu konkretisieren, lassen sich (zunächst kombinatorisch) die folgenden Fragen nach Implikationszusammenhängen stellen, nämlich nach der gegenständlichen oder medialen Bestimmung und Konstitution des Subjekts, etwa – da es sich um soziale Subjekte handelt – der sozialen Form des Subjekts, medialen oder sozialen Konstitution des Inhalts sozialen oder gegenstandsbezogenen Konstitution der Medien. Die folgende Abb. 3 stellt die möglichen Beeinflussungs-Kombinationen in einer Übersicht dar und gibt einige Beispiele für Ergebnisse der wechselseitigen Beeinflussung. Wesentlich bei der Untersuchung konkreter Tätigkeitsfelder ist neben der Interdependenz zugleich die Berücksichtigung der relativen Autonomie jeder der Komponenten. Dies heißt insbesondere, daß neben der Beeinflussung durch die jeweils anderen Strukturmomente im interdependenten Zusammenhang auch eine Eigengesetzlichkeit und Eigendynamik berücksichtigt werden muß. „Entwicklung“ als relevante Kategorie einer Theorie der Persönlichkeit zu postulieren, dürfte unmittelbar einsichtig sein, da die wesentlichen (pädagogischen) Begriffe wie „Erziehung“ und „Bildung“ Prozesse, Vorgänge und Abläufe bezeichnen, die die Entwicklung von Fähigkeiten, Fertigkeiten, Kenntnissen, Einstellungen etc. zum Ziel haben. Die Dialektik als allgemeinste Theorie der Entwicklung lehrt, nach Widersprüchen als Ursache für Entwicklungsprozesse zu fahnden. Wir werden in dieser Untersuchung mit verschiedenen Formen von Widersprüchen zu tun haben. Insbesondere sind zu nennen: Widersprüche, die durch die Herausforderung durch geeignete Entwicklungsaufgaben konstituiert werden, sowie Widersprüche, die die gesellschaftliche Geformtheit des Tätigkeitsprozesses betreffen. Insbesondere bei der letzten Klasse von Widersprüchen wird an entsprechender Stelle nach der Erscheinungsform der erkannten Widersprüche zu fragen sein. Gesellschaftliche Grundwidersprüche haben dabei – je nach Bereich – unterschiedliche Erscheinungsformen. Individuelle Entwicklung wird also zunächst als individuelle Verarbeitung von Widersprüchen erklärt, wobei der jeweilige gesellschaftliche Bereich, in dem sich das Individuum befindet, unterschiedliche Formen der Verarbeitung von Widersprüchen (und dann auch abhängig von ihrer je vorfindlichen Erscheinungsform) anbietet. 39 Von Marx stammt die Erkenntnis, daß in der Anatomie des Menschen der Schlüssel zum Verständnis der Anatomie des Affen stecke und nicht umgekehrt. Weniger bildhaft ausgedrückt bedeutet dies, daß erst das Entwicklungsergebnis den Maßstab dafür liefert, frühere Entwicklungsetappen in ihrer Bedeutung für das in Rede stehende Problem beurteilen und verstehen zu können. Auf das Problem der „Jugend“ angewandt heißt dies etwa, daß breite Bestandsaufnahmen über Artikulationsformen Jugendlicher, der Formen ihres Protestes oder ihrer Verweigerung, daß also empirisch beschreibendes Vorgehen wenig an Erkenntnissen einbringt, wenn nicht zugleich die jeweiligen Feststellungen in ihrer Bedeutung für die Entwicklung der Jugendlichen bewertet werden. Hinzu kommt außerdem das Problem, daß selbst „wertfreie“ Bestandsaufnahmen implizit theoretische Begriffe sowie anthropologische Grundannahmen enthalten (vgl. hierzu vorbildlich Hurrelmann/Ulich 1995). Als Folge aus diesen Überlegungen ergibt sich die Notwendigkeit, eine genaue und begründete Vorstellung über eine „erfolgreiche“ individuelle Entwicklung, also eine begründete und abgeleitete Zielvorstellung für den Prozeß der Persönlichkeitsbildung zu entwickeln. Eine solche Überlegung ist keineswegs neu. Vielmehr gehört die Formulierung von Bildungs- und Persönlichkeitsidealen geradezu zur klassischen deutschen Tradition. Das Problem, das sich stellt, besteht nun darin, nicht bloß auf spekulative Weise Menschenbilder zu konstruieren, sondern begründet die Entwicklungsmöglichkeiten des Menschen darzustellen. Dieser erste Untersuchungsschritt liefert mit der Entwicklung eines begründeten „Bildungs- und Persönlichkeitsideals“ zugleich die Kategorien, die die Bewertung der empirischen Erfassung ermöglichen. Natürlich muß diese empirische Bestandsaufnahme nicht völlig neu beginnen. Vielmehr kann hier auf die zahlreichen Untersuchungen, die mit unterschiedlichem wissenschaftlichem und theoretischem Anspruch bereits vorliegen, nach einer Re-Interpretation – nach Maßgabe der verwendeten Kategorien – zurückgegriffen werden. Diese aktual empirische Phase wirkt auf die Theorienbildung nun auch insoweit zurück, als sie zu einer Differenzierung und Konkretisierung der auf anderem Wege gewonnenen zentralen Kategorien zur Erfassung der Individuation/Vergesellschaftung führt. Der Vergleich der prinzipiell vorhandenen menschlichen Entwicklungsmöglichkeiten mit den Chancen, die gesellschaftlich den einzelnen Jugendlichen real angeboten werden, wird dabei zum kritischen Maßstab zur Bewertung gesellschaftlicher Verhältnisse. (Vgl. für ein solches Vorgehen die Untersuchungen der Arbeitsgruppe von J. Held; z. B. Held 1989). Die Sichtung anthropologischer Erkenntnisse (Fuchs 1999) läßt die folgende Annahme über ein mögliches allgemeines Ziel der Persönlichkeitsentwicklung als begründet erscheinen: 40 Die Entwicklung der Gattung Mensch ist aufs engste verbunden mit der Herausbildung sowohl der Fähigkeit zu als auch des Bedürfnisses nach einer immer weitergehenden Verfügung über die eigenen Lebensbedingungen. An die Stelle des Ausgeliefertseins unter unkontrollierte Umstände, an die Stelle des bloßen Reagierens auf aktuale organismische Bedürfnisse oder äußere Umstände tritt zunehmend die Beherrschung der Umstände und Lebensbedingungen, tritt die Vorsorge für erst antizipierte Bedürfnisse. Im Zuge der Realisierung dieses Entwicklungszuges – als dessen Grundlage und Ergebnis – greift der Mensch gestaltend in seine Umgebung ein. Der Gedanke der Herrschaft über seine Lebensumstände wird in der klassischen deutschen Philosophie mit der Kategorie des „Subjekts“ erfaßt. Ich übernehme diesen Begriff und kann als allgemeines Entwicklungsziel der Persönlichkeit die Entwicklung von „Subjektivität“ als Entwicklung der Möglichkeit, seine Lebensbedingungen zu beherrschen, formulieren. Beherrschung von Lebensbedingungen geschieht durch menschliche Tätigkeit, durch Handeln. Handlungsfähigkeit und -bereitschaft auf der Grundlage erkannter Handlungsmöglichkeiten, auf der Grundlage der Analyse von Hindernissen, auf der Basis einer gemeinschaftlich koordinierten Strategie ist die Grundlage für die Subjektentwicklung im oben vorgestellten Sinn. Handeln kann geschehen im Rahmen gegebener Handlungsmöglichkeiten. In diesem Fall soll von restringierter Handlungsfähigkeit gesprochen werden. Ist das Ziel jedoch, das bestehende Arsenal von Handlungsmöglichkeiten zu erweitern, dann soll dies „verallgemeinerte Handlungsfähigkeit“ genannt werden (vgl. Holzkamp 1983). Es liegt auf der Hand, daß die Entwicklung von Subjektivität sich nicht auf das bloße Agieren im Rahmen je individuell zugänglicher und gesellschaftlich zugestandener Handlungsmöglichkeiten beschränken kann. Das Bedürfnis zu dieser weitergehenden Einflußnahme darf als „Naturerbe“ prinzipiell unterstellt werden: Es gehört zu den (von HolzkampOsterkamp 1975/76 genannten) „produktiven Bedürfnissen“. Trotz der quasi naturhaft angelegten produktiven Bedürftigkeit an ständig wachsender Einflußnahme auf die Lebensbedingungen muß davon ausgegangen werden, daß sich Menschen nicht stets kontrollerweiternd verhalten, sondern daß sie auch bewußt auf eine weitergehende Kontrolle ihrer Existenzbedingungen verzichten können. Wesentlich hierbei ist, daß dieser Verzicht individuell durchaus begründet erfolgen kann. Als zentraler Widerspruch bei der Erfassung individueller Existenz in einer Gesellschaft, die die umfassende (historisch-konkret mögliche) Kontrolle über Lebensbedingungen versagt – und die zudem diesen Verzicht durch geeignete Verarbeitungs- und Denkformen als begründet, sinnvoll und „normal“ nahelegt –, ist der Widerspruch zwischen einem quasi naturhaft vorhandenen 41 Entwicklungsbedarf in Richtigkeit „Subjektivität“ und der gesellschaftlich gegebenen Beschränkung von Entwicklungsmöglichkeiten anzusehen. Dieser Widerspruch liefert keine bloß „moralische“ Kritik an der entwicklungshemmenden Gesellschaft, sondern konstatiert zunächst nüchtern entwicklungsbedingte formationsspezifische Rückständigkeiten: Die notwendigen Mittel für eine umfassende Kontrolle der natürlichen und gesellschaftlichen Existenz stehen selbst heute noch in keiner Gesellschaft zur Verfügung. So gesehen ist dieser Widerspruch „normal“ und bildet eine stimulierende Triebkraft für die weitere Entwicklung. 42 Abb. 3: Systematische Erfassung aller Möglichkeiten einer wechselseitigen Konstitution der „einfachen“ Momente 43 „Tätigkeit“ und „Handlung“ sind also zentrale Kategorien dieser Arbeit. In einer ersten Annäherung mag man davon ausgehen, daß die Extensionen der Begriffe (also der Umfang der von ihnen erfaßten Gegebenheiten) „Arbeit“ „gegenständliche Tätigkeit“ „Handeln“ „Interaktion“/“Kommunikation“ in einer Teilmengenbeziehung zueinander stehen, da bei dem jeweils nächstfolgenden Begriff einengende Bestimmungen wegfallen, so daß der Anwendungsbereich jeweils größer wird. Der engste Begriff ist somit „Arbeit“, die weitesten Begriffe sind „Interaktion/Kommunikation“ (vgl. die etwas andere Systematik bei Arendt 1960). Das dahintersteckende Menschenbild ist also die Vorstellung eines aneignenden und vergegenständlichenden, sich mit seinen Interessen aktiv in gesellschaftliche Zusammenhänge einmischenden Subjekts. In der „Angebotspalette“ von heute vorliegenden Subjektmodellen dürfte daher Hurrelmanns Konzept eines „produktiv realitätsverarbeitenden Subjektes“ (Hurrelmann/Ulich 1995, S. 6ff.) die größte Nähe zu den hier formulierten Vorstellungen haben. 2.3 Persönlichkeitstheoretische Konsequenzen Die Frage nach „persönlichkeitstheoretischen Konsequenzen“ des hier vorgestellten Durchgangs durch philosophische Annäherungsweisen an das „Ich“, die „Person“ etc. betrifft nicht bloß den Transfer von philosophischen Konzepten in andere Theoriefelder, sondern ist zudem eng verbunden mit dem Gebrauch von theoretischen Begriffen in der Praxis. Bevor ich daher im folgenden auf diese Ebene der Anwendungen philosophischer Konzepte zu sprechen komme, will ich kurz auf den Zusammenhang einer immanenten bzw. sozialgeschichtlichen Betrachtungsweise eingehen. Philosophiegeschichtliche Betrachtungen eines Problems – hier: die Entstehung und Genese von Ichkonzepten – neigen dazu, rein philosophieimmanent die Abfolge von Lehrmeinungen und Systemen zu studieren. Ich benenne einige Probleme, die zunehmend als solche erkannt wurden und an denen sich die Philosophen abarbeiteten: die Entstehung oder Erfindung des Individuums und seine Konzeptionalisierung als Atom oder Monade, die Erkenntnis der Gestaltbarkeit und Gestaltungsnotwendigkeit des eigenen Lebens oder der Geschichte zusammen mit der Einsicht in die eigene Verantwortlichkeit, 44 die Entwicklung des Gedankens der Relationalität und der Operativität als Ersatz für die Annahme einer statischen Ontologie des Seins, der Widerspruch zwischen Freiheit und Notwendigkeit. All diese Probleme lassen sich philosophiegeschichtlich studieren. Dies genügt jedoch für die Zwecke einer Persönlichkeitstheorie in pragmatischer Absicht nicht. Bereits Hegel sagte, daß (eine konkrete) Philosophie ihre (jeweilige) Zeit in Gedanken gefaßt sei und benennt damit die Kulturfunktion der Deutung als philosophische Aufgabe. Diese stellt sich jedoch konkret-historisch, so daß der Weg für ein sozialgeschichtliches Verständnis von Philosophie freigelegt ist. Philosophie beginnt jedoch nicht erst nach Abschluß des praktischen Geschehens, so wie – ebenfalls Hegel zufolge – die Eule der Minerva ihren Flug erst in der Dämmerung beginnt. Philosophische Konzepte sind immer wieder auch im Alltag wirkungsmächtig, so daß Philosophie neben der Deutungsfunktion eine Gestaltungsfunktion hat. Es ergibt sich somit eine komplexes Forschungsprogramm, das hier nicht realisiert werden kann, auf das jedoch hingewiesen werden muß: Die Analyse eines komplexen Wirkungszusammenhangs von realem Geschehen in der gesellschaftlichen Praxis, und dies auf allen Ebenen der Gesellschaft: der Wirtschaft, der Politik, des Sozialen, des Kulturellen und auch des Ideellen, und der immanenten Entwicklung von Fachwissenschaften und Philosophie, die jedoch immer wieder aus ihrer immanenten Logik heraus genommen und als Lieferanten für gesellschaftliche Deutungen für die Konstruktion von Selbstverständigungen der Gesellschaft oder einzelner Gruppen verwendet werden. Damit entsteht ein enges Beziehungsgeflecht und eine Dynamik, und dies insbesondere bei solchen Konzepten, die sehr eng mit Prozessen der politischen Hegemonie in der Gesellschaft verbunden sind (und für deren Analyse das Konzept des „Feldes“ von Bourdieu 1999 angemessen ist). Dies ist offensichtlich bei der Problemstellung dieses Textes der Fall. Denn Konzepte der Person sind zum einen innerhalb der Wissenschaften und der Philosophie miteinander verbunden; hier sind sie sogar Fokus der neu entstehenden Humanund Sozialwissenschaften wie Pädagogik und Psychologie im 18. Jahrhundert bzw. der Soziologie, der Geschichts- und der „Geisteswissenschaften“ im 19. Jahrhundert. Das „Ich“ oder das „Selbst“ sind zentrale Themen der Künste, die sich als Sachwalterinnen des Ich, der Individualität und der Subjektivität formieren. Diese Konzepte stehen zudem mitten im Zentrum des Emanzipationskampfes des Bürgertums, wobei dieser Kampf um Hegemonie 45 ökonomisch, politisch, sozial und kulturell ausgetragen wird – und dies nicht nur gegenüber anderen gesellschaftlichen Gruppen (wie etwa dem Adel oder dem Klerus), sondern mehr und mehr auch als Binnenauseinandersetzung verschiedener Gruppierungen innerhalb des sich ausdifferenzierenden Bürgertums. Mit dieser gesellschaftlichen Verortung der Thematisierung des „Ich“ im Kontext der Entwicklung des Bürgertums ist jedoch noch wenig gewonnen. Denn offenbar ist auch der (bürgerlichen) Gesellschaft der Bundesrepublik das „Bürgertum“ ein großes Forschungsproblem. Dies zeigt sich etwa daran, daß es immer wieder ambitionierte Forschungsschwerpunkte zu dieser Frage gegeben hat, die sich mit der Sozial- und Begriffsgeschichte rund um das Bürgertum befaßten (vgl. Kocka 1988, Koselleck 1990). Immerhin wird vielleicht ein in der Einleitung angesprochenes Ziel somit deutlich: Sowohl auf der Ebene der Praxis der Menschen als auch im Hinblick auf theoretische und ideologische Verarbeitungen dieser Praxis muß von einer starken Geschichtlichkeit und Gesellschaftlichkeit der philosophischen Konzepte von „Person“, „Ich“ etc. ausgegangen werden. Damit stellt sich die Aufgabe, die historische und politische Geformtheit oder Aufgeladenheit der philosophischen Kategorien zumindest zu erkennen. Dies schließt die Annahme eines auch ideologischen Charakters dieser Kategorien ausdrücklich ein. So groß dieses Problem nun auch erscheinen mag – denn immerhin ist davon auszugehen, daß auch die notwendigen Erkenntnismittel, die man zum Nachweis der gesellschaftlich- historischen Überformung des möglichen „wahren“ Erkenntnisgehaltes benötigt, ebenfalls unter Ideologieverdacht stehen –: neu ist dieses Problem nicht. In der Wissenschaftsgeschichte kennt man etwa ebenfalls die Frage danach, ob die jeweilige „wissenschaftliche Erkenntnis“ der Ideologie der Zeit oder einem unverfälschten Gegenstandsbezug geschuldet ist. Die Geschichtswissenschaft beschäftigt sich (im Anschluß an R. Koselleck) mit „historischer Semantik“ und dem Zusammenhang von Sozial- und Begriffsgeschichte. Und nicht zuletzt liefert die Soziologie der kulturellsymbolischen Formen von Bourdieu – und speziell seine Analyse der Symbolwerkzeuge Kunst (Bourdieu 1999) und Sprache (Bourdieu 1990) – ein nützliches Instrumentarium, die Macht der Symbole in ihren verschiedenen Dimensionen entschlüsseln zu helfen. Auf all dies kann hier nur hingewiesen werden (vgl. Fuchs 2000), auch wenn der Zusammenhang von Wirtschafts-, Sozial-, Begriffs- und politischer Geschichte im gesamten Text erkennbar sein sollte und in Kapitel 5 zudem ein Stück Realgeschichte – parallel zur hier im Vordergrund stehenden Begriffsgeschichte – nachgeliefert wird (für die Zeit der Aufklärung vgl. etwa Fuchs 1984 – Trapp). Hier also einige Hinweise dazu, welche Rolle die besprochenen philosophischen Konzepte des „Ich“, der „Person“ etc. in der Praxis gespielt haben beziehungsweise welche ideologischen Überformungen und Aufladungen bei ihrem Gebrauch zu beachten sind. 46 1. Zuerst ist darauf hinzuweisen, daß eine sprachliche Form und Begrifflichkeit zu schaffen war, mit der die in Kunst, Politik, Alltag, Einzelwissenschaften und Wirtschaftsleben bedeutsam werdenden Tatbestände der Individualität formuliert werden konnten. Die Entwicklung von geeigneten sprachlichen Formen ist dabei eine außerordentliche Kulturleistung, da vorhandene (lateinische) sprachliche Formen durch die mittelalterliche Theologie und Philosophie nahezu hoffnungslos semantisch beladen waren, so daß die neuen Gedanken sich auf oft ungeeignete sprachliche Mittel stützen mußten (siehe hierzu auch 5.2). Die Bibelübersetzung von Luther, das Wirken einzelner Barockschriftsteller (z. B. Grimmelshausen) und schließlich die – auch sprachlich innovative – Genieleistung von Kant stellten erst das sprachliche Werkzeug bereit, um die Reflexionsprozesse zum Ich adäquat erfassen zu können. Es ist dabei daran zu erinnern, daß auch bei dieser Entwicklung Deutschland eine „verspätete Nation“ (Plessner) ist. Denn die klassischen Perioden der nationalen Sprachformungen geschahen etwa in Frankreich (Corneille, Racine, Molière), England (Shakespeare), Italien (Petrarca, Boccacio, Dante) oder Spanien (Cervantes) erheblich früher als im Deutschland der Weimarer Klassik. Daß die Kantsche „Kopernikanische Wende“ in der Philosophie speziell das Thema der Personalität und Subjektivität betraf, mag man etwa daran sehen, daß die Bedeutung des Subjektbegriffs (subiacere = unterwerfen) geradezu umgedreht wurde (das Subjekt nunmehr als das Bestimmende; vgl. Lektorski 1969). Die für die Praxis entscheidende Bedeutungsaufladung von Subjektivität und Individualität – und diese zugleich in Verbindung mit den anderen Zentralbegriffen, die in diesem semantischen (und politischen) Feld eine Rolle spielen, nämlich Kunst, Kultur, Geschichte und Bildung – läßt sich an der Person Wilhelm von Humboldts festmachen. Er ist der Cheftheoretiker des entstehenden „Bildungsbürgertums“, also von jenem Teil des Bürgertums, das nicht durch Besitz, sondern durch Bildungstitel seinen Platz in der Gesellschaft einfordert (Koselleck 1990, Lepsius 1992). Humboldt ist eng befreundet mit Schiller, dessen „Briefe zur ästhetischen Erziehung“ die Kantsche Philosophie der Ästhetik (die „Kritik der Urteilskraft“, 1790) zu einer politischen Konzeption einer gesellschaftlichen Reform umformulieren, bei der Kunst als Mittel der Erziehung die angestrebten humanitären gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse herstellen soll. Humboldt wiederum ist Sprachtheoretiker und philosophischer Schriftsteller, ist eng verbunden mit der Entwicklung der Künste. Er ist Diplomat und Politiker, der seine Bildungstheorie (den später sogenannten Neuhumanismus) an einflußreicher Stelle in Preußen umzusetzen versucht: „Der wahre Zweck des Menschen“, so Humboldt (1971, Bd. 2, S. 99 f.), „ist die höchste und proportionierlichste Bildung seiner Kräfte zu einem Ganzen. Zu 47 dieser Bildung ist Freiheit die erste und unerläßliche Bedingung. Allein außer der Freiheit erfordert die Entwicklung der menschlichen Kräfte noch etwas anderes, obgleich mit der Freiheit eng verbundenes, Mannigfaltigkeiten der Situationen“. Bei Humboldt finden sich – für bildungstheoretische und -politische Zwecke heruntergebrochen – alle Zuschreibungen, mit denen sich bis heute das heroische (bürgerliche) Individuum als Subjekt seiner Verhältnisse, als autonomer Gestalter seines Lebens, als politischer Kern des Gemeinwesens selbst beschreibt. Und entscheidendes Mittel dieser sozialen und kulturellen Konstruktion ist die autonome Kunst. Bildung wird „zur fortschreitenden Befreiung des Menschen zu sich selbst“ (Heydorn 1980, Bd. 3, S. 301). Sie ist in erster Linie Entwicklung von Bewußtsein. Sie ist – anders als die fremdgesteuerte „Erziehung“ der Aufklärung – entschieden „Selbstbildung durch Selbsttätigkeit“. Freiheit und Autonomie sind ihre Grundlagen. Und hier erhält eine entsprechend verstandene Kunst – und das entstehende moderne Künstlertum (Ruppert 1998) – seine entscheidende Funktion. Das (Bildungs-)Bürgertum nutzt die beschriebenen philosophischen Konzepte des Selbst, des Subjekts, der Individualität mit erheblicher historischer Berechtigung zur Konstruktion eines Selbstbildes und sieht all diese Dispositionen in Kunst und Künstlertum realisiert: „Der Künstler repräsentiert nunmehr die Erfahrungen und die Wahrnehmungsperspektiven des modernen Individuums, die mit der bürgerlichen Kultur entstanden waren“ (ebd., S. 32). Die Tragfähigkeit dieses – zunächst philosophischen – Deutungsangebotes belegt die Wirkungsgeschichte entsprechender Zuschreibungen zum Zusammenhang von Kunst und kreativer Individualität. Diese gesellschaftliche Wirksamkeit konnte nur durch eine in ihrer Rhetorik sich als gesellschaftsabstinent gerierende Kunst- (und Wissenschafts-)auffassung, also durch eine „autonome Kunst“ geleistet werden. Vermutlich gibt es keinen gesellschaftlich wirkungsvolleren Topos in der Kunstgeschichte als die Rede von der Kunstautonomie (vgl. auch Bourdieu 1999 sowie Fuchs 1998 – Macht). Begriffe haben also nicht nur ihre Geschichte, sie haben auch ihre gesellschaftlichen Wirkungsmöglichkeiten. Für „Bildung“ und „Kultur“ – und die sie konstituierenden Konzepte der Person, der Autonomie und der Individualität – verfolgt Bollenbeck (1994, vgl. auch Engelhardt 1986) diese Wirkungsgeschichte im 19. Jahrhundert. Der Ausgangspunkt war der Liberalismus von Wilhelm von Humboldt, der sich für eine Freiheit gegen den Staat stark macht. Humboldt ist also Denker der bürgerlichen Emanzipation. Doch wahr ist auch dies: „Die Geschichte des Deutungsmusters“ (von „Bildung“ und „Kultur“; M. F.) ist mit dem Schicksal des deutschen Bildungsbürgertums verbunden, mit dem 48 deutschen Eigenweg in die Moderne und einer Modernisierungskrise, mit der das Bildungsbürgertum schließlich anfällig für den Nationalsozialismus wird“ (ebd., S. 25; siehe auch die Studie zu Dilthey in Fuchs 1998 – Macht, 2.3 sowie Groppe 1997). Es sind also durchaus – so Münch 1986 – dieselben Leitwerte („kulturelle Codes“) wie Universalismus, Individualismus, Rationalismus und Aktivismus, die die Moderne in Deutschland wie in anderen vergleichbaren Ländern charakterisieren. Aber es werden diese allgemeinen Prinzipien sehr spezifisch inhaltlich gefüllt: eine starke Rolle des Staates, das kräftige Nachwirken der Innerlichkeit, so wie sie Luther vorgedacht hat, der Vorzug einer Freiheit im Denken statt im (politischen) Handeln. „Bildung“ wird daher zu einer sehr deutschen Antwort auf Problemstellungen, die sich auch in anderen Ländern stellen, in denen jedoch andere Antworten gefunden werden. Damit ist „Bildung“ nur zum Teil eine i. e. S. pädagogische Kategorie, sondern gehört vielmehr in den globalen Kontext der (deutschen) Bewältigung der Modernisierung. 2. Die Interpretation, die ich hier bei der Untersuchung der Wirksamkeit der philosophischen Konzepte verfolge, stützt sich wesentlich auf die Rolle des Bürgertums und seinen Emanzipationskampf, also auf seinen Kampf um politische und kulturelle Hegemonie. Aber gibt es überhaupt dieses „Bürgertum“ als abgrenzbare Klasse oder Gruppe, oder ist es nicht vielmehr – so wie man es insbesondere zum Begriff des „Bildungsbürgertums“ gesagt hat – eine intellektuelle Konstruktion von Historikern? Inzwischen hat es geradezu einen Forschungsboom gegeben (vgl. etwa die Sammelwerke Kocka 1988 oder das Projekt „Bildungsbürgertum im 19. Jahrhundert“, z. B. Koselleck 1990, Engelhardt 1986, Lepsius 1992). Auch die Beziehung zum Adel und zum Arbeitertum – etwa im Hinblick auf die These von deren „Verbürgerlichung“ – wurde untersucht (Kocka 1986). Immerhin nennt man das 19. Jahrhundert das „bürgerliche Jahrhundert“. Zur Präzisierung des Begriffs stütze ich mich auf den Einführungsbeitrag „Bürgertum und bürgerliche Gesellschaft im 19. Jahrhundert“ von Kocka (1988, Bd. 1, S. 11 ff.). Er unterscheidet Bourgeoisie (Wirtschafts- und Besitzbürgertum) und Bildungsbürgertum (Ärzte, Professoren, Rechtsanwälte und die anderen „Freien Berufe“, Gymnasiallehrer etc.) als Kerne des Bürgertums, die jedoch unter fünf Prozent der Bevölkerung ausmachen (ebd., S. 12). Zählt man die Handwerker, die kleinen Selbständigen dazu, also das „Kleinbürgertum“, dann kommt man auf maximal fünfzehn Prozent. Die Zusammensetzung ist – wie gesehen – äußerst heterogen: Selbständige und abhängig Beschäftigte, Menschen aus verschiedenen Wirtschaftssektoren, Branchen, Berufen. Kocka kommt im wesentlichen zu zwei Bestimmungsmerkmalen dieses „Bürgertums“: die gemeinsamen sozialen Gegner, also 49 zunächst Adel und Kirche, gegen die bürgerlichen Werte wie die individuelle Leistung und Selbstbestimmung angeführt werden; „nach unten“ sind es die Bauern und die „unterbürgerlichen Schichten“ (Kaschuba 1990). Das zweite Bestimmungsmerkmal ist die bürgerliche Kultur und die Lebensführung: die methodische und selbständig gestaltete Lebensführung, die Rationalität und Bildung, die emotional begründete Familie, z.T. auch „liberale“ Tugenden wie Toleranz, Konflikt- und Kompromißfähigkeit, Autoritätsskepsis und Freiheitsliebe (ebd., S 27 f.). Diese Begriffsbestimmung ist zweierlei: gerade in der Anfangszeit, auf die sich W. von Humboldt bezieht, erfaßt sie ein Stück gelebter Realität, ist also durchaus Beschreibung einer Praxis; zunehmend wird sie jedoch auch Selbstbeschreibung einer gesellschaftlichen Gruppe und dient der kulturellen und politischen Konstruktion ihrer Identität. Damit wird sie im weiteren Verlauf des 19. Jahrhunderts zunehmend zur Ideologie. Immerhin: Ebenso wie das – ansonsten bekämpfte – Aufklärungsdenken zielten der Liberalismus und der Neuhumanismus auf das Allgemein-Menschliche, verstehen sich also nicht als Konzeptionen, die sich bloß auf die Eigeninteressen einer abgrenzbaren Gruppe beziehen. 3. Zu der Wirkungsgeschichte der hier behandelten Begriffe gehört gerade – wie angedeutet – entschieden der Prozeß ihrer Ideologisierung und ihrer Institutionalisierung. Begriffe, so lehrt Gehlen (1950) und so nutzt Bollenbeck (1994) diese Erkenntnis, haben dann sozialen Bestand, wenn ihre Institutionalisierung gelingt. Es braucht dauerhafte Einrichtungen in der Gesellschaft, die als Sachwalterinnen dieser Begriffe Einfluß gewinnen, für „Bildung“ also etwa das Gymnasium oder die Universität, für die Künste entsprechend die Kultureinrichtungen (vgl. Tenbruck 1990, v. a. Kap. 12: Bürgerliche Kultur). Sind diese erst einmal entstanden, so kann man erwarten, daß sie einiges an ideeller-ideologischer Unterstützungsleistung für ihre Grundbegriffe erbringen. (Zur Institutionalisierung des bürgerlichen Kunstbetriebes vgl. Hein/Schulz 1996). So spricht man von der „historischen Konstruktion des Individualismus“ durch den Universitätsprofessor Burkhardt, der die „Kultur der Renaissance“ als historischen Ort der Hervorbringung dieses für die bürgerliche Welt zentralen Topos modelliert (vgl. Kap. 5): „Er arbeitete Aspekte eines Menschenbildes heraus, die den kulturellen Begriffen, Bedürfnissen und Sehnsüchten seines bürgerlichen Publikums Ausdruck verleihen.“ (Ruppert 1998, S. 258). In besonderer Weise steht der Künstler Modell für das Menschenbild des uomo universale, sowohl in seiner Ungebundenheit, Kreativität und Autonomie, aber auch zunehmend als Gegenpol zum Rationalen der bürgerlichen Welt, der also das Emotionale, das Kultische und Sakrale verkörpert: „Der Künstler verkörperte damit die in der bürgerlichen und zivilisatorischen Rationalität nicht aufgehobenen psychischen Befindlichkeiten und Erfahrungen“ (ebd., S. 284). Von hier aus war es dann zum 50 Künstlermythos, als der sich etwa Wagner stilisierte und wie er in dem verhängnisvollen, aber um die Jahrhundertwende überaus einflußreichen Buch „Der Rembrandtdeutsche“ von Julius Langbehn (zuerst 1890) seinen Höhepunkt erreichte, nicht mehr weit (vgl. auch Groppe 1997). Daß die Realität künstlerischer Existenz dieser Sakralisierung überhaupt nicht entsprach, sondern vielmehr die Künstler um die Konstitution eines eigenen „Feldes“ rangen (Bourdieu 1998, Ruppert 1998), sei hier bloß erwähnt. Allerdings übernehmen sie bereitwillig diese kulturellen Zuschreibungen und kultivieren sie in ihrem Künstlerhabitus. Ruppert liefert hierzu zwei Fallstudien (der Porträtmaler und Münchner „Malerfürst“ Lenbach und der Mitbegründer der abstrakten Malerei Kandinsky), die zwei aufeinanderfolgende Etappen in diesem Prozeß der Individualisierung repräsentieren: „Während Lenbach nach einem ästhetischen Ausdruck für die individuelle Erscheinung den Porträtierten suchte, radikalisierte Kandinsky die Aufgabe des Künstlers, indem er die subjektive Wahrnehmung und die Repräsentation der „Seele“ in einer ästhetischen Grammatik der Abstraktion als Bezugspunkte der Kunst propagierte“ (Ruppert 1998, S. 584). Die Entwicklung dieses Künstlerhabitus, so wie er entfaltet und durch vielfältige Institutionen – etwa die Kunstakademie – verkörpert, verwaltet und „produziert“ wird, ist die konsequente Umsetzung des Prozesses, der Kunst, Bildung und Geschichte zu Religionen erhebt. Nipperdey beschreibt diesen Prozeß eindrucksvoll an der Entwicklung des Theaters, der Literatur, der Musik, der Architektur, des Vereinswesens, der Museen: die „ästhetische Kultur“ verbürgerlicht, kommt also aus den Höfen heraus. Mit ihr stilisiert sich der Bürger, schafft sich selbst als kulturelle Konstruktion – und schafft in der Kunst und ihren Einrichtungen zugleich einen Ersatz für die bedeutungsloser werdende Religion: „Die Kunst hat also einen eigentümlich hohen Rang im Hausstand des bürgerlichen Lebens, jedenfalls so, wie man dieses Lebens – idealisierend – interpretiert sehen möchte. Damit bekommt sie eine (quasi) religiöse Funktion; wir können von der Kunstreligion des Jahrhunderts sprechen. Kunst ist, so sagt man seit der Frühromantik, Gegenstand von „Andacht“ und „Weihe“, Pietät, Verehrung, frommem Gefühl ... . Museen, Theater, Konzertsaal präsentieren sich als Tempel, als Bildungstempel und „ästhetische Kirchen“, das ist ihr Anspruch und ihre Funktion als der sichtbare Ausdruck einer Sakralisierung der Kunst. Der subjektiven Kunstfrömmigkeit entspricht das emphatische Verständnis der Kunst als eines diese Welt transzendierenden Seins, ...; Kunst ist ein Organ und ein Ausdruck des Unendlichen und Göttlichen, des Absoluten, der Tiefe und des Geheimnisses von Ich und Universum ... . Kunst tröstet, versöhnt, erlöst, wird eine Art Heilsbegriff.“ (Nipperdey 1983, S. 540 f.). 51 Es liegt auf der Hand, daß das Bürgertum als Sachwalterin einer so verstandenen Kunst – mit dem entsprechend verstandenen „Künstler“ – sich selber adelt, mit höheren Weihen versieht, also neben seiner ökonomischen Bedeutsamkeit nunmehr auch ideologisch oder spirituell zur relevanten Gruppe in der Bevölkerung werden will. (Zur Vorbereitung dieser Entwicklung in der Romantik vgl. Furet 1998). 4. Betrachten wir also diese „Sattelzeit“ rund um 1800 etwas genauer. Nach dem Renaissance-Humanismus ist es vor allem dieser Jahrhundertwechsel zum 19. Jahrhundert, wo ein philosophischer Zugang zur Person und zur Individualität eine entscheidende praktische und politische Rolle spielt. Hier gehen idealistische Philosophie, politischer Liberalismus und ein Bürgertum, das seinen Anteil an der Steuerung von Gesellschaft und Staat haben will, eine Liaison ein, die – wie erwähnt – in besonderer Weise in W. v. Humboldt ihren theoretischen und politisch-praktischen Wortführer findet. Arena dieses Diskurses und dieser politischen Aktivitäten sind Bildungstheorie und -politik. Und es sind gerade nicht das Aufklärungsdenken und die Aufklärungsphilosophie, die das geeignete theoretisch-ideologische Rüstzeug bereitstellen (vgl. Fuchs 1984 – Trapp; Vierhaus 1972). Die Wirkungszeit der hier entstehenden Bildungsphilosophie ist kurz und lang zugleich: kurz, so Kondylis (1991, S. 54ff), weil auf der Ebene der gesellschaftlichen Realität sehr bald, nachdem das Bürgertum Einfluß im Staat gewonnen und seine Kontrolle über die Kultur ausgedehnt hatte, zwei Entwicklungen dominant wurden, die zwar aus dem Schoße dieser Bürgerlichkeit entstanden, die es jedoch letztlich zerstörten: der Kult moderner Technik mit seiner rasanten Dynamik – auch als Basis der Industriellen Revolution, das Aufkommen eines Hangs zum Mythischen, Zeitlosen, Übersinnlichen, Exotischen als Gegenbewegung gegen den kapitalistischen Materialismus. Lang ist dagegen die Wirkungsdauer dieser Rede über Bildung als Ideologie, in der man weiterhin von „Kunst“, „Kultur“ und „Bildung“ spricht, jedoch aufgrund veränderter Rahmenbedingungen – Durchsetzung des Kapitalismus, der Industriellen Revolution, der Führungsrolle des Bürgertums – in der Praxis immer weniger Interesse daran hat, wirklich die Befreiung aller Menschen zu betreiben (vgl. Bollenbeck 1994). Das Menschenbild des Neuhumanismus entspricht so in der Anfangszeit der „heroischen“ Selbstbeschreibung des Bürgers, der seine eigene Emanzipation noch gut als Emanzipation des Menschen schlechthin verstehen kann. Es ist das schöpferische, freie Individuum, so wie es oben beschrieben wurde, das all seine Anlagen in einem Selbstbildungsprozeß ausbildet. Und Medium dieses 52 Prozesses sind die Künste und Wissenschaften, ist „Kultur“ (vgl. Koselleck in Koselleck 1990, S. 11 ff.). Dieser individuellen Seite der anvisierten (bürgerlichen) Gesellschaft entspricht ein Sozialmodell, das wichtige Dimensionen rechtlich absichert (Grimm: Bürgerlichkeit im Recht; in Kocka 1987). Einige Elemente dieses Paradigmenwechsels: rechtliche Sicherung individueller Freiheit, Übergang von einer Dominanz des öffentlichen und Staatsrechts zum Privatrecht, Stärkung des Individuums als Trägers von Rechten, auch abgesichert durch entsprechende Verfassungen. Es dominiert der Gedanke, daß eine „invisible hand“ (Adam Smith) nicht nur den ökonomischen Markt reguliert, sondern auch gesamtgesellschaftlich dafür sorgt, daß die Durchsetzung von Partikularinteressen durch alle Bürger im Selbstlauf zu einem gesellschaftlichen Optimum („Gemeinwohl“) führt. Damit wird die politische Vermittlung zwischen Einzelnem und Gesellschaft systematisch ausgeblendet – eine verhängnisvolle Denkfigur, die bis zu den „Betrachtungen eines Unpolitischen“ von Thomas Mann im Jahre 1918, also einer Distanz und sogar Verachtung gegenüber der Politik beim Bildungsbürgertum führt. Mit der zentralen Rolle des (bürgerlichen) Individuums wird eine Denkfigur installiert, an die – so Kondylis – die entstehende Massengesellschaft und dann auch die Massendemokratie scheinbar anknüpfen konnte, die sie jedoch so radikalisierte, daß die liberale bürgerliche Gesellschaft – die im Grunde keine demokratische Gesellschaft war – zerstört wurde. Die Überwindung der Güterknappheit ist für Kondylis das zentrale Bewegungsmoment bei der Entstehung dieser Massengesellschaft. Erst vor dem Hintergrund von „Vermassungstendenzen“ und ihren Folgen werden daher die Warnungen bürgerlicher Liberaler vor einer Ausdehnung von Demokratie und Bildung aus dieser Zeit verständlich, die sich durchaus des exklusiven Charakters dieser vermeintlich demokratischen Vision des Liberalismus und Neuhumanismus bewußt waren (vgl. hierzu Kap. 6; siehe auch die Überlegungen zur Bildungstheorie im Wilhelminischen Deutschland in Fuchs 1998, 2.3, sowie Vierhaus 1972). Was bedeuten diese Überlegungen nunmehr für die Bewertung der philosophischen Zugänge zur Person? Sie bedeuten zuallererst, daß auch die philosophischen Kategorien politisch nicht unschuldig sind. Sie beziehen sich auf eine konkrete raum-zeitliche 53 Situation und sind Mittel in den Kämpfen um die Hegemonie in der Gesellschaft. Da sich dieser Text zunächst einmal auf ein entwickeltes europäisches Land, auf eine entwickelte bürgerliche Gesellschaft bezieht, in der durchaus noch ein Nachholbedarf im Hinblick auf die emanzipatorischen und „heroischen“ Ziele etwa von W. von Humboldt besteht, sind diese Kategorien und ihr damaliges Bedeutungsfeld meines Erachtens auch heute noch nutzbar. Dies gilt allerdings nur für die bildungstheoretische Konkretisierung der philosophischen Kategorien und nicht für die Bildungspolitik und -praxis. Es ist dies vor allem im Hinblick auf zwei Problemkreise kurz zu benennen: Im Hinblick auf die Einbeziehung von Frauen und im Hinblick auf die entstehende Arbeiterklasse, auf die „unterbürgerlichen Schichten“ (Kaschuba 1990). Zu beiden Gruppen läßt sich feststellen, daß sie in der Theorie, die sich als Konzeption für den Menschen schlechthin, als Allgemeine Menschenbildung, versteht, einbezogen sind. In der Realität müssen sich Frauen jedoch noch lange gegen ihre Aufgabenbestimmung innerhalb der Familie, ihre Zuständigkeit für die niedrig bewerteten Reproduktionstätigkeiten wehren. Zugänge zu Bildungseinrichtungen müssen Schritt für Schritt erkämpft werden. In bürgerlichen Schichten allerdings wird von ihnen eine Kompetenz in der ästhetischen Kultur erwartet, die jedoch mit dem wachsenden Repräsentationsund Selbststilisierungsbedürfnis dieser Schicht zu tun hat (vgl. Kraul in Kocka 1988, Bd. 3, sowie die frauenbezogenen Artikel in den beiden Bänden zum 19. und 20. Jahrhundert Frevert/Haupt 1999). Im Hinblick auf die „Arbeiterkultur“ ist die Forschungslage nicht eindeutig (vgl. den Forschungsbericht Kaschuba 1990). Eine breite Strömung – auch in der sozialistischen und kommunistischen Bewegung und bei Engels und Marx allemal – akzeptiert diese „bürgerliche“ ästhetische Kultur – etwa der Weimarer Klassik – in ihrem humanistischen Potential. Politisch geht es dann darum, daß sich die Arbeiter diesen kulturellen Reichtum aneignen, also insbesondere das Bildungsprivileg der Herrschenden brechen. Gegenüber der Aufklärung wird jedoch der Ablauf umgedreht: Nicht durch Bildung die Macht erreichen zu wollen, sondern über die Eroberung der Macht Zugang zur Bildung zu bekommen. So organisieren sich die Handwerker und Arbeiter seit Beginn des 19. Jahrhunderts wesentlich in Arbeiterbildungsvereinen. Und so ist es etwa auch der Tenor der berühmt gewordenen Rede von Wilhelm Liebknecht „Wissen ist Macht – Macht ist Wissen“ im Februar 1872. Dem Erwerb humanistischer Bildungsgüter geht also die Konzentration auf die Entwicklung von Klassenbewußtsein und auf eine entsprechende Organisationskultur(!) der Arbeiterbewegung voraus. Flankiert wird dies dadurch, daß in der Arbeiterbildungsbewegung etwa die Werke von Schiller und Goethe als integrale Bestandteile einer „humanistischen Ausbildung des Menschen“ angeeignet werden. 54 Die Auseinandersetzung mit „Arbeiterkultur“ geschieht jedoch weniger im Hinblick auf diese ästhetische Hochkultur, sondern im Rahmen einer Ausweitung des Kulturbegriffs auf die Lebensweise und den Alltag, so wie sie prominent der englische Kulturtheoretiker R. Williams vorgenommen hat, wie sie jedoch auch in der kommunistischen Bewegung – in erster Linie etwa bei Gramsci – ausgeführt wurde. Diese Öffnung des Blickes führte zu einer erneuten Darstellung der Geschichte im Hinblick auf die Nicht-Eliten, so wie sie etwa P. Burke in der Renaissance oder die Vertreter der Annales-Schule (Ariès/Duby) realisiert haben. In bezug auf die „Arbeiterkultur“ ist zudem die Auseinandersetzung mit der Leninschen These von den „zwei Kulturen“ relevant (vgl. Kocka 1986). Die aktuelle Kultur- und Bildungstheorie wird hier ohne die Studien von Bourdieu nicht weiterkommen (s. u.). Die Anthropologie von Nussbaum, die gerade die sogenannten „Entwicklungsländer“ im Blick hat, zeigt zudem, daß die beschriebenen Kategorien zwar im Hinblick auf Ort und Zeit ihrer Entstehung zugeordnet werden können, daß jedoch eine Verallgemeinerung und Übertragung auf andere Gesellschaften möglich ist. Trotzdem ist der hier skizzierte Nachweis ihres ideologischen Gehalts unverzichtbar für einen aktuellen Gebrauch. Die Kategorien des „Ich“, der „Person“ etc. sind zudem so abstrakt, daß eine konkrete Umsetzung in die Praxis eines weiteren Vermittlungsschrittes bedarf. Dies soll in den nächsten Kapiteln über einen soziologischen und psychologischen Zugang geschehen, die uns näher an die heutige Praxis und gesellschaftliche Situation heranführen (Kap. 3 und 4). Auch ist es notwendig, die konkrete Ausformung der aktuellen „bürgerlichen Gesellschaft“ zu studieren. Der Zweck der anthropologischen Überlegungen, so wie sie hier angedeutet sind und wie sie in Kapitel 8 erneut aufgegriffen werden (ausführlicher in Fuchs 1999 dargestellt), ist im Nachweis des „Menschenmöglichen“ zu sehen – als vernünftiger Zielstellung für die praktische Gestaltung von Prozessen der Persönlichkeitsentwicklung, aber auch als Meßlatte zur Kritik an Verhältnissen, in denen Lebens- und Entwicklungschancen vorenthalten werden. 55 3. Zur Soziologie der Persönlichkeit 3.1 Die Gesellschaftlichkeit des Individuums und seine Entwicklung Die oben angeführte „Entdeckung“ oder sogar „Erfindung“ des Individuums zu Beginn der Moderne (s. auch Kap. 5) hat in der Philosophie in der Folgezeit dazu geführt, diesen Einzelnen zu verabsolutieren. Nur bei der Ausgangsannahme von isolierten Partikeln muß man sich nämlich die Frage stellen, wie soziale und politische Zusammenschlüsse zustande kommen, die aus solch autonomen oder sogar autarken Individuen gebildet werden. In der politischen Philosophie ist dies der Ausgangspunkt von „Vertragstheorien“, also der Annahme von (fiktiven) Vereinbarungen, die diese autonomen Grundbestandteile untereinander abgeschlossen haben und dabei auf bestimmte Individualrechte einer totalen Freiheit zugunsten eines Allgemeinen – des Staates – verzichten. Der englische Sozialtheoretiker Marshall (1992) hat dabei eine historische Abfolge bei der Durchsetzung von Grundwerten festgestellt: Zunächst war die Herstellung des inneren und äußeren Friedens das Ziel, dann folgten Freiheit, Gleichheit und zuletzt Gerechtigkeit, wobei es einige Jahrhunderte gedauert hat – und bis heute noch nicht abgeschlossen ist –, diese Ziele der bürgerlichen Demokratie auch vollständig umzusetzen, zumal es auch zu Spannungen oder sogar zu Widersprüchen zwischen diesen Zielen kommen kann. Umsetzungsprobleme gibt es, weil es nicht nur um Privilegien und Einflußmöglichkeit bestimmter gesellschaftlicher Gruppen geht, die sich zudem im historischen Ablauf auch noch verändern: Es geht auch darum, daß diese zentralen Werte von jedem Einzelnen gelebt werden müssen, der daher sowohl bestimmte äußere Rahmenbedingungen als auch eine bestimmte mentale Binnenstruktur braucht. Es entsteht daher ein (jeweils regional konkretes) Geflecht von Beziehungen zwischen politischen, ökonomischen, geistigen und menschlichen Entwicklungen. Diese einzelnen Entwicklungen sind sowohl jede für sich, erst recht jedoch in ihrem Verhältnis untereinander sehr unterschiedlich untersucht worden, so daß der derzeitige Forschungsstand qualitativ sehr verschiedene Aussagen zuläßt. Die Binnenentwicklung der Philosophie, also etwa die Geschichte philosophischer Konzepte wie „Ich“, „Selbst“ oder „Subjekt“ ist gut belegt sowohl in Form von Monographien, als auch in monumentalen Handbüchern. So ist gerade der zehnte Band des Historischen Wörterbuches der Philosophie erschienen, das ursprünglich bloß eine Aktualisierung von Eislers „Wörterbuch philosophischer Begriffe“ (1899) hat werden sollen. Ähnlich ist die Situation sowohl im Hinblick auf die Ideengeschichte der Politik- und Wirtschaftswissenschaft als auch im Hinblick auf die Realgeschichte des politischen und ökonomischen Lebens. Schwieriger ist jedoch die Geschichte 56 der mentalen Binnenstruktur, der psychischen Ausstattung, der „Seele“. Hier hat zwar die von Bloch und Fèbvre in Frankreich vor einigen Jahrzehnten ins Leben gerufene Mentalitätsgeschichte inzwischen viele Funde erbracht, vor allem durch eine Konzentration auf den Alltag, das private Leben, die historischen gesellschaftlichen Angebote an „Typen“ von Menschen. Trotzdem steht eine Historische Psychologie, eine Historische Sozialisationsforschung erst am Anfang (vgl. Jüttemann 1986/90). Dies hat zum einen damit zu tun, daß in früheren Zeiten vorhandene psychische Dispositionen des Menschen schwierig zu erfassen sind (vgl. etwa die einschlägigen Artikel zu dem „Körper“ in Wulf 1997). Es hat jedoch auch damit zu tun, daß sich die Psychologie als Wissenschaft damit schwer tut, sich von einem „nomothetischen“ (naturwissenschaftlichen) Forschungsideal zu lösen. „Psychologie als Wissenschaft beobachtbaren Verhaltens“ wurde lange Zeit als Erfolg einer wissenschaftlichen Rationalität gefeiert, weil mit diesem Ansatz die stark spekulative geisteswissenschaftliche Psychologie des späten 19. Jahrhunderts mit ihren intuitiven, wenig kontrollierbaren Methoden („Introspektion“) überwunden werden sollte. Wilhelm Dilthey, dem wir viele historisch gelehrte Stunden auch zur Persönlichkeit in der Geschichte verdanken, hat diesen Ansatz als bewußten Gegensatz zum naturwissenschaftlichen Positivismus entwickelt, während (der ältere) Wilhelm Wundt als Begründer einer „wissenschaftlichen“ Psychologie (im oben genannten Sinne) gilt. Offensichtlich handelt es sich bei diesem Methodenstreit zwischen „Erklären“ und „Verstehen“ um eine Folge des dualistischen Weltbildes seit Descartes, bei dem sich Geist (als Reich der Freiheit) und Körper (als Reich der Notwendigkeit) einander unvermittelt gegenüberstehen. Und natürlich ist diese methodologische und ontologische Diskussion weltanschaulich hochgradig aufgeladen: Gerade die auf die res extensa (Körper) sich beziehende neue Naturwissenschaft von Galilei, Kepler und Newton – die sich freilich von dem Rationalismus des Descartes sofort distanzierte – war verwoben mit dem Emanzipationskampf des Bürgertums (vgl. Fuchs 1984). Und diese politische Verbindung wirkt noch bis Dilthey: „Der naturwissenschaftliche Geist, der insbesondere in der modernen französischen Literatur seinen Ausdruck gefunden hat, hat die abstrakten Prinzipien auf das Wirksamste unterstützt, welche in der Französischen Revolution so einflußreich gewesen sind.“ (Dilthey 1971, S. 127) Und so entwickelt er sein Programm einer „Geisteswissenschaft“, der „Kritik der historischen Vernunft“ als Lebensphilosophie, die weit in die Geschichte der Bundesrepublik hineinragt und die bei Schülern und Anhängern von Dilthey zwar immer wieder weltanschaulich problematische, aber zugleich auch hochgelehrte Studien zu historischen Typen und zur historischen Psychologie 57 hervorgebracht hat (ich nenne hier nur Flitner 1961; vgl. den Beitrag von Herrmann in Jüttemann 1986). Es haben sich die politischen Zuordnungen, die in der ersten Phase der wissenschaftlichen und philosophischen Auseinandersetzung deutlich waren, inzwischen verwischt. Weder ist die naturwissenschaftliche Methode, die der heutigen Positivismus anstrebt, auf der Seite der Emanzipation geblieben, und schon gar nicht plädieren die Befürworter einer Respektierung des Geschichtlichen heute für eine unreflektierte Wiederaufnahme der Diltheyschen Methoden oder für dessen nationalkonservative Weltanschauung. So müssen heute politische, ökonomische, geistige und mentale Entwicklungen zusammengedacht werden, dies ist weitgehend konsensfähig unter denen, die sich mit der Geschichtlichkeit des Menschen und der Psychologie befassen; doch wie dies geschehen kann, bleibt weiterhin umstritten. Die „Entdeckung des Individuums“ war der Ausgangspunkt in diesem Abschnitt. Rückwirkend erscheinen daher die Bemühungen etwas paradox, diese neue Konstruktion von Individualität wiederum vereinbaren zu müssen mit der Notwendigkeit von Gesellschaftlichkeit in ihren unterschiedlichen Ausprägungen, vor allem aber in der Form des Staates. Eine sozial sensible Geschichtsschreibung der Wissenschaften – wesentlich gefördert durch die Erschütterung eines historischen Denkens, insbesondere des Positivismus in den Naturwissenschaften durch Kuhn (1967) – zeigt heute an einzelnen Beispielen die subtilen Zusammenhänge nicht nur zwischen Philosophie, Weltanschauung und Einzelwissenschaft, sondern auch zwischen diesen geistigen Prozessen und der Realgeschichte. Unser wichtigster Bezugsautor im Hinblick auf Anthropologie und Kulturphilosophie, Ernst Cassirer, hat die Notwendigkeit der Zusammenschau sehr klar gesehen: „Beim Menschen treffen wir allerdings, anders als bei den Tieren, auf Gesellschaftlichkeit nicht nur im Handeln, sondern auch im Denken und Fühlen. Sprache, Mythos, Kunst, Religion und Wissenschaft sind Elemente und konstitutive Bedingungen dieser höheren Form von Gesellschaft. Durch sie entsteht aus den Formen gesellschaftlichen Lebens, die wir in der organischen Natur finden, eine neue Stufe: und die des gesellschaftlichen Bewußtseins des Menschen beruht auf dem doppelten Akt der Identifizierung und der Abgrenzung. Nur im Medium des gesellschaftlichen Lebens kann sich der Mensch finden, sich seiner Individualität bewußt werden.“ (Cassirer 1990, S. 238) Er selbst hat zahlreiche geistesgeschichtliche Studien – gerade zur Entwicklung des Ich-Begriffs und der Individualität in der Renaissance – verfaßt (z. B. Cassirer 1974). Doch bleiben bei ihm gesellschaftliche und realgeschichtliche Prozesse außen vor. Gerade der Ich-Begriff im Kontext der Raumtheorie der klassischen Mechanik von Newton bezieht sich auf eine komplexe Analyse von 58 Geistes- und Realgeschichte. Gesetze der Bewegung von Partikeln im Raum können nur auf der Basis von philosophischen Annahmen über Raum, Partikel und wirkende Kräfte formuliert werden. Solche Systeme müssen widerspruchsfrei denkbar sein, und sie müssen auf der Grundlage vorhandener philosophischer Einsichten überhaupt haltbar sein. Die (physikalischen) Partikel im Raum können rasch in Beziehung gesetzt werden zu den „Mensch-Partikeln“ im gesellschaftlichen Raum. Und auch diese müssen nicht nur philosophisch widerspruchsfrei gedacht werden können, sondern es muß eine empirisch-reale Basis dafür geben, den Einzelnen – und nicht mehr wie im Mittelalter das Kollektiv – zum Ausgangspunkt der theoretischen Konstruktionen zu nehmen. Der Raum wird ebenso zu einer Ansammlung von Atomen wie die Gesellschaft zur Ansammlung von partikularen Individuen wird. Die Einzelwissenschaft (der Physik) scheint also ein Modell für philosophische Verallgemeinerungen zu geben. Und es ist sicherlich kein Zufall, daß es englische Philosophen waren, die diese Verallgemeinerung vorgenommen haben: War doch die englische Gesellschaft politisch und ökonomisch am weitesten in Richtung auf die bürgerliche Gesellschaft gediehen (Freudenthal 1982): Die Mechanisierung des Weltbildes (Dijksterhuis 1956) verläuft eine lange Zeit parallel zu politischen, geistigen und ökonomischen Strömungen. Und sie hat – am exponiertesten formuliert in der vorrevolutionären französischen Anthropologie – eine starke Auswirkung auf die vorherrschenden Bilder vom Menschen: „L'homme machine“ heißt etwa das programmatisch wichtige Buch von J. O. Lamettrie (1709–1751) – mit starken Auswirkungen auf die Entstehung einer wissenschaftlichen Pädagogik (Fuchs 1984 – Trapp) und Psychologie (Jaeger/Staueble 1978). Machen wir einen Sprung in die sechziger Jahre des 20. Jahrhunderts. Denn erst dann wurde – nach wichtigen Vorläufern, insbesondere um die Jahrhundertwende (vgl. Geulen in Hurrelmann/Ulich 1984) – das Konzept einer „Sozialisationsforschung“ auf breiter Ebene in die Human- und Sozialwissenschaften eingeführt. Wesentliche Impulse stammen aus den USA, wo bereits Anfang des Jahrhunderts Wissenschaftler in Chicago den – später so genannten – Symbolischen Interaktionismus entwickelt haben (Mead), herausgefordert durch die großen Probleme der gesellschaftlichen Integration in einer Einwanderergesellschaft. In dieser neuen Denkweise, den Einzelnen in seiner gesellschaftlichen Eingebundenheit zu betrachten, gingen Sozial- und Entwicklungspsychologie, Gesellschaftstheorie und Kultursoziologie ein Bündnis ein. Eine Konjunktur dieses Ansatzes gab es in den siebziger Jahren, vor allem in erziehungswissenschaftlichen Kontexten, wovon insbesondere das „Handbuch der Sozialisationforschung“ (Hurrelmann/Ulich 1984, zuerst 1980; 1991 erheblich überarbeitet in einer Neuauflage) Zeugnis ablegt. 59 „Sozialisation“ konnte aus sehr verschiedenen Schulrichtungen der Psychologie und Soziologie und mit sehr verschiedenen methodischen Ansätzen erforscht werden. Man berücksichtigte zudem die verschiedenen „Sozialisationsinstanzen“ (Familie, Kindergarten, Peer-Gruppe, Schule, Betrieb etc.) und Sozialisationsdimensionen (politische, sprachliche, emotionale moralische etc. Sozialisation). Nach dieser Erfolgsgeschichte hat die Sozialisationsforschung in den letzten Jahren an Glanz verloren (vgl. den einführenden Beitrag von Leu in dem Themenheft „Sozialisationsforschung“ der DJI-Zeitschrift „Diskurs“ 1/97): Es wird der Vorrang von Integration in die Gesellschaft – gegenüber der Autonomie und Subjektivität der Einzelnen – bemängelt; Kindheit werde zu sehr als Vorbereitung auf das Erwachsenenalter gesehen; die jeweils unterstellten Vorstellungen des „Subjekts“ werden kritisiert, etwa aus einer postmodernen Sicht die Vorstellung eines „gesellschaftlich handlungsfähigen mündigen Subjekts“; die Diskussion um Individualisierungstendenzen in der Gesellschaft (v.a. Beck 1986) machte Fragezeichen hinter allzu kohärenten und generellen Vorstellungen von Subjektivität – angesichts eines behaupteten Trends zur Pluralität von Lebensformen; insbesondere ist ein zentraler Begriff der Sozialisationsforschung, der Begriff der „Identität“, erheblich unter Druck geraten, da er mehr an Kohärenz und Geradlinigkeit in der Entwicklung des Menschen zu versprechen scheint, als angesichts der Situation des Individuums in einer sich ausdifferenzierenden Gesellschaft angenommen werden kann. Ich komme später auf Ergänzungen oder gar konzeptionelle Alternativen zu solchen Vorstellungen von Sozialisation zurück (etwa unter den Stichwörtern Lebenskunst und Lebensführung). Für die Zwecke dieses Kapitels muß man jedoch festhalten, daß mit dem Sozialisationskonzept systematisch das Beziehungsverhältnis des Einzelnen im gesellschaftlichen Kontext in den Blick genommen wird und unter der Rubrik einer „historischen Sozialisationsforschung“ das Aufwachsen in unterschiedlichen Zeiten zum Gegenstand der Forschung geworden ist. Soziologie der Persönlichkeit muß sich – wie gesehen – auf die Wirkungen der verschiedenen Sozialisationsinstanzen in den verschiedenen Lebensaltern beziehen. Ich komme im nächsten Kapitel zur Ontogenese hierauf zurück. Es können die Wirkungen von Arbeit und Freizeit oder eines Umgangs mit den Künsten untersucht werden. 60 Ich will an dieser Stelle einige Hinweise zur methodischen Erfassung von Individualität/Subjektivität geben, so wie sie eine Rolle in der (auch Historischen) Sozialisationsforschung gespielt haben und spielen. Ich schließe dabei an die anthropologischen Feststellungen in Kap. 2.1 an, insbesondere erinnere ich an Plessner, der seinerzeit auch wichtig war bei der deutschen Rezeption der in den USA entwickelten Rollentheorie. „In solcher exzentrischen Position wurzeln Sprechen, Handeln und variables Gestalten als die für den Prozeß der Zivilisation verantwortlichen Verhaltensweisen. Sie bilden mit ihren Produkten die vermittelnden Zwischenglieder, durch welche der vitale Lebenszyklus des Menschen in eine die Vitalität überlagernde Sphäre gebracht wird. Von Natur künstlich, leben wir nur insoweit, wie wir ein Leben führen, machen wir uns zu dem und suchen wir uns als das zu haben, was wir sind. Bedürfnis steht einer Forderung gegenüber, jedem Verhalten entspricht ein Verhältnis, dem es sich zu beugen hat, und diese Forderungen, Verhältnisse, Ansprüche halten sich an Normen, die dem Ganzen einer Kultur unangreifbare Selbstverständlichkeit verleihen. Weltoffenheit verwirklicht sich daher nur in einer künstlich geschaffenen und geschlossenen, weil von Normen beherrschten Umwelt, deren Güter und Einrichtungen vitalen Bedürfnissen dienen, dadurch aber wiederum auf diese zurückwirken, neue hervorrufen, alte verändern, in jedem Falle aber sie formen und regulieren, sie bändigen und domestizieren.“ (Plessner 1983, S. 191). Man spricht daher neben der biologischen Geburt von einer zweiten, der soziokulturellen Geburt des Menschen, in der er sein Menschsein, nämlich Individualität im gesellschaftlichen Kontext, mit Hilfe kultureller Symbole erst eigentlich ausprägt. Und dieser Prozeß findet sich in der in diesem Text beschriebenen Form mit großer Übereinstimmung in ansonsten recht unterschiedlichen Anthropologien. So verweist – neben dem zitierten Plessner – auch Gehlen (1950, S. 280 ff.) umfassend auf entsprechende Ausführungen von Mead und Plessner, so daß man sich hier auf weitgehend gesichertem (Erkenntnis-)Boden befindet (vgl. Fuchs 2000, Teil 3). Es gibt eine Reihe „mikrosoziologischer“ Theorien, die diese symbolgestützte Entwicklungsphase sowie die Konstruktion des Sozialen aus solchen symbolgestützten Prozessen erklären wollen. Unter diesen Ansätzen spielt der Symbolische Interaktionismus eine zentrale Rolle, der – im Anschluß an den Begründer der amerikanischen Semiotik, Peirce – von Mead (1863 bis 1931) in Chicago (wo er seit 1894 lehrte) begründet worden ist. Die Etikettierung als „Sozialbehaviorismus“ – so der Untertitel seines Hauptwerkes „Geist, Identität und Gesellschaft“ (1968) – weist auf die zentrale Rolle von Handlungen in dieser Konzeption hin. Mead gilt neben Peirce, Dewey und James als einer der wichtigsten Vertreter des Pragmatismus. Die Verbindung zur Semiotik wird zudem durch seinen Schüler Morris hergestellt. 61 Die Rezeption der Rollentheorie in Deutschland wurde von Plessner in den sechziger Jahren vorangetrieben. In seinen Werken und in den Büchern von Gehlen finden sich immer wieder Bezüge zu Mead. Die Rolle als System gesellschaftlicher Verhaltenserwartungen an den Einzelnen schien das geeignete Verbindungsstück zwischen den Anforderungen der Gesellschaft und der individuellen Internalisierung der Normen – also Teil der Persönlichkeit – zu sein. Die Sozialisationstheorie der siebziger Jahre verbreitete den – zunächst soziologischen – Import der Rollentheorie vor allem durch Dahrendorf („Homo sociologicus“), aber auch durch Tenbruck und andere auf die Erziehungswissenschaften (Brumlik 1973). Auch die deutsche (Sozial)Philosophie nimmt immer wieder Bezug auf die Chicago-Schule und den Pragmatismus, insbesondere dort, wo „Kommunikation“ zum Zentralbegriff der Philosophie wird, also etwa bei Habermas oder Apel (vgl. Joas 1992). Neben diesem Siegeszug des Symbolischen Interaktionismus und der Rollentheorie gibt es jedoch auch (ideologie-)kritische Auseinandersetzungen (Haug 1982, Kirchhoff-Hund 1978). Worum geht es: Der Mensch ist für Mead wesentlich ein symbolverwendendes Tier. Gebärden, Laute, Gesten und später die Sprache vermitteln die Menschen untereinander, wobei all diese Lebensäußerungen sinnhaft sind: es sind signifikante Symbole. Menschen nehmen zudem bei Interaktionen stets sich selbst wahr – quasi in einem ständig parallel laufenden Prozeß. Dies nennt Mead den „generalisierten Anderen“. Menschen können die Perspektive wechseln, können sich in die Rolle der anderen hineinversetzen, ein Prozeß, woraus die drei Dimensionen des Individuums entstehen, das „I“, das spontane kreative Ich zusammen mit der Triebausstattung, das „Me“, das soziale Selbst, die Vorstellung des Anderen von mir zusammen mit einer ersten Stufe der Verinnerlichung dieses Fremdbildes, das „Self“ als Identität. Der Schüler von Mead, Blumer, hat dem „Symbolischen Interaktionismus“ nicht bloß seinen Namen gegeben, er hat ihn auch methodisch ausgeformt. Berühmt sind seine drei Prämissen (nach Treibel 1993, S. 114 f.): Menschen handeln Dingen gegenüber aufgrund der Bedeutungen, die diese Dinge für sie besitzen; dabei sind „Dinge“ auch Menschen, Situationen und Institutionen,. Die Beziehung solcher Dinge ist aus der sozialen Interaktion, die man mit Mitmenschen eingeht, abgeleitet oder entsteht aus ihr. Die Bedeutungen werden in einem interpretativen Prozeß, den die Person in ihrer Auseinandersetzung mit den ihr begegnenden Dingen benutzt, gehandhabt und geändert. 62 In der Rollentheorie sah Plessner den Gedanken der „exzentrischen Positionalität“ sehr gut konzeptionalisiert. Die in obigem Zitat aufgeführte „Verkörperung“ als Mittel der Selbst-Schöpfung des Menschen findet durch die Übernahme von Rollen statt: „Nichts ist der Mensch „als“ Mensch von sich aus, wenn er, wie in den Gesellschaften modernen Gepräges, fähig und willen ist, diese Rolle und damit die Rolle des Mitmenschen zu spielen: nicht blutgebunden, nicht traditionsgebunden, nicht einmal von Natur frei. Er ist nur, wozu er sich macht und versteht. Als seine Möglichkeit gibt er sich erst sein Wesen kraft der Verdoppelung in einer Rollenfigur, mit der er sich zu identifizieren versucht. Diese mögliche Identifikation eines jeden mit etwas, was keiner von sich aus ist, bewährt sich als die einzige Konstante in dem Grundverständnis von sozialer Rolle und menschlicher Natur. Sie bewährt sich für die Analyse menschlicher Gesellschaften dank ihrer Abwandlungsfähigkeit auch in sozialen Funktionssystemen, deren Selbstverständnis die Idee des Menschen verschlossen ist und welche damit ihre Identifikation mit sich nicht als solche durchschauen und vollziehen. Sie bildet in unserer Welt Prinzip und Richtschnur für den optimalen Ausgleich zwischen Privatheit und Öffentlichkeit in den industriellen Gesellschaftsordnungen, deren ideologische Gegensätze nur der von einem vergangenen Denken geprägte Ausdruck ihrer fundamentalen Gemeinsamkeit sind.“ (Plessner 1983, S. 204 f.). Krappmann (1971) hat auf der Basis dieser genannten Ansätze vier Grundqualifikationen des Rollenhandelns als im Sozialisationsprozeß anzueignende psychische Dispositionen identifiziert: Rollendistanz, Ambiguitätstoleranz, Empathie und Identitätsdarstellung. In einer Untersuchung zahlreicher Autobiographien studiert Orth-Peine (1990), wie sich in den letzten 200 Jahren vor allem im Bürgertum erst im 19. Jahrhundert diese Fähigkeiten – als Grundlage für die Entstehung von Ich-Identität – ausbilden. Diese Theorielinie wird in Kap. 6, v.a. 6.4 weiterverfolgt. In diesem Abschnitt will ich einen alternativen Ansatz vorstellen. Aus einer marxistischen Sicht ist eine scharfe Kritik des Rollenkonzeptes vorgetragen worden (vgl. Haug 1972). Vorwürfe sind etwa: „Theorie des Scheins“, „Mittelstandsideologie“, Verdoppelung des „Warencharakters der menschlichen Beziehungen“. Als Alternative hat man zur notwendigen Vermittlung von Gesellschaft und Individuum auf die Konzepte der „Individualitäts- und der Denkformen“ zurückgegriffen. „Individualitätsformen“ konzeptionalisieren gesellschaftliche Anforderungen an den Einzelnen: „Individualitätsformen sind objektive Positionen, die Menschen innerhalb 63 historisch bestimmter, arbeitsteiliger Produktionsverhältnisse notwendig innehaben müssen, wenn die gesamtgesellschaftliche Lebenssicherung gewährleistet sein soll. 'Individualitätsform' ist also ein Verhältnisbegriff und meint die objektiv notwendige Regelung aufeinander bezogener menschlicher Aktivitäten innerhalb gegebener Produktionsverhältnisse. Die Menschen unterliegen, sofern sie eine bestimmte Individualitätsform individuell realisieren, zwangsläufig der Anforderungsstruktur der damit eingenommenen Position, bzw. befinden sich, sofern sie diese Anforderungsstruktur nicht in ihrer Aktivität realisieren, automatisch außerhalb der jeweiligen Individualitätsform“. (Holzkamp-Osterkamp 1975, S. 318) Dazu Sève: „Worum handelt es sich also? Auf Seiten der ökonomischen Realitäten handelt es sich um Wirkungsweise und Reproduktion von gesellschaftlichen Verhältnissen, und deren Wirkungsweise, deren Reproduktion erscheinen auf seiten der Individuen als notwendige Aktivitätsmatrizen.“ (Sève 1972, S. 266). Und weiter: „Die Individualitätsformen als Aktivitätsmatrizen prägen den Individuen, die bei der Leistung ihres individuellen Beitrags und damit Reproduktion ihres individuellen Lebens in diese als etwas Vorgegebenem hineinversetzt sind, „objektiv bestimmte gesellschaftliche Charaktere“ auf.“ (Holzkamp-Osterkamp 1975, S. 318). Von diesen objektiven gesellschaftlichen Individualitätsformen sind die je konkreten personalen Verarbeitungsweisen einzelner Individuen zu trennen, die sie erfüllen. Denn nicht nur die allgemeine menschliche Entwicklungsmöglichkeit („menschliche Natur“), deren volle Ausschöpfung objektiv durch die je vorherrschenden Produktionsverhältnisse und den dazugehörigen Stand der Produktivkräfte begrenzt wird, sondern auch die je konkreten individuellen Möglichkeiten bestimmen die sich dann konkret ergebende empirische Subjektivität. Mit der Kategorie der Individualitätsform werden gesellschaftliche Anforderungen an die Verhaltensweisen und Persönlichkeitsmerkmale des Einzelnen zu erfassen gesucht. Aufgrund dieser Aufgabenbestimmung rückt diese Kategorie nun in die Nähe des Begriffs der „Rolle“, der ja auch das Ensemble gesellschaftlicher Verhaltenserwartungen thematisiert. Akzeptiert man diese gemeinsame Aufgabenstellung der beiden Kategorien, so stellt sich jedoch sofort die Frage, wozu für dieselbe Aufgabe zwei Kategorien einzuführen sind? Ist dies nicht eine unnötige Aufblähung des konzeptionellen Apparates? Die Antwort auf diesen berechtigten Einwand findet sich u. a. in den unterschiedlichen theoretischen Hintergründen und der sich daraus ergebenden 64 unterschiedlichen Begründung für die genannten Kategorien. Es kann an dieser Stelle zwar nicht umfassend die Begründung der begrifflichen Alternative „Individualitätsform“ entwickelt werden, die wesentlichen Unterschiede zwischen den beiden Konzeptionen können jedoch benannt werden. HolzkampOsterkamp merkt zu diesem Problem an: „Man darf das Konzept der „Individualitätsformen“ auf keinen Fall mit dem gängigen Konzept der „Rolle“ gleichsetzen. Individualitätsformen sind auf der Grundlage des historischen Materialismus aus den Notwendigkeiten historisch bestimmter Produktionsverhältnisse abgeleitet. „Rollen“ sind gemäß den Vorstellungen der „funktionalistischen“ Soziologie lediglich vorgeprägte Muster für kurzschlüssig „soziale Beziehungen“, die durch aus „Normen“ abgeleitete Sanktionen reguliert werden, wobei hinter den „Rollenstrukturen“ die Produktionsverhältnisse, mithin auch der Klassenantagonismus der bürgerlichen Gesellschaft, verschwinden. Es handelt sich also hier um eine wissenschaftliche Stilisierung der durch den Schein von Freiheit und Gleichheit gekennzeichneten Oberfläche der bürgerlichen Gesellschaft.“ (ebd., S. 320). Der Vorwurf gegenüber der Rollentheorie besteht also nicht darin, daß das empirische Korrelat dieses Begriffs in seiner Existenz bezweifelt, sondern daß die theoretische Durchdringung gesellschaftlicher Verhältnisse zu früh, nämlich bei einer bloßen Oberflächenerscheinung, abgebrochen wird: die Rollentheorie ist ebenso wie die aus der phänomenologischen Soziologie stammende Interaktionstheorie Denken vom Standpunkt der Zirkulation. Ich will es bei dieser Benennung von Kritikpunkten an der Rollentheorie bewenden lassen und statt dessen einige weitere Erläuterungen zu dem hier verwendeten Konzept der „Individualitätsform“ anfügen. Es kann sich bei diesen Ausführungen jedoch nicht um eine systematische Entfaltung dieser Kategorie in einem umfassenden theoretischen Kontext handeln, sondern es soll lediglich ihr Platz in einem kategorialen System verdeutlicht werden. Marx geht in den anthropologischen Ausführungen in seinen PhilosophischÖkonomischen Manuskripten (MEW, Erg.-Bd.) in einem methodologischen Dreischritt vor: Er interpretiert den Menschen als Natur-, als Gattungs- und als Klassenwesen, das heißt als Mitglied einer großen gesellschaftlichen Gruppe in einer bestimmten Gesellschaftsformation. Diese methodologischen Vorüberlegungen zur Entwicklung einer wissenschaftlichen Anthropologie wurden in den letzten Jahren vor allem im Rahmen der Kritischen Psychologie aufgenommen und modifiziert. Deren „methodologischer Dreischritt“ wird von Klaus Holzkamp wie folgt beschrieben: „Der erste Schritt ist die Herausarbeitung der wesentlichen inhaltlichen Aspekte der gesellschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten der Individuen, damit wesentlichen Dimensionen der individuellen Vergesellschaftung ... Es kommt 65 darauf an, unter all jenen Kennzeichen, die auch dem Menschen zukommen, die er aber mit anderen Wesen gemeinsam hat, diejenigen herauszuheben, die für ihn spezifisch und bestimmend sind, also seine besonderen Potenzen zur individuellen Vergesellschaftung ausmachen, um von da aus das Verhältnis der spezifisch-bestimmenden, sekundären und unspezifischen Bestimmungsmomente der menschlichen Individualentwicklung fassen zu können.“ (Holzkamp 1978, S. 46). Ergebnis der Untersuchungen auf dieser Abstraktionsstufe sind Bestimmungen der „menschlichen Natur“ als phylogenetisches Entwicklungsprodukt für die Spezies Mensch. Damit sind spezifisch menschliche Entwicklungsmöglichkeiten erkannt, die dem Menschen – in der Terminologie von Marx – als Natur- und Gattungswesen eigen sind. Charakteristikum der menschlichen Entwicklung ist nun jedoch die Befreiung aus den biologischen Gesetzen der Evolution und Selektion dadurch, daß die Menschen „ihre Geschichte selber machen“: Die Naturgeschichte des Menschen wird abgelöst von einer sozial-historischen Entwicklung. Für die Untersuchung der menschlichen Subjektivität ergibt sich daraus das Problem, die spezifische gesellschaftliche Geformtheit der individuellen Entwicklungsprozesse, zum einen in den unterschiedlichen Gesellschaftsformationen, zum anderen innerhalb einer je bestimmten Gesellschaftsformation, zu analysieren: „Demnach sind in einem zweiten großen Ableitungsschritt marxistischer Individualwissenschaft die formations-, klassen- und standortspezifischen gesellschaftlichen Realisierungsbedingunqen der im ersten Schritt herausanalysierten spezifisch „menschlichen“ Entwicklungsmöglichkeiten und dimensionen etc. herauszuarbeiten. Dies muß einerseits auf der Basis der „Kritik der Politischen Ökonomie“ der bürgerlichen Gesellschaft geschehen, macht aber andererseits Spezifizierungen notwendig, durch welche die konkreten gesellschaftlichen Entwicklungsbedingungen und -schranken jeweils bestimmter Individuen möglichst präzise aufweisbar sind.“ (ebd., S. 49). Dies ist die kategoriale Ebene des „menschlichen Wesens“, in die das oben explizierte Konzept der „Individualitätsform“ (und das unten vorgestellte Konzept der „Denkform“) gehört. Sind mit diesen beiden Ableitungsschritten die Rahmenbedingungen individueller Entwicklung geklärt, so fordert ein abschließender dritter Ableitungschritt die Berücksichtigung der ontogenetischen Entwicklungsgesetzlichkeit: Hier müssen „...die inneren Gesetzmäßigkeiten untersucht werden, in welchen sich die individuellen Entwicklungsmöglichkeiten unter den jeweiligen Realisierungsbedingungen als konkreter personaler Entwicklungsprozeß der individuellen Subjektivität entfalten. Hier ist also das dialektischmaterialistische Entwicklungsdenken voll auf den Prozeß der Individualentwicklung anzuwenden, indem die konkreten Widersprüche, 66 qualitativen Sprünge und Stufen der Entfaltung individueller Subjektivität herausgearbeitet werden und so die Individualentwicklung wie die gesellschaftlich-historische und die naturgeschichtliche Entwicklung voll inhaltlich als historischer Entwicklungsprozeß analysiert wird.“ (ebd., S. 50 f.). Für die in dieser Arbeit untersuchte Problematik ist hervorzuheben, daß mit dem Begriff der Individualitätsform keineswegs die Gesamtheit der Enkulturations-, Sozialisations- und Erziehungsprozesse eingeholt werden soll, sondern bloß die spezifische gesellschaftliche Geformtheit von Erziehungsprozessen in einer konkret-historischen Situation. Individuelle Vergesellschaftung durch das Hinein-Entwickeln in eine vorliegende Individualitätsform ist ferner nicht als bloße Beschränkung natürlich gegebener Entwicklungsmöglichkeiten zu verstehen. Dies würde lediglich die oben kritisierte Vorstellung von „dem“ bedürftigen Individuum und „der“ versagenden Gesellschaft reproduzieren. Vielmehr ist davon auszugehen, daß die individuelle Existenz nur gesellschaftlich gesichert werden kann, die Reproduktion der Gesellschaft also Grundlage des Lebens des Einzelnen – und damit auch Bedingung der Möglichkeit von individueller Entwicklung schlechthin – ist. Natürlich kann dies andererseits nicht die völlige Auslieferung des Individuums an jeweils vorliegende gesellschaftliche Anforderungen bedeuten. Die Möglichkeiten, in den je gegebenen gesellschaftlichen Grenzen im Rahmen der individuellen Vergesellschaftung Bewußtheit zu seiner eigenen Existenz zu erlangen, können jedoch an dieser Stelle nicht weiter diskutiert werden, da es nicht Aufgabe dieser Untersuchung ist, eine Theorie der individuellen Vergesellschaftung zu entwickeln. Es sollte lediglich das Konzept der Individualitätsform so weit in seinen kategorialen Rahmen vorgestellt werden, daß seine Verwendung in dieser Untersuchung transparent – und damit kritisierbar – wird. Zur weiteren Information verweise ich auf die Arbeiten von Holzkamp und HolzkampOsterkamp (1975, S. 320). Abbildung 4 gibt den systematischen Platz der Begriffe „Individualitäts- und Denkform“ im kategorialen Netz schematisch wieder. Mit der Einführung der Kategorie der „Individualitätsform“ ist nun auch die Möglichkeit einer Bewertung gegeben: Inwieweit gesellschaftlich vorhandene Möglichkeiten ausgeschöpft werden, inwieweit ferner „ein Mensch in voller Ausnutzung seiner jeweils konkreten Möglichkeiten einen Beitrag zur gesellschaftlichen Durchsetzung allgemeiner Interessen, in denen seine eigenen Interessen aufgehoben sind, also zur allgemeinen und persönlichen Lebensbereicherung, damit zum gesellschaftlichen Fortschritt geleistet hat“ (Holzkamp-Osterkamp 1975, S. 320). Die Wahrnehmung der Möglichkeiten 67 wird nur dann geschehen, wenn zum einen – kognitiv – die individuelle und gesellschaftliche Situation erfaßt und – emotional/motivational – in Handlungsbereitschaft umgesetzt wird. 68 Abb. 4: Bewegungsformen Bewegungsformen Nat. Bewegung (mechanisch, biologisch etc.) Bewegungen der und in der Gesellschaft Kategoriale Ebene der Anthropologie Menschliche Natur Tier-MenschÜbergangsfeld Menschliches Wesen Vorherrschende Gesetzmäßigkeit Phylogenese: Evolution und Selektion Aneignung und Vergegenständlichung INDIVIDUALITÄTS- u. DENKFORMEN individuelle Individual- und Anthropogenese, Persönlichkeitsentwicklu Ontogenese Aneignung und ng Vergegenständlichung Die Möglichkeit des Erkennens ist nun an gesellschaftlich vorhandene „Denkformen“ gebunden. Mit der Einführung einer solchen Kategorie soll systematisch berücksichtigt werden, daß Denken nicht autonom von äußeren Umständen, nicht unabhängig von vorangegangenen Denkprozessen und nicht isoliert vom gleichzeitigen Denken und Handeln anderer Menschen stattfinden kann. „Denken“ hat als Teil der (einheitlichen) Persönlichkeit einen Beitrag zum Überleben des Einzelnen und der Gattung zu leisten. Man geht in verschiedenen anthropologischen Konzeptionen davon aus, daß der Prozeß der Aneignung und Vergegenständlichung sowohl die individuelle als auch die gesellschaftliche Entwicklung des Menschen erklären kann: Wesenskräfte des Menschen erhalten durch dessen Tätigkeit äußere Gestalt; die derart vergegenständlichten Geisteskräfte können auf diese Weise aufbewahrt, kumuliert und durch Tätigkeit wieder angeeignet, „vergeistigt“ werden. Wissen ist also in erster Linie Überlebenswissen und Denken daher in mehrfacher Hinsicht auf gesellschaftliche Produktions- und Reproduktionsverhältnisse bezogen. Berücksichtigt man ferner, daß ein unterschiedlicher Stand der Produktivkräfte, daß unterschiedliche gesellschaftliche Verkehrsformen auch unterschiedliche Anforderungen an die kognitiven Potenzen der Agierenden stellen, so wird die Annahme einer sozialen Determiniertheit des Erkennens plausibel. „Diese „gesellschaftlichen Denkformen“... enthalten ... objektiv sowohl relatives Wissen wie auch relative Irrtümer über die Realität, wobei diese beiden Momente aber auf der jeweiligen Stufe selbst nicht voneinander unterschieden werden können, sondern zu einem einheitlichen Weltbild, das den praktischen Anforderungen der Lebensbewältigung entspricht, integriert sind. Die in den Denkformen liegenden Irrtümer und Erkenntnisgrenzen offenbaren sich als solche nur von einem historisch entwickelteren Stand gesellschaftlichen Wissens, also entweder an neuen Erkenntnismöglichkeiten, die sich aus den sich 69 verschärfenden Widersprüchen der jeweils gegenwärtigen Entwicklung ergeben, oder rückblickend von einer späteren Entwicklungsstufe. Die „Irrtümer“ gesellschaftlicher Größenordnung entstehen global gesehen stets dadurch, daß eingesehene Zusammenhänge über ihren Gültigkeitsbereich hinaus „extrapoliert“ werden, also das Unbekannte auf inadäquate Weise nach dem Modus des Bekannten strukturiert ist, damit subjektiv scheinbar auch zu „Bekanntem“ wird.“ Und weiter: „Die gesellschaftlichen Denkformen und Weltbilder, in denen bestimmte gesetzmäßige Zusammenhänge zwischen Ereignissen der natürlichen bzw. gesellschaftlichen Wirklichkeit erkannt oder gestiftet sind, haben den Charakter der Herbeiführung, Vorhersage und Interpretation von für die Lebenssicherung relevanten Ereignissen, wobei das Gewicht je nach der gegebenen Eingriffsmöglichkeit und Gesetzeseinsicht mehr auf dem einen oder dem anderen dieser Momente liegen kann.“ (Holzkamp-Osterkamp 1975, S. 255 ff.). Diese Überdehnung des Anwendungsbereichs ist nun jedoch grundsätzlich kein Fehler, so daß man sich Strategien der Vermeidung überlegen kann: Als Teil des Symbolsystems – und daher als Mittel der Weltaneignung – liegt die ständige erweiternde Exploration, also die ständige Tendenz zur Ausdehnung des Anwendungsbereichs in der „Natur“ dieser Mittel: Der Einflußbereich des Menschen reicht nur so weit, wie seine Mittel reichen. Und die Tendenz zur Erweiterung des Einflußbereiches ist offenbar naturgeschichtliche Mitgift. Damit ist jedoch der Mensch zugleich auch zum Irrtum „verdammt“, da eine Garantie für eine stets angemessene Anwendung von Symbolen nicht besteht. „Individualitätsform“ und „Denkform“ liegen also auf derselben kategorialen Ebene: der Erfassung des Ensembles gesellschaftlicher Verhältnisse. Die je konkrete Gesellschaft bietet also – gruppen-, gesellschafts- und klassenspezifisch – gesellschaftliche Typen von Individualität an. Der Einzelne hat nun nach Maßgabe seiner genetischen Mitgift, seines sozialen Standortes und auch abhängig von Unterstützungsleistungen in den Sozialisationsinstanzen die – je nach Gesellschaft unterschiedlich weitreichende – Möglichkeit, sich in solche Individualitätsformen hineinzuentwickeln und sie auch auszugestalten. Doch wie geschieht dieser Prozeß auf Seiten des Individuums? Wie wird der Einzelne mit Gesellschaft vermittelt? Eine Erklärung liefert hierbei unser zentrales Konzept der gegenständlichen Tätigkeit. Zur Erinnerung erwähne ich an dieser Stelle, daß andere Autoren eine Aufspaltung des Handelns in Kommunikation, Arbeit und Interaktion vorgenommen haben, so wie etwa Habermas es in seinen frühen Arbeiten oder in seiner elaborierten Handlungstheorie in seinem Hauptwerk (Habermas 1981, v. a. Kap. III) getan hat. (Abb. 5) 70 Sinnvoll ist es sicherlich, das konkrete Handeln, die Handlungsmöglichkeiten und -fähigkeiten in unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen zu unterscheiden. Vielfach werden solche soziologischen Basistheorien zugrundegelegt, in denen – im Anschluß an Parsons – gesellschaftliche Subsysteme mit je spezifischen Handlungslogiken und Rationalitätskriterien unterschieden werden. Auch Habermas nimmt eine solche Aufteilung in Subsysteme vor, wie sich an seiner Entgegenstellung von „System“ (Wirtschafts- und Politikbereich) und „Lebenswelt“ (sozialer Nahraum und Kultur) zeigt. Marxistisch orientierte Autoren sehen ebenfalls die Notwendigkeit, über die je individuelle Reproduktion (des Einzelnen) die Reproduktion der Gesellschaft sicherzustellen. Abb. 5: Handlungstypen Typ des verkörperten Handlungstypen Wissens teleologisches technisch und Handeln: strategisch instrumentell verwertbares strategisch Wissen konstative empirischSprechhandlungen theoretisches (Konversation) Wissen normenreguliertes moralischHandeln praktisches Wissen dramaturgisches Handeln Form der Argumentation theoretischer Diskurs theoretischer Diskurs Muster tradierten Wissens Technologien/ Strategien Theorien praktischer Diskurs Rechts- und Moralvorstellunge n ästhetischtherapeutische und Kunstwerke praktisches Wissen ästhetische Kritik Quelle: Habermas 1981, Bd. 1, S. 448 Im Zuge der Rezeption des Marxismus in den sechziger und siebziger Jahren hat man die Formen der „Sozialisation in der und in die Klassengesellschaft“ durch Familie, Beruf und vor allem durch das Erziehungssystem untersucht (einige Beispiele sind Gröll 1975, Hurrelmann 1975, Huch 1975). Insbesondere Ottomeyer (z. B. 1977) hat Psychologie und Soziologie verbunden mit systematischen Analysen der Sozialisation/Vergesellschaftung in einer kapitalistischen Warengesellschaft. Topoi dieser Untersuchungen waren die klassischen Aufteilungen in Produktion, Distribution, Zirkulation und Konsum, wobei die Frage der Auswirkungen jeweils der Produktivkräfte beziehungsweise Produktionsverhältnisse umstritten war. 71 Eine Grundfrage bei diesen Positionen war, wie gesellschaftskonform die Sozialisation des Menschen geschehen muß und wie es hierbei um die Freiheitsgrade des Einzelnen bestellt ist. Speziell für den Kulturbereich und hier vor allem im Kontext der kommerziellen Massenkultur war und ist die Frage umstritten, welche Chancen der Einzelne hat, trotz der Warenförmigkeit des Zugangs zu Musik, Literatur, Film etc. und trotz ideologischer Eingebundenheit der Inhalte sich bewußt und kritisch gegenüber dieser (kapitalistischen) Formbestimmtheit verhalten zu können (vgl. Maase 1992; Willis 1991). An dieser Stelle ist es notwendig und hilfreich, sich an die Arbeiten von P. Bourdieu zu erinnern, die sich insbesondere mit der Funktionsweise des Kulturellen befassen. Bourdieu ist in vielfacher Hinsicht anschlußfähig an die theoretischen Grundvorstellungen dieses Textes: Mit und unter Bezug auf Cassirer ist „Wirklichkeit“ bei ihm kein Ding, sondern ein System von Systemen von Beziehungen, also ein System von „Feldern“. Unter den symbolischen Formen sind es immer wieder die Wissenschaften und die Künste (und ihre Institutionen), die Bourdieu (wie Cassirer) faszinieren. Allerdings wird bei Bourdieu die Symboltheorie sozial praktisch und eminent politisch. In Kürze eine Beschreibung seines Ansatzes (vgl. Fuchs 2000, 2.1.2): Es gibt die Wirklichkeit: als System von Beziehungen, dem die Akteure angehören, dem jedoch auch die wissenschaftlichen Betrachter angehören. Es gibt die Akteure in dieser Wirklichkeit, die zum einen selber ihre Weltzugangsweisen in einem System ordnen müssen, die ihre Individualität im Kontext gesellschaftlicher Vorgaben unter bestimmten Lebensbedingungen entwickeln müssen. Zu diesen Lebensbedingungen gehören: „relativ stabile, mehr oder weniger lang tradierte Formen, in denen die Individuen ihre persönlichen Erfahrungen in eine Ordnung, in einen Zusammenhang bringen, der ihren Lebenstätigkeiten Regelmäßigkeit und Kontinuität verleiht: zu vorangegangenen Generationen und aktuell zu den Mitmenschen.“ (Dölling 1986, S. 82) Diese Formen nennt Dölling „kulturelle Formen“. Zu diesen kulturellen Formen des „Determinanten des individuellen Vergesellschaftungsprozesses“, also als gesellschaftliche Vorgabe für die individuelle Entwicklung, gehören etwa Familienund Geschlechterbeziehungen, gehören all die „Sozialisationsinstanzen“, die die Gesellschaft mit dem Einzelnen vermitteln. Zu diesen kulturellen Formen der Vermittlung von Individuum und Gesellschaft gehören insbesondere auch Deutungsmuster, Werthaltungen und Erkenntnisweisen. Es gehören Mimik, Gestik und Körperhaltungen dazu, die sowohl für sich stehen, die jedoch immer auch verweisen – also einen Symbolcharakter haben – auf gesellschaftliche Strukturen, insbesondere auf Machtstrukturen. Sie haben eine bestimmte Bedeutung, die in ihnen „zugleich symbolisiert wie realisiert ist“ (Bourdieu, zitiert nach Dölling 1986, S. 90). Handlungen oder Artefakte sind grundsätzlich mehrdeutig, erfüllen gleichzeitig verschiedene Funktionen. Jede Alltagshandlung – etwa das Holen von Wasser in einem der kabylischen Dörfer, die Bourdieu als Ethnologe am Beginn seiner akademischen Karriere gründlich studiert hatte – erfüllt natürlich den 72 pragmatischen Zweck: das Wasser steht dann auch zur Verfügung. Aber: dieser Vorgang findet in spezifischen Formen statt – eben in symbolisch-kulturellen Formen –, die komplexe Bezüge zur „Kultur“ dieser Dörfer herstellen, die die Handlung und den Agierenden präzise einordnen in das Sozial- und Machtgefüge der Gemeinschaft. Die Form ist es also, die diese Vermittlungs-, Integrations- und Kulturleistung erbringt. Und diese Form ist es auch, die die Ordnung schafft und aufrecht erhält, die der Einzelne und die die Gemeinschaft braucht. Dies würde auch Cassirer so beschreiben: Formen sind nicht (oder nicht nur) als Zwänge zu sehen, als Unterdrückung, sondern ermöglichen erst Individualität und Subjektivität und damit Freiheit. Gleichzeitig – und dies ist das besondere Anliegen von Bourdieu – reproduzieren sie Macht- und Sozialstrukturen. Ein besonderer Schwerpunkt bildet bei Bourdieu die Analyse des gesellschaftlichen Umgangs mit den Künsten: Die „vierte narzißtische Kränkung“ fügt er der Menschheit zu, indem er in breiten empirischen Studien belegt, wie gerade die Künste im sozialen Gebrauch als Mittel der Machterhaltung und der „Distinktion“ im Interesse der Erhaltung vorhandener (ungleicher und ungerechter) Strukturen ausgesprochen wirkungsvoll sind. Und er unterstreicht immer wieder – vor allem am Beispiel von Flaubert – wie der Künstler als sensibler Seismograph gesellschaftlicher Prozesse, aber auch als Akteur in einem sozialen und ökonomischen Feld, zu seinen Werken kommt (Bourdieu 1999). Eine besondere Rolle spielt bei Cassirer und Bourdieu die Frage nach der Vermittlung zwischen dem Einzelnen und dem Ganzen. In erkenntnistheoretischer Sicht geht es um die Lösung des berühmten SubjektObjekt-Problems. Das Symbol leistet eine Vermittlung zwischen Sinn und Sinnlichkeit. Es erlebt seine Relevanz im tätigen Gebrauch: das – aktive, handelnde, und zwar: bedeutungsvoll handelnde – Subjekt stellt durch dieses Handeln eine Einheit von Subjekt und Objekt her. Welt und Mensch, Objekt und Subjekt sind durch Handeln so vermittelt, daß „Welt“ nur als „Welt in und durch den Menschen“ und der Mensch nur mit seiner inkorporierten Welt vorstellbar ist. Bourdieu entwickelt hierfür Konzepte wie den „Habitus“, der als strukturierende Struktur, als individuell angeeignete gesellschaftliche Weltwahrnehmungs-, Deutungsund Wertungsweise ein solches Vermittlungsglied zwischen Mensch und Welt ist. Die Mechanismen der Distinktion erläutert er systematisch und empirisch in einer Schrift, die im Untertitel „Kritik der theoretischen Vernunft“ heißt (Bourdieu 1993) und in der er die Fehler von Objektivismus (Levy-Strauss) und Subjektivismus (Sartre) – die jeweils eine Seite des Vermittlungszusammenhangs verabsolutieren und diesen damit grundsätzlich verfehlen – scharf anprangert. Bourdieu schlägt dagegen etwa den „sens pratique“ und den „Habitus“ als Methoden und Konzepte vor, die die „Subjektivierung des Objektiven“ (im Prozeß der Sozialisation und Kulturalisation) zu objektivieren gestatten und damit Aufschluß über die „Funktionsweise“ des Menschen in gesellschaftlichen Zusammenhängen – gerade auf der Basis der symbolisch-kulturellen Formen – ermöglicht. Die Relationalität der Gesellschaft, die Relationalität der individuellen Aneignung gesellschaftlicher Praktiken und der Selbstorganisation des Einzelnen in der kulturellen Gemeinschaft erfaßt der Soziologe mit einem entsprechenden (relationalen) Begriffsinstrumentarium, wobei auch die Begriffe untereinander ein System bilden. „Habitus“, „praktischer Sinn“, „Feld“, 73 „sozialer Raum“, „kulturelles, ökonomisches, politisches und symbolisches Kapital“ – all diese Begriffe bestimmen sich aufgrund der Relationalität wechselseitig, sie bilden ein Begriffssystem, das sich als Ganzes auf das Beziehungsgefüge Mensch-Welt bezieht. Der wissenschaftliche Beobachter ist jedoch mitnichten „exterritorial“ und neutral. Im Gegenteil verstärkt Bourdieu in den letzten Jahren seine organisatorisch-politischen Aktivitäten, um das praktisch werden zu lassen, was er theoretisch und empirisch immer wieder untersucht hat: Wie der Intellektuelle helfen kann, das „eherne Gesetze“ bei Durchsetzung des Immergleichen (der Erhaltung der Gesellschaft, so wie sie ist) zu durchbrechen. Einige Begriffe von Bourdieu im einzelnen: Feld: Bei dem Feldbegriff, der außerhalb der Physik, in der er zuerst entstanden ist, vor allem in der Psychologie von Lewin eine zentrale Rolle spielt, findet der deutlichste Bezug von Bourdieu auf Cassirer statt (vgl. Bourdieu/Wacquant 1996, S. 35 ff.) Das „Feld ist wie ein Magnetfeld ein strukturiertes System von objektiven Kräften“ (ebd., S. 38). Dieses Feld ist konflikthaft angelegt: Die Akteure darin („Schlachtfeld“) streiten sich um die Erlangung des Monopols einer bestimmten Kapitalsorte. Tausch und Kapital: Auf den ersten Blick erscheint die Terminologie von Bourdieu ökonomistisch. Dies überrascht deshalb, weil er gerade in den letzten Jahren als vehementer Kämpfer gegen den Terror des ökonomistischen Denkens in der Gesellschaft vorgeht. Wie ist dieser Widerspruch zu verstehen? In der Tat spielt der Tausch eine (fast) anthropologisch zu nennende Grundlagenrolle bei dem Verstehen von Menschsein. Tausch als Gabe und Gegengabe: Dies öffnet für Bourdieu zumindest zwei Diskurse: die ökonomische Tauschtheorie von Karl Marx, die die Grundlegung im „Kapital“ darstellt; und die ethnologischen Studien zur „Gabe“ von M. Mauss. Um es vorweg zu nehmen: Die je aktuellen Konzeptionen von Ökonomie – insbesondere der Neoliberalismus – bieten für Bourdieu gerade kein Anregungspotential für Verallgemeinerungen. Sie sind vielmehr verfälschende Schrumpfformen einer umfassenden „Ökonomie“ als Theorie des Tauschens. Tausch als wechselseitiges Geben und Nehmen ist für ihn in der Tat der zentrale Mechanismus: der Naturalientausch; der geldvermittelte Tausch, wobei Geld als symbolisch-kulturelle Form, als Medium so erscheint, wie es im Anschluß (und in Abarbeitung) an Marx von Simmel bereits vorgezeichnet war; aber auch die Theorie des Sprechens als „Ökonomie des sprachlichen Tauschs“ (Bourdieu 1990), so wie insgesamt der Prozeß des Tauschens als gesellschaftskonstituierende Grundhaltung – auch und gerade in den symbolisch-kulturellen Formen – zu finden ist. Ökonomisches „Kapital“ ist auf dieser Grundlage nichts anderes als akkumulierte Arbeit, und jeder Akteur versucht, hiervon so viel wie möglich anzusammeln. Und dies gilt bei Bourdieu nicht nur für ökonomisches Kapital, sondern es gilt auch für kulturelles und soziales Kapital, die sich daher analog zum Studium des ökonomischen Kapitals untersuchen lassen. Das „kulturelle Kapital“ existiert dabei in folgenden Formen: inkorporiert: als zeitraubende Aneignung von Dispositionen und Fertigkeiten, objektiviert: als Bilder, Bücher, Instrumente, Maschinen, 74 institutionalisiert: etwa in Form von Bildungstiteln. Daneben gibt es „soziales Kapital“ als Netzwerk von sozialen Beziehungen in einer sozialen Gruppe, verbunden mit Prozessen der Anerkennung. Eine schillernde Rolle spielt das „symbolische Kapital“, das quer zu den anderen drei Kapitalformen liegt: als deren wahrgenommene und als legitim anerkannte Form. Beispiele sind etwa „Ehre“ und „guter Ruf“, so wie Bourdieu sie in den kabylischen Gesellschaften untersucht. Spannend sind Umwandlungsformen: Wie kann etwa ökonomisches in kulturelles Kapital (und umgekehrt) verwandelt werden? Bourdieu scheut sich nicht, auch diese Fluktuationen in Kategorien des Gewinns und Verlustes zu beschreiben. Er tut dies etwa am Beispiel der symbolisch-kulturellen Form „Sprache“ (Bourdieu 1990): „Als Kommunikationsbeziehung zwischen einem Sender und einem Empfänger, basierend auf Chiffrierung und Dechiffrierung, also auf der Verwendung eines Codes oder auf schöpferischer Sprachkompetenz, ist der sprachliche Tausch auch ein ökonomischer Tausch, der in einem bestimmten symbolischen Kräfteverhältnis zwischen einem Produzenten mit einem bestimmten SprachKapital und einem Konsumenten (oder einem Markt) stattfindet und geeignet ist, einen bestimmten materiellen oder symbolischen Profit zu erbringen. Mit anderen Worten, die Diskurse sind nicht nur ... Zeichen, die dechiffriert und verstanden werden sollen; sie sind auch Zeichen des Reichtums, zu taxieren und bewerten, und Zeichen der Autorität, denen geglaubt und gehorcht werden soll“ (ebd., S. 45). Die politische Brisanz dieses Absatzes findet ihren Höhepunkt in der Beschreibung der politischen Nutzung symbolischer Formen, bei der Anwendung „symbolischer Gewalt“: Hierbei geht es um eine äußerst sanfte Form der Durchsetzung des eigenen Willens. Denn diejenigen, die gehorchen sollen, tun dies scheinbar aus freien Stücken. Dies gelingt dadurch, daß bestimmte Deutungsmuster und Bewertungskategorien, die eben alles andere als gesellschaftlich neutral sind, die vielmehr eindeutig Partei zugunsten und zulasten bestimmter gesellschaftlicher Gruppen ergreifen, gerade von den gesellschaftlichen Gruppen und Personen übernommen werden, die von deren Anwendung Schaden nehmen. Bourdieu hat diesen Mechanismus in letzter Zeit vor allem an der Ideologie des Neoliberalismus aufgegriffen, wobei es hier gerade um die Akzeptanz und Übernahme der euphemistischen – aber als rational-wertfrei daherkommenden – Grundbegriffe dieser Wirtschafts- und Gesellschaftsideologie geht: „Flexibilisierung“, „Globalisierung“, „Freistellung“ – all dies sind Konzepte, die Entlassungen akzeptabel und notwendig erscheinen lassen und die die Profitorientierung der dahinterstehenden Akteure verdecken (vgl. Bourdieu 1998). Menschen handeln also in Feldern, in Systemen von Verhältnissen. Verhältnisse sind geronnene Verhaltensweisen, in denen sich Kooperations- und 75 Machtbeziehungen eine dauerhafte Form gegeben haben. Verhältnisse werden wiederum lebendig durch Verhalten, und Verhalten innerhalb gegebener Verhältnisse erzeugt innere Dispositionen im handelnden Individuum, bewirkt die Verinnerlichung je spezifischer Handlungspräferenzen. Dies ist es, das Bourdieu „Habitus“ nennt, und zurecht nennt Liebau (1987, S. 79 ff.) das Habituskonzept eine implizite Sozialisationstheorie. Familie und Schule sind diejenigen Instanzen, die zentrale Bedeutung bei der Vermittlung des Habitus haben. Allerdings bleibt Bourdieu Soziologe. Es wird ihm zudem Objektivismus und die Vernachlässigung der individuellen Prozesse vorgeworfen. Insbesondere entsteht immer wieder der Verdacht, daß das Subjekt aus dem Prokrustesbett seines Milieus, seines anerzogenen Habitus nicht herauskommen kann (ebd., S. 144 ff.). Es wird also darauf ankommen, die objektive, gesellschaftliche – und sich zunehmend ausdifferenzierende – Anforderungsstruktur an den Einzelnen in seinem jeweiligen Kontext zu kontrastieren mit seiner phsychischen Entwicklungsdynamik. Kurz: Soziologie muß durch Psychologie ergänzt werden. Darauf werde ich im nächsten Kapitel eingehen. Doch lohnt es vielleicht an dieser Stelle, erneut auf reale Rahmenbedingungen einzugehen, die die Rede vom „Ende des Subjekts“ – dieses Mal in soziologischer Hinsicht – zumindest plausibel machen. Denn möglicherweise ist der Überhang des Objektiven, der Bourdieu (gegen dessen Protest) immer wieder vorgeworfen wird, ein theoretischer Reflex auf eine vorfindliche Empirie. Es lohnt auch hierbei wieder, den Blick auf das Ende des 19. Jahrhunderts zu werfen. In philosophischer Hinsicht ist im letzten Abschnitt auf eine verbreitete Kritik am Aufklärungsdenken und die in der Folge entwickelte Lebensphilosophie (W. Dilthey) hingewiesen worden. Die Abkehr vom Aufklärungsdenken läßt sich natürlich philosophie-immanent etwa mit den Namen Schopenhauer, Kierkegaard oder Nietzsche markieren. Es geschieht jedoch in dieser Zeit offenbar auch etwas in der Gesellschaft, was etwa Durkheim bei seinen Untersuchungen zum Selbstmord dazu veranlaßt, das Konzept der „Anomie“ einzuführen: „In zunehmendem Maße erfahren die Menschen im 19. Jahrhundert, daß die von ihnen selbstgeschaffene Gesellschaft eine ökonomisch-technische und eine politisch-soziale Eigendynamik entfaltet, in die sie sich zunehmend nurmehr als Fremdbestimmte und Abhängige einordnen können“. (Geulen in Leu/Krappmann 1999, S. 29). Gleichzeitig, so Durkheim (ebd.), hat das bürgerliche Subjekt seine von ihm selbst geschaffene Gesellschaft verinnerlicht, so daß das „Objektive“ inzwischen Teil von ihm selbst, zugleich jedoch auch ihm fremd ist. Ein inneres Fremdes und zugleich ein starker Kult des Ich in Philosophie und Künsten innerhalb desselben Individuums: Dies erklärt möglicherweise das Gefühl der 76 Zerrissenheit, das den bürgerlichen Menschen begleitet, seit die bürgerliche Gesellschaft einen bestimmten Entwicklungsgrad erreicht hat. Es liegt auf der Hand, daß, sollte diese Deutung zutreffen, der Schritt zu S. Freud, der ja gerade zu dieser Zeit seine Konzeption entwickelt, klein ist. Denn seine Individuen sind genau durch diesen Widerstreit zwischen Ich, Es und Über-Ich, zwischen dem Spontanen und Natürlich-Triebhaften und dem gesellschaftlich-fremden Anforderungskatalog als verinnerlichtem Anderen getrieben. Eine Lösung dieses Problems ist dann auch plausibel: Der Ausstieg aus der Verantwortung, sich selbst, die Gesellschaft und vielleicht sogar noch die Natur bewußt kontrollieren und auch steuern zu müssen. Die lustvolle Postmoderne – es gibt auch eine deprimierte – kann daher den Abschied des mit all zu viel Gestaltungsverantwortung überhäuften Subjekts als Akt der Befreiung feiern (vgl. Bruder in Leu/Krappmann 1999). Und es ist zugleich ein Akt der Befreiung von einer Geschichte der Disziplinierung des Ich, des Überwachens und Strafens, des Zurechtbiegens des Einzelnen, bis er bereit ist, als (scheinbarer) Machthaber des Ganzen zu fungieren (so wie Foucault dies quälend eindringlich geschildert hat). Nun sendet „die Gesellschaft“ sehr viele Signale, hat sehr viele, durchaus verschiedene Anforderungen. Eine klassische Doppelbotschaft hat Heydorn seinen Studien zugrundegelegt: den Widerspruch zwischen Bildung und Herrschaft. Damit ist etwa die widersprüchliche Anforderung an das Bildungssystem gemeint, gleichzeitig brave Untertanen und hochqualifizierte Leistungsträger zu produzieren. Heinrich Mann hat im „Untertan“ einen solchen dargestellt. Derartige Widersprüche gibt es mehr: so gibt es etwa die Marxsche These, daß die Entwicklung der Produktivkräfte zur Höherqualifizierung der Arbeiter führt, die (kapitalistischen) Produktionsverhältnisse hier jedoch enge Grenzen setzen. Es gibt die These, daß die verschiedenen gesellschaftlichen Bereiche der Lohnarbeit und des Konsums sehr unterschiedliche Dispositionen beim Einzelnen fordern: Hier die Unterordnung unter eine strenge Produktionsdisziplin, dort die Vielzahl freier Wahlentscheidungen. Es gibt die These, daß der Mensch ständig umschalten muß: Vom liebevollen Familienmensch zu Hause zum eiskalten Buchhalter und Kalkulator seiner Interessen außerhalb seines Heimes. Die Rollentheorie schien daher ein sehr flexibles Instrument zu sein, das diese Flexibilität, die Frustrationstoleranz beim oft notwendigen Aufschub von Bedürfnissen, gleichzeitig die Kompetenz zur Introspektion und Einfühlen in den Anderen, auf den Begriff brachte und sogar lehrbar machte (vgl. Haug 1972 und 1982). Wissenschaftsmethodisch hat bereits Marx gezeigt, daß die Zirkulation einer anderen („gerechten“) Logik gehorcht als die Produktion, weswegen die Entstehung des gesellschaftlichen Mehrwerts eben nicht dadurch erklärt werden kann, daß (auf der Ebene der Distribution) erfolgreich geschachert wird. 77 An dieser Stelle kann ich an die oben eingeführten Begriffe der „Denkform“ und der „Individualitätsform“ erinnern, und ich will daher hier ein theoretisches Konzept kurz vorstellen, mit dem versucht wird, die (je historisch konkrete) individuelle Reproduktionsleistung im Kontext einer (je historisch konkreten) gesellschaftlichen Reproduktion zu erklären. Dieses Konzept stammt aus einer umfangreichen historisch-systematischen Studie (Kuckhermann/Wigger-Kösters 1985), in der – quasi als historische Sozialisationsforschung oder Anthropologie – in einem Durchgang durch die Geschichte gezeigt wird, welche Formen individueller Subjektivität möglich und nötig waren, damit sich die jeweilige Gesellschaft reproduzieren konnte. Die Autoren analysieren Vorgeschichte, frühe Hochkulturen (mit den Individualitätsformen des Bauern, des Handwerkers, des Kopfarbeiters und des Herrschers), den Feudalismus (u. a. mit der Form der „kleinen Hauswirtschaft“), den Frühkapitalismus des beginnenden Warentauschs bis hin zur gesellschaftlichen und individuellen Reproduktion im Spätkapitalismus. In zwei Abbildungen (Abb. 6 und 7) visualisieren die Autoren ihre Methode der Gegenüberstellung und Verzahnung von gesellschaftlicher und individueller Entwicklung. Ich gebe diese Graphiken hier wieder, auch wenn sie ohne ausführlichere Erläuterung in einzelnen Teilen nur schwer verstanden werden können. Trotzdem wird der Grundgedanke des Ansatzes deutlich, empirisch konkret aufzuzeichnen, wie die „Entwicklung der individuellen Subjektivität“ als Partizipation an der „Entwicklung der gesellschaftlichen Subjektivität“ erfolgt. Auf einzelne Aspekte – etwa die Persönlichkeitsentwicklung in der Arbeitstätigkeit bzw. historische Individualitätsformen – komme ich später zurück. Im zweiten Teil dieses Kapitels will ich den Prozeß der sich entwickelnden Beziehung zwischen Einzelnem und Gesellschaft aus der Sicht der Entwicklung dieses Einzelnen, also in der Ontogenese, betrachten. Damit wird ein Stück weit präzisiert, wie diese Entstehung gesellschaftlich notwendiger Dispositionen in der individuellen Persönlichkeit funktioniert. 3.2 Der Verlauf der individuellen Entwicklung und die Entwicklungsaufgaben „Ontogenese“ ist der Prozeß der Entwicklung der Persönlichkeit. Die Tatsache, daß der Mensch in seiner individuellen Entwicklung eine Zeit braucht, bevor er – nach seiner ersten biologischen Geburt – in einer zweiten „soziokulturellen Geburt“ über ein hinreichend breites Spektrum an Kompetenzen (Kognition, Emotion, Verantwortlichkeit etc.) verfügt, das eine volle Teilhabe am gesellschaftlichen Reproduktionsprozeß erst ermöglicht, ist vergleichsweise neu. 78 Historische Kindheits- und Jugendforschung mußten erst feststellen, wie mühsam sich eigenständige Phasen von Kindheit und Jugend historisch entwickelt haben. Dabei sind die Deutungen dieser Entwicklung so gegensätzlich, wie sie nur sein können: Ariès (1975) stellt diese Geschichte als Geschichte der Domestizierung und Unterdrückung dar, während de Mausse (1977) die wachsenden Freiheitsgrade hervorhebt. 79 Abb. 6: Geschichte der Tätigkeit 1 Quelle: Kuckhermann/Wigger-Kösters 1985 80 Abb. 7: Geschichte der Tätigkeit 2 Quelle: Kuckhermann/Wigger-Kösters 1985 81 Auch als man eine Entwicklungsphase „Jugend“ im Leben des Menschen akzeptiert hatte – schon alleine deshalb, weil sich gesellschaftliche Instanzen wie etwa die Schule entwickelt haben, die individuelle Entwicklungsprozesse gezielt zu steuern versuchten –, hat man lange Zeit das „abstrakt-isolierte Individuum“ mit bloß immanenten Entwicklungsgesetzen gesehen, die es nach einer gewissen Zeit zu einer dann fertigen, aber auch statischen Persönlichkeit formten. Emile Durkheim, der viele Jahre eine Professur für Pädagogik inne hatte, hat als einer der ersten um die Jahrhundertwende den Zusammenhang zwischen Individuum und Gesellschaft systematisch untersucht als Prozeß, in dem der Einzelne – zur Aufrechterhaltung von Gesellschaft und ihrem Zusammenhalt – soziale Normen und Werte verinnerlichen muß (Geulen in Hurrelmann/Ulich 1995, S. 22ff.). Seit dieser Zeit ist die Sozialisationsforschung in Bewegung, wobei sich einige Trends feststellen lassen (die natürlich in einer Wechselbeziehung zu gesellschaftlichen Entwicklungen stehen): weg von quasi automatisch ablaufenden Reifungsvorstellungen hin zu wechselseitigen Prozessen, in denen der Einzelne im gegebenen gesellschaftlichen Kontext seine eigene „Identität“ oder Persönlichkeit entwickelt, weg von normierenden Vorstellungen eines einheitlichen Ablaufs hin zu individualisierten Prozessen, weg von der Vorstellung, „Sozialisation“ als Prozeß wäre irgendwann einmal abgeschlossen hin zu der Vorstellung lebenslanger Prozesse, weg von der Vorstellung eines einheitlichen Entwicklungszieles hin zu einer Pluralität unterschiedlicher Entwicklungspfade. Diese Öffnung von Sozialisationsmodellen korreliert mit der „Pluralisierung der Jugend“ und der „Entstrukturalisierung der Jugendphase“: Damit ist gemeint, daß gesellschaftliche Instanzen ihren normativen Druck auf die individuellen Entwicklungswege verlieren und es daher eine Vielzahl von Möglichkeiten gibt, wie Kinder und Jugendliche erwachsen werden können. Insbesondere eine Jugendkulturforschung hat diese Pluralität erfaßt und entdeckt immer wieder neue Jugendkulturen. Spätestens seit der Shell-Studie von 1982 ist Jugendforschung als Jugendkulturforschung ein zentrales Paradigma. Dahinter steckt z. T. die gesellschaftstheoretische Vermutung, daß sozialökonomische Bestimmungsfaktoren an Relevanz – etwa bei der Sozialstrukturanalyse – verlieren und ästhetische Komponenten an Bedeutung gewinnen („Lebensstile“). Daß auch auf dieser Grundlage ein „emanzipatorischer“ Forschungsansatz möglich ist, nämlich in der Nutzung des ästhetischen Materials der Kulturindustrie Selbstbehauptung zu artikulieren, hat insbesondere das 82 Birmingham Centre for Contemporary Cultural Studies seit den sechziger Jahren gezeigt (vgl. Clarke 1979). Damit ist ein weiterer Aspekt der letzten Jahrzehnte genannt worden: Die (kommerziell geprägte) „Massenkultur“ als Sozialisationsinstanz. Kritisch bewerten etwa Rolff/Zimmermann diese Entwicklung. Sie sehen die „Lebenswelt“ als zentralen Ort der Sozialisation und diese geprägt von Massenkultur, die gerade nicht von der Lebenspraxis, sondern „kulturindustriell erzeugt wird. Massenkultur wird für einen Markt produziert und ist an den Verwertungschancen orientiert. Leitmotiv ist das Profitmotiv. Massenkulturelle Bedeutungen entstehen nicht in der Praxis, sondern sind vorgegeben....“ (Rolff/Zimmermann 1997, S. 146 ff.). Dies gilt für nahezu alle Veränderungen des Aufwachsens: beim Spielzeug, bei den Kindermedien (MC, CD, Comics, TV, etc.). Die Relevanz der Massenkultur ist nicht zu überschätzen, da sie den – neben der materiellen Kultur – wichtigen zweiten Teil der Kultur, nämlich die „symbolische Kultur“ fast vollständig zu überformen droht. Diese Interpretation ist somit Teil einer – oft polarisierenden – Auseinandersetzung über die Sozialisationseinflüsse der Massenmedien, die sich zwischen den Polen: Gefahr der Enteignung und Unterordnung auf der einen Seite und Ermöglichung neuer Formen von Souveränität und Identitätsentwicklung auf der anderen Seite, bewegen (vgl. Abels 1993). Ein weiteres Forschungsergebnis ist die Entdeckung von „Generationsgestalten“ von Jugendlichen – andere sprechen im Anschluß an Fromm von „Sozialcharakteren“ oder von Persönlichkeitstypen. Damit sind unterscheidbare (idealtypische) Lebens-Modelle gemeint, die sich im historischen Wandel zwar verändern, für eine bestimmte Zeit jedoch das Gesamtbild der jeweiligen Jugend prägen. Persönlichkeitsideale sind nicht neu, seit die Renaissance das Individuum entdeckt hat. Berühmt geworden ist die Darstellung des Mathematikers, Malers und Ökonomen Leon Battista Alberti von Burckhardt, der in seiner berühmten Schrift die Leistung der Renaissance geradezu feiert, das Individuum entdeckt zu haben. Er schildert Alberti als hervorragenden Turner und Akrobaten, als Musiker, Mathematiker und Sprachbegabten, als studierten Juristen und Handwerker, als Architekten und Dichter, kurz als Beispiel für den uomo universale der Renaissance (Burkhardt 1958, S. 130 ff.). Dieses Ideal ist geblieben, auch wenn die Jugendforschung des 20. Jahrhunderts zu weniger heroischen Typen kommt. Abb. 8 faßt diejenigen Typen („Generationsgestalten“) zusammen, die bis Mitte der achtziger Jahre relevant waren. 83 Werfen wir abschließend einen Blick darauf, was Trendforscher aktuell an neuen Jugendgestalten gefunden haben. Der neueste Trend ist – nach der EntdekAbb. 8: Generationsgestalten Persönliche Lebensplanung „Das gute persönliche Leben“ Jugendbewegung Hitler-Jugend Skeptische Generation und unbefangene Generation Politische Generation Lebenswelt-Generation 84 Gesellschaftliche Gestaltung „Das gute gemeinschaftliche Leben“ Lebensreformerisch, auf Romantisch-völkisch autonome überhöhte Jugendgemeinschaften Einsatzbereitschaft bezogen heroische Geste des Einsatzes für das Vaterland +– Auf die Stellung Kollektive Identifikation im Mittelpunkt: Stärkung ausgerichtet der Nation, heroischer ... die eigene Person ist Einsatz unwichtig, Aufgaben im Dienste am Volksganzen –+ Konzentration auf Beruf Distanz und problemlose und Gestaltung des Akzeptanz von Politik Privaten und Wirtschaft Phantasien des „schönen Lebens“ +– Anspruch auf Änderung Ethisch-normativ und des eigenen Lebens im theoretisch begründeter Sinne der Befreiung von Änderungsanspruch als gesellschaftlicher Identifikationskern Repression –+ Priorität der autonomen Bewußte Abgrenzung Gestaltung der eigenen zum gesellschaftlichen Lebenswelt Normalentwurf Lebenswertes Leben in Distanz und punktuelle Gemeinschaften Konfrontation +– + – : Identifikationsschwerpunkt : Randzonen: instrumentell für den Identifikationsschwerpunkt Quelle: Fend 1988, S. 204 kung der „Generation X“ (Coupland) – nunmehr die Generation @. Diese neue Generation erfaßt diejenigen jungen Menschen, die mit aller Selbstverständlichkeit in einer durchorganisierten Medienwelt aufwachsen – mit erheblichen Folgen für Sozialverhalten und psychische Innenstruktur. Ich gebe einige Charakterisierungen wieder (nach Opaschowski 1999a und b): sie ist diejenige Generation, die den Übergang von der Industrie- zur Informationsgesellschaft aktiv lebt, sie lebt souverän in den virtuellen und Kommunikationswelten des Computers und des Internets, ihre neue Lebenskultur wird geprägt durch Unabhängigkeit, Offenheit, Toleranz, Meinungsfreiheit, Unmittelbarkeit, sie will alles und auf nichts verzichten: Familie ist (bestenfalls) ein „Boxenstop“, sie genießt aktiv und passiv das Medienangebot, will die Zukunft angenehmer, bequemer und abwechslungsreicher, aber die Welt nicht notwendig besser machen. Auch Opaschowski (ebd.), der mit unverhohlener Sympathie diese neue Generation beschreibt, sieht einige Probleme: das Beziehungsnetz etwa, das zwar immer vielfältiger, aber auch oberflächlicher wird. Er fragt nach einer möglichen Übersättigung, so daß vielleicht sogar als Gegenbewegung der Wert von Familie, Kindern und Ehe wieder kehrt. Soweit eine Zukunftsvision, bei der die einen sich darüber freuen, daß sie bereits im Ansatz erkennbar ist, während sie für andere eine Horrorvision darstellt, die mehr dem Wunsch von Marketingabteilungen und Trendforschern entspringt. Ich komme zurück zu Vorstellungen darüber, wie der ontogenetische Entwicklungsprozeß gedacht werden kann. Dabei wird von der Vorstellung ausgegangen, daß es eine Abfolge von unterscheidbaren Stufen gibt, die jedoch zum einen tätig von dem Einzelnen im sozialen Kontext erarbeitet werden müssen und bei der es zum anderen keine „verbindliche“ Normierung in bezug auf das Lebensalter gibt. 85 Individuelle Entwicklung hat die Realisierung verallgemeinerter Handlungsfähigkeit zum Ziel. Diese läßt sich – wie erläutert – ihrem Wesen nach als Fähigkeit und Bereitschaft zur sowie als Realisierung der Einflußnahme auf die Rahmenbedingungen des (individuellen und gemeinschaftlichen) Handelns bestimmen. Die Charakterisierungen „verallgemeinert“ beziehungsweise „restringiert“ lassen sich an den einzelnen Funktionsdimensionen von Handlungsfähigkeit als Alternative beschreiben zwischen Deuten vs. Begreifen im Bereich der Kognition, restringierte vs. verallgemeinbare Emotion/Motivation, innerer Zwang vs. motivierte Handlung, Instrumentalvs. Sozialkooperativen. Interpersonal-Beziehungen im Bereich des Im Zusammenhang mit der oben vorgestellten jugendbezogenen Fragestellung ist nun jedoch zu berücksichtigen, daß sich (die spezifische Form von) Handlungsfähigkeit in der Ontogenese erst entwickelt. Es ist in diesem Abschnitt daher ein Konzept der Ontogenese vorzustellen, in dem „Jugend“ als Lebensphase einen Platz findet. Im Rahmen des dieser Arbeit zugrundeliegenden anthropologischen Verständnisses ist zu fragen, wie sich die menschliche Natur – als gesellschaftliche Natur des Menschen – im Zuge seiner (individuellen) Entwicklung realisiert. Ontogenese ist daher wesentlich der Prozeß der individuellen Vergesellschaftung. Im Zuge dieses Prozesses müssen sich die psychischen Grundlagen des Individuums für die Bewältigung seiner gesellschaftlichen Existenz entwickeln: „Individuelle Vergesellschaftung“ bedeutet daher immer „Herausbildung von Handlungsfähigkeit.“ Handlungsfähigkeit entwickelt sich im Spannungsverhältnis von individueller Befindlichkeit und gegebenen Handlungsaufforderungen und -möglichkeiten. Die zur Verfügung stehenden Handlungsmöglichkeiten übersteigen nun bei weitem die individuell realisierbaren und schließlich auch realisierten Handlungsmöglichkeiten. Die vorhandenen Handlungsmöglichkleiten stellen ein Angebot dar für das Individuum, aus denen es – natürlich nicht unbeeinflußt durch äußere Umstände – eine Auswahl trifft. Die Beziehung des Individuums zu den Handlungsmöglichkeiten ist daher wesentlich eine Möglichkeitsbeziehung, die in jedem Fall eine Entscheidung erzwingt (da man sich nicht nicht verhalten kann). Handlungsmöglichkeiten werden wie erwähnt bereitgestellt. Sie liegen vor, sind gesellschaftlich produziert, haben also im Lebensbewältigungsprozeß anderer eine Rolle gespielt – kurz: es handelt sich 86 um gesellschaftlich entstandene „Bedeutungen“: Ontogenese ist daher Aneignung von Bedeutungen. Sie ist ein Entwicklungsprozeß von Handlungsfähigkeit, der geprägt ist durch eine ständige Auswahl unter (alternativen) Handlungsmöglichkeiten. Die Untersuchung der Ontogenese ist daher Entwicklungsanalyse, und – da Entwicklung provoziert wird durch Entwicklungswidersprüche – zugleich Widerspruchsanalyse. 87 Da Entwicklung von Handlungsfähigkeit sich realisiert als Auswahl unter Handlungsmöglichkeiten, die wiederum zustande kommen durch gesellschaftliche Produziertheit von Bedeutungen, ist die Untersuchung der Ontogenese wesentlich Bedeutungsanalyse. Aneignung von Handlungsfähigkeit geschieht nun nicht passiv oder kontemplativ, sondern ist nur realisierbar über aktives Eingreifen, über kooperativ-gegenständliche Tätigkeit. Die Untersuchung der Ontogenese ist daher wesentlich Tätigkeitsanalyse. Damit sind einige zentrale Bestimmungen der Ontogenese gewonnen, die im folgenden ausführlicher dargestellt werden sollen. Bevor in diesem Kontext der Ansatz von Holzkamp dargestellt wird, sei anhand einer Graphik (Abb. 9) an den vermutlich bekanntesten Vorschlag von Erikson (1973) erinnert. Holzkamp (1983) gibt die folgenden Entwicklungszüge in der Ontogenese an: nach einem ontogenetischen Vorlauf folgt der Entwicklungszug der Bedeutungsverallgemeinerung. Daran schließt sich der Zug der Unmittelbarkeitsüberschreitung an, mit deren Erreichen die individuelle Realisierung von Handlungsfähigkeit erfolgen kann. Ich will die beiden mittleren Entwicklungszüge kurz charakterisieren. Dabei kann hier nicht im einzelnen gezeigt werden, wie diese Entwicklung vorangetrieben wird durch die schrittweise Hineinverlagerung „äußerer“ Entwicklungsaufgaben in das Individuum, wodurch „innere“ Entwicklungswidersprüche entstehen, die auf dem nächst höheren Niveau der Handlungsfähigkeit aufgehoben werden. In einer ausführlichen Analyse der Entwicklung ist dabei zu zeigen, wie auf einem bestimmten Niveau der Handlungsfähigkeit zunächst untergeordnete Funktionsmomente bestimmend werden und einen „Dominanzumschlag“, das heißt einen qualitativen Sprung im Entwicklungsprozeß bewirken, so daß sich auf nun höherer Entwicklungsstufe der beschriebene Vorgang wiederholen kann. 88 Abb. 9: Identitätsentwicklung nach Erikson A B Psychosozial Umkreis der e Krisen Beziehungspe rson I Vertrauen gg. Mißtrauen Mutter II Autonomie Eltern gg. Scham, Zweifel III Initiative gg. Familienzelle Schuldgefüh l IV Werksinn Wohngegend gg. Schule Minderwerti gkeitsgefühl „eigene“ Gruppen „die Anderen“ FührerVorbilder Freunde, sexuelle Partner, Rivalen, Mitarbeiter VII Generativität Gemeinsame gg. Arbeit, Selbstabsorp Zusammenleb tion en in der Ehe V Identität und Ablehnung gg. Identitätsdiffusion VI Intimität und Solidarität gg. Isolierung VIII Integrität gg. „Die Verzweiflun Menschheit“ g „Menschen meiner Art“ C Elemente der Sozialordnu ng Kosmische Ordnung D Psychosoziale Modalitäten Gegeben bekommen Geben E Psychosexuelle Phasen Oralrespiratorisch, sensorisch kinästhetisch (Einverleibungsm odi) „Gesetz und Halten Anal-urethral Ordnung“ (Festhalten) Muskulär Lassen (Retentiv(Loslassen) eliminierend) Ideale Tun Infantil-genital Leitbilder (Drauflosgehen) Lokomotorisch „Tun als ob“ (Eindringend, (=Spielen) einschließend) Technologis Etwas Latenzzeit che „Richtiges“ Elemente machen, etwas mit anderen zusammen machen Ideologisch Wer bin ich Pubertät e (Wer bin ich Perspektive nicht) n Das Ich in der Gemeinschaft ArbeitsSich im anderen Genitalität und verlieren und Rivalitätsor finden dnungen Zeitströmun Schaffen gen in Versorgen Erziehung und Tradition Weisheit Sein, was man geworden ist; wissen, daß man einmal nicht mehr sein wird. Säuglin g Kleinkin d Spielalte r Schulalter Adolesz ens Frühes Erwachsenenalt er Erwachsenenalt er Reifes Erwachsenenalt er Quelle: Oerter/Montada 1995, S. 323 89 „Entwicklung“ meint hier auch nicht die Entwicklung eines einzelnen privaten Individuums, sondern die Entwicklung des Einzelnen in seinem sozialen Umfeld, konkret: Entwicklung der Koordination zwischen Kind/Jugendlichem einmal zu Erwachsenen beziehungsweise zwischen Kindern, Jugendlichen untereinander. Dies wird zwar im folgenden stets mitgedacht: Der Hauptakzent der Ausführungen liegt jedoch in der Beschreibung der Entwicklung der individuellen psychischen Regulationsformen. Der Entwicklungszug der Bedeutungsverallgemeinerung führt zur Erkenntnis des „verallgemeinerten Gemachtseins-zu“. Beim Eingang in diese Etappe werden Gegenstände zwar vielseitig verwendet und diese Verwendungsweisen explorativ erkundet: die in den Gegenständen (durch andere Produzenten) vergegenständlichten Zwecke ihrer Existenz werden jedoch nicht – oder nur als gleichberechtigte Zwecke unter anderen – gesehen. In diesem Entwicklungszug eignet sich das Kind also nicht mehr nur Bedeutungen an oder macht durch sein Hantieren mit Dingen vielseitige Erfahrungen über die Welt und seine Befindlichkeit darin: Es lernt darüber hinaus, Absichten anderer Menschen zu erkennen und ihre Beziehung zu eigenen Absichten zu bestimmen (dies nennt man „Sozialintentionalität“). Die über die verwendeten Mittel hergestellte Sozialbeziehung ist nun nicht mehr unmittelbar an die agierenden Personen gebunden. Das gegenständliche Resultat der kooperativen Tätigkeit wird bestimmend. K. Holzkamp charakterisiert den Verlauf der individuellen Bedeutungsverallgemeinerung im Zuge der individuellen Entwicklung dadurch, „ ... daß hier die in den objektiven Bedeutungen liegenden vergegenständlichten allgemeinen Bestimmungen gesellschaftlich-individueller Existenzerhaltung (in ihren ausgewiesenen sachlichen und sozialen Momenten) vom Subjekt in einem ontogenetischen Verallgemeinerungsprozeß der Weltund Selbstsicht/Lebenspraxis allererst angeeignet werden. Das Resultat dieses Entwicklungszuges ist die kooperativ-gesellschaftlich bestimmte Handlungsfähigkeit, die wiederum Voraussetzung für den entwicklungs-logisch nachgeordneten Zug der Unmittelbarkeitsüberschreitung mit dem Resultat des Prozeßtyps der Reproduktion (voll entfalteter) Handlungsfähigkeit in der Individualgeschichte ist. Den entwicklungslogischen „Ausgangspunkt“ der ontogenetischen Bedeutungsverallgemeinerung gewinnt nach der Absehung vom verallgemeinert-gesellschaftlichen Charakter der Bedeutungen, womit eine ontogenetische Verfassung der Individuen angenommen ist, in welcher sie die objektiv-verallgemeinerten Bedeutungen so erfahren, als ob sie lediglich Handlungsdeterminanten in einer bloß naturhaft-individuellen „Umwelt“ wären, beziehungsweise präziser, solche unspezifischen Momente der gesellschaftlichen Bedeutungskonstellationen, die diese mit naturhaftindividuellen „Umwelt“-Bedeutungen gemeinsam haben.“ (Holzkamp 1983, S. 423). 90 Das Individuum erkennt sich also als Fall des „verallgemeinerten Nutzers“ und „verallgemeinerten Produzenten“. Allerdings wird auf dieser Stufe erst eine bloß kooperativ-gesellschaftliche Handlungsfähigkeit und damit eine lediglich kooperativ-gesellschaftliche Bedingungsverfügung erreicht. Dies drückt sich insbesondere in dem Wesenszug der Unmittelbarkeit aus, der für die Art der sozialen Organisation der gegenständlichen Tätigkeit hier noch charakteristisch ist. Die Stufe der Bedeutungsverallgemeinerung löst also die unmittelbar personenorientierte Beziehung des vorhergehenden Entwicklungszuges zugunsten einer neuen Stufe der Kind-Erwachsenen-Koordination ab. Die in der letzten Stufe angeeignete Fähigkeit des sachgemäßen Handelns wird erweitert zu der Fähigkeit zu sachintentionalem Machen. Der junge Mensch erkennt nun den Zusammenhang „zwischen der intendierten/realisierten Brauchbarkeit des gegenständlichen Resultats und der damit erreichbaren Beeinflussung der Intentionalität der anderen im Interesse der eigenen Verfügungserweiterung.“ (Wetzel 1983). Das Kind sieht ein, warum Erwachsene bestimmte Mittelverwendungen favorisieren – und entwickelt damit zugleich Kriterien zur Beurteilung des Erwachsenenhandelns. Es kann nun die Intentionen Erwachsener nicht nur (wie im Rahmen der Sozialintentionalität) bloß verstehen, sondern es kann sie in ihrer Nützlichkeit auch beurteilen. Mit der neuen Stufe der Handlungsfähigkeit entsteht zugleich eine neue Qualität der Bedrohungsüberwindung; es entstehen allerdings auch neue Quellen von Angst und eine neue Qualität des Lebens: Während diese auf der früheren Stufe ihre Ursache im Verlust von Zuwendung hatten, entstehen sie nun bereits aus der „Befindlichkeit bedrohter Handlungsfähigkeit durch erfahrene Isolation von der kooperativen Verfügung über die eigenen Lebensbedingungen“ (Holzkamp 1983, S. 467). Das Kind gewinnt in dieser Etappe an kooperativem Einfluß innerhalb der Häuslichkeit, erfährt sich jedoch zugleich zunehmend als ausgeschlossen von der Teilhabe an gesellschaftlichen Verfügungsmöglichkeiten. Der Bedarf an einer solchen Teilhabe wird „entwicklungsnotwendig“, da in der zu beschreibenden Etappe der Unmittelbarkeitsüberschreitung gerade außerhäusliche Faktoren entwicklungsbestimmend werden: Die Erfahrung der Aushäusigkeit wird als umfassende, jedoch zunächst noch unfaßbare Rahmenbedingung des häuslichen Handelns erfahren (ebd. S. 478). Realisierte sich in früheren Entwicklungszügen die gesamtgesellschaftliche Vermittlung individueller Existenz noch ausschließlich kooperativ (nämlich im wesentlichen im unmittelbaren Umgang mit den Eltern), so bringt das nun stattfindende Aufbrechen des häuslichen Rahmens, seine Überschreitung in verschiedene außerhäusliche Lebenszentren (Straße, Kindergarten, Schule etc.) eine neue Form der gesamtgesellschaftlichen Vermittlung und damit neue Anforderungen an die psychische Regulation der individuellen Existenz. 91 Holzkamp (1983, S. 483 ff.) gibt die folgenden fünf Schritte dieser Unmittelbarkeitsüberschreitung an: 1. Universalität des häuslichen Verfügungsrahmens als kindliches LebensZentrum (als Ausgangspunkt), 2. praktische Erfahrung der Vielfalt häuslicher Zentren, 3. praktische Erfahrung anderer Lebens-Zentren als der von „Häuslichkeiten“, 4. praktische Überschreitung des häuslichen Zentrums in gesellschaftlichinstitutionelle Lebens-Zentren der Pflege/Erziehung hinein, 5. praktische Überschreitung des häuslichen Zentrums in außerhalb des Reproduktionsbereichs liegende Zentren der Vorbereitung auf Positionsrealisierung. Für die später noch thematisierte Frage der (zunächst einmal so bezeichneten) „Identitätsbildung“ ist nun folgende Überlegung wichtig: Die Überschreitung der häuslichen Unmittelbarkeit ermöglicht die Erkenntnis, daß individuelle Reproduktion, daß individuelle Existenzsicherung auch ohne eigene kooperative Beiträge zur gesellschaftlichen (Re-)Produktion geschieht. Mit dieser Erkenntnis ergibt sich für das Individuum eine „materielle Entlastung“ als Grundlage der Möglichkeit zur Entwicklung von Erkenntnisdistanz des menschlichen Bewußtseins (ebd. S. 482; s. u.). Der Gedanke der Distanz, die eine Grundlage für die Möglichkeit einer bewußten (reflexiven) Beziehung zu sich darstellt, ist – wie gesehen – ein Grundgedanke der hier unterstellten Anthropologie und wird später wieder aufgenommen. Diese Dialektik zwischen Distanz und Nähe, zwischen Unmittelbarkeit und Vermitteltheit ist ein zentrales Problem gerade für die kulturell-ästhetische Sozialisation und damit für die kulturpädagogische Praxis, da diese häufig mit „Konkretheit“ und Unmittelbarkeit als Vorzüge dieser Praxisform argumentiert. Hingewiesen sei an dieser Stelle außerdem auf den Zusammenhang zwischen materieller Existenz und psychischer Regulation. War auf der früheren Entwicklungsstufe das stofflich-sinnliche Machen wesentliches Vehikel bei der Realisierung des „verallgemeinerten Gemachtseins-zu“ der gesellschaftlichen Bedeutungen, so verläuft dieser Prozeß nun abstrakter. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Sprache, die nun in vollem Umfang ihre Funktion als „gegenständliches“ Medium kumulierter, verdichteter, formalisierter gesellschaftlicher Erfahrung erfüllt. Sie verliert insbesondere ihren unmittelbaren Gegenstandsbezug, wird operativ nutzbar durch Aufbrechen der Ein-Eindeutigkeit Zeichen – Begriff. Damit vollzieht der Einzelne einen Wechsel in der Sprachauffassung, wie er sich geschichtlich seit der Renaissance (vgl. Fuchs 1998, Kap. 6) zeigt und wie er in der Cassirerschen Symboltheorie ebenfalls als notwendig herausgestellt wird (Cassirer 1990). 92 Mit dem Vollzug der hier skizzierten Unmittelbarkeitsüberschreitung sind (im materiellen Leben und im Hinblick auf die psychischen Regulationsformen) alle Voraussetzungen geschaffen, die je individuelle Form von Handlungsfähigkeit zu entwickeln. Nach Abschluß dieses Entwicklungszuges gilt zur Erfassung des Handelns die Beschreibung voll entwickelter Handlungsfähigkeit. Es kann heute kaum über die Entwicklung von Individuen nachgedacht werden, ohne sich mit dem Begriff der „Identität“ und ihrer Entwicklung auseinanderzusetzen. Freilich ergibt sich durch diese Selbstverpflichtung das Problem, eine Vielzahl von Autoren und Ansätzen zur Kenntnis zu nehmen und verarbeiten zu müssen. Dies kann jedoch hier nur äußerst global geschehen, da eine ausführlichere Beschäftigung mit der Literatur zum Identitätsproblem mit dem anvisierten Umfang dieser Arbeit nicht verträglich wäre. Es sind heute im wesentlichen zwei unterscheidbare Zusammenhänge, in denen sich ein Identitätsbegriff findet: In psychoanalytischer Tradition hat vor allem Erikson ein Identitätskonzept als psychisches Organisationsprinzip entwickelt. Daneben gibt es ein Identitätskonzept, das wesentlich von der symbolisch – interaktionistischen Sozialpsychologie (dieses geht auf Mead zurück; mit dem Identitätsproblem hat sich unter anderen Goffmann befaßt) vertreten wird und das hier vor allem ein soziales Organisationsprinzip ist. (Vgl. Joas und Ottomeyer in Hurrelmann/Ulich 1984). Beide Ansätze haben wesentliche Einsichten über das anstehende Problem gebracht, die in der kritisch-psychologischen Konzeption (re-interpretiert) aufgenommen worden sind. Ich werde daher im folgenden von „Identität“ sprechen, wobei die Verwendung von Anführungszeichen auf die Notwendigkeit einer inhaltlichen Bestimmung dieser Worthülse verweisen soll. Unter „Identität“ versteht man eine bestimmte, relativ stabile Form des Selbstbewußtseins und des Selbstgefühls. „Selbstbewußtsein“ als (reflexives) Bewußtsein seiner selbst als von anderen abgrenzbarer Person mit ihrer Geschichte, ihren Wünschen und ihrer Weitsicht, ist nur dem Menschen eigen. Der Gedanke, daß eine so verstandene „Identität“ als reflexiver Selbstbezug des Menschen nicht unmittelbar entsteht, sondern daß ihre Entwicklung notwendig sowohl andere Menschen als auch „Gegenstände“ erforderlich macht, findet sich schon bei Marx: „Das Tier ist unmittelbar eins mit seiner Lebenstätigkeit. Es unterscheidet sich nicht von ihr. Der Mensch macht seine Lebenstätigkeit selbst zum Gegenstand seines Wollens und seines Bewußtseins. Er hat bewußte Lebenstätigkeit.“ (MEW 3). Sich selbst zum Gegenstand machen zu können, setzt – wie oben am Beispiel von Plessner dargestellt – die Fähigkeit zur Distanz 93 voraus. Im vorangegangenen Abschnitt wurde gezeigt, welche zentrale Rolle diese Entstehung von Distanz als Aufbrechen von der Unmittelbarkeit im Lebensvollzug auch in der Ontogenese spielt. 94 Zum Betrachten seiner selbst hat der Mensch zwei Möglichkeiten: er sieht sich und seine Wesenskräfte vergegenständlicht in den Resultaten seiner produktiven Tätigkeit und er sieht sich im anderen, eben im Vollzug der kooperativen gegenständlichen Tätigkeit, die durch den Gegenstand als gemeinsamer „dritter Sache“ koordiniert und organisiert wird. Mit dieser Überlegung ist übrigens ein wichtiger Unterschied zu interaktionistischen Identitätstheorien angeführt: die Berücksichtigung bloßer Interaktionsprozesse bei weitgehender Vernachlässigung des Gegenstandes von Kommunikation, Interaktion und Handeln. Die Gegenständlichkeit von Handeln ist zentral für einen weiteren Aspekt der „ldentitäts“-entwicklung: Die Folgen seines beabsichtigten eingreifenden Handelns erleben zu können und somit die Relevanz eigener Absichten zu erkennen. Dieser Gedanke, selber Ausgangspunkt von Absichten – also „Intentionalitätszentrum“ – zu sein, ist Grundgedanke des phänomenologischen Herangehens an das Identitätsproblem. Hier wird gezeigt, daß sich Intersubjektivität gerade durch die reziproke Struktur unserer Erfahrung konstituiert. Die intentionale Beziehung zur Realität wird dabei als Möglichkeitsbeziehung erkannt, da die Realität das je Intendierbare stets überschreitet (Holzkamp 1984, S. 5 ff.). Die Tatsache der Möglichkeitsbeziehung zu den gesellschaftlich gegebenen Handlungsmöglichkeiten ist in unserem ontogenetischen Konzept von zentraler Wichtigkeit, weil erst dadurch das Verhältnis Individuum/Gesellschaft genau gefaßt wird. Erst durch die Tatsache, daß das Spektrum möglicher Handlungen den Bereich der tatsächlich realisierbaren Handlungen weit überschreitet, macht die Auswahl, macht also ein bewußtes Verhalten-zu notwendig und damit restringierte/verallgemeinerte Handlungsfähigkeit als Alternative real möglich. Eine Folge dieser Notwendigkeit zur Entscheidung unter Handlungsmöglichkeiten ist die bereits oben angesprochene „existentielle Entlastung“ des Individuums: In bloß kooperativen Zusammenhängen hat jedes Ereignis noch unmittelbar Bedeutung für die eigene Existenz. Jetzt jedoch „wird jene „Erkenntnisdistanz“ möglich, in welcher Beziehungen von Ereignissen untereinander als objektive Gesetzmäßigkeit faßbar werden.“ (Holzkamp 1983, S. 236) Mit dem Vorhandensein dieser Möglichkeitsbeziehung ist der andere nun nicht mehr nur ein „soziales Werkzeug“ bei der gemeinsamen Erreichung von Zielen, er ist auch nicht mehr nur „Kommunikationspartner“, mit dem ich in wechselseitiger Steuerung die gemeinsame Schaffung verallgemeinerter Lebensbedingungen plane. In der geschilderten „gnostischen Beziehung“ zur Welt ist vielmehr notwendig die Unterscheidung zwischen dem Erkenntnisgegenstand und „jeweils mir“ als dem Erkennenden beschlossen, und 95 ich erfasse damit die „anderen Menschen“ generell als Ursprung des Erkennens, des „bewußten“ Verhaltens und „Handelns gleich mir“ (ebd. S. 237 f.). Die Sozialbeziehungen werden im Zuge dieser Entwicklung – sie findet während des Entwicklungszuges der Unmittelbarkeitsüberschreitung statt – umstrukturiert. Es kommt zur Perspektivverschränkung, indem ich „vom Standpunkt meiner Weltund Selbstsicht den anderen gleichzeitig in seiner Welt- und Selbstsicht in Rechnung stelle“ (ebd.). Die in diesem Entwicklungszug vorherrschende, die Häuslichkeit aufbrechende Existenzweise des Individuums steht also in unmittelbarem Zusammenhang mit den nun notwendigen (aber auch möglichen) neuen Formen der psychischen Regulation: „Aus der Realisierung des widersprüchlichen Zueinanders zwischen der Einbezogenheit in jeweils konkrete Lebenszentren und der diese überschreitende Bezogenheit auf den gesamtgesellschaftlichen Lebenszusammenhang muß sich das individuelle Bewußtsein immer deutlicher als Ich-Bewußtsein, also als Instanz erster Person entwickeln, indem hier das Individuum nicht mehr in den jeweils kooperativen Gemeinschaften aufgeht und verschwindet, sondern sich als ich zu diesen verhalten kann, nicht aufgrund irgendeiner Potenz des Bewußtseins selbst, sondern aufgrund der materiellen Aufgehobenheit im die einzelnen unmittelbaren Kooperationseinheiten übergreifenden gesamtgesellschaftlichen Erhaltungssystem. Damit können sich dann auch die interpersonalen Beziehungen in Richtung auf „intersubjektive“ Beziehungen, in welchen sich die Individuen bewußt als Subjekte zueinander verhalten, entwickeln, was auch die Möglichkeit bewußten Verhaltens zu sich selbst, seinen eigenen Bedürfnissen, seiner eigenen Emotionalität etc. als „problematisches“ Verhältnis zur Welt und zur eigenen Person einschließt...“ (Holzkamp 1983, S. 488.) „Identität“ wird als Begriff in Holzkamps „Grundlegung“ an keiner Stelle erwähnt. Die vorstehenden Ausführungen zeigen jedoch, daß der Sachverhalt, den das Identitätskonzept erfassen will, berücksichtigt ist. Das Identitätskonzept wird jedoch nicht bloß berücksichtigt, sondern ist vielmehr im Konzept der Handlungsfähigkeit „aufgehoben“. Seit Hegel verwenden wir „aufheben“ dabei in dreifacher Bedeutung: als „beenden“, „höher heben“ und „bewahren.“ „Bewahrt“ ist das Identitätskonzept insofern, als der von ihm angesprochene Sachverhalt der Entwicklung von Selbstbewußtsein und Selbstgewißheit im Rahmen einer sozialen Eingebundenheit durch das Konzept der Handlungsfähigkeit erfaßt wird. Mit Hilfe des Identitätskonzepts kann jedoch dieser Sachverhalt nur unzureichend erfaßt werden, da zum einen das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft nur als Gegensatz verstanden und zum anderen die Gegenständlichkeit auch des kommunikativen und interaktiven Handelns in den Theorien, in die das Konzept eingebettet ist (Psychoanalyse, Symbolischer Interaktionismus und phänomenologische Soziologie und Sozialpsychologie) prinzipiell vernachlässigt wird. Daher wird der vom 96 Identitätskonzept angesprochene Sachverhalt meines Erachtens durch das Konzept der Handlungsfähigkeit adäquater erfaßt, so daß diese „Identität“ „aufhebt“ im Sinne des Hebens auf eine höhere Stufe und eine weitere Verwendung dieses Begriffs (sofern sein oben angesprochener theoretischer Rahmen mitbedacht wird) entbehrlich (also beendet) wird. Es wurde gezeigt, daß im Zuge der ontogenetischen Entwicklung von (immer höheren Stufen von) Handlungsfähigkeit sich notwendig Ich-Bewußtsein als neue Qualität der psychischen Regulation, als psychisches Korrelat zu den sozialen und sachlichen Regulationsformen der Lebenszentren/Sozialisationsinstanzen, die für das Individuum im Zuge seines Heranwachsens relevant werden, entwickelt. Dabei wurden sowohl das Sozial-Kooperative in seinen unterschiedlichen Erscheinungsformen in den verschiedenen Entwicklungszügen, als auch die Gegenstände, mit denen sozial-kooperativ in einer sich vertiefenden Kompetenz umgegangen wird, wesentlich bei der Entwicklung von Ich-Bewußtsein berücksichtigt. Die sozial-kooperativen (eben: entwicklungszugspezifischen gesellschaftlichen) Zusammenhänge sind dabei zunächst nicht von vornherein als gesellschaftliche Behinderung einer individuellen Entwicklung zu verstehen, der man unterstellt, daß sie ohne Gesellschaft spontan und zielstrebig verliefe, sondern vielmehr als Grundlage der Möglichkeit dieser Entwicklung. Gesellschaft ist also relatives Apriori oder – wenn man so will – transzendentale Bedingung der individuellen Entwicklung: „Apriori“, insofern unterschiedliche Formen von Gesellschaftlichkeit bereits vorhanden sind; bloß „relativ“, insofern Ziel der individuellen Entwicklung sein soll, zunehmend (kooperativ) Einfluß auch auf die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen nehmen zu können. Allerdings ist die Entwicklung von Ich-Bewußtsein nur eine Facette in der komplexen ontogenetischen Entwicklung, in der sich alle Dimensionen von Handlungsfähigkeit (Emotion, Motivation, Kognition, sozial-kooperatives Handeln) auf eine Weise diskontinuierlich entfalten, daß die oben vorgestellten logischen Entwicklungszüge der Ontogenese unterscheidbar werden. Wo ist nun die „Jugend“ in diesem Konzept einzuordnen? Ohne Festlegung auf Altersangaben läßt sich Jugend in einem ersten Anlauf einordnen zwischen Kindheit und Erwachsenenalter. Es liegt auf der Hand, daß – eben weil Kindheit noch eng an Häuslichkeit gebunden ist, die zunehmend abgelöst wird durch andere Lebenszentren – Jugend in den Entwicklungszug der Unmittelbarkeitsüberschreitung gehört. Die zunehmende Ablösung der Häuslichkeit als dominantem Lebensraum bringt eine starke Vergrößerung von Handlungsanforderungen und Handlungsangeboten, von neuen Möglichkeiten der Bedrohung individueller Existenz und neuen Formen der Bedrohungsüberwindung mit sich. Die neuen Handlungsmöglichkeiten bringen 97 zugleich die Notwendigkeit zur Entscheidung, zur Auswahl mit sich. Sie sind daher Aufgaben, die das Individuum bewältigen muß, wobei die Form der Bewältigung die Qualität der späteren Handlungsfähigkeit bestimmt. Bevor ich nun einige Aufgaben bzw. Bereiche, in denen sich diese Aufgaben stellen, angebe, will ich einige weitere Ausführungen zum Tätigkeitskonzept machen, die uns helfen sollen, die neuen Aufgaben systematisch zu ordnen (und damit ein Stück weit zu „begreifen“). Da die Unmittelbarkeitsüberschreitung nur handelnd und aktiv, nur durch kooperativ-gegenständliche Tätigkeit geschieht, müssen sich die ablaufenden Prozesse sinnvoll auf das Tätigkeitskonzept beziehen lassen. Es sind also sowohl die einzelnen „einfachen Momente“ (Subjekt, Mittel, Objekt), das Tätigkeitsziel sowie die gesellschaftliche Geformtheit des Tätigkeitsprozesses im Hinblick auf die Unmittelbarkeitsüberschreitung zu befragen. Da es sich bei dem „Subjekt“ des Tätigeitsprozesses in der Regel um ein kollektives Subjekt handelt (also um eine Gruppe von Menschen) und solche Gruppen – vor allem die Peers – nun eine zentrale Rolle zu spielen beginnen, läßt sich das „Subjekt“ aufschlüsseln in die Dimension der Kommunikation, Koordination, Kooperation. Schematisch läßt sich dies (ohne Berücksichtigung der gesellschaftlichen Geformtheit) darstellen wie in Abb. 10. Abb. 10: Tätigkeit und Ontogenese Kooperation Koordination Objekt – Kommunikation Subjekt – Tätigkeit – Ziel Mittel Im Hinblick auf die „Bedeutung“ ist zu differenzieren: 98 Aneignung und Vergegenst ändlichung Bedeut ung Bedeutung 1: Bedeutung 2: Bedeutung 3: vorliegende Bedeutung der Mittel und Objekte sowie der Organisationsform des Subjekts; bereits vergegenständlichte Wesenskräfte; bereitstehende Handlungsmöglichkeiten (und anforderungen): Objektive Seite der Bedeutung bislang individuell realisierte und individuell „relevante“ (das heißt: nach Maßgabe der Biographie und der Befindlichkeit) Bedeutungen (bereits angeeignete Wesenskräfte), also „Sinn“ durch Tätigkeitsprozeß entstehende neue Bedeutung; objektiv: neue Vergesellschaftung von Wesenskräften; subjektiv: individuell realisierte Handlungsfähigkeit als angeeignete Bedeutung (Ausschnitt von B1; „Sinn“) Es sind durch den Tätigkeitsprozeß als Realisierung eines angestrebten Zieles entstanden neue Aspekte bei der Verwendung der gegenständlichen Mittel (neu für das Individuum, unter Umständen aber auch neu insgesamt), neue Gegenstände (0), neue Fähigkeiten der Individuen, neue Organisationen (Kooperations-, KoordinationsKommunikationsformen) des kollektiven Subjekts. und Wetzel (1983) hat in einer differenzierten Untersuchung des ontogenetischen Entwicklungszuges der Unmittelbarkeitsüberschreitung als spezifische Prozeßelemente ermittelt: die Relativierung der materiellen Abhängigkeit der Heranwachsenden von den Eltern, die Integration der Erziehungsinstanzen Kinder/Jugendlichen in gesellschaftliche die Neustrukturierung des sozialen Beziehungsgefüges (wobei man hier die Entwicklung von Selbstorganisationsformen in der Gleichaltrigengruppe („peers“) hervorheben muß). Mit diesen tätigkeitstheoretischen Überlegungen läßt sich zumindest das dritte der genannten Prozeßelemente exakter fassen. Die Neustrukturierung des Beziehungsgefüges läßt sich im einzelnen befragen im Hinblick auf neue Formen der Kommunikation, der Koordination und der Kooperation: 99 Kommunikation: In den entsprechenden Ausführungen zum Entwicklungszug der Unmittelbarkeitsüberschneidung wurde dargelegt, daß sich eine neue Form und Funktion von Sprache entwickelt: es findet ein Aufbrechen der unmittelbaren Bindung sprachliche Zeichen – Begriff statt. Kooperation: Das Aufbrechen der Häuslichkeit und die neuen, zu bewältigenden Aufgaben machen neue Formen der sozialen Organisation möglich und nötig, wobei die psychischen Grundlagen dieser erweiterten Sozialkontakte andere sind als es die Familienbeziehungen waren. Hier spielen ferner symbolischkulturelle Formen – insbesondere die oben beschriebene Massenkultur – eine entscheidende Rolle. Koordination: Mit einer wachsenden Komplexität der Aufgaben wird eine entsprechend neue Qualität der gemeinsamen Aufgabenbewältigung nötig. Man hat die Diskontinuität dieses Entwicklungsprozesses nun dadurch versucht begreifbar zu machen, daß man unterschiedliche „Entwicklungsaufgaben“ identifiziert hat, an denen sich der Einzelne abarbeiten muß. Der Begriff der „Entwicklungsaufgabe“ zielt zunächst auf die (ontogenetische) Entwicklung des Individuums Die „Aufgabe“, von der zu sprechen sein wird, ist also zunächst eine Aufgabe für das Individuum. Da sich die Gesellschaft jedoch nur darin reproduzieren kann, wenn die heranwachsende Generation auch die auf sie zukommenden Produktions- und Reproduktionsaufgaben erfüllt, ist die Stellung jugendspezifischer Entwicklungsaufgaben sowie die Bereitstellung von Voraussetzungen für ihre Bewältigung auch eine Aufgabe für die Gesellschaft. Was ist nun „Entwicklungsaufgabe“? Die Rede von Aufgaben schließt sich an die Auffassung von Leontiew (1982) an, demzufolge Persönlichkeitsentwicklung als ein dem individuellen Subjekt ausgegebener Vollzug der Entfaltung seiner Wesenskräfte, also der Fähigkeit und Bereitschaft zum Handeln, zum Produzieren, zur Aneignung und Vergegenständlichung, ist. Aufgaben haben den Charakter der Anweisung, Handlungen zu vollziehen. Die Handlungen sollen dazu dienen, einen Zustand herbeizuführen, der vorher nicht vorhanden war, der aber für „wünschenswert“ oder „notwendig“ gehalten wird. „Aufgaben“ sind also Herausforderungen zum Handeln, die jedoch nur dann angenommen werden, wenn sie in einem Bezug zum eigenen Leben, also als „sinnvolle“ Aufgaben anerkannt werden. „Wünschenswert“ ist ein normativer Begriff. „Wünschenswert“ ist in unserem Zusammenhang eine solche Tätigkeitsabfolge, die der individuellen Entwicklung dient, die also die vorhandenen psychischen und motorischen Fähigkeiten stabilisiert und weiterentwickelt. Entwicklung soll also stattfinden; sie soll stattfinden über die Bewältigung von Aufgaben. Die Menschheit, so 100 wieder Marx, stellt sich nur Aufgaben, die sie auch lösen kann. Wo sind nun die in diesem Sinne lösbaren Aufgaben für das Individuum anzusiedeln in ihrem Schwierigkeitsgrad? Von Wygotski stammt der Vorschlag, die Entwicklung stimulierenden und unterstützenden Aufgaben in der „Zone der nächsten Entwicklung“ zu suchen. Um diese „Zone“ jedoch zu bestimmen, bedarf es der Kenntnis des ontogenetischen Verlaufs. Wie oben festgestellt, umfaßt die Zeit des Jugendalters die letzten Schuljahre, die Zeit der Berufsausbildung und die ersten Berufsjahre bzw. die Zeit des Studiums. Mit dem Festmachen des Jugendalters an den genannten Ereignissen habe ich die meines Erachtens entscheidenden Entwicklungsaufgaben für den Jugendlichen genannt. Die Jugendzeit ist die Zeit der Loslösung von der Familie, die in der Regel bei Kindern noch der zentrale Einflußbereich ist. Insbesondere wird die Bereitstellung von Entwicklungsmöglichkeiten sowie die Behinderung von Entwicklung in der Familie „personal“ gesehen und interpretiert. In der Jugendphase findet insofern ein Aufbrechen dieser (kindlichen) Häuslichkeit statt, als nun außerhäusliche „Institutionen“ an Einfluß gewinnen und bestimmend für die Entwicklung werden. In diese Zeit einer allgemeineren Vergesellschaftung fällt in der Regel die Schaffung der Grundlage, später durch eigene Berufstätigkeit seinen Lebensunterhalt bestreiten zu können. Im Zuge einer politischen Entwicklung, in der häufiger „sinnvolle Betätigung“ als Alternative zur Berufstätigkeit empfohlen wird, muß auf die prinzipielle Unersetzbarkeit der Möglichkeit, selber seinen Unterhalt bestreiten zu können, hingewiesen werden. Es hat meines Erachtens wenig Sinn, entgegen gesellschaftlich verbreiteten Werthaltungen etwa kulturell-ästhetische Betätigung als Alternative zu empfehlen, und dies selbst dann, wenn sie Alternative zu einer sinnentleerten Tätigkeit am Fließband sein sollte. Denn „Arbeit“ umfaßt nicht nur den eigentlichen Produktionsablauf, der in der Tat sinnentleert und persönlichkeitsdeformierend sein kann. Arbeit umfaßt darüber hinaus die betriebliche Interessenvertretung oder die Möglichkeit zu Sozialkontakten außerhalb der Wohnung. In diesem Zusammenhang ist auf die empirischen Befunde, insbesondere von Baethge, zur veränderten Rolle von Arbeit im Leben Jugendlicher hinzuweisen. Denn entgegen allen Annahmen über eine postmaterialistische und hedonistische Jugend, die zeitweilig die Diskussion bestimmt haben, scheint die Realität anders auszusehen: „Anders als Demoskopie und landläufige Meinung uns lange Zeit glauben machen wollten, hat die Jugend die Erwerbsarbeit innerlich nicht abgeschrieben. Im Gegenteil: für die Mehrheit gilt, daß sie Arbeit und Beruf bei ihrer Suche nach Identität einen hohen, häufig einen zentralen Stellenwert zusprechen. Wenn wir auf der Basis mehrjähriger empirischer Forschung dem kulturkritischen Trend, eine ganze Generation in ihrem subjektiven Verhältnis 101 zur Arbeit krank zu schreiben, nicht folgen, so bedeutet das nicht, die traditionelle Arbeitsmoral zu bestätigen und für in Ordnung zu erklären. Denn tatsächlich hat sich vieles zwischen der Jugend und der Arbeit verändert, was uns neue Probleme aufgibt. Unser zentrales Ergebnis läßt sich in einem Widerspruch zuspitzen. In den persönlichen Identitätsentwürfen hat die Erwerbsarbeit für die Mehrheit der Jugendlichen einen hohen Stellenwert, gleichzeitig scheint sie für immer weniger Jugendliche den Kristallisationspunkt für kollektive Erfahrungen und die Basis für soziale und politische Identitätsbildung abzugeben.“ (Baethge 1988, S. 58f ). Mit der Ablehnung eines Ersatzes für die Möglichkeit einer angemessenen Ausbildung und Berufsausübung steht zugleich ein Maßstab zur Beurteilung unserer Gesellschaft bereit. Wenn man sich darauf einigen kann, daß „Gesellschaft“ als politische, ökonomische und soziale Veranstaltung nicht Selbstzweck ist oder den Interessen einzelner Personen oder Institutionen zu dienen hat, sondern daß sich die Qualität ihrer Organisation daran messen lassen muß, wie mit den Entwicklungsmöglichkeiten jedes einzelnen ihrer Mitglieder umgegangen wird, dann muß die Ausbildungs- und Beschäftigungssituation jedes Jugendlichen eine zentrale Rolle spielen. Berücksichtigt man ferner die Tatsache, daß die wichtigste gesellschaftliche Produktivkraft der Mensch selber ist, so ergibt sich verschärft – nun auf gesellschaftlicher Ebene – das bereits oben angeführte Problem: Daß sich Menschen – nun auch noch massenhaft – begründet gegen ihre objektiven Interessen verhalten können, insofern „die“ Gesellschaft in ihr vorhandene Ressourcen nicht nutzt. (Vgl. zur psychischen Verarbeitung der gesellschaftlichen Entwicklung insbesondere die Shell-Studie „Jugend '97“ – Jugendwerk 1997). Für das in dieser Arbeit diskutierte Problem ergibt sich nunmehr, daß auf dem Ansatz „Jugend als Entwicklungsaufgabe“ selbst dann noch zu beharren ist, wenn die Empirie zeigt, daß solche Aufgaben einer großen Anzahl Jugendlicher versagt bleiben und daß – als gesellschaftliches Verarbeitungsangebot dieses Vorenthaltens – Resignation, Realitätsabwehr und Anspruchsreduktion angeboten werden. Die Ablehnung eines Surrogates für Ausbildung und Arbeitstätigkeit bedeutet nun jedoch nicht eine Ablehnung der angebotenen Alternativen schlechthin, sondern lediglich die Ablehnung der Behauptung ihrer Gleichwertigkeit. Denn natürlich kann kulturell-ästhetische Praxis gerade den gesellschaftlich sanktionierten Verarbeitungsformen der Misere entgegenwirken, indem Erkenntnis-, Genuß- und Aufklärungsfunktion künstlerischer Medien bewußt ausgenutzt werden. Natürlich ist es wichtig – da an einer schlechten Realität ohnehin so schnell nichts geändert werden kann – die Möglichkeit, mit einer ästhetisch-kulturellen Praxis Zutrauen zur eigenen Fähigkeit zu entwickeln, zu nutzen und auf diese Weise die Entwicklung produktiver Bedürfnisse voranzutreiben. Die oben angesprochenen 102 unterschiedlichen Artikulationsformen Jugendlicher können demnach geradezu danach bewertet werden, inwieweit sie dem Abfinden mit der Situation dienen, oder ob sie vielmehr Ausdruck eines noch unbewußten Protestes oder Widerstandes sind. Sie sind daraufhin zu befragen, wie gesellschaftliche Konflikte und Widersprüche verarbeitet werden (ob durch Abwehr, Verdrängung, Personalisierung oder Privatisierung oder auch durch Entwicklung einer neuen, möglichkeitserweiternden Handlungsbereitschaft, durch Entwicklung neuer Regulationsformen, eines kollektiven Problemverständnisses etc.). Ich komme hierauf zurück. Die Entwicklungspsychologie beschäftigt sich mit Jugend unter anderem unter dem Gesichtspunkt der Adoleszens. In diesem Zusammenhang ist die Rede von „Entwicklungsaufgaben“ durchaus geläufig. Hurrelmann und andere (1985, S. 125) geben die folgenden Entwicklungsaufgaben an, die in der psychologischen Literatur zur Kennzeichnung der Jugendphase geläufig sind: Entwicklung einer intellektuellen und sozialen Kompetenz, um selbstverantwortlich schulischen und anschließend beruflichen Qualifikationen nachzukommen, mit dem Ziel, eine berufliche Erwerbsarbeit aufzunehmen und dadurch die eigene ökonomische und materielle Basis für die selbständige Existenz als Erwachsener zu sichern. Entwicklung der eigenen Geschlechtsrolle und des sozialen Bindungsverhaltens zu Gleichaltrigen des eigenen und des anderen Geschlechts, Aufbau einer heterosexuellen Partnerbeziehung, die langfristig die Basis für die Erziehung eigener Kinder bilden kann. Entwicklung eines eigenen Wert- und Normensystems und eines ethischen und politischen Bewußtseins, das mit dem eigenen Verhalten und Handeln in Übereinstimmung steht, so daß langfristig ein verantwortliches Handeln in diesem Bereich möglich wird. Entwicklung eigener Handlungsmuster für die Nutzung des Konsumwarenmarktes und des kulturellen Freizeitmarktes (einschließlich Medien und Genußmittel) mit dem Ziel, einen eigenen Lebensstil zu entwickeln und zu einem autonom gesteuerten bedürfnisorientierten Umgang mit den entsprechenden Angeboten zu kommen. Wilfried Ferchhoff und Georg Neubauer stellen den folgenden Katalog von Entwicklungsaufgaben zusammen: 1. Akzeptanz der eigenen körperlichen Erscheinung und effektive Nutzung des Körpers: sich des eigenen Körpers bewußt werden, den Körper in Sport und Freizeit, aber auch in der Arbeit und bei der Bewältigung der täglichen Aufgaben sinnvoll zu nutzen. 103 2. Erwerb der männlichen bzw. weiblichen Rolle: der Jugendliche muß eine individuelle Lösung für das meistens stereotyp geschlechtsverbundene Verhalten und für die Ausgestaltung der Geschlechtsrolle auf der Basis des Anpassungsdrucks von Eltern und Peers finden. 3. Erwerb neuer und reiferer Beziehungen zu Altersgenossen beiderlei Geschlechts: hierbei gewinnt die Gruppe der Gleichaltrigen an Bedeutung. 4. Lockerung, Ablösung und Gewinnung emotionaler Unabhängigkeit von den Eltern und anderen Erwachsenen und Hinwendung zu ausgewählten Peers: für die Eltern ist gerade diese Entwicklungsaufgabe schwer einsehbar und oft schmerzlich. Obwohl sie ihre Kinder gerne zu tüchtigen Erwachsenen erziehen wollen, möchten sie die familiäre Struktur mit den wechselseitigen Abhängigkeiten möglichst lange aufrecht erhalten. Dieser Prozeß der Umstrukturierung des sozialen Netzwerkes kann innerfamiliär zu Konflikten führen. Konfliktstoff ist vor allem die Ausübung und das Ausmaß elterlicher Kontrolle, die sich auf folgende Bereiche erstreckt: Häufigkeiten, Dauer des Weggehens, Umgang mit Peers, Orte der Peers, Relationen, Kleidung und Aussehen sowie Verwendung des Geldes. 5. Qualifikationsbezogene Vorbereitung auf die berufliche Karriere: Lernen bzw. Qualifikationserwerb im Jugendalter zielt direkt (bei berufstätigen Jugendlichen) oder indirekt (in weiterführenden Schulen) auf die Übernahme einer beruflichen Tätigkeit in die soziale Plazierung im Gesellschaftsgefüge ab. 6. Vorbereitung auf Heirat und Familienleben: sie bezieht sich auf den Erwerb von Kenntnissen und sozialen Fertigkeiten für die bei Partnerschaft und Familie anfallenden Aufgaben. Die Verlängerung der Lernzeit bis häufig weit in das dritte Lebensjahrzehnt macht im Zusammenhang mit dem säkularen Wandel allerdings auch neue Lösungen notwendig. 7. Gewinnung eines sozial-verantwortungsvollen Verhaltens: Bei dieser Aufgabe geht es darum, sich für das Gemeinwohl zu engagieren und sich mit der politischen und gesellschaftlichen Verantwortung des Bürgers auseinanderzusetzen. 8. Aufbau eines Wertsystems und eines ethischen Bewußtseins als Richtschnur für eigenes Verhalten: Die Auseinandersetzung mit Wertgeltung in der umgebenden Kultur soll in diesem Lebensabschnitt zum Aufbau einer eigenständigen internalisierten Struktur von Werten als Orientierung für das Handeln führen. 9. Über sich selbst im Bilde sein (und ein relativ „stabiles Selbstkonzept“ auszubilden), wobei Triebe und Affekte im Rahmen der Selbstkontrolle zu beherrschen sind und Mündigkeit als Persönlichkeitsentwicklung an Bedeutung gewinnt. 104 10.Aufnahme intimer und emotionaler Beziehungen zum Partner/zur Partnerin (Sexualität, Intimität). Es ist darauf hinzuweisen, daß heterosexuelle Beziehungen von Jugendlichen eine breite Streuung aufweisen und nicht mit genitaler Sexualität gleichgesetzt werden sollen. 105 11.Entwurf eines Lebensplans auf der Basis mehr oder weniger institutionalisierter Ablaufmuster von Lebensläufen. Entwicklung einer Zukunftsperspektive, die gern in eigene Regie genommen würde. (Ferchhoff/Neubauer 1989, S. 121f.). Eine Ähnlichkeit zwischen den beiden Katalogen von Entwicklungsaufgaben und Konzeptentwurf ist nicht zu verkennen. Insbesondere wird in beiden Fällen die besondere Rolle der Berufsvorbereitung für die Entwicklung hervorgehoben. Es ist festzuhalten: Das Konzept „Jugend als Entwicklungsaufgabe“ enthält als erste Konkretisierung die Untersuchung jugendspezifischer Entwicklungsaufgaben. Man kann in dieser Frage auf zahlreiche Vorarbeiten zurückgreifen, in denen „Kindheit“, „Jugend“ und (junges) „Erwachsenenalter“ in ihren jeweiligen Entwicklungsaufgaben unterschieden werden. Dabei dürfen wir die Notwendigkeit der Gesellschaft für das Stattfinden von Entwicklung nicht ausklammern oder diese gar als bloß der Entwicklung widerständig entgegensetzen, sondern sehen „Gesellschaft“ als unabdingbare Entwicklungsvoraussetzung, deren Bereitstellung von Chancen und Behinderungen jeweils konkret-historisch untersucht werden muß. Neben den im letzten Abschnitt angesprochenen Entwicklungaufgaben in der Lebensphase Jugend kann man den durch diese einzelnen Aufgaben bestimmten biographischen Zeitraum als ganzen – eben die „Jugend“ eines Menschen – als Entwicklungsaufgabe bestimmen. Es ist eine mehr oder weniger scharf abgetrennte Lebensphase mit ihren Möglichkeiten und Notwendigkeiten, die – über die Zersplitterung und Atomisierung in einzelne Teilaufgaben hinaus – als Ganzes eine Einheit von Anforderungen und gelungenen und mißlungenen Problembewältigungen und Konfliktverarbeitungen darstellt, durch die die erwachsene Persönlichkeit als relativ stabile Einheit von Kenntnissen, Ansichten, Werten, Fähigkeiten entsteht. Die so verstandene Jugend als Gesamtheit der einzelnen Aufgaben hängt zwar ab von der jeweiligen Bewältigung der einzelnen Aufgaben, ist als ganzes jedoch mehr als die bloße Summe der Bewältigungen. Damit ist eine zweite Bedeutung der Rede von der „Jugend als Entwicklungsaufgabe“ gewonnen. Diese Bedeutung spielt insbesondere dort eine Rolle, wo über Lebenslauf und Biographie nachgedacht wird (Berger/Hradil 1990). „Jugend“ ist nicht nur ein Begriff, der eine bestimmte Lebensphase in der individuellen Entwicklung beschreibt: die besondere politische Relevanz erhält „Jugend“ als Bezeichnung einer umfangreichen gesellschaftlichen Gruppe. Als gesellschaftliche Kategorie soll nun „Jugend“ als die Gruppe von den 106 Gesellschaftsmitgliedern verstanden werden, die – jeweils individuell – die „Lebensphase Jugend“ durchlaufen. Offensichtlich ist dies keine konstante Gruppe mit festen Mitgliedern, sondern eine bestenfalls im Fließgleichgewicht befindliche Gruppe: „Jugend“ in einer Gesellschaft ist unter Berücksichtigung der Geschichtlichkeit der Gesellschaft eine sich ständig wandelnde Population. Die so verstandene Jugend ist nun für die Gesellschaft eine Entwicklungsaufgabe. Machen wir uns kurzzeitig den Blick des Historikers zu eigen, dessen Interesse sich weniger auf das einzelne Individuum, sondern vielmehr auf Gesellschaften im historischen Ablauf richtet, so läßt sich dieses neue „Subjekt der Geschichte“ ebenfalls auf seine „ontogenetischen“ Entwicklungsgesetze befragen. Aus gesellschaftstheoretischer Sichtweise wird man konstatieren können, inwieweit der historische Ablauf, also die Entwicklung einer bestimmten Gesellschaft, von der jeweiligen, konkret-historischen Binnenstruktur abhängt. Da es geschichtlich gesehen so ist, daß die heute Heranwachsenden morgen die Träger der gesellschaftlichen Ausstattung sind, so wird man annehmen können, daß es im Hinblick auf die Zukunft der Gesellschaft nicht gleichgültig ist, wie diese zukünftigen Produzenten des gesellschaftlichen Reichtums auf diese Aufgabe vorbereitet werden. „Jugend“ wird daher für die Gesellschaft zu einer Aufgabe, die sie im Interesse ihrer eigenen Entwicklung bewältigen muß. Die Bereitstellung von Entwicklungsaufgaben für die Jugendlichen sowie die Schaffung von Möglichkeiten, diese Aufgaben auch zu bewältigen, darf also als Grundlage für die Bewältigung der „Entwicklungsaufgabe Jugend“ für die Gesellschaft gesehen werden. Jugendpolitik erhält somit neben der Förderung der Jugend als zentrale Aufgabe die Gestaltung des Prozesses, in dem die „Gesellschaft“ ihre Entwicklungsaufgabe Jugend löst. Auf beiden Ebenen, der gesellschaftlichen und der individuellen, ist die Entwicklung des Einzelnen also kein harmonischer und linear ablaufender Prozeß. Betrachten wir daher die Widerständigkeit dieses Prozesses etwas genauer. Mit dem Aufbrechen der häuslichen Unmittelbarkeit gewinnen außerhäusliche Faktoren auf die individuelle Vergesellschaftung an Einfluß. Bei diesem Prozeß fallen auf einer phänographischen Ebene verschiedene Merkmale besonders auf: War die häusliche Gesellschaftsform noch stark durch familiäre Emotionen geprägt, so erfolgt nun schon alleine durch die starke Vergrößerung des Aktionsfeldes eine Ent-Emotionalisierung der Sozialkontakte. Waren in der Familie – über die Familienmitglieder (aber auch über die Familie als Einheit, die mehr als die Summe ihrer Mitglieder ist) als 107 Vermittlungsorgan – gesellschaftliche Anforderungen und Verhaltensstandards noch gebunden an Personen, die somit mit diesen Anforderungen identifiziert werden konnten, so tritt nun eine Anonymisierung der Anforderungen ein. Es wird also eine neue Stufe der Vergesellschaftung möglich, eben weil eine neue Stufe von „Gesellschaft“ zugänglich wird. Damit ändern (vergrößern) sich Chancen und Anregungspotential für die weitere Entwicklung; es stellen sich neue Aufgaben und Anforderungen, aber auch neue Handlungsmöglichkeiten, diese Aufgaben zu bewältigen. Es wird also zumindest in zweifacher Hinsicht ein bewußtes Verhalten notwendig: zu den Anforderungen und Aufgaben und zu den angebotenen Verarbeitungsformen. Die Ent-Emotionalisierung dieser Vorgänge ist dabei eine wesentliche Voraussetzung für das bewußte (was ja auch heißt: kritische) Verhalten-zu. Die hier angedeuteten Tendenzen werden gelegentlich als zunehmende Komplexität der nun entstehenden Lebenssituation interpretiert. Bezogen auf das Individuum kann dem nicht sofort zugestimmt werden, da sich in gleichem Maße – wie angedeutet: geradezu bewirkt durch diese herausfordernde Situation – neue emotionale, kognitive und soziale Bewältigungsformen entwickeln. In psychologischer Perspektive – was hier heißt: Komplexität nicht schlechthin, sondern Komplexität für das Individuum – steht also einer objektiv sich vergrößernden Komplexität ein sich ebenfalls vergrößerndes Instrumentarium zur Organisation, Bewältigung und Reduzierung dieser Komplexität zur Verfügung. Man kann sagen: Ein Kriterium für den Erfolg des Vergesellschaftungsprozesses ist darin zu sehen, daß die Komplexität (und dann: wie sie) bewältigt wird, also in dem Maß der entwickelten Handlungsfähigkeiten angesichts sich vergrößernder Handlungsaufforderungen, -möglichkeiten und angebote. Die hier bislang erst illustrierte Situation wird in der Sozialisationsforschung als Fortsetzung der ihrerseits in der Familie begonnenen zweiten „soziokulturellen Geburt“ verstanden und mit Begriffen wie „Sozialisation“ und „Enkulturation“ zu erfassen gesucht. Es handelt sich wie dargestellt um entscheidende Etappen der (psychischen und sozialen) „ldentitätsentwicklung“. Familie, Straße, Kindergarten oder Schule, Betrieb, Jugendzentrum etc. sind dabei Instanzen in diesem Sozialisationsprozeß (vgl. Hurrelmann/Ulich 1984 bzw. 1995). „Die Gesellschaft“ ist ein Abstraktum, mit dessen empirischem Korrelat der Einzelne in entwickelteren Gesellschaftsformen nicht unmittelbar zu tun bekommt. Die Beziehung Individuum – Gesellschaft ist vielmehr vielfältig vermittelt. Dies beginnt bereits bei den ersten Entwicklungsschritten des 108 gezeugten Menschen, der sehr bald sensitive Kontakte mit seiner Umgebung aufnimmt. Es setzt sich fort bei der allmählichen Aneignung der – zunächst natürlich sehr kleinen – Umgebung. Die Art der Befriedigung der unmittelbaren Bedürfnisse, die ersten Kommunikationsformen – all dies ist gesellschaftlich geprägt und ist damit Teil der spezifischen soziokulturellen Aneignung. Spielmittel, Spielformen, Sprache, auch schon: gesellschaftliche Erwartungshaltungen, etwa wann das Kind „stubenrein“ sein sollte, sind sozial geformt und zielen auf die Einordnung in soziale Zusammenhänge hin, sind also zugleich Integration in Soziales und damit auch Bereitstellung vergrößerter Entwicklungsmöglichkeiten. „Gesellschaft“ tritt also an das Individuum in Form verschiedener Lebenszentren bzw. Sozialisationsinstanzen heran. Diese stehen zwischen Individuum und „Gesellschaft“, sind daher sowohl Bindeglied als auch Trennungsmoment. Sie konstituieren sich natürlich durch die Tätigkeit der beteiligten Individuen, ebenso wie sie wiederum „Gesellschaft“ konstituieren. „Konstituieren“ heißt hierbei jedoch nicht „determinieren“. Vielmehr entwickelt sich eine relative Autonomie sowohl gegenüber den beteiligten Personen als auch gegenüber der „Gesellschaft“. Aus dieser Zwischenstellung und der relativen Autonomie ergibt sich als Folgerung, nach spezifischen Regulationsformen zu fragen, die in den einzelnen Lebenszentren vorherrschen. Zu diesen Regulationsformen sind die psychischen Regulationsformen der Individuen in Beziehung zu setzen – und auch ein Stück weit damit zu erklären. Die Regulationsformen der Lebenszentren sind – eben weil Lebenszentren eine wesentliche Form sind, in der Gesellschaft auf das Individuum einwirkt – wiederum in Beziehung zu setzen zu gesellschaftlichen Gesetzmäßigkeiten und Regulationsformen. Man hat also gesellschaftliche Regulationsformen, Gesetzmäßigkeiten und Anforderungsprofile, etwa als Individualitätsformen Regulationsformen des jeweiligen Lebenszentrums und psychische (Regulations-) Formen des Individuums je gesondert und auch in ihrem Einfluß auf die jeweils anderen zu untersuchen. Aus all diesen Entwicklungsvorgaben und -möglichkeiten, Anforderungen (die sich zum Teil widersprechen können) zusammen mit weiteren soziokulturellen Merkmalen wie Geschlecht, Wohnort, Religionszugehörigkeit, soziokulturelle Orientierungen etc. kristallisiert sich für jedes einzelne Individuum dessen spezifischer „Habitus“ als wichtiger Teil seiner Persönlichkeitsentwicklung heraus (vgl. umfassend Hurrelmann/Ulich 1995, Teil 4). Welche Widersprüche lassen sich in diesem Beziehungsgeflecht identifizieren? 109 Böttcher (in Deinhard/Sparschuh 1983, S. 8 f.) gibt die folgenden Widersprüche an, die in der jugendlichen Entwicklung eine Rolle spielen: Alternative Jugendkulturen, Jugendproteste, Jugendprobleme signalisieren insofern gesellschaftliche Mißstände, als mit der zunehmenden Institutionalisierung, Bürokratisierung des Systems zwischen gesellschaftlichen Anforderungen und der Zuweisung sozialer Chancen ein Mißverhältnis entsteht. Die Institutionalisierung und die Bürokratisierung verhindern die Fähigkeit zum sozialen Lernen, die Fähigkeit zum kollektiven Verhalten und fordern die „Ellbogen“-Konkurrenz. Der zweite Widerspruch besteht zwischen der Notwendigkeit zur gesellschaftlichen Integration der jungen Generation einerseits als dem Problem der Sozialisation und andererseits der angeblichen Notwendigkeit zur Aufrechterhaltung bestehender Machtverhältnisse in unserer Gesellschaft, also der Frage der Reproduktion. Jugendliche sind weitgehend Objekte von Entscheidungen, und zwar Objekte von Entscheidungen der Erwachsenenwelt. Sie haben keine Möglichkeit, in ihre subjektiven Bedürfnisse selbst einzugreifen, sozusagen die Entscheidungen für sich selbst zu fällen oder zumindest in die Überlegungen der Entscheidungsfindung durch die Erwachsenenwelt einbezogen zu werden. In derselben Arbeit finden sich weitere Widersprüche (ebd., S. 32 f.): den Widerspruch zwischen Leben und Lernen, wie er sich am sinnfälligsten im öffentlichen Schulwesen zeigt, den Widerspruch zwischen Ausbildung und tatsächlich erreichbarem Beruf, die Gegensätzlichkeit der Werte einmal in Schule und Beruf, zum andern in der Freizeit, der Widerspruch zwischen dem bruchstückhaften Fertigwissen in der Schule und dem Bedürfnis nach Ganzheitlichkeit, der Widerspruch zwischen verbreitetem Mythos und verbreiteter Ideologie und der tatsächlich vorfindlichen realen Situation, den Gegensatz zwischen der Ausweitung des Schonraumes der Jugend und wachsendem Druck und Kontrolle in diesem Bereich, die Ausweitung von Ausbildungs- und Lernzeit und die Verringerung der Chancen zur Identitätsbildung in dieser Zeit. Ich will es bei Nennung dieser Widersprüche bewenden lassen. Es wird deutlich, daß diese Widersprüche nicht bloß auf die Unterschiedlichkeit von Handlungsaufforderungen und -möglichkeiten verschiedener Lebenszentren/Sozialisationsinstanzen hinweisen, sondern in dieser zu bewältigenden Widersprüchlichkeit ebenfalls Entwicklungsaufgaben für das 110 Individuum darstellen – ebenso wie die Entwicklungsaufgaben einen Widerspruch/eine Nichtübereinstimmung zwischen vorhandener und erforderlicher Handlungskompetenz zugrunde legen. Allerdings bedeutet der Zusammenhang von Entwicklungsaufgabe und Widerspruch nicht gleich eine Identität von beidem, wenn auch gewisse strukturelle Ähnlichkeiten im Hinblick auf ihren Herausforderungscharakter gegenüber dem Individuum bestehen. Es ist nun bei der Aufzählung der oben genannten Widersprüche zu berücksichtigen, daß sie nicht alle jugendspezifisch sind. Vielmehr ist zu fragen, ob nicht die Probleme jeweils von arbeitslosen Jugendlichen – arbeitslosen Erwachsenen, studentischen Jugendlichen – Hochschulabsolventen im Beruf, Jugendlichen aus der Arbeiterklasse – erwachsenen Arbeitern eher vergleichbar sind als die Probleme der unterschiedlichen Gruppen von Jugendlichen untereinander. Dies führt zu der folgenden vorläufigen These: Die unterschiedlichen gesellschaftlichen Funktionsbereiche produzieren je unterschiedliche, in sich und auch untereinander zum Teil widersprüchliche Anforderungen und Vergesellschaftungsbedingungen. Diese werden je nach Klasse und Standort, zwar bei unterschiedlichen biographischen Voraussetzungen, jedoch bei gemeinsamer ontogenetischer Gesetzmäßigkeit wahrgenommen, erfüllt und verarbeitet. Es entstehen Verarbeitungsformen, die – weil die Bedingungen und Standorte überindividuell sind – zur Bildung von Gruppen führen. Es gibt also eine gesellschaftliche Produziertheit von Widersprüchen und Vergesellschaftungsbedingungen auf der einen Seite und individuelle Biographien auf der anderen Seite. Es entstehen „Teilkulturen“, die der gemeinschaftlichen Realisierung individueller Bedürfnisse auf der Grundlage gesellschaftlicher Realisierungsbedingungen dienen. Im Hinblick auf die Entwicklung verallgemeinerter Handlungsfähigkeit ist zu fragen, welchen Beitrag sowohl die Lebenszentren einschließlich der Peers und sonstigen gesellschaftlichen Gruppen leisten: Was leisten sie im Hinblick auf die verschiedenen Funktionsaspekte von Handlungsfähigkeit: welche Form der Kognition, der Emotion-Motivation und des Sozial-Kooperativen werden gefördert/behindert? Wie geschieht – als wesentlicher Bestandteil verallgemeinerter Handlungsfähigkeit, die sich nicht bloß mit dem gegebenen Rahmen von Handlungsmöglichkeiten zufrieden geben kann – der Verweis auf das (gesellschaftliche) Ganze? Welche Formen der Problem- und Konfliktverarbeitung werden praktiziert, welche sanktioniert? 111 Welche Möglichkeiten der Perspektiventwicklung sind vorhanden? Da „Jugend“ als Übergang von der Aneignungszur Vergegenständlichungszentriertheit gesehen werden muß, ist neben der Untersuchung der Aneignung von Bedeutungen wesentlich die Möglichkeit zur Konstitution von Bedeutung einzubeziehen. Dies konkretisierend: Findet eine Emotionalisierung und Personalisierung gesellschaftlicher Vorgänge statt, werden etwa die Übernahme einer Konsumentenideologie und ein (wenn auch nur zeitweiliger) Rückzug auf „allgemein-menschliche“ Probleme und idyllische Scheinlösungen gesellschaftlicher Konflikte nahegelegt? Dies erfordert, die „Bedeutungsstrukturen“/Handlungsmöglichkeiten in jedem Zentrum sowie die Verarbeitungsformen und Bewältigungsstrategien in jeder Teilkultur zu untersuchen. Zumindest einige Schritte in diese Richtung werden in Kap. 6.3 vorgestellt. Insbesondere ist eine (erneute) Thematisierung der Prozeßhaftigkeit dieser Entwicklungsprozesse dort in den Blick der Forschung geraten, wo Lebenslauf und Lebensführung – meist unter besonderer Focussierung auf den Alltag – thematisiert werden (Projektgruppe 1995). Mit dieser soziologischen und sozialpsychologischen Thematisierung korrespondiert auf philosophischer Ebene das Interesse an „Lebenskunst“ (Schmid 1998), das inzwischen auch die pädagogische Praxis erreicht hat (Baer 1997, Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung 2000). 3.3 Persönlichkeitstheoretische Konsequenzen Die Philosophie, so Kapitel 2, stellt auf sehr allgemeiner Ebene Kategorien zur Verfügung, die den „Einzelnen“ verstehen helfen sollen. Philosophie – als auch zeitgebundenes Deutungsprojekt einer Gesellschaft – ist jedoch Teil eines historischen Prozesses. Dies hat u.a. zur Folge, daß sie nicht unabhängig von der je vorhandenen Empirie betrachtet werden kann und daß ihre Konzepte, Begriffe und Ideen sehr schnell Teil eines sehr handfesten politischen Meinungsstreites – also ideologisch – werden können. Im vorangegangenen Kapitel wurde daher versucht, über historische Reflexionen für eine zeitgemäße Persönlichkeitstheorie relevante Kategorien zu finden, also die ideologische Überformung von Begriffen wie „Ich“, „Subjekt“, „Person“ etc. zumindest aufzuzeigen. Im Ergebnis wurde bei aller Respektierung der Historizität und Ortsgebundenheit der genannten Begriffe ihre aktuelle Relevanz aufrecht erhalten. Die Anthropologie als weitere philosophische Disziplin stützt – so wurde gezeigt – diese Annahmen. Damit ist das „Menschenmögliche“ an Entwicklung 112 aufgezeigt. Daß dies nicht nur Spekulation ist, zeigen die „funktionalistischen Ableitungen“ von Holzkamp und seinen Kollegen. Damit kann man die nächste Stufe in der Präzisierung der Persönlichkeitstheorie angehen: Nämlich die Frage zu behandeln, was in einer speziellen Gesellschaft historisch-konkret an Entwicklungsmöglichkeiten gegeben ist. Dazu ist es nicht nur nötig, die je nach sozialem Standort unterschiedlichen Entwicklungsmöglichkeiten zu erfassen, es stellt sich zudem das Problem, mit welchen Instrumenten diese Gegebenheiten erfaßt werden können und wie die Beziehung des Einzelnen in seinem Kontext konzeptionalisiert wird. Genau dies beansprucht die Sozialisationsforschung zu tun, die sich spätestens seit den siebziger Jahren auf die Nahtstelle Einzelner/Gesellschaft konzentrierte. Auch hierbei ist es hilfreich, die Beziehung des Einzelnen und der Gesellschaft im historischen Prozeß zu untersuchen. Einzelne Ergebnisse sind etwa: „Gesellschaft“ differenziert sich vielfältig aus: in die großen Gesellschaftsbereiche Produktion, Distribution, Konsum; in Klassen, Gruppen, Schichten, Milieus; in Lebenswelten von Männern und Frauen; Kinder, Jugendliche und Erwachsene etc. „Gesellschaft“ in diesem ausdifferenzierten Sinne ermöglicht Entwicklung und begrenzt sie. Auch die Konzepte, Begriffe und Theorien der Erfassung dieser Prozesse und Beziehungen sind nicht wertfrei; so haben etwa „Rolle“ und „Individualitätsform“, die sich beide auf gesellschaftliche Anforderungsstrukturen an den Einzelnen beziehen, durchaus unterschiedliche Logiken und Erkenntnisinteressen. „Handlungsfähigkeit“, die Entwicklung immer ausdifferenzierter Systeme von Tätigkeiten in der Ontogenese, diese wiederum verstanden als Prozeß einer tätigen Abarbeitung an Entwicklungsaufgaben und Widersprüchen: all dies erweist sich als soziologische Entwicklungstheorie, die mit dem philosophischen Kategoriensystem aus Kapitel 2 kompatibel ist und dieses ein Stück weit konkretisiert. Trotzdem bleiben weitere Fragestellungen, die somit in den nächsten Kapiteln behandelt werden sollen: nämlich einen tieferen Einblick in die beiden Pole zu geben, die die soziologische Persönlichkeitstheorie vermitteln soll: die Binnenstruktur des Einzelnen (Kap. 4) und die Struktur der „Gesellschaft“, so wie sie sich heute (in Deutschland) darstellt (Kap. 6). Insbesondere will ich im nächsten Kapitel die Ontogenese im Hinblick darauf ein Stück weiter verfolgen, welche Modellvorstellungen über die innerpsychischen Prozesse entwickelt worden sind. 113