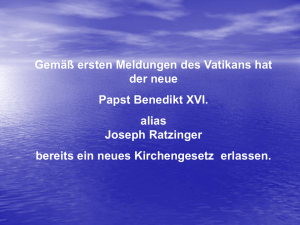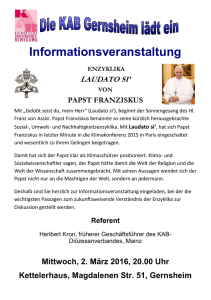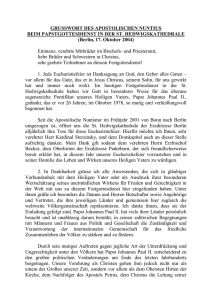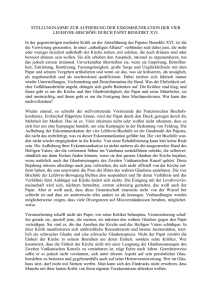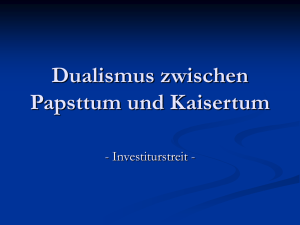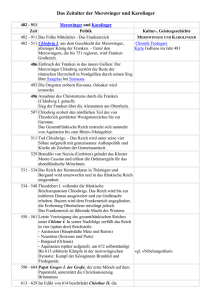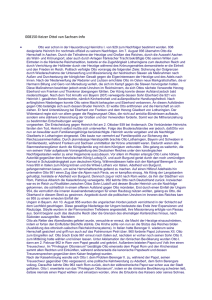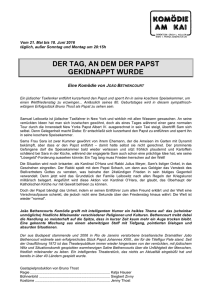Die Gründung der heutigen Benediktinerabtei Ottobeuren mit ihrer
Werbung

Ottobeurer Studienwoche 2014 Das Haus Gottes und Pforte des Himmels 1250 Jahre Benediktinerabtei Ottobeuren I: Tradition und Geschichte. 1250 Jahre Benediktinerabtei Ottobeuren 29. Mai 2014 (Christi Himmelfahrt) Prof. Dr. Manfred Weitlauff, Universität München Ottobeuren I: Königtum, Papsttum, Mönchtum 8.-11. Jahrhundert Die Gründung der heutigen Benediktinerabtei Ottobeuren mit ihrer grandiosen barocken Klosteranlage und ihrer Basilika, Höhepunkt der Sakralbaukunst des Barockzeitalters – ein wahrhaft singuläres Weltkulturerbe -, fällt nach der Haustradition in das Jahr 764: in die Mitte des für die europäische Geschichte und für Kirche und Papsttum höchst bedeutsamen 8. Jahrhunderts. Und diese Abtei zählt zu den ältesten frühmittelalterlichen Klostergründungen im schwäbisch-bayerischen Raum und besteht seit Ihrer Gründung ununterbrochen bis zum heutigen Tag. Ich möchte deshalb im ersten Vortrag das „Umfeld“ der politischen, kirchlichen und kulturellen Entwicklung und darin eingebunden den Weg der Durchsetzung der Benediktsregel und ihrer Entfaltung skizzieren, ehe ich im zweiten Vortrag die Geschichte der Abtei Ottobeuren bis zum Ende des 17. Jahrhunderts schildere und im dritten Vortrag die Kirche der Abtei zu erschließen suchen werde, mit „Ausblick“ auf die Säkularisation und deren Folgen für das Schicksal der Abtei. Das 8. Jahrhundert ist die Zeit des Aufstiegs der Pippiniden, die als Hausmeier im Dienst der fränkischen Könige aus dem Geschlecht der Merowinger gestanden hatten, aber dank ihrer einflußreichen Stellung als oberste königliche Amtsträger zu so mächtigen Grundherren geworden waren, daß sie nach und nach die Herrschaft im fränkischen Reich an sich zu ziehen und die Könige aus ihr zu verdrängen vermocht hatten. Freilich war dieses „Frankenreich“ kein Reich im heutigen Sinn, geschweige denn ein verfaßter Staat; es war ein flächenmäßig über fast ganz Gallien sich erstreckendes, über den Rhein nach Osten ausgreifendes Territorium, besiedelt, vor allem im Süden, von Romanen, zurückgebliebenen Bevölkerungsresten des untergegangenen spätantiken römischen Reiches, und von unterschiedlichen germanischen Stämmen, Stammesgruppen und Völkern, die im Zuge der 2 Völkerwanderung eingedrungen waren und sich festgesetzt hatten. Unter diesen Stämmen mit ganz unterschiedlichen Rechtstraditionen hatte der germanische Stammesverband der (salischen) Franken unter Führung ihres Königs Chlodwig (466-511, seit 480/81 König), des eigentlichen Begründers der merowingisch-fränkischen Dynastie, die Oberhand gewonnen. Und durch Chlodwigs epochale Entscheidung für die Annahme des Christentums in seiner katholischen Form 498/99 waren die Voraussetzungen für eine Integration der katholischen Gallo-Romanen und für die Missionierung der noch heidnischen oder vereinzelt bereits arianischen Germanenstämme sowie – in Anknüpfung an noch bestehende spätrömische Bischofssitze in Gallien - für den Aufbau einer auf den König bezogenen fränkischen Landeskirche geschaffen worden. Doch die Grenzen der fränkischen Herrschaft oder Oberherrschaft waren fließend. So scheinen die östlich des Lechs zwischen Donau und Alpen siedelnden „Baibari“ oder „Baioarii“ frühzeitig unter fränkische Oberherrschaft gekommen zu sein; denn nachweislich seit der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts standen an ihrer Spitze Herzöge aus dem Geschlecht der Agilolfinger, einer besitzmächtigen fränkischen, königsnahen und von Anfang an offenbar katholischen Adelsfamilie, der – nach der Lex Baiuvariorum - ein Erbrecht auf die Herrschaft in diesem Stammesherzogtum eingeräumt worden war, allerdings, soweit erkennbar, zumindest dem Anspruch nach in Unterordnung unter den merowingischen König. Die westlich des Lechs siedelnden Alamannen scheinen dagegen von stammeseigenen Herzögen angeführt worden zu sein, hatten aber den Frankenkönigen Heeresfolge zu leisten und standen somit ebenfalls in deren Abhängigkeit. Der fränkische Hausmeier Karl, mit dem späteren Beinamen „Martellus“ („der Hammer“), hatte 732 die von Süden bis zur Loire in das Frankenreich eindringenden muslimischen Sarazenen bei Tours und Poitiers und 737 erneut im Rhonetal zurückgeworfen – ein Sieg, der, zu einem gewaltigen Triumph propagandistisch hochstilisiert, Karls Kriegsruhm über das Frankenreich hinaus begründete. Bis nach Rom eilte die Kunde von diesem Sieg, so daß Papst Gregor III. (731-741), der sich von den in Italien vorstoßenden Langobarden bedroht fühlte, ohne auf den Schutz des Kaisers im fernen Byzanz noch zählen zu können, Karls Waffenhilfe anrief und ihn mit wertvollsten Geschenken umwarb, freilich zunächst vergeblich. Karl war nämlich selber mit dem Langobardenkönig Aistulph verbündet und seine Machtposition wohl noch nicht genügend gefestigt, um nach Italien auszugreifen. Rom und der Papst lagen ihm fern. Zwar konnte er es wagen, den Thron unbesetzt zu lassen. Aber er regierte immer noch im Namen der Merowinger, und für Kriegszüge bedurfte er der Gefolgschaft der fränkischen Großen, die sich ihm in ihrer Gesamtheit noch nicht gebeugt hatten. Und überdies waren kriegerische Unternehmungen kostspielig, mit seinen eigenen Mitteln allein nicht zu stemmen, weshalb er die seit langem bestehenden 3 fränkischen Bischofssitze und Klöster samt ihren Gütern rigoros in den Dienst seiner Politik nach innen und außen zwang, mit anderen Worten die „Einstaatung“ der Kirche im Sinne ihrer Hinordnung auf seine emporstrebende Dynastie betrieb. Nach Friedrich Prinz’ Urteil war dies eine „der größten politischen Leistungen Karl Martells“, weil erst aus dem daraus erwachsenden wechselseitigen Austausch die nachmalige kulturelle Blüte im Frankenreich möglich geworden sei. Für Karl Martell hatte aber zunächst die Unterwerfung des Gefahrenherdes in der südgallischen Provinz um Narbonne Vorrang, und in den Randprovinzen östlich des Rheins galt es, das Selbständigkeitsstreben der Herzogsgewalten bei den Alamannen und Baiern zu brechen, was ihm aber trotz mehrerer Heerfahrten und Raubzüge nicht oder nur kurzzeitig gelang. Nach Karl Martells Tod 741 – der schließlich den Leitnamen für sein Geschlecht, eben die „Karolinger“, abgab - setzte sich im Machtkampf seiner drei legitimen Söhne Pippin, Karlmann und Grifo, unter die er das Reich mit Zustimmung der Großen testamentarisch aufgeteilt hatte, am Ende Pippin durch, nachdem dieser noch zusammen mit Karlmann 743 einen Aufstand der Alamannen niedergeworfen und gleichzeitig am Lech, wohl bei Epfach, den mit dem Alamannenherzog Theutbalt verbündeten Baiernherzog Odilo geschlagen hatte. Während ein nochmaliger Aufstandsversuch des Alamannenherzogs 746 im Blutgericht bei Cannstatt erstickt wurde, wo Karlmann einen Teil der alamannischen Führungsschicht niedermachen ließ, dem alamannischen Herzogtum ein Ende setzte und den Grundbesitz der Unterworfenen als fränkisches Kronland einzog, erfuhr das agilolfingische Herzogtum Baiern trotz seiner völligen Niederlage schonende Behandlung, vermutlich weil Herzog Odilo mit Hiltrud, einer Schwester der Hausmeier, verheiratet war. Jedenfalls konnte beider Sohn Tassilo (III.), wohl 741 geboren, nach seines Vaters Tod 748 unter dem Schutz Pippins und der Vormundschaft seiner Mutter Hiltrud im bairischen Stammesherzogtum formell die Herrschaft antreten. Wohl im selben Jahr 748 wurde Pippin aus dessen Ehe mit Bertrada sein Sohn Karl und bald darauf sein zweiter Sohn Karlmann geboren. Etwa gleichzeitig zog sich Pippins Bruder Karlmann, kaum ganz freiwillig, unter Verzicht auf die Herrschaft als Mönch auf den Monte Soracte nördlich von Rom zurück. Beider Halbbruder Grifo dagegen - durch seine Mutter Swanahilt, eine Agilolfingerin, die Karl Martell 725 aus Baiern mitgeführt und geehelicht hatte, ein halber Agilolfinger - scheiterte mit seinem Versuch, nach Herzog Odilos Tod die Herrschaft in Baiern an sich zu reißen. Er wurde von Pippin vertrieben, schließlich von dessen Leuten erschlagen. Daß diese Vorgänge von blutigen Machtkämpfen, Bruderkriegen, begleitet waren, steht außer Frage, auch wenn die spärlich fließenden Quellen dies nur gerade andeuten. 4 Pippin und Karlmann hatten nach ihres Vaters Tod, beim Herrschaftswechsel, mit Bedacht vorsichtshalber nochmals einen Merowinger, Childerich III., obzwar eine Marionette in ihrer Hand, auf den Thron gesetzt. Nach Ausgrenzung seiner Brüder Alleinherrscher im Frankenreich geworden, wagte Pippin nunmehr den Schritt, vor dem Karl Martell noch zurückgescheut war. Er sandte 749 Bischof Burkard von Würzburg und seinen capellanus Fulrad nach Rom, um Papst Zacharias (741-752) „wegen der Könige in Francien zu fragen, die damals keine königliche Macht hatten, ob das gut sei oder nicht“. Und der Papst habe Pippin nicht nur den Bescheid überbringen lassen, „daß es besser sei, den als König zu bezeichnen, der die Macht habe, statt den, der ohne königliche Macht blieb“, sondern habe auch, „um die Ordnung nicht zu stören, kraft seiner apostolischen Autorität befohlen, daß Pippin König werde“. Gestützt auf den Spruch des Nachfolgers des Himmelspförtners Petrus, habe sich Pippin 751 vom fränkischen Adel „nach der Sitte der Franken“ – wie es heißt – „zum König wählen“ und diesen Akt durch eine vom Erzbischof und päpstlichen Legaten Bonifatius und von fränkischen Bischöfen vollzogene Salbung mit heiligem Öl, vielleicht nach alttestamentlichen Vorbildern, legitimieren lassen. Wahl und Salbung, wenn sie denn stattgefunden haben sollten, waren bislang völlig unbekannte Neuerungen. Der nominelle König Childerich III. und sein Sohn Theuderich, die beiden letzten Merowinger, wurden geschoren – das heißt ihres langen Haarschopfes beraubt - und für den Rest ihres Lebens in ein Kloster verbannt – Auslöschung ihres Geschlechts. So die geschönte, teil auch widersprüchliche knappe Darstellung dieses ganzen Vorgangs des Thronwechsels in den offiziellen „Reichsannalen“, ähnlich in der Chronik des sogenannten Fredegar – nach Johannes Fried Ergebnis „einer anchronistischen Konstruktion“ zur „nachträglichen Legitimierung des Unlegitimierbaren“. Tatsächlich war es eine Revolution, ein politischer Umsturz, dessen wirkliche Abfolge in diesen „Annalen“, den einzigen erhaltenen Quellen, irreführend verschleiert wurde. Doch „fortan eilte das Gerücht seiner [nämlich von Pippins] Macht und die Furcht vor seiner Kühnheit durch alle Lande“ (Annales Mettenses priores). Die moralische Stützung dieses Umsturzes durch den Papst – wie immer es sich mit der Wirklichkeit des Vorgangs verhalten haben mag – war allerdings nur der erste Akt, dem im Zeichen des „Übergangs“ gleichsam im Gegenzug ein zweiter folgte. Die Langobarden, übrigens bereits um 600 von ihrer Königin Theodolinde (570/75-627), einer bairischen Agilolfingerin, zur katholischen Kirche geführt, hatten eben (751) Ravenna, den letzten Stützpunkt des byzantinischen Kaisers in Oberitalien erobert, und beanspruchten auch die Hoheit 5 über Rom. Angesichts unmittelbarer Gefährdung seiner unabhängigen Stellung und des „Patrimonium Petri“, des Besitzes der römischen Kirche, erschien am Dreikönigstag 754 der Papst persönlich – es war Zacharias’ Nachfolger Stephan II. (752-757) – in der fränkischen Königspfalz Ponthion, um von dem mit seiner Hilfe zum König erhobenen Pippin Beistand „für die Rechte des heiligen Petrus“ zu erbitten. Natürlich waren Reise und Empfang beiderseits bis ins einzelne diplomatisch vorbereitet. Aber der Papst, dem man den jungen Königssohn Karl zum Geleit hundert Meilen weit entgegengeschickt hatte, kam mit großem Gefolge, und beim Empfang in der Königspfalz entfalteten die römischen Ankömmlinge einen zeremoniellen Pomp, der die immer noch ziemlich barbarischen Franken in helles Staunen versetzt haben mußte, auch wenn darüber nur der päpstliche Chronist (im Liber pontificalis) berichtet. Daß dieser – auf Imponieren berechnete – pompöse Auftritt dem byzantinischkaiserlichen Zeremoniell nachempfunden war, wußten die Franken natürlich nicht. Monatelang blieb Stephan II. mit seinem Gefolge im Frankenreich, bis König Pippin ihm, zweifellos nach intensiven Verhandlungen, mit Zustimmung des bereitwilligen Teils der fränkischen Großen zu Ostern 754 in Quierzy feierlich die in Ponthion – nach einer fränkischen Quelle vom Papst „in Sack und Asche“ (Chronik von Moissac) erflehte Hilfe, nämlich den Heereszug gegen die Langbarden, versprach und für den Fall seines Sieges über die Langobarden in einer Urkunde dem heiligen Petrus weitreichende Gebietszusagen in Mittelitalien machte, das sog. Pippinische Schenkungsversprechen. Zum Erweis der angeblich legitimen Besitzrechte des heiligen Petrus auf die versprochenen Gebiete hatten die Römer womöglich bereits damals gefälschte Dokumente, die sog. Konstantinische Schenkung, mitgeführt oder erst bei ihrem Aufenthalt im Franken „konzipiert“, wonach Kaiser Konstantin dem Nachfolger Petri den ganzen Westen seines Imperiums übereignet und sich selbst demütig in den Osten, nach Byzanz, zurückgezogen habe. Es ging nach römischer Version also beim Versprechen Pippins um eine lediglich partielle Rückeroberung petrinischen Besitzes. Pippin und Stephan II. schlossen zugleich einen „Bund gegenseitiger Liebe“, zu dessen Besiegelung der Papst vor seinem Aufbruch nach Italien Ende Juli 754 Pippin in Saint-Denis erneut zum König salbte und diese Salbung zugleich bedachtsam auch an dessen beiden Söhnen, dem siebenjährigen Karl und dem dreijährigen Karlmann, vollzog. Der Papst krönte Pippin wahrscheinlich auch – es wäre dann die erste Königskrönung in der fränkischen Geschichte gewesen - und verlieh allen drei Karolingern den Ehrentitel eines Patricius Romanorum, zweifellos um zu bekräftigen, daß sie anstelle des Kaisers in Byzanz Verantwortung für die Stadt und Kirche des heiligen Petrus zu tragen hätten. Dabei habe er angeblich den Franken unter Androhung des Bannes geboten, niemals mehr einen König aus einem anderen Geschlecht als dem Pippins zu 6 erheben. Pippins Bruder Karlmann, der auf die Nachricht von der Reise des Papstes ebenfalls herbeigeeilt war, wurde auf Wunsch Pippins von Stephan II. in ein fränkisches Kloster verwiesen, wo er noch im selben Jahr starb. Drogo und die anderen Söhne Karlmanns, die dieser Pippins Obhut anempfohlen hatte, verschwanden, zu Mönchen geschoren, namenlos in irgendwelchen Klöstern. Es bedurfte dann zweier Feldzüge Pippins, im Spätsommer 754 und im Winter 755/56, um die Langobarden zurückzuwerfen und dem Papst, genauer dem heiligen Petrus, wenigstens den Exarchat von Ravenna, den Dukat von Rom und zwei weitere Gebietsteile, aus der Sicht des Papstes, nicht etwa zu übergeben, sondern zu „restituieren“. Sie bildeten den Grundstock für die allmähliche Entstehung des „Kirchenstaats“, allerdings unter der Oberhoheit Pippins und danach seines Sohnes Karl. Der „Bund des Papsttums mit den Franken“, Beginn einer grundlegenden politischen Neuorientierung des Papsttums in Abwendung vom römischen Kaiser im Osten und Hinwendung zur aufsteigenden Macht im Westen – Beginn einer epochalen Wende in der Geschichte Europas oder des werdenden Europas – war aber, geistesgeschichtlich betrachtet, zu erheblichem Teil Ergebnis oder Wirkung des Wirkens des angelsächsischen Mönchs, Missionars und Kirchenreformers Winfrid-Bonifatius (672/75-754). England, die Heimat des Bonifatius, war durch die Missionsinitiative Papst Gregors I (590-604) christianisiert und in enger Verbindung mit dem Papst in Rom kirchlich organisiert worden. Und im Gefolge dieser Missionsimpulse war auch die von Gregor I. hochgeschätzte Benediktsregel nach England gelangt und in ihren wesentlichen Teilen von den dortigen Klöstern und Klostergründungen als Lebensregel adaptiert worden. Nachdem sich Bonifatius, das heißt der benediktinisch geprägte angelsächsische Mönch Winfrid, zur Mission auf dem Festland, bei den germanischen Stämmen im östlichen Frankenreich entschlossen hatte, zog er zuerst nach Rom, um sich vom Papst als Missionar bevollmächtigen zu lassen, und als Abgesandter des heiligen Petrus, vom Papst mit dem Namen Bonifatius versehen, begann er 719 in engster Fühlung mit dem Papst seinen Einsatz als Missionar und Kirchenreformer. Wo immer er mit seinen zahlreichen angelsächsischen Mitarbeitern als Missionar, dann als Erzbischof für Germanien und Legat des Papstes, tätig wurde, stets im Zusammenwirken mit den örtlichen Gewalten, knüpfte er die kirchlichen Bande mit Rom, in Baiern, wo er 739 - in Durchführung eines herzoglichen Plans von 715 - mit der kanonischen Errichtung oder genauer: Bestätigung der Bischofssitze in Freising, Passau, Regensburg und Salzburg und der Abgrenzung ihrer Sprengel eine fast geschlossene Kirchenprovinz begründete, auf dem Nordgau und in Ostfranken, in Hessen und Thüringen, nicht dagegen in Alamannien, das ihm offenbar verschlossen blieb, schließlich im 7 Zusammenwirken vor allem mit dem Hausmeier Karlmann auf Synoden mit fränkischen Bischöfen (ohne daß ich jetzt im einzelnen darauf eingehen kann). Wo immer Bonifatius, seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Klöster oder klösterliche Zellen gründete, in Amöneburg, Fritzlar, Ohrdruf, Bischofsheim, Kitzingen, Ochsenfurt usw., hielt auch die Benediktsregel oder ein an ihr orientierte Lebensordnung Einzug. Und seinen Schüler Sturmi, den aus bairischem Adel stammenden ersten Abt seiner Lieblingsgründung Fulda, schickte er 747 nach Rom und Monte Cassino, der einstigen Wiege des Benediktinerordens, damit er dort eingehend das Leben der Mönche nach der Benediktsregel studiere. Bonifatius hatte durch sein über dreißigjähriges Wirken im Dienst des heiligen Petrus ganz entscheidend den Boden bereitet für die Hebung des Ansehens Roms und der moralischen Autorität des Papstes im Frankenreich, für die daraus erwachsene wechselseitige Verbindung von Papst und Frankenkönig und für den Einzug und die Entfaltung der Benediktsregel in den Regionen nördlich der Alpen. Bischof Burkard von Würzburg, der zusammen mit Fulrad im Auftrag Pippins nach Rom gereist war, um den zitierten Entscheid des Papstes einzuholen, war ein Schüler und Weggenosse des Bonifatius. Um so merkwürdiger will es scheinen, daß Bonifatius selbst am Aufenthalt des Papstes im Frankenreich keinen Anteil mehr hatte. Er fand im selben Jahr 754, am 5. Juni, noch während der Papst im Frankenreich weilte, bei Dokkum in Friesland einen gewaltsamen Tod. Im gleichen Jahr 754 starb auch Hiltrud, die Mutter des immer noch unmündigen Baiernherzogs Tassilo III.; Pippin, Hiltruds Bruder, übernahm bis zu Tassilos Mündigkeit die Vormundschaft im Herzogtum. Aber als er 757, sechzehnjährig, für mündig erklärt wurde, mußte der junge Baiernherzog zusammen mit Großen seines Stammes König Pippin und dessen Söhnen Karl und Karlmann, seinen Vettern, einen Treueid leisten, der später zum Vasalleneid umgedeutet wurde, und sich zur Heeresfolge verpflichten. Tassilos politischer Spielraum war somit begrenzt oder sollte begrenzt sein, er stand in seinem Herzogtum unter der Kontrolle der ebenfalls vereidigten bairischen Großen. Doch er verstand offensichtlich seiner herzoglichen Autorität im Baiernstamm solche Geltung zu verschaffen, daß er sich angeblich 763 in Nevers der Heeresfolge seines königlichen Oheims zu entziehen gewagt habe. Seine „Eide und Versprechungen“ brechend und die Wohltaten seines Oheims beiseite setzend, habe er sich „arglistig“ aus der Heeresgefolgschaft entfernt, sei nach Baiern gezogen „und wollte nie mehr den genannten König von Angesicht sehen“ – so nachträglich die karolingischen Reichsannalen und ähnlich andere karolingische Quellen; agilolfingische Quellen dagegen fehlen. Es bleibt jedenfalls unklar, ob Tassilo tatsächlich in Nevers war, und wenn doch, 8 ob er sich wirklich unerlaubt oder mit zulässigem Grund entfernt hatte. Wenig später vermählte er sich mit Liutpirch, der Tochter des Langobardenkönigs Desiderius, offenbar um eine Allianz mit diesem zur Stärkung und Verteidigung seiner herzoglichen Gewalt gegenüber der expansionistischen fränkischen Königsmacht zu schmieden. Baiern war zu diesem Zeitpunkt als Stammesherzogtum, wie erwähnt, durch die von Bonifatius in päpstlicher Vollmacht 739 durchgeführte Bistumsorganisation zumindest kirchlich strukturiert, und der Herzog war selbstverständlich Herr seiner Landeskirche. Deren bereits bestehende Klöster als Gebets-, Missions- und Kulturzentren, wie beispielsweise St. Emmeram in Regensberg, St. Peter in Salzburg, Niederalteich, Benediktbeuern, das nach der Tradition von Bonifatius persönlich geweiht worden sei, und andere, wurden durch Stiftungen Tassilos, etwa im Chiemsee (Frauenchiemsee), in Innichen im Pustertal, in Kremsmünster, vielleicht auch in Mattsee, und durch Stiftungen von Adelsfamilien mit herzoglicher Zustimmung, wie etwa in Tegernsee, ansehnlich vermehrt. Die meisten dieser Klostergründungen hatten, je nach örtlicher Lage, auch eine strategisch wichtige Funktion, so Benediktbeuern am Fuß der Alpen und eines wichtigen Übergangs nach Italien, oder Kremsmünster als nicht nur missionarischer Vorposten zu den angrenzenden Karantanen und Awaren, einem aus dem Osten in die alte römische Provinz Pannonien eingedrungenen Reitervolk, das diese Provinz und die Umgebung durch Tributerpressung beherrschte oder „in Schach hielt“, wie ein Jahrhundert später die Ungarn weite Teile Europas. Tassilo scheint mit den Awaren in Unterhandlungen gestanden zu haben. Was immer sich Tassilo aus fränkischer Sicht hatte zuschulden kommen lassen: es diente zur Handhabe, um gegen ihn vorzugehen. Zwar verfolgte ihn nicht mehr König Pippin. Dieser war nach seinen beiden erwähnten Kriegszügen gegen die Langobarden mit der Vertreibung der Mauren nördlich der Pyrenäen und mit der Durchsetzung seiner Königsgewalt in Aquitanien beschäftigt, durch Erstürmung befestigter Städte und Verwüstung ganzer Landstriche, „so daß kein Bauer der Gegend mehr Äcker oder Weinberge zu bebauen wagte“ (Chronik des Fredegar). Die Quellen berichten unaufhörlich von brutaler Zerstörung und Verwüstung, Brandschatzung, Raubzügen und Niederringung örtlicher Gewalten, auch durch Mord: von immer neuen Kriegszügen, mit denen Pippin seiner königlichen Autorität rücksichtslos Geltung verschaffte, dessen Siege aber von seinen Zeitgenossen und von ihm selbst als untrügliche Zeichen seiner göttlichen Erwählung gedeutet wurden. Die 763/64 neu gefaßte Aufzeichnung der Lex Salica, des fränkischen Volksrechtes, belegt dies, wenn im Prolog vom „hehren Stamm der Franken“ die Rede ist, der, „von Gott gegründet“, als „tapfer unter Waffen und standhaft im gegebenen Friedenswort, weise im Rat und von edlem Aussehen“ und „zum 9 katholischen Glauben bekehrt, frei von Irrlehren“, gepriesen wird und in dem Christus, „der die Franken liebt“, als Schirmherr ihres Reiches und ihres Heeres angerufen wird. Doch Pippin wußte zur Durchsetzung seiner Königsherrschaft nicht nur „mit Gottes Hilfe“ das Schwert zu führen, sondern begriff auch das von Bonifatius und dessen angelsächsischen Mitarbeitern begonnene Werk der Reform der fränkischen Kirche mehr und mehr als Verpflichtung seines göttlichen Herrschaftsauftrags. Dieses Werk weiterzuführen war für ihn, den vom Papst gepriesenen „neuen Moses und neuen David“, natürlich auch Mittel zur Festigung seiner königlichen Autorität und zur Integration der Stämme seines Großreiches. Und dazu bedurfte er des Rückhalts bei den Bischöfen, die er zu Synoden versammelte, um mit ihnen die Regulierung der kirchlichen Organisation, die Vereinheitlichung der liturgischen Bücher nach römischem Muster, die Normierung des kanonikalen Lebens von Klerikergemeinschaften vor allem an den Domkirchen im Unterschied zu dem der Mönche und Nonnen voranzutreiben. Freilich gelang dies auf breiter Basis erst seinem Sohn und größeren Nachfolger Karl, der nach Pippins Tod 768 zusammen mit seinem jüngeren Bruder Karlmann die Herrschaft antrat, nach Karlmanns plötzlichem Tod 771 aber unter sofortiger Ausschaltung von Erbansprüchen der unmündigen Söhne Karlmanns - die mit ihrer Mutter zu den Langobarden flüchteten - sich die Alleinherrschaft sicherte. Die Entwicklung unter Karl dem Großen, dessen 1200. Todestag in dieses Jahr fällt, führte dank seiner überragenden Tatkraft in Italien zur völligen Unterwerfung der Langobarden und zur Entstehung des „Kirchenstaats“, wenn auch längst nicht im Umfang der angeblichen „Konstantinischen Schenkung“, und in Sachsen zur Unterwerfung dieses widerspenstigen, christlicher Mission sich verweigernden Stammes, in dem er nach den Reichsannalen „dreimal ein Blutbad“ anrichtete, schließlich, nach einem erneuten Aufstand, 782 in Verden an der Aller sämtliche sächsischen Rädelsführer, nach denselben Annalen 4.500 an der Zahl, hinrichten ließ, um nachfolgend die Sachsen zwangsweise zu „christianisieren“. Im Jahr 787 braute sich dann das Verhängnis über Herzog Tassilo zusammen, das sich offenbar seit längerem angekündigt hatte; denn Tassilo hatte während eines Aufenthalts des Frankenkönigs in Rom nach Weihnachten 786 den Papst durch hochrangige Boten um Friedensvermittlung gebeten, war aber von diesem unter Androhung des Bannes, falls er seine König Pippin und König Karl geleisteten Eide nicht halte, schroff abgewiesen worden – so die Reichsannalen. Nach Franzien zurückgekehrt, berief Karl einen Reichstag nach Worms ein und lud dorthin den Baiernherzog vor. Da dieser sich weigerte, der Vorladung zu folgen, rückte Karl – in einem ersten Schritt - mit seinem Heer bis zum „Lechfeld oberhalb der Stadt Augsburg“ vor und ließ 10 durch ein zweites Heer aus „Ostfranken, Thüringern und Sachsen“ den Übergang an der Donau versperren. Tassilo, von allen Seiten umschlossen und von den „Baiern, die alle dem König Karl mehr treu waren als ihm“, verlassen, suchte sich zu retten, indem er sich persönlich dem König „als Vasall in die Hände gab“ und das ihm „von König Pippin übertragene Herzogtum“ mit dem Geständnis, übel gehandelt zu haben, zurückerstattete. Sodann erneuerte er seinen Eid, das heißt er leistete den Vasalleneid (der bislang von keinem Herzog im Frankenreich gefordert worden war) und stellte zwölf Geiseln, als dreizehnte seinen Sohn Theodo, worauf er sein Herzogtum als Lehen zurückerhielt. Doch diese Demütigung des Herzogs genügte Karl nicht. Im folgenden Jahr 788 berief Karl einen Reichstag zu Ingelheim am Rhein ein, auf dem auch Tassilo mit seinen Vasallen, bairischen Großen, erscheinen mußte. Diese klagten ihn als „eidbrüchig“ an und beschuldigten ihn obendrein einer gegen den König gerichteten Verschwörung mit den Awaren, also des Landesverrats, und dies alles auf „Einflüsterung“ seiner „böswilligen Gemahlin (malivola uxor)“ Liutpirch. Tassilo habe gestanden, und die „Franken und Baiern, Langobarden und Sachsen“ und alle übrigen Versammelten hätten daraufhin „in Erinnerung an seine früheren Übeltaten“ und weil er seinerzeit den Heereszug König Pippins verlassen, „zu deutsch harisliz (quod theodica lingua harisliz dicitur)“, Fahnenflucht begangen habe, die Todesstrafe gefordert. Doch der „fromme König (rex piissimus)“ habe erreicht, daß er nicht sterben müsse; vielmehr habe er Tassilo nach seinem Begehren gefragt, worauf dieser gebeten habe, „sich scheren lassen, in ein Kloster eintreten und seine vielen Sünden bereuen zu dürfen, um seine Seele zu retten“. So geschah es. Tassilo und sein ebenfalls abgeurteilter Sohn Theodo verschwanden in einem Kloster, „im sicheren Gefängnis der Zeit“. Einige bairische Große, die ihm die Treue gehalten hatten und dem König feindlich gesinnt waren, wurden verbannt. So der viele Frage aufwerfende Bericht der Reichsannalen über das Ende der Agilolfinger. Der König nahm das Herzogtum Baiern in Besitz und gliederte es, wie das Langobardenreich und andere eroberte Reiche, in sein Reich ein. Tassilos angeblicher Landesverrat bot Karl zugleich den Rechtfertigungsgrund, um die Awaren als äußere Feinde anzugreifen. Noch im selben Jahr berichten die Annalen von vier Schlachten gegen die Awaren; sie wurden geschlagen, und Karl brachte ihren durch Tributzahlungen angehäuften sagenhaften Schatz an sich. Ebendiese Folge der Vorgänge von 787 und 788 mag verdeutlichen, daß hinter ihr eine wohlgeplante Strategie steckte. Allerdings änderte Karl nichts an der kirchlichen Einheit Baierns, sondern vollendete sie 798 durch die Erhebung Salzburg zur erzbischöflichen Metropole als eigenständige Kirchenprovinz. 11 Aber Karl der Große, bekanntlich an Weihnachten 800 in St. Peter feierlich vom Papst zum Kaiser gekrönt, war – inmitten seiner vielen Kriege, die ihn unentwegt „im Sattel“ hielten ebenso ein eminenter Förderer der Kultur in ihrer damals möglichen Breite. Er sammelte in seiner Hofkapelle die wohl gelehrtesten Männer seiner Zeit, Theologen und Juristen, um sich und ergriff mit ihnen Initiativen für Wissenschaft und Kunst, für eine Vereinheitlichung der kirchlichen Rechtsbücher, der Liturgie, des Wortlauts der lateinischen Bibel, soweit möglich nach Maßgabe der stadtrömischen Tradition, überhaupt für eine Kultivierung der Sprache und ihre Verschriftlichung, für eine bildungsmäßige Hebung des niederen Klerus, für eine Hebung der Rechtskultur zur Versittlichung des Volkes, für die Rettung des literarischen Erbes der Antike usw.; die an seinem Hof geförderte Schrift, die sogenannte karolingische Minuskel, eroberte die Welt, ebenso der dort entstandene Kalender, wenn auch nach mancherlei Veränderungen. Nicht zuletzt betrieb er den Ausbau der Kirchenorganisation in seinem Reich als Grundvoraussetzung für die Durchsetzung einer einheitlich geordneten Gottesverehrung, die er als göttlichen Auftrag und somit als Fundamentalpflicht seines Herrscheramtes betrachtete. Und gerade in Bezug auf diesen weitgespannten religiös-kulturellen Aufbau des Frankenreiches und seiner Provinzen kam den durch zahlreiche königliche und adelige Stiftungen sich mehrenden Klöstern vor Ort – den sich verdichtenden Klosterlandschaften – eine ganz zentrale Bedeutung zu, eben nicht nur als Stätten des Gebets und der Pflege des Gottesdienstes, sondern ebensosehr als Träger und Vermittler der Bildung in allen Lebensbereichen, wobei man sich von den damit verbundenen Schwierigkeiten und der „Primitivität“ der damaligen Anfänge kaum mehr eine Vorstellung machen kann. Freilich war die Klöster noch keineswegs einheitlich verfaßt. Wohl scheinen die Benediktsregel oder von ihr beeinflußte Mischregeln im Vormarsch gewesen zu sein. Aber es gab noch eine Vielzahl alter Klöster aus der vorbonifatianischen Missionsperiode, die vom östlich geprägten altgallischen Mönchtum und von dem - Bonifatius zutiefst verhaßten - irischen, iroschottischen Mönchtum beeinflußt waren, so die auf den Iren Columban den Jüngeren († 615) zurückgehenden Gründungen Luxeuil, Fontaine und Annegray oder im alamannischen St. Gallen, die allesamt eine weite Ausstrahlung erlangt hatten, aber einer überaus harten asketischen Regelobservanz mit schier endlosen Gebetszeiten und dem Gebot absoluten Gehorsams gegenüber dem Abt verpflichtet waren. Nun versuchte Karl der Große im Jahr 802 erstmals eine vereinheitlichende Reform der Klöster und Kanonikerstifte einzuleiten, und zwar der Klöster nach der Benediktsregel, von der er sich bereits 787 eine Abschrift hatte vorlegen lassen. Diesen Reformanstoß begann Karls Sohn und Nachfolger Kaiser Ludwig der Fromme 12 auf den Aachener Synoden von 816, 817 und 818/19 im Zusammenwirken mit dem aquitanischen Abt Benedikt von Aniane (um 750-821), dem eigentlichen „Gründer der Benediktiner“ (Pius Engelbert), umzusetzen. Die mildere und anpassungsfähigere, man könnte auch sagen: humanere und der je unterschiedlichen Persönlichkeitsstruktur des einzelnen Mönchs samt deren Grenzen mehr entgegenkommende Benediktsregel, die zudem als römisch galt, sollte entsprechend der Maxime „eine Regel, eine Gewohnheit“ an die Stelle der anderen Klosterregeln treten, und zwar in der Interpretation der anianischen Gewohnheiten (consuetudines), die einen Versuch darstellten, „der Lebensform, nach der Benedikt von Nursia und seine Mönche im 6. Jahrhundert gelebt hatten, so nahe wie nur möglich zu kommen“. Der Mönch sollte sich aus der Seelsorge zurückziehen und persönlich besitzlos im Kloster bleiben – Absage an das nicht kontrollierbare Wandermönchtum iroschottischer Version -, hier entsprechend den Normen der Benediktsregel sein Leben auf das opus dei ausrichten, auf Chorgebet, feierliche Liturgie und Meditation, und durch den labor manuum, durch seiner Hände Arbeit, seinen Lebensunterhalt bestreiten bzw. zu dem seiner Gemeinschaft beitragen. Im Grunde kann man erst seither „von Benediktinerklöstern im eigentlichen Sinne sprechen“ (Ulrich Faust). Der Benediktsregel wurde damit als vorrangiger monastischer Lebensnorm allmählich für etwa vier Jahrhunderte zum Durchbruch verholfen: ein für die Entwicklung der abendländisch-christlichen Kultur hochbedeutsamer Vorgang. Nun kann ich im Rahmen dieses Referats weder auf die Problematik der Entstehung der Benediktsregel und der in ihr verarbeiteten Einflüsse noch auf ihren Inhalt im einzelnen eingehen. Ebensowenig können das Drama des Niedergangs der Karolinger nach dem Tod Karls des Großen mitsamt dem Verfall des karolingischen Reiches, die Kette der Reichsteilungen und Bruderkriege und damit wiederum zusammenhängend der Niedergang des Papsttums im 10. und in der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts geschildert werden. Auf dem Stuhl Petri in Rom, ohne Schutz einer tatkräftigen kaiserlichen Macht hilflos der Gier rivalisierender römischer Adelscliquen ausgeliefert, lösten in jenem „Saeculum obscurum“ nicht weniger als 45 „Päpste“, meist kaum mehr als Marionetten der jeweils dominierenden Clique, einander ab, 25 von ihnen wurden abgesetzt oder für abgesetzt erklärt, 14 endeten im Kerker, wurden verstümmelt, dem Hungertod preisgegeben, erwürgt, in den Tiber geworfen oder starben im Exil; nicht weniger als sechs Schismen spalteten die römische Kirche, ohne allerdings über Rom hinaus sich auszuwirken, woraus zu schließen ist, daß dieses in sich zerfallene Papsttum fast zur Bedeutungslosigkeit herabgesunken war. Die Frage nach der Legitimität mancher dieser „Päpste“ braucht man erst gar nicht zu stellen. Das Argu- 13 ment, die Situation in anderen Städten und Territorien Italiens sei nicht weniger gewesen, sticht angesichts der Bedeutung Roms und päpstlicher Ansprüche nicht. Andererseits zeitigten diese wirren Zustände im zerfallenden Karolingerreich und am Stuhl Petri, noch verstärkt durch die Einfälle der Sarazenen von Süden her und der Ungarnhorden von Osten her, ganz allgemein verheerende Folgen, die auch an vielen Bischofssitzen und in zahlreichen Klöstern ihre tiefen Spuren hinterließen. Der Ausfall der königlich-kaiserlichen Zentralgewalt führte aber auch zu einem Wiedererstarken der von Karl dem Großen niedergerungenen partikularen Herzogsgewalten. Nach dem Untergang der Karolinger im östlichen Teil des alten Frankenreiches, in der Francia orientalis, am Beginn des 10. Jahrhunderts vermochte sich gegen erhebliche herzogliche Widerstände das Sachsenherzog schließlich als König durchzusetzen (Heinrich I.). Sein Sohn und Nachfolger Otto I., durch seine die partikularen Machtverhältnisse - nicht zuletzt mittels der Bischofskirchen als Gegengewicht - klug ausbalanciernde Innenpolitik und durch seine siegreichen Feldzüge gegen äußere Feinde, zuletzt 955 in der Schlacht gegen die Ungarn bei Augsburg, auf dem „Lechfeld“, als Verteidiger des christlichen Abendlandes gefeiert, wurde 962 von einem Papst zum römischen Kaiser gekrönt, und fortan blieb die römische Kaiserwürde mit der „Francia orientalis“, dem nachmals sogenannten „Heiligen Römischen Reich“ bis zu dessen Ende im Jahr 1806 – man muß sagen – schicksalhaft verbunden. Aber weder Otto I. noch seine unmittelbaren Nachfolger vermochten den desolaten römischen Zuständen ein Ende zu bereiten. Erst der Salier Heinrich III. rettete das Papsttum vor dem völligen Absturz. Er berief auf seinem Romzug 1046 kraft seiner königlichen Autorität als berufener Schutzherr des Stuhles Petri in Sutri, dann in Rom eine Synode ein, ließ durch sie drei rivalisierende Päpste absetzen und den Bamberger Bischof Suitger in seinem Gefolge als Papst einsetzen. Mit ihm, Clemens II., dem ersten deutschen Papst, begann die Epoche eines erneuerten, in seiner Geltung über die Stadt Rom sich wieder erhebenden Papsttums. Noch im selben 11. Jahrhundert beanspruchte ein Papst – es war Gregor VII. -, kraft seiner ihm von Gott verliehenen Vollgewalt über alle Kirchen und Reiche gesetzt zu sein und auch über dem Kaiser zu stehen, allein das Recht zu haben, die kaiserlichen Insignien zu führen und Könige und Kaiser abzusetzen. Es war der Beginn der sogenannten „Gregorianischen Reform“, in Wahrheit einer – wie es scheint, auch auf Fälschungen basierenden - kirchlichen Neuerung, die viele Bistümer, ja ganze Ländern in Spaltungen stürzte und letztlich in einem tödlichen Kampf zwischen Kaisertum und Papsttum, den beiden Häuptern der (westlichen) 14 Christenheit, endete. Und schon Kaiser Heinrichs III. Sohn und Nachfolger Heinrich IV. war der erste König und Kaiser, den der päpstliche Bannfluch traf. Als Bischof Otto von Freising, der bedeutendste Geschichtsschreiber des Mittelalters, Enkel Kaiser Heinrich IV. und Oheim Friedrich Barbarossas in seiner „Chronica sive historia de duabus Civitatibus“ auf diesen bis dahin unerhörten Vorgang zu sprechen kam, meinte er: Zwar würden manche behaupten, Gott habe die Erniedrigung des Reiches gewollt, um die Kirche zu erhöhen, doch zweifle in der Tat niemand daran, „daß die Kirche durch die Machtmittel des Reiches und die Fürsorge der Könige erhöht und bereichert worden“ sei, und es sei „Tatsache, daß sie [die Kirche] erst dann das Reich so erniedrigen konnte, als dieses selbst durch seine Liebe zur Kirche seine Kräfte völlig erschöpft hatte“ und dann „mit dem Schwert der Kirche, das heißt dem geistlichen“ und „mit seinem eigenen materiellen Schwert geschlagen“, zusammengebrochen sei. Die für ihn ungeheuerliche Tatsache machte diesen hochadeligen Bischof, zuvor Mönch und Abt der Zisterzienserabtei Morimund, fassungslos. Er schreibt: „Dies zu beurteilen oder zu erörtern geht über unsere Kraft.“ Aber er fügt hinzu: „Doch will mich bedünken, daß die Priester in jeder Beziehung zu tadeln sind, die dem Reich mit ihrem Schwert, das sie doch selber nur von der Könige Gnaden haben, Wunden zu schlagen sich unterstehen, es sei denn, sie gedächten David nachzuahmen, der den Philister, den er zunächst mit Gottes Hilfe niedergestreckt hatte, dann mit seinem eigenen Schwert abschlachtete.“ Und doch erwachte in jener sturmbewegten Zeit seit dem Niedergang der Karolinger, in dessen Folge Bischofssitze und Klöster örtlichen Gewalten und von außen eindringenden Feinden schutzlos ausgeliefert waren, in vielen Klerus- und Laienkreisen eine starke Sehnsucht nach religiöser Erneuerung und vertiefter Verchristlichung. Allmählich entstanden, teils in Klosterruinen, einige religiös-spirituelle Zentren, von denen aus zunächst unscheinbaren Anfängen alsbald ein Aufbruch benediktinisch-monastischer Erneuerung ausging, wie er in der Geschichte des westlichen Mönchtums trotz verschiedener späterer Reformwellen ein zweites Mal so nicht wiederkehrte. Nördlich der Alpen gingen damals die stärksten Impulse hauptsächlich von zwei Zentren aus: vom lothringischen Kloster Gorze bei Metz und von der burgundischen Klostergründung Cluny. Kloster Gorze bei Metz, das 934 von einem Adeligen (Jean de Vandière) wieder belebt und auf die strenge Befolgung der Benediktsregel als Hausgesetz verpflichtet wurde, strahlte mit Unterstützung der Bischöfe von Metz und Toul reformerisch zunächst auf Klöster in ihren Bistümern und über Verdun (Saint-Vanne) nach St. Maximin in Trier und von dort auf die 15 Francia orientalis, das Reich Ottos I., aus; denn Otto I. besiedelte sein 937 gegründetes Mauritius-Kloster in Magdeburg, seine Lieblingsstiftung, mit Mönchen aus St. Maximin, und dies wurde wieder für andere Reichs- oder Königsklöster zum Anstoß, sich ebenfalls am Vorbild St. Maximins zu orientieren. Im Süden des Reiches wurde zum Vermittler dieser „lothringischen Reform“ Bischof Wolfgang von Regensburg (972-994), ein gebürtiger Schwabe, Zögling im Kloster Reichenau, dann Domscholaster von Trier, wo er St. Maximin kennen- und schätzen lernte, ehe er als Mönch in das Kloster Einsiedeln eintrat, dort von Bischof Ulrich von Augsburg zum Priester geweiht wurde und nach kurzem missionarischem Wirken bei den 955 zurückgeworfenen Ungarn von Kaiser Otto I. 972 auf die Regensburger Bischofskathedra berufen wurde. Bischof Wolfgang verselbständigte die mit seinem Bischofsstuhl in Personalunion verbundene uralte Abtei St. Emmeram, konstituierte sie als Benediktinerkloster und setzte ihm (974) als Abt den Mönch Ramwold (um 900-1000) von St. Maximin vor. Ramwold, damals bereits siebzigjährig, leitete St. Emmeram über zwei Jahrzehnte. Er führte die in seinem Heimatkloster beobachteten Gorzer consuetudines ein und trug, allen Übersteigerungen abhold, Sorge dafür, daß seine Mönche neben der Hingabe an das opus dei im Sinne des labor manuum einer sinnvollen Beschäftigung zugeführt wurden. Er baute die Bibliothek aus, ließ sie katalogisieren und im bereits bestehenden Scriptorium Bücher, das heißt Handschriften, abschreiben, er machte im Kloster die Kunst der Buchmalerei heimisch und ließ ein Verzeichnis der Stiftsgüter anfertigen. St. Emmeram blühte auf und entwickelte sich binnen kurzem zum benediktinischen Reformzentrum für Baiern und den ganzen süddeutschen Raum, erfaßte die Klöster Tegernsee, Niederaltaich, Weltenburg, St. Peter in Salzburg, Feuchtwangen, Thierhaupten, auch die Reichsklöster Reichenau und St. Gallen und wirkte, von den ottonischen Kaisern, vielen Bischöfen und Adeligen gefördert, auch wieder ins Reich zurück. Im 11. Jahrhundert zählte man im Reich rund 160 von der „lothringischen Reform“ ergriffene und beeinflußte Klöster. Man kann von einem „Reichsmönchtum“ Gorzer oder lothringischer Observanz sprechen, doch bildete dieses keinen Verband. Die einzelnen Klöster blieben entsprechend benediktinischer Tradition autonom, zumeist unter bischöflicher Jurisdiktion, pflegten aber untereinander Gebetsverbrüderung und errangen als Schulzentren, als Initiatoren und Förderer der Künste sowie im Dienst des Reiches und der Reichskirche eminente Bedeutung. Cluny in Burgund war dagegen eine Neugründung Herzog Wilhelms von Aquitanien, der seine Stiftung, um sie von vornherein gegen Übergriffe oder Einflüsse fremder Gewalten, weltlicher und bischöflicher, abzuschirmen, unmittelbar dem Schutz des Heiligen Stuhls 16 unterstellte und mit dem Recht freier Abtswahl ausstattete (Stiftungsurkunde vom 11. September 910). Freilich verdankte das Kloster in den Anfängen die Wahrung seiner ihm in die Wiege gelegten Freiheiten weniger dem Schutz des fernen und in eigene Probleme verwickelten Heiligen Stuhls als seiner äußerst günstigen geographischen Lage im eher neutralen Grenzgebiet zwischen Frankreich und Deutschland, ferner drei hochbefähigten Äbten, deren ungewöhnlich lange Amtszeit von je über 50 Jahren eine sonst nur selten anzutreffende Kontinuität der Leitung ermöglichte. Herzog Wilhelm übergab seine Gründung einem bereits reformerisch tätigen Abt zweier Klöster (Berno), der diese und nunmehr auch Cluny auf die Observanz einheitlicher consuetudines im Anschluß an die Benediktsregel in der Reformtradition Benedikts von Aniane verpflichtete. Sein Nachfolger (Odo), von der frühmonastischen Idee einer „Verwirklichung der Pfingstkirche“ durch Weltabgewandtheit und engelgleiches Leben erfüllt, knüpfte Beziehungen zum westfränkischen Königshof, begab sich nach Rom, erbat sich vom Papst (Johannes XI.) die Erlaubnis, auch fremde Mönche aufnehmen zu dürfen, sofern diese in ihrem eigenen Kloster an der Erfüllung ihrer Armutsgelübde gehindert würden, und empfing obendrein die päpstliche Bestätigung für sein Kloster Cluny als verfassungsrechtliches Haupt einer Gruppe von Klöstern: Grundlage für die Entstehung eines Klosterverbandes unter der zentralen Leitung des Abtes von Cluny. Durch den Zuwachs weiterer Klöster, die zumeist nicht von Cluny gegründet, sondern zum Zweck der Reform Cluny übergeben wurden oder sich freiwillig anschlossen, durch reiche Zustiftungen von Grundbesitz und wirtschaftlich ersprießliche Verwaltung seiner sich mehrenden Ländereien und gestützt auf seine „Freiheiten“ entstand so eine Art cluniazensisches „Klosterreich“ mit dem Großabt von Cluny an der Spitze, der diesen Klosterverband wie ein Monarch regierte. Dank seinem Reichtum war für Kleidung, Tafel, Sauberkeit und Hygiene der Mönche gut gesorgt. Es entwickelte sich ein hochstehendes, kultiviertes Mönchtum, das auch den Adel anzog und allein den Konvent der Mutterabtei von 100 Mönchen in der ersten Hälfte des 10. Jahrhunderts auf 400 Mönche zu Beginn des 11. Jahrhunderts ansteigen ließ. Cluny erstarkte nicht nur zu erheblicher wirtschaftlicher und kultureller Kraft, die sich im Bau seiner Bibliothek, der an Handschriften reichsten Frankreichs, und schließlich in der Errichtung seiner gewaltigen Abteikirche, damals der größten der lateinischen Christenheit, 1130 vom Papst (Innozenz II.) persönlich geweiht, dokumentierte; das zentralistisch geleitete clunizensische Mönchtum wurde vielmehr zu gutem Teil auch geistiger Wegbereiter des gregorianischen Zeitalters mit all seinen tiefgreifenden, verändernden Folgen für die Verfassungsentwicklung der ganzen Kirche. Der Schwerpunkt dieses Klosterverbandes lag in Frankreich mit rund 1.300 Klöstern, dazu mit weiteren rund 250 Klöstern unterschiedlicher Zuordnung in den 17 benachbarten Regionen von England bis Spanien und Portugal. In der Francia orientalis, im Reich, vermochten die Cluniazenser allerdings nur gelegentlich und beschränkt auf den äußersten Westen Fuß zu fassen. Erst im späten 11. Jahrhundert, in den Anfängen des Wiederaufstiegs des Papsttums in der sogenannten „Gregorianischen Reform“ verbreiteten sich die cluniazensischen Ideale auch in Teilen des Reiches, vermittelt durch den als Reformabt nach Kloster Hirsau im Schwarzwald berufenen St. Emmeramer Mönch Wilhelm (1026-1091), einen erklärten Parteigänger Papst Gregors VII. und seiner papalistisch ausgerichteten Kirchenreform. Abt Wilhelm, ursprünglich von seinem Heimatkloster her von der „lothringischen Reform“ geprägt, legte der Lebensordnung des Klosters Hirsau die cluniazensischen consuetudines zugrunde, schickte auch Mönche nach Cluny zum Studium der dortigen Ordnung und orientierte an ihr schließlich in den von ihm verfaßten Constitutiones Hirsaugienses (1090/91) Klosteralltag und Liturgie Hirsaus, ohne allerdings sich bzw. sein Kloster jurisdiktionell Cluny anzuschließen. Die Hirsauer Reform erfaßte schließlich im Reich von Schwaben bis Thüringen etwa 100 Klöster. Aber sie bildeten keinen Verband, sie blieben je autonom. Zu diesen Klöstern der Hirsauer Observanz stieß dann über St. Ulrich und Afra in Augsburg auch das damals längst dringend der Reform bedürftige Kloster Ottobeuren.