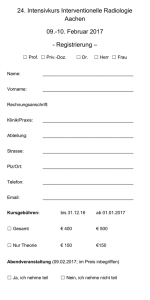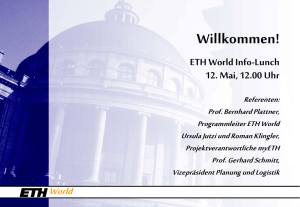Folien für den Unterricht
Werbung

Das ökonomische Problem Volkswirtschaft verstehen – 9. Auflage 2017, S. 6 © vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich Grafik 1.1 Bedürfnisse können auch anders als mit Konsumgütern befriedigt werden (z.B. mit Arbeit) Bedürfnis nach Selbstverwirklichung Bedürfnis nach Achtung Bedürfnis nach Zugehörigkeit Bedürfnis nach Sicherheit körperliche Bedürfnisse KONSUMWÜNSCHE WISSEN, AUSBILDUNG NEUE KAPITALGÜTER KONSUMGÜTER Waren und Dienstleistungen PRODUKTIONSPROZESS ARBEITSKRAFT körperliche und geistige Arbeit, Wissen und Fähigkeiten UNTERNEHMERISCHE TÄTIGKEIT KAPITALGÜTER BODEN UMWELT Maschinen, Gebäude, Strassen, Patente Land und Bodenschätze Luft, Artenvielfalt, Landschafts- und Ortsbilder, Klima, Ruhe, Ozonschicht usw. Kurve der volkswirtschaftlichen Produktionsmöglichkeiten Volkswirtschaft verstehen – 9. Auflage 2017, S. 10 © vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich Grafik 1.2 Maschinen (in Stück) Produktion bei voll genutzten Ressouren 600 Y A 400 B 340 X 30 35 50 Spielfilme (in Stück) Wirtschaftswachstum Grafik 1.3 Volkswirtschaft verstehen – 9. Auflage 2017, S. 11 © vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich Maschinen neue Produktionsmöglichkeitenkurve dank Wirtschaftswachstum Spielfilme Die sechs Koordinationsmechanismen in einer modernen Volkswirtschaft Volkswirtschaft verstehen – 9. Auflage 2017, S. 15 © vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich Grafik 1.4 100 % persönliche Beziehung persönliches Geschenk Solidarität in Kleingruppen Interessensolidarität Tradition, Werte Hierarchie in Unternehmen Markt 100 % Tausch Hierarchie im Staat 100 % Zwang Bestimmungsgründe von Angebot und Nachfrage Volkswirtschaft verstehen – 9. Auflage 2017, S. 31 © vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich Grafik 2.2 Bedürfnisse Erwartungen bezüglich Preisen, Technik usw. Technik, Organisation Konsumwünsche Preise für Inputs angebotene Menge Werbung, Trends, Mode etc. Preis des gehandelten Gutes koordiniert das Angebot mit der Nachfrage Erwartungen über Einkommen, Preise usw. nachgefragte Menge Einkommen, Vermögen andere Güter, z.B. ihre Preise Abnehmender Grenznutzen beim Konsum von Hamburgern Volkswirtschaft verstehen – 9. Auflage 2017, S. 34 © vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich Grafik 2.5 Grenznutzen 10 der Grenznutzen nimmt ab 8 6 4 2 0 –2 Gesamtnutzen 25 20 der Gesamtnutzen nimmt zu, solange der Grenznutzen positiv ist 15 10 5 0 0 1 2 3 4 5 6 Stück Hamburger Angebotsüberschuss oder Nachfrageüberschuss Volkswirtschaft verstehen – 9. Auflage 2017, S. 39 © vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich Grafik 2.10 Preis pro Stück in Fr. Angebotsüberschuss Angebot 8.– 4.– Nachfrage Nachfrageüberschuss 4 8 12 15 Mio. Hotdogs pro Jahr Marktgleichgewicht, Gleichgewichtspreis und Gleichgewichtsmenge Volkswirtschaft verstehen – 9. Auflage 2017, S. 40 © vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich Grafik 2.11 Preis pro Stück in Fr. Nachfrage Angebot Gleichgewichtspreis Gleichgewicht 5.– Gleichgewichtsmenge 10 Mio. Hotdogs pro Jahr Folgen einer Nachfragesteigerung Volkswirtschaft verstehen – 9. Auflage 2017, S. 41 © vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich Grafik 2.12 Preis pro Stück in Fr. 1. Angebot neues Gleichgewicht 6.50 2. 5.– altes Gleichgewicht N1 10 2. 13 N2 Mio. Hotdogs pro Jahr Folgen eines Angebotsrückgangs Volkswirtschaft verstehen – 9. Auflage 2017, S. 42 © vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich Grafik 2.13 Preis pro Stück in Fr. neues Gleichgewicht 1. altes Gleichgewicht 6.– 2. A1 A2 5.– Nachfrage 8 10 2. Mio. Hotdogs pro Jahr Lineare Nachfragekurve und Nachfragekurve mit konstanter Elastizität Volkswirtschaft verstehen – 9. Auflage 2017, S. 50 © vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich Grafik 3.5 Fr./kg lineare Nachfragekurve 5 4 Preiselastizität konstant –1 3 2 1 0 0 100 200 300 400 500 kg Preiselastizität entlang einer linearen Nachfragekurve Volkswirtschaft verstehen – 9. Auflage 2017, S. 51 © vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich Grafik 3.6 Preis preiselastisch Preiselastizität = –1 einheitselastisch preisunelastisch N 0 0 Menge Preiselastizität der Nachfrage und Umsatz Volkswirtschaft verstehen – 9. Auflage 2017, S. 52 und 53 © vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich Grafiken 3.7 bis 3.10 Fr./Eintritt Fr./Eintritt 5 5 + + 4 4 – 900 1000 N – N Eintritte Fr./Eintritt 400 Eintritte 1000 Fr./Eintritt 6 preiselastisch + 5 5 + 4 Preiselastizität = –1 – N – N preisunelastisch 2 + 1 – 800 1000 Eintritte 200 400 1000 1200 Eintritte Internationaler Kunstpreisindex Volkswirtschaft verstehen – 9. Auflage 2017, S. 59 © vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich Grafik 3.15 700 SFr.-Index 1975 = 100 600 Kunstpreise 500 400 300 Wert von Bundesobligationen inkl. Rendite 200 allgemeines Preisniveau 100 0 1975 80 85 90 95 2000 05 10 15 Wie wirkt eine Steuer, wenn die Nachfrage unelastischer ist als das Angebot? Volkswirtschaft verstehen – 9. Auflage 2017, S. 62 © vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich Grafik 3.16 Preis pro Liter in Fr. Gleichgewicht mit Steuer Angebot mit Steuer Angebot ohne Steuer Preis bevor Steuer erhoben wurde Preis, den Verkäufer erhalten 7.15 5.00 Gleichgewicht bevor Steuer erhoben wurde Steuer Preis, den Käufer zahlen 4.15 Nachfrage 83 100 Mengenrückgang Mio. Liter Wie wirkt eine Steuer, wenn die Nachfrage elastischer ist als das Angebot? Volkswirtschaft verstehen – 9. Auflage 2017, S. 63 © vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich Grafik 3.17 Angebot mit Steuer Preis pro Liter . in Fr Gleichgewicht mit Steuer Angebot ohne Steuer 6.25 Preis bevor Steuer erhoben wurde 5.00 Preis, den Verkäufer erhalten 3.25 Gleichgewicht bevor Steuer erhoben wurde Steuer Preis, den Käufer zahlen Nachfrage 65 100 Mengenrückgang Mio. Liter Wie wirken Subventionen? Volkswirtschaft verstehen – 9. Auflage 2017, S. 64 © vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich Grafik 3.18 Preis pro kg in Fr. Gleichgewicht bevor Subvention bezahlt wurde Preis, den Verkäufer erhalten Preis bevor Subvention bezahlt wurde 3.15 3.00 Preis, den Käufer zahlen 2.15 Subvention Angebot ohne Subvention Angebot mit Subvention Gleichgewicht mit Subvention Nachfrage 10 11,6 Mengenzunahme Mio. kg Wie wirken Höchstpreise? Volkswirtschaft verstehen – 9. Auflage 2017, S. 67 © vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich Grafik 3.19 Preis Angebot Gleichgewicht Gleichgewichtspreis Höchstpreis Nachfrageüberschuss e ng e ng Nachfrage me Me Me s t e e gt ich ten a r w o ef ge eb g h g h c c i an na Gle e ng Menge Wie wirken Mindestpreise? Volkswirtschaft verstehen – 9. Auflage 2017, S. 68 © vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich Grafik 3.20 Preis Angebot Angebotsüberschuss Mindestpreis Gleichgewichtspreis Gleichgewicht Nachfrage e ng e ch na g a efr M gte e sm cht i w ge h ic e l G e ng an g o eb te M ne e e ng Menge Der kurzfristige Kostenverlauf Volkswirtschaft verstehen – 9. Auflage 2017, S. 76 © vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich Grafiken 4.1 und 4.2 Fr. 5000 Gesamtkosten 4000 3000 2000 variable Kosten 1000 Fixkosten 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m3/ Tag Fr./m3 1600 Grenzkosten 1200 durchschnittliche Gesamtkosten 800 400 durchschnittliche variable Kosten 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m3/ Tag Abnehmende Grenzerträge bei teilweiser Erhöhung der Ressourcen Volkswirtschaft verstehen – 9. Auflage 2017, S. 78 © vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich Grafik 4.3 m3 5 Gesamtprodukt 4 3 2 hier nimmt das Grenzprodukt ab 1 0 m3 0,8 Grenzprodukt 0,6 0,4 0,2 0 –0,2 0 2 4 6 8 10 12 variable Ressourcen (z.B. Arbeit) Langfristige Durchschnittskostenkurve, z.B. für eine Sägerei Volkswirtschaft verstehen – 9. Auflage 2017, S. 80 © vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich Grafik 4.5 zunehmende Skalenerträge Fr./ m3 konstante Skalenerträge 500 abnehmende Skalenerträge 400 optimale Betriebsgrösse 300 200 Durchschnittskosten 100 0 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 produzierte Menge pro Tag Gesamtumsatz und Gesamtkosten, Nachfragekurve/Preis/Grenzumsatz und Grenzkosten Volkswirtschaft verstehen – 9. Auflage 2017, S. 82 © vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich Grafiken 4.6 und 4.7 Fr. t s rlu maximaler Gewinn, wo die Gesamtkosten gleich stark ansteigen wie der Gesamtumsatz 5000 Ve 4000 nn 3000 i ew G Gesamtumsatz 2000 Gesamtkosten 1000 st lu er V 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m 3 /Tag Fr./m 3 1600 durchschnittliche Gesamtkosten 1200 Grenzkosten Grenzkosten = Grenzumsatz 800 Preis = Nachfragekurve = Grenzumsatz maximaler Gewinn 400 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m 3 /Tag Gesamtumsatz und Gesamtkosten, Nachfragekurve/Preis/Grenzumsatz und Grenzkosten beim langfristigen Betriebsminimum Volkswirtschaft verstehen – 9. Auflage 2017, S. 83 © vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich Grafiken 4.8 und 4.9 Fr. 5000 Gesamtkosten 4000 st rlu Ve weder Gewinn noch Verlust beim Preis von 360 Franken 3000 Gesamtumsatz 2000 1000 st rlu Ve 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m 3 /Tag Fr./m 3 1600 1200 Grenzkosten 800 Ø Gesamtkosten Ø variable Kosten 400 Preis = Nachfragekurve = Grenzumsatz 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m 3 /Tag Mit freiem Marktzutritt werden die Gewinne wegkonkurriert Volkswirtschaft verstehen – 9. Auflage 2017, S. 84 © vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich Grafik 4.10 Angebot steigt, Verkaufspreise fallen, Umsätze fallen Bei freiem Marktzutritt ziehen Gewinne neue Konkurrenten an Gewinne tendieren gegen null Nachfrage nach Ressourcen steigt, Inputpreise steigen, Kosten steigen Wirtschaftskreislauf mit Güter- und Faktormärkten Volkswirtschaft verstehen – 9. Auflage 2017, S. 91 © vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich Grafik 5.1 unternehmerische Tätigkeit gegen Gewinn ARBEITSMÄRKTE Arbeitsleistung gegen Lohn KAPITALMÄRKTE Kapital gegen Zins BODENMÄRKTE Boden gegen Bodenrente Arbeit im Haushalt HAUSHALTE UNTERNEHMEN Geldströme Güter- und Ressourcenströme GÜTERMÄRKTE Güter gegen Preis Realzins, Nominalzins und Inflationserwartung Volkswirtschaft verstehen – 9. Auflage 2017, S. 96 © vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich Grafik 5.4 Zinsfuss Angebot, wenn 4% Inflation erwartet wird Nominalzins bei 4% 5% Inflationserwartung Nachfrage, wenn 4% Inflation erwartet wird Angebot, wenn keine Inflation erwartet wird Nachfrage, wenn keine Inflation erwartet wird Realzins 1% Gleichgewichtsmenge Spargelder in Fr. Wirtschaftskreislauf mit Güter- und Faktormärkten, erweitert um die Umweltressourcen und den Aussenhandel Grafik 5.5 unternehmerische Tätigkeit gegen Gewinn Volkswirtschaft verstehen – 9. Auflage 2017, S. 105 © vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich ARBEITSMÄRKTE Arbeitsleistung gegen Lohn KAPITALMÄRKTE Kapital gegen Zins BODENMÄRKTE Boden gegen Bodenrente Arbeit im Haushalt HAUSHALTE Importe AUSLAND UNTERNEHMEN Exporte Umweltgüter Umweltgüter Geldströme Güter- und Ressourcenströme GÜTERMÄRKTE Güter gegen Preis Treten externe Kosten auf, sind die Preise zu tief und die Menge zu hoch Volkswirtschaft verstehen – 9. Auflage 2017, S. 117 © vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich Grafik 6.1 Flugpreis Nachfrage Angebot aufgrund der gesamtgesellschaftlichen Kosten Marktgleichgewicht mit effizienter Nutzung der Ressourcen heutiges Marktgleichgewicht Menge bei Einbezug der externen Kosten Menge unter Missachtung von externen Kosten externe Kosten Angebot aufgrund der privaten Kosten geflogene Menge Externe Effekte im Überblick unter dem Aspekt der Ausschliessbarkeit Volkswirtschaft verstehen – 9. Auflage 2017, S. 118 © vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich Tabelle 6.2 gesamtgesellschaftlicher Nutzen externer Nutzen mit free riders privater Nutzen öffentliche Güter private Güter öffentliche Ungüter private / interne Kosten externe Kosten mit forced riders gesamtgesellschaftliche Kosten Pigou-Steuer in der Höhe der externen Kosten führt zu effizienter Nutzung der Umweltressourcen Volkswirtschaft verstehen – 9. Auflage 2017, S. 126 © vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich Grafik 6.4 Preis Nachfrage Angebot aufgrund der gesamtgesellschaftlichen Kosten neues Marktgleichgewicht mit effizienter Ressourcennutzung Pigou-Steuer Angebot aufgrund der privaten Kosten Marktgleichgewicht vor der Pigou-Steuer Menge bei internalisierten externen Kosten Menge unter Missachtung von externen Kosten Menge Vom Grenzwert zur Umweltabgabe – der Standard-Preis-Ansatz Volkswirtschaft verstehen – 9. Auflage 2017, S. 128 © vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich Grafik 6.5 Preis neues Marktgleichgewicht mit effizienter Ressourcennutzung 3. Angebot inklusive Umweltabgabe altes Angebot aufgrund der privaten Kosten 2. Umweltabgabe Nachfrage Menge 1. Menge, die aufgrund des Grenzwerts nicht überschritten werden soll Menge unter Missachtung von externen Kosten Gesamtumsatz und Grenzumsatz eines Unternehmens, das einer geraden Nachfragekurve gegenübersteht Volkswirtschaft verstehen – 9. Auflage 2017, S. 143 © vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich Grafik 7.4 Fr. 400 Gesamtumsatz 300 200 100 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 cl Fr./cl 80 preiselastisch in der Mitte der Geraden Preiselatizität = –1 60 40 20 preisunelastisch Nachfragekurve Grenzumsatzkurve 0 2 –20 –40 4 6 8 10 12 14 16 cl Gewinnmaximierung eines Monopolisten Volkswirtschaft verstehen – 9. Auflage 2017, S. 146 © vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich Grafik 7.5 Verlust Fr. 360 Gesamtumsatz 320 Gewinn 280 240 Gesamtkosten 200 maximaler Gewinn, wo die Gesamtkosten gleich stark ansteigen wie der Gesamtumsatz 160 120 80 40 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 cl Fr./cl 90 80 Nachfrage 70 60 50 40 Cournotscher Punkt maximaler Gewinn wo Grenzkosten = Grenzumsatz Durchschnittskosten 30 20 G 10 Grenzumsatz (Grenzerlös) Grenzkosten 0 2 –10 4 6 8 10 12 14 16 cl Gewinnmaximierung eines neuen Unternehmens im monopolistischen Wettbewerb Volkswirtschaft verstehen – 9. Auflage 2017, S. 147 © vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich Grafik 7.6 Fr./ Essen Durchschnittskosten 60 50 Cournotscher Punkt 40 30 maximaler Gewinn 20 Nachfrage G 10 Grenzkosten 0 2 –10 4 6 Grenzumsatz (Grenzerlös) 8 10 12 14 16 Essen Langfristiges Gleichgewicht unter monopolistischer Konkurrenz Volkswirtschaft verstehen – 9. Auflage 2017, S. 148 © vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich Grafik 7.8 Fr./ Essen Durchschnittskosten 60 50 Cournotscher Punkt 40 Umsatz = Kosten, Gewinn = 0 30 20 10 G Grenzkosten 0 2 –10 4 6 Nachfrage Grenzumsatz (Grenzerlös) 8 10 12 14 16 Essen Heizölpreise und Heizölkonsum in der Schweiz ab 1970 Volkswirtschaft verstehen – 9. Auflage 2017, S. 151 © vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich Grafik 7.9 300 Index 1970 = 100 200 Heizölpreise inflationsbereinigt 100 Heizölkonsum 50 1970 75 80 85 90 95 2000 05 10 15 Drei Konzepte zur Verteilungsgerechtigkeit Volkswirtschaft verstehen – 9. Auflage 2017, S. 177 © vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich Grafik 9.1 Leistungsgerechtigkeit Die Belohnung soll der Leistung entsprechen, die für die Gesellschaft erbracht wird. Welche Leistung? Bedarfsgerechtigkeit Menschen haben ein Anrecht auf das, was sie brauchen, um ein würdiges Leben zu führen. Wie weit will man gehen? Überwindung von Knappheit Vergütung = Wert des Grenzprodukts des Inputs. Aufwand: Ausbildung und Mühe Der Input entspricht nicht immer dem Output. Niemand soll in materieller Not leben müssen. Es fehlt eine anerkannte Norm für den Minimalbedarf. vor dem Gesetz gleich Umfasst nicht ökonomische Gleichheit. Gleichheit Alle Menschen haben die gleichen Rechte. Wie weit will man gehen? beschränkte Einkommensunterschiede Wie gross sollen die Unterschiede sein? Chancengleichheit Wichtige Voraussetzung für Leistungsgerechtigkeit. Markt- und Kreislaufmodell eines gemischtwirtschaftlichen Systems Grafik 10.1 FAKTORMÄRKTE Ressourcen gegen Lohn, Zins, Bodenrente, Gewinne staatl. Leist. Importe AUSLAND UNTERNEHMEN Exporte staatliche Leistungen STAAT Steuern Arbeit im Haushalt HAUSHALTE Steuern Umweltgüter Umweltgüter Geldströme Güter- und Ressourcenströme Volkswirtschaft verstehen – 9. Auflage 2017, S. 194 © vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich GÜTERMÄRKTE Güter gegen Preis BIP und potenzielles BIP in der Schweiz seit 1950 Volkswirtschaft verstehen – 9. Auflage 2017, S. 219 © vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich Grafik 11.3 600 Mrd. Fr potenzielles BIP zu Preisen von 2000 300 BIP zu Preisen von 2000 200 100 Zuwachsraten des realen BIP 8% 6% 4% 2% 0% –2% –4% –6% –8% 1950 55 60 65 70 75 80 85 90 95 2000 05 10 15 Fachbegriffe der Konjunkturtheorie Volkswirtschaft verstehen – 9. Auflage 2017, S. 220 © vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich Grafik 11.4 Mrd. Fr (zu konstanten Preisen) potenzielles BIP = Produktionspotenzial = mögliches Gesamtangebot Hochkonjunktur, Boom, positive BIP-Lücke – + BIP – negative BIPLücke Konjunkturaufschwung negative BIP-Lücke wird kleiner Konjunkturabschwung, Rezession negative BIP-Lücke öffnet sich Zeit BIP seit 1850 und potenzielles BIP seit 1965 in der Schweiz Volkswirtschaft verstehen – 9. Auflage 2017, S. 229 © vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich Grafik 12.1 500 Mrd. Franken zu Preisen von 2000 potenzielles BIP 200 BIP 100 50 20 10 1850 60 70 80 90 1900 10 20 30 40 1950 60 70 80 90 2000 10 Bestimmungsgründe des langfristigen Produktionspotenzials Volkswirtschaft verstehen – 9. Auflage 2017, S. 231 © vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich Grafik 12.2 wachsendes potenzielles BIP organisatorischer Wandel gesteigerte Nutzung der vorhandenen Ressourcen mehr Arbeitsstunden = Bevölkerungszahl x Erwerbsquote x Jahresarbeitszeit grösseres technisches und organisatorisches Wissen mehr Kapitalgüter technischer Fortschritt: • Prozessinnovationen • Produktinnovationen Boden, Bodenschätze, und übrige natürliche Ressourcen Erwerbstätige in der Schweiz nach Sektoren 1850–2015 Volkswirtschaft verstehen – 9. Auflage 2017, S. 233 © vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich Grafik 12.3 70% 3. Sektor tertiärer Sektor 60% 50% 1. Sektor primärer Sektor 2. Sektor sekundärer Sektor 40% 30% 20% 10% 0% 1850 60 70 80 88 1900 10 20 30 41 50 60 70 80 91 2001 15 Arbeitslosigkeit USA, Schweiz, EU (15 Mitglieder) und Euroraum, Jahresdurchschnitte seit 1960 Volkswirtschaft verstehen – 9. Auflage 2017, S. 249 © vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich Grafik 13.1 12% Arbeitslosenquote USA 10% 8% 6% 4% 2% 0% 1960 12% 65 70 75 80 85 90 95 Arbeitslosenquote Schweiz 2000 05 10 15 Erwerbslosenquote gemäss ILO (BFS) 10% ArbeitsmarktUngleichgewicht (KOF) 8% 6% 4% 2% 0% 1960 Quote der registrierten Arbeitslosen (SECO) 65 70 75 80 85 90 95 12% 10% 8% 2000 05 10 15 Arbeitslosenquote Euroraum Arbeitslosenquote EU-15 6% 4% 2% 0% 1960 65 70 75 80 85 90 95 2000 05 10 15 Klassische Betrachtungsweise und Kreislaufwirkung Volkswirtschaft verstehen – 9. Auflage 2017, S. 253 und 256 © vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich Grafiken 13.3 und 13.5 Höhe der Löhne Nachfrage nach Arbeitskräften, Kapital und Boden Zinsniveau Geldstrom Angebot an Arbeitskräften, Kapital und Boden Einkommen Arbeitseinkommen, Zinsen, Bodenrenten, Gewinne Bodenrenten UNTERNEHMEN UNTERNEHMEN HAUSHALTE HAUSHALTE Angebot an Waren und Dienstleistungen Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen Höhe der Güterpreise Ausgaben für Waren und Dienstleistungen Potenzielles BIP, BIP und Arbeitslosenquote Volkswirtschaft verstehen – 9. Auflage 2017, S. 259 © vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich Grafik 13.6 Mrd. Fr. (zu konstanten Preisen) positive BIP-Lücke potenzielles BIP keine BIP-Lücke negative BIP-Lücke % Gesamtnachfrage, BIP konjunkturelle Arbeitslosigkeit Hochkonjunktur Arbeitslosenquote friktionelle, strukturelle und institutionelle Arbeitslosigkeit Zeit Potenzielles BIP, BIP und Arbeitslosigkeit in der Schweiz Volkswirtschaft verstehen – 9. Auflage 2017, S. 260 © vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich Grafik 13.7 Mrd. Fr. zu Preisen von 2000 500 400 Hochkonjunktur potenzielles BIP schwache Hochkonjunktur oder keine BIP-Lücke BIP 300 Arbeitslosenquote 10% Arbeitsmarktungleichgewicht konjunkturelle Arbeitslosigkeit 225 8% 6% 4% Erwerbslosenquote gemäss ILO institutionelle Arbeitslosigkeit friktionelle, strukturelle und 1965 70 75 80 85 90 95 2000 05 10 15 2% 0% Kreislaufmodell zur Analyse von Konjunkturschwankungen Volkswirtschaft verstehen – 9. Auflage 2017, S. 271 © vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich Grafik 14.2 Geldzuflüsse Geldabflüsse verfügbares Einkommen – indirekte Steuern + Subventionen erwirtschaftetes Einkommen – direkte Steuern + Zahlungen der Sozialversicherungen UNTERNEHMEN STAAT Gesamtnachfrage nach inländischen Gütern: = priv. Konsum + priv. Investitionen + Staatsausgaben + Exporte – Importe + Exporteinnahmen HAUSHALTE + Staatsausgaben Konsum W ec – Importausgaben hs el ku – Sparen rs + Ausgaben für Investitionen e Absatzaussichten Akzeleratoreffekt au Z ive insn BIP, BNE und VE im Kreislaufmodell Volkswirtschaft verstehen – 9. Auflage 2017, S. 272 © vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich Grafik 14.3 Volkseinkommen BNE – indirekte Steuern + Saldo Kapital- und Arbeitseinkommen aus dem Ausland BIP Entstehung Verteilung – Abschreibungen verfügbares Einkommen + Subventionen – direkte Steuern + Zahlungen der Sozialversicherungen UNTERNEHMEN STAAT BIP HAUSHALTE +G Verwendung =C+I+G+X–M +X C –M –S +I Geldmengen in der Schweiz, November 2016 (in CHF) Volkswirtschaft verstehen – 9. Auflage 2017, S. 283 © vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich Publikumsgeldmengen, von den Nichtbanken verwendetes Geld Grafik 15.1 Termineinlagen Laufzeit unter 4 Jahren Spareinlagen abzüglich Geld auf Transaktionskonti 51 Mrd. 350 Mrd. M2 942 Mrd. Buchgeld Sichtguthaben und Geld auf Transaktionskonti Bargeldumlauf Noten und Münzen ausserhalb der Banken und der Post 516 Mrd. M3 993 Mrd. M1 592 Mrd. 76 Mrd. Noten Notenbankgeldmenge, M0 Noten + Sichteinlagen der Geschäftsbanken bei der Zentralbank 524 Mrd. Reserven der Geschäftsbanken: Bargeld und Guthaben bei der Zentralbank Der schweizerische Landesindex der Konsumentenpreise Volkswirtschaft verstehen – 9. Auflage 2017, S. 288 © vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich Grafik 15.2 100 Jahresdurchschnitte, Index 2000 = 100 50 25 Zunahmen gegenüber dem Vorjahr in %, Inflationsraten 10% 8% 6% Kerninflation 2 4% 2% 0% –2% 1950 55 60 65 70 75 80 85 90 95 2000 05 10 15 Preise und Lebenshaltungskosten, Jahresdurchschnitte, Index 1950 = 100 Volkswirtschaft verstehen – 9. Auflage 2017, S. 292 © vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich Grafik 15.3 1750 Lebenshaltungskosten im weitesten Sinn aufgrund von gesetzlichen, technischen und sozialen Standards steigen sie ungefähr mit dem hier abgebildeten nominellen BNE/Kopf 480 offizieller LIK 330 Lebenshaltungskosten im engeren Sinn ohne Berücksichtigung von Zwangskonsum irgendeiner Art, Differenz gegenüber LIK –0,6 % pro Jahr 100 1950 55 60 65 70 75 80 85 90 95 2000 05 10 15 Geldmengenwachstum (abzüglich BIP-Wachstum) und Inflation Volkswirtschaft verstehen – 9. Auflage 2017, S. 301 © vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich Grafik 16.1 80% 15% Inflation pro Jahr Inflation pro Jahr 12% 60% 9% 40% 6% 20% 3% Geldmengenzuwachs abzüglich BIP-Wachstum pro Jahr 0% 0% 20% 40% 60% 80% Geldmengenzuwachs abzüglich BIP-Wachstum pro Jahr 0% 0% 3% 6% 9% 12% 15% Geldmengenzuwachs und Inflationsrate in der Schweiz und in den USA, seit 1965 Volkswirtschaft verstehen – 9. Auflage 2017, S. 303 © vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich Grafik 16.2 +38% Geldmengenzuwachs Schweiz 20% Inflationsrate Schweiz 16% 12% 8% 4% 0% 70 –4% 75 80 85 90 95 90 95 2000 05 2000 05 10 15 10 15 –8% Geldmengenzuwachs USA Inflationsrate USA 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 1965 70 75 80 85 Inflationäre Eigendynamik und Angebotsinflation Volkswirtschaft verstehen – 9. Auflage 2017, S. 308 © vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich Grafik 16.3 Preise: Marktmacht, Inflationserwartung Inflationsrate Löhne: Marktmacht, Inflationserwartung globale Marktmacht / globaler Wettbewerb Potenzielles BIP, BIP und Inflationsrate Volkswirtschaft verstehen – 9. Auflage 2017, S. 308 © vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich Grafik 16.4 Mrd. Fr. (zu konstanten Preisen) positive BIP-Lücke potenzielles BIP keine BIP-Lücke negative BIP-Lücke % Gesamtnachfrage, BIP Hochkonjunktur Ausgangswert von z. B. 4 % Inflationsrate Zeit Inflationäre Eigendynamik, Angebots- und Nachfrageinflation Volkswirtschaft verstehen – 9. Auflage 2017, S. 309 © vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich Grafik 16.5 konjunkturelle Dynamik Gesamtnachfrage negative / positive BIP-Lücke Preise: Marktmacht, Inflationserwartung Inflationsrate Löhne: Marktmacht, Inflationserwartung globale Marktmacht / globaler Wettbewerb Potenzielles BIP, BIP, Arbeitslosenquote und Inflationsrate Volkswirtschaft verstehen – 9. Auflage 2017, S. 310 © vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich Grafik 16.6 Mrd. Fr. (zu konstanten Preisen) positive BIP-Lücke potenzielles BIP keine BIP-Lücke negative BIP-Lücke % Gesamtnachfrage, BIP konjunkturelle Arbeitslosigkeit Hochkonjunktur Arbeitslosenquote inflationsstabile Arbeitslosenquote Zeit % Ausgangswert von z. B. 4 % Inflationsrate Zeit Potenzielles BIP, tatsächliches BIP, Arbeitslosigkeit und Inflation in der Schweiz Volkswirtschaft verstehen – 9. Auflage 2017, S. 311 © vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich Grafik 16.7 Mrd. Fr. zu Preisen von 2000 500 400 Hochkonjunktur potenzielles BIP schwache Hochkonjunktur oder keine BIP-Lücke BIP 300 10% Arbeitsmarktungleichgewicht 8% Arbeitslosenquote 225 6% 4% inflationsstabile 1965 70 75 80 85 90 Arbeitslosenquote 95 2000 Erwerbslosenquote gemäss ILO 2% 0% 05 10 15 10% Inflationsrate 8% 6% 4% Kerninflation 2 2% 0% 1965 70 75 80 85 90 95 2000 05 10 15 Die Phillips-Kurve Volkswirtschaft verstehen – 9. Auflage 2017, S. 313 © vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich Inflationsrate Grafik 16.8–16.10 10 % 8% 6% Phillips-Kurve 4% 2% 0% Inflationsrate 0% 10 % 2% 4% 6 % 8 % 10 % Arbeitslosenquote 1974 8% 1981 1975 6% 1990 4% 1993 2% 1995 2001 1997 1986 0% 0% 2009 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % Arbeitsmarktungleichgewicht NAIRU Veränderung der Inflationsrate 4% 1979 2% 1995 0% 1997 –2% 1986 –4% 1976 –6% 0% 2% 4% 6% 8% 10 % Arbeitsmarktungleichgewicht Die nominale Zinsstruktur seit 1965 in der Schweiz Volkswirtschaft verstehen – 9. Auflage 2017, S. 320 © vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich Grafik 17.3 Hochkonjunktur 12% inverse Zinsstruktur 10% geringe oder keine BIP-Lücke 3-MonatsZinssatz 8% Rendite Bundesobligationen 6% 4% 2% normale Zinsstruktur 0% –2% 1965 70 75 80 85 90 95 2000 05 10 15 Antizyklische Konjunkturpolitik in einer mit der übrigen Welt verbundenen Volkswirtschaft Volkswirtschaft verstehen – 9. Auflage 2017, S. 323 © vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich Grafik 17.4 Regierung Notenbank Einnahmen und Ausgaben kurzfristige Zinsen direkte Intervention auf den Devisenärkten allg. Zinsniveau konjunkturelle Dynamik Gesamtnachfrage nach schweizerischen Gütern Attraktivität der Fr.-Zinsen gegenüber ausländischen Zinsen schweizerische Exporte BIP-Lücke negativ / positiv Frankenkurs Wechselkursspekulation schweizerische Importe Preisentwicklung der inländischen Güter Preisentwicklung der ausländischen Güter Inflationsrate Marktmacht, Inflationserwartung globale Marktmacht/ globaler Wettbewerb Inflationsstabile Arbeitslosenquote in den USA und in der EU Volkswirtschaft verstehen – 9. Auflage 2017, S. 333 © vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich Grafiken 17.5 und 17.6 12% 10% tatsächliche Arbeitslosenquote 8% 6% 4% inflationsstabile Arbeitslosenquote 2% 0% 1960 12% 2% 6% 3% 65 70 Inflationsraten 3% 2% 5% 75 80 85 3% 90 95 3% 2000 EU-15 tatsächliche Arbeitslosenquote 05 10 15 10 15 Euroraum 10% 8% 6% inflationsstabile Arbeitslosenquote EU-15 4% 2% 0% 1960 4% 65 Inflationsraten 5,5% 70 75 80 85 5% 90 1,5% 95 2000 2,2% 05 Dollarkurs in Preisnotierung und Kaufkraftparitäten seit 1970 Volkswirtschaft verstehen – 9. Auflage 2017, S. 351 © vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich Grafik 18.2 SFr./US$ 4 gehandelter Wechselkurs 3 2 1.5 Kaufkraftparität 1 1970 75 80 85 90 95 2000 05 10 15 Realer Dollarkurs seit 1970 Volkswirtschaft verstehen – 9. Auflage 2017, S. 352 © vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich Grafik 18.3 Index Jan. 2000 = 100 realer Aussenwert des Schweizer Frankens US$/SFr. SFr./US$ 150 100 50 1970 75 80 85 90 95 2000 05 10 15 Die Entwicklung der BIP-Preise in ausgewählten Euro-Ländern Volkswirtschaft verstehen – 9. Auflage 2017, S. 359 © vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich Grafik 18.5 145 Index 1998 = 100 Griechenland Spanien 140 Portugal Italien 130 Eurogebiet Frankreich 120 Deutschland Österreich 110 100 2000 05 10 15 –100% –75% –50% komparative Vorteile der Handelspartner –25% 0% 25% 50% Finanzdienste Grafik 19.2 Uhren Versicherungsdienste Präzisionsinstrumente Chemikalien, Medikamente Nahrungsmittel Kunststoffe Metalle Fremdenverkehr (mit Einkaufstourismus) Maschinen, Elektronik Bijouterie Papier, Grafik Energieträger (v. a. Erdöl und Elektrizität) Fahrzeuge Textilien, Bekleidung, Schuhe Offenbarte komparative Vorteile der Schweiz 2015 Volkswirtschaft verstehen – 9. Auflage 2017, S. 368 © vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich 75% 100% komparative Vorteile der Schweiz BNE pro Kopf und Lebenserwartung 2014/2015 Volkswirtschaft verstehen – 9. Auflage 2017, S. 388 © vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich Grafik 20.1 85 Lebenserwartung bei der Geburt Japan Schweiz Singapur Chile Deutschland 80 Europa, USA Lateinamerika Süd- u. Ostasien Nahost u. Afrika USA China Vietnam 75 Saudi-Arabien Nepal 70 65 Russland Madagaskar Äthiopien 60 Kongo/Zaïre 55 Südafrika Moçambique Angola Sierra Leone BNE pro Kopf in KKP-US$ 50 1000 3000 10'000 30'000 100'000 Die vier Phasen des demografischen Übergangs Volkswirtschaft verstehen – 9. Auflage 2017, S. 392 © vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich Geburten- und Sterberaten, pro 1000 Einwohner Grafik 20.3 50 Geburtenrate Sterberate 40 30 Wachstumsrate der Bevölkerung 20 10 0 vorindustrielle Phase Frühphase der industriellen Entwicklung fortgeschrittene industrielle Entwicklung industrielle Reifephase
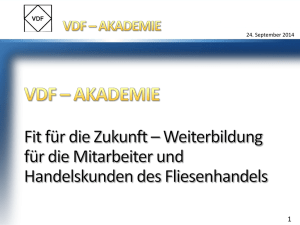
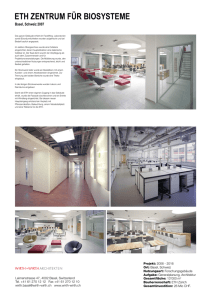

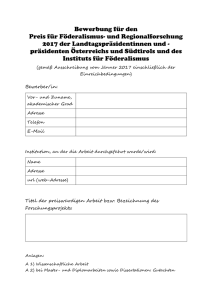
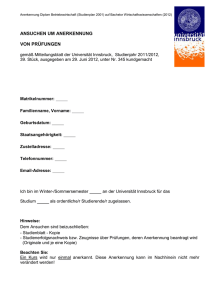
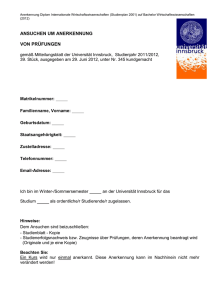
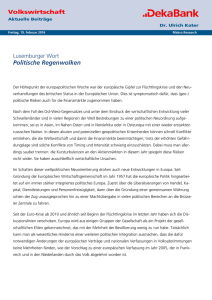
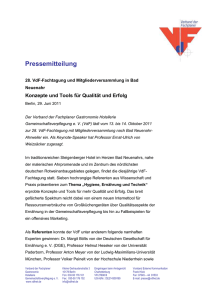
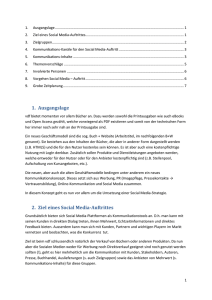
![Aus 3 mach 4 am 24.06.2017 mit Frühstü[...]](http://s1.studylibde.com/store/data/005451420_2-6b4b1934357b1219c87ebd544d71a2f1-300x300.png)