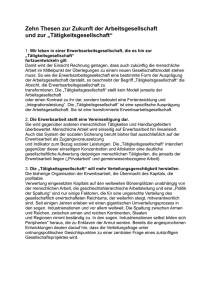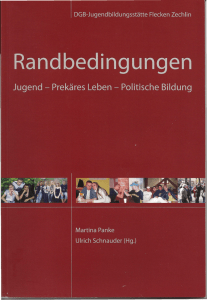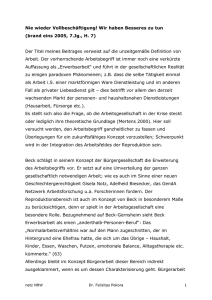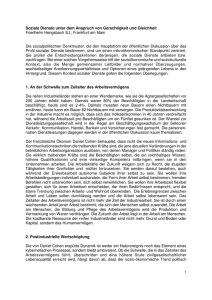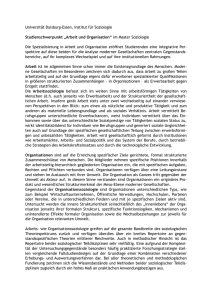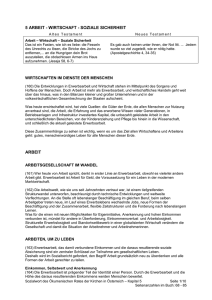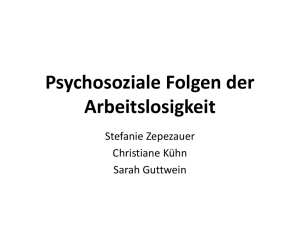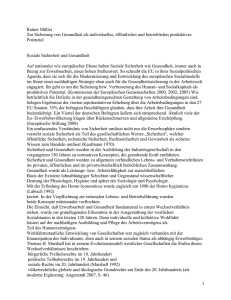Prekarisierung von Erwerbsarbeit - DGB
Werbung

Erscheint 2004 in: Heitmeyer, W. / P. Imbusch (Hg.), Desintegration in modernen Gesellschaften (Arbeitstitel), VS-Verlag, Wiesbaden. Prekarisierung von Erwerbsarbeit Zur Transformation eines arbeitsweltlichen Integrationsmodus Klaus Kraemer und Frederic Speidel In der viel beachteten Studie Les métamorphoses de la question sociale hat Robert Castel (1995, dt. 2000) die These einer doppelten Spaltung der Erwerbsgesellschaft formuliert. Im Einzelnen diagnostiziert er eine schrumpfende „Zone der Normalität“ mit Beschäftigungsverhältnissen, die nicht frontal den Unwägbarkeiten kurzatmiger Märkte ausgesetzt sind, sondern eine stabile gesellschaftliche Existenz ermöglichen und soziale Sicherheit durch Rechtsgarantien und andere Schutzmaßnahmen gewährleisten. Dieser relativ geschützten Zone steht eine größer werdende „Zone der Entkoppelung“ gegenüber, in der sich die „Entbehrlichen“ und „Überflüssigen“ der Arbeitsgesellschaft befinden, die nicht nur temporär, sondern dauerhaft aus dem Beschäftigungssystem ausgeschlossen sind (vgl. Kronauer 2002; Franzpötter 2003). Zwischen diesen beiden Polen der Erwerbsgesellschaft hat sich Castel zufolge eine „Zone der Prekarität“ heraus gebildet, die eine Vielfalt flexibilisierter Arbeitsverhältnisse umfasst und sowohl Zeit- und Leiharbeit, geringfügige Beschäftigung und marginale Selbstständigkeit als auch befristete Projektarbeit sowie Vollerwerbsarbeit im Niedriglohnsektor umfasst (vgl. hierzu Letourneux 1998; Giesecke/Groß 2002; Vogel 2003; Noller 2003; Pietrzyk 2003; Kim/Kurz 2003). Die kontinuierliche Ausbreitung der „Zone der Prekarität“ interpretiert Castel als schleichende Rekommodifizierung der Arbeitskraft, da die für die fordistische Erwerbsgesellschaft noch charakteristische enge Kopplung von Berufsarbeit und sozialen Sicherheitsgarantieren aufgehoben wird. Für Castel ist Beschäftigung in der „Zone der Prekarität“ in besonderer Weise „verwundbar“ geworden, da kollektive Regelungssysteme geschwächt und soziale Sicherungen abgebaut werden. Diese Überlegungen verdichten sich in der These, dass mit der Ausbreitung ungeschützter Erwerbsarbeitsformen ein zentrales „Fundament der gesellschaftlichen Integration“ (2001: 88) zur Disposition gestellt wird.1 In diesem Beitrag wird die These von der Schwächung erwerbsarbeitsbezogener Integrationspotentiale durch die Ausbreitung atypischer, prekärer Beschäftigung in kritischer Absicht diskutiert. Dies erscheint umso dringlicher, da bei der Erforschung von Desintegrationsprozessen die Bedeutung von Erwerbsarbeit in aller Regel nur im Hinblick auf die sozialen Folgen der Exklusion aus der Arbeitswelt (Arbeitslosigkeit) berücksichtigt wird, während Desintegrationspotentiale deregulierter Beschäftigungsformen innerhalb der 1 In Abgrenzung zu einer anthropologisch-normativen Aufladung des Arbeitsbegriffs ist in diesem Zusammenhang der Hinweis von Castel (2001: 111) bedeutsam, dass nicht „Arbeit als solche“, sondern sozial abgesicherte Erwerbsarbeit eine zentrale Möglichkeitsbedingung sozialer Integration ist. 1 Arbeitswelt weithin ausgeklammert bleiben. Demgegenüber ist in diesem Beitrag eine Perspektivenverschiebung vorzunehmen. Nicht die Exklusion, sondern der Wandel von Erwerbsarbeitsformen und ihre Prekarisierung soll als Integrationsproblem thematisiert werden. Im Einzelnen ist folgende Vorgehensweise vorgesehen: Zunächst ist herauszuarbeiten, warum ungeachtet der wiederkehrenden sozialwissenschaftlichen Debatten zum „Ende der Arbeitsgesellschaft“ der Institution der Erwerbsarbeit auch weiterhin eine herausragende Bedeutung im Hinblick auf soziale Integrations- und Desintegrationsprozesse zuzuschreiben ist (1). Sodann ist zu klären, was in einem engeren soziologischen Sinne unter prekärer Erwerbsarbeit überhaupt zu verstehen ist, um hieran anschließend unterschiedliche Dimensionen von Prekarisierung unterscheiden zu können (2). Darüber hinaus soll herausgearbeitet werden, dass prekäre Erwerbsarbeit nicht nur arbeitsweltliche Desintegrationserfahrungen schüren kann, sondern oftmals mit unterschiedlichen ReIntegrationsbemühungen der Prekarisierten einher geht (3). Wie sodann aufzuzeigen ist, gewinnt mit der Diffusion von Prekarisierungsängsten innerhalb und außerhalb der „Zone der Prekarität“ ein arbeitsweltlicher Integrationsmodus an Bedeutung, der weniger auf Teilhabe, sondern auf Disziplinierung und Drohung gründet (4). Abschließend wird die Frage aufgeworfen, inwiefern dieser Integrationsmodus politische Einstellungsmuster und Orientierungen begünstigen kann, die für rechtspopulistische und fremdenfeindliche Zuspitzungen offen sind. 1. Erwerbsarbeit und soziale Integration Unter dem Schlagwort von der „Krise der Arbeitsgesellschaft“ (Matthes 1983) ist seit den 1980er Jahren immer wieder die These vertreten wurden, dass mit der Verkürzung der Wochen- und Jahresarbeitszeit sowie mit der Verringerung der in der Arbeitswelt verbrachten Lebenszeit die soziale Institution der Erwerbsarbeit an gesellschaftlicher Relevanz verloren habe. Dieser Bedeutungsverlust werde von einem tiefgreifenden Wandel von Arbeitswerten und Arbeitsverhalten begleitet. Vor allem in der umfangreichen Lebensstilforschung der 1980er und 1990er Jahre ist diese Grundannahme aufgegriffen und der Nachweis versucht worden, dass die soziale Positionierung des Individuums immer weniger von der Stellung innerhalb der Arbeitswelt abhängt. An deren Stelle seien andere Handlungsfelder und Aktivitätszentren außerhalb von Büro und Betrieb (Freizeit, Massenkultur etc.) getreten, in denen sich neuartige soziale Identitäten und Vergemeinschaftungsformen herausbilden würden, die von weitaus größerer subjektiver Relevanz seien (Schulze 1992). In jüngerer Zeit hat Ulrich Beck (1999; 2000b) die Debatte zur „Krise der Erwerbsgesellschaft“ wieder aufgegriffen und mit dem Vorschlag zur Förderung von „Bürgerarbeit“ sowie anderen Formen „bürgerschaftlichen Engagements“ den Stellenwert der marktvermittelten Erwerbsarbeit zugunsten anderer „nützlicher Tätigkeiten“ zu relativieren versucht. Damit ist 2 die Hoffnung verknüpft, dass der an klassische Erwerbsarbeit gekoppelte Integrationsmodus der Arbeitsgesellschaft, in der die Erwerbsarbeit selbst zu einem knappen Gut geworden ist, gelockert und auf andere, nicht-marktgängige gemeinwohlorientierte Tätigkeiten im sog. Dritten Sektor erweitert werden könne. Dem liegt die Erwartung zugrunde, dass die normative Aufwertung von „Bürgerarbeit“ dazu beitragen könne, sinnvolle und notwendige Tätigkeiten jenseits von Markt und Staat zu schaffen, um das Angebot an Erwerbsarbeit auf dem Arbeitsmarkt zu verringern und die sozialen Sicherungsnetze zu stabilisieren. Aus einem anderen theoretischen Blickwinkel formulieren schließlich Kocka/Offe (2000: 11) die Hoffnung, dass angesichts der anhaltenden Massenarbeitslosigkeit „Erwerbsarbeit zukünftig nicht mehr die zentrale Rolle für Identitätsbildung und Lebensplanung, soziale Beziehungen und gesellschaftlichen Zusammenhalt spielen wird, wie wir es aus der Vergangenheit kennen.“ Sicherlich ist unbestritten, dass die Arbeitswelt schon lange nicht mehr als unhinterfragter Mittelpunkt der subjektiven Lebenswirklichkeiten angesehen werden kann. Die veränderte Stellung von Erwerbsarbeit hat allerdings keineswegs zur Folge, dass sie an sozialer Relevanz verliert. Ganz im Gegenteil: Obwohl die Erwerbsarbeit quantitativ an Umfang eingebüßt hat und die Freizeit deutlich gewachsen ist, muss oftmals der individuelle Aufwand intensiviert werden, um den eigenen Arbeitsplatz nicht zu gefährden (höhere Arbeitsbelastung), berufliche Arbeit dauerhaft ausüben und zunehmende Erwerbsrisiken bewältigen zu können (berufliche Weiterbildung, „lebenslanges Lernen“). Mit anderen Worten wird Erwerbsarbeit subjektiv unwichtiger und zugleich immer wichtiger (vgl. bereits Voß 1993: 109). Visionäre Spekulationen zur „Überwindung der Erwerbsgesellschaft“ kollidieren nicht nur mit der – empirisch nachgewiesenen – ausgeprägten Erwerbsorientierung breiter Bevölkerungsgruppen (vgl. Holst/Schupp 1995), die sich gerade auch unter Frauen immer mehr durchgesetzt hat, sondern sie stehen auch quer zu dem Umstand, dass Erwerbsarbeit weiterhin einen uneingeschränkt hohen Stellenwert für die Positionierung des Individuums im sozialen Raum zugeschrieben werden muss. Der Arbeitsmarkt repräsentiert neben dem Bildungssystem (Müller 1998) eine zentrale Drehscheibe der ungleichen Zuteilung von Lebenschancen (Kreckel 1992). Die ungebrochene Strahlkraft von Erwerbsarbeit besteht darin, dass mit ihr eine Reihe fundamentaler Erwartungshaltungen verbunden sind, die eine stabile soziale Existenz und eine längerfristige Lebensplanung möglich machen. Wenn man einmal von Einkommen aus Besitz (Vermietung, Verpachtung) und Privatvermögen (Zinserträge) absieht, dann sind die Reproduktions- und Konsumchancen der allermeisten Privathaushalte dauerhaft an die Erwerbsbedingungen der modernen Lohnarbeit gebunden. Auf dem Arbeitsmarkt fallen die Entscheidungen über Art und Niveau der materiellen Versorgung des Individuums und damit über die soziale Verteilung begehrter Güter. Dies trifft übrigens auch in gleichem Maße für die nicht-erwerbstätige Bevölkerung zu, die ihren Lebensunterhalt über Versicherungsleistungen bzw. Versorgungsansprüche bestreitet. So bemisst sich die Einkommenshöhe von Erwerbslosen, Rentnern oder Studenten an der 3 eigenen früheren bzw. an der zukünftig erwarteten Erwerbstätigkeit. Und die sozioökonomische Stellung der Empfänger privater Unterhaltszahlungen wie nichterwerbstätiger Ehepartner und Kinder hängt wiederum von der Erwerbsposition des Unterhaltspflichtigen ab. Es sind also nicht nur die Arbeitenden in aller Regel auf Erwerbsarbeit angewiesen, sondern gerade auch die von ihnen wirtschaftlich abhängigen Haushaltsmitglieder. Darüber hinaus darf nicht übersehen werden, dass angesichts hoher Scheidungsraten die Ehe immer weniger als lebenslange Versorgungsinstitution gesehen werden kann. In diesem Zusammenhang signalisiert der säkulare Anstieg der Erwerbsquote von Frauen in den letzten Jahrzehnten einen weiteren Bedeutungszuwachs marktorientierter Erwerbsarbeit. Hinzu kommt, dass Familienhaushalte zunehmend auf zwei Erwerbseinkommen angewiesen sind, wenn ein bestimmter Lebensstandard gesichert werden soll. Dass weder von einem subjektiven noch von einem objektiven Bedeutungsverlust der sozialen Institution Erwerbsarbeit gesprochen werden kann, zeigt sich schließlich auch bei jenen, die unfreiwillig ausgeschlossen sind, den Arbeitslosen (Kronauer/Vogel/Gerlach 1993: 220ff.). Die normative Ausstrahlungskraft von Erwerbsarbeit lässt sich auch daran ermessen, dass durch sie die materiellen Bedingungen (Geldverfügbarkeit) definiert werden, unter denen viele nicht-erwerbsbezogene Motive überhaupt erst verfolgt werden können. Unter Bedingungen einer entwickelten „Marktgesellschaft“ ist Geld ein generalisierter Eigentumstitel, der die Institution des Sacheigentums transzendiert, da fast schon beliebig unterschiedliche Wertobjekte erworben werden können. Außerdem ist Geld hinsichtlich seiner Zweckverwendung offen. Es ist nämlich ein absolut unverzichtbares Mittel, um nicht nur zweckrationale Motive, sondern insbesondere auch solche wertrationaler oder expressiver Natur in nicht-vermarktlichten, vergemeinschafteten Handlungsfeldern wie Familie, Haushalt, Freundeskreis und Massenkultur verfolgen zu können (Simmel 1989). Mit anderen Worten ist marktvermittelte Erwerbsarbeit gewissermaßen Mittel zum Zweck der Realisierung nichtmarktlicher Motive außerhalb der Arbeitswelt. Verallgemeinernd folgt hieraus: Stabile und auf Dauer gestellte Erwerbschancen sind nicht nur eine wichtige Möglichkeitsbedingung für ökonomische Integration, sondern zugleich auch konstitutiv für alltagspraktische und symbolische Teilhabechancen an den pluralen Optionen der materiellen Kultur. Diese Bedeutung der materiellen Kultur für soziale Integrationsprozesse (vgl. Brock 1993; Kraemer 2002) bleibt unverstanden, wenn sie – wie so oft – aus der Introspektive eines akademischen Bildungsmilieus als kompensatorischer Konsumismus kulturkritisch beklagt wird. Die ungebrochene soziale Geltung legaler, marktvermittelter Erwerbsarbeit – auch Beck (2000a: 46) spricht bezeichnenderweise von einem „Art Daseins-Monopol in unserem kulturell verordneten Selbstwertgefühl“ – resultiert allerdings nicht nur aus dem Tatbestand, dass sie die eigenständige Erwirtschaftung des Lebensunterhalts und die Teilhabe an der materiellen Kultur ermöglicht. Über stabile, kontinuierliche Erwerbsarbeit wird zudem soziale Anerkennung zugeschrieben. Die identitätsstiftende Bedeutung von Erwerbsarbeit strahlt im 4 übrigen auch auf nichterwerbstätige Haushaltsmitglieder der Erwerbstätigen aus sowie auf diejenigen, die noch im Ausbildungssystem sind (z.B. Studenten) oder bereits aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sind (Langzeitarbeitslose, Rentner). Diese innerhalb und außerhalb der Arbeitswelt zugeschriebene soziale Anerkennung interpretiert Richard Sennett als „Chemie sozialer Inklusion“ (2000: 433). So wird etwa innerhalb der Arbeitswelt durch die Zuschreibung von Anerkennung ein wechselseitiges soziales Verhältnis konstituiert, das als spezifische Norm sozialer Reziprozität (Mauss 1990) interpretiert werden kann. Dadurch werden Sozialbeziehungen im Arbeitsteam, in der Abteilung, innerhalb der Unternehmenshierarchie stabilisiert und auf Dauer gestellt. Genauer betrachtet handelt es sich keineswegs um einen symbolischen Austausch unter Statusgleichen, sondern um Rituale gegenseitiger Anerkennung zwischen den Inhabern unterschiedlicher Status- und Machtpositionen. In diesen Ritualen wird betriebsöffentlich vergegenwärtigt und zugleich bezeugt, dass „die Angestellten von den Firmen, für die sie arbeiten, wahrgenommen und gehört werden“ (Sennett 2000: 433). Diese Rituale können in institutionalisierter Form in den Ablauf von Betriebsversammlungen, Konferenzen oder Abteilungssitzungen eingebunden sein oder in den eingeschliffenen Gesten des Betriebsalltags sichtbar werden. Selbst die vermeintlich sachlichen Tarif- und Entlohnungssysteme transportieren die symbolische Botschaft der reziproken Anerkennung. Mit der Bezahlung wird nämlich nicht nur in zweckrationaler Weise eine arbeitsvertragliche Vereinbarung abgegolten, sondern auch soziale Wertschätzung der geleisteten Arbeit zugeschrieben. Mit der „Deregulierung“ der Arbeitsmärkte breiten sich nun prekäre Beschäftigungsformen aus, die enger an (vermeintliche oder tatsächliche) unternehmerische Markterfordernisse gekoppelt werden. Dadurch wird sowohl das funktionale als auch das symbolische Integrationspotential von Erwerbsarbeit geschwächt. Wenn Arbeitsverhältnisse nur vorübergehend eingegangen werden und Beschäftigte zwischen befristeten Erwerbsarbeits- und Arbeitslosigkeitszeiten pendeln, wird nämlich nicht nur die Einkommenssituation prekär, sondern auch der an Erwerbsarbeit gekoppelte soziale Status. In den Sozialwissenschaften wird der Desintegrationsbegriff nicht selten als allgemeine Erklärungsformel verwendet, um relativ unabhängig von konkreten Entwicklungsprozessen Probleme oder „Störungen“ moderner Gesellschaften (Gewalt, Anomie, soziale Bindungslosigkeit, Normerosion etc.) beschreiben zu können (vgl. Peters 1993; Friedrichs/Jagodziniski 1999). Demgegenüber soll im Folgenden der Desintegrationsbegriff nur in einem eingeschränkten Sinne verwendet und ausdrücklich auf eine konkrete ökonomisch-politisch-soziale Konstellation bezogen werden, nämlich auf die voranschreitende Internationalisierung nationaler Ökonomien und die Infragestellung lange Zeit selbstverständlicher sozial- und tarifpolitischer Regulierungsnormen (vgl. Dörre/Anders/Speidel 1997). Genauer betrachtet bezieht sich der verwendete Begriff Desintegration darauf, dass soziale Erwartungen bzgl. der Teilhabe am wirtschaftlichen Fortschritt und gesellschaftlichen Wohlstand enttäuscht werden. Sowohl die Chance eines 5 kollektiven sozialen Aufstiegs seit den 1950er Jahren als auch das Niveau der sozialstaatlichen Absicherung des „rheinischen Kapitalismus“ sind im Laufe der letzten Jahrzehnte zu einem festen Bestandteil legitimer „Anrechte“ (Dahrendorf 1992) geworden, auf deren Erfüllung sich bislang gesellschaftliche Integration gründete. Im Zuge der „Globalisierung“ wirtschaftlicher Beziehungen und der voranschreitenden „Deregulierung“ der Arbeitsmärkte scheint nun die für die fordistische Epoche charakteristische Selbstverständlichkeit, dass ökonomische Wertzuwächse der gesellschaftlichen Wohlfahrtsproduktion zugute kommen, zur Disposition gestellt zu werden. Jedenfalls werden seit geraumer Zeit die institutionellen Arrangements zur De-Kommodifizierung der Erwerbsarbeit sukzessive wieder eingeschränkt und zurück genommen. Zu beobachten ist eine breit angelegte, in vielen Bereichen der Arbeitswelt um sich greifende „Verschiebung der Marktgrenzen“ (Brinkmann 2003), in deren Verlauf marktförmige Kontroll- und Steuerungsmechanismen an Bedeutung gewinnen. Vor dem Hintergrund dieser und anderer Entwicklungen verblasst das für die politisch-institutionelle Ordnung der Bundesrepublik konstitutive Versprechen, am „Wohlstand für alle“ teilhaben zu können, solange man „normaler“ Erwerbsarbeit nachgeht oder zumindest im Falle von Arbeitslosigkeit bereit ist, „normale“ Erwerbsarbeit anzunehmen, die dem eigenen beruflichen Qualifikationsniveau entspricht. Im Ergebnis wird der am Modell „normaler“ Erwerbsarbeit eng gekoppelte Integrationsmodus in Frage gestellt. 2. Prekäre Erwerbsarbeit – was ist das? Soziologisch betrachtet gibt es keine Erwerbsarbeit, die aufgrund spezifischer Merkmale oder Eigenschaften an und für sich als „prekär“ bezeichnet werden könnte. Erwerbsarbeit und die sozialen Umstände, unter denen sie verrichtet wird, sind nicht allein schon deshalb als prekär zu bezeichnen, weil sie so sind wie sie sind, sondern weil sie in Relation zu anderen Beschäftigungsformen und ihren jeweiligen sozialen Umständen als prekär bewertet werden. „Prekarität“ ist das Ergebnis sozialer Zuschreibungen und Klassifikationen auf der Basis eines normativen Vergleichsmaßstabs. Genauer formuliert kann die „Prekarität“ einer Erwerbsarbeit nicht substantialistisch, sondern nur im Verhältnis zu Beschäftigungsverhältnissen bestimmt werden, deren soziale Geltung üblicherweise mit den Attributen „regulär“ oder „normal“ umschrieben wird. Bevor also geklärt werden kann, was unter „prekärer“ Erwerbsarbeit zu verstehen ist, ist zunächst der normative Referenzmaßstab von prekärer Erwerbsarbeit selber, d.h. „normale“ Erwerbsarbeit, in den Blick zu nehmen. Im Unterschied zu anderen abhängigen Beschäftigungsformen wird oder wurde doch zumindest lange Zeit von regulärer, „normaler“ Erwerbsarbeit immer dann gesprochen, wenn mit ihrer Ausübung spezifische Sicherheitsgarantien und Rechtsansprüche verbunden sind, die eine stabile gesellschaftliche Statusposition begründen. Genauer betrachtet wird das 6 „Normale“ an „Normalarbeitsverhältnissen“ (Mückenberger 1985) auf sozial generalisierte Erwartungsmuster bezogen, die mit einem spezifischen Arbeitnehmerstatus verbunden sind: Diese Erwartungsmuster rekurrierten erstens auf die Unbefristung eines Arbeitsvertrages, die als selbstverständlich angesehen wird und berufliche bzw. biografische Planungssicherheit verspricht; zweitens auf ein Arbeitszeitmodell, das sich an der Norm der Vollzeitbeschäftigung orientiert und auf die wöchentlichen Werktage gleichmäßig verteilt ist; drittens auf eine stabile Entlohnung der Arbeitsleistung nach Arbeitszeit, beruflichem Status und familiärer Stellung; sowie viertens auf ein bestimmtes Niveau der sozialen und arbeitsrechtlichen Absicherung Bezug nimmt, das – von Männern – als obligatorisch angesehen wird, um als „Ernährer“ den Lebensunterhalt einer Familie bestreiten zu können. Ein derartiges „Normalarbeitsverhältnis“ garantiert gesetzliche Schutzrechte, kollektive Tarifleistungen und betriebliche Vergünstigungen (Betriebsrenten, Sozialpläne, Qualifizierungsmaßnahmen), wobei hervorzuheben ist, dass das Niveau der sozialen Absicherung mit Dauer der Betriebszugehörigkeit (Senioritätsprinzip) und der Kontinuität der Erwerbsbiografie (Sozialversicherungsansprüche) zunimmt. In diesem Zusammenhang ist bedeutsam, dass diese Standards auch heute noch in großen Teilen der Bevölkerung die Vorstellung von „normaler“ Erwerbsarbeit prägen, obwohl ihre normative Gültigkeit von maßgeblichen gesellschaftlichen Eliten in Wirtschaft, Politik und Wissenschaft erheblich unter Druck gesetzt worden ist.2 An der schrittweisen Neuausrichtung der arbeitsmarktpolitischen Gesetzgebung der Bundesrepublik seit Mitte der 1980er Jahre ist jedenfalls abzulesen, dass das Normalitätsmuster abhängiger Erwerbsarbeit in der bislang gültigen Form seine Selbstverständlichkeit als normativer Bewertungsmaßstab für die gesetzliche Regulierung von abhängiger Beschäftigung verloren hat. War es beispielsweise noch bis Anfang der 1970er Jahre das erklärte Ziel von Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsrecht, atypische Beschäftigungsformen an die sozialen Standards „regulärer“ Beschäftigung heranzuführen, so hat sich das Blatt inzwischen vollständig gewendet. Die Neuausrichtung wird mit der Erwartung verbunden, dass eine reibungsärmere Reintegration von Erwerbslosen in den Arbeitsmarkt besser gelingen könne. So sind in den letzten beiden Jahrzehnten mit Inkrafttreten bzw. Novellierung u.a. des Beschäftigungsförderungsgesetzes (1985), des Arbeitszeitgesetzes (1994), des Wachstums- und Beschäftigungsförderungsgesetzes (1996), des Teilzeit- und Befristungsgesetzes (2001), Job-AQTIV-Gesetzes (2002) sowie des ersten („Hartz 1“) und zweiten („Hartz 2“) Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (2003) sukzessive neue gesetzliche Grundlagen geschaffen worden, die darauf abzielen, auf breiter Linie „atypische“ Beschäftigungsformen zu fördern (vgl. Jahn/Rudolph 2002a, 2002b; Rudolph 2003). Hinzu kommen eine Reihe weiterer sozial- und arbeitsmarktpolitischer 2 So besitzt die normative Ausstrahlungskraft „regulärer“ Beschäftigungsverhältnisse gerade auch weiterhin für diejenigen Beschäftigten Gültigkeit, die sich aus Mangel an „normalen“ Erwerbsmöglichkeiten mit atypischer Arbeit begnügen müssen. Im sozialen Gespür für den Grad der eigenen erwerbsbiografischen Gefährdung manifestiert sich die unangefochtene soziale Geltung, die „normale“ Erwerbsarbeit als Richtschnur für ungewollt befristete und prekär Beschäftigte ausübt. 7 Weichenstellungen, die sich vom normativen Leitbild sozial geschützter Normalarbeitsverhältnisse abwenden. Zu nennen ist etwa die Absenkung gesetzlicher Mindeststandards von Arbeitsverträgen, die Lockerung des Kündigungsschutzes sowie Leistungskürzungen bei Krankenversicherung und gesetzlichen Rentenbezügen. Und schließlich wird der Druck zur Aufnahme unterdurchschnittlich geschützter „atypischer“ Erwerbsarbeit dadurch erhöht, dass Unterstützungsleistungen für Erwerbslose gekürzt und Zumutbarkeitsregeln der Arbeitsvermittlung verschärft werden (vgl. Lessenich 2003). Wie kann nun aber genauer Prekarität in einem relationalen Sinne bestimmt werden? In der einschlägigen Literatur gilt eine Erwerbsarbeit dann als „prekär“, wenn die für ein Normalarbeitsverhältnis charakteristischen sozialen, rechtlichen und betrieblichen Standards unterschritten werden. Demzufolge ist Prekarität nicht identisch mit vollständiger Ausgrenzung aus dem Erwerbssystem, absoluter Armut, totaler sozialer Isolation, irreversiblem Kontrollverlust und absoluter Apathie. Prekarität kann nur an gesellschaftlichen Normalitätsstandards gemessen werden, die ihrerseits historischen Veränderungen unterliegen (vgl. Mayer-Ahuya 2003: 14ff.). Die Vorzüge einer derartigen Definition liegen in der strikt relationalen Herangehensweise sowie darin begründet, dass die strukturellen Veränderungen von Arbeitsverhältnissen zum Bezugspunkt der Analyse gemacht werden. Um die Prekarisierungsproblematik in ihrer ganzen gesellschaftlichen Bedeutung in den Blick nehmen zu können, ist es gleichwohl unverzichtbar, Prekarisierung nicht nur als objektive Benachteiligung im Sinne einer statistischen Abweichung von einem Normalstandard zu fassen. Um die Integrationsproblematik atypischer Beschäftigungsformen in einem umfassenderen Sinne thematisieren zu können, erscheint es sinnvoll, die „objektive“ Identifikation von Prekarisierungsprozessen um eine „subjektive“ Komponente zu erweitern. Die Differenzierung zwischen objektiven Prekarisierungsprozessen und subjektiven Prekarisierungsängsten ist insofern von zentraler Bedeutung für die hier verfolgte integrationstheoretische Fragestellung, als dadurch die relationale Wahrnehmung zwischen Prekarisierten und Nicht-Prekarisierten eingefangen werden kann. Neben den sozioökonomischen und institutionellen Strukturmerkmalen prekärer Beschäftigung dürfen latente oder manifeste Prekarisierungsängste nicht übersehen werden. So ist immer zugleich auch die subjektiv artikulierte Sorge in den Blick zu nehmen, die eigene, bisher als sicher wahrgenommene Beschäftigungssituation könne in einem wachsenden Umfeld prekarisierter Erwerbsarbeit an Stabilität und Sicherheit einbüßen, selbst wenn dies aufgrund der eigenen „objektiven“ Beschäftigungslage noch so unwahrscheinlich erscheint. Es sind also nicht nur objektive Prekarisierungsprozesse zu thematisieren, sondern zudem jene subjektiven Prekarisierungsängste, die auch in bisher noch integrierten Sektoren des Arbeitsmarktes anzutreffen sind. Prekarisierungsängste sind oftmals latenter Natur. Sie können allerdings buchstäblich über Nacht manifest werden, wenn etwa Befürchtungen aufkeimen, der bisherige berufliche Werdegang könne in eine prekäre Befristungskarriere einmünden; wenn mit der Übernahme 8 des Betriebes durch ein konkurrierendes Unternehmen die im Laufe der Unternehmenszugehörigkeit erworbenen Rechtsansprüche und Schutzregelungen unterminiert werden; wenn unternehmensinterne Reorganisationen und Umstrukturierungen die eigene Position innerhalb der betrieblichen Statushierarchie schwächen; wenn der eigene Arbeitsplatz durch unternehmensexternes Personal („Outsourcing“) substituiert wird; oder wenn private Finanzierungsmodelle, auf denen ganze Lebensplanungen (z.B. Hausbau, Immobilienerwerb, private Altersvorsorge) gründen, im Falle von erzwungener Arbeitslosigkeit wie ein Kartenhaus in sich zusammen fallen. Prekarisierungsängste sind somit sowohl innerhalb als auch außerhalb einer als objektiv prekär definierten Zone des Arbeitsmarktes in den Blick zu nehmen. Die Ausbreitung derartiger Verunsicherungen und Prekarisierungsängste (vgl. Fuchs/Conrads 2003) verweist auf den Grad der Verallgemeinerung sozialer Verunsicherung. Von sozialer Verunsicherung kann immer dann gesprochen werden, wenn sowohl einzelne Lebenspläne als auch umfassendere Lebenskonzepte bis hin zur Konstruktion berufsbiografischer Identitäten als bedroht wahrgenommen werden. Nur wenn eine derartige erweiterte Perspektive eingenommen wird, kann auch das Bedrohungspotential von Prekarisierung und seine soziale „Ausstrahlung“ auf andere, bislang standardisierte Beschäftigungsformen problematisiert werden. Selbst wenn nach objektiver Definition Prekarität gegenwärtig nicht die Mehrheit der Beschäftigungsverhältnisse kennzeichnet, sondern sich auf bestimmte Segmente der Arbeitswelt beschränkt, so können Prekarisierungsängste gesellschaftsweit diffundieren und in Bereiche vordringen, in denen man diese aufgrund eines (über-)durchschnittlichen sozialen Absicherungsniveaus von Erwerbsarbeit bislang kaum vermuten konnte. Prekäre Erwerbsarbeit ist in einem weiten Spektrum atypischer Beschäftigungsformen anzutreffen, das Zeit- und Leiharbeit, Scheinselbstständigkeit, Teilzeitarbeit, geringfügige Beschäftigung und Vollerwerbsarbeit im Niedriglohnsektor sowie befristete Erwerbsarbeit auf Projekt- und Werkvertragsbasis umfasst. Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang, dass allerdings nicht jede atypische Beschäftigung als prekär bezeichnet werden kann. Hinter ein und derselben Beschäftigungsform können sich unterschiedliche arbeitsweltliche Wirklichkeiten verbergen. Stets ist in Rechnung zu stellen, dass ein und dieselbe Arbeitsstelle mit vergleichbaren sozialen Merkmalen und institutionellen Rahmenbedingungen unterschiedlich bewertet werden kann. Die Bewertung ist immer zugleich auch von den berufsbiografisch, soziallagespezifisch oder geschlechtlich gefilterten Erwartungshaltungen abhängig. Für die allermeisten Formen flexibler, atypischer Beschäftigung gilt gleichwohl, dass sie ein prekäres Potential (Mayer-Ahuja 2003: 29; Dörre 2003: 24) beinhalten, welches sich unter genauer zu eruierenden Bedingungen entfalten oder auch eingehegt werden kann. Das prekäre Potential einer geringfügigen Beschäftigung auf 400-Euro-Basis wird beispielsweise dann nicht geweckt, sondern schlummert lediglich weiter, wenn diese Tätigkeit nur deswegen aufgenommen worden ist, um das Erwerbseinkommen eines Familienhaushalts aufzubessern („Hinzuverdienst“) oder familiäre Verpflichtungen (Kinderbetreuung) 9 wahrgenommen werden und die betreffende Person ansonsten, etwa über risikoabsorbierende Haushaltsstrukturen bzw. stabile Partnerbeziehung abgesichert ist. Ändern sich jedoch infolge von Scheidung oder Trennung die Lebensumstände, dann wird das schlummernde prekäre Potential buchstäblich über Nacht sozial wirksam und die vormals erwünschte geringfügige Beschäftigung leicht zu einer Armutsfalle. In aller Regel reicht eine geringfügige Beschäftigung nämlich weder zur eigenständigen Bestreitung eines existenzsichernden Lebensunterhalts aus noch garantiert sie die üblicherweise an reguläre Dauer- und Vollzeitbeschäftigung gekoppelten Rechtsansprüche wie Kündigungsschutz, Abfindungsregelungen oder Anwartschaften für Rentenansprüche. Auch reicht der Tatbestand der Befristung keineswegs aus, um das Prekarisierungspotential eines Arbeitsverhältnisses abschätzen zu können. Vielmehr müssen die mit einem befristeten Beschäftigung verbundenen Erwartungshaltungen, Erwerbsmotive und Handlungsoptionen selbst in den Blick genommen werden. Zu fragen wäre deswegen, ob die Aufnahme einer atypischen Beschäftigung gewollt oder erzwungen ist? Dient diese als „Sprungbrett“, um auf dem Arbeitsmarkt wieder Fuß zu fassen oder wird sie als provisorische „Übergangslösung“ wahrgenommen, um eine erwerbsbiografische Lücke auszufüllen? Ermöglicht sie den Wiedereinstieg ins Berufsleben, z.B. nach der Betreuungsphase von Kindern im eigenen Haushalt? Wird sie als schlichter „Hinzuverdienst“ angesehen, um das Haushaltseinkommen „aufzubessern“? Oder wird sie als aufgeherrschter Dauerzustand angesehen, der keine alternativen Beschäftigungsoptionen mehr zulässt? In dem einen Fall ist man beispielsweise von Befristung „betroffen“, weil sie die einzige Erwerbsalternative zu Arbeitslosigkeit darstellt. In dem anderen Fall kann Befristung aber auch eine kaum vermeidbare Episode im Verlauf einer Erwerbsbiografie sein, um sich bestimmte Berufschancen und Karrierewege offen zu halten. Natürlich kann sich auch im zweiten Falle das prekäre Potential einer Befristung entfalten; und zwar zeitversetzt immer dann, wenn sich die mit dem Umweg einer Befristung verbundenen beruflichen Erwartungen als unrealistisch erweisen. Allgemeiner formuliert: Ohne einem strukturvergessenen Voluntarismus das Wort reden zu wollen, ist die Frage der Handlungsfähigkeit (capability) (Giddens 1988) aufzuwerfen und auf die Gruppe atypisch Beschäftigter zu beziehen, da ansonsten das prekäre Potential atypischer Beschäftigungsformen unter unterschiedlichen sozialen Kontextbedingungen nicht annäherungsweise abgeschätzt werden kann. Gerade aus einer aufgeklärten akteurs- bzw. handlungstheoretischen Perspektive, die zugleich den strukturellen Kontext, in dem gehandelt wird, in Rechnung stellt, macht es jedenfalls einen bedeutsamen Unterschied, ob einer befristeten Erwerbsarbeit mangels Einkommens- oder Beschäftigungsalternativen nachgegangen werden muss oder ob unter Abwägung tatsächlich vorhandener oder erwartbarer alternativer Beschäftigungschancen sowie unter Berücksichtigung des prinzipiell nie auszuschließenden Prekarisierungsrisikos atypischer Beschäftigung eine Befristung eingegangen wird. Der Prekarisierungsgrad hängt also immer auch von den verfügbaren Entscheidungsoptionen bzw. der Wahrscheinlichkeit eines 10 Wechsels auf eine alternative Stelle (exit option) ab. Mit anderen Worten handeln die sozialen Akteure in prekärer Beschäftigung stets innerhalb eines Erfahrungshorizontes, der durch die jeweiligen Grade der objektiven und subjektiv wahrgenommenen Gefährdung der eigenen Erwerbsbiografie geprägt ist. Auf jeder Prekarisierungsstufe gibt es Beschäftigte, die ihre Erwerbssituation besser bewältigen können als andere, da sie über Entscheidungsoptionen, Netzwerke und Ressourcen verfügen, die es erlauben, eher im Sinne eigener Orientierungen zu handeln. Nicht zuletzt ist festzuhalten, dass prekäre Erwerbsarbeit nicht zwangsläufig in prekärem Wohlstand einmünden muss. Zwar geht eine prekäre Erwerbslage oftmals mit einer prekärer Lebensführung einher. Aber prekäre Erwerbsarbeit sollte trotzdem nicht mit prekärem Wohlstand gleichgesetzt werden. Erfahrungen von Prekarisierung innerhalb der Arbeitswelt können nämlich, aber müssen nicht außerhalb des Erwerbsbereichs ihre Fortsetzung finden; sie können auch aufgefangen oder abgemildert werden. Dies hängt von weiteren, im Folgenden allerdings zu vernachlässigenden außerarbeitsweltlichen Einflussfaktoren ab, wie z.B. der Stabilität familiärer und anderer gemeinschaftlicher Netzwerke, der Einkommens- und Vermögensverhältnisse des gesamten Haushalts, der individuellen „Kapitalausstattung“ im Sinne Pierre Bourdieus usw. 3. Prekäre Erwerbsarbeit zwischen Desintegration und Reintegration Von prekärer Arbeit kann gesprochen werden, wenn sich die Erwerbslage von anderen, als „normal“ oder „regulär“ wahrgenommenen Beschäftigungsverhältnissen durch strukturelle Benachteiligungen unterscheidet, die den Zugang zu Ressourcen und Rechten sowie die Zuschreibung von Anerkennung betreffen. Es handelt sich hierbei um Beschäftigungsformen, die durch eine Verallgemeinerung sozialer Unsicherheitserfahrungen gekennzeichnet sind. Prekäre Erwerbsarbeit kann in mehrfacher Hinsicht desintegrierend wirken: Erstens ermöglicht sie allenfalls vorübergehend, aber nicht dauerhaft ein existenzsicherndes Erwerbseinkommen. Im Gegensatz zu Festangestellten partizipieren prekär Beschäftigte auch an sonstigen betrieblichen Entgeltregelungen (z.B. Höhergruppierung, Überschussbeteiligung, Weihnachts- und Urlaubsgeldansprüche) nicht oder nur unzureichend. Zweitens werden im Regelfall soziale Sicherheitsgarantien wie Kündigungsschutz, Abfindungsansprüche und sonstige betriebliche Leistungen ausgehöhlt, die üblicherweise an „Normalerwerbsarbeit“ gekoppelt sind. Drittens werden institutionell garantierte Partizipationschancen in der Arbeitswelt wie betriebliche Interessenvertretung nicht oder nur unzureichend gewährt. Viertens herrscht aufgrund von befristeten Arbeitsverträgen mehr oder weniger permanente Beschäftigungsunsicherheit vor. Fünftens ist unter diesen Beschäftigungsbedingungen jede längerfristige Planungssicherheit für den eigenen Lebensentwurf blockiert. So können beispielsweise Elternschaft oder Wohneigentum zu einem nicht kalkulierbaren sozialen Risiko werden, wenn der Lebensunterhalt eigenständig erwirtschaftet werden muss. Wenn 11 Beschäftigte nur befristet erwerbstätig sind, ist das zwangsläufig mit Unsicherheitserfahrungen verbunden. Das gilt um so mehr, wenn die Übergänge zwischen den Arbeitsplätzen durch Phasen erzwungener Arbeitslosigkeit unterbrochen sind, deren Dauer von vornherein nicht abgeschätzt werden kann. Zudem kann der stete Wechsel zwischen unterschiedlichen Arbeitsplätzen die private Organisation des Alltags erheblich beeinträchtigen, da ein verlässlicher Zeitrahmen für kontinuierliche lebensweltliche Aktivitäten in Familie, Freundeskreis und Freizeit nicht gegeben ist. Selbst mit Blick auf kürzere Fristen wird ein bestimmtes Maß der für ein „gutes“ Leben unverzichtbaren privaten Planungssicherheit erschwert. Je entwickelter bestimmte berufsbezogene Ansprüche an Erwerbsarbeit sind, desto intensiver kann prekäre Erwerbsarbeit sechstens im Sinne einer klassischen Statusinkonsistenz auch als ausbildungsinadäquate, unterwertige Beschäftigung wahrgenommen werden, die zu einer berufsbiografischen Bedrohung heranwächst, je länger Beschäftigte in dieser Erwerbslage verharren müssen. Der gegenüber „Normalarbeitsverhältnissen“ benachteiligte Zugang zu betrieblichen Anrechten und Privilegien wird innerhalb der betrieblichen Sozialhierarchie siebtens in Form unterschiedlichster Grenzmarkierungen und Anerkennungszuschreibungen reproduziert. Hierbei dürfen die ausgrenzenden Effekte keineswegs unterschätzt werden, die von der Setzung symbolischer Unterscheidungen ausgehen können.3 So kann beispielsweise die ohnehin schon prekäre ökonomische und arbeitsvertragliche Stellung von Zeit- und Leiharbeiternehmern durch ihren Status verstärkt werden, der die gleichberechtigte Zugehörigkeit zu betrieblichen Gemeinschaften im besten Falle auf Zeit gewährt. Auch kann der stete Wechsel des Arbeitsplatzes als Sprung ins Ungewisse erlebt werden, der das jeweilige Unternehmen und seine betriebliche Ordnung „unlesbar“ (Sennett 2000: 440) macht. Für Beschäftigte in einer prekärer Erwerbslage sind Unsicherheit und Diskontinuität ein generalisiertes Erfahrungsmuster, wodurch soziale Desintegration begünstigt wird. Die Ungewissheit, die mit derartigen Beschäftigungsformen einher geht, erstreckt sich über weite Bereiche der sozialen Existenz, erfasst sowohl berufliche als auch private Zukunftserwartungen und spiegelt sich nicht zuletzt in der Einschätzung der eigenen Stellung auf dem Arbeitsmarkt und im betrieblichen Alltag. Diese generalisierte Unsicherheit kann als fluide Schwebelage ohne kalkulierbare Verortung im betrieblichen und außerbetrieblichen 3 So kann beispielsweise der soziale Status eines Leiharbeitnehmers selbst dann rasch desintegrierend wirken, wenn es vergleichsweise gut gelingt, ihn für die Zeit der Beschäftigung im Entleihunternehmen zu integrieren. Schließlich handelt es sich lediglich um Bindungen auf Zeit. Im temporären Integrationsfall ist Anerkennung nur für den Zeitraum der Betriebszugehörigkeit „geliehen“. Mit dem obligatorischen Ausscheiden aus einem Beschäftigungsverhältnis wird die erworbene Anerkennung wieder entwertet, so dass sie auch bei jedem Arbeitseinsatz wieder aufs Neue erworben werden muss. Zum fast schon unvermeidbaren symbolischen Anerkennungszyklus prekärer Beschäftigung vgl. Kraemer/Speidel (2004b). Im Falle einer zeitlich befristeten Beschäftigung in einem Unternehmen besitzt – mit Sennett (2000) gesprochen – der reziproke Austausch sozialer Anerkennung nur provisorische Geltung. Allgemeiner formuliert können Strukturen ökonomischer Privilegierung/Benachteilung immer auch als Anerkennungskonflikte gelesen werden. Vgl. grundsätzlich zum Stellenwert von Anerkennungsbeziehungen im ökonomischen Feld die Kontroverse bei Fraser/Honneth (2003) sowie Voswinkel (2001). 12 Sozialraum beschrieben werden. Und trotzdem sollten die mit prekärer Erwerbsarbeit verbundenen Desintegrationspotentiale nicht hypostatiert werden. Anzunehmen ist nämlich, dass gerade prekär Beschäftigte, die weder der „Zone der Normalität“ noch der „Zone der Exklusion“ zugerechnet werden können, vor dem Hintergrund der Desintegrationserfahrungen vielfältige Reintegrationsanstrengungen unternehmen, die allesamt von der Hoffnung leben, die eigene instabile Erwerbslage könne überwunden und die „Normalität“ eines „Normalarbeitsverhältnisses“ (wieder) hergestellt werden. Das Bemühen um Reintegration ist umso wahrscheinlicher wie die Erwartung nicht dauerhaft enttäuscht wird, dass prekäre Erwerbsarbeit den (Wieder-)Einstieg in akzeptable, „normale“ Beschäftigung ermöglichen oder der unterbrochene berufliche Weg wieder fortgesetzt werden könnte. Im umgekehrten Fall ist die Sorge um die eigenen Beschäftigungschancen umso verbreiteter, wenn prekäre Erwerbsarbeit nicht mehr als „Übergangslösung“ wahrgenommen wird, um etwa eine durch Arbeitslosigkeit oder Kindererziehung hervorgerufene erwerbsbiografische Lücke auszufüllen, sondern als unvermeidbare neue Normalität. Der reintegrative Effekt prekärer Erwerbsarbeit, der ihre desintegrierenden Folgen gewissermaßen temporär einhegt, basiert im Wesentlichen darauf, dass diese Beschäftigungsform als einzig noch verbleibende Exit-Option aus der Arbeitslosigkeit wahrgenommen wird und die Hoffnung auf geschütztere Anschlussoptionen auf dem Arbeitsmarkt nährt, auch wenn diese im Einzelfall noch so vage und unbestimmt bleiben mag. Geradezu paradox wurzelt die Attraktivität prekärer Erwerbsarbeit in der Möglichkeit ihrer Überwindung. Mit anderen Worten kann prekäre Erwerbsarbeit nicht nur desintegrierend, sondern zugleich solange integrierend wirken, wenn die Erwartung, in dieser unsicheren Erwerbslage nur für eine überschaubare Zeit verharren zu müssen, nicht dauerhaft enttäuscht wird. Aufgrund der gegenwärtigen Arbeitsmarktprobleme ist gleichwohl davon auszugehen, dass die Hoffnung prekär Beschäftigter, in ein festes Arbeitsverhältnis übernommen zu werden, ganz erheblich mit dem Lebensalter, dem Qualifikationsniveau und dem beruflichen Erwartungshorizont korreliert. Insbesondere bei älteren Arbeitnehmern kann die auf eine unbestimmte Zukunft projizierte Hoffnung rasch der resignativen Gewissheit weichen, dass prekäre Beschäftigung keine vorübergehende Episode, sondern ein erzwungener Dauerzustand ist, der den Zugang zu einer qualifikationsadäquaten Dauerbeschäftigung mit „normalem“ sozialen Absicherungsniveau versperrt und dazu zwingt, ganze Lebenspläne zu korrigieren (kumulative Negativkarriere). Das spezifische Integrationsund Desintegrationspotential einer prekären Beschäftigung hängt also immer auch von der wahrgenommenen Wahrscheinlichkeit ab, die „Zone der Prekarität“ wieder verlassen und in die „Zone der Normalität“ hinüberwechseln zu können. Es ist allerdings davon auszugehen, dass die skizzierten Reintegrationspotentiale in der „Zone der Prekarität“ in dem Maße schwächer werden wie sich die Grenzen dieser Zone verfestigen und Übergänge in „Normalarbeit“ schwieriger werden. 13 4. Prekarisierungsängste und Wandel des Integrationsmodus Wenn man Prekarität in einem objektivistischen Sinne zu bestimmen versucht, dann sind die Unterschiede zwischen prekären und „normalen“ Erwerbslagen erheblich. Gleichwohl wäre es ein Fehlschluss, die „Zone der Prekarität“ und die „Zone der Normalität“ als eindeutig abgrenzbare Segmente der Arbeitsgesellschaft zu konzeptionalisieren. Es sind vielmehr fließende Übergänge und Abstufungen zwischen stabilen und instabilen Erwerbslagen in Rechnung zu stellen. Eine trennscharfe Unterscheidung von prekären und nicht-prekären Arbeitsverhältnissen wird zudem dadurch erschwert, dass instabile Erwerbslagen verunsichernd und disziplinierend auf geschützte Normarbeitsverhältnisse zurückwirken. Von einer disziplinierenden Wirkung prekärer Arbeit auf „regulär“ beschäftigte Stammbelegschaften kann insbesondere immer dann gesprochen werden, wenn eine vergleichsweise reibungsarme temporäre Integration von prekär Beschäftigten in betriebliche Arbeitsabläufe gelingt. So kann sich innerhalb der Stammbelegschaft ein diffuses Gefühl der Ersetzbarkeit ausbreiten, wenn beispielsweise befristet Beschäftigte (etwa Leih- und Zeitarbeiter, Kontingentarbeitnehmer aus Billiglohnländern) dieselben Arbeitstätigkeiten wie Festangestellte durchführen, ohne in der gleichen Lohngruppe eingruppiert zu werden oder im größeren Stile externe Arbeitskräfte als „Freelancer“ bzw. auf Werkvertragsbasis eingestellt werden, weil diese flexibler einsetzbar und leichter kündbar sind (vgl. Kraemer/Speidel 2004a; 2004b). Um derartige Rückwirkungen der „Zone der Prekarität“ auf die „Zone der Normalität“ in ihrer ganzen Tragweite erfassen zu können, ist in Abgrenzung zu einfachen Erklärungsmodellen der Prekarisierungsbegriff nicht nur als Unterschreitung spezifischer sozioökonomischer und rechtlicher Normalitätsstandards von Erwerbsarbeit zu bestimmen. Wenn man der Frage nachgeht, inwiefern die Verbreitung prekärer Beschäftigungsformen das gesellschaftliche Integrationspotential von Erwerbsarbeit insgesamt schwächt, dann müssen über die strukturellen sozioökonomischen oder arbeitsrechtlichen Benachteiligungen hinaus Prekarisierungsängste innerhalb der „Zone der Normalität“ analytisch einbezogen werden. Wie Bourdieu (1998) aufgezeigt hat, wird mit der Prekarisierung von Beschäftigungsverhältnissen ebenfalls in der „Zone der Normalität“ auf subtile Weise soziale Verunsicherung geschürt. Insofern ist Prekarisierung immer auch das Ergebnis einer relationalen Wahrnehmung von unterschiedlichen Beschäftigtengruppen innerhalb und außerhalb der „Zone der Prekarität“. Nur wenn man dies in Rechnung stellt, kann auch das wirklichkeitsmächtige Bedrohungspotential, die soziale Ausstrahlung von Prekarisierung auf bislang als vergleichsweise sicher geltende Segmente der Arbeitsgesellschaft problematisiert werden. Castels zonale Modell der postfordististischen Arbeitsgesellschaft ist mit einer gewissen Vorentscheidung verbunden. Es wird nämlich nahe gelegt, dass Beschäftigungsverhältnisse, die aufgrund ihrer formalen Struktur der „Zone der Prekarität“ zuzuordnen sind, soziale Desintegration verursachen oder doch zumindest verstärken können. 14 Und umgekehrt wird auf der begrifflichen Ebene unterstellt, dass in der „Zone der Normalität“ Erwerbstätige anzutreffen sind, die über Normarbeitsverhältnisse scheinbar problemlos in die Arbeitsgesellschaft integriert werden. Eine eindeutige Zuordnung von Integrations- und Desintegrationsprozessen zu unterschiedlichen Zonen erscheint allerdings gerade dann wenig sinnvoll zu sein, wenn die subjektiven Deutungsmuster unterschiedlicher Beschäftigtengruppen konzeptionell berücksichtigt werden. Wie bereits weiter oben dargelegt, sind in der „Zone der Prekarität“ – mit unterschiedlicher Gewichtung – nicht nur Desintegrationseffekte, sondern ebenso Integrationsprozesse anzutreffen. Mehr noch: (Des)Integrationsprozesse erzeugen nicht nur widersprüchliche, sondern mitunter geradezu paradoxe Effekte. Von einem Integrations-Desintegrationsparadoxon kann immer dann gesprochen werden, wenn ein und derselbe Prozess mit gegenläufigen Tendenzen innerhalb einer Zone (intrazonal) oder zwischen den Zonen (interzonal) der Arbeitsgesellschaft einher geht. Aufgrund der unsicheren Erwerbslage bemühen sich prekär Beschäftigte verstärkt um Reintegration in die „Zone der Normalität“ und just diese Bemühungen können zugleich desintegrierende Ängste vor einem erneuten Absturz in die Arbeitslosigkeit, vor dem Entzug mühsam erworbener symbolischer Anerkennung sowie vor dem erneuten Verzicht auf Teilhabechancen an der materiellen Kultur erzeugen. Die Integrationsanstrengungen von Beschäftigten in prekärer Erwerbslage korrespondieren also unmittelbar mit der Befürchtung, dass sich Desintegration wieder verstetigen könnte. Dies ist um so wahrscheinlicher, wenn die Bemühungen enttäuscht werden, den Sprung in geschützte Normarbeit schaffen zu können. In diesem Zusammenhang ist von besonderer Bedeutung, dass sowohl die Desintegrationserfahrungen von prekär Beschäftigten als auch die unterschwelligen, kaum ausgesprochenen Befürchtungen von Festangestellten innerhalb der „Zone der Normalität“, die eigene Beschäftigungssituation könne weitaus instabiler sein als bislang angenommen wurde, auf beide Gruppen disziplinierend und damit in problematischer Weise reintegrierend wirken können. Im Gegensatz zum fordistischen Integrationsmodell basiert dieser Integrationsmodus weniger auf einem Teilhabeversprechen an der ökonomischen Entwicklung als auf subtilen Ängsten, den Arbeitsplatz zu verlieren und sozial „abzurutschen“, wenn beispielsweise die Marktnachfrage wegbricht, die Renditeerwartungen der Anteilseigner enttäuscht werden, betriebliche Leistungskennziffern unterschritten werden, die Arbeitsproduktivität hinter den Vorgaben des Managements zurück bleibt, die allgemeine Lohnkostenstruktur gegenüber ausländischen Billiganbietern nicht mehr konkurrenzfähig ist, usw. Mit anderen Worten sind potentiell alle Beschäftigten der permanenten Drohung des Arbeitsplatzverlustes ausgesetzt. Dadurch wird, wie Bourdieu (1998: 99) hervorhebt, die Konkurrenz der Beschäftigten untereinander um knappe Erwerbstellen kontinuierlich angeheizt: „Die Konkurrenz um die Arbeit geht einher mit einer Konkurrenz bei der Arbeit, die jedoch im Grunde auch nur eine andere Form der Konkurrenz um die Arbeit ist, eine Arbeit, die man, mitunter um jeden Preis, gegen die Erpressung mit der angedrohten Entlassung bewahren muß.“ Unter diesen Bedingungen wird die arbeitsweltliche Integration 15 durch Unterordnung unter das „Marktregime“ (Dörre/Röttger 2003) erzwungen sowie durch die Bereitschaft hergestellt, zum Zwecke des Arbeitsplatzerhaltes notgedrungen auf kollektive soziale Errungenschaften zu verzichten. Insofern kann auch nicht pauschal eine schwindende Integrationskraft der Erwerbsarbeit unterstellt werden, wenn soziale Sicherheitsgarantien der Erwerbsarbeit abgebaut werden und Prekarisierungsängste um sich greifen. Paradoxerweise ist vielmehr vom Gegenteil auszugehen. In dem Maße, wie Erwerbsarbeit wieder enger an kurzfristige unternehmerische Marktrisiken gekoppelt wird und die Arbeitsmarktrisiken weiter individualisiert werden (Re-Kommodifizierung), scheint jedenfalls auch der arbeitsweltliche Integrationsmodus sukzessive umgestellt zu werden. Diese Umstellung des Integrationsmodus von Teilhabe auf Disziplinierung, Einschüchterung und Folgebereitschaft kann allerdings nur dann in den Blick genommen werden, wenn man sich von einem integrationstheoretischen Verständnis verabschiedet, das in einem stark normativen Sinne positive Integration und negative Desintegration gegenüber stellt (vgl. die kritischen Hinweise bei Heitmeyer 1997: 26f.) und den Zusammenhang von prekärer Erwerbsarbeit und (Des)Integration allzu schematisch interpretiert. Stets sind die gesellschaftlichen, ökonomischen und politischen Kontextbedingungen von Erwerbsarbeit aufzuhellen, wenn man danach fragen will, ob ein hoher arbeitsweltlicher Integrationsgrad breite Teilhabechancen und soziale Sicherheit signalisiert oder Ausdruck eines prekär gewordenen Beschäftigtenstatus ist. 5. Ausgrenzende Integrationsnorm Im Vorangegangenen ist dafür plädiert worden, die Prekarisierungsproblematik nicht nur auf eine nach objektiven Merkmalsbündelungen eindeutig definierbare Gruppe von „Prekarisierten“ zu beschränken, da sich Befürchtungen um die Sicherheit des eigenen Arbeitsplatzes weit über die „Zone der Prekarität“ hinaus ausgebreitet haben. Angesichts anhaltend hoher Massenarbeitslosigkeit, verschärfter Standortkonkurrenzen und internationalisierter Märkte („Globalisierung“) ist sogar davon auszugehen, dass inzwischen ganze Stammbelegschaften in der „Zone der Integration“ ihre Erwerbslage als latent gefährdet wahrnehmen und insofern auch von Prekarisierungsängsten erfasst werden. Diese interzonale Diffusion von Prekarisierungsängsten und sozialen Verunsicherungen lässt den für den „rheinischen Kapitalismus“ archetypischen arbeitsweltlichen Integrationsmodus verblassen, der bislang allen Erwerbstätigen ein bestimmtes Maß an Stabilität, Sicherheit und Teilhabechancen zubilligte. An dessen Stelle schiebt sich sukzessive ein Modus, der Integration durch die implizite Drohung des Arbeitsplatzverlustes erzwingt und von der Maxime geleitet wird, dass jede, selbst schlecht bezahlte und sozial ungeschützte Arbeit, die kein individuelles Auskommen ermöglicht, besser ist als überhaupt keine Arbeit. Diese Transformation des arbeitsweltlichen Integrationsmodus kann, so lautet die abschließende These, unter spezifischen Bedingungen Neigungen bzw. Dispositionen zu Überanpassung 16 und ausgrenzenden Integrationsvorstellungen begünstigen. Mit ethnischen oder nationalistischen Konstruktionen verknüpft, können diese Vorstellungen sogar zu scharfer Ausgrenzung gegenüber Bevölkerungsgruppen führen, die solch einseitig definierten Integrationsnormen nicht entsprechen. Abschließend ist diese ausgrenzende Integrationsnorm kurz zu charakterisieren. Unbestritten ist, dass die skizzierten arbeitsweltlichen Prekarisierungstendenzen und (Des-)Integrationserfahrungen nicht geradlinig spezifische politische Verarbeitungsformen bedingen. Deswegen wäre es beispielsweise auch abwegig, Affinitäten oder Übergänge zu rechtspopulistischen Orientierungen als kausale Entsprechung zum wahrgenommenen Ausmaß sozialer Desintegration zu begreifen. Organisationen und Akteure der Arbeitswelt wirken lediglich als Instanzen einer sekundären politischen Sozialisation, die überhaupt erst mit dem Eintritt in das Erwerbsleben virulent werden können. Im Sinne eines MehrebenenAnalysemodells sind zudem weitere einstellungsrelevante Erklärungsfaktoren außerhalb der Arbeitswelt wie allgemeine Sozialisationsbedingungen, Generations- und Kohorteneffekte, soziales Klima und individuelles Kompetenzprofil, Rezeptionsroutinen politischer Ideologien und mediale Thematisierungszyklen zu berücksichtigen (vgl. ausführlicher Anhut/Heitmeyer 2000: 53ff.). Arbeitsweltliche Prekarisierungs- und (Des-)Integrationserfahrungen liefern lediglich den Problemrohstoff, der in höchst unterschiedlichen politischen Orientierungen aufgegriffen und bearbeitet werden. Ganz in diesem Sinne wäre es ein deterministischer Kurzschluss, davon auszugehen, dass die Erosion der sozialen Bindekraft sozialstaatlich regulierter Normarbeitsverhältnisse mehr oder weniger zwangsläufig zu einer stetigen Kumulation von Desintegrationsprozessen führen muss. Wie weiter oben ausgeführt worden ist, können die im Verlauf einer prekären Beschäftigungskarriere gemachten Desintegrationserfahrungen auch einen entgegengesetzten Effekt haben und die eigenen Reintegrationsbemühungen verstärken. So unternehmen gerade Beschäftigte, die ihre Erwerbslage als prekär bewerten und die Rückkehr in die „Zone der Integration“ anstreben, im jeweiligen Betrieb vielfältige Anstrengungen, um leistungsbezogene Erwartungshaltungen nicht zu enttäuschen und sich geräuschlos in den Produktionsalltag einzufügen. Die Bereitschaft zur distanzlosen Anpassung an Strukturen, Normen und Verhaltensanforderungen innerhalb der Arbeitswelt dient letztlich dem alles überragenden Zweck, der Prekarisierung entfliehen zu können und die Chancen auf Übernahme in ein festes Arbeitsverhältnis zu wahren. Unter den Bedingungen einer verschärften Konkurrenz um knappe Erwerbsstellen erscheint zuweilen die angestrebte Reintegration überhaupt nur noch bei vorbehaltloser Unterordnung unter das betriebliche Arbeitsregime denkbar zu sein. In eine ähnliche Richtung wirken übrigens auch die gegenüber Stammbelegschaften ausgesprochenen Drohungen von Unternehmensleitungen, Lohnleistungen zu kürzen, Produktionsstandorte zu schließen und in Billiglohnländer zu verlagern. Selbst wenn im Einzelfall unklar bleibt, ob die angekündigten Drohungen glaubwürdig und durchsetzungsfähig sind, so wirken sie insofern einschüchternd, da 17 Ungewissheit oktroyiert wird. Angst ist ein verbreiteter Ausdruck dieser Ungewissheit. Entscheidend ist in diesem Zusammenhang, dass die disziplinierende Wirkung dieser Ungewissheit alle Beschäftigtengruppen selbst dann erfasst, wenn Drohkulissen des Managements nur selektiv aufgebaut, die Drohungen durch Zugeständnisse entschärft werden oder nur wenige Beschäftigte vom tatsächlichen Vollzug der angedrohten Konsequenzen betroffen sind.4 In dem Maße, in dem unter den Beschäftigten die Ungewissheit um die Sicherheit des eigenen Arbeitsplatzes um sich greift, wird betriebliche Verhaltenskonformität begünstigt. Diese kann unterschiedliche Formen annehmen und von bloßer Regeltreue bis zu Unterwürfigkeit und vorauseilendem Gehorsam reichen. Sie dient dem übergeordneten Zweck, die eigene arbeitsweltliche Integration nicht zu gefährden. Unter noch genauer zu eruierenden Bedingungen scheint dieses Streben nach Anpassung und Integration innerhalb der Arbeitswelt (Arbeitsbewusstsein) als normative Referenzfolie zu fungieren, um gesellschaftliche Probleme (politisches Bewusstsein) zu bewerten. Was man von sich selbst erwartet, d.h. in diesem Falle die Bereitschaft, sich anzupassen und einzufügen, das erwartet man auch von Dritten. Mit anderen Worten kann die durch Ungewissheit und Einschüchterung erzwungene betriebliche Verhaltenskonformität mit einer Integrationsnorm einhergehen, deren Geltung nicht nur auf das betriebliche Feld beschränkt bleibt, sondern sozial generalisiert und als legitimer Maßstab zur Bewertung der sozialen Welt herangezogen wird. Bemerkenswerterweise muss diese Integrationsnorm selbst dann nicht an Attraktivität einbüßen, wenn die eigene Leistungsbereitschaft im Unternehmen nicht honoriert wird, unverschuldet Entlassungen drohen oder elementare Prinzipien einer Leistungsgerechtigkeit durch Managemententscheidungen missachtet werden. In diesem Falle kann das eigene Integrationsverständnis sogar umso vehementer gegenüber ethnischen Minderheiten und anderen outgroups eingeklagt werden. Dieser Integrationsnorm folgend bemisst sich die Legitimität von Ansprüchen an ökonomischer und gesellschaftlicher Teilhabe daran, ob ein sichtbarer Leistungsbeitrag für die Gesellschaft erbracht wird. Folge dieser Normgeneralisierung ist, dass all jene Individuen oder Bevölkerungsgruppen sozialmoralisch stigmatisiert und aus der Gemeinschaft der Leistungsfähigen symbolisch ausgegrenzt werden, die dieser Norm nicht entsprechen. In ständig wiederkehrenden Deutungsmustern wird vor allem ethnischen Minderheiten und anderen sog. Randgruppen Leistungsverweigerung und eine illegitime Vorteilserschleichung auf Kosten der nationalen Gemeinschaft der Leistungswilligen vorgeworfen. Ihnen wird pauschal unterstellt, dass sie „nichts leisten“, „nichts auf sich nehmen“, nur „die Hand aufhalten“, „Ansprüche stellen“ und trotzdem immer wieder von den sozialen 4 Wie bereits Popitz in der allgemeinen Abhandlung Phänomene der Macht (1992: 79ff.) aufgezeigt hat, liegt die Besonderheit einer Drohung in ihrer „Dehnbarkeit“ begründet. Der Begriff Dehnbarkeit spielt u.a. auf die Macht der Drohung an, eine „unbestimmte Besorgnis der Angst“ (1992: 85) unter den Adressaten der Drohung zu schüren. Zur Interaktionsmacht der Drohung und ihrer durchaus ambivalenten Folgewirkungen vgl. den grundlegenden Beitrag von Paris/Sofsky (1987). 18 Sicherungssystemen „aufgefangen“ werden. Vor allem wird eine mangelnde Anpassungsbereitschaft von ethnischen Minderheiten an die Mehrheitskultur der Autochthonen, ihres Wertesystems und ihrer symbolischen Praktiken beklagt. In dieser Perspektive erscheint Integration als einseitige Bringschuld der zu Integrierenden. Eine reziproke Anerkennung kultureller Differenzen wird zurück gewiesen und die Integration von Ausländern allenfalls unter den Bedingungen einer geräuschlos vonstatten gehenden Assimilierung akzeptiert. Desintegrationserfahrungen innerhalb der Arbeitswelt können rechtspopulistische Ausgrenzungen und fremdenfeindliche Ressentiments begünstigen. Das soeben skizzierte „überintegrierte“ Einstellungsmuster kann allerdings nicht einfach als maßstabsgetreuer Ausdruck sozialer Desintegrationsprozesse interpretiert werden. Entgegen den Modellannahmen der Desintegrationshypothese muss paradoxerweise auch vom Gegenteil ausgegangen werden. Ausgrenzende Deutungsmuster und fremdenfeindliche Ressentiments können auch als Folge einer spezifischen Integrationsvorstellung gedeutet werden, die im Verlauf des Erwerbslebens durch arbeitsweltliche Anpassungsleistungen an reale oder vermeintliche äußere Zwänge genährt worden ist und als normative Referenzfolie herangezogen wird, um wahrgenommene Problemlagen innerhalb und außerhalb der Arbeitswelt zu beurteilen. Hieran schließen sich weitere Forschungsfragen an, die bislang ungeklärt sind. So wäre etwa genauer zu problematisieren, auf welchen Wertorientierungen diese Überintegration im Einzelnen basiert, durch welche spezifischen Arbeitserfahrungen diese Wertorientierungen begünstigt werden können, welche Bedeutung marktzentrierten Kontrollstrategien und Leistungsnormen bei der Stabilisierung dieser Wertorientierungen zukommt, wie sich der Typus der ausgrenzenden Integrationsnorm zum Deutungsmuster des „reaktiven Nationalismus“ (Dörre 2001) verhält und welche arbeitspolitischen Strategien denkbar sind, um die im „überintegrierten“ Typus angelegten Ausgrenzungseffekte einzudämmen. Literatur: Anhut, R. / Heitmeyer, W. (2000), Desintegration, Konflikt und Ethnisierung. Eine Problemanalyse und theoretische Rahmenkonzeption. In: Heitmeyer, W. / Anhut, R. (Hg.), Bedrohte Stadtgesellschaft. Soziale Desintegrationsprozesse und ethnisch-kulturelle Konfliktkonstellationen, Weinheim, 17-75 Beck, U. (1999), Schöne neue Arbeitswelt. Vision: Weltbürgergesellschaft, Frankfurt/M. Beck, U. (2000a), Wohin führt der Weg, der mit dem Ende der Vollbeschäftigungsgesellschaft beginnt? In: Ders. (Hg.): Die Zukunft von Arbeit und Demokratie, Frankfurt/M., 7-66. Beck, U. (2000b), Die Seele der Demokratie: Bezahlte Bürgerarbeit. In: Ders. (Hg.), Die Zukunft von Arbeit und Demokratie, Frankfurt/M., 416-447. Bourdieu, P. (1998), Prekarität ist überall. In: Ders., Gegenfeuer, Konstanz, 96-102. 19 Brinkmann, U. (2003), Die Verschiebung von Marktgrenzen und die kalte Entmachtung der WissensarbeiterInnen. In: Schönberger, K. / Springer S. (Hg.), Subjektivierte Arbeit: Mensch – Technik – Organisation in einer entgrenzten Arbeitswelt, Frankfurt/M., 63-94. Brock, D. (1993), Wiederkehr der Klassen? Über Mechanismen der Integration und der Ausgrenzung in entwickelten Industriegesellschaften. In: Soziale Welt, Jg. 44, 177-198. Castel, R. (2000), Metamorphosen der sozialen Frage. Konstanz. Castel, R. (2001), Überlegungen zum Stand der sozialen Frage heute: Aushöhlung, Zusammenbruch oder Reorganisation der sozial abgesicherten Erwerbsarbeit. In: Mitteilungen des Instituts für Sozialforschung, September, Heft 12, Frankfurt/M., 81 - 119. Dahrendorf, R. (1992), Der moderne soziale Konflikt. Essay zur Politik der Freiheit, Stuttgart. Dörre, K. (2001), Reaktiver Nationalismus in der Arbeitswelt. Rechtsextremismus – Ursachen und Thesen. In: Widerspruch, H. 41, Zürich, 87-102. Dörre, K. (2003), Zwischen Freisetzung und Prekarisierung. Arbeitspolitik im flexiblen Kapitalismus. In: Jahrbuch für Kritische Medizin, H. 39, 10-30. Dörre, K. / Anders, R.-E. / Speidel, F. (1997), Globalisierung als Option. Internationalisierungspfade von Unternehmen, Standortpolitik und industrielle Beziehungen. In: SOFI-Mitteilungen Nr. 25, Göttingen, 43-70. Dörre, K. / Röttger, B. (Hg.) (2003), Das neue Marktregime, Hamburg. Franzpötter, R. (2003), Die Disponiblen und die Überflüssigen. Über die abgedunkelte kehrseite der Employabilitygesellschaft. In: Arbeit, Jg. 12, 131-146. Fraser, N. / Honneth, A. (2003), Umverteilung oder Anerkennung? Eine politisch-philosophische Kontroverse, Frankfurt/M. Friedrichs, J. / Jagodziniski, W. (Hg.) (1999), Soziale Integration. Sonderheft 39 der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Opladen/Wiesbaden. Fuchs, T. / Conrads, R. (2003), Analyse der Arbeitsbedingungen, -belastungen und Beschwerden von abhängig Beschäftigten unter besonderer Berücksichtigung von flexiblen Arbeitsformen (Forschungsbericht an die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin). o.O. Giddens, A. (1988), Die Konstitution der Gesellschaft. Grundzüge einer Theorie der Strukturierung. Mit einem Einführung von Hans Joas, Frankfurt/M. Giesecke, J. / Groß, J. (2002), Befristete Beschäftigung: Chance oder Risiko? In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Jg. 54, 85-108. Heitmeyer, W. (1997), Einleitung: Sind individualisierte und ethnisch-kulturell vielfältige Gesellschaften noch integrierbar? In: Ders. (Hg.), Was hält die Gesellschaft zusammen? Frankfurt/M., 23-65. Holst, E. / Schupp, J. (1995), Erwerbsbeteiligung von Frauen in West- und Ostdeutschland. In: Glatzer, W. / Noll, H.-H. (Hg.), Getrennt vereint. Lebensverhältnisse in Deutschland seit der Wiedervereinigung, Frankfurt/M. 51-70. Jahn E. / Rudolph, H. (2002a), Zeitarbeit Teil I: Auch für Arbeitslose ein Weg mit Perspektive. In: IABKurzbericht Nr. 20, 1-7. Jahn E. / Rudolph, H. (2002b), Zeitarbeit Teil II: Völlig frei bis streng reguliert. Variantenvielfalt in Europa. In: IAB-Kurzbericht 21, 1-7. Kim, A. / Kurz, K. (2003), Prekäre Beschäftigung im Vereinigten Königreich und Deutschland. Welche Rolle spielen unterschiedliche institutionelle Kontexte? In: Müller, W. / Scherer S. (Hg.), Mehr Risiken – Mehr Ungleichheit? Abbau von Wohlfahrtsstaat, Flexibilisierung von Arbeit und ihre Folgen, Frankfurt/M., 167-192. Kocka, J. / Offe, C. (2000), Einleitung. In: Dies. (Hg.), Geschichte und Zukunft der Arbeit., Frankfurt/M., 9-15. Kreckel, R. (1992), Politische Soziologie der sozialen Ungleichheit, Frankfurt/M. Kraemer, K. (2001), Kapitalistische Gesellschaft. In: Kneer, G. / Nassehi, A. / Schroer, M. (Hg.), Soziologische Gesellschaftsbegriffe II, Klassische Zeitdiagnosen, München, 111-138. Kraemer, K. (2002), Konsum als Teilhabe an der materiellen Kultur. In: Scherhorn, G. / Weber, C. (Hg.), Nachhaltiger Konsum. Auf dem Weg zur gesellschaftlichen Verankerung, München, 55-62. 20 Kraemer, K. / Speidel, F. (2004a), (Des-)Integrationseffekte typischer und atypischer Erwerbsarbeit. In: Jahrbuch Arbeit, Bildung, Kultur, hrsg. vom Forschungsinstitut Arbeit Bildung Partizipation, Recklinghausen. Kraemer, K. / Speidel, F. (2004b), Prekäre Leiharbeit. Zur Integrationsproblematik einer atypischen Beschäftigungsform. In: Vogel, B. (Hg.), Leiharbeit. Sozialwissenschaftliche Befunde zu einer prekären Beschäftigungsform, Hamburg (Im Erscheinen). Kronauer, M. (2002), Exklusion. Die Gefährdung des Sozialen im hoch entwickelten Kapitalismus, Frankfurt/M. Kronauer, M. / Vogel, B. / Gerlach F. (1993), Im Schatten der Arbeitsgesellschaft. Arbeitsslose und die Dynamik sozialer Ausgrenzung, Frankfurt/M. Lessenich, S. (2003), Der Arme in der Aktivgesellschaft – zum sozialen Sinn des “Förderns und Forderns”. In: WSI Mitteilungen, H 4, 214-220. Letourneux, V. (1998), Precarious Employment and Working Conditions in Europe, Dublin. Matthes, J. (Hg.) (1983), Krise der Arbeitsgesellschaft? Verhandlungen des 21. Deutschen Soziologentages, Frankfurt/M. 1983. Mauss, M. (1990), Die Gabe. Form und Funktion des Austausches in archaischen Gesellschaften. Mit einem Vorwort von E.E. Evans-Prichard, Frankfurt/M. Mayer-Ahuja, N. (2003), Wieder prekärer Beschäftigung seit 1973, Berlin. dienen lernen? Von westdeutschen 'Normalarbeitsverhältnis' zu Mückenberger, U. (1985), Die Krise des Normalarbeitsverhältnisses. Hat das Arbeitsrecht noch Zukunft? In: Zeitschrift für Sozialreform, H. 7/8, 415-434, 457-475. Müller, W. (1998), Erwartete und unerwartete Folgen der Bildungsexpansion. In: Friederichs, J. / Lepsius, M.R. / Mayer, K. U. (Hg.), Die Diagnosefähigkeit der Soziologie. Sonderheft 38 der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Opladen, 81-112. Noller, B. (2003), Gefährdungsbewusstsein: Erfahrungen und Verarbeitungsformen beruflich-sozialer Gefährdung in Leiharbeit und befristeter Beschäftigung. In: Linne, G. / Vogel, B. (Hg.), Leiharbeit und befristete Beschäftigung. Neue Formen sozialer Gefährdung oder Chance auf Arbeitsmarktintegration? Arbeitspapier 68 der Hans-Böckler-Stiftung, Düsseldorf, 47-56. Paris, R. / Sofsky, W. (1987), Drohungen. Über eine Methode der Interaktionsmacht. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 39. Jg., 15-39. Peters, B. (1993), Die Integration moderner Gesellschaften, Frankfurt/M. Pietrzyk, U. (2003), Flexible Beschäftigungsform „Zeitarbeit“ auf dem Prüfstand. In: Arbeit, Jg. 12, 112-130. Popitz, H. (1992), Phänomene der Macht, 2. stark erw. Aufl., Tübingen. Rudolph, H. (2003), Befristete Arbeitsverträge und Zeitarbeit. Quantitäten und Strukturen „prekärer Beschäftigungsformen“. In: Linne, G. / Vogel, B. (Hg.), Leiharbeit und befristete Beschäftigung. Neue Formen sozialer Gefährdung oder Chance auf Arbeitsmarktintegration? Arbeitspapier 68 der Hans-Böckler-Stiftung, Düsseldorf, 9-26. Schulze, G. (1992), Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart, Frankfurt/M. Sennett, R. (1998), Der flexible Mensch. Die Kultur des neuen Kapitalismus, Berlin. Sennett, R. (2000), Arbeit und soziale Inklusion. In: Kocka, J. / Offe, C. (Hg.), Geschichte und Zukunft der Arbeit., Frankfurt/M., 431-446. Simmel, G. (1989), Philosophie des Geldes, Frankfurt/M. Vogel, B. (2001), Überflüssige in der Überflussgesellschaft? Sechs Anmerkungen zur Empirie sozialer Ausgrenzung. In: Mittelweg, H. 36, 57-62 Vogel, B. (2003), Leiharbeit und befristete Beschäftigung – Neue Formen sozialer Gefährdung oder Chance auf Arbeitsmarktintegration. In: Linne, G. / Vogel, B. (Hg.): Leiharbeit und befristete Beschäftigung. Neue Formen sozialer Gefährdung oder Chance auf Arbeitsmarktintegration? Arbeitspapier 68 der Hans-Böckler-Stiftung, Düsseldorf, 39 - 46. Voswinkel, S. (2001), Anerkennung und Reputation. Die Dramaturgie industrieller Beziehungen, Konstanz. 21 Voß, G. G. (1993), Der Strukturwandel der Arbeitswelt und die alltägliche Lebensführung. In: Jurczyk, K. / Rerrich, M. S. (Hg.), Die Arbeit des Alltags. Beiträge zu einer Soziologie der alltäglichen Lebensführung, Freiburg i. B., 70-111. Dr. Klaus Kraemer / Frederic Speidel FIAB - Forschungsinstitut Arbeit Bildung Partizipation Institut an der Ruhr-Universität Bochum Münsterstr. 13-15 D - 45657 Recklinghausen Tel. +49 (0) 2361.904 48-24 Fax +49 (0) 2361.183 36 2 [email protected] www.ruhr-uni-bochum.de/fiab/ 22