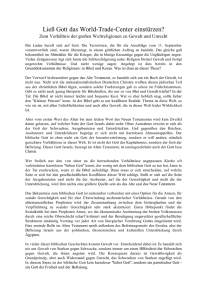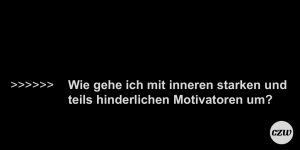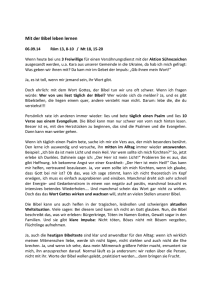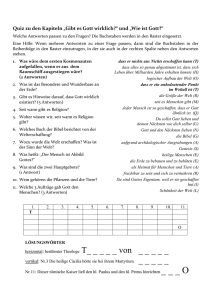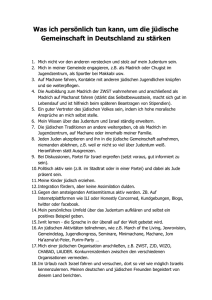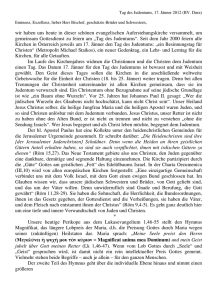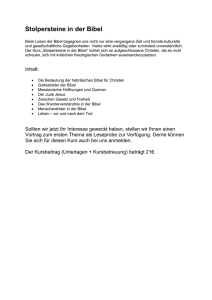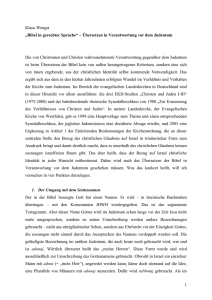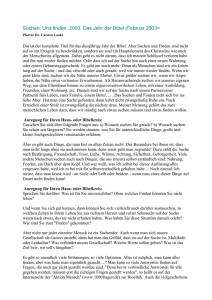Verheißung und Erfüllung? - Evangelischen Forums Westfalen
Werbung
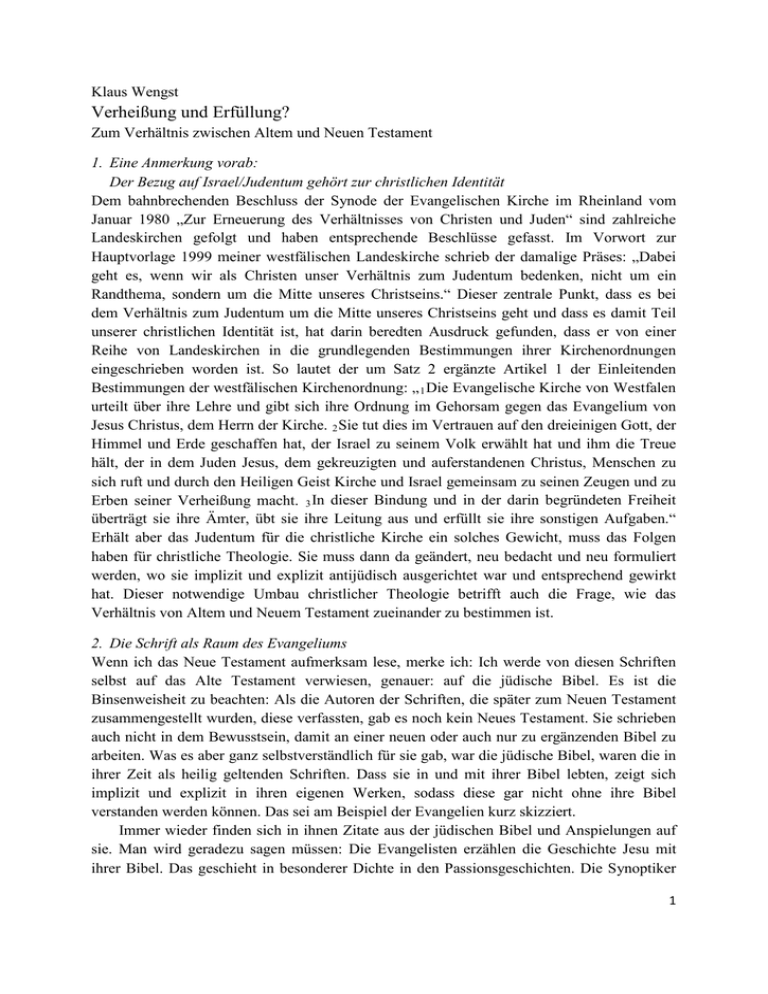
Klaus Wengst Verheißung und Erfüllung? Zum Verhältnis zwischen Altem und Neuen Testament 1. Eine Anmerkung vorab: Der Bezug auf Israel/Judentum gehört zur christlichen Identität Dem bahnbrechenden Beschluss der Synode der Evangelischen Kirche im Rheinland vom Januar 1980 „Zur Erneuerung des Verhältnisses von Christen und Juden“ sind zahlreiche Landeskirchen gefolgt und haben entsprechende Beschlüsse gefasst. Im Vorwort zur Hauptvorlage 1999 meiner westfälischen Landeskirche schrieb der damalige Präses: „Dabei geht es, wenn wir als Christen unser Verhältnis zum Judentum bedenken, nicht um ein Randthema, sondern um die Mitte unseres Christseins.“ Dieser zentrale Punkt, dass es bei dem Verhältnis zum Judentum um die Mitte unseres Christseins geht und dass es damit Teil unserer christlichen Identität ist, hat darin beredten Ausdruck gefunden, dass er von einer Reihe von Landeskirchen in die grundlegenden Bestimmungen ihrer Kirchenordnungen eingeschrieben worden ist. So lautet der um Satz 2 ergänzte Artikel 1 der Einleitenden Bestimmungen der westfälischen Kirchenordnung: „ 1 Die Evangelische Kirche von Westfalen urteilt über ihre Lehre und gibt sich ihre Ordnung im Gehorsam gegen das Evangelium von Jesus Christus, dem Herrn der Kirche. 2 Sie tut dies im Vertrauen auf den dreieinigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der Israel zu seinem Volk erwählt hat und ihm die Treue hält, der in dem Juden Jesus, dem gekreuzigten und auferstandenen Christus, Menschen zu sich ruft und durch den Heiligen Geist Kirche und Israel gemeinsam zu seinen Zeugen und zu Erben seiner Verheißung macht. 3 In dieser Bindung und in der darin begründeten Freiheit überträgt sie ihre Ämter, übt sie ihre Leitung aus und erfüllt sie ihre sonstigen Aufgaben.“ Erhält aber das Judentum für die christliche Kirche ein solches Gewicht, muss das Folgen haben für christliche Theologie. Sie muss dann da geändert, neu bedacht und neu formuliert werden, wo sie implizit und explizit antijüdisch ausgerichtet war und entsprechend gewirkt hat. Dieser notwendige Umbau christlicher Theologie betrifft auch die Frage, wie das Verhältnis von Altem und Neuem Testament zueinander zu bestimmen ist. 2. Die Schrift als Raum des Evangeliums Wenn ich das Neue Testament aufmerksam lese, merke ich: Ich werde von diesen Schriften selbst auf das Alte Testament verwiesen, genauer: auf die jüdische Bibel. Es ist die Binsenweisheit zu beachten: Als die Autoren der Schriften, die später zum Neuen Testament zusammengestellt wurden, diese verfassten, gab es noch kein Neues Testament. Sie schrieben auch nicht in dem Bewusstsein, damit an einer neuen oder auch nur zu ergänzenden Bibel zu arbeiten. Was es aber ganz selbstverständlich für sie gab, war die jüdische Bibel, waren die in ihrer Zeit als heilig geltenden Schriften. Dass sie in und mit ihrer Bibel lebten, zeigt sich implizit und explizit in ihren eigenen Werken, sodass diese gar nicht ohne ihre Bibel verstanden werden können. Das sei am Beispiel der Evangelien kurz skizziert. Immer wieder finden sich in ihnen Zitate aus der jüdischen Bibel und Anspielungen auf sie. Man wird geradezu sagen müssen: Die Evangelisten erzählen die Geschichte Jesu mit ihrer Bibel. Das geschieht in besonderer Dichte in den Passionsgeschichten. Die Synoptiker 1 tun es mit Anspielungen, Halbzitaten und ganzen Zitaten, ohne sie als solche kenntlich zu machen, das Johannesevangelium führt darüber hinaus ausdrücklich gekennzeichnete Zitate an. Es ist vorauszusetzen, dass die Evangelisten wussten, was sie taten, dass also ihr Erzählen mit der Bibel ein bewusst eingesetztes Mittel literarischer Gestaltung ist, das einer theologischen Intention dient. Weiter ist vorauszusetzen, dass auch die intendierte Leser- und Hörerschaft – die Evangelien sind von vornherein als Lesetexte für die versammelte Gemeinde geschrieben worden – diese Bezüge erkannte und ihr dabei die eingespielten biblischen Kontexte vor Augen standen. Denn jüdisches Zitieren ist – in aller Regel – ein Anzitieren, das erwartet, dass die Lesenden und Hörenden den Text fortsetzen können. In diesem Erzählen mit der Bibel wird Gott ins Spiel gebracht, wird Gott in dieses schlimme Geschehen von Jesu Festnahme, Folterung und Hinrichtung hineingezogen, Gott, der ein Gott des Lebens ist und deshalb Leiden und Tod Jesu nicht das Letzte sein lassen wird, von dem erzählt werden kann. Gegenüber den geschichtlich mit tödlicher Gewalt handelnden Subjekten wird hier behauptet, dass ein ganz anderer das entscheidende Subjekt sei, das seine Finger im Spiel habe und dem schlimmen Geschehen eine andere Wendung gebe. Wohlgemerkt: Es geht dabei nicht um das Schreiben eines Drehbuchs für eine vom Himmel gesteuerte Inszenierung; das wäre einfach nur schrecklich. Die Evangelisten schreiben im Nachhinein der geschehenen Hinrichtung Jesu. Ihnen geht es darum, der hier erfolgten faktischen Gewalt nicht den Triumph der End- und Letztgültigkeit zu lassen. Noch einmal anders gesagt: Ihr Schreiben mit der Bibel ist nicht himmlische Legitimierung schlimmen Geschehens, sondern im Gegenteil Protest gegen es. Als ein Beispiel sei das letzte Wort Jesu am Kreuz nach Mk 15,34 angeführt. Dort heißt es: „Und in der neunten Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme.“ Was Jesus schrie, gibt Markus in griechischer Transkription auf Aramäisch wieder: eloí, eloí, lemá sabachtháni. Das ist auch der Wortlaut des aramäischen Targums von Ps 22,2a, das dem hebräischen Text wörtlich entspricht: „Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen?“ Die von Markus gegebene griechische Übersetzung folgt exakt seinem aramäischen Zitat und nicht der Septuaginta, die gegenüber dem hebräischen Text eine leichte und eine kräftige Abweichung hat. Nach dieser Darstellung sagt Jesus also den Beginn von Ps 22. Ich hatte schon vermerkt, dass im Judentum das Zitieren als Anzitieren erfolgt. Der Kontext des Zitats wird vom Zitierenden bei seiner Leser- und Hörerschaft als präsent vorausgesetzt. Jede Leserin, jeder Hörer des Markusevangeliums weiß – oder kann es wissen –, dass Ps 22,2a der Beginn eines Gebets des leidenden Gerechten ist: „Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen? Fern von jeder Hilfe verhallt mein Schreien. Mein Gott, ich rufe am Tag, aber Du antwortest nicht, in der Nacht, aber ich finde keine Ruhe“ (V. 2f.). Der Beter blickt im weiteren Text zurück auf Gottes rettende Hilfe in der Geschichte seines Volkes, kontrastiert das mit der eigenen Not; Vertrauensaussagen wechseln mit bitterer Klage. „Ich kann alle meine Knochen zählen. Sie schauen zu und taxieren mich. Sie teilen meine Kleider unter sich, um mein Gewand werfen sie das Los“ (V. 18f.). Es folgt eine dringliche Bitte um Rettung – und dann die Wende: „Du gibst mir Antwort“ (V. 22b). Daran schließt sich sofort der Lobpreis an: „Ich will meinen Brüdern und Schwestern von Deinem Namen erzählen, inmitten der Gemeinde will ich Dich preisen“ (V. 23). Für das Bewusstsein einer in biblischer Tradition lebenden Leser- und Hörerschaft – und das waren die Gemeinden, für die die Evangelien geschrieben wurden – macht sich Jesus mit dem 2 Verlassenheitsruf am Beginn von Ps 22 dieses Gebet zu eigen. Sie weiß, wie es weitergeht und zu welchem Ziel es führt. Mit dem Zitat des Anfangs ist das Ganze gegeben. Die Einspielung von Ps 22,2a an dieser dramatischsten Stelle in der Erzählung des Evangeliums bringt einmal mehr und betont Gott ins Spiel und reißt die Dimension der Hoffnung auf sein rettendes Handeln auf. Dementsprechend beenden die Evangelien ihre Erzählung nicht mit einem Satz, wie er am Schluss des Jesusbuches von David Flusser steht: „Schließlich schrie Jesus laut und starb“ (Jesus, S. 140). Da Jesus tatsächlich gestorben ist, können sie nicht von Rettung vor dem Tod erzählen. Sie müssen und können sozusagen noch eins draufsetzen und bezeugen seine Rettung aus dem Tod. Im Lukasevangelium leistet dasselbe – gewiss in anderer Tönung – der Bezug auf Ps 31,6 in Lk 23,46: „Deinen Händen vertraue ich meinen Lebensatem an.“ Historisch verwertbar ist hier nichts. Was Jesus tatsächlich am Kreuz historisch getan hat, ob er nach Lukas Ps 31,6 gebetet hat oder ob nach Markus Ps 22,2 und – wenn letzteres zuträfe – ob er nur den Verlassenheitsschrei ausgestoßen oder den Psalm weiter bis zum Ende gebetet hat oder ob es noch einmal ganz anders war, weiß niemand von uns und kann niemand wissen. Es sind müßige Fragen; wir brauchen es auch nicht zu wissen. Wir haben die Erzählungen der Evangelien; auf die ist jeweils zu hören. Das bloße historische Faktum, dass Jesus an einem römischen Kreuz hingerichtet worden ist, wird von den Evangelisten vorausgesetzt und ja auch berichtet. Aber an allen weiteren historischen Details sind sie nicht interessiert. Sie interessiert, was Gott mit diesem Faktum zu tun hat, dass und wie er in ihm und gegen es zum Zuge kommt. Dafür erzählen sie mit ihrer Bibel. Dafür führen Markus und Matthäus als letztes Wort Jesu vor seinem Tod Ps 22,2 an und Lukas Ps 31,6. 3. Das Alte Testament als Vor-Gabe: Wer unser Gott ist Aufgrund des im vorigen Abschnitt Ausgeführten ist der immer wieder begegnende isolierte Gebrauch des Neuen Testaments ein Missbrauch, ein Unding; er entspricht nicht dem Usus der Kirche. Die letzte von Luther zu seinen Lebzeiten herausgegebene deutsche Bibel hat den Titel: „Biblia: Das ist: die gantze Heilige Schrift“. Vom 17. Jahrhundert bis einschließlich der Revision von 1912 lautete er: „Die ganze heilige Schrift Alten und Neuen Testaments“. Seit 1984 heißt es nur noch: „Die Bibel“. Dass die jüdische Bibel erster Teil der christlichen Bibel ist, darüber wurde in der Geschichte der Kirche nie entschieden oder gar abgestimmt. Das war selbstverständliche Voraussetzung, in jedem Sinn des Wortes Vor-Gabe. Wer das in Frage stellte, wie schon in der Mitte des 2. Jahrhunderts Markion, wurde aus der Kirche ausgeschlossen. Entsprechend war es kein Zufall, dass die Kraft der „Deutschen Christen“ nach der Sportpalastrede von Reinhold Krause im November 1933 gebrochen war, in der die radikale Ablehnung des Alten Testaments deutlich wurde. Mit der selbstverständlichen VorGabe der jüdischen Bibel als dem Alten Testament der Kirche war aber von vornherein über die in meinen Augen wichtigste theologische Frage entschieden, wer nämlich für die Kirche Gott ist: der in dieser Bibel bezeugte Gott, der gewiss als Schöpfer der Gott aller Welt ist, aber kein Allerweltsgott, sondern Israels Gott, dem es gefallen hat und weiter gefällt, mit diesem Volk seine besondere Bundesgeschichte zu haben. Dafür brauchen Christinnen und Christen das Alte Testament: um zu wissen, wer Gott ist. Um mit Blaise Pascal zu sprechen: „Der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, und nicht der Gott der Philosophen.“ 3 Das unterscheidet ja biblisches Reden von Gott vom philosophischen, dass es zwar selbstverständlich den einen Gott auf die ganze Wirklichkeit bezieht, ihn aber mit bestimmter, dazu noch höchst partikularer Geschichte in unlösbaren Zusammenhang bringt, im Alten Testament mit der Geschichte des Volkes Israel, im Neuen noch einmal zugespitzt mit der Geschichte eines Menschen aus Israel, dem Juden Jesus aus Nazaret. Dass der in der Bibel bezeugte Gott Israels Gott ist und bleibt, ist in der Geschichte der Kirche weithin vergessen und verdrängt worden – vor allem dadurch, dass die Kirche den Begriff „Israel“ für sich selbst usurpierte und sich als das „wahre Israel“ behauptete. In dieser Perspektive wurde das außerhalb der Kirche weiter existierende Judentum zum „falschen“ Israel, das es eigentlich nicht mehr geben dürfte. Das hatte immer wieder mörderische Konsequenzen. Hier hat inzwischen ein Umdenken begonnen. Es ist entdeckt worden, dass auch nach dem Neuen Testament Gottes Geschichte mit seinem Volk Israel mit Jesus nicht beendet ist, sondern weitergeht, dass das Jesus ignorierende Judentum das von Gott geliebte Volk ist und bleibt. So ist es keine Nebensächlichkeit, dass auch im Neuen Testament Gott ausdrücklich als Gott Israels bezeichnet wird. Von der Erkenntnis her, dass der im Neuen Testament bezeugte Gott kein anderer ist als der im Alten Testament, in der jüdischen Bibel bezeugte und also Israels Gott, bin ich als Christ und besonders auch als Neutestamentler auf das Hören des jüdischen Zeugnisses verwiesen. Denn Israels Gott gibt es nicht ohne sein Volk Israel, ohne das jüdische Volk. In Jesaja 43,12 heißt es in Gottesrede an Israel: „Und ihr seid meine Zeugen, Spruch des Ewigen, und ich bin Gott.“ Rabbinische Auslegung nimmt das so auf: „Wenn ihr meine Zeugen seid, bin ich Gott; wenn ihr aber nicht meine Zeugen seid, bin ich gleichsam nicht Gott“ (Sifrej Dvarim § 346). Wir Christinnen und Christen machen gewiss – durch die Botschaft von Jesus vermittelt – unsere eigenen Glaubenserfahrungen. Wer aber Gott als Israels Gott ist, das zu beschreiben, ist Sache des jüdischen Zeugnisses – in der jüdischen Bibel und in der weitergehenden jüdischen Tradition. Will ich also festhalten, dass Gott, zu dem ich mit meinen Vorfahren durch Jesus in Beziehung gesetzt bin, Israels Gott ist und bleibt – und das festzuhalten, bin ich durch meine kanonischen Grundlagen angehalten –, bleibe ich auf jüdisches Zeugnis angewiesen. Wenn ich also als Neutestamentler auf jüdisches Zeugnis höre, ist das nicht nur eine historisch-religionsgeschichtlich naheliegende Pragmatik, sondern es ist zutiefst theologisch bedingt. 4. Das Alte Testament als Sprachraum des christlichen Glaubens Bei der Vorbereitung der Hauptvorlage 1999 für die Synode der Evangelischen Kirche von Westfalen hat Frank Crüsemann einmal auf den Tatbestand hingewiesen, dass wir unsere christlichen Glaubenserfahrungen ganz und gar mit alttestamentlichen Texten beschreiben können. Daraus ergibt sich, dass diese Glaubenserfahrungen schon vorher – also ohne Jesus – in Israel gemacht wurden. Im Konfirmandenunterricht hatte ich aus dem Anhang meines Katechismus „Lebensworte der Heiligen Schrift“ auswendig zu lernen. Dazu gehörte die schöne Aussage, wie sie in Jesaja 54,10 als Anrede Gottes an Israel steht und die wir doch so gerne auch uns gesagt sein lassen: „Ja, die Berge werden weichen und die Hügel wanken, aber meine Freundlichkeit wird nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens nicht wanken, spricht, wer sich deiner erbarmt: der Ewige.“ Oder: Die bei Christen so beliebte 4 Aussage aus Jesaja 43,1, verwendet als Spruch zu Taufe, Konfirmation und Beerdigung, ist nach dem biblischen Zusammenhang Zusage Gottes an Israel: „Und jetzt, so spricht der Ewige, der dich, Israel, geschaffen, dich, Jakob, gebildet hat: Fürchte dich nicht, ich habe dich doch befreit; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein!“ Wer will den traurigen Mut aufbringen, diese Zusage – an jedem ersten Schabbat im Jahreszyklus als Prophetenlesung in jeder Synagoge der Welt gelesen – ließen sich Jüdinnen und Juden zu Unrecht gesagt sein, weil sie in Jesus nicht den Messias erkennen können? Oder: Was bedeutet es, dass Luther das Evangelium von der Rechtfertigung in der Vorlesung über die Psalmen entdeckte? Doch dies, dass das, was er da erkannte, in den Psalmen da ist und weiter wirkt, wenn sie von Jüdinnen und Juden gebetet werden. „Lobe den HERRN, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen! Lobe den HERRN, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat! ... Barmherzig und gnädig ist der HERR, geduldig und von großer Güte... Er handelt nicht mit uns nach unsern Sünden und vergilt uns nicht nach unsrer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. So fern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsre Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der HERR über die, die ihn fürchten“ – um nur einige Verse aus Psalm 103 in der Übersetzung Luthers zu zitieren (V.2-3.8.10-13). Aus Gottes ungeschuldeter Barmherzigkeit erfolgende Sündenvergebung wurde in Israel lange vor Jesus und wird im Judentum lange nach Jesus bis heute erfahren. Gerade das Evangelium von der Rechtfertigung, das in der christlichen Auslegungsgeschichte und besonders in der protestantischen von Luther an antijüdisch profiliert worden ist, findet sich auch in Texten der jüdisch-rabbinischen Tradition. Auch sie weiß davon, dass alle der Sünde verfallen sind und niemand vor Gott gerecht ist, dass Gott es ist, der gerecht macht und die zur Umkehr Bereiten am Versöhnungstag rechtfertigt und als neue Schöpfung erschafft, dass alles an seiner Gnade hängt, auf die sich der Glaube verlässt, wie schon Abraham „diese und die kommende Welt allein dank des Glaubens geerbt hat“. (Vgl. Jesus zwischen, S. 180–183). Wieder frage ich: Wer will den traurigen Mut aufbringen zu behaupten: Weil in Matthäus 1,21 im Blick auf Jesus steht, er werde „sein Volk retten von ihren Sünden“, und Jüdinnen und Juden Jesus nicht beanspruchen, sei das, was am Versöhnungstag in den Synagogen geschieht und dort als Sündenvergebung erfahren wird, ungültig? Ich könnte fortfahren und an Texten der jüdischen Bibel und der jüdischen Tradition aufzeigen: Was wir durch Jesus an Vertrauen auf Gott gewinnen, an Vergebung der Sünden, an Erbarmen und Rechtfertigung erfahren, kennt und erfährt das Judentum in Vergangenheit und Gegenwart auch ohne Jesus. Ich will dafür nur noch ein Beispiel aus unserer Gegenwart nennen. Was bedeutet es, das im Evangelischen Gesangbuch unter der Nummer 237 im Abschnitt über Beichte – also im theologischen Zentrum, wo es um Schuld und Vergebung und unbedingtes Vertrauen auf den barmherzigen Gott geht – das Gedicht eines Juden, nämlich Schalom Ben-Chorins, steht? „Und suchst Du meine Sünde, / flieh ich von Dir zu Dir, / Ursprung, in den ich münde, / Du fern und nah bei mir. Wie ich mich wend und drehe, / geh ich von Dir zu Dir; / die Ferne und die Nähe / sind aufgehoben hier. Von Dir zu Dir mein Schreiten, / mein Weg und meine Ruh, / Gericht und Gnad, die beiden / bist Du – und immer Du.“ Wir können dieses Gedicht nachsprechen und es als Lied im Gottesdienst singen, weil 5 wir darin unsere durch Jesus Christus vermittelten Erfahrungen ausgedrückt finden. Das sind dann ganz offensichtlich dieselben Erfahrungen – Erfahrungen im innersten Zentrum der Existenz vor Gott –, die Juden ohne die Vermittlung durch Jesus Christus machen. Unser Bekenntnis, dass Jesus für alle gestorben und auferstanden ist, muss und darf nicht die Annahme zur Konsequenz haben, Juden fehle etwas, wenn sie das nicht für sich beanspruchen. Weder die jüdische Bibel noch die jüdische Tradition sind gegenüber dem Neuen Testament und dem Christentum defizitär. Wie die tatsächliche Erfahrung der Kirche vielmehr zeigt, ist das Alte Testament Sprachraum des christlichen Glaubens. 5. Eine doppelte Frage: Was ist das Neue am Neuen Testament? Wie können wir das für Luther zentrale solus Christus verstehen? Wenn die jüdische Bibel und das Judentum nicht als defizitär beschrieben werden dürfen, könnten sich die Fragen stellen, was denn neu sei am Neuen Testament – und warum überhaupt das Christentum? Die einzig neu akzentuierende Aussage, die ich im Neuen Testament erkenne, die aber auch nur im jüdischen Kontext gemacht werden konnte, besteht darin, dass vom hingerichteten Jesus nicht bezeugt wird – wie bei den makkabäischen Märtyrern –, dass Gott ihn auferwecken wird, sondern dass er ihn auferweckt hat, verstanden als Anbruch endzeitlicher Neuschöpfung. Von daher konnte die sich alsbald einstellende Erfahrung, dass sich die auf Jesus bezogene Verkündigung als attraktiv für Menschen aus der Völkerwelt erwies, in folgender Weise gedeutet werden: Was in biblischen Texten von der Endzeit erhofft wurde, dass Gott seinen Geist über „alles Fleisch“ ausgießt (Joel 3) und dass die Völker der Welt sich Israels Gott als dem einen Gott zuwenden (z.B. Jes 2; Micha 4), sieht man sich jetzt schon vollziehen. Ich formuliere daher knapp als These: Das Neue am Neuen Testament ist, dass wir mit unseren Vorfahren als Menschen aus der Völkerwelt durch die auf Jesus bezogene Verkündigung kraft des heiligen Geistes zum Glauben an den einen Gott gekommen sind, der Israels Gott ist und bleibt, dass wir ihn bitten und loben, ihm klagen und singen können, ohne jüdisch werden zu müssen. Deshalb gilt für uns als Kirche das solus Christus. Zu dem biblisch bezeugten Gott sind wir allein durch Jesus in Beziehung gesetzt worden und werden auch allein durch ihn in dieser Beziehung gehalten. Aber dieses solus Christus zeitigt schlimme Folgen, wenn es absolut und exklusiv verstanden wird. Das lässt sich sehr deutlich an Luther beobachten. Wer Gott ist, beschreibt er ganz und gar von Jesus Christus her. So ergibt sich zwangsläufig die Logik, dass diejenigen, die die hebräische Bibel als ihre heilige Schrift haben und gebrauchen, die Juden, dennoch keine Ahnung von Gott haben, weil sie Jesus nicht anerkennen. Ja, sie werden von daher sogar zu Gottesleugnern und Feinden Gottes. „Wer nun Jesus von Nazaret, den Sohn der Jungfrau Maria, leugnet, lästert und flucht, der leugnet, lästert und flucht auch Gott, den Vater, selbst, der Himmel und Erde geschaffen hat. Solches tun aber die Juden“. 1 Nebenbei sei angemerkt, dass das passive Verhalten der Juden, dass sie Jesus nicht akzeptieren, unter der Hand umgemünzt wird in ein höchst aktives negatives Handeln. Luther identifiziert Gott und Christus in direkter Weise: „Christus, das ist Gott selbst.“ 2 Daraus ergibt sich dann zwingend, dass alles, was die Juden religiös tun – „ihr Lob, Dank, Gebet und Lehren“ –, 1 2 WA 53,53121–23; Walch XX 2001 Nr. 325. WA 53,54021; Walch XX 2012 Nr. 355. 6 nichts anderes sei als „eitel Gotteslästern, Fluchen, Abgötterei“. 3 Das aber heißt, dass nach dieser Logik gerade die Juden das erste Gebot verfehlen. Das kann nach Luther im christlichen Bereich nicht geduldet werden. Genau von daher sind seine schlimmen Ratschläge an die Fürsten, wie mit den Juden umzugehen sei, in der Schrift „Von den Juden und ihren Lügen“ begründet. Sie ergeben sich gerade von diesem theologischen Zentrum her, einer exklusiv christologisch gefassten Theologie. Solche Ratschläge wird heute selbstverständlich niemand geben, der an diesem Punkt theologisch in Luthers Spuren geht. Letzteres geschieht etwa, wenn vehement für eine „christologische Theologie“ plädiert wird (Eckstein). Doch sollte man sich im Klaren darüber sein, was damit implizit gegeben ist, dass nämlich Altes Testament und Judentum notwendig als defizitär erscheinen, insofern ihnen rechte Gotteserkenntnis abgeht, die es danach nur in christologischer Perspektive gibt. Ich halte es für bezeichnend, dass bei solchen Versuchen einer „christologischen Theologie“ die neutestamentlichen Texte von der späteren altkirchlichen Dogmatik her interpretiert werden, die doch bei ihrer Entstehung selbst nur Auslegung der Bibel in einem anderen geistesgeschichtlichen Kontext sein wollte. Es ist dann auch nicht verwunderlich, wenn ein bekannter lutherischer Systematiker behauptete, der Gott des Christentums sei ein anderer als der des Judentums. Liest man die neutestamentlichen Texte in ihrem Entstehungskontext – und der ist ein jüdischer –, ist die Formulierung von der „christologischen Theologie“ genau umzukehren. Dem Neuen Testament geht es um eine „theologische Christologie“, nämlich darum, zu bezeugen, dass in dem Menschen Jesus wirklich Gott begegnet – eben der Gott, den die jüdische Bibel und die auf ihr fußende jüdische Tradition bezeugt. Von daher ist für die Auslegung des Alten Testaments Luthers hermeneutisches Prinzip „Was Christum treibet“ zu bestreiten und für die Verhältnisbestimmung von Altem und Neuem Testament die Dominanz des Schemas von Verheißung und Erfüllung in Frage zu stellen. 6. Wider das hermeneutische Prinzip „Was Christum treibet“ und die Dominanz des Schemas von Verheißung und Erfüllung Luthers bekannte Aussage, im Alten Testament gelte das, „was Christum treibet“, ist nicht nur eine Verengung, sondern führt auch zur Verzeichnung der jüdischen Bibel und des Judentums. Luther ignoriert das am Alten Testament, was er für spezifisch jüdisch hält, wertet das in ihm Gebotene negativ als „Gesetz“ ab, das die Juden zur Werkgerechtigkeit verführe, und nimmt positiv auf, was er als Verheißung in ihm erkennt, die auf Christus hinweise, ja ihn schon enthalte. Auf diesen dritten Punkt gehe ich nun näher ein und stelle dabei heraus, dass Luther ihn verabsolutiert und sich von daher entschieden gegen jedes Hören auf jüdische Auslegung wehrt. „Beherrschend ist in allen das Judentum betreffenden Schriften des Reformators nachzuweisen, ja in Gestalt seiner Schriftauslegung regelrecht zu beweisen, dass Jesus Christus der in der Schrift Alten Testaments angekündigte Messias ist.“ 4 Luther dekretiert: „Wir Christen haben den Sinn und das Verstehen der Bibel, weil wir das Neue Testament, d.h. Jesus Christus, haben, der im Alten Testament verheißen und danach 3 4 WA 53,53637–38; Walch XX 2008 Nr. 345; vgl. WA 53,52331; Walch XX 1991 Nr. 302. Osten-Sacken, Luther, S. 39. 7 gekommen ist und mit sich das Licht und das Verstehen der Schrift gebracht hat.“ 5 Da nun die Juden Jesus nicht als Messias akzeptieren, formuliert er an anderer Stelle kurz und bündig: „Die Juden verstehen die Bibel nicht, weil sie deren Gegenstand (res) nicht verstehen.“ 6 Und dieser Gegenstand, diese „Sache“ ist nach Luther Jesus Christus. Die Konzentration seiner Auslegung des Alten Testaments auf Jesus Christus „hat unverkennbar die Art und Weise bestimmt, in der er die Juden als Feinde Christi ins Spiel bringt“. 7 „Weil sie diesen Christus nicht annehmen, können sie nicht wissen noch verstehen, was Mose, die Propheten und die Psalmen sagen, was rechter Glaube ist, was die zehn Gebote wollen, was die Beispiele und Geschichten hergeben, sondern die Schrift muss ihnen sein (nach der Weissagung Jesaja 29) wie ein Brief demjenigen, der nicht lesen kann.“ 8 So wird ihnen die Ehrenbezeichnung „Israel“ entzogen und selbst beansprucht: „Die Apostel und die anderen Jünger Christi, die aus den Juden kommen, waren das rechte Israel und haben auch des ganzen Volkes Israel Namen geerbt […]. Darum ist der Name Israel hinfort bei den Aposteln geblieben und auf alle ihre Jünger vererbt, sodass nunmehr die heilige Christenheit und wir auch und alle, die dem Wort der Apostel glauben und ihre Jünger sind, Israel heißen.“ Als Ziel dieser Aussagen gibt Luther an: „Das sage ich darum, dass man sich an der Juden Auslegung nicht kehre.“ 9 Denn diese Ausleger sind „nicht Freunde, sondern Feinde der heiligen Schrift“. 10 Wenn etwas im Alten Testament unverständlich ist, gilt: „Was wir Christen nicht erfassen oder verdeutlichen, das können sie auch nicht verstehen oder erklären; denn sie haben die Bedeutung oder den Sinn der heiligen Schrift nicht. Die heiligen Schriften aber ohne Glauben an Christus zu lesen, heißt in Finsternis zu wandeln; wie Christus sagt (Joh 8,12): ‚Ich bin das Licht der Welt.‘“ Luther verwendet diese verheißende Aussage in negativer Umkehrung und dekretiert: „Da die Juden dessen verlustig gegangen sind, ist es unmöglich, dass sie auch nur eine Stelle der Verheißung recht verstehen“. 11 Man solle den Juden die Schrift wegnehmen als „öffentlichen Dieben“. So wünscht Luther: „Gott gebe, dass unsere Theologen getrost Hebräisch studieren und die Bibel uns wieder heimholen von den mutwilligen Dieben.“ 12 Dass er Jesus Christus als Gegenstand des Alten Testaments absolut gesetzt hat, führt ihn also dazu, diejenigen als Diebe der hebräischen Bibel zu bezeichnen, die sie – während sie in der Kirche vergessen worden war – durch die Jahrhunderte bewahrten und von denen sie samt dem Erlernen der hebräischen Sprache im Zeitalter von Humanismus und Renaissance übernommen wurde. Auf der Linie Luthers liegen heutige Versuche, die „das Christusgeschehen“ zum Verstehensschlüssel des Alten Testaments machen oder die Einheit der Bibel vom „Christusgeschehen“ her bestimmt sehen. Wiederum ist zu bemerken, dass Vertreter dieser Position selbstverständlich nicht Luthers antijüdische Ausfälle wiederholen. Aber ebenfalls wiederum müssen sie sich fragen lassen, wie sie damit umgehen, dass diese Position eine 5 6 7 8 9 10 11 12 Von den letzten Worten Davids, WA 54,293–9; Walch III 1882 Nr. 3. Dafür werden Johannes 5,46; Lukas 21,22; 24,27 angeführt. WATr 5,21225–26; von Kaufmann, „Judenschriften“, auf S. 97 angeführt. Osten-Sacken, Luther, S. 71. Von den letzten Worten Davids, WA 54,301–5; Walch III 1883 Nr. 6. Vorrede auf das 38. und 39. Kapitel Hesekiel, WA 30 II,22424–29; 2259. Genesis-Vorlesung, WA 44,6835–6; Walch II 1838 Nr. 145. Genesis-Vorlesung, WA 44,7908–13; Walch II 2030 Nr. 330. Von den letzten Worten Davids, WA 54,9323; 10021–22; Walch III Nr. 149; 1973 Nr. 165. 8 Eigenaussage der jüdischen Bibel und jüdische Auslegung implizit recht grundsätzlich in Frage stellt. Die Einheit der christlichen Bibel ist im Übrigen nicht in christologischer Perspektive zu suchen; sie ist theologisch vorgegeben, da für die neutestamentlichen Autoren Gott, den sie als in Jesus wirkend bezeugen, kein anderer ist als der, den sie aus ihrer jüdischen Bibel kennen. Schon lange vor Luther ist in der christlichen Kirche bei der Verhältnisbestimmung von Altem und Neuem Testament das Schema von Weissagung bzw. Verheißung und Erfüllung dominant geworden. Diese Zuordnung reduziert das Alte Testament auf eine Funktion für das Neue und lässt es in und mit diesem „aufgehoben“ sein. Dagegen sei auf die folgenden drei Punkte hingewiesen. Einmal ist hinter die Rede von der „Erfüllung“ ein kräftiges Fragezeichen zu setzen. Was an den großen Verheißungen der jüdischen Bibel ist denn tatsächlich „erfüllt“ worden? In der auf Jesus bezogenen Gemeinschaft, aus der dann die christliche Kirche wurde, sind in der Geschichte, die weiterlief, als wäre nichts geschehen, immer nur fragmentarische Erfahrungen des Erhofften gemacht worden. Und zudem ist dieser Kirche, wie Franz Overbeck um 1900 bissig bemerkt hat, kein Verbrechen, wie es in der Welt geschieht, fremd geblieben. „Erfüllt“ ist, dass zwar nicht die Völker der Welt, aber doch immerhin zahlreiche Menschen aus den Völkern der Welt zum Glauben an den in der Bibel bezeugten Gott Israels als den einen Gott gekommen sind, womit sie sich zusammen mit Israel, mit dem Judentum in einer Hoffnungsgeschichte und nicht in einer Erfüllungsgeschichte vorfinden. Im Neuen Testament begegnet oft die Aussage, dass etwas „erfüllt“ werde, was geschrieben steht, worauf dann ein Schriftzitat folgt. Aber liegt hier wirklich das Schema „Verheißung und Erfüllung“ vor? Zur Beantwortung dieser Frage gehe ich zunächst auf Mt 5,17 ein. Danach sagt Jesus – auch hier gebe ich zuerst die Übersetzung der Lutherrevision von 1984: „Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen; ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen.“ Zweimal wird hier stark verneint, Jesus sei dafür da, Tora und Propheten aufzulösen. „Tora und Propheten“ stehen für die Schrift im Ganzen. Nichts von der Schrift soll aufgelöst, außer Kraft gesetzt, annulliert werden. Als positiver Gegensatz dazu ist ein Wort gebraucht, dessen erste Bedeutung „erfüllen“ ist. Aber ist damit das in diesem Gegenüber Gemeinte treffend wiedergegeben? An dieser Stelle hatte ich vor über zwanzig Jahren ein Aha-Erlebnis. Als ich endlich gut genug Hebräisch gelernt hatte, um die rabbinischen Texte lesen zu können, habe ich mir in Israel eine CD besorgt, auf der die Bibel, die Texte der rabbinischen und noch viele andere der weiteren jüdischen Tradition versammelt sind, verbunden mit einem intelligenten Suchprogramm. Ich habe dann das Wort toráh und das hebräische Wort für „erfüllen“ eingegeben und bekam nur einen einzigen Beleg. Nach ihm werden die Gelehrtenschüler aufgefordert: „Steht auf und erfüllt das ganze Land mit Tora!“ (BerR 61,3) Sie sollen Tora auslegen, damit sie gehalten wird. Dann habe ich außer toráh das hebräische Wort für „auflösen“, „annullieren“ eingegeben und bekam massenhaft Belege. Dabei fand ich dann auch sehr oft den Gegenbegriff dazu. Es ist eine Intensivform des Wortes für „stehen“, das die Bedeutungen hat: „aufrichten“, „zustande bringen“, „bestätigen“, „in Geltung setzen“, „verwirklichen“. Ich gebe ein Beispiel: In Mischna Avot 4,9 heißt es von Rabbi Jonathan: „Jeder, der die Tora aus Armut aufrichtet, wird sie schließlich aus Reichtum aufrichten. Jeder, 9 der die Tora aus Reichtum außer Geltung setzt, wird sie schließlich aus Armut außer Geltung setzen.“ Das in Mt 5,17 gebrauchte positive griechische Verb, dessen erste Bedeutung „erfüllen“ ist, ruft nicht in jedem Fall die Vorstellung von einem leeren Gefäß hervor, das gefüllt werden muss. Es kann sich – wie das deutsche Wort „vollbringen“, das eine mögliche Bedeutung des griechischen Wortes wiedergeben kann – ganz davon lösen. Bei „erfüllen“ ist die Vorstellung von einem Leerraum da, der gefüllt werden muss; und wenn er voll ist, ist die Sache erledigt. Versteht man aber das „Erfüllen“ als ein „Vollbringen“, ergibt sich für Mt 5,17 ein klarer Zusammenhang: „Meint nicht, dass ich gekommen bin, die Tora und die Propheten außer Geltung zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um sie außer Geltung zu setzen, sondern um sie zu vollbringen/auszuführen/zustande zu bringen.“ Auch die vor allem in den Evangelien immer wieder begegnenden Wendungen vom „Erfüllen“, besser „Vollbringen“, „Ausführen“ dessen, „was geschrieben steht“, bekommen so einen anderen Akzent. Die hier gebrauchte Formulierung entspricht sehr genau einer Wendung, die im rabbinischen Schrifttum mehr als vierhundertmal begegnet: „um aufzurichten (oder: zu vollbringen/auszuführen), was gesagt worden ist“, worauf ein biblisches Zitat folgt. So wird z.B. in einem Midrasch zu 4. Mose 6,2 im Blick auf die Richter 13,5 angekündigte Geburt Simsons und dessen besonderes Leben gefragt: „Was bedeutet es, dass es heißt: von Mutterleib an?“ und unmittelbar anschließend geantwortet: „Da wurde ausgeführt, was gesagt worden ist (Jeremia 1,5): Bevor ich dich bildete im Mutterleib, kannte ich dich“ (BemR 10,5; Wilna 37b). Weder dieser noch vergleichbare andere rabbinische Texte noch die entsprechenden Aussagen der Evangelien sind im Schema von Verheißung und Erfüllung geschrieben. Ihre Autoren entdecken vielmehr Momente im Leben der jeweils Beschriebenen in der Schrift. Indem sie das kenntlich machen, bringen sie das Mitsein Gottes mit den jeweils Beschriebenen und Gottes Wirken durch sie zum Ausdruck. 7. Die ganze heilige Schrift – von vorne und von hinten gelesen oder: Jerusalem als Perspektive eines christlich-jüdischen Miteinanders Ich plädiere nicht für eine einseitige Leserichtung der zweigeteilten christlichen Bibel. Beide möglichen Leserichtungen, die vom Neuen Testament zum Alten Testament und die vom Alten zum Neuen, haben ihr jeweiliges Recht, das sich präzis beschreiben lässt. Die Leserichtung von vorn, vom Alten zum Neuen Testament, stellt das Prae des Alten Testaments heraus, sein „Voraus“ und „Zuvor“. Es gilt in der Hinsicht, dass das Alte Testament als jüdische Bibel schon da war, als die neutestamentlichen Autoren ihre Schriften verfassten. Es gilt nicht nur zeitlich, sondern auch sachlich, insofern für diese Autoren ihre jüdische Bibel die Basis ihres Schreibens bildet, sie nur mit ihrer Bibel zum Ausdruck bringen konnten, was sie bezeugen wollten: das Mitsein Gottes mit der Geschichte Jesu. Von daher gilt das Prae des Alten Testaments dezidiert theologisch. Andererseits habe ich als Nichtjude nicht von Haus aus eine Beziehung zur jüdischen Bibel. Durch ihr Zusammenbinden mit dem Neuen Testament ist die jüdische Bibel zum Alten Testament der Kirche geworden, das heißt nicht: zum veralteten, sondern zum ersten und in Geltung bleibenden Testament, zu dem ich als Nichtjude Zugang durch das Neue Testament habe. Unter der Hinsicht des Zugangs, dass ich also durch Jesus zu dem biblisch bezeugten Gott in Beziehung gesetzt bin und darin gehalten werde, hat daher für mich das Neue Testament ein Prae, ein „Voraus“ und „Zuvor“. 10 Das begründet das Recht der Leserichtung „von hinten“, also vom Neuen Testament zum Alten. Aber vielleicht sind „vorn“ und „hinten“ hier nicht einmal die treffenden Kategorien. Das könnte deutlich werden, wenn ich versuche, das Verhältnis von Altem und Neuem Testament zueinander und zugleich das Verhältnis der christlichen Bibel zur jüdischen Bibel an meiner Arbeitsbibel geradezu handgreiflich zu demonstrieren. Nachdem mir die überragende Bedeutung der jüdischen Bibel, des Alten Testaments für das Neue Testament und damit doch auch für Christentum und Kirche aufgegangen war, ärgerten mich isolierte Druckausgaben des Neuen Testaments und ihr weit verbreiteter Gebrauch. Wird damit doch so getan, als wäre das Neue Testament das „eigentlich christliche“ Buch und das Alte demgegenüber weniger wichtig. Auch in meinem wissenschaftlichen Umgang wollte ich daher kein für sich stehendes griechisches Neues Testament mehr benutzen. So ließ ich mir den „Nestle/Aland“ mit einer hebräischen Bibel zusammenbinden. Als hebräische Bibel wählte ich nicht eine christliche Ausgabe mit textkritischem Apparat, die Biblia Hebraica, sondern eine in Jerusalem gekaufte jüdische Bibel. So habe ich bei meiner Arbeit stets vor Augen und werde daran erinnert, dass der erste Teil der christlichen Bibel zuvor und zugleich heilige Schrift des Judentums war und ist. Außer dem praktischen Umstand, dass ich so immer die ganze heilige Schrift – jedenfalls die der reformatorischen Konfessionsfamilie –, in einem einzigen Band in den Originalsprachen zur Hand habe, enthält dieses zusammengebundene Buch bedeutsame symbolische Aspekte. Die Formate stimmen nicht überein. Der „Nestle/Aland“ ist etwas größer als das verwendete Exemplar der jüdischen Bibel. Ich habe das Neue Testament nicht beschneiden lassen, um eine glatte Einheit zu erreichen – ein Hinweis auf bleibende Unterschiede, die wahrzunehmen und zu respektieren sind. Sodann: Dieses zusammengebundene Buch hat kein Vorn und kein Hinten. Da Hebräisch von rechts nach links geschrieben und gelesen wird, fängt ein hebräisches Buch auch da an, wo bei uns hinten wäre. Beide Buchdeckel meiner Bibel sind also jeweils vorn und die jeweiligen Schlüsse bilden die Mitte des ganzen Buches; sie ist da, wo die jüdische Bibel und das Neue Testament mit ihrem jeweiligen Ende zusammenstoßen. „Was stößt in deiner Bibel zusammen?“ war die spontane Frage Edna Brockes, als ich in einem unserer zahlreichen gemeinsamen Seminare zum ersten Mal mit meiner zusammengebundenen Bibel neben ihr saß. An den üblichen christlichen Bibelausgaben nimmt sie Anstoß an dem als steigernde Erfüllung interpretierten Übergang vom Alten zum Neuen Testament. Das christliche Alte Testament endet mit dem Buch Maleachi, an dessen Schluss die Erwartung des kommenden Elija ausgesprochen wird. Darauf folgt als Beginn des Neuen Testaments das Matthäusevangelium, in dem Elija in Gestalt Johannes des Täufers alsbald kommt. In der Mitte meiner Bibel stößt mit dem Schluss der jüdischen Bibel und dem Schluss des Neuen Testaments anderes zusammen. Den Abschluss der jüdischen Bibel bilden die Chronikbücher. An deren Ende, in 2Chr 36,23, steht das Edikt des Perserkönigs Kyros, gerichtet an die nach Babylon exilierten Juden: So spricht Kyros, der König von Persien: Alle Königreiche der Erde hat mir der Ewige, der Gott des Himmels, gegeben. Und er hat mir auferlegt, ihm ein Haus in Jerusalem, das in Judäa liegt, zu bauen. Wer immer unter euch zu seinem Volk gehört, mit dem ist der Ewige, sein Gott, und so möge er hinaufsteigen. Als letztes Wort steht vejaal: und er wird/kann/darf/möge/soll hinaufsteigen – nach Jerusalem als Vorort und Repräsentanz des Landes Israel. Nach 11 Jerusalem steigt man immer hinauf. Aus diesem Verb ist das Nomen Alija gebildet, das bis heute die Einwanderung, die Rückkehr von Jüdinnen und Juden ins Land Israel bezeichnet. Am Schluss der jüdischen Bibel kommt also Jerusalem in den Blick als Ort der Heimkehr aus dem Exil, als Ort, an dem wieder ein selbstbestimmtes jüdisches Leben beginnen kann im Dienst gegenüber Israels Gott und in der Verantwortung vor ihm. Das letzte Buch im Neuen Testament ist die Apokalypse des Johannes. Sieht man von ihren abschließenden Mahnungen und dem brieflichen Schlussgruß ab (22,6–21), so ist ihr letzter großer Zusammenhang die Vision vom neuen Jerusalem, das vom Himmel herabsteigt (21,9–22,5). Cum grano salis stoßen also in meiner Bibel das irdische Jerusalem und das himmlische Jerusalem zusammen. Da einerseits das neue Jerusalem der Apokalypse des Johannes doppelt geerdet ist, indem es vom Himmel auf die Erde herabkommt und zugleich als „Braut des Lammes“ die Gemeinde symbolisiert und also in dem, was es bedeutet, auf konkrete Verwirklichung drängt, und andererseits das Jerusalem der jüdischen Bibel immer wieder über das faktische Jerusalem hinausweist auf ein verändertes und neues Jerusalem hin, kann dieses Zusammentreffen des irdischen und himmlischen Jerusalem in der Mitte meiner Arbeitsbibel eine gute Perspektive für das jüdisch-christliche Verhältnis abgeben. 12