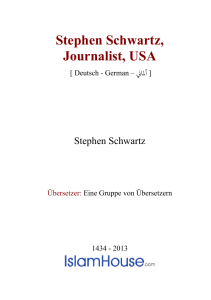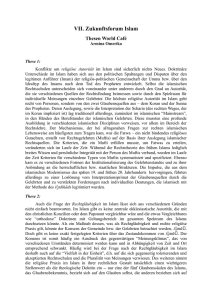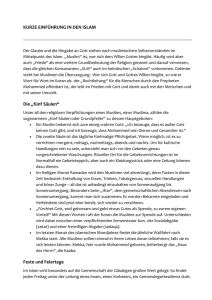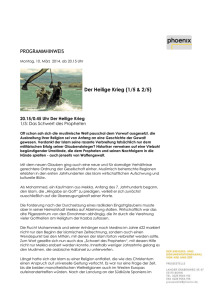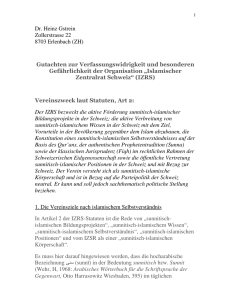Einführung in die Geschichte der islamischen Länder II
Werbung

Einführung in die Geschichte der islamischen Länder II Die Entstehung der salafīya 1 Einleitung: Der Orient und die Moderne 2 Europäisierung, nachholende Entwicklung und ihr Scheitern 2.1 Europa-Begeisterung 2.2 Autokratische Gegenbewegung: Abdülhamid II. (1876-1909) 2.3 Reaktionen auf zunehmende Schwäche der islamischen Länder 3 Modernisierung ohne Verwestlichung: al-Afġānī 4 Vorwärts zu den Altvorderen: Die arabische salafıya, Deoband 4.1 Rašīd Riḍā 4.2 Deoband 1 Einleitung: Der Orient und die Moderne Ist der Orient – genauer: der islamische Orient – „modernefähig“? Manchmal hat diese Frage auch eine andere Form, man fragt nach der Kompatibilität von Islam und Moderne oder Islam und Demokratie, und knüpft daran besorgte Prognosen über die Zukunft der arabischen oder insgesamt der islamischen Welt. Es wird darauf verwiesen, dass der Orient, genauer: der islamische Orient, keine Aufklärung erlebt habe, und fügt dann die Frage an, ob der Islam wohl „aufgeklärt“ werden könne; man verweist auf die christlichen oder – historisch korrekter – christlich-jüdischen Wurzeln der europäischen Kultur und meint, mit diesem Hinweis auch die Aufklärung integriert zu haben (wobei der teilweise vehement antiklerikale und antireligiöse Charakter der Aufklärung eigenartigerweise so gut wie nie erwähnt wird). Antipode dieser Vorstellung ist implizit eigentlich immer der Islam, der damit von dem europäischen Projekt der Moderne ausgeschlossen wird. All diese Fragen stellen heißt sie verneinen. Denn wer an der Moderne partizipiert, den fragt man nicht, ob er „modernefähig“ sei. Wenn also derartige Fragen gestellt werden, steht im Hintergrund mehr oder weniger explizit die Vorstellung, es gebe im Orient, genauer: im islamischen Orient etwas, was sich der Moderne hartnäckig widersetzt. Und wenn die Menschen im Orient, also genauer: die Muslime, nun doch an der Moderne teilhaben wollen oder sollen, dann bedeutet das demzufolge, dass sie sich von diesem Etwas lösen müssen, dass sie es abschütteln, sich davon befreien müssen, um sich zu modernisieren. 1 Ist dieses Etwas etwa der Islam? Betrachten wir noch einmal den Begriff der Moderne. Danach werde ich auf die vorgestellten Modernisierungs-Pfade in der islamischen Welt eingehen (es gab vier Beispiele: Ägypten, das Osmanische Reich, Iran, der kolonisierte Orient). Danach geht es mit der historischen Darstellung weiter, wobei Reaktionen aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zur Sprache kommen, sowohl staatliche (Abdülhamid II.) als auch intellektuelle, insbesondere die Gründerväter der salafīya. Begriff der Moderne (s.auch Vorlesung 6 mit einem Exkurs zur Begriffsbestimmung der Moderne nach Ira M. Lapidus). Moderne ist gewiss nicht nur Technik und/oder Technologie, und daher sind die in den Medien so gern gezeigten Gegenüberstellungen von Menschen in „traditioneller“ Kleidung und technischen Einrichtungen so wenig aussagekräftig. Billard spielende Saudis in ihren Gewändern, verschleierte Frauen vor chromblitzenden Straßenkreuzern oder vor Internet-Bildschirmen, Kamele vor Bohrtürmen: Hier soll das Kamel die Tradition, der Bohrturm die Moderne versinnbildlichen. Das ist zu primitiv. Moderne ist eher schon in Zusammenhang zu bringen mit der individuellen Wahlfreiheit zwischen diversen Lebensstilen, der Gründung der Gemeinschaft auf das Individuum, der freiwilligen Zugehörigkeit von Individuen zu Gemeinschaften, aus denen sie sich auch wieder herauslösen können. Und natürlich gehört ebenso dazu eine bestimmte Wirtschaftsauffassung – der nicht umsonst „modern“ genannte Industrie-Kapitalismus – und entsprechend auch die Gegenentwürfe, die diesen Kapitalismus ja bereits voraussetzen. Ferner die dazu gehörenden Formen der gesellschaftlichen Willens- und Meinungsbildung und so weiter, aber auch die Formen staatlichen Handelns; der moderne Staat greift sehr viel tiefer in die Gesellschaft ein, misst, reguliert, sortiert, teilt ein und auf, und das in Bereichen, in denen der Staat „früher“ nicht tätig war. Vormoderne Staaten hat man auf zwei Tätigkeitsbereiche beschränkt gesehen: Sicherheit innen und außen und Rechtswesen mit den zu beiden Tätigkeitsfeldern gehörenden Steuerapparaten; in der Neuzeit weiten sich diese Aufgabenfelder beträchtlich aus. Besonders hervorgehoben wurde und wird die Kontrolle über die Körper der Menschen als eine staatliche Tätigkeit (zuerst in eine Theorie gefasst von Michel Foucault, z.B. in Surveiller et punir „Überwachen und Strafen“). Moderne bedeutet also, dass die wichtigsten gesellschaftlichen Bereiche dem Anspruch nach auf die Grundlage rationaler Prinzipien gestellt werden; die Aufklärung, so Foucault, hat die Freiheiten entdeckt, aber auch die Mechanismen der Disziplinierung entwickelt – beides im Sinne der Rationalität. Als Basis der Institutionen sollen also immer Vernunftgründe benannt werden können, die von allen vernunftbegabten Menschen nachvollzogen werden können. Daraus ergibt sich auch der Universalismus der Moderne. 2 Europäisierung, nachholende Entwicklung und ihr Scheitern 2 Über die sich hieraus ergebenden Konsequenzen – der Übertragung eines und desselben Entwicklungsweges auf alle möglichen Kulturen und Regionen – habe ich schon gesprochen. Das Konzept der „nachholenden Entwicklung“ ist aus dieser Vorstellung der bloßen Anwendung eines universalen Prinzips im regionalen Maßstab entstanden. Und nicht nur in Europa, auch in den Gesellschaften des Nahen und Mittleren Ostens gab es viele Denker und Politiker, die dieser Konzeption anhingen. Dies sind die Europäisierer der ersten Stunde, etwa bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts, die von einer wahren Euphorie für alles Europäische erfasst waren. Dazu gehörten viele Tanzimat-Politiker im Osmanischen Reich, ihre Entsprechungen in Ägypten wie der im Folgenden vorgestellte al-Ṭahṭāwī, aber auch z.B. Amīr Kabīr, der Reformpremierminister Irans (1848-52). Während die erste Generation (noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts) einfach die technisch-militärischen Errungenschaften übernehmen wollte und so an Europa Anschluss zu finden hoffte, begriff man bald, dass dies ohne weitgehende Anpassung – d.h. Übernahme – europäischer Institutionen, z.B. im Rechtswesen, in der Organisation des Staatswesens, nicht gelingen würde. Hinzu kam in manchen Fällen, in Ägypten früher, im Osmanischen Reich später, in Iran erst durch die Tätigkeit ausländischer Gesellschaften, die Umorientierung der Produktion auf den Weltmarkt, in der Praxis auf den Export in europäische und amerikanische Märkte. Ferner wurde zum ersten Mal eine Öffentlichkeit geschaffen, die über die Zirkel der Gelehrten und Literaten bzw. des Hofes hinausging, mit Hilfe der Einführung der Presse und des Buchdrucks, auch in diesem Fall mit der charakteristischen Zeitverschiebung: Ägypten zuerst, danach Istanbul, Iran zum Schluss. Umorientierungen im Bildungswesen entsprachen diesen Schritten: Zunächst wurden Bildungsinstitutionen für den Bedarf der Armee geschaffen (Ausbildung für die technischen Waffengattungen und für Militärärzte), später kamen Einrichtungen für den Bedarf des Staatsapparats hinzu, später kam ein allgemeiner gesellschaftlicher Bedarf zum Tragen. Diese dritte Stufe wurde in Iran nur unvollständig erreicht. Die kolonisierten Länder entwickelten sich im Grunde entlang der gleichen Linien, nur wurden die entsprechenden Institutionen mit Orientierung auf die Einrichtungen der kolonisierenden Metropole geschaffen, und oft gab es kulturelle Schranken, ganz wörtlich: Grenzen, welche die Angehörigen der kolonisierten Gesellschaft nicht überschreiten konnten, weder in sozialer noch – oft genug – in räumlicher Hinsicht. Eine eigenständige Entwicklung war dort nicht möglich. 2.1 Europabegeisterung Die Europabegeisterung der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts möchte ich am Beispiel eines Mannes vorstellen, Rifāʿa Rifʿat aṭ-Ṭahṭāwī (1801-1878). Er war von 1826 bis 1831 Imam der ersten ägyptischen Studienmission in Paris und hat auch später in den 3 Diensten der Herrscher von Ägypten gestanden, insbesondere des Khediven Ismāʿīl (186379), dem Bauherrn des Suez-Kanals, einem besonders Europa-begeisterten Mann, dessen Ziel es war, Ägypten zu einem Teil Europas werden zu lassen. Für Ṭahṭāwī waren die Herrscher Ägyptens aus der Linie Muḥammad ʿAlīs wohlwollende Monarchen, ohne deren Führung Ägypten nicht den Anschluss an den Fortschritt gefunden hätte. Sie hatten, so Ṭahṭāwī, Ägypten aus seiner Isolation befreit, das Land an Europa herangeführt. Die moderne Entwicklung sah er besonders in dem neu geschaffenen Zugang zu europäischer Bildung; er benutzt den Gegensatz von „Unwissenheit“ und „Bildung“, wenn er von europäischer Bildung spricht. So ist es auch konsequent, wenn er die immer fortwährende Entwicklung – ein Prinzip der Fortschrittsgläubigkeit im 19. Jahrhundert – als überragendes Prinzip anerkennt; die Herrscher haben die Aufgabe, diese Entwicklung zum Nutzen des Landes voranzutreiben. Auch die Rechtsgrundsätze einschließlich der Šarīʿa müssen sich dem Fortschritt anpassen. Neue Schichten von Gebildeten sind in die Herrschaft einzubeziehen: Experten für Landwirtschaft, Industrie, Medizin. Das Allgemeinwohl soll im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit des Herrschers stehen (das lässt sich aus dem šarīʿa-gemäßen Prinzip der maṣlaḥa gut begründen, das so viel wie Allgemeinwohl heißt und gelegentlich als Begründung angeführt wird, wenn die Entwicklung der Rechtsgrundsätze zu wenig praktikablen Regelungen zu führen droht). Wissenschaft, Bildung, Gewerbefleiß, Rechtlichkeit – das sind für Ṭahṭāwī die Garanten der fortschrittlichen Entwicklung, und die Hoffnung, Ägypten könne, wenn es auf diesem Weg fortschreitet, eines Tages „europäisch“ werden, ist dann natürlich gut begründet. Auch die beginnende koloniale Penetration gerade Nordafrikas durch europäische Mächte, vor allem Frankreich, konnte unseren Autor nicht wesentlich von dieser Position abbringen. Die europäischen Mächte standen nun einmal für Wissenschaft und Fortschritt. Diese Hoffnung, durch fleißige Anwendung derjenigen Prinzipien, die man als die spezifisch europäischen Errungenschaften ansah und die demzufolge für die beobachtete europäische Überlegenheit in militärischer und wirtschaftlicher Hinsicht als ursächlich betrachtet wurden, auf den Stand der Europäer zu kommen, hatte Ṭahṭāwī nicht allein; er ist damit wie gesagt lediglich ein Repräsentant einer ganzen Richtung von Autoren und Politikern in der islamischen Welt, von Nordafrika bis Indien, die in seiner Generation gewiss eine Mehrheit unter denjenigen stellte, die sich überhaupt über die Gesamtsituation Gedanken machten. 2.2 Autokratische Gegenbewegung: Abdülhamid II. (1876-1909) Die politische Bewegung weg von immer größerer Anpassung an Europa hin zu einem wieder autokratischen Stil kann man durch die Person des osmanischen Sultans Abdülhamid II. veranschaulichen. Er kam 1876 an die Macht durch ein Komplott der Konstitutionalisten; wie bereits dargestellt, bot er die Garantie, die neue osmanische 4 Verfassung nicht nur zuzulassen, sondern aktiv zu unterstützen. Das war in den ersten beiden Jahren seiner Regierung auch der Fall. Die dann folgenden katastrophalen Niederlagen des Osmanischen Reiches auf dem Balkan führten dazu, dass er das neu gebildete osmanische Parlament wieder auflöste und für den Rest seiner Regierungszeit autokratisch herrschte. Sein Regime war auf der absoluten Macht des Sultans aufgebaut, damit auch der Polizei und der Bürokratie; die Pressezensur wurde wieder schärfer gehandhabt. Der Sultan spielte gleichzeitig die Karte des Kalifats, er betrachtete sich als Oberhaupt aller (sunnitischen) Muslime und wurde als solches weitgehend anerkannt (nicht zuletzt in den kolonisierten Gebieten Mittelasiens und Indiens sowie Indonesiens, wo es eine muslimische Herrschaft nicht mehr gab, die als muslimische Autorität hätte fungieren können). Dessenungeachtet kombinierte dieses Regime konservative islamische Züge mit einer Weiterführung der Reformen in einem eher technischen Verständnis; neue Schulen wurden gegründet, die Rechtsreform kam voran, und vor allem wurden Eisenbahnen gebaut und neue Kommunikationswege geschaffen (Post und Telegraf). Auch das Militär wurde weiter modernisiert, am Ende der Regierungszeit begannen die Osmanen mit dem Aufbau einer modernen Kriegsflotte (die Schiffe wurden in Europa gebaut). Die Maßnahmen zur Einführung einer Plantagen-ähnlichen Landwirtschaft mit Exportorientierung (çiftlik) waren durchaus von Erfolg gekrönt. Seit 1838 hatte die osmanische Wirtschaft, besonders die Landwirtschaft, sich in den Weltmarkt integrieren müssen (die Zollregelungen waren so gestaltet worden, dass die Einfuhren in das Osmanische Reich viel billiger wurden). Getreide, Wolle, (getrocknete) Früchte und Trauben, Baumwollel, Tabak, Angora-Haare und andere landwirtschaftliche Produkte wurden exportiert. Ein Schwerpunkt war – notgedrungen – Anatolien, die lange vernachlässigte Region (immer hatten die osmanischen Sultane die europäischen Besitzungen auf dem Balkan für wichtiger gehalten, nun waren diese zum großen Teil verloren gegangen). Bis 1913 stieg der Anteil Anatoliens an der landwirtschaftlichen Produktion des Osmanischen Reiches auf 55% und machte damit 48% des Bruttoinlandsprodukts aus. Von den Exporten waren 80 bis 85% landwirtschaftliche Produkte. Diese technischen und teilweise ökonomischen Schritte zur weiteren Entwicklung des Landes waren jedoch eben von der erwähnten autokratischen politischen Linie begleitet. Dazu gehörte auch die erneute Betonung des islamischen Charakters der osmanischen Herrschaft. In den vorangegangenen Reformperioden waren die Sonderregelungen für NichtMuslime (Christen und Juden) auf Druck der europäischen Mächte allmählich aufgehoben worden, in den 1850er und 1860er Jahren gab es das Projekt einer allgemeinen osmanischen Staatsangehörigkeit und Loyalität. Seit 1867 konnten Christen in höhere Staatsämter aufsteigen; 1863 erhielten die Armenier das Recht, eine eigene Versammlung mit einer Mehrheit von Nicht-Klerikern zu gründen, die Regierung veranlasste, dass die 5 Griechisch-Orthodoxen Christen ebenfalls eine solche Versammlung bildeten; die bulgarische Orthodoxie wurde aus dem Gesamtverbund der griechisch-orthodoxen Kirche herausgelöst. Die religiöse Differenz sollte keine Schranke mehr zwischen den Untertanen bzw. zunehmend Bürgern des Osmanischen Reiches sein. Die blutigen Auseinandersetzungen zwischen Christen, Drusen und Muslimen 1860-61 in vielen Städten Syriens und des Libanon wurden auch darauf zurückgeführt, dass durch diese Versuche, Christen und Muslime gleichzustellen, am Ende ein Übergewicht der Christen (weniger der Juden) drohe; dies hat zunächst die Weiterführung der Reformen nicht verhindert. Ein Umdenken setzte aber ein, als das Projekt der Gesamt-Osmanischen Loyalität offenbar gescheitert war. Die Völker des Balkans formierten sich zunächst als „KonfessionsNationen“: Gemeinsamkeit suchen die frühen Nationalisten in der gemeinsamen Zugehörigkeit zu einer Kirche; das ist dann einfacher und näherliegend, wenn diese Kirchen – wie in der Orthodoxie gängig – autokephal sind, also eine eigene Hierarchie haben, die vom Patriarchen in Istanbul entweder gar nicht oder nur sehr locker abhängt. Diese Konfessionsnationen (das klassische Beispiel ist Rumänien) werden erst sehr allmählich mit „nationalistischem“, auch säkularem Inhalt gefüllt, man entdeckt die Sprache als Instrument, beginnt, in dieser Sprache zu schreiben, entwickelt ein eigenes Alphabet, sammelt Überlieferungen (Folklore: Märchen, Lieder) und konstituiert um all dies herum einen eigenen diskursiven Raum; dies alles ist Voraussetzung für die Forderung nach staatlicher Unabhängigkeit. Abdülhamid hat aus den zunehmenden Spannungen zwischen Christen und Muslimen im asiatischen Teil des Reiches, der enorm beschleunigten Loslösung der christlichen Völker auf dem Balkan aus dem Verband des Osmanischen Reiches und der immer schneller zunehmenden militärischen Schwäche des Reiches die Konsequenz gezogen, dass die Politik der Liberalisierung, des Konstitutionalismus und der Gesamt-Osmanischen Identität gescheitert ist. Mit seiner Unterstützung des Panislamismus und dann in den 1890er Jahren den ersten Massakern an Armeniern hat er in den westeuropäischen Ländern das Bild des orientalischen Despoten – nicht modernefähig, nicht demokratiefähig – bedient. Die Armenier-Massaker sind ebenfalls in dieser Phase ein Ausdruck der Spannung zwischen Muslimen und Christen im Osmanischen Reich. Ähnlich wie in den Balkan-Ländern wuchs auch in Armenien die nationale Bewegung, zunächst wiederum in Form einer KonfessionsNation, aber bald mit auch säkular-politischen Formen. Wie weit diese Bewegung von Russland unterstützt wurde, ist eine offene Frage; berücksichtigt werden muss, dass die radikaleren armenischen Gruppen auch in Russland illegal waren und auch dort verfolgt wurden. 6 Die nationale Bewegung der Armenier nahm von 1890-97 auch militante Formen an, dazu gehören Anschläge auf osmanische Beamte. Die Regierung Abdülhamids war in den von Armeniern bewohnten Provinzen des östlichen Anatolien nicht sehr gut präsent. Es gab daher eine indirekte Antwort, die Gründung der sog. Ḥamidīye-Regimenter, die vor allem von kurdischen Großgrundbesitzern geführt und von deren Leuten bemannt wurden. Es sind wohl diese Ḥamidīye-Regimenter gewesen, die 1894 die ersten Armenier-Massaker im Osmanischen Reich verübt haben. Die öffentliche Meinung in Europa war entsprechend aufgebracht. Die armenische Bewegung ging daraufhin in den Untergrund. Das Ende kam dann während des Ersten Weltkriegs: ab 1915 kam es zu einer weitreichenden Deportation von Armeniern aus ihren bisherigen Wohngebieten. Als Grund dafür wurde benannt, dass Armenier die russische Armee unterstützten oder unterstützen könnten. Die deportierten Armenier wurden zum großen Teil in die syrische Wüste gebracht, wo viele von ihnen umgekommen sind. Der historische Streit wegen des Armeniermassakers kreist um zwei Fragen: Erstens um die Zahl der Opfer. Die türkische Seite erkennt an, dass es Opfer gegeben hat, und dass die Deportation nicht in allen Fällen gerechtfertigt war, aber sie gibt eine viel niedrigere Zahl an Opfern. Zweitens geht es darum, ob die damalige osmanische Regierung die Massaker angeordnet hat. Das wird von der türkischen Seite bestritten. 2.3 Reaktion auf zunehmende Schwäche der islamischen Länder Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts, für manche schon früher, wurde also ersichtlich, dass die Strategie der rückhaltlosen Europäisierung nicht zum Erfolg führen würde. Dies in mehrfacher Hinsicht. Zum einen blieb die militärische Schwäche des Osmanischen Reichs bestehen, ja sie verschlimmerte sich noch. Das hatte spätestens der osmanisch-russische Krieg von 1878 gezeigt, der die Russen kurz vor Istanbul sah. Auch die finanzielle Lage hatte sich keineswegs verbessert: 1875 hatte die osmanische Regierung den Staatsbankrott anmelden müssen. Trotz gewisser Erfolge auf den Weltmärkten für landwirtschaftliche Produkte war ein industrieller Aufschwung der islamischen Länder nicht in Sicht. Ähnliche Entwicklungen, vor allem in finanzieller Hinsicht, waren in Ägypten, später auch in Iran zu beobachten. Schließlich konnte man auch weltweit nicht übersehen, dass die europäischen Mächte nach Belieben muslimische Staaten ihren Kolonialreichen einverleiben konnten, und dass der antikoloniale Widerstand, wo es ihn gab, zu keinem militärisch nennenswerten Ergebnis führte. Ferner hatte die Liberalisierungspolitik zu Spannungen im Inneren geführt, die sich in bis dahin unbekannten blutigen Auseinandersetzungen zwischen religiösen Gruppen entluden. Die Balkanvölker waren auch durch weitgehende Zugeständnisse an ihre Autonomie nicht mehr bereit, im Staatsverband des Osmanischen Reiches zu bleiben. Dabei erntete das Osmanische Reich für die Gleichstellung von Christen und Muslimen keineswegs die 7 Anerkennung im Ausland, die es meinte verdient zu haben. Stattdessen hielt die europäische öffentliche Meinung dem Osmanischen Reich (und auch anderen islamischen Ländern) immer wieder vor, der Islam sei es, der sie an der Modernisierung hindere. Diese Position – der Islam sei insgesamt nicht modernefähig und sei daher das wesentliche Hindernis bei der Entwicklung der islamischen Länder auf Pfaden, die für Europa positiv sind – wird bis heute aufrecht erhalten (s.o.). Auf diese Position können Muslime, denen die Zukunft ihrer Länder am Herzen liegt, auf drei Weisen reagieren, wie mir scheint. Die vierte – nämlich die Position als solche zurückzuweisen und zu sagen, Religion, welche auch immer, habe mit Moderne im oben skizzierten Sinn rein gar nichts zu tun, ist im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert höchstens von isolierten Denkern vertreten worden. Erst heute scheint sie an Anhängern zu gewinnen. Erste Reaktion. Man sagt: Ja, es ist richtig – der Islam ist das größte Hindernis bei der Modernisierung. Also weg damit, so weit weg wie möglich! Man hat hier die Position der radikalen Verwestlicher, darunter einiger Tanzimat-Politiker und insbesondere einiger Vertreter der Jungtürken (dazu in der kommenden Stunde), bei denen diese Ablehnung des Islam, die durchaus auch offen und öffentlich vorgetragen wurde, eine mehr oder weniger gut feststellbare Grundlage gewesen ist. Zweite Reaktion. Man sagt: Ja, es ist richtig – der Islam ist ein Hindernis bei der Modernisierung. Aber das ist nicht der richtige Islam, sondern ein falsch verstandener. Wir werden uns also modernisieren, indem wir den Islam reformieren. Das ist auch möglich: Denn der Islam steht als solcher keineswegs im Widerspruch zu einer rationalen Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens, sondern kann ein wirksames Instrument bei der Einrichtung einer solchen rationalen gesellschaftlichen Ordnung sein. Dritte Reaktion. Man sagt: Ja, es ist mindestens teilweise richtig – der Islam ist ein Hindernis bei der Modernisierung, und es ist auch richtig, dass ein falsches Verständnis von Islam die Hauptursache für die Misere in den islamischen Ländern ist. Es handelt sich nämlich um eine geistig-religiöse Misere. Wir werden also den Islam reinigen, und wenn alle Muslime dem so gereinigten Islam folgen, wird es uns allen mit Gottes Hilfe besser gehen. Die zweite und die dritte Position werden uns im weiteren Verlauf beschäftigen. 3 Modernisierung ohne Verwestlichung: al-Afġānī Für die zweite Position sei Ǧamāl ad-dīn al-Afġānī benannt. Anders als sein Name zu sagen scheint und er selbst glauben machen wollte, stammte er nicht aus Afghanistan, sondern aus Iran (Asadābād/Iran 1839 – Istanbul 1897). Er war ein politischer Aktivist und Publizist, kein systematischer Denker. Sein vorrangiges Ziel scheint es gewesen zu sein, den britischen Einfluss in der islamischen Welt zu stoppen und zurückzudrängen (er hatte als 8 junger Mann einige Zeit in Indien gelebt). Dazu war ihm annähernd jedes Mittel recht, auch bei den Bündnispartnern war er nicht wählerisch; so hat er auch versucht, den britischrussischen Gegensatz für seine politischen Ziele auszunutzen. Er war auf Grund seiner politischen Aktivitäten oft zu einem Ortswechsel gezwungen. Die wichtigste Publikation, die er begründet hat, hieß al-ʿUrwa al-wuṯqā „Das feste Band“, in Anspielung auf koranische Ausdrücke. Die Zeitschrift erschien 1884 in Paris, sie hat es auf insgesamt 14 Ausgaben gebracht, was in Anbetracht der damaligen Verhältnisse nicht wenig ist (aber auch nicht besonders viel). In ihr warb al-Afġānī für europäische Tugenden, die er hinter dem Erfolg der europäischen Länder sah: Unternehmungsgeist, Aktivität, Rationalismus. Hierher gehören dann auch freiheitliche politische Institutionen und eine moderne, d.h. auch um Naturwissenschaften bemühte Bildung und Erziehung. Um Europa standhalten zu können, ja um daran denken zu können, europäische Länder zu besiegen, müssen die islamischen Länder von Europa lernen. Aber Europa sollte nicht einfach imitiert werden – diesen Fehler warf er den Regierungen des Osmanischen Reiches, Ägyptens und Irans vor, für welche alle er zu einem Zeitpunkt in seinem Leben tätig war oder tätig zu sein versuchte – sondern es galt, bei allem Lernen von Europa die Grundwerte des Islam nicht zu vergessen. Der Islam müsste aber, um den europäischen Tugenden nicht länger im Wege zu stehen, von Aberglauben und vielerlei alten Zöpfen befreit wserden, die sich in seiner Jahrhunderte langen Geschichte über den rationalen und durchaus mit Europa kompatiblen, konkurrenz- und zukunftsfähigen Kern des Islam gelegt hätten. Daher müssten die Basistexte des Islam neu gelesen und interpretiert werden, wobei rationale Methoden anzuwenden wären, die dann den rationalen Charakter des Islam auch herausarbeiten würden. Wieweit die politische Einheit des Islam bei al-Afġānī im Mittelpunkt des politischen Denkens und Handelns stand oder stehen sollte, scheint kontextabhängig gewesen zu sein. In Ländern mit starker muslimischer Mehrheit hat er offenbar auch islamische Mobilisierung befürwortet, dann konnte es auch so wirken, als sei er für ein Bündnis mit dem osmanischen Sultan auch mit dessen panislamistischem Programm einverstanden. In Ländern wie Indien aber, in denen die Muslime nur eine Minderheit stellten, war er eher für eine Mobilisierung im nationalen Rahmen, so dass dort die panislamistische Karte (einschließlich der Anerkennung Abdülhamids als Kalif) in den Hintergrund trat. Auf eine Formel gebracht war Afġānī für eine Modernisierung des Islam und der islamischen Länder ohne Verwestlichung. Das war für ihn deswegen möglich, weil der Islam in seinem Kern rational ist, eine Religion, in der nichts gegen das naturwissenschaftliche Weltbild spricht und auch nichts gegen solche Formen des Wirtschaftens, die auf individuelle Aktivität und auf Profitstreben ausgerichtet sind. 9 Der zweite wichtige Vertreter des Reformislam am Ende des 19. Jahrhunderts gehört nicht so eindeutig in diese Position „Reform und Modernisierung ohne Verwestlichung“, obwohl er ein Schüler und zeitweiliger Weggefährte Afġānīs gewesen ist. Die Rede ist von Muḥammad ʿAbduh (1849-1905). ʿAbduh hat fast sein ganzes Leben, abgesehen von Phasen des Exils und der Verbannung, in Ägypten verbracht. Er war Gelehrter und Publizist, später hat er wichtige Ämter bekleidet (was Afġānī nie gelang): Er wurde Obermufti von Ägypten und hat als solcher auch die Azhar-Universität tief beeinflusst. Gemeinsam mit al-Afġānī hat er die genannte Zeitschrift al-ʿUrwa al-wuṯqā herausgegeben (er war mit Afġānī zusammen aus Ägypten ausgewiesen worden und dann nach Paris gegangen). Besonders um die Reform des Bildungswesens (wohlgemerkt: des islamischen Bildungswesens) und auch des Gerichtswesens hat er sich bemüht. Zitat ʿAbduh Folgende Gedanken werden hier zusammengefasst. Erstens. In Lehre und Praxis des Islam haben sich im Laufe der Zeit Fehler breitgemacht. Diese Fehler werden als schädliche Neuerungen bezeichnet. Zweitens. Die Beseitigung dieser Fehler ist daher die zentrale Aufgabe. Drittens. Ist die Beseitigung der schädlichen Neuerungen gelungen, wird das Handeln der Muslime frei von Unordnung und Verworrenheit sein, d.h. sie werden zielgerichtet und in Übereinstimmung mit der wahren Lehre des Islam handeln können. Viertens. Die Besserung des Einzelnen durch Bildung („Erleuchtung durch die wahren religiösen und weltlichen Wissenschaften“) führt zur Besserung der Gemeinschaft der Gläubigen insgesamt. Die Frage ist dann natürlich sofort: Welches sind diese schädlichen Neuerungen, wie erkennt man sie? Dann ist es nicht mehr schwer, sie zu überwinden, die Mittel dazu stehen bereit: Studium der wahren weltlichen und religiösen Wissenschaften. Ist das Programm soweit umgesetzt, ist der Erfolg auch auf der materiellen (wirtschaftlichen und politischen) Seite, also den Lebensbedingungen der Muslime, eine Frage der Zeit. Die Position ʿAbduhs markiert so den Übergang zu der folgenden. Noch stärker als bei Afġānī wird die Modernisierung als ein Zurück zu den Basistexten gesehen, die neu zu lesen und rational zu interpretieren sind. Das Nebeneinander von religiösen und weltlichen Wissenschaften, das ja die modernen Naturwissenschaften explizit einschließt, ist dabei in etwa wie folgt zu gestalten: Bei nicht auflösbaren Widersprüchen zwischen Positionen der Basistexte, vor allem des Koran, und Erkenntnissen der modernen Wissenschaften sind die Basistexte dann symbolisch zu verstehen. Der Koran könne auf eine gewisse Weise den Naturwissenschaften nicht widersprechen, da Gott so verstanden zwei Bücher herabgesandt 10 habe, das eine geschaffen, nämlich die Schöpfung, und das andere ungeschaffen und geoffenbart, nämlich den Koran. Daher diene die Naturerkenntnis letztlich auch der Gotteserkenntnis. 4 Vorwärts zu den Altvorderen: Die arabische salafīya, Deoband 4.1 Rašīd Riḍā Die dritte Position, diejenige also, die den Ausweg allein im Islam sucht, ist diejenige der expliziten salafīya. Der Ausdruck salafīya kommt von ar. as-salaf aṣ-ṣāliḥ, „die frommen Altvorderen“, also den Muslimen jener Zeit, als der Islam, weil rein und unverfälscht, die Grundlage für die Stärke der Muslime bildete; gemeint ist die Zeit des Propheten und der Rechtgeleiteten Kalifen (etwa bis 661), also die erste Generation des Islam. Daher kann man sagen: Die salafīya wollen zurück, aber in Wirklichkeit vorwärts, zu den frommen Altvorderen. Sowohl Afġānī als auch ʿAbduh gelten als Wegbereiter der salafīya, aber nicht als ihre wirklichen Gründer. Der Hauptvertreter und eigentliche Gründer der Richtung ist vielmehr Rašīd Riḍā (18651935), ein Libanese, der aber in Ägypten Karriere gemacht hat. Er ist bekannt als Gründer und zunächst auch Herausgeber der Zeitschrift al-Manār („das Leuchtfeuer“ oder auch „das Minarett“), die seit 1898 erschien und bis 1935, also bis zum Tod Riḍās, am Markt blieb. Er selbst war einer der eifrigsten Autoren. Riḍā vollzog unter den islamischen Reformern die Hinwendung zu den Positionen der Wahhābīya, die er seit ihren neuerlichen Erfolgen im Ḥiǧāz (Gründung des Dritten saʿūdischen Staates bereits Anfang des 20. Jahrhunderts, 1924 Übernahme der Kontrolle über die Heiligen Städte) auch politisch unterstützte. Er hatte sich früh von allen getrennt, die im Osmanischen Reich noch eine Perspektive sahen, was für Afġānī und auch für ʿAbduh noch selbstverständlich gewesen war – hier ist man eben zwei Generationen weiter, und seit 1908 bestimmen die sehr dezidiert nicht religiösen Jungtürken die Geschicke des Reichs. Mit dieser Regierung wollte Riḍā nichts zu tun haben, vielmehr gehörte er zu denjenigen, die auch eine Brücke zum entstehenden arabischen Nationalismus schlagen (den Jungtürken wurde eine Turkisierungspolitik zu Lasten der Araber und des Arabischen vorgeworfen). Riḍā unterstützte daher auch den „arabischen Aufstand“ gegen die osmanische Herrschaft während des Ersten Weltkriegs (ab 1916). Die Salafīya insgesamt stehen für Reform des Islam und gleichzeitigen Widerstand gegen die Verwestlichung; diese Position teilen sie allerdings mit vielen anderen. Aber sie beziehen eine skeptische Haltung gegenüber allen Dingen die aus Europa kommen, weil sie aus Europa kommen. Anders als bei Afġānī und auch noch ʿAbduh hat sich nun eine generelle Europa-Skepsis breitgemacht. 11 Die Salafīya wendet sich mit ihrem Appell „Zurück zum reinen Islam der Altvorderen“ eben nicht einfach nach rückwärts. Sie haben vielmehr ein komplexes Programm zur Erneuerung des Islam, das besser als dasjenige der Wahhābīya geeignet ist, weite Verbreitung zu finden (heute ist der Unterschied nicht mehr sehr groß, und am Ende sind eine überwältigende Mehrheit der muslimischen Gelehrten heute in einer Tradition von salafitischen Gedanken, teilweise mit wahhabitischen Akzenten). Die Salafīya fordern insbesondere die „Öffnung des Tors des iǧtihād“. Unter iǧtihād versteht man die eigenständige Bemühung („Bemühung“ ist die Wortbedeutung) um Auffinden der richtigen Entscheidung in einer vorgelegten Frage, ohne dass man sich dabei auf eine Lehrautorität stützen müsste. Der Gegenbegriff ist taqlīd, was mit „Nachahmung“ übersetzt wird; jemand, der sich im taqlīd übt, geht in den Texten der Lehrautoritäten seiner Rechtsschule so lange auf die Suche nach der richtigen Lösung auf die vorgelegte Frage, bis er sie gefunden hat, sonst muss er passen. Ein Mann, der sich im iǧtihād übt, also ein muǧtahid, ist darauf nicht angewiesen. Er kann die Lösung der Frage aus den Basistexten selbst entwickeln. Das sind im radikalsten Fall nur der Koran und das Korpus der prophetischen Überlieferung ḥadīṯ bzw. sunna. Bei diesem Umgang mit den Basistexten sind gewisse Regeln anzuwenden, die auch mit Logik zu tun haben. In einem etwas weniger radikalen Fall werden gewisse Texte einer Rechtsschule beigezogen, dann ist der muǧtahid kein „absoluter muǧtahid“, sondern ein „muǧtahid in der Rechtsschule“; und es können noch weitere Einschränkungen vorgenommen werden. Aber in jedem Fall ist die eigenständige Bemühung um das Finden der richtigen Lösung das Kennzeichen. Mit der (Wieder-) Belebung des iǧtihād schuf die Salafīya eine völlig neue Situation im Umgang mit der islamischen Lehrtradition. Bislang war es so, dass die Gelehrten sich auf den Schultern ihrer Vorgänger sahen, die Rezeption der Basistexte erfolgte immer im Lichte dieser langen und sehr ausgefeilten Tradition, bis dahin, dass die Rezeption der Basistexte gegenüber dem Studium der späteren Kommentare und Kompendien in den Hintergrund trat. Nun wird diese Tradition übersprungen, zumindest teilweise, und der direkte Zugriff auf die Basistexte soll wieder die Regel sein. Zunächst wird dabei noch darauf geachtet, dass die Studierenden die Tradition zumindest kennen; das Überschreiten der Experten-Grenze bei der Interpretation der Basistexte ist später das Ergebnis der Tätigkeit gewisser Vertreter des politischen Islam. Gleichzeitig wendet sich die Salafīya genauso wie die Wahhābīya gegen die Sufi-ʿUlamāʾSynthese, die sich im Laufe der Zeit herausgebildet hatte. Darunter versteht man, dass Gelehrte an den Riten und Bräuchen des „volkstümlichen“ Islam teilnehmen und diesen dadurch eine zusätzliche Legitimation verschaffen. In den späteren Jahrhunderten des Osmanischen Reiches war es gang und gäbe, dass Gelehrte auch einer sufischen Bruderschaft angehörten, und dass diese Bruderschaften neben ihren mystischen Übungen 12 und den entsprechenden Zusammkünften auch an Riten und Feierlichkeiten maßgeblich beteiligt waren, die in früheren Zeiten nicht die Billigung von Gelehrten gefunden hätten, war in den Hintergrund geraten. Die Grabkomplexe bedeutender sufischer Meister oder anderer prominenter Gestalten aus der islamischen Geschichte waren ebenso zentrale Orte religiöser Praxis wie die großen Moscheen der osmanischen Städte. Diese Praktiken, dieses System lehnt die Salafīya ab, wobei sie nicht das gleiche Maß von Militanz entfaltet wie die Wahhābīya. Die Rückkehr zu den Basistexten bedeutet daneben, dass diese in ganz anderer Weise wörtlich genommen werden als bisher. Wenn sie durch den Filter einer Jahrhunderte langen Tradition geleitet werden, ist die jeweilige Interpretation immer schon bekannt, und auch die Abwägungen von eventuell widersprüchlich scheinenden Stellen sind geläufig. In einem so sehr auf der Lehrtradition beruhenden System kann es kaum Überraschungen geben. Das Wörtlich-Nehmen der Basistexte unterscheidet die Salafīya auch von den Modernisierern vom Schlage Afġānīs: Von symbolischen Bedeutungen ist nicht mehr die Rede. Mit dem Überspringen der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Lehrtradition wird auch das ganze System der feinen Abstimmung zwischen wissenschaftlicher, durchaus auch rationaler Systematisierung in den Bereichen Recht und Ritual beiseite geräumt, und es dauert wie gesagt nicht mehr allzu lange, bis sich Personen an die Interpretation der Basistexte machen, die dazu in früheren Zeiten nicht berechtigt gewesen wären. Iǧtihād gab es nach neueren Forschungen zu allen Zeiten, aber es war nie eine Tätigkeit, die für alle offen war. Das berühmte „Tor des iǧtihād“ war nie ganz geschlossen, aber es war natürlich geschlossen für die allermeisten Muslime, die sich eben an das halten mussten, was kompetente Leute als richtige Lösung und daher als richtiges Verhalten ermittelt hatten. Die Salafīya öffnet damit der freihändigen Interpretation der Basistexte durch Laien den Weg, der heute – in der „Neo-Salafīya“ in vielen Fällen gegangen wird. Die Freigabe der Interpretation für Laien bedeutet dabei nicht unbedingt und nicht immer eine Liberalisierung der Auslegungspraxis; ganz im Gegenteil, sie führt zu einer Konkurrenz, zu einem gegenseitigen sich Überbieten in Islamizität der rituellen Praxis, wobei diese Konkurrenz manchmal in einer recht begrenzten Anzahl von Feldern stattfindet. Die Freigabe der Interpretation bedeutet daher eine zunehmende Unterwerfung der interpretatorischen Praxis unter die jeweils verfolgten politischen Ziele. Die Salafīya, ebenso wie die anderen Reformbestrebungen in den Zentren der islamischen Welt im 19. Jahrhundert, steht mit den Bemühungen um Reinigung des islamischen Rituals und überhaupt der Islamisierung der gesellschaftlichen Praxis, wie sie als Antwort auf das Vordringen der europäischen Mächte vielerorts gefordert und angegangen wurde – das war ein wichtiger Aspekt bei der Betrachtung der antikolonialen Bewegungen aus der ersten 13 Hälfte des 19. Jahrhunderts – vielleicht in keinem unmittelbaren Zusammenhang. Aber es fällt auf, dass die Antworten der salafitischen Autoren wesentliche Punkte aus der Reformdebatte aufnehmen, die seit dem 18. Jahrhundert die islamische Welt durchzieht. Insbesondere das direkte Anknüpfen an der Praxis, an der Lehre und auch an der Person des Propheten Muḥammad ist keineswegs neu, sondern ist grundlegendes Element der sog. „Muḥammad-Pfade“, von denen es sowohl in der sufischen Bewegung als auch in reformorientierten Gelehrtenkreisen eine ganze Reihe gegeben hat. Ferner hatte schon das Beispiel der Wahhābīya gezeigt, dass auch in einer Situation, die nicht durch unmittelbare Konfrontation mit europäischem Vordringen gekennzeichnet ist, gewisse typische Reformideen Platz greifen; der Unterschied liegt oft hauptsächlich im Ausmaß der Militanz, welche die entsprechenden Strömungen an den Tag legen. Manche Reformbewegungen haben auch schon vor der Salafīya beansprucht, in den alten Texten die Antwort auf die Herausforderungen der Zeit gefunden zu haben. Annähernd gleichzeitig mit der Entwicklung der Salafīya in Ägypten (und den arabischen Ländern des Osmanischen Reiches) bildet sich in Indien in einer Lehrkontroverse diejenige Richtung heraus, die man die indische Wahhabīya genannt hat, obwohl es vermutlich keine direkte Beeinflussung gab. 4.2 Deoband Deoband ist eine kleine Stadt in der Nähe von Delhi, berühmt durch eine islamische Hochschule, die dort 1866 oder 1867 (die Angaben sind nicht ganz eindeutig) gegründet wurde. Diese Dār al-ʿulūm Dīwband genannte Einrichtung besteht bis heute und bezeichnet sich selbst (auf ihrer Website) als die zweitwichtigste islamisch-sunnitische Lehranstalt nach der Azhar-Universität in Kairo. Das ist möglicherweise nicht einmal übertrieben. Ihre Ausstrahlung reicht über Südasien weit hinaus, und schon der Umstand, dass es sich mit Sicherheit um die wichtigste Einrichtung dieser Art in Südasien handelt, macht sie erwähnenswert. Deoband steht im Rahmen der islamischen Erneuerungsbewegungen des 18. und 19. Jahrhunderts und somit in der Nachfolge von Šāh Walīallāh, der im 18. Jahrhundert als erster in Indien die für dies Jahrhundert insgesamt typischen „Reform“-Bewegungen angestoßen hat (ar. taǧdīd : „Erneuerung“ und iṣlāḥ „Korrektur“, dieser Begriff wird heute mit „Reform“ übersetzt, es ist aber im Grunde kein Fortschritts-Gedanke damit verbunden). Diese Reformbewegung greift in Indien wie auch sonst das bis dahin geübte Prinzip der „Nachahmung“ (taqlīd) an. Der in der vorigen Vorlesung genannte Anführer einer antikolonialen Bewegung, Saiyid Aḥmad Barelwī, der in den 1820er Jahren eine ǧihād-Bewegung ins Leben gerufen hatte, 14 hatte seit seiner Pilgerfahrt nach Mekka gute Beziehungen zur Wahhābīya; Deoband ist nicht die direkte Fortführung dieser Bewegung, aber in vielen Punkten hat Deoband Parallelen zur Lehre der Wahhābīya, auch wenn es vielleicht keinen direkten Einfluss gab. Deoband hat heute ca. 3000 Studierende, und der Campus wird aktiv ausgebaut. Die Absolventenstatistik zeigt klar ein überwiegend südasiatisches Profil, aber innerhalb des Subkontinents keine weitere Regionalisierung. Viele Studierende kamen und kommen aus Regionen, in denen Urdu nicht gesprochen wird. Die Schule wirkt also mit an der Etablierung von Urdu als der Hauptsprache der Muslime in Indien. Die Inhalte betonen die Überlieferungs-Wissenschaften (ar. manqūlāt). Das mag in einer Einrichtung, die sich von der „Nachahmung“ verabschiedet hat, überraschen. Aber gemeint ist ein besonderer Ansatz, wie man dem Vorbild des Propheten folgen kann: Man versucht, für jede Situation die passende Überlieferung vom Propheten (hadīṯ) zu finden. Das ist ein Ansatz, der sich in der Geschichte des islamischen Denkens mit dem Namen von Aḥmad b. Ḥanbal verbindet (gest. 855). Bekanntlich sind die arabischen Wahhābīya Nachfolger von Aḥmad b. Ḥanbal; in Indien ist dagegen die stärker auf juristische Systematik orientierte ḥanafitische Rechtsschule traditionell am weitesten verbreitet. Deoband steht für eine Annäherung an die ḥanbalitische Auffassung. Das Ergebnis der Reform à la Deoband ist also nicht eine Modernisierung des islamischen Denkens einschließlich der Rechtsfindung, sondern eine Skripturalisierung anderen Typs. Weitere Parallelen zu anderen „salafitischen“ Reformbewegungen ergeben sich in der kritischen Haltung gegenüber dem Schrein-Islam, auch wenn, was bei den Wahhābīya ausgesprochen selten ist, manche Deobandis auch in sufischen Bruderschaften organisiert sind. An den Schreinen soll das rituelle Gebet (ar. ṣalāt) nicht verrichtet werden, die Konzeption der Fürsprache für die einfachen Gläubigen durch die großen Verstorbenen (ar. šifāʿa) wird abgelehnt, das bezieht sich auch auf den Propheten, der ebenfalls keine Fürsprache üben kann. Die Militanz der Wahhābīya haben die Deobandis in ihrer Ablehnung des Schrein-Islams jedoch nicht, sie gehen also nicht so weit, Schreine zu zerstören. Es gibt ferner eine Reihe von Details, in denen Deobandis dem Vorbild des Propheten folgen, wie es in der Ḥadīṯ-Überlieferung erkennbar wird (z.B. die Möglichkeit für Witwen, wieder eine Ehe einzugehen, das war im indischen Kontext unüblich geworden – der Prophet hat auch Witwen geheiratet, das taten manche Deobandi-Gelehrte dann auch). Deoband steht somit auch für eine Externalisierung dessen, was „richtiges islamisches Leben“ ausmacht. Was Deoband als Bewegung insgesamt ausmacht, ist eine sehr weitgehender Schwerpunkt darin, dass sie eine Reihe von rituellen Praktiken und individuellen Verhaltensweisen ermutigen, die sich auf die gottesdienstlichen Handlungen, die Kleidung und alltägliches Verhalten beziehen. Manche sehen daher in Deoband einen 15 wichtigen Ursprung für die unter den Taliban zu trauriger Berühmtheit gelangte Auffassung vom Islam. 16