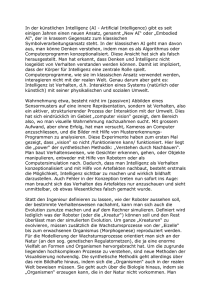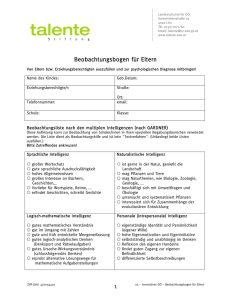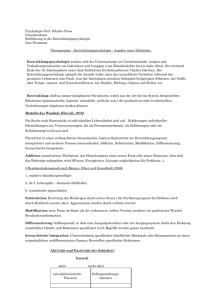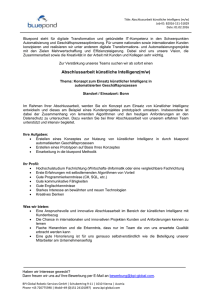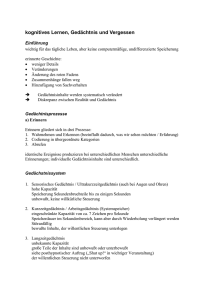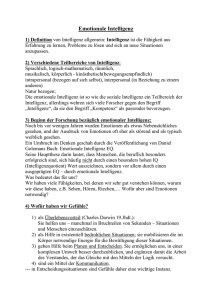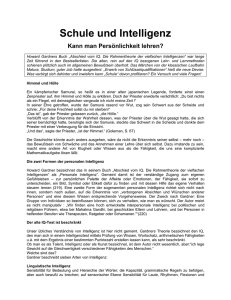II Differentielle - EWS
Werbung

DIFFERENTIELLE PSYCHOLOGIE I. KOGNITIVE BEDINGUNGEN DES LERNENS 1. Intelligenz 1.1. Begriffsdefinition: Es gibt keine allgemein anerkannte Definition von Intelligenz. Vielmehr handelt es sich bei Intelligenz um ein hypothetisches Konstrukt, das je nach zugrunde liegendem Modell unterschiedlich beschrieben wird. EDWIN BORINGS (1923) definiert den Begriff daher operational. Ihm zufolge ist Intelligenz das, was Intelligenztests messen. Eine solche Definition ist aufgrund des darin enthaltenen Zirkelschlusses natürlich unbefriedigend. Adäquater ist die Definition STERNBERG’S, der Intelligenz als die allgemeine Fähigkeit definiert, aus Erfahrungen zu lernen und sich neuen Umweltgegebenheiten anzupassen. Aus dieser Definition lassen sich verschiedene Merkmale von „Intelligenz“ ableiten. Das Verhalten an die Umwelt anzupassen, erfordert u.a. schlussfolgerndes Denken, Problemlösen, Wissen und eine effektive Informationsverarbeitung. „Intelligenz“ kann aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden: Der Informationsverarbeitungsansatz betrachtet v.a. die kognitiven Prozesse, die intelligentem Handeln zugrunde liegen. Der entwicklungspsychologische Ansatz, der auf PIAGET zurückgeht, untersucht die Entwicklung kognitiver Strukturen. Dem psychometrischen Ansatz geht es um die Messung von Intelligenz und die Erfassung von Leistungsunterschieden – weniger um die zugrunde liegenden kognitiven Prozesse. Im Folgenden soll es v.a. um die psychometrische Intelligenz gehen. 1.2. Klassische Intelligenzmodelle Die klassischen Intelligenzmodelle (z.B. Spearman, Thurstone etc.) beruhen überwiegend auf dem statistischen Verfahren der Faktorenanalyse. Dabei werden Variablen, die hoch miteinander korrelieren, zu übergeordneten Faktoren zusammengefasst. 1.2.1. Die Zwei-Faktoren-Theorie von Spearman (1904) Die Zwei-Faktorentheorie von Spearman ist das erste Intelligenzmodell, das auf dem statistischen Verfahren der Faktorenanalyse beruht. Aufgrund hoher Korrelationen zwischen verschiedenen Aufgabentypen geht SPEARMAN von einem Generalfaktor („g“) aus. Dieser Faktor fließt ihm zufolge in alle intellektuellen Leistungen mit ein; er lässt sich in eine verbal-schulische- und praktische Intelligenz unterteilen. Auf der untersten Ebene postuliert SPEARMAN verschiedene spezifische Faktoren bzw. Fähigkeiten („s“). Das Entscheidende an Spearmans Modell ist dessen hierarchische Gliederung. Der Generalfaktor „g“ ist mit der „allgemeinen Intelligenz“ einer Person gleichzusetzen; alle übrigen Faktoren hängen von diesem Faktor ab; die spezifischen Faktoren „s“ (in 1 die der Generalfaktor in unterschiedlichem Ausmaß einfließt) dienen der Aufklärung der Restvarianz. Mit Hilfe der spezifischen Faktoren können also die Leistungsunterschiede erklärt werden, die nicht auf den Generalfaktor zurückzuführen sind. 1.2.2. Das Primärfaktormodell von Thurstone (1938) THURSTONE geht davon aus, dass sich die menschliche Intelligenz aus 7 voneinander unabhängigen Primärfaktoren zusammensetzt. Statt wie SPEARMAN eine allgemeine Intelligenz zu postulieren, spricht er von sieben primären mentalen Fähigkeiten. 1) Verbales Verständnis (verbal comprehension) 2) Wortflüssigkeit (verbal fluency) 3) Schlussfolgerndes Denken (reasoning) 4) Räumliches Vorstellungsvermögen (spatial visualisation) 5) Merkfähigkeit; KZG (memory) 6) Rechenfähigkeit (number) 7) Wahrnehmungs- & Auffassungsgeschwindigkeit (perceptual seed) Je nach Aufgabentyp fließen die einzelnen Fähigkeiten in unterschiedlichem Ausmaß in die Leistung einer Person mit ein. Vorteil: Die intellektuelle Leistungsfähigkeit einer Person kann mit THURSTONES’S Modell wesentlich differenzierter beschrieben werden als mit dem Generalfaktormodell von Spearman. 1.2.3. Die Theorie der fluiden und kristallinen Intelligenz von Cattell (1957) CATELL greift das hierarchische Intelligenzmodell SPEARMAN’S auf, unterscheidet aber nicht zwischen schulisch-verbaler- und praktischer-, sondern zwischen kristalliner- („Gc“) und fluider Intelligenz („Gf“). Dabei handelt es sich um Faktoren „zweiter Ordnung“: sie sind voneinander unabhängig, basieren aber auf demselben Generalfaktor. Die fluide Intelligenz ist CATELL zufolge angeboren und unabhängig von persönlichen Lernerfahrungen. Sie bildet gewissermaßen die „Hardware“ und bestimmt v.a., wie schnell- und auf welche Weise eine Person Informationen verarbeitet. Kurz: Die fluide Intelligenz entspricht der Leistungsfähigkeit des neurophysiologischen Apparates; von ihr hängen die Basisprozesse der Informationsverarbeitung ab, u.a. die Wahrnehmungsgeschwindigkeit, die Gedächtnisspanne und elementare Denkprozesse. Testskalen zur fluiden Intelligenz beziehen sich u.a. auf die Gedächtnisspanne, die Fähigkeit zum induktiven Schließen und auf das Erkennen und Herstellen figuraler Beziehungen. Die kristalline Intelligenz ist im Gegensatz dazu die umweltbedingte Komponente der allgemeinen Intelligenz. Sie beruht auf persönlichen Lernerfahrungen und umfasst das deklarative- und prozedurale Wissen einer Person sowie deren sprachliche Fähigkeiten. Im Gegensatz zur fluiden Intelligenz, die ab einem gewissen Alter abnimmt, nimmt die kristalline Intelligenz kontinuierlich zu oder bleibt zumindest gleich. Testskalen, mit denen die kristalline Intelligenz erhoben wird, betreffen z.B. das verbale Verständnis. BALTES unterscheidet in Anlehnung an CATELL zwischen „Pragmatik“ (wissens- und kulturabhängig) und „Mechanik“ (Basisprozesse der Informationsverarbeitung, universell und inhaltsfrei) Ein Test, der auf diesem Modell aufbaut, ist der CFT (Culture Fair Test), ein sprachfreier Test, der sich auf die Messung der fluiden Intelligenz beschränkt. 2 1.2.4. Das Würfelmodell der Intelligenz von Guilford (1959) GUILFORD unterscheidet zwischen 3 Dimensionen, anhand derer er versucht, die menschliche Intelligenz zu strukturieren. Er differenziert zwischen Denkoperationen, Denkinhalten und Denkprodukten. Zu den von ihm genannten Denkoperationen gehören Erkenntnis, Gedächtnis, Bewertung, divergente Produktion und konvergente Produktion. Zu den Denkprodukten zählt GUILFORD z.B. Einheiten, Klassen, Systeme und Transformationen, bezüglich der Inhalte unterscheidet er u.a. zwischen semantischen, symbolischen und figuralen Inhalten. Aus der Kombination dieser 3 Dimensionen ergibt sich ein Würfel mit 120 Zellen, die laut GUILFORD jeweils als eigenständige Intelligenzfaktoren zu betrachten sind. Problematisch ist, dass das Modell nicht auf einer entsprechenden Faktorenanalyse beruht, sondern ausschließlich auf den logisch-intuitiven Überlegungen GUILFORD’S. GULIFORD ist der erste, der Kreativität (divergente Produktion) als eigenständige Komponente von Intelligenz thematisiert (s.u.) 1.3. Moderne Intelligenzkonzeptionen 1.3.1. Das Berliner Intelligenzstrukturmodell von Jäger (1984) Das Berliner Intelligenzstrukturmodell von JÄGER beschreibt Intelligenz als hierarchisch aufgebautes Konstrukt, wobei sich jede Intelligenzleistung bimodal aus einer operativen- und einer inhaltlichen Komponente zusammensetzt. Insgesamt werden 4 operative Fähigkeiten und 3 mögliche Inhalte unterschieden. Die operativen Fähigkeiten beziehen sich auf die allgemeinen kognitiven Prozesse, die zur Bearbeitung bestimmter Aufgaben notwendig sind. Unterschieden wird zwischen… 1) der Bearbeitungsgeschwindigkeit 2) der Merkfähigkeit 3) dem Einfallsreichtum 4) und der Verarbeitungskapazität Davon abzugrenzen sind die 3 inhaltsbezogenen Fähigkeitskomponenten. Unterschieden wird zwischen… 1) Sprachgebundenem Denken (verbaler Inhalt) 2) Zahlengebundenem Denken (numerischer Inhalt) 3) und anschauungsgebundenem Denken (figural-bildhafter Inhalt) Dem Modell nach lässt sich jede Intelligenzleistung als Kombination aus einer operativen und einer inhaltsgebundenen Komponente darstellen. Das Schreiben eines Gedichtes erfordert beispielsweise sowohl sprachliches Können (inhaltliche Komponente: V ) als auch Einfallsreichtum (operative Komponente: E) Aus der Kreuzung der inhaltlichen und operativen Komponenten ergeben sich 12 spezifische Teilfähigkeiten, die zusammen die „allgemeine Intelligenz“ einer Person bilden. Auf diesem Modell baut der Berliner Intelligenzstruktur-Test (BIS-Test) auf, der in 2 Versionen vorliegt (s.u.): BIS-4 (Berliner Intelligenzstrukturtest, Form 4): ab 15 BIS-HB (Berliner Intelligenzstrukturtest für Jugendliche) für Jugendliche zw. 12 und 16; besonders für die Begabungs- und Hochbegabungsdiagnostik geeignet. 3 1.3.2. Theorie der multiplen Intelligenzen von Gardner (1983) GARDNER postuliert 6 voneinander unabhängige „Intelligenzen“: 1) Sprachliche Intelligenz 2) Logisch-mathematische Intelligenz 3) Räumliche Intelligenz 4) Musikalische Intelligenz 5) Motorische Intelligenz 6) Personale Intelligenz (entspricht der emotionalen bzw. sozialen Intelligenz) Eine solche Unterscheidung ist nach GARDNER u.a. aufgrund der folgenden Kriterien legitim: Neuroanatomische Grundlage Die meisten der von ihm postulierten Intelligenzen lassen sich spezifischen Hirnregionen zuordnen. Außergewöhnliche Spezialbegabungen In den 6 Bereichen liegen jeweils außergewöhnliche Spezialbegabungen vor. Typischer Entwicklungsverlauf Evolutionsbiologische Grundlage Die meisten der von GARDNER postulierten Intelligenzen dient der Lösung eines spezifischen Adaptionsproblems Eigenständige geistige Operationen Experimentelle Prüfbarkeit 1.3.3. Das triarchische Intelligenzmodell von Sternberg (1985) STERNBERG unterscheidet zwischen analytischen-, kreativen- und praktischen Fähigkeiten. Leistungen in diesen Bereichen setzen sich wiederum aus 3 Komponenten zusammen, die STERNBERG als Subtheorien bezeichnet. 1) Die Komponentensubtheorie besagt, dass es 3 Komponenten gibt, die zur Informationsverarbeitung notwendig sind. Diese sind universell und umfassen… sog. „Metakomponenten“, die der Planung und Überwachung der kognitiven Prozesse dienen („Monitoring“), sog. „Performanzkomponenten“, die der Ausführung dienen (Kodierung), und Komponenten des Wissenserwerbs, die u.a. der Speicherung und Assimilation von Wissen dienen (LZG). 2) Die Zwei-Facetten-Subtheorie bezieht sich auf das Verhältnis von Erfahrung und Intelligenz. Sie enthält zum einen die Fähigkeit, mit Neuem umzugehen, zum anderen die Fähigkeit, Prozesse zu automatisieren. 3) Die Kontextsubtheorie besagt, dass die Intelligenz immer im kulturellen Kontext betrachtet werden muss. Sie umfasst die Komponenten, die im Zusammenhang mit der jeweiligen Umwelt stehen. Anpassung Selektion Umformung 4 1.4. Intelligenztests Ursprünglich bezeichnete der Intelligenzquotient (IQ) das Verhältnis des mentalen Alters zum Lebensalter. Da dieser Quotient bei Erwachsenen allerdings sinnlos ist, ist der IQ heute anders definiert: Er entspricht der an der jeweiligen Altersgruppe normierten Leistung in einem Intelligenztest. Durch die Normierung an der Altersgruppe ergibt sich eine Normalverteilung, so dass die Ergebnisse unterschiedlicher Intelligenztests miteinander verglichen werden können. Der Mittelwert dieser Normalverteilung ist dabei (willkürlich) auf 100 festgelegt; er entspricht der durchschnittlichen Intelligenz. Die Standardabweichung beträgt 15 IQ-Punkte. Werte, die mehr als eine Standardabweichung über- bzw. unter dem Mittelwert liegen, sind über- bzw. unterdurchschnittlich. IQ-Werte zw. 85 und 115 sind dagegen durchschnittlich. In diesem Bereich liegen ca. 68 % der Bevölkerung. Die meisten Intelligenztests erfassen sprachliches und rechnerisches Denken, Raumvorstellung und logisches Schlussfolgern. Der Vorteil von Intelligenztests: IQ- Tests sind ein weitgehend objektives-, validesund zeitökonomisches Messverfahren. Nachteile von Intelligenztests: Kulturabhängigkeit Was die verschiedenen Intelligenztests messen, hängt stark vom zugrunde liegenden Modell ab und ist daher immer nur ausschnitthaft. Geringe Korrelation zu komplexen Problemlösefähigkeiten (DÖRNER: Lohhausenproblem) Vernachlässigung der emotionalen bzw. sozialen Intelligenz Anstelle des Potentials (WYGOTSKY) wird lediglich der Status Quo gemessen Messfehler 1.4.1. Der Berliner Intelligenzstrukturtest Der BIS-Test baut auf dem Berliner Intelligenzstrukturmodell von JÄGER auf. Er besteht aus 45 Aufgabentypen, die sich auf die 12 Zellen der Matrix (Inhalt – Operationen) verteilen. Jede Aufgabe ist so konstruiert, dass sie jeweils eine operative- und eine Inhaltskomponente abbildet (Prinzip der Bimodalität). Eine Aufgabe, die anschauliches Denken und Einfallsreichtum erfordert, besteht z.B. darin, aus geometrischen Einzelfiguren möglichst viele zusammengesetzte Figuren zu bilden. 1.4.2. Der Hamburg-Wechsler-Intelligenztest Es gibt einen Hamburg-Wechsler-Intelligenztest für Erwachsene (HAWIE) und einen für Kinder (HAWIK). Ersterer umfasst 11 Skalen, letzterer 13. Die Struktur ist analog. Beide Tests teilen sich in einen Verbal- und einen Handlungsteil auf. Skalen, die zum Verbalteil zählen, sind z.B. „allgemeines Wissen“, „WortschatzTest“, „Rechnerisches Denken“, „Allgemeines Verständnis“, „Objekte finden“ Skalen, die zum Handlungsteil gehören, sind u.a. „Bilder ergänzen“, „Bilder ordnen“, „Figuren legen“ etc. Theoretisch stützt sich dieser Test am ehesten auf die Intelligenzmodelle von SPEARMAN und CATTELL. 5 1.5. Intelligenz und Schulleistung 1.5.0. Einleitung Seit es Intelligenztests gibt (BINET; 1905) spielt der Zusammenhang zwischen psychometrischer Intelligenz und Schulleistung in der Forschung eine große Rolle. Das liegt zum einen daran, dass „Intelligenz“ im Allgemeinen mit „Begabung“ gleichgesetzt wird; weshalb ihr eine grundlegendere Bedeutung zugemessen wird als schulischen Leistungen. Ein wichtiger Aspekt ist in diesem Zusammenhang das Problem der „Underachiever“ (s.u.). In umgekehrter Richtung wird die Schulleistung (Zensuren, Lehrerurteile) häufig als Außenkriterium herangezogen, um die Validität von Intelligenztests zu bestimmen. Die Validität eines Tests entspricht der Genauigkeit, mit der der Test das misst, was er messen soll. Aus historischer Perspektive muss hinzugefügt werden, dass die Intelligenzmessung in der Schuldiagnostik ihren Ursprung hat. Der erste Intelligenztest von BINET (1905) diente dazu, lernbehinderte Kinder zu ermitteln, um diese schulisch adäquat fördern zu können. 1.5.1. Begriffsklärung Zur Intelligenz: s.o. Schulleistung ist genau wie Intelligenz (s.o.) ein äußerst komplexes Konstrukt, das von einer Vielzahl von Faktoren abhängt und sich auf verschiedene Weise definieren lässt. KRAPP definiert Schulleistung allgemein als das Ergebnis von Lernprozessen, „die durch Unterrichtsmaßnahmen initiiert und /oder gesteuert wurden.“ Diese Definition impliziert zweierlei: 1) Erstens, sind Schulleistungen von außerschulischen Leistungen abzugrenzen. 2) Zweitens, muss zwischen der tatsächlichen Leistung eines Schülers und deren Bewertung bzw. Messung unterschieden werden. Mit dem zweiten Punkt ist das Problem angesprochen, dass Zensuren, aber auch vermeidlich objektive Schulleistungstests nicht fehlerfreibzw. nicht immer valide sind. Es handelt sich lediglich um Indikatoren (siehe: pädagogisch-psychologische Diagnostik). 1.5.2. Empirische Befunde A) Allgemeine Intelligenz Schulleistung Zum Zusammenhang zwischen Intelligenz und Schulleistung gibt es eine Vielzahl empirischer Befunde. Als Prädiktor wird dabei üblicherweise ein Intelligenztest verwendet; als Indikator für Schulleistung dienen Zensuren, Lehrerurteile oder entsprechende Schulleistungstests. Die Korrelationen, die man auf diese Weise erhält, liegen im Durchschnitt bei ca. 0.5 (mittelhoch). Das entspricht einer Varianzaufklärung von 25%. Obwohl dieser Zusammenhang nicht überwältigend hoch ist, gilt Intelligenz damit als einer der besten Prädiktoren für schulischen Erfolg. Weder motivationale-, noch emotionale Faktoren (s.u.) haben einen ähnlich hohen Erklärungswert. 6 Betrachtet man den Zusammenhang von Schulleistung und Intelligenz genauer, fällt Folgendes auf: 1) Die Zensuren in Hauptfächern korrelieren meist höher mit der allgemeinen Intelligenz als Leistungen in Nebenfächern. …vermutlich weil in den Hauptfächern höhere kognitive Anforderungen gestellt werden. 2) Am besten lässt sich im Allgemeinen die Mathematiknote vorhersagen. 3) Wenn die Schulleistung mit Tests (z.B. AST 4) erfasst wird, treten meistens höhere Korrelationen auf als wenn Zensuren als Kriterium dienen. …was vermutlich daran liegt, dass Schulleistungstests objektiver sind als Zensuren, die nicht zuletzt vom jew. Lehrer abhängen. Der immer wieder gefundene Zusammenhang zwischen Intelligenz und Schulleistung ist aus mehreren Gründen plausibel – und bedarf eigentlich kaum einer näheren Erläuterung: Intelligentere Schüler/innen können sich schneller auf neue Aufgaben einstellen, verfügen über effektivere Problemlösestrategien, erkennen leichter lösungsrelevante Regeln, verfügen über elaboriertere Gedächtnisstrategien und haben eine größere Verarbeitungskapazität. All das erleichtert schulisches Lernen. B) Schule Intelligenz Der Zusammenhang zwischen Schulleistung und Intelligenz ist keineswegs einseitig, sondern reziprok: Einerseits fördert Intelligenz die Schulleistung, andererseits wirkt sich schulisches Lernen positiv auf die Entwicklung der Intelligenz aus. CECI fasst in einer Meta-Analyse verschiedene Studien zusammen, die diesen Befund belegen. Beispielsweise haben Kinder, die ein Jahr später eingeschult wurden, durchschnittlich geringere Intelligenzquotienten als ihre Altersgenossen, die schon ein Jahr länger zur Schule gehen. Andere Befunde zeigen, dass die im Verlauf eines Schuljahres zu beobachtende Verbesserung der Intelligenzleistungen während der Sommerferien stagniert oder sogar leicht abfällt. Siehe auch: SCHOLASTIK-Studie! Fazit: Die Intelligenzentwicklung hängt nicht zuletzt von der Dauer und Qualität der Beschulung ab. Insofern ist Intelligenz nicht nur Voraussetzung, sondern auch eine Folge schulischen Lernens. Alles andere wäre auch ernüchternd. Schließlich gehört zu den Zielen schulischer Bildung nicht nur die Vermittlung fachspezifischen Wissens, sondern auch die Förderung allgemeiner intellektueller Fähigkeiten. 7 C) Fachspezifisches Vorwissen Schulleistung Intelligenz ist nicht die einzige kognitive Voraussetzung für schulischen Erfolg. In der neueren Forschung rückt neben der allgemeinen Intelligenz zunehmend das bereichsspezifische Vorwissen der Schüler in den Blick. Als Indikator für das Vorwissen dient dabei meist die jeweilige Note aus dem vorhergehenden Schuljahr. Nähere Auskunft über den Zusammenhang von Vorwissen, Intelligenz und Schulleistung gibt u.a. die Längsschnittstudie SCHOLASTIK (HELMKE & WEINERT). HELMKE & WEINERT zeigen anhand einer auf den Ergebnissen dieser Studie aufbauenden Pfadanalyse, dass der Einfluss der Intelligenz auf die Schulleistung bis zur 4. Klasse abnimmt, während bereichsspezifisches Vorwissen zunehmend wichtiger wird. Die Korrelation zw. Intelligenz und mathematischer Kompetenz sinkt von 0.3 in der 1. Klasse auf 0.14 in der 4. Klasse. Im selben Zeitraum steigt die Korrelation zwischen Vorwissen und mathematischer Kompetenz von .45 auf .63. Erklärung: Diese gegenläufige Entwicklung ist damit zu erklären, dass die prädiktive Bedeutung der Intelligenz umso größer ist, je unbekannter die Lerninhalte sind, d.h. je weniger Vorwissen vorhanden ist. Die Ergebnisse der SCHOLASTIK-Studie sind kongruent zu einer Vielzahl anderer Studien, die ebenfalls zeigen, dass fachspezifisches Vorwissen die Schulleistung besser vorhersagt als allgemeine Intelligenz. Als Beleg dafür gelten meist die durchgehend hohen Zusammenhänge zwischen Noten aus benachbarten Schulstufen, die durch die Auspartialisierung der Intelligenz nur unwesentlich verringert werden. Es gibt auch experimentelle Befunde, die zeigen, dass Intelligenzunterschiede durch bereichsspezifisches Vorwissen kompensiert werden können. SCHNEIDER: Fußballexperten SCHNEIDER prüfte in einem 2 × 2- Design den Einfluss von Vorwissen und Intelligenz auf das Textverständnis und die Behaltensleistung von Schülern. Zu diesem Zweck legte er Dritt-, Fünft- und Siebtklässler eine Fußballgeschichte vor, die sie anschließend reproduzieren sollten. Die Schüler wurden je nach Intelligenz und fußballerischem Vorwissen einer von 4 Versuchsgruppen zugeteilt. Ergebnis: Dabei zeigte sich für alle 3 Altersgruppen, dass die Fußballexperten unabhängig von ihrer allgemeinen Leistungsfähigkeit den Text immer besser erinnerten als ihre Mitschüler. 1.5.4. Die multiple Determiniertheit der Schulleistung Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Intelligenz eine wichtige, aber keineswegs die einzige Determinante von Schulleistung ist. Intelligenz beschreibt allenfalls ein Leistungspotenzial (Kompetenz Performanz). Ob dieses genutzt wird oder nicht, hängt u.a. von motivationalen und emotionalen Faktoren sowie den familiären, schulischen und sozio-kulturellen Rahmenbedingungen ab. Nur aufgrund der multiplen Determiniertheit der Schulleistung sind Under- und Overachievement (erwartungswidrige Schulleistungen) erklärbar. Bezüglich der verschiedenen Determinanten der Schulleistung gibt es eine Vielzahl verschiedener Modelle. Im Folgenden soll exemplarisch das Modell nach BLOOM dargestellt werden. 8 1.5.4.1. Bloom’s Modell des schulischen Lernens BLOOM zufolge hängt Schulleistung von 3 Bedingungsgruppen ab: 1) Qualität des Unterrichts Durch die Unterrichtsqualität können nach BLOOM ca. 25 % der Leistungsunterschiede erklärt werden. Entscheidend für die Unterrichtsqualität ist ihm zufolge die Art der Informationsdarbietung, adäquate Verstärkungen, Feedback und die aktive Beteiligung der Schüler. 2) Affektiv-motivationale Schülermerkmale Zu den affektiv-motivationalen Faktoren gehören u.a. das Fähigkeitsselbstkonzept, das Interesse, die Lernmotivation und die allgemeine Einstellung zur Schule. Nach BLOOM erklären die Faktoren weitere 25% der Leistungsvarianz. 3) Kognitive Schülermerkmale Den größten Einfluss auf die Schulleistung haben nach BLOOM kognitive Faktoren; dazu gehört neben der allgemeinen Intelligenz das bereichsspezifische Vorwissen der Schüler. Die kognitiven Voraussetzungen der Schüler erklären 50% der Leistungsunterschiede. 1.5.4.2. Weitere Determinanten der Schulleistung Andere Modelle unterscheiden oft zwischen individuellen-, schulischen-, und außerschulischen Determinanten der Schulleistung. Zu den individuellen Faktoren werden dabei wie in BLOOM’S Modell v.a. die kognitiven- und affektiv-motivationalen Merkmale des Lerners gezählt. Die schulischen- und außerschulischen Rahmenbedingungen beeinflussen die Schulleistung teilweise direkt, teilweise indirekt, insofern sie Einfluss auf die individuellen Merkmale des Lerners haben. Als die wichtigste außerschulische Einflussgröße gilt allgemein die Familie. a) Genetische Einflüsse - Die Intelligenz und Persönlichkeit des Lerners ist zu großen Teilen genetisch bedingt. b) Status- und Strukturvariablen - soziale Schichtzugehörigkeit (siehe: PISA) - Familienkonstellation (Anzahl der Geschwister, Scheidung etc.) - Berufstätigkeit c) Prozessmerkmale des Elternverhaltens - Elterliche Leistungserwartung - Stimulation und Instruktion (Hilfe bei den Hausaufgaben, familiäre Förderung und Unterstützung etc.) - Modellfunktion der Eltern Unter die schulischen Faktoren fallen primär die Unterrichtsqualität und – quantität. - Lehrermerkmale (subjektive Theorien) - Unterrichtsstil (autoritativ, direkt vs. demokratisch, offen etc.) - Klassenklima (Klassengröße etc.) 9 Entscheidend ist, dass zwischen den verschiedenen Determinanten Überlappungen und wechselseitige Abhängigkeiten bestehen. Insofern macht es kaum Sinn, einzelne Determinanten isoliert zu betrachten. Je höher z.B. die Unterrichtsqualität, desto weniger ist der Lernzuwachs von den kognitiven Voraussetzungen der Schüler abhängig. Schließlich zeichnet sich guter Unterricht u.a. dadurch aus, dass die Schüler möglichst individuell gefördert werden und Unterschiede im Vorwissen zu Beginn einer Unterrichtseinheit egalisiert werden (Wiederholung der Lerneinheiten, evtl. Vermittlung von Nachhilfe, Elternkontakt, zusätzliche Lernangebote etc.). Auch die kognitiven und affektiv-motivationalen Merkmale des Lerners interagieren miteinander. Sie stehen entweder im Verhältnis der Kopplung oder der Kompensation zueinander. Von Kopplung spricht man, wenn für einen bestimmten Effekt Mindestausprägungen verschiedener Variablen notwendig sind. Schwierige Aufgaben erfordern beispielsweise ein Mindestmaß an Intelligenz und Anstrengung. Leichtere Aufgaben können dagegen entweder mit Intelligenz oder Anstrengung gelöst werden. Mangelnde Anstrengung kann durch eine entsprechende Intelligenz-, geringe Intelligenz durch entsprechende Anstrengung kompensiert werden. Insbesondere die individuellen Determinanten der Schulleistung sind mit einer Vielzahl anderer Variablen konfundiert (s.o.). Die Intelligenz beispielsweise mit der familiären Herkunft, aber auch mit der Unterrichtsqualität (s.o.) 10 2. Begabung 2.1. Begriffsklärung Der Begriff „Begabung“ ist äußerst unscharf und wird in unterschiedlicher Bedeutung verwendet. Allgemein kann Begabung als angeborene Leistungsdisposition definiert werden. Allerdings sollte eine solche Definition nicht im Sinne eines genetischen Determinismus missverstanden werden. Nicht umsonst wird in der Literatur immer wieder betont, dass sich Begabungen (bzw. Fähigkeiten) erst in der aktiven Auseinandersetzung mit der Umwelt entwickeln und manifestieren. Im Folgenden sollen verschiedene Facetten des Begriffs „Begabung“ kurz angerissen werden: 1) Zunächst kann zwischen der allgemeinen Begabung einer Person und spezifischen Begabungen unterschieden werden. 2) Darüber hinaus ist es sinnvoll, zwischen intellektuellen und nichtintellektuellen Begabungen zu differenzieren. Zu den nicht-kognitiven Begabungen gehören z.B. die praktischhandwerkliche und die soziale Begabung einer Person. Zu den kognitiven Begabungen gehört nicht nur die Intelligenz, sondern seit GUILFORD auch Kreativität (=eigenständige Begabungskomponente). 3) Eine letzte wichtige Unterscheidung betrifft die Realisierung von Begabungen. Begabungen können-, müssen sich aber nicht in entsprechenden Leistungen niederschlagen. Man unterscheidet daher zwischen Kompetenz und Performanz. Die allgemeine Begabung einer Person wird meist mit deren allgemeiner Intelligenz gleichgesetzt. In diesem Sinne entspricht Begabung dem von SPEARMAN postulierten Generalfaktor „g“. Auch zur Erklärung von Spezialbegabungen (z.B. im Bereich Mathematik oder Musik) werden im Allgemeinen Intelligenzmodelle (z.B. GARDNER’S multiple Intelligenzen) herangezogen. FAZIT: Das Konstrukt „Begabung“ ist äußerst facettenreich. Es ist kaum zu operationalisieren und oft nur unscharf vom Konstrukt „Intelligenz“ abzugrenzen. Daher wird „Begabung“ oft auf „Hochbegabung“ eingegrenzt. 2.2. Hochbegabung Die gängige Definition von Hochbegabung richtet sich nach der Intelligenz. Danach sind Personen hochbegabt, wenn sie einen IQ größer als 130 haben; das entspricht einem Bevölkerungsanteil von 2%! Andere Definitionen gehen nicht vom IQ, sondern der erbrachten Leistung aus. Ihnen zufolge ist eine Person hochbegabt, wenn sie in einem spezifischen Bereich besondere Leistungen erbringt (Ex-post-facto-Definitionen). Nach STERNBERG kann eine Person als hochbegabt gelten, wenn sie eine zuverlässig und gültig nachweisbare Leistung erbringt, die in Relation zu einer geeigneten Bezugsgruppe exzellent, selten, produktiv und wertvoll ist. Mehrdimensionale Modelle von Begabung beziehen neben den kognitiven Fähigkeiten auch nicht-intellektuelle Faktoren wie Ausdauer und Anstrengungsbereitschaft in die Definition mit ein. Ein Beispiel für eine solche Konzeption ist das 3-Ringe-Modell von RENZULLI. 11 2.2. Multidimensionale Konzeptionen von Begabung 2.2.1. Renzulli’s Drei-Ringe-Modell der Begabung RENZULLI zufolge setzt sich Begabung aus folgenden 3 Komponenten zusammen: überdurchschnittliche Fähigkeiten (Intelligenz, Musikalität etc.), Kreativität und Aufgabenverpflichtung. Im Überschneidungsbereich dieser 3 „Ringe“ siedelt er Begabung an! Zu den überdurchschnittlichen Fähigkeiten gehört die allgemeine Intelligenz, aber auch spezifische Talente (z.B. soziale oder künstlerische Begabung). Unter Aufgabenverpflichtung versteht Renzulli eine leistungsorientierte Arbeitshaltung; damit erweitert er den Begabungsbegriff um eine motivationale Komponente. Für ihn ist Leistung ein konstitutives Merkmal von Begabung! Eine Unterscheidung zwischen Kompetenz und Performanz trifft er nicht. 2.2.2. Münchner Modell der Hochbegabung von Heller Ein differenzierteres Modell als das von RENZULLI ist das Münchner Modell der Hochbegabung von HELLER. Das Modell unterscheidet zwischen Fähigkeitsfaktoren (z.B. Intelligenz, Kreativität, soziale Kompetenz etc.) und Leistungsbereichen. Ob die vorhandenen Fähigkeiten umgesetzt werden und sich in entsprechenden Leistungen niederschlagen, hängt von nicht-kognitiven Persönlichkeitsmerkmalen und Umweltfaktoren ab. Zu den nicht-kognitiven Persönlichkeitsmerkmalen gehören u.a. die Leistungsmotivation, Kontrollüberzeugungen, Lernstrategien und das Ausmaß an Angst. Zu den Umweltfaktoren zählt HELLER den familiären Hintergrund, das Klassenklima, die Qualität der Instruktion, kritische Lebensereignisse etc. Die „Münchener Testbatterie für Hochbegabung“ - ein Test, der auf diesem Modell aufbaut - ist in Arbeit. KRITIK: ROST kritisiert an mehrdimensionalen Modellen, dass es sich um Leistungs- und nicht um Begabungsmodelle handle (hochbegabte Underachiever?!); außerdem ist er dagegen, unscharfe Konstrukte wie „Kreativität“ in den Begabungsbegriff mit einzubeziehen. Er empfiehlt stattdessen eine Beschränkung auf die Intelligenz. 2.2.3. Sonstiges Identifikation und Diagnostik: Hochbegabung wird überwiegend anhand von Tests (Intelligenztests, Kreativitätstests, Schulleistungstests etc.) festgestellt. Eltern-, Lehrerund Peerurteile haben sich als wenig valide erwiesen. V.a. hochbegabte Underachiever werden ohne entsprechende Testungen kaum erkannt. Klassische Untersuchungen: Die berühmte Längsschnittstudie von TERMAN widerlegt gängige Vorurteile gegenüber Hochbegabten. Die wenigsten Hochbegabten sind sozial zurückgezogen und unangepasst. Im Gegenteil, Hochbegabung geht meist mit hoher sozialer Kompetenz einher. Durch die Münchner- und Marburger Hochbegabtenstudien werden diese Befunde bestätigt. Schulische Förderung von Hochbegabten: „Differenzierungsmaßnahmen“: Zusatzaufgaben, weniger klare Vorgaben, Tutorfunktionen für schwächere Klassenkameraden, außerschulische Förderung (Wettbewerbe, Kinderuni etc.), Auslandsaufenthalte „Segregationsmaßnahmen“: vorzeitige Einschulung, Klassenüberspringen, Spezialschulen etc. (Problem: „Big-Fish-Little-Pond-Effekt“) 12 2.4. Kreativität 2.4.1. Begriffsklärung Eine eindeutige Definition von „Kreativität“ gibt es nicht. Dem Wortsinn nach bezeichnet Kreativität die Fähigkeit zu schöpferischem Denken und Handeln (lat. „creare“). In die Psychologie eingeführt wurde das Konstrukt von GUILFORD (s.o.). Ihm zufolge ist Kreativität eine konstitutive Komponente von Intelligenz. Dementsprechend beschreibt er „Kreativität“ als kognitiven Faktor; er unterscheidet in seinem Intelligenzmodell zwischen konvergenter und divergenter Produktion. Während konvergentes Denken auf eine schnelle und effiziente Problemlösung abzielt, bezeichnet divergentes bzw. kreatives Denken die Fähigkeit, verschiedene und ungewöhnliche Lösungen zu generieren. Nach GUILFORD zeichnet sich das Konstrukt „Kreativität“ durch 4 Merkmale aus: 1) Sensitivität gegenüber Problemen Insofern erfordert Kreativität nicht zuletzt Vorwissen bzw. Expertise. 2) Flüssigkeit des Denkens Die Leichtigkeit, Ideen und Assoziationen zu generieren. 3) Flexibilität Fähigkeit zum Perspektivwechsel, Wechsel von Bezugssystemen etc. 4) Originalität Kreative Produkte sind neu und selten! Bezüglich der Wechselwirkung von Kreativität und Intelligenz gibt es verschiedene Modelle. Nach dem Summationsmodell kann Kreativität Intelligenzdefizite z.T. ausgleichen (eine Erklärung für Overachievement) Nach dem Schwellenmodell ist ein bestimmter IQ für Kreativität unentbehrlich. Ist dieser Schwellenwert überschritten, spielt der IQ allerdings keine Rolle mehr das Ausmaß der Kreativität. Demgegenüber geht das Kapazitätsmodell davon aus, dass das Intelligenzniveau eine Obergrenze für die Kreativität festlegt. Dem Kanalmodell zufolge dient Intelligenz dem Sammeln und Speichern von Informationen, während Kreativität die Verarbeitung dieser Infos zu etwas Neuem beinhaltet. Der kreative Prozess kann in 4 Phasen unterteilt werden: 1) Vorbereitungsphase: In der Vorbereitungsphase wird ein Problem erkannt; erfordert Offenheit, Vorwissen und Sensitivität. 2) Inkubationsphase: die Zeit vor der dem Finden der Lösung; häufig: vorübergehende Abwendung vom Problem (siehe: Päd Psy: Kap. 6.4.) 3) Inspiration/Einsicht/Illumination: Aha-Erlebnis, im Zuge dessen die Lösung plötzlich gefunden wird. 4) Verifizierung: Beinhaltet die Ausarbeitung, Evaluation und Umsetzung der Lösungsidee Es gibt mittlerweile eine Vielzahl von Kreativitätstests, deren Validität und Reliabilität allerdings vielfach angezweifelt wird. Im Gegensatz zu Intelligenztests gibt es in Kreativitätstests nicht eine richtige, sondern mehrere gute und weniger gute Lösungen. Bewertet wird weniger die Richtigkeit der Antworten, als vielmehr deren Anzahl und statistische Seltenheit. Z.B.: „Torrance Tests of Creative Thinking“(TTCT von TORRANCE). 13 2.4.2. Kreativitätshemmende Faktoren Vielfach wird behauptet, dass die Institution Schule Kreativität eher behindert, anstatt sie zu fördern. Dabei werden u.a. folgende Kritikpunkte genannt. In schulischen Lernsituationen besteht ein hoher Konformitätsdruck (Mitschüler, Lehrer) Gefördert werden überwiegend konventionelle Lösungen (das, was der Lehrer hören will) Permanente Beurteilung Schulisches Lernen zeichnet sich meist durch eine strikte Erfolgsorientierung und eine überwiegend extrinsische Motivation aus. Vielen Autoren zufolge sind kreative Prozesse aber gerade dadurch gekennzeichnet, dass sie intrinsisch motiviert sind. Die bürokratische Organisation des Unterrichts (festgelegte Stundendauer, Zeitdruck, Lehrplan etc.) verhindern Flexibilität. Arbeit-Spiel-Dichotomie 2.4.3. Kreativitätsförderung Lehrer sollten die Probleme nicht immer vorgeben, sondern sie von den Schülern selbst finden und formulieren lassen. Der Lehrer als „Anreger“ und nicht als „Alleswissender“ Nicht von optimalen Lösungen ausgehen, sondern den Schüler verschiedene Lösungswege ausprobieren lassen (entdeckendes Lernen). Kreative bzw. neue und seltene Lösungen loben; kreative Prozesse positiv verstärken! Inschutznahme kreativer Kinder Vermeidung von Leistungsangst Förderung der intrinsischen Motivation (Interesse etc.) Kreative Aufgaben stellen, die Querdenken und Phantasie erfordern (z.B. kreatives Schreiben) Den Schülern kreativitätsfördernde Methoden beibringen Brainstorming: Sammeln von Lösungsvorschlägen in der Gruppe (Wichtig: die verschiedenen Lösungsvorschläge dürfen während des Brainstormings nicht bewertet werden; die Durchführbarkeit der Vorschläge spielt in der Sammelphase eine untergeordnete Rolle) Methode 635: eine Art schriftliches Brainstorming, bei dem negative Gruppenprozesse ausgeschaltet werden; jeder von 6 Personen schreibt 3 Lösungsvorschläge auf einen Zettel (5 Minuten Zeit) und gibt den Zettel an seinen Nachbarn weiter, der 3 weitere Vorschläge notiert. Der Vorgang wird solange wiederholt (6 Mal), bis jeder Teilnehmer auf jeden Zettel 3 Vorschläge notiert hat. Morphologischer Kasten: Das zu lösende Problem wird in seine Problembestandteile zerlegt, für die dann jeweils einzeln Lösungen gesucht werden. 14 II. MOTIVATIONALE BEDINGUNGEN DES LERNENS 1. Motivation 1.1. Begriffsklärung Allgemein versteht man unter „Motivation“ Prozesse, die zielgerichtetes Verhalten auslösen und aufrechterhalten. Dementsprechend bestimmt unsere Motivation Richtung, Dauer und Intensität unseres Verhaltens. Da unser Verhalten allerdings nicht immer mit unseren Absichten bzw. Zielen übereinstimmt, ist es sinnvoll, zwischen dem Setzen von Zielen und deren Umsetzung zu unterscheiden. KUHL differenziert dementsprechend zwischen „Selektionsmotivation“ (Zielauswahl) und „Realisationsmotivation“ (Zielumsetzung); HECKHAUSEN & GOLLWITZER zwischen Motivation und Volition (s.u.). Motivation vs. Motiv: Zu unterscheiden ist ferner zwischen Motivation und Motiv. Motive sind überdauernde Dispositionen (z.B. Machtmotiv, Leistungsmotiv etc.). Als solche können sie mit entsprechenden Fragebögen oder projektiven Tests (TAT) empirisch erfasst werden. Demgegenüber bezeichnet Motivation bzw. Motiviertheit den aktuellen Zustand einer Person. Die Motivation ist situationsabhängig. Sie ergibt sich aus den überdauernden Motiven einer Person und den potenziellen Anreizen der jeweiligen Situation. Intrinsische vs. extrinsische Motivation: Je nachdem, ob der Anreiz für eine Handlung in dieser selbst oder in deren Folgen begründet liegt, spricht man von intrinsischer- oder extrinsischer Motivation. Eine Handlung ist extrinsisch motiviert, wenn sie wegen ihrer Folgen angestrebt wird (=> instrumentelle Handlungen). Wenn sie um ihrer selbst willen- oder aus Interesse an einem Gegenstand ausgeführt wird, ist sie dagegen intrinsisch motiviert. 2. Lernmotivation 2.1. Lernmotivation allgemein Definition: HECKHAUSEN definiert Lernmotivation als die momentane Bereitschaft eines Individuums, seine sensorischen, kognitiven und motorischen Funktionen auf die Erreichung eines Lernziels zu richten und entsprechend zu koordinieren. Kurz: Lernmotivation ist die Absicht bzw. Bereitschaft, bestimmte Inhalte oder Fähigkeiten zu erlernen; sie umfasst Prozesse, die der Initiierung und Aufrechterhaltung von Lernaktivitäten dienen. 2.1.1. Lernmotivation nach Pekrun Nach PEKRUN umfasst schulische Lernmotivation folgende Komponenten: 1) Intrinsische Motivation (Interesse und Lernfreude) 2) Kompetenzmotivation (Kompetenz und Selbstdiagnose) 3) Leistungsmotivation (Streben nach Erfolg / Vermeidung von Misserfolg) 4) Soziale Motivation (Bedürfnis nach positiver Zustimmung von Eltern, Lehrern und Mitschülern) 15 2.1.2. Lernmotivation nach Heckhausen Auch HECKHAUSEN zufolge setzt sich die Lernmotivation aus verschiedenen Komponenten zusammen; dabei unterscheidet HECKHAUSEN zwischen intrinsischen und extrinsischen Anteilen: Zu den intrinsischen Komponenten der Lernmotivation gehören die Leistungsmotivation (LM × E × Ae), der Neuigkeitsgehalt einer Aufgabe (N) und deren sachspezifischen Anreize (sA). Letztere entsprechen den Interessen des Lerners. Zu den extrinsischen Komponenten gehören das Bedürfnis nach Identifikation (bId), das Bedürfnis nach Zustimmung (bZust), das Bedürfnis nach Abhängigkeit (bAbh), das Bedürfnis nach Geltung und Anerkennung (bGelt) und das Bedürfnis nach Strafvermeidung (bStrafv). 1) Leistungsmotivation (LM × E × Ae): Die Leistungsmotivation einer Person ergibt sich aus deren Leistungsmotiv und situativen Bedingungen. Das Leistungsmotiv (LM) entspricht dem generellen Bedürfnis, Leistung zu erbringen bzw. Erfolge zu erzielen und Misserfolge zu vermeiden. Was dabei als Erfolg bzw. Misserfolg gewertet wird, hängt von den subjektiven Gütemaßstäben der Person ab. Die Ausprägung des Leistungsmotivs wird durch die Hoffnung auf Erfolg und die Furcht vor Misserfolg bestimmt. Die situativen Faktoren, die das Leistungsmotiv einer Person moderieren, sind a) die potenzielle Erreichbarkeit (E) des Leistungsziels und b) der Anreiz des Ziels bzw. der Aufgabe (Ae); beide Größen hängen von der Aufgabenschwierigkeit ab und verhalten sich komplementär zueinander. Je schwieriger eine Aufgabe ist, desto geringer ist zwar die Erfolgswahrscheinlichkeit (E), dafür steigt aber deren Anreiz bzw. Wert. 2) Neuigkeitsgehalt einer Aufgabe(N) Am motivierendsten sind Aufgaben mittlerer Neuigkeit (s.u.: Neugier). 3) Sachbereichsspezifische Anreize (sA) Sachbereichsspezifische Anreize hängen nicht von der Aufgabenschwierigkeit, sondern von den Interessen des Lerners ab (s.u.). 4) Das Bedürfnis nach Identifikation mit dem Erwachsenenvorbild (bId) 5) Das Bedürfnis, Zustimmung zu erhalten (bZust) Positive Rückmeldung 6) Das Bedürfnis nach Abhängigkeit vom Erwachsenenvorbild (bAbh) 7) Das Bedürfnis nach Strafvermeidung (bStrafv) Ausgehend von diesen Bedingungsfaktoren stellt HECKHAUSEN folgende Gleichung auf: Lernmotivation = [(LM × E × Ae) + sA + N] + [bId + bZust + bAbh + bGelt + bStrafv] Intrinsische Komponenten extrinsische Komponenten Sowohl die Persönlichkeitsmerkmale des Lerners (Leistungsmotiv und Interesse), als auch die situativen Faktoren, die in die Lernmotivation einfließen, können – zumindest z.T. – vom Lehrer beeinflusst werden. Allerdings ist dabei immer auf ATI-Effekte (Aptitude-Treatment-Interaktion) zu achten. Nicht alle Schüler können auf die gleiche Weise motiviert werden. Konkrete Maßnahmen zur Motivationsförderung müssen sich immer an den individuellen Vorsaussetzungen der jeweiligen Schüler orientieren. 16 3. Ausgewählte Komponenten der Lernmotivation 3.1. Leistungsmotivation 3.1.1. Das Risikowahl-Modell von Atkinson Erwartungs-x-Wert-Theorien sind kognitive Theorien: Sie gehen davon aus, dass unsere Motivation bzw. unser Verhalten von kognitiven Prozessen bestimmt wird. Ob bzw. wie wir handeln, hängt davon ab, welchen Wert wir dem jeweiligen Handlungsziel beimessen (Wert) und für wie wahrscheinlich wir es halten, dieses Ziel zu erreichen (Erwartung). Ein prominenter Vertreter dieser Theorie ist ATKINSON, der den Grundgedanken dieser Theorie auf die Leistungsmotivation überträgt. Wie LEWIN betrachtet ATKINSON dabei eine Leistungssituation als AnnäherungsVermeidungs-Konflikt: Auf der einen Seite steht die Tendenz, sich einer Leistungssituation in der Hoffung auf Erfolg zu stellen (Te) – auf der anderen Seite besteht die Tendenz, Leistungssituationen aus Furcht vor Misserfolg zu meiden (Tm). Wie stark diese Tendenzen jeweils sind, hängt nach Atkinson von 3 Komponenten ab: 1) Dem Anreiz der Aufgabe (Wert) 2) Der Wahrscheinlichkeit auf Erfolg bzw. Misserfolg (Erwartung) 3) Dem Erfolgs- bzw. Misserfolgsmotiv der jew. Person (Persönlichkeitsvariable) Zu 1: Der Anreiz der Aufgabe hängt von deren Schwierigkeitsgrad ab. Der Erfolgsanreiz (Ae) einer Aufgabe ist umso größer, je geringer die Erfolgserwartung. Schließlich ist man stolzer darauf, eine schwierige Aufgabe zu lösen als eine leichte. Ae = 1 – We Der Misserfolgsanreiz (Am) dagegen steigt mit der Erfolgserwartung. Je leichter eine Aufgabe ist, desto eher schämt man sich für einen Misserfolg. Am = 1 – Wm Zu 3: Das Erfolgs- und Misserfolgsmotiv (Me und Mm) sind laut Atkinson von der Situation unabhängige Persönlichkeitsvariablen (messbar mit dem Thematischen Apperzeptionstest, kurz: TAT). Die Annahme stabiler Persönlichkeitsvariablen ermöglicht die Erklärung interindividueller Unterschiede. Die Tendenz, einen Erfolg anzustreben (Te), ergibt sich aus der multiplikativen Verknüpfung des Erfolgsmotivs (Me), der Erfolgserwartung (We) und dem Anreiz von Erfolg (Ae). Die Tendenz, einen Misserfolg zu vermeiden (Tm), ist dementsprechend das Produkt aus Misserfolgsmotiv (Mm), Misserfolgserwartung (Wm) und Misserfolgsanreiz (Am). Te = Me x We x Ae Tm = Mm x Wm x Am Daraus ergibt sich als resultierende Tendenz: Tr = Te – Tm Schlussfolgerungen und Hypothesen: Wenn das Misserfolgsmotiv einer Person größer ist als deren Leistungs- bzw. Erfolgsmotiv sollten Leistungssituationen, sofern keine extrinsischen Motive vorliegen, grundsätzlich gemieden werden; im umgekehrten Fall sollten sie aufgesucht werden. In der Schule ist die völlige Vermeidung von Leistungssituationen allerdings nicht möglich; Unterschiede im Leistungsmotiv äußern sich daher v.a. in der Anspruchsniveausetzung. 17 Wenn das Misserfolgsmotiv überwiegt, sind Aufgaben mittlerer Schwierigkeit mit der größten Vermeidungstendenz verbunden; es sollten eher leichte (geringe Misserfolgserwartung) oder schwere (geringer Misserfolgsanreiz) Aufgaben gewählt werden. Umgekehrtes gilt für ein stärker ausgeprägtes Erfolgsmotiv; hier sollten überwiegend Aufgaben mittlerer Schwierigkeit gewählt werden, da in diesem Fall das Produkt aus Erfahrung und Wert am größten ist (0,5 × 0,5 = 0,25). Empirische Überprüfung: Aufgabenwahl (ATKINSON): Bei einer Ringwurfaufgabe, bei der der Abstand zum Ziel frei gewählt werden konnte, wählten Vpn mit hohem Erfolgsmotiv (TAT) tatsächlich überwiegend Aufgaben mittlerer Schwierigkeit (=> realistische Zielsetzung). Für Vpn mit hohem Misserfolgsmotiv konnte die Ausgangshypothese allerdings nicht bestätigt werden. Sie wählten alle Aufgabenschwierigkeiten in etwa gleich oft und zeigten keine eindeutigen Wahlpräferenzen. Anspruchsniveau-Setzung (MOULTON): Bei Vpn mit hohem Erfolgsmotiv zeigt sich eine typische Anspruchsniveausetzung (nach Erfolg Erhöhung -; nach Misserfolg Senkung des Anspruchsniveaus) Vpn mit hohem Misserfolgsmotiv wählen gleichermaßen typische- und atypische AN-Setzungen (nach Erfolg Senkung -, nach Misserfolg Erhöhung des Anspruchsniveaus). Anstrengung und Ausdauer (FEATHER): Wird eine Aufgabe von vornherein als schwierig deklariert, wenden sich erfolgsorientierte Vpn nach mehreren (fingierten) Misserfolgsrückmeldungen meistens einer anderen Aufgabe zu. Wird die Aufgabe dagegen als einfach deklariert, bleibt die Mehrzahl der erfolgsorientierten Vpn trotz Misserfolgsrückmeldungen bei der Sache (=> sinnvolle Einteilung der Energie). Bei misserfolgsorientierten Vpn ist es umgekehrt (=> kein effizienter Einsatz der eigenen Energie): Setzt man die Richtung der Leistungsmotivation [Hoffnung auf Erfolg (Te) – Furcht vor Misserfolg (Tm)] zur Gesamtmotivation [Hoffnung auf Erfolg (Te) + Furcht vor Misserfolg (Tm)] in Beziehung, lassen sich 4 Ausprägungen des Leistungsmotivs unterscheiden. 1) Die Gruppe der hoch- und misserfolgsmotivierten Schüler ist dabei am problematischsten. Sie zeichnet sich durch deutlich überhöhte Zielsetzungen und massive Versagensängste aus. Pädagogische Maßnahmen: Förderung realistischer Zielsetzungen (Kleine, machbare Lernziele vorgeben); positive Verstärkung und Wertschätzung 2) Niedrig- und misserfolgsmotivierte Schüler: Resignation u. Passivität 3) Hoch- und erfolgsmotiviert Schüler: Risikofreude und Einsatzbereitschaft 4) Niedrig- und erfolgsmotivierte Schüler: wenig Eigeninitiative, stark vom Lehrer abhängig 18 3.1.2. Weiner’s Attributionstheorie Das Risikowahlmodell von ATKINSON kann zwar viele, aber nicht alle Fragen zur Leistungsmotivation beantworten. Offen bleibt v.a., wie die beiden subjektiven Größen „Erwartung“ und „Wert“ zustande kommen und wodurch das überdauernde Leistungsmotiv einer Person im Einzelnen gekennzeichnet ist. WEINER zufolge hängen Erfahrung, Wert und Leistungsmotiv v.a. davon ab, wie die betreffende Person Erfolg und Misserfolg attribuiert. Ihm zufolge gibt es 4 Möglichkeiten, Erfolg bzw. Misserfolg zu attribuieren. Er unterscheidet dabei zwischen der Lokationsdimension („internal vs. external“) und der Stabilitätsdimension („zeitstabil vs. zeitinstabil“). Zeitstabilität stabil variabel Lokation in der Person (internal) in der Umwelt (external) Fähigkeit Aufgabenschwierigkeit Anstrengung Zufall (Glück/Pech) Von der Art der Attribution hängt sowohl die emotionale Reaktion auf Erfolg und Misserfolg ab, als auch die Motivation für zukünftiges Handeln. Die Zeitstabilität beeinflusst die Erfolgserwartung. Wer Misserfolg auf zeitstabile Faktoren, wie geringe Fähigkeit oder die Aufgabenschwierigkeit, zurückführt, hat eine geringere Erfolgserwartung, als jemand, der von zeitvariablen Ursachen (geringe Anstrengung oder Pech) ausgeht. Der Wert bzw. Anreiz eines Erfolgs oder Misserfolgs hängt v.a. von der Lokation der Ursache ab. Macht man Umweltfaktoren verantwortlich, haben Leistungsresultate weniger Auswirkungen auf die Selbstbewertung, als wenn man sich selbst verantwortlich macht. Bezüglich der Selbstbewertung gilt dabei allgemein, dass die emotionale Reaktion am ausgeprägtesten ist, wenn man Leistungen auf die eigene Fähigkeit attribuiert (=> Stolz oder Scham). Fremdbewertung: Bewertet man die Leistung anderer, ist die emotionale Reaktion am stärksten, wenn man die betreffende Leistung auf hohe oder geringe Anstrengung zurückführt (=> Zufriedenheit oder Ärger). FAZIT: Auf der Basis der Attributionstheorie lassen sich Erfolgs- und Misserfolgsorientierte nach ihrem bevorzugten Attributionsstil unterscheiden. Misserfolgsmotivierte Personen zeichnen sich durch einen ungünstigen Attributionsstil aus: Sie tendieren dazu, Erfolg auf zeitvaribale und externe Faktoren-, Misserfolg dagegen auf zeitstabile und interne Faktoren zurückzuführen. Bei erfolgsorientierten Personen ist es umgekehrt. 19 3.1.3. Das Selbstbewertungsmodell der Leistungsmotivation von Heckhausen Die momentan aktuellste und umfassendste Theorie zur Leistungsmotivation ist HECKHAUSEN’S Selbstbewertungsmodell der Leistungsmotivation. Das Modell stellt gewissermaßen eine Synthese aus WEINER’S Attributionstheorie und ATKINSON’S Risikowahl-Modell dar. Anders als ATKINSON beschreibt H. das Leistungsmotiv nicht als stabiles u. einheitliches Persönlichkeitsmerkmal, sondern als komplexes Selbstbewertungssystem. Die Motivausprägung hängt ihm zufolge von 3 sich gegenseitig stabilisierenden Teilprozessen ab: 1) dem Anspruchsniveau bzw. der Zielsetzung, 2) der bevorzugten Attribution von Erfolg bzw. Misserfolg 3) und der daraus resultierenden Selbstbewertung Anhand dieser 3 Prozesse kommt HECKHAUSEN zu einer differenzierten Unterscheidung zwischen erfolgs- und misserfolgsmotivierten Personen. Erstere zeichnen sich durch eine realistische Zielsetzung aus: sie bevorzugen mittelschwere Aufgaben, also Aufgaben, die am meisten über ihre Tüchtigkeit aussagen. Die Zielsetzung einer Person bzw. deren Anspruchsniveau hat wiederum Einfluss auf das Attributionsmuster. Bei mittelschweren Aufgaben liegt es nahe, Erfolg auf internale Ursachen (Fähigkeit oder Anstrengung)-; Misserfolg dagegen auf zeitvariable Ursachen (Mangelnde Anstrengung oder Pech) zurückzuführen. Aufgrund dieses Attributionsmusters kommen Erfolgsorientierte zu einer positiven Selbstbewertungsbilanz: Freude und Stolz nach Erfolg sind größer als die negativen Affekte nach Misserfolg; realistische Leistungssituationen werden demnach nicht gemieden, sondern aufgesucht. das System verstärkt sich selbst (= „Engelskreis“). Bei misserfolgsmotivierten Personen sind die Zusammenhänge umgekehrt. Sie bevorzugen extrem leichte oder besonders schwere Aufgaben; dementsprechend attribuieren sie Erfolg meistens auf externale Faktoren (wie Glück oder die Leichtigkeit der Aufgabe), Misserfolge dagegen auf mangelnde Fähigkeit. Das Resultat ist eine negative Selbstbewertungsbilanz. Ein Erfolg bedeutet wenig; Misserfolge werden dagegen als belastend erlebt. Aufgaben mittlerer Schwierigkeit werden gemieden (= „Teufelskreis“). HECKHAUSEN’S Modell bildet die theoretische Basis verschiedener Trainingsprogramme (s.u.): Zu fördern sind realistische Zielsetzungen sowie günstige Attributionen und Selbstbewertungen. 3.1.4. Instrumentelle und tätigkeitsspezifische Anreize (Rheinberg) RHEINBERG unterscheidet in seinem handlungstheoretischen Motivationsmodell zwischen Situation => Handlung => Ergebnis => und den Folgen des Ergebnisses. Auf diese Weise kommt er zu einer differenzierteren Beschreibung der Begriffe „Erwartung“ und „Anreiz“. Zu unterscheiden ist zwischen „Situations-Ergebnis-Erwartungen“, „SituationsHandlungs-Erwartungen“, „Handlungs-Ergebnis-Erwartungen“ und „Ergebnis-Folge-Erwartungen“. Bezüglich der Anreize für eine Handlung unterscheidet RHEINBERG zwischen tätigkeitsspezifischen- und instrumentellen Vollzugsanreizen. Bei tätigkeitsspezifischen Vollzugsanreizen liegt der Wert einer Handlung in der Handlung selbst; bei instrumentellen Anreizen liegt der Wert der Handlung in deren Folgen begründet. RHEINBERG zufolge unterscheiden sich Menschen u.a. danach, ob sie habituell eher tätigkeits- oder eher zweckorientiert sind (dispositioneller Anreizfokus). 20 3.2. Intrinsische Motivation 3.2.1. Begriffsklärung Eine Handlung ist extrinsisch motiviert, wenn sie wegen ihrer Folgen angestrebt wird (=> instrumentelle Handlungen). Wenn sie um ihrer selbst willen- oder aus Interesse an einem Gegenstand ausgeführt wird, ist sie dagegen intrinsisch motiviert. Dementsprechend kann die intrinsische Motivation gegenstands- oder tätigkeitszentriert sein. Nach der motivationalen Theorie der Selbstbestimmung (DECI & RYAN) basiert intrinsische Motivation auf 3 psychologischen Grundbedürfnissen: dem Bedürfnis nach Kompetenz, dem Bedürfnis nach Autonomie und dem Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit. Der Theorie nach entwickelt sich intrnisische Motivation in 4 Stufen, wobei die äußeren Vorgaben (Handlungsziele) zunehmend internalisiert und ins Selbstkonzept integriert werden: extrinsische Handlungsregulation Introjektion Identifikation Integration 3.3. Interesse 3.3.1. Begriffsklärung Interesse ist eine Form der intrinsischen Motivation. Im Gegensatz zu vielen anderen motivationalen Konstrukten sind Interessen dabei immer gegenstandsspezifisch. Dementsprechend definiert die Person-Gegenstands-Theorie (KRAPP, PRENZEL et al.) Interessen als längerfristige und überdauernde Person-Gegenstands-Bezüge. Interessensgegenstand können dabei bestimmte Objekte, Themen oder Tätigkeiten sein. Entscheidend ist, dass dem betreffenden Gegenstand eine hohe subjektive Bedeutung zugemessen wird und die Auseinandersetzung mit dem Gegenstand als positiv und angenehm erlebt wird („wertbezogene und emotionale Valenz“). Aus der wertbezogenen und emotionalen Valenz des Gegenstandes ergibt sich die intrinische Qualität bzw. „Selbstintentionalität“ von Interessen: Man geht Interessen um ihrer selbst Willen nach und nicht aufgrund äußerer Zwänge. Auf kognitiver Ebene zeichnen sich Interessen dadurch aus, dass sie gegenstandsspezifisches Wissen voraussetzen und mit einer Ausdifferenzierung und Erweiterung dieses Wissens einhergehen („epistemische Orientierung“): Wer sich für eine Sache interessiert, möchte mehr darüber erfahren! Auch Interesse kann als Zustand (situationales Interesse) und Disposition (dispositionales Interesse) beschrieben werden. Das Interessen-Hexagon von HOLLAND ist ein Modell zur Klassifikation verschiedener Interessen. Es beruht auf 2 bipolaren Dimensionen: Einerseits unterscheidet Holland zwischen sach- und personorientierten-, andererseits zwischen daten- und ideenorientierten Interessen. Anhand dieser Dimensionen kommt er zu 6 verschiedenen Interessensarten, die er in Form eines Sechsecks anordnet. Dabei stehen forschende- und unternehmerische-, soziale- und realistischesowie künstlerische- und konventionelle Interessen einander jeweils gegenüber. HOLLAND’S Modell findet v.a. in der Berufsberatung Anwendung. Interessen regulieren unser Verhalten unabhängig von aktuellen Anreizen (funktionelle Autonomie). Sie verselbständigen sich (werden Teil des Selbstkonzepts) und haben dadurch maßgeblichen Einfluss auf die Auseinandersetzung des Individuums mit seiner Umwelt (Genom-Umwelt-Passung)! 21 3.3.2. Die Entwicklung von Interessen Im menschlichen Lebenslauf lässt sich die Entwicklung der Interessen nach Bereichen aufgliedern, wobei sich typische Sequenzen beobachten lassen: 1) Universelle Interessen Treten bereits im ersten Lebensjahr auf; lassen sich danach unterscheiden, ob sie eher person- oder sachorientiert sind (siehe: HOLLAND); u.a. abhängig vom erfahrenen Bindungstyp 2) Geschlechtspezifische bzw. kollektive Interessen Bilden sich im Kindergarten- und Vorschulalter heraus; werden stark von der Schule beeinflusst (Gymnasiasten haben generell ein breiteres Interessenspektrum und sind weniger von geschlechtsstereotypen Interessen abhängig) 3) Schulisch-akademische Interessen Meint das Interesse an einzelnen Schulfächern – nimmt mit dem Alter zunehmend ab; Wie die Längsschnittstudie LOGIK zeigt, nimmt das schulische Interesse schon im Grundschulalter kontinuierlich ab (HELMKE). Dieser Trend setzt sich in den weiterführenden Schulen fort. Betroffen ist dabei v.a. das Interesse an Mathematik und Naturwissenschaften (außer Biologie), wobei Mädchen generell ein geringeres Interesse an diesen Fächern zeigen als Jungen (negative Folge der Koedukation?! – Konfrontation mit Geschlechtsstereotypen). Die Wahl der Leistungskurse bestätigt diesen Befund. Fächer wie Deutsch und Biologie werden häufiger gewählt als z.B. Chemie oder Physik! Während die meisten Studien lediglich die Mittelwerte verschiedener Jahrgänge miteinander vergleichen, untersucht FEND auf der Basis der Konstanzer Längsschnittstudie die intraindividuellen Entwicklungsverläufe. Dabei kommt er zu dem Ergebnis, dass der negative Entwicklungstrend lediglich für 20-30% der Schüler zutrifft. Die Mehrheit der Schüler zeigt keinen signifikanten Einstellungswandel was Motivation und Lernfreude betrifft. Schulischer Einfluss auf die Interessenentwicklung: ein Vorteil ist, dass der Unterricht die Begegnung mit neuen Gegenstandsbereichen ermöglicht und dadurch neue Interessen wecken kann; allerdings muss dazu die Verknüpfung mit den persönlichen Interessen der Schüler gelingen etc.; ansonsten: Schulverdrossenheit und Desinteresse! 4) Berufliche Interessen werden zunehmend realistischer und stabilisieren sich im Jugendalter (Interessenentwicklung als Teil der Identitätsentwicklung) GINZBERG unterscheidet 1) Stufe der Phantasiewahlen (7-11 Jahre) 2) Stufe der Probewahlen (11-17 Jahren;v.a. vom Interesse bestimmt) 3) Stufe der realistischen Wahlen (ab 17 Jahren, bei Hauptschülern früher; Erwägung der eigenen Interessen, Fähigkeiten und Möglichkeiten: Explorations-, Kristallisationsund Spezifikationsphase) Geschlechtsunterschiede: Bei Jungen wächst die Korrelation zwischen beruflichem Interesse und Berufsprestige mit zunehmendem Alter an, bei weiblichen Jugendlichen liegt sie bei Null! 22 5) Personale (spezifische) Interessen kristallisieren sich im Laufe der Entwicklung heraus; drücken sich im Beruf oder entsprechenden Hobbys aus; überschneiden sich mit den übrigen Interessensbereichen 3.2.2. Die Entstehung und Förderung von Interessen Interessen sind genetisch bedingte Dispositionen, hängen aber auch von den spezifischen Erfahrungen einer Person ab. Der Person-Gegenstands-Theorie zufolge entwickeln sich Interessen nur dann, wenn der betreffende Gegenstand als bedeutsam erachtet und die Auseinandersetzung mit ihm als positiv erlebt wird. Die Erlebnisqualität hängt der Theorie zufolge v.a. davon ab, ob die drei von DECI & RYAN postulierten Grundbedürfnisse nach Autonomie, Kompetenz und sozialer Eingebundenheit erfüllt werden. Die Entwicklung bzw. Aufrechterhaltung schulischer Interessen hängt somit entscheidend von der Lehrer-Schüler-Beziehung, der Möglichkeit zur Selbstbestimmung und der Kompetenzerfahrung der Schüler ab. Zu hohe Anforderungen und ein autoritärer, stark lehrerzentrierter Unterricht sollten sich negativ auf die Interessenentwicklung auswirken, ein „autoritativer“ Erziehungsstil dagegen positiv. Damit sich Interesse entwickeln kann, muss den Schülern die Bedeutsamkeit des Lernstoffes immer wieder verdeutlicht werden! Ein typischer Interessenkiller ist der fehlende Alltags- und Anwendungsbezug des Lernstoffs. Der „Korrumpierungs-“ oder „Overjustification Effect“ besagt, die instrinsische Motivation durch äußere Verstärker (Belohnung) untergraben werden kann. EXPERIMENT (Greene et al., 1976): Das „Mathespiel“ Nach einer Belohnungsphase spielen die Kinder ein Mathespiel weniger häufig als vor der Belohnungsphase! Das ursprüngliche Interesse an dem Mathespiel (intrinsische Motivation) geht verloren, wenn das Spielen vorübergehend belohnt wird. Vermeidung des Overjustification Effects: Leistungskontingente Belohnung statt aufgabenkontingenter Belohnung (Nicht das Mathespiel an sich, sondern lediglich gute Leistungen darin sollten belohnt werden) => Aber Vorsicht: Bewertungsangst muss vermieden werden, da sie Motivation raubt! Nur so viel belohnen, wie notwendig ist. Didaktische Maßnahmen zur Interessensförderung: Autoritativ-demokratischer Unterrichtsstil Identifikation mit dem Lehrer fördern Angemessene Anforderungen und positive Rückmeldung Durchschaubarkeit des Dargebotenen Anschaulichkeit Anwendungs- und Alltagsbezug (an den Problemen der Schüler anknüpfen) Eigenaktivität und die Selbstbestimmung von Lernzielen sollte ermöglicht werden. Gruppenarbeit 23 4. Empirische Befunde zu d. motivationalen Faktoren des Lernens 4.1. Lernmotivation PEKRUN untersuchte auf der Basis des Münchner Längsschnitts zur Schülerpersönlichkeit die Entwicklung der Lernmotivation anhand von 4 Dimensionen: Intrinsische Motivation, Kompetenzmotivation, Leistungsmotivation und soziale Motivation (s.o.). Dabei zeigte sich, dass lediglich die Leistungsmotivation über die Jahrgangsstufen hinweg stabil bleibt. Die übrigen Formen der Lernmotivation fallen kontinuierlich ab. Einer Metaanalyse von WALBERG et al. zufolge beträgt die durchschnittliche Korrelation zw. Lernmotivation und Leistung lediglich r = .12. Dieser geringe Zusammenhang ist v.a. damit zu erklären, dass in entsprechenden Untersuchungen immer nur Teilaspekte der Lernmotivation erfasst werden können. Hinzu kommt, dass Motivation stark situationsabhängig ist (z.B. von der zeitlichen Nähe zur Prüfung) und sich nur in Verbindung mit anderen Faktoren (z.B. Intelligenz) in entsprechenden Leistungen niederschlägt. 4.1. Selbstwirksamkeit Das Konzept der Selbstwirksamkeit (Self-efficacy) geht auf BANDURA zurück. Es bezeichnet die subjektive Überzeugung, Aufgaben und Probleme aufgrund eigener Kompetenzen bewältigen zu können (Handlungs-Ergebnis-Erwartuung). Die Selbstwirksamkeit einer Person enthält bereichsspezifische und generalisierte Überzeugungen. Sie hat Einfluss auf die Leistung und Zielsetzung einer Person. Umgekehrt beeinflussen die Leistungsergebnisse die Selbstwirksamkeitserwartungen (reziproker Zusammenhang). Dementsprechend verwundert es nicht, dass eine hohe Selbstwirksamkeit mit besseren Leistungen und größerer Lernfreude einhergeht (JERUSALEM). 4.2. Lernfreude, Interesse und Leistung Lernfreude und schulisches Interesse nehmen ab der Grundschulzeit kontinuierlich ab. Das zeigen u.a. die Längsschnittstudien LOGIK & SCHOLASTIK. Die Analyse intraindividueller Entwicklungsverläufe zeigt jedoch, dass dieser negative Entwicklungstrend lediglich für 20-30% der Schüler zutrifft. Die Mehrheit der Schüler zeigt keinen signifikanten Veränderungen was Motivation und Lernfreude betrifft (FEND: Konstanzer Längsschnittstudie). JERUSALEM zufolge hängen Lernfreude und Interesse eng mit den schulischen Leistungen zusammen; dabei verstärken sich die einzelnen Größen wechselseitig. Gute Noten gehen mit Lernfreude und Interesse einher; umgekehrt begünstigt Interesse und eine entsprechende Lernfreude gute Leistungen. Die gefundenen Korrelationen zw. Lernfreude und Schulleistung nehmen im Lauf der Schulzeit kontinuierlich zu. Die Lernfreude guter Schüler bleibt relativ konstant, während die Lernfreude schlechter Schüler zunehmend zurückgeht. Betrachtet man die Entwicklungsverläufe in Abhängigkeit vom Fach, zeigt sich, dass v.a. Mathematik und die naturwissenschaftlichen Fächer (außer Biologie) von einem Rückgang des Interesses betroffen sind. Mädchen haben dabei durchschnittlich weniger Interesse und Freude an Mathematik als Jungen, erbringen aber keine schlechteren Leistungen. 24 In einer Metaanalyse von SCHIEFELE et al. wurde über mehrere Schularten, Jahrgangsstufen und Fächer hinweg ein mittlerer Zusammenhang zwischen Interesse und Leistungen (Noten, Tests) von r = .30 ermittelt. Es konnte nachgewiesen werden, dass dieser Zusammenhang reziprok ist: Schulleistung und schulisches Interesse beeinflussen sich wechselseitig. Gute Noten fördern das Interesse, insofern sie das Bedürfnis nach Kompetenz und sozialer Eingebundenheit befriedigen. Umgekehrt führt Interesse zu besseren Leistungen, insofern Interesse zu erhöhter Aufmerksamkeit und einer tieferen Informationsverarbeitung führt (Elaborations- und Organisationsstrategien). 4.3. Stage-Environment-Fit-Theorie Die „Stage-Environment-Fit-Theorie“ (ECCLES et al.) erklärt das Absinken der (intrinsischen) Lernmotivation folgendermaßen: Die Lehrer-Schüler-Beziehung wird im Laufe der Schulzeit zunehmend formeller; dementsprechend erfahren ältere Schüler durchschnittlich weniger emotionale Unterstützung und Zuwendung als jüngere Schüler. Dem Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit wird zunehmend weniger entsprochen! Die Ansprüche steigen; die Notenpraxis wird strenger und die Noten dementsprechend schlechter. Zunehmende soziale Bezugsnormorientierung; Verschärfung der Wettbewerbssituation Widerspruch zum Bedürfnis nach Kompetenz Zunehmende Lehrerzentrierung Widerspruch zum Bedürfnis nach Autonomie und Selbstbestimmung. FAZIT: Mangelnde Passung zwischen den Bedürfnisse der Schüler und den schulischen Bedingungen führt zum Absinken der Lernmotivation! 25 5. Förderung der Lernmotivation 5.0. Allgemeines Lehrer können die Lernmotivation ihrer Schüler auf verschiedene Weise beeinflussen. Im Folgenden soll v.a. die Förderung der Leistungsmotivation und des Interesses behandelt werden. 5.1. Förderung der Leistungsmotivation Nach HECKHAUSEN’S Selbstbewertungsmodell sollten sich Lehrer bei der Förderung der Leistungsmotivation an 3 Zielen orientieren: Sie sollten stark misserfolgsorientierte Schüler zu einer realistischen Zielsetzung bewegen, ihnen einen günstigen Attributionsstil nahe legen und auf diese Weise eine positive Selbstbewertungsbilanz fördern. Vgl. hierzu das Motivationstraining von KRUG & HANEL Eine zentrale Rolle spielt dabei die Bezugsnormorientierung des Lehrers. Bei einer individuellen Bezugsnormorientierung werden die Leistungen der Schüler mit deren persönlichem Leistungsniveau verglichen, was sich v.a. aus 2 Gründen positiv auf die Leistungsmotivation auswirkt: 1) Erstens, gerät dadurch das Potenzial der Schüler in den Blick und nicht deren Grenzen. Misserfolge werden eher auf variable Ursachen wie Anstrengung zurückgeführt anstatt auf Fähigkeit. 2) Zweitens, fördert eine individuelle Bezugsnormorientierung eine realistische Zielsetzung. Anstatt sich an den Klassenbesten zu orientieren, wird leistungsschwächeren Schülern nahe gelegt, sich an den eigenen Standards zu orientieren. Bei einer sozialen Bezugsnormorientierung ist es genau umgekehrt; dementsprechend negativ wirkt sie sich auf die Leistungsmotivation aus. Der Zusammenhang zwischen der Bezugsnormorientierung des Lehrers und der Leistungsmotivation der Schüler ist empirisch vielfach nachgewiesen. Nach Beobachtungen von RHEINBERG zeichnen sich Lehrer mit individueller Bezugsnormorientierung neben einem günstigeren Attributionsstil v.a. durch folgende Punkte aus: 1) Sie äußern generell mehr Lob, insbesondere gegenüber leistungsschwächeren Schülern – und machen ihr Lob stärker von der individuellen Leistungsentwicklung abhängig. 2) Sie stimmen ihren Unterricht stärker auf den Einzelnen ab; der Schwierigkeitsgrad der Aufgaben wird, soweit wie möglich, an die individuellen Voraussetzungen der Schüler angepasst. 26 5.2. Interessenförderung Der Person-Gegenstands-Theorie zufolge entwickeln sich Interessen nur dann, wenn der betreffende Gegenstand als bedeutsam erachtet und die Auseinandersetzung mit ihm als positiv erlebt wird (Emotionale und wertbezogene Valenz). Insofern sind an der Interessengenese sowohl kognitiv-rationale als auch emotionale Faktoren beteiligt (KRAPP spricht daher vom „dualen Funktionssystem der Interessengenese“) 5.2.1. Emotionale Valenz Die emotionale Erlebnisqualität hängt der Theorie zufolge v.a. davon ab, ob die drei von DECI & RYAN postulierten Grundbedürfnisse nach Autonomie, Kompetenz und sozialer Eingebundenheit erfüllt sind. Dementsprechend sollten Lehrer im Unterricht v.a. auf 3 Dinge achten: 1) Sie sollten eine positive Beziehung zu ihren Schülern aufbauen, die Schüler in ihren Belangen ernst nehmen und für ein gutes Klassenklima sorgen (=> soziale Eingebundenheit). 2) Sie sollten den Schülern Kompetenzerfahrungen ermöglichen: dazu ist es notwendig, die Aufgabenschwierigkeit den Voraussetzungen der Schüler anzupassen (Schaffung von Erfolgserlebnissen). Außerdem sollte Lob von der individuellen Leistungsentwicklung- und nicht vom Klassendurchschnitt abhängig gemacht werden. Abwertende Rückmeldungen sollten vermieden werden (stattdessen: informierende Rückmeldungen). 3) Um dem Bedürfnis nach Autonomie gerecht zu werden, empfiehlt sich ein eher schülerzentrierter, demokratisch-autoritativer Unterrichtsstil. Der Lehrer sollte den Schülern Wahlmöglichkeiten geben und sie, soweit das möglich ist, in die Unterrichtsplanung mit einbeziehen. Eigenständiges Arbeiten: z.B. in Gruppen, bei Referaten etc. 5.2.2. Wertbezogene Valenz Die wertbezogene Valenz ist im Gegensatz zur emotionalen inhaltsspezifisch. Trotz der Lehrplanvorgaben hat der Lehrer einen entscheidenden Einfluss auf die Unterrichtsinhalte und deren Darbietung: Schüler können zumindest teilweise an der Themenwahl beteiligt werden! Relevanz und Alltagsbezug des Lernstoffs sollten verdeutlicht werden! Ansprechendes Arbeitsmaterial (Einsatz verschiedener Medien etc.) Auf unnötige Wiederholungen des Stoffs verzichten Spannende Aufgaben- und Fragestellungen Begeisterung ausstrahlen (Lernen am Modell): Nur wer selbst von seinem Fach begeistert ist, wird andere dafür begeistern können. Vermeidung des „Overjustification-Effekts“ (s.o.)! 27 6. Handlungsregulation 6.0. Allgemeines Theorien zur Handlungskontrolle befassen sich mit den psychologischen Prozessen, die nach der Zielsetzung (s.o.) zur Zielerreichung beitragen und ein bestimmtes Ziel gegen rivalisierende Ziele abschirmen. Die bekannteste Theorie zur Handlungskontrolle ist das Rubikon-Modell von HECKHAUSEN & GOLLWITZER. 6.1. Das Rubikonmodell (Heckhausen & Gollwitzer) Handlungsphasen: Heckhausen & Gollwitzer gehen von 4 Handlungsphasen aus. Am Anfang einer jeden Handlung steht ein Bedürfnis oder Wunsch (z.B. etw. für die körperliche Fitness zu tun). Vorentscheidungsphase (prädezisional): 1. Die sog. Vorentscheidungsphase dient der Intentionsbildung. Dabei werden die verschiedenen Handlungsalternativen bezüglich ihres Wertes und ihrer Erfolgserwartung* gegeneinander abgewogen (z.B. joggen, Fußball, Tanzkurs,…). * Erwartung x Wert (s.o.): Ist die Handlungsalternative realisierbar (Erwartung) und ist sie attraktiv (Wert)?! 2. Am Ende dieser Phase steht ein Entschluss (Fazittendenz): Aus dem allgemeinen Wunsch (etw. für die körperliche Fitness zu tun) ist eine konkrete Handlungsabsicht (Zielintention) geworden (Fußball spielen). Vorhandlungsphase (präaktional): 1. Die Vorhandlungsphase dient der Erstellung eines Handlungsplans; es geht also um die Erwägung konkreter Umsetzungsmöglichkeiten (Wo, wie und wann wird Fußball gespielt?). 2. Fiattendenz: Am Ende dieser Phase steht ein Plan bzw. ein konkreter Vorsatz (Implementierungsintention), der festlegt, wie und wann die Handlung realisiert werden soll. Handlungsphase (aktional): 1. Die Handlungsphase dient der Ausführung des Handlungsplans, der dabei fortwährend mit den aktuellen Gegebenheiten verglichen wird. 2. Am Ende dieser Phase steht der Abschluss der Handlung, im idealen Fall bedeutet das zugleich die Erreichung des Ziels (fit zu sein). Nachhandlungsphase (postaktional): 1. Die Nachhandlungsphase dient der Bewertung des Erreichten. Es geht also darum, für sich zu entscheiden, ob die Handlung erfolgreich war oder nicht. 2. Am Ende dieser Phase steht evtl. eine Neubewertung der ursprünglichen Handlungsalternativen oder gar der eigenen Standards. (Rudern statt Fußball? Oder ist Erfolg im Studium doch wichtiger als körperliche Fitness?!) 28 Bewusstseinslagen: Die verschiedenen Phasen zeichnen sich durch unterschiedliche Bewusstseinslagen aus. Die motivationale Bewusstseinslage: Zur motivationalen Bewusstseinslage gehören die Vorentscheidungsund Nachhandlungsphase: Zielsetzung! Um eine möglichst breite Vielfalt von Handlungsalternativen erfassen zu können, ist diese Bewusstseinlage durch Offenheit und Objektivität gekennzeichnet. Es gilt, möglichst viele Informationen aufzunehmen und sie möglichst objektiv bezüglich ihres Wertes und der Erfolgserwartung zu bewerten (realitätsorientierte Informationsverarbeitung). Die volitionale Bewusstseinslage: Zur motivationalen Bewusstseinslage gehören die Vorhandlungsund die Handlungsphase: Initiierung und Aufrechterhaltung des Handelns! In dieser Bewusstseinslage wird die Aufmerksamkeit auf die konkrete Absicht, deren Umsetzung und Ausführung fokussiert. Es gilt, sich nicht durch andere Handlungsabsichten ablenken zu lassen und die Konzentration ganz auf zielrelevante Infos und Reize zu richten. Realisierungsorientierte, statt realitätsorientierte Informationsverarbeitung, d.h. man ist weitaus optimistischer und blendet negative Rückmeldungen z.T. aus, um sich bei der Umsetzung nicht entmutigen zu lassen. 29 III. EMOTIONALE BEDINGUNGEN DES LERNENS 1. Angst 1.1. Begriffsklärung 1.1.1. Angst allgemein Angst kann als unangenehm erlebter Erregungsanstieg definiert werden. Ausgelöst wird Angst in Situationen, die als unsicher und bedrohlich wahrgenommen werden. Welche Situationen das im Einzelnen sind, ist individuell verschieden und hängt von der genetischen Disposition und den Erfahrungen der betreffenden Person ab. Allgemein kann zwischen Angst als Zustand und Ängstlichkeit als Persönlichkeitseigenschaft oder Disposition unterschieden werden. Angst im Sinne eines Zustandes meint die akute, situationsspezifische Reaktion. Ängstlichkeit bezeichnet dagegen die generelle Tendenz, auf bedrohliche Reize mit Angst zu reagieren. Bezüglich des Angstgegenstandes kann zwischen generalisierten und bereichsspezifischen Ängsten unterschieden werden. „Grundformen“ der Angst sind die Existenzangst, die soziale Angst und die Leistungsangst bzw. – ängstlichkeit. Manche Autoren treffen darüber hinaus eine weitere Differenzierung: Handelt es sich bei der wahrgenommenen Bedrohung um eine klar bestimmbare Gefahr, die von außen kommt und sinnvolle Reaktionsweisen nahe legt (Flucht oder Angriff), sprechen sie von „Furcht“; von „Angst“ sprechen sie dagegen, wenn die Gefahr unspezifisch-, eher innerlich- und nur schwer zu bewältigen ist. Wenn die Angst ein gewisses Maß übersteigt und nicht mehr im Verhältnis zur objektiv gegebenen Gefahr steht, spricht man von „Phobie“. 1.1.2. Schul- und Leistungsangst Schulangst kann definiert werden als die relativ überdauernde Bereitschaft, schulische Situationen als persönliche Bedrohung zu empfinden. Die Hauptformen von Schulangst sind Leistungsangst und soziale Angst (Angst vor Zurücksetzung, Nichtanerkennung etc.). LIEBERT & MORRIS unterscheiden in Bezug auf die Leistungsangst zwischen 2 Komponenten: der Besorgtheits- und der Aufgeregtheitskomponente. Die „Besorgtheit“ („worry“) ist die kognitive Komponente der Leistungsangst; sie äußert sich in aufgabenirrelevanten Gedanken und Sorgen. Dazu gehören z.B. Selbstzweifel, selbstwertschädigende Leistungsvergleiche, eine übersteigerte Beschäftigung mit Noten, Fantasien über mögliche Misserfolge etc. Leitungsängstliche Schüler machen sich vor einer Prüfung oft mehr Gedanken über einen möglichen Misserfolg, als über den zu lernenden Stoff! Die „Aufgeregtheit“ („emotionality“) bezeichnet die wahrgenommene Erregung einer Person (Herzrasen, innere Anspannung etc.). Ausgehend von dieser Differenzierung kann Leistungsangst definiert werden als die Besorgtheit und Aufgeregtheit angesichts von Leistungsanforderungen, die als selbstwertbedrohlich eingeschätzt werden. Dabei gilt: Je höher der (subjektive) Stellenwert einer Leistung und je niedriger die (subjektive) Erfolgswahrscheinlichkeit, desto größer die Leistungsangst. 30 2. Indikatoren für Schul- und Leistungsangst 2.1. Wie äußert sich Angst? (Angst als Zustand) Angstzustände äußern sich auf 3 Verhaltensebenen: 1) Auf einer physiologischen Ebene kommt es zu einem Erregungsanstieg des autonomen Nervensystems. Die Folgen sind Herzklopfen, ein erhöhter Blutdruck, Schweißausbrüche, beschleunigte Atmung etc. 2) Auf der verbal-subjektiven Ebene äußert sich Angst im Gefühl der Bedrohung und Hilflosigkeit. Auf dieser Ebene wird die angstauslösende Situation interpretiert und bewertet. 3) Auf einer dritten Ebene äußert sich Angst in beobachtbaren Verhaltensweisen; dazu gehören z.B. Flucht- und Vermeidungstreaktionen, entsprechende Veränderungen der Mimik und Gestik, Artikulationsstörungen, Verkrampfungen etc. Innerhalb und zwischen diesen Ebenen korrelieren die Variablen in der Regel nur mäßig. Das liegt zum einen daran, dass Angstrektionen z.T. stark variieren. Will sagen: Nicht jeder reagiert auf Bedrohungen in gleicher Weise. Zum anderen treten die einzelnen Symptome oft zeitversetzt auf. Insbesondere die physiologischen Reaktionen sind mehrdeutig (Auch bei Freude ist der Puls erhöht). 2.2. Wie äußert sich Schulangst? (Angst als Eigenschaft) Schüler mit Schulangst versuchen ihre Angst meistens vor der Umwelt zu verbergen. Da Angst ohnehin nur bedingt beobachtbar ist, bleibt Schulangst daher oft unerkannt. Folgende Indikatoren gelten als Hinweise für Schulangst: Hochängstliche Schüler haben ein negativ getöntes Selbstbild und sind stark misserfolgsorientiert. Sie attribuieren Leistungserfolge eher external (z.B. Glück), Misserfolge dagegen überwiegend internal (z.B. Fähigkeit). Dementsprechend werden negative Rückmeldungen als äußerst belastend erlebt, während positives Feedback kaum zu positiven Affekten führt (negative Selbstbewertungsbilanz). Hochängstliche Schüler sind durch Hilflosigkeit, Unsicherheit und mangelndes Selbstvertrauen gekennzeichnet. Sie sind oft angespannt und fallen durch nervöses Verhalten auf. Sie zeigen eine schlechte Arbeitshaltung, sind häufig abgelenkt und von den gestellten Aufgaben überfordert. Dementsprechend geht Schulangst in der Regel mit schlechten Leistungen und Zensuren einher (s.u.). In der Peergroup nehmen ängstliche Schüler meist einen unteren Rangplatz ein. Sie werden von ihren Mitschülern weniger geschätzt als andere und sind oft sozial isoliert (Rückzug und Ausgrenzung). Hochängstliche Schüler fehlen häufiger und sind häufiger krank (Magenweh, Übelkeit etc.)! Generell sind Mädchen häufiger von Schulangst betroffen als Jungen. Zur systematischen Erfassung von Ängstlichkeit stehen entsprechende Tests zur Verfügung, die sich meist an dem Zwei-Komponenten-Modell von LIEBERT & MORRIS orientieren. 31 3. Angst und Leistung Es ist davon auszugehen, dass Schulangst und Leistung sich wechselseitig beeinflussen: Ängstlichkeit mindert das Leistungsvermögen; schlechte Leistungen wiederum erhöhen die Angst. Einer Metaanalyse von SEIPP zufolge beträgt die durchschnittliche Korrelation zw. Leistung und Angst r = -.21. Obwohl dieser Zusammenhang lediglich schwach negativ ist, darf er nicht unterschätzt werden. Für die leistungsmindernde Wirkung von Schulangst gibt es zahlreiche theoretische Erklärungen: Nach dem „Yerkes-Dodson-Gesetz“ besteht zwischen emotionaler Erregung, Aufgabenschwierigkeit und Leistung folgender Zusammenhang: Bei einfachen Aufgaben wirkt Erregung leistungsoptimierend; bei schwierigen Aufgaben dagegen eher leistungsmindernd. Da Angst mit einem Erregungsanstieg verbunden ist, sollten also einfache Lernprozesse (z.B. klassisches Konditionieren) durch Angst begünstigt-, komplexere Lernprozesse (z.B: Wissenserwerb) dagegen behindert werden. In einem entsprechenden Experiment von YERKES & DODSON wurden Mäuse für die falsche Lösung einer Diskriminationsaufgabe mit Elektroschocks (Aktivierung) bestraft. UVn: Variiert wurden die Schockintensität (Erregnung) und die Aufgabenschwierigkeit. Bei einfachen Aufgaben führte eine Intensivierung des Schockslevels zu einer Leistungsverbesserung, bei schweren Aufgaben dagegen zu einer Leistungsverschlechterung. Dass Angst die Aufmerksamkeit und damit die Gedächtnisleistung beeinträchtigt, ist empirisch vielfach belegt. Eine theoretische Erklärung für die Befunde bietet das „Habit-Interferenz-Modell“ von MANDLER & SARASON: Danach werden in Leistungssituationen antagonistische Triebe aktiviert. Der Aufgabentrieb und der Angsttrieb. Letzterer kann Ansporn, aber auch Hindernis sein. Bei Hochängstlichen ist der Angsttrieb eher ein Hindernis. Er führt zu aufgabenirrelevanten Reaktionstendenzen, durch die die Aufgabenlösung beeinträchtigt wird (Interferenz). Sprich: Leistungsängstliche Schüler lassen sich durch ihre Sorgen und Selbstzweifel von der Aufgabenlösung ablenken! Anstatt eine Prüfung systematisch vorzubereiten, machen sie sich Gedanken über einen möglichen Misserfolg. KUHL: Anstatt negative Affekte und Gedanken beiseite zu schieben, um sich auf die Aufgabenlösung konzentrieren zu können (Handlungsorientierung), sind ängstliche Schüler in ihren Sorgen befangen: sie denken über vergangene und mögliche Misserfolge nach und werden dadurch von der Aufgabenlösung abgelenkt (Lageorientierung): Oberflächliche Aufgabenbearbeitung, Unkonzentriertheit, Hektik, oberflächliche Strategien etc. Leistungsmindernd wirkt dementsprechend v.a. die Besorgtheitskomponente der Leistungsangst! Neben der kognitiven Beeinträchtigung bringt Angst motivationale Defizite mit sich: Ausgeprägte Misserfolgserwartung, evtl. erlernte Hilflosigkeit etc. (s.o.)! 32 4. Die Entstehung von Schulangst A) Lerntheoretische Erklärungsansätze Aus verhaltenstheoretischer Sicht wird Angst „gelernt“. Dabei lassen sich 3 Varianten unterscheiden: Nach dem Paradigma der klassischen Konditionierung entstehen Ängste durch die wiederholte Paarung eines ursprünglich neutralen Reizes mit einem aversiven Reiz. Nach dem Paradigma der operanten Konditionierung wird der Erwerb von Angstreaktionen durch das Prinzip der Verstärkung erklärt. Eine dritte Möglichkeit besteht darin, Ängste durch die Beobachtung und Nachahmung anderer zu erlernen (Modelllernen). 4.1. Klassische Konditionierung WATSON, der als Begründer des Behaviorismus gilt, ging davon aus, dass unsere grundlegenden Emotionen (Angst, Wut, Liebe) durch klassische Konditionierungsprozesse bedingt sind. Um seine These zu belegen, führte er ein klassisches Experiment durch: Er brachte einem 11 Monate alten Jungen namens „Albert“ im wahrsten Sinne des Wortes „das Fürchten bei“. Jedes Mal, wenn der Junge eine Ratte sah, vor der er ursprünglich keine Angst hatte, schlug Watson auf eine Eisenstange und koppelte dadurch die Ratte, anfangs neutral- oder sogar positiv besetzt, an ein angstbesetztes Geräusch. Beim klassischen Konditionieren wird also ein neuer bzw. „bedingter“ Reiz als Auslöser für eine biologisch vorgegebene Verhaltensweise gelernt! Man spricht deshalb auch von Reiz-Reaktions- bzw. S-R-Lernen. Ein unbedingter Reiz (Geräusch) führt zu einer unbedingten Reaktion (Angst). Im Rahmen der Konditionierung wird der unbedingte Reiz mit einem neutralen Reiz (Ratte) gekoppelt. Wichtig ist dabei a) die zeitliche- und räumliche Nähe des bedingten und unbedingten Reizes (Kontiguität) sowie b) die Wiederholung dieser Reizkombination. Ist beides gegeben, wird der neutrale Reiz mit dem unbedingten assoziiert (deshalb auch: assoziatives Lernen)! Dadurch entsteht eine neue Reiz-Reaktions-Beziehung: Der ursprünglich neutrale Reiz (Ratte) wird zu einem bedingten Reiz, der allein ausreicht, um die jew. Reaktion (nun eine bedingte Reaktion) hervorzurufen. FAZIT: Durch klassisches Konditionieren lernen wir emotionale Reaktionen auf ursprünglich neutrale Reize zu übertragen. Beispiele aus der Schule (1) Bestrafung (= unbedingter Reiz) => Angst (= unbedingte Reaktion); (2) Lehrer (neutraler Reiz) + Bestrafung => Angst (unbedingte Reaktion); (3) Lehrer (bedingter Reiz) => Angst (bedingte Reaktion) Typische Beispiele für diese Art der Angstentstehung sind traumatische Erlebnisse. Ein Schüler, der an die Tafel geholt wird und dort vor der gesamten Klasse versagt, oder wiederholt Demütigungen durch Klassenkameraden erfährt etc. In schwerwiegenden Fällen kann es zu einer „Reizgeneralisierung“ kommen: Angstreaktionen werden dann nicht nur in Prüfungssituationen ausgelöst, sondern u.U. schon beim Anblick des Schulgebäudes. 33 4.2. Operante Konditionierung Nach dem Paradigma der operanten Konditionierung werden Angstreaktionen aufgrund von Konsequenzen gelernt. Der entscheidende Prozess ist dabei der der Verstärkung. Verstärker sind nach SKINNER alle Konsequenzen, die die Auftretenswahrscheinlichkeit eines Verhaltens erhöhen. Zu unterscheiden ist dabei zwischen positiver und negativer Verstärkung. Positive Verstärkung: Darbietung eines angenehmen Reizes, Negative Verstärkung: Beseitigung eines unangenehmen (aversiven) Reizes Die spontane Reaktion auf Angst ist Flucht- und Vermeidungsverhalten. Ein solches Verhalten ist kurzfristig meistens erfolgreich, führt aber langfristig zu einer Verstärkung der Angst. Indem Flucht- und Vermeidungsreaktionen verstärkt werden, wird eine sinnvolle Bewältigung („Coping“) der Angst verhindert. Flucht- und Vermeidungsverhalten bei Schulangst: Schuleschwänzen, Prüfungsvorbereitungen vor sich herschieben, sich ablenken, Suchtmittel, etc. Wer bei Klausuren immer schwänzt, wird nie lernen, dass er auch erfolgreich sein kann. Da auf Angstzustände im Allgemeinen Erleichterung folgt, verstärkt sich Angst selbst. 4.3. Die Zwei-Faktoren-Theorie der Angstentstehung von Miller & Mowrer Nach MILLER & MOWRER wirken bei der Entstehung von Angst klassische und operante Konditionierungsprozesse zusammen („Zwei-Faktoren-Theorie der Angstentstehung“). Durch klassische Konditionierung werden ursprünglich neutrale Reize mit Angst besetzt. Die spontane Reaktion auf Angst ist Flucht- und Vermeidungsverhalten. Da ein solches Verhalten zur kurzfristigen Reduktion der Angst führt, wird es negativ verstärkt. Dadurch stabilisiert sich die Angst selbst. Anhand dieser Theorie kann die Entstehung von Prüfungsangst folgendermaßen erklärt werden: Ein Schüler, der im Zusammenhang mit Prüfungssituationen gehäuft negative Erfahrungen macht (Misserfolg, Bestrafung durch die Eltern, Tadel vom Lehrer, etc.) assoziiert Prüfungen auf die Dauer mit Angst. Um die Angst zu reduzieren, versucht er sich abzulenken; er schiebt z.B. die Prüfungsvorbereitung vor sich her oder schwänzt die Schule. Dieses Verhalten ist zwar kurzfristig erfolgreich, verhindert aber auf die Dauer eine Bewältigung der Angst. 4.4. Modelllernen Die sozial-kognitive Theorie von BANDURA geht davon aus, dass Verhaltensweisen, Einstellungen und emotionale Reaktionen nicht zuletzt durch Beobachtung und Nachahmung gelernt werden. In diesem Sinne kann Angst auch dadurch entstehen, dass sie an anderen beobachtet wird. Gerade vor Prüfungen wirkt die Angst anderer oft ansteckend! 34 B) Kognitive Erklärungsansätze Kognitive Erklärungsansätze betonen, dass nicht die objektive Situation, sondern deren subjektive Interpretation angstauslösend wirkt. Angstreaktionen werden als das Produkt kognitiver Verarbeitungsprozesse beschrieben. Im Zentrum stehen dabei die subjektive Erwartung und die Bewertung der Situation. 4.5. Lazarus’ Theorie der Angstauslösung und -verarbeitung LAZARUS beschreibt die Entstehung von Angst als mehrphasigen Bewertungsprozess: 1) Primary Appraisal: In einem ersten Schritt wird eine Situation im Hinblick auf das eigene Wohlergehen bewertet. Dabei wird zum einen die Relevanz der betreffenden Situation eingeschätzt, zum anderen deren Nützlichkeit bzw. Schädlichkeit. 2) Secondary Appraisal: In einem zweiten Schritt werden die eigenen Ressourcen eingeschätzt. Auch hierbei spielen sowohl Situations- als auch Dispositionsvariablen eine Rolle. Eingeschätzt werden die Ursache der Gefahr und die eigenen Bewältigungsmöglichkeiten (Coping). Ergibt die zweite Bewertung, dass keine direkte Handlung möglich ist, um die Bedrohung zu beseitigen, reagiert man mit Angst und entsprechenden Abwehrmechanismen. 3) Reappraisals: Während der Auseinandersetzung mit einer Situation kommt es nach LAZARUS fortwährend zu Neueinschätzungen. Nach dem Modell von LAZARUS ist Angst also durch Bedrohung, Hilflosigkeit und Unsicherheit gekennzeichnet! C) Psychoanalytischer Erklärungsansatz In der Psychoanalyse werden 3 Arten von Angst unterschieden: Die Realangst, die neurotische Angst und die moralische Angst. Die Realangst resultiert aus einer realen Gefahr, die neurotische Angst aus einem Konflikt mit dem „Es“ und die moralische Angst aus einem Konflikt mit dem „Über-Ich“. Als Ursache für die neurotische und moralische Angst werden meist nicht verarbeitete Konflikte in der Kindheit angenommen. In der pädagogischen Praxis spielt der psychoanalytische Ansatz kaum eine Rolle; Beachtung finden lediglich die von der Psychoanalyse postulierten Abwehrmechanismen (Verdrängung, Sublimierung, Fixierung, Verschiebung etc.) 35 5. Einflussfaktoren 5.1. Schule (Lehrer und Mitschüler) Lehrerverhalten: Konkurrenzbetontes Klassenklima (soziale Bezugsnormorientierung, autoritärer Führungsstil, übersteigerter Leistungsdruck etc.); Bestrafung (Strafarbeiten, Anschreien, körperliche Attacken, Demütigung etc.) Inhalt und Vermittlung des Lehrstoffs und Leistungsbewertung: Unklare Aufgabenstellungen, verwirrende Strukturierung, mangelnde Transparenz bezüglich der Prüfungsanforderungen, seltenes Feedback; zu hohe Anforderungen Schüler-Schüler-Verhältnis: Mobbing bzw. Bullying 5.2. Familie Hoher Leistungsdruck und übersteigerte Anforderungen (Zuwendung an gute Zensuren knüpfen, Bestrafung schlechter Leistungen; emotionale Kälte; Strenge etc.) Eltern und Geschwister als Angstmodelle Geschwisterrivalität 5.3. Schülerpersönlichkeit Überforderung (evtl. falsche Schulwahl) Fehlende Bewältigungsstrategien Mangelnde Unterstützung Soziale Isoliertheit 6. Prävention und Intervention Präventions- und Interventionsmaßnahmen können an 3 Problembereichen ansetzen: dem Lehrerverhalten, dem Elternverhalten und der Schülerpersönlichkeit. 6.1. Lehrer und Schule Um Ängste gar nicht erst entstehen zu lassen, sollten sich Lehrer darum bemühen, die Relevanz von Prüfungssituationen abzumildern, die Unsicherheit ihrer Schüler zu reduzieren und ihr Selbstvertrauen zu stärken. Dazu zählt u.a., die eigenen Anforderungen möglichst transparent zu machen: Schüler/innen sollten über die Lehrziele und Bewertungsmaßstäbe informiertund mit entsprechenden Vorbereitungshilfen (Übungen, Quellen etc.) ausgestattet werden. Zu hohe Anforderungen, Zeitdruck und verunsichernde Bemerkungen vor- und während einer Prüfung sind zu vermeiden! Abmilderung der Relevanz von Prüfungssituationen: viele „kleine“, statt wenige „große“ Prüfungen; Hinweis auf Kompensationsmöglichkeiten (mündliche Note) Aufbau von Prüfungen: einfache Aufgaben am Anfang, schwierige zum Schluss; die Reihenfolge der Bearbeitung freistellen etc. Das Selbstvertrauen der Schüler wird v.a. durch positive Rückmeldung gesteigert; abwertende Kommentare sind daher zu vermeiden! Überhöhter Konkurrenzdruck und eine soziale Bezugsnormorientierung wirken angstfördernd! Um die Entstehung sozialer Ängste zu verhindern, sollte daher ein kooperatives, emotional warmes Klassenklima geschaffen werden! Vermeidung von primären und sekundären Angstauslösern (Bestrafung, Anschreien, Demütigungen etc.) 6.2. Elternhaus Kommunikation und Kooperation mit dem Elternhaus 36 6.3. Schülerpersönlichkeit A) Angstabbau durch Imitationslernen Durch die Beobachtung eines angstfreien Modells kann die Angst reduziert werden. Dieses Phänomen kann v.a. in neuartigen Prüfungssituationen genutzt werden: z.B. wenn es darum geht, die Hausaufgaben vorzulesen oder ein Referat zu halten. Eine weitere Anwendung des Modelllernens besteht im gezielten Umsetzen (stellvertretende Densibilisierung). Dabei werden hochängstliche Schüler bewusst neben weniger ängstliche Schüler gesetzt. Ziel dieser Maßnahme ist es, dass die ängstlichen Schüler im Umgang mit ihren Sitznachbarn an Sicherheit gewinnen und sich Bewältigungsstrategien „abschauen“. Die Wirksamkeit dieser Methode konnte empirisch bisher allerdings nur bedingt bestätigt werden. In entsprechenden Experimenten (z.B. von IMMISCH oder ROST) wurde nicht nur in der Experimentalgruppe (umgesetzt), sondern auch in der Kontrollgruppe (nicht umgesetzt) ein Angstrückgang beobachtet. B) Systematische Desensibilisierung Die Methode der systematischen Desensibilisierung ist die klassische Methode zum Angstabbau; sie beruht auf dem Prinzip der klassischen Konditionierung (siehe: Pädagogische Psychologie: S. 4f.) und ist prinzipiell auch im Unterricht einsetzbar. Die dosierte Steigerung von Angstreizen ist allerdings im Schulalltag nur schwer zu realisieren. C) Unspezifische Entspannungsverfahren Die Einübung von Entspannungsverfahren (z.B. autogenes Training oder progressive Muskelrelaxation nach JACOBSON) kann durchaus sinnvoll sein! D) Unterrichtsgespräche: Thematisierung von Schulangst im Unterricht Klassengespräche über Angst (im Sitzkreis) bewirken, dass Angst als normales Phänomen erkannt wird (auch andere haben Angst!) und Bewältigungsstrategien ausgetauscht werden können. E) Leistungsförderung Beratung und Therapie sollten immer mit einer Leistungsförderung einhergehen!! Dementsprechend ist es wichtig, Schülern mit Leistungsangst entsprechende Arbeitsund Lernstrategien zu vermitteln und ihnen gegebenenfalls Nachhilfe anzubieten, um Wissens- und Lerndefizite aufholen zu können. 37 7. Aggression und Gewalt in der Schule 7.1. Begriffsbestimmung 7.1.1. Aggression Aggression ist ein Konstrukt, das je nach Theorie unterschiedlich definiert werden kann. Allgemein ist mit Aggression intentionales Verhalten gemeint, das darauf ausgerichtet ist, Schmerz bzw. Schaden zuzufügen. Zu Unterscheiden ist dabei zwischen instrumenteller und feindseliger Aggression. Instrumentelle Aggression dient einem Zweck; sie wird eingesetzt, um etwas damit zu erreichen (z.B. Anerkennung, Macht oder materielle Vorteile) Feindselige Aggression dient dagegen ausschließlich dazu, anderen zu schaden. Verhaltensweisen, die zwar Schaden anrichten, aber unabsichtlich sind, werden nicht als aggressiv bezeichnet. Insofern ist Aggression z.B. von Hyperaktivität und Impulsivität abzugrenzen. Unter ersterem versteht man eine desorganisierte, mangelhaft regulierte und überschießende motorische Aktivität; unter letzterem unüberlegtes Handeln und die Unfähigkeit, Bedürfnisse aufzuschieben. Die Art und Weise, in der aggressives Verhalten sich äußert, ist alters- und geschlechtsabhängig. Jungen neigen beispielsweise eher zu physischer Aggression; während Mädchen eher indirekte und verbale Ausdrucksformen wählen. Richtet sich die Aggression gegen Objekte spricht man von Vandalismus, richtet sie sich gegen Mitschüler, spricht man von „Bullying“ bzw. „Mobbing“. Das Gegenteil von aggressivem Verhalten ist prosoziales Verhalten. Prosoziales Verhalten ist darauf ausgerichtet, anderen zu helfen bzw. ihnen Gutes zu tun; entscheidend ist, dass das Verhalten freiwillig – und nicht im Rahmen von Aufgaben oder Pflichten erfolgt (BIERHOFF). 7.1.2. Gewalt Gewalt ist eine Ausdrucksform von Aggression. Sie kann verbaler, physischer oder indirekter Art (soziale Ausgrenzung) sein. Entscheidend ist, dass Gewalt mit relativer Macht einhergeht. Um also von „Gewalt“ sprechen zu können, muss der Täter dem Opfer in irgendeiner Weise überlegen sein (asymmetrisches Kräfteverhältnis). Richtet sich Gewalt wiederholt und über einen längeren Zeitraum gegen einen unterlegenen Mitschüler, spricht man von „Bullying“ bzw. „Mobbing“ (OLWEUS). 7.2. Empirische Befunde Gewalttätigkeit ist ein massives Problem, das prinzipiell alle Schularten betrifft. Das jüngste Beispiel liefern die Ereignisse an der „Rütli-Schule“. Anders als einschlägige Medienberichte vermuten lassen, ist allerdings kein genereller Anstieg schulischer Gewalt zu verzeichnen; das zeigt unter anderem eine Studie von TODT & BUSCH, in der Schüler und Schülerinnen zwischen 1993 bis 2002 regelmäßig zu ihren Erfahrungen mit Gewalt befragt wurden. 38 Die mit Abstand häufigste Form schulischer Gewalt ist verbaler und indirekter Art (üble Nachrede, soziale Ausgrenzung etc.). Körperliche Gewalt und Vandalismus werden deutlich seltener berichtet. Jungen sind insgesamt stärker von schulischer Gewalt betroffen als Mädchen. Sie machen nicht nur einen größeren Anteil der Täter aus, sondern zählen auch öfter zu den Opfern schulischer Gewalt. Einer Studie von OLWEUS (1995) zufolge berichten etwa 8- bis 10% der Jungen und ca. 2- bis 5 % der Mädchen, ihre Mitschüler zumindest manchmal zu schikanieren. Mädchen neigen dabei eher zu verbaler und indirekter Gewalt (üble Nachrede, soziale Ausgrenzung etc.), Jungen eher zu körperlichen Aggressionsformen. Studien, die an deutschen Schulen durchgeführt wurden, bestätigen diese Befunde weitgehend. Festzuhalten ist, dass ein Großteil der Schüler, nach OLWEUS 60- bis 70%, überhaupt nicht an schulischer Gewalt beteiligt ist! Nach OLWEUS gibt es keinen Unterschied zwischen Schulen in Großstädten und Schulen in ländlicheren Gegenden! Über die Hälfte der Opfer wendet sich nicht an die Eltern oder Lehrer (OLWEUS). Je stärker die Pausenaufsicht, desto geringer die Anzahl der Gewaltfälle (OLWEUS). Der Großteil der Gewaltfälle findet in der Schule und nicht auf dem Schulweg statt (OLWEUS). Zwischen dem Ausmaß der Gewalt und der Größe der Schule bzw. Klasse besteht kein signifikanter Zusammenhang (OLWEUS). Grundsätzlich nehmen die Gewaltprobleme in den höheren Klassen ab. A) Typische Gewalttäter (Bullies) Typische Bullies zeigen einen aggressiven Verhaltensstil – und zwar nicht nur gegenüber Gleichaltrigen, sondern auch gegenüber Lehrern und Eltern. Sie sind impulsiv und den Opfern meist körperlich und z.T. verbal überlegen. Anders als oft angenommen, dient ihre Aggression nicht der Kompensation von Schwäche. Vielmehr sind typische Bullies weniger ängstlich als andere und haben ein verhältnismäßig positives Selbstbild. Sie zeichnen sich durch ein stark ausgeprägtes Machtmotiv aus und sind in der Klasse durchschnittlich beliebt (meist gibt es einen kleinen Kreis von Bewunderern). Von den typischen Bullies zu unterscheiden sind passive Gewalttäter bzw. Mitläufer. Fazit: Aggressives Reaktionsmuster + (bei Jungen) körperliche Stärke B) Typische Opfer (Prügelknaben) Typische Opfer können als ängstlich und unsicher beschrieben werden. Sie haben ein negatives Selbstbild und sind den Tätern körperlich unterlegen (v.a. bei Jungen). In der Klasse sind sie weniger beliebt und meist isoliert. OLWEUS bezeichnet diese Art von Opfern als passive Opfer. Sie bilden die Mehrheit. Davon zu unterscheiden sind „provozierende Opfer“, die oft Täter und Opfer zugleich sind. Sie sind nach OLWEUS weitaus seltener. Fazit: Ängstliches Reaktionsmuster + (bei Jungen) körperliche Schwäche Spätfolgen: Junge Erwachsene (um die 23), die während der Schulzeit gemobbt wurden, haben einen niedrigeren Selbstwert und eine erhöhte Neigung zu Depression. 39 7.3. Aggressionstheorien Zur Entstehung von Aggression gibt es verschiedene Theorien. Grundsätzlich lassen sich Instinkt- oder Triebtheorien von lerntheoretischen Ansätzen unterscheiden. Eine dritte Perspektive stellt die Frustrations-Aggressions-Theorie dar. 7.3.1. Triebtheorien Triebtheorien gehen davon aus, dass es sich bei Aggression um ein angeborenes Verhaltensmuster handelt; zu unterscheiden ist dabei zwischen psychoanalytischenund ethologischen Triebtheorien. 7.3.1.1. Die psychoanalytische Triebtheorie nach Freud Nach FREUD wird unser gesamtes Verhalten durch 2 Triebe bestimmt: den Todestrieb („Thanatos“), zu dem er die Aggression zählt, und den Sexual- bzw. Selbsterhaltungstrieb („Eros“), der sich primär in der Libido äußert. Nach FREUD sind Triebe durch Quelle, Drang, Ziel und Objekt gekennzeichnet. Aufgrund physiologischer Bedürfnisse (Quelle) baut sich Energie bzw. Spannung auf (Drang). Ziel ist es, diese Spannung an einem geeigneten Objekt zu entladen. Ausgehend von diesem „Hydraulik-Modell“ kommt FREUD zu der sog. „KatharsisHypothese“, die besagt, dass die regelmäßige Entladung aggressiver Energie notwendig ist, um größere Aggressionen zu verhindern. 7.3.1.2. Die ethologische Triebtheorie von Konrad Lorenz Die Verhaltensbiologie oder Ethologie betrachtet den Mensch in Analogie zum Tier; sie geht davon aus, dass sich menschliches Verhalten im Laufe der Evolution herausgebildet hat und spezifische Funktionen erfüllt. Aus dieser Perspektive beschreibt KONRAD LORENZ Aggression als einen von 4 grundlegenden Trieben. Aggressionen haben ihm zufolge einen adaptiven Wert; sie dienen u.a. der Verteidigung des Rangplatzes, der Notwehr und der Exploration und sind insofern überlebensnotwendig. Wie FREUD geht LORENZ davon aus, dass sich Aggressionen entladen müssen. Die Abfuhr aggressiver Energie hängt dabei von auslösenden Reizen ab. Um den Aggressionstrieb zu regulieren und Eskalationen zu vermeiden, schlägt er Ersatzhandlungen vor, wie z.B. sportlichen oder akademischen Wettstreit. Insofern ist auch Lorenz ein Vertreter der „Katharsis-Hypothese“. 7.3.1.3. Kritik Triebtheorien sind keine Erklärungen im eigentlichen Sinn. Sie beruhen auf einem Zirkelschluss: Weil es Gewalt gibt, gibt es einen Aggressionstrieb. Weil es einen Aggressionstrieb gibt, gibt es Gewalt. Triebtheorien legen ein pessimistisches und fatalistisches Menschenbild nahe und sind daher wenig konstruktiv: Wenn Aggression ein angeborener Trieb ist, macht es keinen Sinn, sich gegen sie zu sträuben. Die Katharsis-Hypothese kann als empirisch widerlegt gelten: Anstatt zu einer Aggressionsabbau zu führen, scheinen sich aggressive Verhaltensweisen langfristig sogar zu verstärken! Operantes Lernen Selbstwahrnehmungstheorie von BEM (Wir schließen aus unserem Verhalten auf unsere Einstellungen) Kognitive Dissonanz-Theorie von FESTINGER (Wir passen unsere Einstellungen unserem Verhalten an; dementsprechend führt aggressives Verhalten langfristig zu einer Dehumanisierung) 40 7.3.2. Die Frustrations-Aggressions-Hypothese In ihrer strengen Form (DOLLARD) besagt die Frustrations-Aggressions-Theorie, dass Aggression immer die Folge von Frustration ist und Frustration immer zu einer Form der Aggression führt. Frustration tritt auf, wenn eine zielgerichtete Handlung gestört oder unterbrochen wird. Je näher das Ziel und je größer die Erwartung bezüglich des Ziels, desto größer die Frustration. In einer abgeschwächten Form besagt die Frustrations-Aggressions-Hypothese, dass Aggression zwar die dominante, aber nicht die einzige Reaktion auf Frustration darstellt. Nach BERKOWITZ ruft Frustration entweder Ärger oder Furcht hervor. Ärger führt dabei zu Aggression, allerdings nur in Kombination mit entsprechenden Hinweisreizen. Hinweisreize, die aggressives Verhalten hervorrufen bzw. wahrscheinlicher machen, sind alle Reize, die mit Ärger bzw. Aggression assoziiert werden (Waffen etc.). Am plausibelsten ist die Frustrations-Erregungs-Hypothese, die besagt, dass Frustration zu erhöhter Erregung führt. Wie diese Erregung interpretiert wird, d.h. zu welcher Emotion sie führt, hängt von der Situation und dem Attributionsstil der Person ab. Eine Frustration führt z.B. eher zu Ärger und Aggression, wenn dem Frustrationsauslöser eine Absicht unterstellt wird. Mit welchem Verhalten die Emotion einhergeht hängt von der Lerngeschichte der Person ab (BANDURA). Aggression ist nur dann die dominante Reaktionstendenz, wenn sie als Mittel zur Erregungsreduktion gelernt wurde. Anwendung: Jede Form von Frustration zu vermeiden ist weder sinnvoll, noch möglich; stattdessen sollte ein vernünftiger Umgang mit Frustrationen gelernt werden. 7.3.3. Lerntheoretische Erklärungsansätze 7.3.3.1. Klassisches Konditionieren Durch klassisches Konditionieren lernen wir, Wut und Ärger auf neutrale Reize zu übertragen. Hat uns eine Person wiederholt geärgert, kann nach einiger Zeit schon ihr Anblick genügen, um Wut und Aggressionen bei uns auszulösen. 7.3.3.2. Operantes Konditionieren Sind aggressive Verhaltensweisen erfolgreich, was sie leider oft genug sind, werden sie verstärkt. Ein Schüler, der sich durch das Schikanieren eines Mitschülers Anerkennung bei der Klasse erwirbt oder die Aufmerksamkeit des Lehrers auf sich zieht, wird kaum damit aufhören. Das Durchbrechen dieses Mechanismus ist aus 3 Gründen schwierig: 1) Um Verhalten zu löschen, darf es nicht verstärkt-, es muss konsequent und von allen ignoriert werden. Eine Bedingung, die in der Praxis kaum erfüllt werden kann (siehe: Pädagogische Psychologie: S.8). Das ist v.a. deshalb problematisch, weil ein Verhalten, das nur gelegentlich nicht zum Erfolg führt, intermittierend und damit besonders wirkungsvoll verstärkt wird! Ein inkonsequentes Vorgehen gegen Gewalt ist insofern nicht nur weniger effektiv, sondern sogar kontraproduktiv! 41 2) Ein 2. Problem besteht darin, dass sich ungute erzieherische Interaktionen schnell stabilisieren („Verstärkungsfallen“). Ein Kind, dem es mit Wutausbrüchen gelingt, seinen Willen durchzusetzen, wird in diesem Verhalten positiv verstärkt. Die Mutter, die dem Kind nachgibt, wird negativ verstärkt. Dadurch, dass sie nachgibt, beruhigt sich das Kind: ein aversiver Reiz entfällt! 3) Man kann zwischen primären (angeborenen) und sekundären (erlernten) Verstärkern unterscheiden. Durch klassische Konditionierung kann Gewalt zu einem sekundären Verstärker werden; in diesem Fall wird sie zum Selbstzweck. Ist aggressives Verhalten wiederholt an die Erfüllung von Bedürfnissen gekoppelt, bekommt Aggression einen eigenen Wert und wird zum sekundären Verstärker! 7.3.3.3. Modelllernen Das Lernen neuer Verhaltensweisen kann mit klassischer- und operanter Konditionierung nur bedingt erklärt werden; nach BANDURA wird solches Verhalten durch die Beobachtung und Nachahmung anderer gelernt. EXPERIMENT (HICKS) HICKS führte 5-jährigen Kindern einen kurzen Film vor, in dem von einem Modell 4 verbale- und 4 körperliche Aggressionen gezeigt wurden. Eine der gezeigten Aggressionen bestand z.B. darin, eine Puppe mit einem Plastikhammer zu schlagen. Als Modell agierte entweder ein Mann, eine Frau, ein Junge oder ein Mädchen. Die Kontrollgruppe bekam keinen Film gezeigt. Nach der Filmvorführung folgte eine kleine Frustration und die Vpn bekamen Zeit, mit verschiedenen Gegenständen zu spielen (darunter eine Puppe und ein Plastikhammer). Das Hauptergebnis bestand darin, dass in allen 4 Versuchsgruppen viele der zuvor im Film gesehenen Aggressionen imitiert wurden, während in der Kontrollgruppe keine imitativen Aggressionen beobachtet werden konnten. Am meisten Aggressionen wurden dabei gezeigt, wenn das Modell ein Junge war. Ein halbes Jahr später beobachtete HICKS die Vpn nach einer kleinen Frustration noch einmal (allerdings ohne ihnen vorher den Film zu zeigen); der Haupteffekt blieb (wenn auch in geringerem Ausmaß) bestehen: Noch immer ahmten Kinder, die (ein halbes Jahr zuvor!) einen der Filme gesehen hatten, viele der Aggressionen nach. Am meisten imitative Aggressionen zeigte dabei die Gruppe, die das männliche Modell beobachtet hatte. In einem ähnlichen Experiment zeigte BANDURA, dass der Nachahmungseffekt auch bei verfremdeten Modellen (Trickfilmfiguren) eintritt. Besonders wahrscheinlich ist eine Nachahmung dann, wenn das Modell für sein Verhalten belohnt wird (stellvertretende Verstärkung), was fataler Weise in den meisten Filmen der Fall ist! FAZIT: Aggression umfasst sowohl angeborene-, als auch erlernte Komponenten. 42 7.4. Bedingungsfaktoren 7.4.1. Familie Nach OLWEUS wird Gewalttätigkeit durch mangelnde Wärme, eine Laissez-faireHaltung (keine Grenzen) und körperliche Bestrafung gefördert. Zwischen dem sozioökonomischen Status der Familie und Gewalttätigkeit besteht kein Zusammenhang. Ungünstige Erziehungsbedingungen werden allerdings durch familiäre Probleme (Scheidung, Alkoholismus etc.) begünstigt. 7.4.2. Schule Einstellung und Engagement der Lehrer haben einen erheblichen Einfluss auf die Gewalttätigkeit an Schulen. Dementsprechend gibt es z.T. massive Unterschiede zwischen Schulen. Wie Bullying entsteht: Ein Bully findet ein Opfer und verleitet sein Umfeld dazu, dieses ebenfalls zu schikanieren. Die sozialpsychologischen Prozesse, die dabei eine Rolle spielen, sind „soziale Ansteckung“, „Modelllernen“ (der Bully wird für sein aggressives Verhalten belohnt; er geht als Sieger aus den Konflikten hervor); Deindviduation (die Hemmschwelle für aggressives Verhalten wird gesenkt); Verantwortungsdiffusion; veränderte Wahrnehmung des Opfers 7.4.3. Medien Dass zwischen aggressivem Verhalten und dem Konsum gewalttätiger Filme und Computerspiele ein positiver Zusammenhang besteht, ist vielfach nachgewiesen. Darüber hinaus gibt es Experimente, die nahe legen, dass dieser Zusammenhang nicht nur korrelativ, sondern kausal zu interpretieren ist! EXPERIMENT (LIEBERT et al.): Kinder, die einen Spielfilm gezeigt bekommen, in dem Gewalt vorkommt, sind beim Spielen danach aggressiver als Kinder, die eine gewaltfreie Sportsendung gezeigt bekommen haben. Die von Vertretern der Medien immer wieder vorgebrachte „Katharsis-Hypothese“ (s.o.) kann als widerlegt gelten. Stattdessen ist davon auszugehen, dass Gewalt in den Medien eine Vielzahl ungünstiger „Nebenwirkungen“ mit sich bringt: 1) Erhöhte Akzeptanz von Gewalt; Hemmmechanismen gegen aggressive Reaktionen werden geschwächt. 2) Abstumpfung/Desensibilisierung/Habituation (physiologisch) weniger Empathie/Sympathie mit Gewaltopfern 3) Soziales Lernen (=Imitation), da Gewalttäter in den Medien oft als Helden dargestellt werden. 4) Priming der Emotion Ärger / Priming der aggressiven Reaktion Die eigenen Gefühle werden eher als Ärger interpretiert; aggressive Verhaltensschemata sind verfügbarer 5) Die Welt insgesamt wird als unsicherer und gewalttätiger wahrgenommen, als sie vielleicht tatsächlich ist – und dementsprechend das Verhalten anderer eher als Angriff interpretiert. 43 7.5. Prävention und Intervention DAN OLWEUS schlägt ein umfassendes Präventions- und Interventionsprogramm vor, das mittlerweile in verschiedenen Schulen in Norwegen erfolgreich angewandt wurde. Die Gewaltprobleme in den beteiligten Schulen gingen innerhalb von 2 Jahren um 50% und mehr zurück. Ziel des Programms ist es, mittelbare und unmittelbare Gewalt langfristig zu unterbinden und die Beziehungen zwischen den Schülern zu verbessern. Dazu setzt das Programm an 3 Ebenen an: Es sind Maßnahmen auf Schulebene, Klassenebene und persönlicher Ebene vorgesehen. Die Grundprinzipien des Programms lassen sich folgendermaßen zusammenfassen: 1) Es soll eine schulische Umgebung geschaffen werden, die durch Wärme und Anteilnahme gekennzeichnet ist. 2) Gleichzeitig sollen klare Grenzen gesetzt werden. Es muss unmissverständlich klar gemacht werden, dass Gewalt unter keinen Umständen akzeptiert wird. Dazu ist ein konsequentes Eingreifen erforderlich. 3) Um dieses zu ermöglichen bedarf es einer angemessenen Aufsicht und Überwachung! Damit das Programm gelingen kann, ist es notwendig, bei Lehrern, Schülern und Eltern ein Problembewusstsein zu schaffen und entsprechende Betroffenheit hervorzurufen (Schulethos). Gewalt darf weder bagatellisiert, noch als „normal“ gerechtfertigt werden. 7.5.1. Maßnahmen auf Schulebene Fragebogenerhebung => Genauere Informationen über das Problem (wie viele Schüler sind beteiligt bzw. betroffen, was sind Problemzonen etc.) => differenziertes Problembewusstsein und Betroffenheit Pädagogischer Tag: Vorstellen der Umfrageergebnisse; allgemeine Informationen über die Bedingungen von Gewalt => Aufstellen eines langfristigen Handlungsplans. Wichtige Maßnahmen Verbesserung der Aufsicht (hohe „Lehrerdichte“ in den Pausen und Freistunden => unbedingt Eingreifen!) Einrichtung eines Kontakttelefon (um Opfern zu ermöglichen, ihre Probleme anonym zu besprechen) Kooperation zwischen Lehren und Eltern (Eltern müssen über die Vorhaben informiert und zu aktiver Beteiligung eingeladen werden) Arbeitsgruppen zur Verbesserung des Schulmilieus (Pausenhof und Klassenzimmergestaltung => Ermöglichung sinnvoller Freizeitgestaltung; wohnliche Atmosphäre) Schüler zu Streitschlichtern (Mediatoren) ausbilden - mit der Aufgabe, zumindest Alltagsstreitigkeiten zu schlichten. 44 7.5.2. Maßnahmen auf Klassenebene Aufstellen von Klassenregeln gegen Gewalt Die Regeln und mögliche Strafen bei Missachtung sollten in der Klasse diskutiert werden; die Regeln sind an sichtbarer Stelle im Klassenzimmer aufzuhängen. Lob und nichtfeindliche Strafen Prosoziales Verhalten muss positiv verstärkt werden; aggressives Verhalten dagegen angemessen (d.h. nicht feindlich und schon gar körperlich) bestraft werden. Regelmäßige Klassengespräche (am besten ein Mal die Woche) Kooperative Lernformen Auf Gruppenzusammensetzung achten, positive Interdependenz und „Einzelverantwortlichkeit“ realisieren etc. (siehe: Sozialpsychologie) Gemeinsame positive Aktivitäten unbedingt darauf achten, dass wirklich alle beteiligt sind und niemand ausgeschlossen wird! 7.5.3. Maßnahmen auf persönlicher Ebene Gespräche mit Mobbern Gespräche mit Gemobbten Gespräche mit den Eltern betroffener Schüler 45