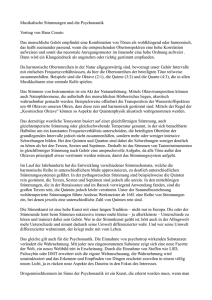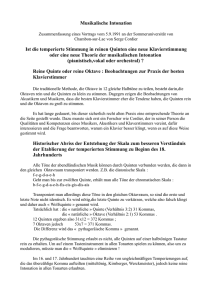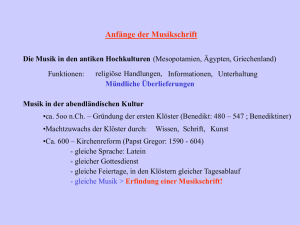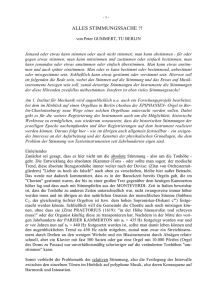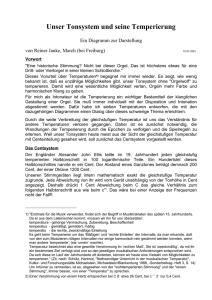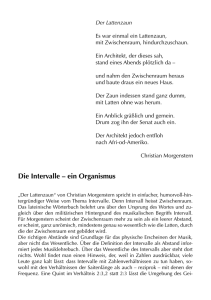„Schwebungen“ - ein Softwarewerkzeug zur interaktiven Vermittlung
Werbung

Universität für Musik und darstellende Kunst Wien „Schwebungen“ - ein Softwarewerkzeug zur interaktiven Vermittlung von Stimmungs- und Intonationsgrundlagen Schriftliche Hausarbeit zur Erlangung des akademischen Grades „Magister artium“ von Michael Meixner Betreuer: Ao.Univ.-Prof. Mag. Dr. Matthias Bertsch Institut für Wiener Klangstil Wien, im April 2004 Inhaltsverzeichnis Einleitung ................................................................................................................. 2 I. Grundlagen ............................................................................................................ 5 Intervalle und Zahlenverhältnisse .......................................................................... 5 Musikalische Intervalle innerhalb der Teiltonreihe .............................................. 12 Konsonanz – Dissonanz ...................................................................................... 23 Stimmung und Intonation .................................................................................... 28 Mathematisch-physikalischer Exkurs: Teiltonreihe und Spektrum....................... 37 II. Arten der Vermittlung ........................................................................................ 41 III. „Schwebungen“ – die Software ......................................................................... 45 Anforderungen an das Interface........................................................................... 45 Benutzungsarten.................................................................................................. 45 Die Programmierumgebung MAX/MSP.............................................................. 46 Die Oberfläche von „Schwebungen“ ................................................................... 49 IV. Anwendungsbeispiele ....................................................................................... 58 V. Zusammenfassung.............................................................................................. 62 Literaturverzeichnis ................................................................................................ 64 Anhang 1: Salinas Tonsystem in: De musica libri VII (1577) .................................. 67 Anhang 2: Programmdokumentation....................................................................... 68 1 Einleitung Der Themenkreis musikalische Stimmungen, Stimmungssysteme, Intervallverhältnisse, Konsonanz/Dissonanz-Fragen, Intonation und damit verbundene Gebiete der Musiktheorie und der praktischen Musikausübung erweist sich in der Praxis auch für erfahrene Musiker oft als eigentümlich unzugänglich: nicht selten herrscht eine gewisse Reserviertheit gegenüber den notwendigerweise mit Mitteln der Mathematik und Physik operierenden Darstellungen des Themas. Zahlen und Logarithmen wollen nicht so recht zum „Gefühl“ passen, das ein Musiker (oder auch interessierter Laie) mit seinem Musikerlebnis verbindet. Dadurch entsteht aber in Fragen, deren Behandlung einen gewissen Anteil Rationalität erfordern, Unsicherheit und manchmal Hilflosigkeit. Meinungen und biografische Zufälligkeiten ersetzen solide Diskussionsgrundlagen. Dass Probleme dieser Art nicht ganz neu sind, geht aus folgendem Ausschnitt aus der „Zuschrifft“ hervor, die Andreas Werckmeister seiner „Musicalischen Temperatur“ von 1691 voranstellt (Werckmeister 1691) „…und haben das Clavier auf gewisse Maße eingetheilet und temperieret. Hierinnen sind nun wieder unterschiedliche Meynungen vorgebracht worden / einer hat das Ding bey diesem, der andere bey einem anderen Zipffel angefasset / die meisten haben gleichsam im finstern getappet / und daher selten etwas gefunden / wie es von Natur seyn sollte / weil sie den Mathematischen Grund / und die ocularem demonstrationem nicht alle gehabt: Denn wenn sie meineten / die Stimmung wäre in diesen concordantien richtig / so fehlte es wieder an den andern.“ Wie sich im Text sobald zeigt, ist die notwendige Schulung, nämlich die Darstellung der Klänge und deren Verhältnisse für das Ohr als auch für das Auge, die Werckmeister anspricht, leicht zu bewerkstelligen – das Mittel dazu ist schon damals von ehrwürdigem Alter, offenbar aber ungebrochen praktikabel: „Wie nun dieser Weg nicht besser / als durch das Monochordum, den Augen und Ohren kann vorgebildet und gezeiget werden: So habe ich diese / zwar mühsame / doch hochnöthige und nützliche Arbeit vornehmen / und durch Hülffe der Mathesis, Gott zu ehren / dem Nechsten zum besten / in diesem Tractätgen / und auff den dabey vorhandenen monochordischen Abrisse oculariter zeigen wollen 2 / wie man am besten zu solcher temperierten Stimmung […] gelangen könne / und wie einige bißher im schwange gegangene irrige Meinungen möchten gezeiget und verändert werden.“ Abb. 1: Werckmeister, Musicalische Temperatur (1691): Darstellung verschiedener Stimmsysteme anhand einer Monochordteilung Die Stimmungskämpfe des 17. und 18. Jahrhunderts sind ausgetragen, die Polemiken, die zwischen den Zeilen anklingen, historisch, die Grundforderung aber selbstverständlich weiterhin aufrecht: der Musiker (der musikinteressierte Laie sei immer mit eingeschlossen) soll nicht die Augen vor den einfachen mathematischen und physikalischen Grundlagen des Metiers verschließen – was rational darstellbar ist, soll eine entsprechende Darstellung bekommen, der Lohn der „zwar mühsamen, doch hochnöthigen und nützlichen Arbeit“ wird ein beträchtlicher sein: klare Grundlagen der Diskussionen zum Thema. Der oft halbbewusst befürchtete Schaden – Austrocknung des Gefühls durch rationale Betrachtung – wird schwerlich eintreten, der Lohn: erweiterte musikalische Kompetenz und tiefergehendes Strukturverständnis – wird die Beziehung zur Musik vertiefen. Die Benützung eines Monochordes kann auch heutigen Musikern gelegentlich anempfohlen werden, neuere Mittel der Darstellung treffen aber vielleicht noch eher auf Resonanz: die spielerischen Möglichkeiten, die sich durch moderne Medien eröffnet haben, lassen die „hochnöthige Arbeit“ viel weniger „mühsam“ erscheinen. Insbesondere der Computer bietet sich als Möglichkeit für alle diejenigen an, die kein Cembalo oder ähnliches Instrument zu Hause haben, das ganz von selbst zur Beschäftigung mit diesen Fragen verleitet, sobald man sich nicht mehr den Presets eines Stimmgerätes ausgeliefert wissen will. 3 Erfahrungsgemäß findet die erste Begegnung mit dem Thema in Form von Büchern, oder vielleicht sogar CD(ROM)s mit einigen Musikbeispielen statt, das Ergebnis ist in den allermeisten Fällen zwar Verstehen, aber ohne die wünschenswerte Nachhaltigkeit. „Learning by doing“, also der Erwerb von Fertigkeiten erweist sich a la longue als ertragreicher als pure Information. Das vorzustellende Computerprogramm versucht einen Schritt in die skizzierte Richtung zu gehen: Ausprobieren und Üben auf einem entsprechenden Spielfeld (in diesem Fall dem Bildschirm) sollen das entsprechende aktive Wissen fördern. Im Folgenden werden zuerst die Themen umrissen und eingegrenzt, deren Kenntnis mit der vorgestellten Software erworben werden soll, darauf soll kurz auf verschiedene vorhandene Lehrmitteltypen und deren Vor- und Nachteile eingegangen werden. Es folgt eine Beschreibung der Software samt einem Ausblick auf ihre weiteren Entwicklungsmöglichkeiten. Schließlich wird an einigen Beispielen gezeigt, wie das Programm beim Erlernen der beschriebenen Wissensbereiche eingesetzt werden kann. 4 I. Grundlagen Intervalle und Zahlenverhältnisse Für die Wahrnehmung von musikalischen Intervallen gilt: nicht die Differenz zweier Frequenzen ist maßgebend, sondern ihr Verhältnis. Zwei Sinustöne mit den Frequenzen 100 und 150 Hz ergeben nicht das gleiche Intervall wie ein Frequenzpaar 1000 und 1050 Hz, sehr wohl aber die Paare 100 zu 150 (= 100 x 1,5) und 1000 zu 1500 (= 1000 x 1,5). Will man in diesem Beispiel den Gebrauch von Dezimalzahlen vermeiden, kann man mit den einfacheren natürlichen Zahlen operieren, indem man passende Verhältnisse wählt: 1,5 = 3/2, also: 100 × € 3 = 150 2 und 1000 × 3 = 1500 2 Beide Frequenzpaare ergeben gehörsmäßig das gleiche Intervall (in diesem Fall die rei€ 3 ne Quint), das in beiden Fällen mit 1: , oder noch einfacher 2:3 musikalisch korrekt 2 beschrieben ist. Für das Addieren von Intervallen (also etwa deren Übereinanderschichten in einem Ak€ kord) gilt folgerichtig, dass deren Verhältnisse miteinander multipliziert werden müssen. Dies soll am Beispiel eines einfachen Durdreiklanges gezeigt werden.1 Dem musikalischen Intervall der großen Terz entspricht ein (Frequenz-)Verhältnis von 4:5, dem der kleinen Terz eines von 5:6. Diese beiden Intervalle übereinandergestellt ergeben also: 5 6 30 3 × = = . Unterster und oberster Ton des Dreiklangs stehen im Verhältnis 4 5 20 2 2:3, also dem Intervall der reinen Quinte. Der Durdreiklang als Verhältnis 4:5:6 lässt € sich wiederum leicht auf „reale“ Frequenzen anwenden, für den A-Dur Dreiklang (mit a’= 440 Hz): 1 Mit diesem Beispiel, das hier nur zur Demonstration der Rechenmethode dient, soll nicht Theorien Vorschub geleistet werden, die dur-moll-tonale Akkorde ausschließlich als Schichtung von Terzen begreifen wollen. 5 Für die Autoren des europäischen Mittelalters und der Renaissance, die ja keinesfalls mit Frequenzen, sondern mit physischen Maßen klingender Körper (Saiten, Pfeifen usw.) befasst waren, stellte sich die Rechnung umgekehrt dar; so entsteht die Oktave durch Teilung einer Strecke in zwei gleiche Hälften, nicht durch Multiplikation (an den beteiligten Verhältniszahlen selbst ändert sich natürlich nichts); die oben erwähnte Quinte wird durch Wegnehmen eines Drittels einer Strecke gefunden, der Teilungspunkt befindet sich also bei 2/3 des Ausgangsmaßes. So wird in einem anonymen Traktat des 11. Jahrhunderts die geometrische Konstruktion einer Tonleiter auf dem Monochord folgendermaßen beschrieben (zitiert nach Lindley 1987: 114f) : „An das eine Ende des Monochords…setze ein Γ, das ist ein griechisches G … Teile dann (die Strecke) von diesem Γ bis zu dem anderen Punkt am anderen Ende (des Monochords) in neun (Teile) , und wo das erste Neuntel von Γ endet, schreibe den Buchstaben A; das heißt der erste Schritt. Von diesem ersten Buchstaben A an teile gleicherweise wiederum bis zum Ende der Strecke neun (Teile) und setze an das Ende des (nächsten) Neuntels den Buchstaben B für den zweiten Schritt. Dann geh zurück zum Anfang und teile (die Strecke) von Γ (bis zum anderen Ende) in vier (Teile) und setze für den 3. Schritt den Buchstaben C. Vom ersten , A, aus teile gleicherweise (die Strecke bis zum Ende) in vier (Teile) und setze für den vierten Schritt den Buchstaben D.“ Es werden also zuerst zwei Ganztöne 9:8 aneinandergesetzt (Γ–A und A–B, in modernen Notennamen: G–A und A–H), anschließend werden reine Quarten – 4:3 – von Γ und A aus gebildet, damit die diatonische Skala von G bis D komplettiert. Bemerkenswert ist hierbei, dass für die Großterz, die zwischen G bis H entsteht, nicht das einfachere Verhältnis 5:4 herangezogen wird: für mittelalterliche Theoretiker ist die Terz als aus zwei Ganztönen zusammengesetzt gedacht („Ditonus“), also 9:8 × 9:8 = 81:64. Diese etwas größere („pythagoreische“) Terz wirkt vergleichsweise unruhiger, „dissonanter“ als ihre 5:4-Version. Terzen galten in der Musiktheorie des Mittelalters als Dissonan6 zen, d. h. sie waren auflösungsbedürftig. Ernst Apfel gibt in Diskant und Kontrapunkt ein Beispiel anhand eines Traktates aus der Ars nova, De musica seu lucidarium in arte musicae planae des Marchettus von Padua (Apfel 1982: 51) „Marchettus von Padua teilt die für die Mehrstimmigkeit brauchbaren Zusammenklänge in Konsonanzen und Dissonanzen ein. Konsonanzen sind die Quart, Quint, Oktav, Quart und Quint der Oktav (sowie Doppeloktav). Die Terz, Sext und Dezim sind Dissonanzen. Diese Dissonanzen bedürfen, wie schon aus ihrer Bezeichnung als solche hervorgeht, der Auflösung in die Konsonanzen. Zu diesem Zweck werden sie je nach der Größe der folgenden Konsonanzen durch Akzidentien verändert, diesen an Größe angenähert. Vor der Quint erscheint also die große Terz, vor dem Einklang die kleine und vor der Oktav die große Sext.“ Eine solche Auflösung des Ditonus in eine Quint (neben einer solchen der großen Sexte in die Oktave) finden wir etwa am Anfang des folgenden Beispiels, eines dreistimmigen Madrigals des Jacopo da Bologna: Abb. 2: Jacopo da Bologna, Si come al Canto (Wiedergabe nach: Die Musik des Mittelalters; 396) Im 15. Jahrhundert wird die Terz zur Konsonanz umgewertet, zögernd lösen sich die Theoretiker von pythagoreischen Grundsätzen und machen den Weg frei zur Emanzipation der „Naturterz“ (Ruhnke 1996: 1080): „Die Komponisten der frankoflämischen Schule hatten in ihrer Vokalmusik den Terzen allmählich Positionen eingeräumt, in denen gute Sänger sie zweifellos dem in der Obertonreihe gegebenen Naturintervall (5:4) entsprechend, nicht aber pythagoreisch (81:64) intoniert haben, denn von W. Odington bis Fr. Gaffurius 7 mussten Theoretiker immer wieder zugeben, dass Terzen und Sexten in der Praxis wie Konsonanzen klängen.“ Die Bewertung von Intervallen, so erweist sich an diesem Beispiel, unterliegt neben ihren rein rational beschreibbaren Eigenschaften auch kultureller Interpretation. Das Denken und Messen in proportionalen Verhältnissen ist also charakteristisch für die mittelalterliche Musiktheorie, sie bestimmt aber noch über weite Strecken die Spekulationen und Berechnungen der Stimmungstheoretiker des 15. bis 18. Jahrhunderts und erfährt mit der Entdeckung der Teiltonreihe neue Nahrung (siehe Exkurs Teiltonreihe und Spektrum). Um die Qualitäten der verschiedenen Zahlenverhältnisse zu kategorisieren wurde ein umfangreicher Katalog von Bezeichnungen entwickelt, hier in der Darstellung durch Otto Gibelius in seiner Introductio musicae theoricae didacticae (1660) im Kapitel De proportione: Abb. 3: Gibelius, De proportione (nach Lindley 1987: 115) 8 Führt man diese Art der Rechnung für ein komplettes Tonsystem europäischer Prägung durch, ergeben sich wegen alsbald auftretender Inkongruenzen (davon mehr weiter unten) für viele Töne verschiedene Varianten und äußerst komplizierte Verhältnisse, die sich in einem rein proportionalen, nur mit Ganzzahlen operierenden System nur noch mit sehr großen Zahlen darstellen lassen, wie folgendes eindrucksvolle Beispiel belegt, in dem die vielfachen Proportionsverkettungen zu einem kleinsten gemeinsamen Vielfachen von 57600 führen: Abb. 4: Salinas, De musica libri VII (1577) (Wiedergabe nach Lindley 19897: 173) siehe auch die Erläuterungen zu dieser Abbildung im Anhang Centrechnung Die Entwicklung der Logarithmen gab ein anderes Mittel an die Hand, Intervalle zahlenmäßig zu beschreiben. Erste Überlegungen zu logarithmischem Rechnen gehen auf das Ende des 15. Jahrhunderts zurück (1484, Chuquet), 1617 erscheinen die Logarithmentafeln von H. Briggs. Die Anwendung auf Intervallberechnungen erfolgt dann vor 9 allem durch Huygens (1661), Newton (1665) und schließlich Euler, der 1739 vorschlägt, den Logarithmus zur Basis 2 zu benutzen: dies entspricht der gehörsmäßigen Gliederung des Tonraumes in Oktaven. Abb. 5: Newtons Stimmungsberechnungen unter Verwendung von Logarithmen (Wiedergabe nach Lindley 1987: 206) 1875 führt A. J. Ellis die heute übliche Centrechnung ein. (Für eine umfassende Übersicht über die Entwicklung der Logarithmen und ihre Anwendung in der Musiktheorie siehe Martin Ebeling, Tonhöhe S. 37 ff.) Das Hauptmaß dieser Methode ist der gleichstufig temperierte Halbton, der proportional in 100 gleiche Teile, eben cent geteilt wird. Der Oktave - 12 Halbtöne - besteht dann aus 1200 solchen Feinstufen. Mathematisch drückt sich das Verfahren folgendermaßen aus: Intervall (cent) = 1200log 2 f1 f2 Der Logarithmus zur Basis 2 entspricht dem Oktavmaß, f1/f2 dem Verhältnis der Fre€ quenzen, die Multiplikation mit 1200 der gewählten Feinteilung. Die obenerwähnte reine Quinte 2:3 ergibt dann: 1200log 2 3 = 701,96 cent 2 die (untemperierte, s. u.) große Terz: € 1200log 2 5 = 386,31 cent 4 Die Differenz zwischen diesen beiden Intervallen – die kleine Terz – lässt sich durch € einfache Subtraktion gewinnen: 702 – 386 = 316 cent. 10 Die Centrechnung hat mehrere Vorteile: • dem logarithmischen Tonhöhenempfinden des Gehörs wird Rechnung getragen • Intervalladditionen/subtraktionen werden gegenüber den Multiplikationen und Divisionen der Proportionsrechnung wieder zu Addition/Subtraktionen vereinfacht. • für Vermessung von Intonation und Stimmungen steht eine probate Werteinheit zur Verfügung. Ein Nachteil dieser Methode wird in den oben gezeigten Umrechnungen auch sichtbar: an die Stelle einfacher („schöner“) Verhältnisse, die sich leicht anschaulich darstellen lassen, treten anonyme, „gesichtslose“ Dezimalzahlen. 11 Musikalische Intervalle innerhalb der Teiltonreihe Musikalische Töne lassen sich physikalisch als komplexe Töne beschreiben, sie bestehen aus der Überlagerung reiner harmonischer Schwingungen (Sinustöne) (siehe Exkurs Teiltonreihe und Spektrum). Wenn die einzelnen Teiltöne in ganzzahligen Frequenzverhältnissen stehen (1:2:3:4:5:6…), entsteht für das Gehör einen Ton mit bestimmbarer Tonhöhe. (Näheres siehe unter Mathematisch-physikalischer Exkurs: Teiltonreihe und Spektrum) Hörbarkeit der Teiltöne Einem feinen Ohr ist es durchaus möglich, Teiltöne etwa bis zur Nr. 8 zu fokussieren, also als Einzelkomponente aus dem Gesamtklang herauszuhören (Campbell 1987: 83): „The ability to distinguish the pure tone components of a complex tone varies from person to person. The seventeenth century musical theorist Marin Mersenne found it possible to hear the first seven members of the harmonic series distinctly; other investigators, perhaps blessed with more vivid imaginations, have claimed to be able to hear up to twenty-seven. Careful modern experiments have shown that harmonics above the eighth member of the series cannot be distiguished by the majority of listeners (Plomb 1964).“ Zur Erklärung dieser Grenze dient das Konzept der Frequenzgruppe (critical band). In einer entsprechenden Versuchsanordnung werden zwei reine Töne (Sinustöne) gleicher Amplitude überlagert. Wenn sich die Frequenzen nur geringfügig unterscheiden (um weniger als 15 Hz) werden Schwebungen erster Ordnung hörbar; es handelt sich dabei um eine Amplitudenmodulation des Schwingungsmusters: 12 Abb. 6: Schwebung erster Ordnung Die Geschwindigkeit dieser Modulation errechnet sich aus dem Unterschied der beiden Frequenzen: f Schwebung = Δ f = f 2 − f1 Wenn der Frequenzunterschied über 15 Hz hinaus erhöht wird, tritt an die Stelle der € Schwebung eine Empfindung, die als Rauhigkeit beschrieben wird, bei weiterer Erhöhung wird die sogenannte Frequenzunterscheidungsgrenze Δ f D überschritten, das Gehör beginnt zwei Einzeltöne zu wahrzunehmen. Schließlich verschwindet bei weiterem Vergrößern des Abstandes auch die Rauhigkeit, und zwar bei Erreichen einer Frequenz€ differenz, die man als Frequenzgruppe Δ fCB (critical band) bezeichnet; diese Grenze ist fließend, der Übergang kontinuierlich. € Abb. 7: Frequenzüberlagerung (wiedergegeben nach Roederer 1977: 32) 13 Die Breite der Frequenzgruppe ist nicht konstant, sondern hängt von der Position im Hörbereich ab: Abb. 8: Frequenzgruppenbreite (wiedergegeben nach Roederer 1977: 35) In folgender Abbildung sind die ersten zwölf Teiltöne des Tones c in musikalischer Notation wiedergegeben, die senkrechten Balken zeigen die Breite der jeweiligen Frequenzgruppe an: Abb. 9: Spektrum mit Frequenzgruppen (nach Campbell 1987: 84) Die Überlappungen der Bänder ab dem 7. Teilton erklärt, warum das „Heraushören“ einer Einzelkomponente dort zunehmend schwierig bis unmöglich wird. Allerdings 14 kann dem Hörer dadurch geholfen werden, dass man den entsprechenden Teilton zuerst isoliert zu Gehör bringt – die vorgestellte Software erlaubt dies auf einfache Weise. Intervalle Zwischen den Teiltönen Nr. 1 bis 10 finden sich einige wichtige musikalische Intervalle, die in der Entwicklung der europäischen Kunstmusik für den Aufbau des Tonsystems und den daraus resultierenden Satzgepflogenheiten Grund legend waren; einigen von ihnen kommt zusätzlich eine zentrale Rolle in Intonations- und Stimmungsfragen zu. Im Folgenden sollen sie in der Reihenfolge ihres Auftretens in der Teiltonreihe besprochen werden. Abb. 10: Aufbau der Teiltöne 1–12 des Tones C in Notenschrift (Teilton 7 und 11 liegen wesentlich tiefer als die temperierten Versionen, die in traditioneller Musik gebräuchlich sind und wurden daher in der Notation mit Pfeilen modifiziert.) Die folgenden Erläuterungen verstehen sich im Hinblick auf (historische) Stimmungssysteme: ästhetische Bewertungen, die dabei zur Sprache kommen, sind auf den jeweiligen historischen Kontext bezogen, wie schon oben erwähnt, ist 1:2 – die Oktave Die Oktave ist das Intervall mit dem höchsten Verschmelzungsgrad: viele weniger trainierte Hörer halten zwei im Oktavabstand gespielte Töne für einen Einzelton. Schon eine sehr kleine Verstimmung wird von jedem Hörer wahrgenommen, der genauen Intonation der Oktaven wird deshalb sowohl im Ensemblespiel als auch beim Einstimmen 15 von Instrumenten höchste Priorität gegeben. Definitionsgemäß beträgt ihr cent-Wert 12002. Beim Spielen einer Tonleiter wird der Eintritt der Oktave als Wiederholung der Qualität des Grundtones empfunden. Dies spiegelt sich in den Notennamen wieder: Töne im Oktavabstand tragen den gleichen Namen, unterschieden nur durch die Angabe der Oktavlage. Dieses Phänomen wurde wiederholt als Tonhöhenschraube visualisiert, wie in dem folgenden Beispiel von Wilhelm Opelt (1834): Abb. 11: Tonsäule von Opelt (wiedergegeben nach Ebeling 1999: 91) Die Oktave gilt in der traditionellen europäischen Musiktheorie als vollkommene Konsonanz. 2 In höheren und tieferen Lagen werden Oktaven gehörmäßig etwas größer, „gespreizt“ intoniert; für diesen nichtlinearen Effekt werden verschiedene Gründe ins Treffen geführt, auf die hier nicht weiter eingegangen werden soll. Manche entwickelteren Stimmungssysteme nutzen diesen Effekt, temperieren die Oktaven zugunsten reinerer Quinten. 16 2:3 – die Quinte Auch die (reine) Quinte wird – wie die Quarte – als vollkommene Konsonanz bezeichnet. Darin spiegelt sich wiederum ihre Empfindlichkeit gegenüber schon sehr kleinen Verstimmungen, obwohl der Toleranzbereich gegenüber der Oktav schon etwas erweitert erscheint: fast alle nachmittelalterlichen Stimmungssysteme gestatten und erfordern Kompromisse für die Quinten, wenn auch nur in geringem Maß. Früheste überlieferte Modelle mehrstimmigen Musizierens nutzen den hohen Verschmelzungsgrad der Quinte zur Verbreiterung und Intensivierung des Klangbildes (Quinten- bzw. Quint-Quart-Organum); mit einigem Recht werden diese Praktiken eher als Klangtechniken denn als reale Mehrstimmigkeiten analysiert. Auch im Orgelbau findet sich eine Parallele in Form der Mixturen, also der Kombination mehrerer hochliegender Oktav- und Quintpfeifenreihen, deren Zweck natürlich nicht Mehrstimmigkeit, sondern spektrale Bereicherung des entsprechenden Grundtones ist3. Die Quinte ist ein grundlegendes Intervall für einfache Zusammenklänge; über Jahrhunderte hinweg war sie – neben Oktave und Einklang – das einzige Intervall, dem die Musiktheorie Schlussfähigkeit, also klangliche Stabilität ohne Fortsetzungsverpflichtung zugestand. In der Centrechnung beträgt ihr (nichttemperierter) Wert 701,95 cent. 3:4 – die Quarte Die Quarte spielt als Komplementärintervall zur Oktave eine ähnliche Rolle wie die Quinte: sie galt theoretisch, schon wegen ihres einfachen Zahlenverhältnisses, als vollkommene Konsonanz. Dies steht in einem gewissen Widerspruch zu ihrer Verwendung im musikalischen Satz, wo sie auf Grund ihres empfundenen Mangels an klanglicher Fundamentierung bald nicht mehr als uneingeschränkt konsonanzfähig galt und pragmatisch dem Regelwerk zur Dissonanzbehandlung unterworfen wurde, wenn sie nicht 3 Ein berühmtes Beispiel dieses Prinzips auf das Orchester angewandt sind die Takte 149ff. im Bolero von M. Ravel; dort treten sogar von Anfang an gemischte Quint/TerzMixturen auf. 17 durch eine tiefere Terz oder Quint „gedeckt“ war. Diese kompositions- (und improvisations-)technische Tatsache warf für die Theoretiker der Musik nicht geringe Probleme auf, die oft nur durch weltanschaulich gefärbte Erklärungsmuster aufgelöst werden konnten, wie etwa in dem schon erwähnten Werk von Andreas Werckmeister, das in dieser Hinsicht die Spannungen zwischen älterer pythagoreischer und neuerer, aufgeklärter Sicht der Dinge auszutragen hat. Im folgenden Zitat wird der „Fall“ der Quarte daher mit beträchtlichem sprachlichem Aufwand behandelt, wobei auch gleich im Versuch einer Zusammenschau das Verhältnis von Terzen und Sexten zur Sprache kommt (Werckmeister 1691: 27f): „…das aber die quarta von etlichen vor eine imperfecta Consonans oder Dissonans gehalten wird / kömmt daher / wenn sie bloß profundamento, oder unter die quinta gesetzet wird / da sie doch ihren rechten Sitz nicht hat / und eine Verkehrung der Natur vorstellet / und an den Tag gibt / und deswegen eine Resolution verlanget / eben solch eine Beschaffenheit hat es mit den Tertien / welche nichts anders als verkehrte Sexten sind / denn wenn dieselben auch gebraucht / so müssen sie nemlich den Sexten gleichfals zur Resolution gebracht werden; Die Quinta bestehet in 2–3. Wenn die 2. dupliret wird / werden 4 gegen 3. Die Tertia major besteht in 4-5 wenn die 4. dupliret wird / so wird 8 gegen 5 oder Sexta minor, 5-6 geben Tertiam minorem, wird die 6. halbiret / ist 3. gegen 5. und geben Sextam majorem, also sind dieses nur verkehrte Dinge / die die natur nicht leyden kan / und verlanget ihre resolutiones, dass aber die Quarta noch etwas härter klinget / wenn sie aus ihrem Sitze gebracht wird / als die Sexten / kömmet daher / weil ihre Stelle in perfectern Zahlen bestehet / daher der Misslaut noch grösser vernommen wird / denn je vollkommener und reiner ein Ding ist / je mehr und eher man einen Mangel daraus spüren kann / derowegen ist die Quarta keine imperfecta Consonans, vielweniger eine dissonans, sondern die Verkehrung der natürlichen Zahl=Ordnung verursachen diese Härtigkeit / wenn sie aber in ihrer rechten Ordnung stehet / so ist sie so perfect als die Quinta, weil sie / wie gemeldet / zugleich gebohren werden / nur ratione ordinis ist sie unvollkommener als die Quinta. In unsern Musicalischen Wegweiser ist zwar eine beyläufftige Ursache mit angehenget / warum die blosse Quarta nicht so wohl klinge / als wenn sie mit ihrer zum Grunde gesetzten Quinta angeschlagen wird / sed dies diem docet, dass die Quarta bloß / oder unten nicht wohl klinget / ist keine andere Ursache / als dass sie nicht in ihrer rechten Ordnung stehet / und 18 dass der Ternarius die Mutter und radix nicht ist / worauff eine vollkommene natürliche harmonia könne gebauet werden / sondern dass 1. 2. 4. 8. die rechten Wurtzeln seyn / worauff eine perfecte harmonia könne gesetzet werden / wie davon droben gehandelt worden.“ Einige der hier behandelten Gedanken finden eine nachträgliche Bestätigung in neueren Forschungen zum sogenannten „Zentralen Tonhöhenerkenner“, einem noch nicht näher geklärten Mechanismus im zentralen Nervensystem, der über passende „Schablonen“ im Erregungsmuster auf der Basilarmembran fehlende Grundtöne rekonstruiert, also etwa zu einer reinen Quarte g-c einen entsprechenden Grundton C zu ergänzen sucht; dies würde einer klanglich empfundenen Ergänzung der „verkehrten Zahl=Ordnung“ entsprechen. In der Centrechnung beträgt der Wert der (nichttemperierten) Quart 498,05 cent. 4:5 – die große Terz / 5:6 – die kleine Terz Mit den Terzen und Sexten kommen wir zu den historisch als unvollkommen konsonant eingestuften Intervallen. Sie wurden in der Geschichte der Mehrstimmigkeit erst nach einigem Zögern als Konsonanzen anerkannt, führten dann aber rasch zu einem neuen Klangbewußtsein, und damit verbunden zu veränderten Kompositionsnormen. Im Gefolge dieser Entwicklung musste zwangsläufig die Stimmungsfrage neu gelöst werden, weil reine 2:3-Quinten und reine 4:5-Großterzen nicht kompatibel sind (s. u. „Inkongruenzen“). Man könnte ohne allzu große Vereinfachung die Geschichte der Stimmungssysteme schreiben als den fortgesetzten Versuch, zwischen Quinten und Terzen so zu vermitteln, dass den Erfordernissen des musikalischen Zeitgeschmackes Genüge getan wird. (Näheres s. u. im Kapitel „Historische Stimmungssysteme “). Die Intonation der Terz wird in fast allen Quellen als toleranter, „verhandelbarer“ beschrieben, wobei im Allgemeinen der kleinen Terz noch etwas größerer Spielraum eingeräumt wird als der Großterz. Es ergibt sich – aufsteigend durch die Verhältnisse der Teiltonreihe, von der Oktave über Quint/Quart zu den Terzen und Sexten – eine abnehmende Empfindlichkeit für Verstimmungen. Es lag nahe, dies aus dem Grad der Einfachheit der Proportionen abzuleiten. Dazu wieder Werckmeister (1691: 4f): 19 „Und obschon dieses eigentlich zur Composition gehöret / so muß doch zum wenigsten eine Erkäntnis vorher gehen / dass man wisse den Unterscheid dieser Vollkommenheiten in der Temperatur Bereitung: Denn das ist gewiß / dass die Octava nichts / die Quinta und Quarta wenig / die Tertiæ majores ein mehres / die Tertiæ minores noch mehr / also auch die Sexten / in denen Temperaturen vertragen können / wie solches auff dem Monochordo klärlich zuvernehmen ist / als wenn einer dupla oder Octav […] ein Comma zugeleget oder genommen wird / so it die dissonans unerträglich / ein Comma denen Tertien und Sexten zugelegt oder genommen / so ist zwar Tertia major sehr hart / iedoch nicht so sehr als Quinten und Quarten / Tertia minor aber ist ganz tolerabel / also auch Sexta major und minor […] Daß aber die vollkommenen Consonantien die Temperatur nicht annehmen wollen / und die Ureinigkeit noch eher an denen vermercket wird / als an den unvollkommenen / hat seine gründliche Ursache aus der Natur. Denn ie reiner und zarter ein Ding ist / ie eher man den Mackel und Flecken darinnen spüret / sonderlich in weissen Farben und köstlichen Edelgesteinen […] Also ist es beschaffen mit den Temperaturen / da man nicht zuviel unreines in die vollkommene Consonantien hinein jagen / sondern den unvollkommenern das meiste zueignen soll.“ Centwerte (wiederum untemperierte „Naturintervalle“): große Terz (4:5) = 386,31 kleine Terz (5:6) = 315,64 3:5 – die große Sext / 5:8 – die kleine Sext Sexten werden qualitativ den Terzen annähernd gleichgehalten, nur satztechnisch werden sie den Terzen nachgeordnet. Rangordnungsmäßig - nach der Einfachheit der Zahlenverhältnisse - ginge die große Sext (3:5) allerdings der großen Terz (4:5) voraus. Centwerte: große Sext (3:5) = 884,36 kleine Sext (5:8) = 813,69 20 8:9 – der große Ganzton / 9:10 – der kleine Ganzton In der Teiltonreihe treten drei Intervalle auf, die in einem tonalen System historischer Prägung als Ganztöne zurechtgehört werden: 8:9, 9:10, 10:11. Das letztere Verhältnis steht allerdings schon an der Schwelle zum Halbton und wird im Allgemeinen nicht mehr in Betracht gezogen. Teilton Nr. 9 hat zwei Eigenschaften, die für Intonations- und Stimmungsfragen interessant sind: er teilt die reine Großterz 4:5 harmonisch (nach barocker Mathematik: 4:5 = 8:10, Teilung 8:9:10), gleichzeitig steht er genau zwei Quinten (plus 2 Oktaven) über 2 3 3 2 9 dem Grundton Nr. 1: × × = 2 2 1 1 Diese Eigenschaft macht ihn in Standard-Quintfallklauseln zu einem beachtenswerten Ton, wie in folgendem Beispiel: € Sensibel intonierende Sänger werden in der Mittelstimme den Ganzton e-d („10:9“) etwas enger nehmen als den schließenden Schritt d-c („9:8“). Zur Orientierung wurde auch die Unterstimme mit den entsprechenden Verhältniszahlen versehen. Die Bassstimme mit ihren Verhältnissen 8-6-4 lässt sich vereinfachen zu 4-3-2, die Zusammenklänge zwischen Bass- und Mittelstimme werden zu: 8:10 = 4:5, 6:9 = 2:3, 4:8 = 1:2. Auf diese Weise werden alle beteiligten Intervalle bestmöglich ihren Vorbildern in der Obertonreihe angenähert. Schon an diesem einfachen Beispiel erweist sich die Notwendigkeit zweier verschieden großer Ganztöne für die Musik der Renaissance und des Barock; folgerichtig wird diese Unterscheidung in allen einschlägigen Traktaten getroffen. Erst wenn Fragen der Temperierung ins Spiel kommen, zum Beispiel bei Tasteninstrumenten, wird diese Differenz zugunsten notwendiger Transpositionsmöglichkeiten aufgegeben oder zumindest weitgehend kompromittiert. 21 Centwerte: 8:9 = 203,91 cent 9:10 = 182,40 cent 7 und 11 – die „nichtintegrierten“ Töne Teilton Nr. 7, im einleitenden Notenbeispiel als „zu tiefes b“ über dem Grundton C notiert, steht in starker Spannung zum horizontal-melodischen Tonort a oder b: die Abweichung erscheint nicht mehr tolerabel, der Ton wurde – mit einigem Bedauern – ausgeschieden, oder besser nie aufgenommen. Die Begründung dafür fällt jenen Autoren, die noch auf pythagoreisch-symbolischer Ebene argumentieren, besonders schwer, war doch gerade die Zahl 7 mit dem Nimbus besonderer Heiligkeit umgeben; entsprechend aufwendig die Erklärungsversuche, die hier aufgeboten werden. Allerdings hat die Möglichkeit, mit seiner Hilfe z. B. vollkonsonante Vierklänge zu herzustellen immer wieder andere Theoretiker dazu bewogen, nach Möglichkeiten zur Integration dieses Tones in das bestehende Tonsystem zu suchen. Erst im 20. Jahrhundert ist dies beispielsweise in den Werken von Harry Partch geschehen, in diesem Fall mussten allerdings neue Instrumente gebaut werden, die dem geforderten erweiterten Tonvorrat gerecht wurden (siehe: http://www.harrypartch.com). Teilton Nr. 11 ist vom Intonationsstandpunkt ein ähnlicher Fall wie Nr. 7, es wird jedoch vor dem 20. Jahrhundert selten für eine Eingliederung in Betracht gezogen. Der folgende Ausschnitt – der Beginn des ersten Satzes Hora lunga aus der Sonate für Viola Solo (1994) von G. Ligeti bedient sich der Naturintervalle aus der Teiltonreihe von F, muss dazu aber die gewohnte Notation um mikrotonale Modifikationen erweitern: 22 Konsonanz – Dissonanz In der obigen Aufstellung wurde bereits mehrfach die traditionelle Kategorisierung der Intervalle in Konsonanzen und Dissonanzen angesprochen; anhand der Großterz wurde sichtbar, wie sich die entsprechende Einordnung eines Intervalls im Zuge kompositorischer Stilwandel durchaus ändern kann, dass mithin rein mathematische oder auch physikalische Erklärungsversuche in diesen Fällen offenbar etwas zu kurz greifen. Trotzdem kann davon ausgegangen werden, dass sie den „Anlass liefern“, dass also sensorische Intervallqualitäten durch kulturelle Überformung ihre musikalische Bewertung erhalten. Für die folgenden Darstellungen ist zu beachten, dass der Begriff Intervall, der ja wörtlich den Abstand zwischen zwei Tönen bezeichnet, einen quantitativen und einen qualitativen Aspekt in sich trägt: im Hintereinanderspielen zweier Töne steht eben der Abstand, die Distanz im Vordergrund, der bei gleichzeitigem Erklingen gegenüber der Qualität des Zusammenklangs, der Sonanz (Wellek 1963), zurücktritt. „Der Begriff Sonanz bezieht sich auf die Tatsache, dass gleichzeitig erklingende Töne unter bestimmten Bedingungen als klare, gegliederte Einheiten wahrgenommen werden, während andere Zusammenklänge trüb, unruhig, rau oder instabil wirken. Zwischen den Extremen sind beliebige graduelle Abstufungen möglich. Die Sonanz kann in einem zweidimensionalen Sonanzfeld näher spezifiziert werden. Die beiden Dimensionen des Feldes sind Rauhigkeit, d.h. die »Störungen des Zusammenklanges« im Sinne Helmhotz’, und die Geschlossenheit, die Stumpf als Verschmelzung bezeichnet.“ (Ruhnke 1996: 1089) Konsonanz/Dissonanz-Theorien gehen also naturgemäß eher von einem SonanzVerständnis aus, Überlegungen zur Distanz - dem melodischen Aspekt - bleiben in ihnen unberücksichtigt oder stehen zumindest in der Gefahr, unterbewertet zu werden. (Eine ganzheitliche Betrachtung musikalischer Gebilde wird gleichermaßen beiden Seiten Aufmerksamkeit widmen müssen, insbesondere auch deren Beziehungen zueinander.) 23 Pythagoreik Legendenhaft wurde durch das ganze Mittelalter hindurch Pythagoras die Entdeckung der Intervalle als Zahlenverhältnisse zugeschrieben: nachdem er – an einer Schmiede vorüberkommend – festgestellt hatte, dass die Schmiedehämmer deswegen in musikalischen Intervallen zu hören waren, weil ihre Gewichte in proportionalen Verhältnissen zueinander standen, habe er diese Erkenntnis auf verschieden gespannte Saiten und verschieden große Glocken übertragen und dabei die Proportionalität als inneres Wesen der Intervalle erkannt. Abb. 13: aus Gaffurius, Theorica nusice 1492) „Das Besondere der griechischen Intervallenlehre lag darin, dass sie nur einen Teil einer umfassenden Kosmologie bildete. Das Weltall war für die Griechen von den gleichen Gesetzmäßigkeiten beherrscht, die man beim Erklingen zweier Saiten sichtbar und hörbar aufzeigen konnte. Wenn man in Mittelalter auf die Lehre von der Herrschaft und Bedeutung der Zahl zurückgriff, so konnte man sich dabei auf das […] Bibelwort berufen, dass Gott alles nach »Maß, Zahl und Gewicht geordnet« habe (Weisheit Salomons 11,21). Lange Zeit hat bei den mittelalterlichen Theoretikern der pythagoreische Grundsatz gegolten, dass man 24 der ratio , dem mathematischen Zahlenbeweis, mehr glauben müsse als dem trügerischen Sinneseindruck.“ (Ruhnke 1996: 1073) Nach dieser Auffassung sind Konsonanzen nur im genus multiplex (siehe Kapitel Intervalle und Zahlenverhältnisse) und im genus superparticulare zu finden; praktisch sind dies Oktave, Quinte und Quarte. Alle anderen Intervalle werden durch Kombinationen aus ihnen gebildet, also der Ganzton aus zwei Quinten minus einer Oktave (3/2 × 3/2 × 1/2 = 9/8), die Großterz als Summe zweier solcher Ganztöne (9/8 × 9/8 = 81/64), der kleine Halbton als Differenz von reiner Quart 4/3 zur großen Terz usw. Helmholtz In seinem Werk Die Lehre von den Tonempfindungen als physiologische Grundlage für die Theorie der Musik (1863) erklärt H. von Helmholtz verschiedene Grade von Konund Dissonanz als bestimmt durch entsprechende verschiedene Grade von Rauhigkeit im Gesamtklang, die durch Schwebungen zwischen verschiedenen Teil- und Differenztönen der beteiligten Einzeltöne entstehen. Im Beispiel eines Dreiklanges: Übereinstimmungen zwischen Teiltönen sind als gerade Linien dargestellt, beim genauen Einstimmen des Dreiklangs verschwinden die Schwebungen zwischen ihnen. Selbst wenn dies perfekt gelingt verbleiben jedoch Schwebungen und Rauhigkeiten zwischen höherliegenden Obertönen (in dieser Darstellung wurden Abstände bis zur kleinen Sekunde durch Wellenlinien gekennzeichnet). Wie weit sich diese als Rauhigkeit oder Unruhe im Gesamtklang bemerkbar machen, hängt von der Intensität der jeweiligen Teiltöne ab. 25 Neuere Untersuchungen haben den Zusammenhang zwischen Intervallgröße, Obertongehalt und Dissonanzgrad in großangelegten Reihenversuchen verifiziert; dabei wurde das ganze Kontinuum von Intervallen zwischen Einklang und Oktave (also 12 Halbtöne mit vielen Zwischenwerten) untersucht.: Abb. 14: Dissonanzgrade (aus: Campbell 1987: 167) In dieser Grafik werden verschiedene Punkte deutlich: • höherer Obertongehalt führt zu höheren Dissonanzgraden • einige Intervalle sind durch scharf abgegrenzte „Konsonanztäler“ ausgezeichnet: Quart, Quint und vor allem Oktave – die Schmalheit ihrer Konsonanzbereiche erklärt ihre Empfindlichkeit auch schon gegen geringe Verstimmungen • Terzen und Sexten weisen diesbezüglich größere Toleranz auf Die beiden letzten Punkte decken sich – wenn auch anders begründet – mit den historischen Aussagen zu: o ihrer Kategorisierung (vollkommene/unvollkommene Konsonanzen, Dissonanzen) o ihrer Temperierbarkeit, d.h. der Bandbreite, innerhalb derer sie noch als Konsonanzen „zurechtgehört“ werden können 26 Differenztöne Das vorige Erklärungsmodell beschreibt vor allem Dissonanzgrade, also inwieweit ein konsonanter Zustand durch Rauhigkeiten gestört erscheint. Andere Modelle betonen in positiver Weise Konsonanzeigenschaften; zu diesen Theorien gehört diejenige von F. Krueger, der das Phänomen der Kombinationstöne zur Begründung von Konsonanzgrad heranzog. Unter geeigneten Bedingungen entstehen aus der Kombination von zwei Primärfrequenzen f1 und f 2 Differenztöne der Form f 2 − f1 und 2 × f1 − f 2 . Bei konsonanten Intervallen bilden die Differenztöne einen stabilen Unterbau, sie ergänzen das Intervall zur Tiefe hin wie eine natürliche Teiltonreihe; weichen die Frequenzen jedoch € € € € von einfachen Verhältnissen ab, so wird der Unterbau labil. Neurophysiologie Neuere Forschungen legen nahe, dass die Zeitstruktur überlagerter Schwingungen als reizsynchrone Nervenimpulse im unteren Teil des Hörnervensystems abgebildet und in zentralen neuronalen Prozessen verwertet wird. Wenn zwei als zueinander dissonant beschriebene Töne getrennt an linkes und rechtes Ohr geleitet werden, verschwindet ihre charakteristische Rauhigkeit; trotzdem heben sich Intervalle, die bei normalem Hören als konsonant bezeichnet werden, auch in diesem Hörmodus durch eine besondere Qualität aus dem Kontinuum heraus. (siehe Ruhnke 1996: 1087) 27 Stimmung und Intonation Einstimmen von Intervallen und Akkorden Das grundlegende praktische Verfahren des Einstimmens eines Intervalls oder eines Akkordes besteht darin, die konsonanten Komponenten der beteiligten Töne so weit in Übereinstimmung zu bringen, dass Schwebungen minimiert werden. Wieweit das möglich wird, hängt stark von den zu stimmenden Intervallen ab: die Obertonstrukturen der beteiligten Töne interagieren und lassen eine mehr oder weniger optimierte Schwebungssituation zu. Dies zu veranschaulichen ist eine der Hauptaufgaben des Programmes „Schwebungen“. Inkongruenzen Bei Anwendung der idealen, reinen Intervallverhältnisse ergeben sich verschiedene Probleme, wenn man versucht, ein geschlossenes tonales System einzustimmen. Es entstehen Fehlbeträge, die Kommata genannt werden. Obwohl diese Fehler rechnerisch klein erscheinen, stören sie doch empfindlich das musikalische Gehör. pythagoreisches Komma Versucht man reine Quinten aufeinanderzuschichten, bis wieder eine (enharmonische) Oktave des Ausgangstones erreicht wird, also c – g – d – a – e – h – fis – cis – gis – dis – ais – eis – his (= enharmonisch c) ergibt sich ein Fehlbetrag: das erreichte „his“ ist gegenüber dem „c“ um fast 24 cent zu hoch: 3 3 × × ...(12mal) = 3 2 2 2 12 () = 531441 4096 gekürzt um 7 Oktaven: € 1 7 1 = 2 128 Fehlbetrag (Komma): € 3 12 1 7 531441 ⋅ = 2 2 524288 das sind 23,46 cent. € 28 kleine Diesis Schichtet man drei reine Großterzen aufeinander 5 3 125 = 4 64 verfehlt man die reine Oktave € 2 128 = 1 64 um 41,06 cent (immerhin fast ein Viertelton). € große Diesis Schichtet man vier reine Kleinterzen aufeinander 6 4 1296 = 5 625 überschreitet man die reine Oktave € 2 1250 = 1 625 um 62,6 cent. € Terzkomma (syntonisches Komma) Dies ist – neben dem pythagoreischen Komma - für Fragen der historischen Stimmungen das wichtigste Problem: 3 4 1 2 81 Vier Quinten abzüglich 2 Oktaven: ⋅ = ergeben eine gegenüber der reinen 2 2 64 5 80 81 zu große pythagoreische Terz, reine Quinten und „Na= eine um 4 64 80 € turterzen“ sind also inkongruent. Eine andere, historisch öfter anzutreffende Darstellung Großterz setzt zwei pythagoreische Ganztöne (8:9) aneinander (Ditonus, siehe oben) und kommt € € damit natürlich zu dem gleichen Ergebnis. 29 Die entstandene Differenz ist das syntonische Komma, es beträgt 21,5 cent. Das pythagoreische und das syntonische Komma sind zufällig annähernd gleich groß, der Unterschied (das sogenannte „Schisma“) von etwa 2 cent „verliert“ sich im allgemeinen beim praktischen Stimmen eines Instruments. Stimmpragmatiker in den überlieferten Traktaten sprechen daher fast immer nur vom „Komma“. Der Ausgleich der verschiedenen Kommata geschieht durch Temperierung: der Fehlbetrag wird in geeigneter Weise (d. h. möglichst unauffällig und den tonartlichen Gepflogenheiten angepasst) auf die beteiligten Intervalle verteilt. Am Beispiel der modernen gleichstufigen Temperierung: alle zwölf Quinten, die den Quintenzirkel aufbauen, werden um ein Zwölftel des pythagoreischen Kommas verkleinert (ca. 2 cent). Dadurch wird der Überschuss beseitigt und der Zirkel kann geschlossen werden. Im Ergebnis sind alle Intervalle außer der Oktave nicht mehr rein, es ist aber ein Spiel in allen Tonarten möglich. Dies ist nicht die einzige – und nach Ansicht vieler Musiker früherer Zeiten keinesfalls eine ideale - Lösung für das Problem; es findet sich also in der Geschichte der europäischen Musik eine Vielzahl an Stimmungssystemen. 30 Historische Stimmungssysteme im Überblick Pythagoreik Entsprechend dem Primat der Oktave, Quint und Quart des pythagoreischen Ansatzes wurden bis zum frühen 15. Jahrhundert Tasteninstrumente im allgemeinen pythagoreisch gestimmt: Abb. 15: Pythagoreische Stimmung Das Stimmsystem ist einfach: von Fis/Ges aufwärts werden durchgehend reine Quinten (2:3) bis H gestimmt. Aufgrund der Inkongruenz der Quinten und Oktaven (siehe „pythagoreisches Komma“ unter Inkongruenzen) fällt die letzte Quint H-Fis um fast 24 cent zu klein aus – sie ist musikalisch nicht brauchbar, weil der (bei diesem Intervall schmale) Konsonanzbereich weit überschritten ist: die Quinte „heult“ und wird als Wolfsquinte bezeichnet. Die diatonischen Terzen sind in diesem System pythagoreisch (81:64), überschreiten das Naturterzmaß (5:4) um das syntonische (das Terz-) Komma 81:80, sind also im allgemeinen quasi-dissonant und lösungsbedürftig. Als Nebeneffekt fallen dagegen Terzen mit erhöhten Tönen (d/fis, a/cis, e/gis und h/dis) fast ganz rein aus; diese Terzen könnten für das nachfolgende mitteltönige System Vorbildwirkung gehabt haben. (Siehe auch Lindley 1987: 127ff) 31 Mitteltönigkeit Die neue Satzart des fortschreitenden 15. Jahrhunderts, festzumachen etwa an den Werken der mittleren Schaffenszeit G. Dufays, zeigt sich in der vor allem in einer neuen Art des Wohlklangs, der konsonante, verschmelzungsfähige Dreiklänge sucht; die Stimmenzahl wird von drei auf vier oder fünf erhöht, die Bassstimme übernimmt mit reichlichen Quart- und Quintbewegungen klangfundamentbildende Funktion. Vokalensembles intonieren Terzen ihrer neuen Bewertung gemäß offenbar als wohlklingende 4:5Intervalle, für Tasteninstrumente muss daher eine neue Stimmungsart gefunden werden, die möglichst viele Terzen optimiert. Dies ist mit dem Stimmen von reinen Quinten nicht vereinbar (Terzkomma); die Lösung besteht darin, die vier Quinten, die im Quintenzirkel innerhalb einer Großterz auftreten, gleichmäßig zu verkleinern (temperieren), und zwar um je ein Viertel des Terzkommas. Der Stimmvorgang beginnt mit dem Reinstimmen etwa der Terz C-E und dem Verteilen des Kommas: Abb. 16: mitteltönige Stimmung, Anfang Danach können durch Stimmen reiner Terzen (4:5) die restlichen Töne leicht festgelegt werden: G-H, G-Es, D-Fis, D-B, A-Cis, A-F, E-Gis. Das Ergebnis wird mitteltönige Stimmung genannt: 32 Abb. 17: mitteltönige Stimmung Elf Quinten sind um ein Viertel Terzkomma verkleinert, als Folge davon ist die zwölfte Quint – hier traditionell Gis/As-Es – viel zu groß; sie ist ebenfalls unbrauchbar (Wolf) und wird in den Kompositionen der Zeit vermieden. Der Hauptzweck dieser Stimmung, nämlich möglichst viele Naturterzen ist soweit wie möglich verwirklicht: acht Terzen sind ideal, vier (C/Gis, F/Cis, B/Fis und H/Es) sind eigentlich verminderte Quarten und aufgrund der Unmöglichkeit, eine Oktave in drei reine Großterzen zu unterteilen (siehe Inkongruenzen: Diesen) ebenfalls viel zu groß. Allerdings räumen alle Autoren die Möglichkeit ein, solche Terzen vorübergehend im Satz zu gebrauchen, solange sie in geeigneter Art verbrämt werden, etwa durch kurze Dauer oder Verzierungen. Kennzeichnend für dieses System ist weiterhin: regelmäßige Quintenstruktur mit einem Wolf, ähnlich der pythagoreischen Stimmung und Festlegung der chromatischen Töne auf jeweils nur eine Variante (also nur Es und nicht Dis etc.). Der Wunsch nach Erweiterung des Tonvorrats wird über zwei Varianten möglich: • Einführung weiterer Tasten (in Form geteilter Obertasten), z.B. gis+as • Aufweichen der Reinheit der „guten“ Terzen zugunsten der „schlechten“ Dazu schreibt Michael Prätorius in seinem Syntagma musicum (1619): 33 „Die Quinten cis gis und fis cis / müssen nicht gar so falsch / und nicht gar so reine seyn / sondern nur etzlicher massen / doch dass sie nicht so sehr wie andere Quinten schweben / damit es / wann aus frembden Clavibus , vnd durch die Semitonia etwas geschlagen wird / nicht gar zu sehr dissoniere […] Darumb dann die Alten das f gis den Wulff genennet haben / Dieweil diese beyden Claves […] eine gar falsche Tertiam minorem geben: Vnd damit jhnen gleichwohl in etwas geholffen würde / haben sie allen andern Clavibus ein gar geringes abgebrochen / vnd die Tertiam Majorem e gis nicht gar zu reine / sondern etwas weiter von einander gezogen / damit das gis eine wenig in die höhe dem a näher / dem f aber weiter komme / vnd fast / wiewohl nicht gar pro Tertia minore zur Noth könne gebraucht werden.“ Dieses System wird schriftlich bei Gaffurius 1496 greifbar, allerdings nicht im Sinne einer Neuerung, sondern bereits als feststehender Brauch. Das Ende der mitteltönigen Stimmung kommt für leicht stimmbare Tasteninstrumente wie Cembali im Lauf des 18. Jahhunderts, als „Wohltemperierungen“ ihre Vorteile in reicher modulierender Kompositions- (und Improvisations-) art ausspielen können (siehe nächster Abschnitt). Im Orgelbau hält sich diese Stimmart noch bis Mitte des 19. Jahrhunderts (!). (weitere Details siehe Kelletat 1981 :17ff) „Wohltemperierungen“ Die Stimmsysteme des 18. und teilweise noch des 19. Jahrhunderts sind bestimmt von dem Bestreben, die Wölfe in den älteren Systemen verschwinden zu lassen, und zunehmend alle Tonarten spielbar zu machen. Dies bedeutet nicht Egalisierung; diese sogenannten Wohltemperierungen resultieren in unregelmäßigen Quintenzirkeln mit realer (nicht rein psychologischer) Tonartencharakteristik. Es entstehen unzählige Varianten, begleitet von zum Teil heftiger Polemik der Urheber. Als ein Beispiel möge hier eines der bekanntesten Systeme dienen, das heute unter dem Namen Werckmeister III bekannt ist. 34 Man beginnt mit dem mitteltönigen Modul, also: c – e rein Einpassen mitteltöniger Quinten c – g, g – d, d – a, a – e nun wird das „pythagoreische Modul“ angewandt: a – e wird rein gestimmt (e also erhöht) e – h rein reine Quinten abwärts: c – f, f – b, b – es, es – as, as/gis – cis, cis – fis h – fis ergibt sich als fast mitteltönige Quint automatisch. Abb. 18: Werckmeister III Werckmeisters Aufstellung der Schwebungsverhältnisse zeigt: die meisten Quinten sind rein (es gibt also keinen Wolf mehr), die Terzen changieren zwischen fast rein (F/A, C/E) bis maximal pythagoreisch (Fis/Ais, Cis/Eis, As/C); jede Tonart hat aufgrund jeweils verschiedener Kombinationen von reinen/verkleinerten Quinten und verschieden großen Terzen ihr eigenes Gepräge. 35 Stimmungssysteme lernen Wer vor der Aufgabe steht, diese historischen Stimmungen praktisch zu erlernen, wird zuerst vor der Fülle an möglichen und überlieferten Stimmungen zurückschrecken. Es zeigt sich aber bald, dass es nur einige wenige Grundmodule zu erwerben gilt, die dann in verschiedenen Abwandlungen zu dem gewünschten Stimmsystem zusammengesetzt werden können. das „Quintmodul“ (Pythagoreik) Dies ist – neben dem Reinstimmen von Oktaven – das einfachste Modell: es werden reine Quinten schwebungsfrei gestimmt. Man beginnt von einem gewählten Ton aus reine Quinten auf- oder abwärts zu stimmen. Es ergeben sich ausschließlich pythagoreische, also „angespannte“, überschwebende Terzen. das „mitteltönige Modul“ In dieses Modell muss etwas mehr Übungszeit investiert werden, weil zum ersten Mal Temperierung, also gezieltes Verstimmen von konsonanten Intervallen notwendig wird. Man beginnt, indem eine reine Großterz (4:5) gestimmt wird, zum Beispiel c – e. Für Hörer, die an moderne, gleichstufig temperierte Terzen gewöhnt sind, erfordert dieser Schritt ein wenig Umgewöhnung – die entspannte Großterz muss in ihrer Qualität oft erst wieder angeeignet werden. Das gezielte Hineinhören in die Obertonreihe wird diesen Teil des Lernprozesses stark erleichtern. Anschließend werden die vier Quinten über dem Ausgangston, in unserem Beispiel c – g, g – d, d – a und a – e gleichmäßig verengt gestimmt, sodass der Fehler, der sich bei reinen Quinten ergeben würde (das syntonische Komma), verschwindet. Hierbei ist zu lernen, geringfügig verstimmte Intervalle (hier: Quinten) qualitätsmäßig anzugleichen. 36 Mathematisch-physikalischer Exkurs: Teiltonreihe und Spektrum Für die Zwecke der Musik wird zwischen Tönen mit bestimmbarer Tonhöhe und solchen ohne (musikalisch) definierte Tonhöhe unterschieden. Die allermeisten Instrumente der europäischen Kunstmusik sind Tonerzeuger im ersten Sinn. Die meisten Schlaginstrumente erzeugen geräuschhaftere Klänge und werden in älterer Musik deshalb fast ausschließlich zur rhythmischen Akzentuierung des Tonsatzes eingesetzt. Sie sind daher von Fragen der Stimmung und Intonation weitgehend ausgenommen. (Erst die Musik nach 1900 hat diese strenge Kategorisierung aufgehoben: die empfundene Befreiung von Konsonanzzwängen und Harmoniefortschreitungen setzt das Geräusch kompositorisch in ein neues Licht, serielle Konzepte versuchen gar eine Skala zwischen dem „reinen“ Ton (dem Sinuston etwa) und dem völlig Tonlosen (Rauschen) herzustellen .) Der traditionellen, rein gehörsmäßig motivierten Einteilung der Klänge entspricht eine physikalisch-mathematische Erklärung: das Konzept der Oberton- oder besser: der Teiltonreihe. Mathematisch werden musikalische Töne (im ersten Sinn) als periodische Funktionen betrachtet, d. h. das beobachtete Schwingungsmuster wiederholt sich nach einer gewissen Zeitspanne, die die Periode der Schwingung genannt wird. (Alle zitierten Definitionen und Formeln sind entnommen aus: Glatz, Gerhard … Brücken zur Mathematik - Band7: Fourier-Analysis Hrsg. Hohloch, Eberhard … Berlin: Cornelsen Verlag, 1996) Definition: Eine Funktion heißt periodisch, wenn für alle x ∈ R gilt: f (x + P) = f (x) . Der kleinste derartige positive Wert P heißt Periode der Funktion ƒ(x). € € 37 Beispiele anhand der grundlegenden Sinus- und Cosinusfunktionen: sin x = sin(x + 2π) = sin(x + 4π) = … ⇒ P = 2π cosω t = cos (ω t + 2π) = cos [ω ( t + € 2π ω )] ⇒ P =T = 2π ω Der Satz von Fourier erklärt nun, wie eine periodische Funktion mit der Periode 2π durch eine Überlagerung von Sinus- und Cosinusfunktionen angenähert werden kann: Satz von Fourier Jede in −π < x < π definierte stückweise stetige Funktion ƒ(x) von praktischer Bedeutung lässt sich darstellen als konvergente trigonometrische Reihe der Form € ∞ f (x) = a0 + ∑ (ak cos kx + bk sin kx) 2 k=1 mit den Koeffizienten € 1 π ak = ∫ f (x)cos kx dx; k = 0,1,2,… π −π bk = 1 π ∫ f (x)sin kx dx; k = 1,2,… π −π Die Periode einer zeitabhängigen periodischen Funktion (Schwingung) ƒ(t) bezeichnet € man als Schwingungsdauer T = 2π ω , ω heißt Kreisfrequenz. Der obige Satz kann nun auch formuliert werden wie folgt: € € Jede Schwingung ƒ(t) mit der Kreisfrequenz ω und Schwingungsdauer T = 2π ω lässt sich darstellen als konvergente trigonometrische Reihe der Form ∞ € f (t) = a0 + ∑ [ ak cos (kω t) + bk sin(kω t)] 2 k=1 € mit den Koeffizienten T € 2 2 ak = ∫ f (t) cos(kω t) dt; k = 0,1,2,… T −T 2 T 2 bk = 2 ∫ f (t) sin(kω t) dt; k = 1,2,… T −T 2 38 € Wenn man komplexe Zahlen heranzieht, lassen sich durch Anwendung der Eulerschen Formeln e j k x = cos kx + j sin kx e− j k x = cos kx − j sin kx die Sinus- und Cosinusglieder zusammenfassen und man erhält folgende stark vereinfachte Form: € Jede Schwingung ƒ(t) mit der Kreisfrequenz ω und Schwingungsdauer T = 2π ω lässt sich darstellen als konvergente Reihe der Form ∞ f (t) = ∑c k ⋅ e jkω t ; ω = 2π T € € k=−∞ € mit den Koeffizienten T 1 2 c k = ∫ f (t) ⋅ e− jkω t dt; k = 0,± 1,± 2,… T −T 2 Die letzte Form ist rechentechnisch günstiger, hat aber den Nachteil, wenig anschaulich € zu sein. Glücklicherweise lässt sich auch die nichtkomplexe Version in der Praxis fast immer vereinfachen, für sogenannte gerade Funktionen zu: ∞ f (t) = a0 + ∑ ak cos( kω t ) 2 k=1 für ungerade zu: ∞ € f (t) = ∑ bk sin(kω t) k=1 € Die „normalsprachliche“ Formulierung lautet: jede periodische Schwingung lässt sich darstellen / zerlegen in einen Grundton mit der Frequenz f und Obertöne mit den Frequenzen 2f, 3f, 4f,…, mit ihrer jeweiligen Amplitude. Trägt man die Amplituden (und fakultativ auch die Phasenwinkel) über dem Frequenzparameter auf, erhält man die bekannte Spektrumsdarstellung. 39 Der mathematischen Analyse des Vieltongemisches, das ein musikalischer Ton also aus physikalischer Sicht darstellt, entspricht hörphysiologisch eine Analyse durch Erregungsmaxima auf der Basilarmembran: Tonhöhen werden durch einen geeigneten Mechanismus räumlich verschlüsselt, wobei gleiche Frequenzverhältnisse auf annähernd gleiche Distanzen abgebildet werden. Beispielsweise beträgt dieser Abstand für die Oktave – also ein Frequenzverhältnis 1:2 – ziemlich konstant 3,5 mm. Die Tonhöhenwahrnehmung verhält sich also zur Frequenz annähernd logarithmisch. 40 II. Arten der Vermittlung Im Folgenden soll auf verschiedene Methoden der Vermittlung dieser Kenntnisse eingegangen werden, mögliche Vor- und Nachteile sollen dabei kurz besprochen werden. historisch: Monochord Auf diese traditionelle Art, musikalische Zahlenverhältnisse anschaulich zu machen, wurde bereits zu Beginn dieser Arbeit hingewiesen: die Arbeit (das Spiel) am Monochord. Der einzige wesentliche Unterschied zu den Erklärungen, die hier bisher gegeben wurden ist, dass die Proportionen umgekehrt erscheinen: Tonerhöhungen werden natürlich durch Verkürzen der Saite erzeugt. Beispielsweise entsteht die reine Großterz dadurch, dass die Saite um ein Fünftel verkürzt wird: 5 4 statt . 4 5 Dem Vorteil des Instruments – physische Anschaulichkeit steht natürlich die praktische Tatsache entgegen, dass sich nur in den allerwenigsten musikalischen Haushalten ein € € Monochord finden wird. (Tasten) Instrument Ideal erscheint das Stimmen eines geeigneten Tasteninstruments (unter anfänglicher Anleitung): Cembalo oder Clavichord lassen sich mit geringem Kraftaufwand stimmen, die Instrumente nehmen Experimente nicht übel, das Ergebnis der Bemühung ist sofort an geeigneten Werken nachzuvollziehen. Auch hier gilt natürlich, dass diese Instrumente nicht eben häufig zur Verfügung stehen; immerhin stellen zusehends auch elektronische Keyboards Stimmtabellen bereit. 41 Buch + CD (ROM) Die Vermittlung über Bücher erscheint sinnvoll zur Vor- und Nachbereitung des Materials; historische und strukturelle Aspekte können in aller gebotenen Ausführlichkeit dargelegt werden. Ein Standardwerk dieser Art ist Mark Lindley, Stimmung und Temperatur (Lindley 1987) Dies ist eine umfassende Studie zum Werdegang der verschiedenen Stimmsysteme; Hintergründe werden ausführlich behandelt. Das anvisierte Publikum ist der „gehobene“ Spezialist, es handelt sich um eine wissenschaftliche Darlegung des Materials auf höchstem Niveau. Zur selben Gruppe von Texten gehören Bücher über spezifisch stilkundlich motivierte Fragestellungen; ein Beispiel dafür ist Martin Jira, Musikalische Temperaturen in der Klaviermusik des 17. und frühen 18. Jahrhunderts (Jira 1997) Diese Arbeit untersucht das musikalische Umfeld, in dem J. S. Bach als Musiker aufwuchs und versucht auf diesem Weg, die stimmungsmäßigen Grundlagen seiner Musik herauszuarbeiten. Dem Buch ist eine Audio-CD beigegeben, die sehr instruktive vergleichende Hörbeispiele enthält. Wer das praktische Stimmen erlernen will wird vielleicht eher zuerst zu Bernhard Billeter, Anweisung zum Stimmen von Tasteninstrumenten (Billeter 1979) greifen. In der Einleitung wird die Zielsetzung deutlich (S. 7): „Zwar sind schon viele Arbeiten über Stimmungssysteme veröffentlicht worden. Es fehlt aber darunter […] eine allgemeinverständliche Anweisung zum Stim42 men von Cembali und Clavichorden, die es dem Musikliebhaber und Musiker, der diese Instrumente spielt und meistens ja auch selber stimmt (oder stimmen möchte), ermöglichen würde, in dieses Gebiet einzudringen. Dazu braucht es nämlich weder mathematische Begabung noch überragendes handwerkliches Geschick, sondern nur gute Schulung des Gehörs und Geduld.“ Hier wird also eine praktische Handleitung geboten, die notwendigen Grundlagen (z.B Kommata) werden kurz und prägnant dargestellt, der Schwerpunkt liegt in der konkreten Stimmarbeit. Ein solches Buch rechnet also unbedingt mit der praktischen Erfahrung, die mit der Stimmtätigkeit verbunden ist. Ähnlich praktische Ziele verfolgt, wenn auch mit anderem Zielpublikum Doris Geller, Praktische Intonationslehre für Instrumentalisten und Sänger (Geller 1997) Es versteht sich als „Ratgeber und Handbuch für Musiker aller Sparten“. Auch für dieses Buch ist eine CD erhältlich, die alle im Buch beschriebenen Phänomene in Hörbeispielen zur Verfügung stellt. Der Text enthält eine umfangreiche Darstellung der Materie, der Schwerpunkt liegt nicht bei der Erläuterung von Stimmsystemen, sondern vor allem bei Intonationsfragen, mit denen Spieler von Melodieinstrumenten und Sänger täglich zu tun haben. Integraler Bestandteil des Buches ist ein umfangreicher Übungsteil – dem motivierten Musiker wird reiche Anleitung und Anregung geboten, sich die Grundlagen praktisch zu erarbeiten. Einen Versuch, den Experimentiercharakter, also Interaktivität direkt in ein Buch einzubinden finden wir bei Erich Neuwirth, Musikalische Stimmungen (Neuwirth: 1997) Hier ist eine CD-ROM integraler Bestandteil des Konzeptes: sie enthält alle im Text besprochenen Themen als interaktive Hörbeispiele. Intervallkonstellationen können auf Bildschirmklaviaturen ausprobiert werden, Querverweise in Form von Links erleichtern 43 ein Querlesen nach eigenen Gesichtspunkten und Interessen. Die Interaktivität ist allerdings auf das jeweilige Beispiel beschränkt, freies Weiterentwickeln und Experimentieren ist nicht möglich. Software (wirkliche Interaktivität) Dieses zu erreichen war das Ziel der in dieser Arbeit vorgestellten Software. Lehrgänge der vorbeschriebenen Art sollten zwar möglich sein, aber der Schwerpunkt wurde so weit wie möglich in ein offenes Konzept gelegt. Wirkliche Interaktivität – so die Hoffnung des Autors – wird den Spieltrieb des Benutzers optimal nützen, lustvolles Lernen durch einen hohen Grad an Eigenaktivität zu vitalisieren. Erfahrung und Wissen sollen an die Stelle von bloßer Information treten. 44 III. „Schwebungen“ – die Software Anforderungen an das Interface Über allen Vorteilen, die eine grafische Darstellung akustischer Zusammenhänge mit sich bringt – Anschaulichkeit, optisches „Einfrieren“ flüchtiger Tonphänomene und so weiter – darf ein möglicher Nachteil der Methode nicht übersehen werden: optische Ablenkung vom Akt des (Hin)Hörens. Die Oberfläche (das Interface) des Programms sollte also nicht mehr Ressourcen als notwendig vom Hören abziehen. Daraus ergibt sich unmittelbar die Forderung, das Interface so einfach, übersichtlich und vor allem so schnell erlernbar wie möglich zu gestalten. Das Erlernen neuer „Spielregeln“ ist auf ein Minimum zu reduzieren. Nachdem das anvisierte Publikum vor allem aus Musikern und in zweiter Linie auch musikalisch vorgebildeten Laien besteht, können bestehende Gewohnheiten und Darstellungsweisen nutzbringend eingesetzt werden. So ist zum Beispiel ist die Eingabe einer Tonhöhe über Tonnamen oder eine durch Anklicken zu spielende Tastatur auf dem Bildschirm dem Eintippen einer Frequenz vorerst vorzuziehen. Selbstverständlich ist das gleichzeitige Vorhandensein von Frequenz- und Centanzeigen kein Schade und wird nach einiger Zeit zunehmend das Interesse des Benutzers auf sich ziehen, was dem Verständnis der physikalischen Seite der Materie nur dienlich sein kann. Weiterhin soll die Oberfläche zu eigenen Experimenten einladen. „Was geschieht wenn…“-Versuche fördern den Erwerb aktiven Wissens und sollen schnell und einfach durchführbar sein: alle wesentlichen Bedienelemente müssen also jederzeit leicht erreichbar und gut strukturiert angeordnet sein. (Selbstverständlich sind das Forderungen, die für jedes Programm gelten, oder gelten sollten, wie der oft frustrierende Umgang mit schlecht aufgebauten Interfaces leider immer wieder beweist.) Benutzungsarten Das Programm soll sowohl das freie – möglicherweise phantasievoll-spielerische – Erforschen der Zusammenhänge fördern, als auch die Möglichkeit zu geführten Lehrgängen bieten. Fast alle Benutzer werden eine Einführung in die Bedienung der Oberfläche und die zugrunde liegenden Konzepte durchlaufen wollen. Weiterhin sollen das Programm einzelne Themen in Form kurzer Lehrgänge anbieten; dafür bietet sich eine 45 Kombination von Voreinstellungen (Presets) und (illustrierten) Texten in einem eigenen Fenster an. Der Wechsel zum freien Ausprobieren und Weiterdenken momentan interessanter Aspekte soll dabei jederzeit zwanglos möglich sein. Die Programmierumgebung MAX/MSP Die in diesem Projekt benutzte Programmiersprache ist MAX/MSP. Die Dokumentation berichtet über ihre Entstehung: “Max is a graphical music programming environment for people who have hit the limits of the usual sequencer and voicing programs for MIDI equipment.” —Miller Puckette, Max reference manual, 1988 Max was conceived in 1986 as a project for producing interactive music at IRCAM (Institut de Recherche et de Coordination Acoustique/Musique) in Paris. The original author was Miller Puckette. Max became a commercial product from Opcode Systems in 1991 with further development by Puckette and David Zicarelli. Cycling ’74 became the publisher of Max in 2000.“ MAX ist eine umfangreiche Sammlung von Programmmodulen, die auf grafische Weise miteinander verknüpft werden. Die folgende Abbildung zeigt einen kleinen Ausschnitt aus dem aktuellen Projekt: 46 Dieser Teil des Programms nimmt oben links eine Zahl entgegen (Frequenz), dieser Wert wird sogleich auf eine Kommastelle gerundet [Lround 1] und ausgegeben. Das Objekt [ftom] berechnet die entsprechende MIDI-Note (wiederum ein Zahl), diese wird durch eine Modulo-Operation [% 12] oktavreduziert. Dieser Wert wird nun an eine Datensammlung [coll Notenname] übergeben, die einen entsprechenden Textstring (Notenname) liefert, gleichzeitig wird durch zwei weitere Rechenschritte [/ 12] [-4] die im Deutschen übliche Bezeichnung der Oktavlage gewonnen. Mit [bondo] und [pack] werden diese Daten nun zu einem für das Interface geeigneten Ausgabetext (Notenname mit Oktavlage deutsch) kombiniert. Gleichzeitig wird die Abweichung der Eingangsfrequenz von der daraus abgeleiteten Note errechnet, das Wort „cent“ angehängt und auch als Text weitergegeben. Schließlich wird die errechnete MIDI-Note an ein Objekt namens kslider weitergegeben (hier nicht zu sehen), das eine grafische Darstellung in Form einer Klaviertastatur bereitstellt. Dieses kurze Beispiel mag genügen, das Prinzip der Programmierung in MAX zu illustrieren. (Im Anhang finden sich weitere Programmteile als Bildschirmfotos.) Die zunehmende Geschwindigkeit moderner Computer erlaubte schließlich die Erweiterung der Sprache MAX durch Module zur Echtzeit-Synthese/Verarbeitung von Audiosignalen. Diese Objekte werden unter dem Namen MSP zusammengefasst. Ihre Einbindung in das MAX-Konzept erfolgt in gleicher Weise, wie folgendes Beispiel zeigt: [cycle~] und [phasor~] sind Tongeneratoren (Sinus und Sägezahn), [slide ~] „verschleift“ das Signal von [phasor~] – dies dient hier dazu, über einen numerischen Wert verschiedene Klangfarben verfügbar zu machen – [selector~] schaltet je nach Ein- 47 gangsbedingung eines der beiden Audiosignale weiter, durch Multiplikation [*~] wird das Signal mit der gewünschten Lautstärke (Amplitude) versehen und über [pass~], das der Verwaltung von Rechnerresourcen in Audioprozessen dient, weitergegeben. Audio(MSP)-Wege werden durch eine andere Farbgebung von MAX-Datenwegen unterschieden. MAX/MSP ist durch sein molekülartiges Konzept äußerst flexibel einsetzbar; die grafische Art zu programmieren ist vergleichsweise leicht zugänglich, befehlszeilenartige Syntax entfällt. 48 Die Oberfläche von „Schwebungen“ Tonhöheneingabe Die Eingabe der Tonhöhen erfolgt über entsprechende Module im rechten Teil des Bildschirms, die Zuordnung zu den Teiltonkämmen in der zentralen Darstellung erfolgt über Farben. Es werden zwei Arten der Eingabe angeboten: a) Eingabe über musikalische Tonhöhen: die kleine Klaviertastatur links oben erlaubt die Eingabe des gewünschten Tones innerhalb einer Oktave, die Oktavlage wird über die Schaltflächen „8va“ und „8vb“ gewählt. b) direkte Eingabe der Frequenz: rechts unten ist eine direkte Eingabe der Frequenz möglich (entweder durch Ziehen mit der Maus oder durch Anklicken und Eintippen) Im mittleren Feld wird die resultierende Tonhöhe als Notenname und Abweichung in cent von der modernen gleichstufig temperierten Skala angezeigt (bezogen auf den Stimmton a’ = 440 Hz). Jede Änderung der Tonhöhe aktualisiert alle Anzeigen, das Modul ist also auch als „Tonhöhenrechner“ verwendbar. Die Feinstimmung erfolgt über die großen „+/–“ –Tasten im rechten Teil: Einzelklicks erhöhen / erniedrigen den Ton um ein Viertelcent, Festhalten der Taste erlaubt beschleunigtes Stimmen. Der farbige Rahmen der Einheit dient einerseits der Identifizierung des Tons in der Hauptgrafik, andererseits erlaubt er die temporäre Stummschaltung des Tons durch Einmalklick; Rahmen und Teiltondarstellung werden dann grau dargestellt. Dies ist zum Beispiel für das Feinstimmen einzelner Intervalle innerhalb eines Akkordes oder aber 49 auch für das Verketten mehrerer Intervalle interessant (etwa bei Betrachtungen zum „pythagoreischen“ und dem „mitteltönigen Modul“, s.o.). Jeder Ton wird als Aufbau seiner harmonischen Teiltöne dargestellt (in diesem Beispiel bis zum 10. Teilton). Die Teiltöne eines harmonischen Tones stehen zueinander bekanntlich in ganzzahligen Frequenzverhältnissen (1:2:3:4…). Das menschliche Gehör interpretiert gleichartige Verhältnisse, zum Beispiel 1:2 und 2:4 als gleiche Tonabstände (Intervalle), unabhängig von den absoluten Frequenzwerten. Dieser logarithmischen Wahrnehmung trägt die grafische Darstellung Rechnung, indem gleiche musikalische Intervalle als gleiche Abstände erscheinen. Zu Grunde liegt die cent-Skala, die Intervalle (Frequenzverhältnisse) gehörrichtig als Logarithmus zur Basis 2 (Oktaven werden als Wiederholung der gleichen Tonhöhenqualität empfunden) multipliziert mit 1200 (entsprechend einer Unterteilung der 12 gleichstufig temperierten Halbtöne der Oktave in weitere 100 Teile): f1 ln f Intervall (cent) = 1200log 2 1 = 1200 ln 2f 2 f2 € Der Benutzer findet also vorerst vertraute Verhältnisse vor – musikalische Distanzen entsprechen grafischen Abständen – wird aber schnell an Hand eines weiteren InterfaceElementes (des „Fokus“) den logarithmischen Zusammenhang zwischen Frequenz und Intervall begreifen lernen. 50 Das Programm erlaubt in der vorliegenden Version das Betrachten von bis zu vier Tönen (Teiltonkämmen) und der dabei auftretenden Verhältnisse. In diesem Beispiel wurde ein zweiter Ton aktiviert, der genau eine Oktave höher als der erste klingt. Am unteren Rand der Abbildung ist jetzt auch schon der „Fokus“ zu sehen, der genau auf den Grundton („1“) des linken Tons gestellt wurde und es erscheint die (gerundete) Frequenz 131 Hz (C). Bereits hier ist die perfekte Koinzidenz der Teiltöne anschaulich wahrzunehmen, der hohe Konsonanzgrad des Oktavintervalls wird unmittelbar sinnfällig. Die Einstellung der Tonhöhen erfolgte über die im rechten Teil des Programmfensters platzierten Bedienelemente: 51 In diesem zweiten Beispiel wurde der rechte Ton auf eine (temperierte) Quinte unter den ersten, also auf F gestimmt. Das Programm stellt den tiefsten Ton immer am unteren Rand des Fensters dar (sozusagen an der Position „0 cent“), weshalb der Teiltonkamm des Tons C jetzt (proportional) höher abgebildet wird. Diese Art der Darstellung wurde gewählt, um zu betonen, dass es die relativen Verhältnisse (Proportionen) der Töne zueinander sind, die für den Zusammenklang verantwortlich sind. Absolute Frequenzen bleiben weiterhin auslesbar, werden aber durch die Darstellung nicht als musikalisch wesentlich gezeigt. Die Verschiebung der Teiltonkämme erfolgt dynamisch während der Benutzer die Tonhöhen verändert, der Stimmvorgang wird also auch sichtbar vollzogen. Die dargestellten Töne werden währenddessen auch klingend (mit wählbarer Klangfarbe) wiedergegeben: die dauernde Kopplung von akustischer und optischer Darstellung ist ein wesentliches Element des Konzeptes. (Selbstverständlich kann die Tonwiedergabe bei Bedarf ausgeschaltet werden, etwa um rein „geometrische“ Intervallbetrachtungen zu ermöglichen.) 52 In diesem Beispiel wurde ein – wiederum gleichstufig temperierter – Durdreiklang eingegeben. Gut zu erkennen sind die entsprechenden Koinzidenzen, etwa zwischen Grundton und Quint (Teiltöne 2/3, 4/6 u.s.w.) und Grundton und Terz (Teiltöne 4/5), gleichzeitig wird aber auch schon die Abweichung der (gleichstufig) temperierten Terz von ihrer Idealposition sichtbar: Teilton 4 der Dreiklangsterz liegt ein wenig über Teilton 5 des Dreiklangsgrundtones. In dieser Gesamtansicht ist dieser Abstand noch recht gering, das Programm erlaubt deshalb Teilbereiche der Grafik zu vergrößern (siehe weiter unten). Die entsprechenden Tonhöheneinstellungen: 53 Der „Fokus“ Der Fokus ist ein frei per Maus verschiebbarer Punkt im rechten Teil der Teiltongrafik, der drei Aufgaben erfüllt: a) Anzeige der Frequenz an einer bestimmten Stelle der Grafik: in der vorliegenden Version wird die Frequenz direkt als Zahl über dem Fokus angezeigt, für den weiteren Ausbau des Programms ist eine alternative Anzeige in cent vorgesehen. b) dynamische Darstellung der Amplitude an dieser Stelle. die Gesamtlautstärke in diesem (schmalbandig gefilterten) Teil des Spektrums wird durch den Durchmesser eines Kreises ausgedrückt. Wenn diese Amplitude schwankt, etwa weil sich in diesem Frequenzbereich zwei Teiltöne schwebend überlagern, wird dies auch optisch durch ein Pulsieren dieses Kreises sinnfällig: … 54 c) akustisches „Zoomen“ in den betreffenden Bereich: durch Doppelklick wird die „Lupe“ auch akustisch: zu hören ist jetzt nur mehr der schmalbandige Ausschnitt aus dem Gesamtklang. Dies ermöglicht zahlreiche Hörwege: • durch Verschieben des Fokus im Aufbau eines Einzeltons treten die Teiltöne plastisch hervor • in Mehrklängen werden Schwebungen am Entstehungsort hörmäßig isolierbar, Rauhigkeiten als Auslöser für Dissonanzempfindung sind optisch und akustisch leicht zu identifizieren, Zurechtstimmen eines Zusammenklanges kann leicht nachvollzogen werden. Besonders der letzte Punkt ist von großem Interesse: viele Hörer müssen erst lernen, wo in den Gesamtklang hin(ein)zuhören ist, wenn von Schwebungen die Rede ist. Durch wiederholtes Hin- und Herschalten zwischen den beiden Modi wird dieser Lernvorgang effizient unterstützt. Der Fokus wird im auch linken Teil der Grafik – eine Übersicht über das Spektrum – dargestellt, und erlaubt so eine schnelle Orientierung. Die Erklärung dieses Elementes folgt im nächsten Abschnitt. 55 Weitere Elemente der Oberfläche Anhand der folgenden Abbildung werden jetzt die noch nicht besprochenen Elemente der Bedienoberfläche erklärt: Die Teiltonreihen werden zweimal dargestellt: links in einer Übersicht, rechts in einem frei wählbaren Ausschnitt. Dies ist notwendig, um einerseits den Überklick „über das Ganze“ nicht zu verlieren, andererseits aber mit der notwendigen Feinauflösung arbeiten zu können, die in Stimmungsfragen erfordert wird. Die Wahl des Ausschnitts erfolgt 56 durch Ziehen in einem speziellen Bereich zwischen den Teilfenstern, die Darstellung folgt auch hier dynamisch allen Veränderungen. Links über dem Übersichtbereich findet sich ein Regler, mit dessen Hilfe sich die Anzahl der dargestellten Teiltöne und folglich auch der Generalmaßstab der Darstellung bestimmen lässt. Beispielsweise werden höhere Teiltöne als Nr. 16 nur selten in Fragen der Stimmung oder Akkord-Konsonanz/Dissonanz herangezogen werden, Flexibilität bei der Wahl des relevanten Ausschnittes dient hier also der Übersichtlichkeit und Effizienz der Darstellung. Unter dem rechten (Vergrößerungs-)bereich befinden sich vier weitere Regler (wieder farbkodiert zur Zuordnung zu den Einzeltönen), mit deren Hilfe die horizontale Position der Teiltonkämme verändert werden kann: dadurch werden Vergleiche durch Nebeneinanderrücken zweier Töne erleichtert. Rechts unter den Eingabeeinheiten werden die Frequenzverhältnisse der gerade aktiven Töne in dezimaler Form dargestellt. Schließlich finden sich im linken unteren Teil noch die notwendigen Bedienelemente zur Tonwiedergabe: Ein/Aus, Lautstärke und Klangfarbe (reine Sinustöne bis sehr obertonreich). Insgesamt sind nur wenige Elemente vorhanden, sodass die eingangs aufgestellte Forderung nach Einfachheit und schneller Erlernbarkeit des „Spielfeldes“ erfüllt sein dürfte. 57 IV. Anwendungsbeispiele An einigen wenigen Beispielen soll dargestellt werden, wie das Programm beim Erlernen der Grundlagen von Intonation und Stimmung eingesetzt werden kann. mathematische und musikalische Struktur der Teiltonreihe Ein einzelner Ton wird eingeschaltet, der Fokus auf „Tonlupe“ gestellt, durch Verschieben mit der Maus treten also die Teiltöne deutlich hervor. • Indem der Benutzer die verschiedenen Bereiche des Spektrums absucht und die dort lokalisierten Töne vergleicht, wird er schnell die verschiedenen Intervalle entdecken und ihren Proportionswerten zuordnen können. Beispielsweise wird sich das Verhältnis 2:3 weiter oben als 4:6 und als gleiches Intervall erweisen, die harmonische Teilung des letzteren an der Position 5 wird die Entstehung des Durdreiklangs deutlich machen; gleichzeitig wird das Ohr für die besonders entspannte Qualität der Naturterz geschärft ( gegenüber dem gewohnten temperierten, überspannten Intervall). • Die Frequenzanzeige über dem Fokus macht dabei die logarithmische Funktionsweise des Gehörs deutlich: Umstimmen des Tons führt wohl zu anderen Frequenzzahlen, maßgeblich für die musikalischen Intervalle bleiben aber die Zahlenverhältnisse. • Durch abwechselndes Hin- und Herschalten des Fokus zwischen seinen beiden lernt das Ohr, auch im Gesamtklang die wichtigsten Teiltöne zu fokussieren und herauszuhören. • Durch Ändern der Klangfarbe des Tongenerators und Untersuchung der Teiltonlautstärken wird der Zusammenhang zwischen Spektrum und Klangfarbe sinnfällig. 58 Schwebungen zwischen einfachen Schwingungen Zwei Tongeneratoren werden eingeschaltet, die Klangfarbe auf Sinusschwingung reduziert. • Durch Einstellen verschiedener (kleiner) Frequenzabstände werden Schwebungen deutlich hörbar. • Durch langsames, kontinuierliches Verstimmen eines Einklangs werden die verschiedenen Phasen (Schwebung / Rauhigkeit / Zweitongefühl) hörbar. Dies kann in anderen Lagen wiederholt werden, dabei werden wichtige Eigenschaften des Gehörs deutlich (z. B. verschiedene Grade der Tonhöhenauflösung). • Ändern der Klangfarbe hin zu obertonreicheren Klängen und Abhören verschiedener Spektrumsabschnitte zeigt: Schwebungsgeschwindigkeiten sind auch proportional – leichte Verstimmungen führen in unteren Teiltonbereichen noch zu angenehm langsamen Schwebungen, in höheren Lagen treten gleichzeitig Rauhigkeiten ein. Durch Ändern der Klangfarbe lässt sich die Abhängigkeit dieses Phänomens von Teiltonintensitäten beobachten. Einstimmen eines Intervalls Durch sorgfältiges Abgleichen der Teiltontürme zweier Töne bis zur maximal möglichen Beruhigung des Klangs wird sichtbar: Beseitigung von Rauhigkeiten zwischen Teiltönen gelingt bei manchen Intervallen besser, weil ihre Muster besser zueinander passen – Konsonanz und Dissonanzwahrnehmung können direkt beobachtbar erprobt werden. Durch wiederholtes Umschalten des Fokus können die wichtigen Schwebungen während des Stimmvorgangs isoliert werden, das Gehör kann sehr schnell lernen, auf die jeweils relevante Stelle im kombinierten Spektrum der beiden Töne zu fokussieren – eine wesentliche Fähigkeit für Intonation und Stimmung! Terzkomma • Zwei Tongeneratoren werden auf eine reine Naturterz gestimmt (Teilton 4 des einen steht in Übereinstimmung mit Teilton 5 des anderen Tons), anschließend wird der obere Ton stummgeschaltet. • Zwei weitere Tongeneratoren werden nun – ausgehend vom ersten Ton - abwechselnd in reinen Quinten übereinandergestimmt, Oktavierungen sind dabei leicht zu bewerkstelligen. 59 • Die erreichte (pythagoreische) Terz kann nun direkt mit der vorher eingestimmten Naturterz verglichen werden. • Nun kann durch gleichmäßiges Verkleinern der Quinten und fortwährenden Vergleich das Terzkomma „wegtemperiert“ werden; dies entspricht dem unter „Grundlagen – Stimmungen lernen“ erwähnten „mitteltönigen Modul“. konsonanter Vierklang Durch Einbeziehen des Teiltones Nr. 7 lässt sich sogar ein konsonanter Septakkord (!) herstellen: 60 Diese wenigen Beispiele zeigen bereits viele Möglichkeiten von Experimenten auf. Selbstverständlich würde jeder Benutzer des Programms ausgehend von solchen Anordnungen viele Variationen und weiterführende Versuche finden; spielerisch und vielleicht zuerst unbemerkt wird ein zunehmend vertieftes Verständnis für die grundlegenden Zusammenhänge in Stimmungs- und Intonationsfragen entstehen. 61 V. Zusammenfassung Der Themenkreis Stimmung, Stimmungssysteme und Intonationsfragen ist auf Grund seiner zu Abstraktheit und – in den meisten Darstellungen – Unanschaulichkeit neigenden Natur für praktische Musiker und Musikinteressierte oft nur schwer zugänglich. Für eine kompetente Diskussion und Anwendung in musikalischer Praxis ist der Erwerb von einigem Grundlagenwissen zum Thema vonnöten. Dies umfasst: • Intervallbegriff als Verhältnis von Frequenzen • Rechnen mit Intervallen: Verhältnisrechnung, logarithmisches Rechnen (Centrechnung) • die Teiltonreihe als physikalisches Phänomen • musikalische Intervalle der Teiltonreihe • Konsonanz- und Dissonanzfragen und ihre physikalischen und davon ableitbaren musikästhetischen Grundlegungen • Unvereinbarkeit der wichtigsten systembildenden Konsonanzen (Quinten, Terzen) in geschlossenen tonalen Systemen, Notwendigkeit ihrer Temperierung • Stimmverfahren: Schwebungen und deren Minimierung • Grundmodelle historischer Stimmungssysteme Die Beschäftigung mit diesen Themen in abstrakter Form über Bücher oder ähnliche Formen des Wissenstransports entbehrt meist der notwendigen Hör- und Übungspraxis. Die praktische Beschäftigung mit dem Stimmen eines geeigneten, polyphon spielbaren Instrumentes (Cembalo u.a.) wird in diesem Zusammenhang als Idealfall gesehen, der den meisten Musikern jedoch aus praktischen Gründen verwehrt bleibt. Es wurde eine Alternative in Form einer Software gesucht, die folgende Eigenschaften aufweisen soll: • leichte Erlernbarkeit • musikernahe Bedienelemente • offenes Konzept, das zu eigenen Versuchen anregt • ein Höchstmaß an Anschaulichkeit 62 • einfache Methoden zur Sensibilisierung des Gehörs für Obertonreihen und deren Interaktion (Schwebungsverhalten, Konsonanzbeurteilung nach Helmholtz usw.) Es wurde auf der Basis der musiknahen Programmiersprache MAX/MSP ein entsprechendes Konzept verwirklicht. (Die Software kann derzeit auf Macintosh-Computern (OS X) eingesetzt werden, eine Windows-Versionen ist in Planung.) Anhand einiger Beispiele wurde gezeigt, wie das Programm für verschiedenste Fragestellungen zu dem am Anfang beschriebenen Themenkreis eingesetzt werden kann. Ausblick Ein Ausbau des Programms ist in folgenden Punkten geplant: • Integrierung realer Instrumentenklänge in Form von stimmbaren Samples • Spezialmodule zum Thema historische Stimmungssysteme • Spielbarkeit der eingestellten Stimmungen auf einem MIDI-Keyboard Einige Limitationen sind erkennbar: • Das Programm in der derzeitigen Form beschäftigt sich ausschließlich mit stationären Klängen (Sonanzprinzip), Fragen der dynamischen Intonation, z.B. im Zusammenhang von Melodien, sind nicht darstellbar. • Es werden nur Schwebungsphänomene erster Ordnung visualisiert, Differenztöne und deren Kombinationseffekte sind herstellbar, aber noch nicht in das visuell-auditive Lernkonzept einbezogen. 63 Literaturverzeichnis Apfel, Ernst. Diskant und Kontrapunkt in der Musiktheorie des 12. bis 15. Jahrhunderts. Hrsg. Richard Schaal. Taschenbücher zur Musikwissenschaft 82. Wilhelmshaven: Heinrichshofen’s Verlag, 1982. Auhagen, Wolfgang. „Stimmung und Temperatur“. in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Sachteil Bd. 8. 2., neuberarb. Ausg. Kassel: Bärenreiter, 1998 Billeter, Bernhard. Anweisung zum Stimmen von Tasteninstrumenten in verschiedenen Temperaturen. Edition Merseburger 1194. Kassel: Verlag Merseburger Berlin GmbH, 1979. Campbell, Murray; Greated, Clive. The Musician’s Guide to Acoustics. New York: Oxford University Press, 1987 Ebeling, Martin. Tonhöhe physikalisch–musikalisch–psychologisch–mathematisch. Hrsg. Fricke, Jobst. Systemische Musikwissenschaft; Bd. 2. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH Europäischer Verlag der Wissenschaften, 1999. Geller, Doris. Praktische Intonationslehre für Instrumentalisten und Sänger. 2., korrigierte Auflage 1999. Kassel: Bärenreiter-Verlag, 1997. Glatz, Gerhard et al. Fourier-Analysis. Brücken zur Mathematik Bd. 7. Berlin: Cornelsen Verlag, 1996 Jira, Martin. Musikalische Temperaturen in der Klaviermusik des 17. und frühen 18. Jahrhunderts. Hrsg. Osthoff, Wolfgang. Würzburger Musikhistorische Beiträge Bd. 17. Tutzing: Verlag Schneider, 1997. 64 Kelletat, Herbert. Zur musikalischen Temperatur: Bd. 1 Johann Sebastian Bach und seine Zeit. 2., verb. Aufl. Edition Merseburger 1190. Kassel: Verlag Merseburger Berlin GmbH, 1981. Ligeti, György. Sonate für Viola solo. ED 8374. Mainz: Schott Musik International, 2001 Lindley, Mark. Stimmung und Temperatur. in: Geschichte der Musiktheorie Hrsg. Zaminer, Frieder. Geschichte der Musiktheorie Bd. 6. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1987. S. 109–331 Möller, Hartmut; Stephan, Rudolph (Hrsg.). Die Musik des Mittelalters. Neues Handbuch der Musikwissenschaft Bd. 2. Laaber: Laaber Verlag 1991 Neuwirth, Erich. Musikalische Stimmungen. Wien: Springer-Verlag, 1997. Praetorius, Michael. Syntagma musicum (Faksimile Reprint der Ausgabe Wittenberg 1614/15). Kassel: Bärenreiter-Verlag, 2001 Roederer, Juan. Physikalische und psychoakustische Grundlagen der Musik. Berlin Heidelberg New York: Springer-Verlag, 1977. Ruhnke, Martin; Hesse, Horst-Peter. „Intervall“. in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Sachteil Bd. 4. 2., neuberarb. Ausg. Kassel: Bärenreiter, 1996 Werckmeister, Andreas. Die musicalische Temperatur (1691) (Reprint). Hrsg. Bimberg, Guido und Pfeiffer, Rüdiger. Denkmäler der Musik in Mitteldeutschland: Ser. 2., Documenta theoretica musicae; Bd. 1; WerckmeisterStudien. Essen: Verlag Die Blaue Eule, 1996. 65 empfohlene Literatur: Kirnberger, Johann Philipp. Die Kunst des reinen Satzes in der Musik (Reprint der Ausgabe Berlin und Königsberg 1776–79). Hildesheim-Zürich-New York: Georg Olms Verlag, 1988 66 Anhang 1: Salinas Tonsystem in: De musica libri VII (1577) Erklärung der wichtigsten Intervallbezeichnungen: Dupla…Oktave, Diapente…Quinte, Diatessaron…Quarte, Ditonus…große Terz, Semiditonus…kleine Terz, Tonus major/minor…großer/kleiner Ganzton 67 Anhang 2: Programmdokumentation Hauptfenster, Programmieransicht Initialisierungroutinen 68 Eingabeeinheit (im Programmiermodus) Eingabeeinheit: Berechnung und Ausgabe der angezeigten Werte 69 Eingabeinheit: Farbsteuerung Rahmen Teiltondisplay: Umfangsberechnung Skalierung der Teiltondisplays 70 Mausabfrage Teiltongrafik: Hauptsteuerung Teiltongrafik: Ausgabe 1 71 Teiltongrafik: Ausgabe 2 Generierung der Teiltongrafik: Teiltöne 72 Generierung der Teiltongrafik: Fokus-Form Generierung der Teiltongrafik: Fokus-Frequenzberechnung und Durchmesser (Amplitudenmessung) 73 Fokus: Hauptseite Umrechnung Verhältnis –> cent Normierung der Frequenzen (dient der Umfangsberechnung) 74 Audioteil: Hauptfenster Audioteil: Tongenerator 75 Audioteil: Tongenerator-Mutes (Stummschaltung) Audioteil: Antiklick-Maßnahme (weiche fades) 76 Curriculum vitae Michael Meixner geboren am 23. März 1962 in Wien 1968–1972 Volksschule Wöllersdorf 1972–1980 Neusprachliches Gymnasium Wr. Neustadt 1980 Matura 1979 Beginn des Studiums an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Wien (Komposition, seit 1980 auch Kirchenmusik) 1986 Diplomprüfung (Kirchenmusik) seit 1989 Unterrichtstätigkeit an der Hochschule für Musik (Satzlehre, Formenlehre, Gehörbildung, Computernotensatz, Methoden der Notation in der Gegenwart) 2004 Ergänzungsstudium gem. § 80 a Abs. 11 UniStG 77