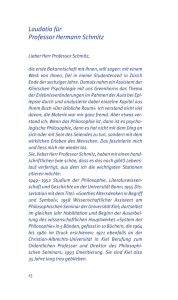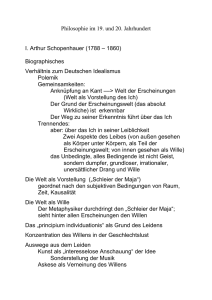Von Pyrrhon zu Husserl - Metodo. International Studies in
Werbung

Von Pyrrhon zu Husserl Zur Vorgeschichte der phänomenologischen Epoché 1 Klaus Held Bergische Universität Wuppertal Jede „Sache“ – sei dies ein Gegenstand, den wir mit den Sinnen wahrnehmen, eine Institution, eine Angelegenheit, ein Gedanke, kurz: alles, womit wir in unserem Denken und Handeln zu tun haben – kann uns auf so divergierende Weise erscheinen, dass ein Streit der Meinungen darüber entsteht. Der Streit bricht dann aus, wenn jeder Beteiligte für sich die Wahrheit in Anspruch nimmt, indem er behauptet, nur die Weise, wie ihm die Sache erscheint, entspreche dem, was und wie die Sache selbst ist. Den Meinungsstreit gibt es ebenso zwischen einzelnen Menschen wie zwischen Gruppen von Menschen, ja zwischen ganzen Völkern und Kulturen. Seit die Philosophie zum ersten Mal über ihr eigenes Tun nachgedacht hat, d.h. seit Heraklit und Parmenides gegen Ende des 5. vorchristlichen Jahrhunderts, hat sie es als ihre Aufgabe angesehen, den Streit endgültig zu überwinden, der dadurch entsteht, dass das Sein einer Sache sich in unterschiedlichen Erscheinungsweisen zeigt. In diesem Sinne war die Philosophie seit ihrem Beginn eine Suche nach der Wahrheit. Die Phänomenologie des 20. Jahrhunderts ist, wie ihr Name sagt, eine philosophische Methode zur Erforschung des Erscheinens, griechisch ausgedrückt: des phaínesthai oder des phainómenon. Den Ausgangspunkt der Phänomenologie, so wie sie von Edmund Husserl begründet wurde, bildet die Relativität des Erscheinens. Deshalb ist sie eine neuartige Wiederaufnahme des Versuchs, bei der Suche nach der Wahrheit den Meinungsstreit zu überwinden. Welchen Weg – griechisch méthodos – sie dabei einschlägt, sollen die folgenden Überlegungen verdeutlichen, indem sie von den Anfängen der Philosophie in der Antike ausgehen und von dort eine Brücke zu Husserls Phänomenologie schlagen. Auf welchen Wegen haben die Griechen versucht, durch die Philosophie über den vorphilosophischen Meinungsstreit hinauszugelangen? Mit der Bemühung um die endgültige Überwindung des Meinungsstreits unterscheidet sich die Philosophie von der Denkweise der Menschen vor und außerhalb der Philosophie. Hegel charakterisiert diese Denkweise in seiner Phänomenologie des Geistes als das „natürliche Bewusstsein“, 2 und Husserl führt sie in der „Fundamentalbetrachtung“ seines methodischen Hauptwerks, des ersten Bandes der Ideen zu einer reinen Phänomenologie, auf eine dem Menschen vollkommen selbstverständliche Grundhaltung zurück, die er als die „natürliche Einstellung“ bezeichnet. 3 Heraklit scheint um die Wende vom 6. zum 5. vorchristlichen Jahrhundert der erste gewesen zu sein, der die Frage gestellt hat, wodurch sich die Einstellung, von der das philosophische Denken getragen ist, von der natürlichen Einstellung unterscheidet. Er bezeichnet die große Masse der Menschen, wie sie ihr Leben in der natürlichen Einstellung führen, als die Vielen, polloí, und wirft ihnen polemisch vor, dass ihr 1 Deutsche aktualisierte Fassung eines Aufsatzes, der unter dem Titel The Controversy Concerning Truth: Towards a Prehistory of Phenomenology in englischer Übersetzung erschienen ist. Vgl. Held 2000. 2 Hegel 1952, 67 ff. 3 Husserl 1976, 56 ff. Hua III/1. Metodo. International Studies in Phenomenology and Philosophy Vol. 1, n. 2 (2013) ISSN 2281-9177 234 Klaus Held Verhalten dem von Träumenden gleiche. 4 Wer träumt, kennt in diesem Zustand nur die Privatwelt, den ídios kósmos seines Traumes und steht mit den anderen Menschen und ihren Welten nicht in Verbindung; er ist abgeschnitten vom „Gemeinsamen“, koinón, der einen gemeinsamen Welt aller Menschen, worin alle privaten Welten zusammengehören. Die Polemik des Heraklit gegen die Vielen enthält implizit eine Erklärung dafür, warum überall und immer wieder zwischen den Menschen der Meinungsstreit entsteht: Die unterschiedlichen Erscheinungsweisen der Sachen, aufgrund deren wir divergierende Urteile über ihr Sein fällen, ergeben sich daraus, dass dieses Sein für uns immer nur in Erscheinungsweisen zum Vorschein kommt, die ihrerseits an bestimmte Welten gebunden sind. Von solchen Welten hat nicht nur Heraklit gesprochen, sondern auch wir tun das noch, wenn wir von der „Welt des Büroangestellten“, „die Welt des Sportlers“, „die Welt des Computerfachmanns“ und vielen anderen solchen Welten sprechen. Wir meinen damit die begrenzten Gesichtskreise unseres Denkens und Handelns, d.h. die Horizonte, in denen wir uns gewohnheitlich bei unserem Verhalten orientieren. Die Philosophie ist nach Heraklit das Erwachen aus der Abkapselung in den privaten Traumwelten unserer beschränkten Horizonte. Das Erwachen zur Aufgeschlossenheit für die eine, allen Menschen gemeinsame Welt ist möglich, weil keiner der partikularen Horizonte gänzlich abgeschlossen ist. Sie alle verweisen jeweils über sich hinaus auf andere Horizonte, und so gehören sie alle in einem allumfassenden Verweisungszusammenhang zusammen, der einen Welt. Die Philosophie ist, das war Heraklits wegweisende Erkenntnis, die Öffnung des Menschen für die so verstandene eine Welt. Gegen das bei Heraklit formulierte ursprüngliche Selbstverständnis der Philosophie erhob sich etwa ein halbes Jahrhundert später der Widerspruch des Protagoras, der damit die Sophistik begründete, die seitdem den ewigen Gegner der Philosophie bildet. Protagoras hält den Anspruch der Philosophie, Aussagen über die eine Welt machen zu wollen und zu können, für eine Vermessenheit, griechisch gesprochen: für Hybris. Er behauptet, es gebe für die Menschen nur ihre vielen Privatwelten und keine gemeinsame eine Welt darüberhinaus. Protagoras stellt sich damit gegen Heraklit auf die Seite der Vielen, die über ihre partikularen Welten nicht hinausblicken. Prägnanter Ausdruck dieser Auffassung ist sein berühmt-berüchtigter homo-mensura-Satz: «Der Mensch ist das Maß aller Dinge, der seienden, dass sie sind, der nichtseienden, dass sie nicht sind», in Platons Theaitetos 152 a folgendermaßen in indirekter Rede zitiert: «pánton chremáton métron ánthropon eínai, ton men ónton hos ésti, ton de me ónton hos ouk éstin». Mit dem „Menschen“, von dem dieser Satz spricht, ist nicht der abstrakte „Mensch überhaupt“ gemeint, sondern die vielen Menschen und Menschengruppen mit ihren jeweiligen partikularen Welten, die „Vielen“ des Heraklit. Dass und wie die Dinge sind, hängt allein davon ab, wie sie den Menschen in ihren Privatwelten erscheinen. Als Erläuterung für das, was Protagoras meint, kann ein Beispiel dienen, mit dem schon Platon im Theaitetos 152 b den Sinn des homo-mensura-Satzes erläutert hat: Es kann sein, dass zwei Menschen, die beide dem gleichen Wind ausgesetzt sind, dabei gegensätzliche Empfindungen haben, weil sie in unterschiedlichen Privatwelten leben: Dem einen wird kalt, und der Wind erscheint ihm als kalt, dem anderen wird warm, und entsprechend erscheint ihm der Wind. Was der Wind ist, ist relativ auf die Empfindungen des Empfindlichen und des Robusten. Deshalb hält der eine für wahr, dass der Wind kalt ist, der andere hingegen, dass er warm ist. Wenn wir sagen, dass es im Meinungsstreit um die Wahrheit geht, verstehen wir 4 Diels und Kranz 1964, 22 B 89 in Verbindung mit B 1, B 2, B 114 und B 30. Vgl. hierzu und zum Folgenden Held 1980a. Metodo. International Studies in Phenomenology and Philosophy Vol. 1, n. 2 (2013) Von Pyrrhon zu Husserl 235 den Begriff „Wahrheit“ in dem Sinne, dass eine Sache sich in einer Erscheinungsweise so zeigt, wie sie ist. Das Gegenteil der Wahrheit, das wir im Meinungsstreit unseren Gegnern vorwerfen, besteht darin, dass sich ihnen die Sache anders zeigt, als sie selbst ist, d.h. dass ihnen ihr Sein mehr oder weniger verborgen bleibt. Demnach bedeutet „Wahrheit“ in diesem Zusammenhang das Nicht-Verborgenbleiben des Seins einer Sache, das Zum-Vorschein-Kommen der Sache selbst in entsprechenden Erscheinungsweisen. In diesem Sinne hat die antike Philosophie die Wahrheit als „Unverborgenheit“ – alétheia – verstanden; 5 das ist das griechische Wort, das wir mit „Wahrheit“ übersetzen. Nicht zufällig hat der homo-mensura-Satz höchstwahrscheinlich am Anfang eines Werks gestanden, das den Titel „Alétheia“ trug. Protagoras setzt die Wahrheit mit den horizontgebundenen Erscheinungsweisen der Dinge gleich; sie haben kein Sein jenseits der Privatwelten. Das ist der Weg des Relativismus der Sophistik. 6 Ein Meinungsstreit wird ausgetragen, indem die Beteiligten miteinander reden und zur Sprache bringen, auf welche Weise ihnen die Sache, um die es geht, erscheint. Die sprachliche Gestalt, in der wir darlegen, wie uns das Sein einer Sache erscheint, ist der Aussagesatz. Die Grundform der Aussage ist nach der traditionellen, von Aristoteles begründeten Logik das Urteil „S ist p“. Mit dem Urteil vollziehen wir eine sýnthesis, eine Verbindung zwischen einem Prädikat „p“ und einer Sache, auf die sich die Prädikation bezieht. Die Sache ist das, was der Prädikation zugrundeliegt, das hypokeímenon, ins Lateinische übersetzt: das subiectum „S“. Nach Aristoteles ist eine Aussage wahr, wenn die Verbindung eines bestimmten Prädikats mit einer bestimmten Sache, die in ihr behauptet wird, auch außerhalb der Aussage besteht. 7 as Prädikat bringt in diesem Falle etwas vom Sein der Sache zum Erscheinen, und von den prädikativ zur Sprache gebrachten Erscheinungsweisen kann man dann sagen, dass in ihnen die Sache selbst „offenbar“, „offenkundig“ wird, griechisch: dêlos. In diesem Sinne ist das menschliche Sprechen, sofern es die Form einer wahren Aussage hat, ein deloûn, ein Offenbarmachen. Mit dieser Interpretation des Sprechens folgt Aristoteles dem Verständnis von Wahrheit als Unverborgenheit. Parmenides, der große Zeitgenosse des Heraklit, hat in seinem Lehrgedicht den Eintritt in die Philosophie als Entscheidung für einen Weg beschrieben, den Weg der Alétheia. 8 Dieser Weg unterscheidet sich vom Weg der Vielen, 9 den Protagoras später rehabilitieren wollte. Was den Menschen zum Weg der Philosophie befähigt, ist sein Vermögen, sich für die eine gemeinsame Welt zu öffnen: der „Geist“, griechisch nous. Dieses Substantiv hängt mit dem Verb noeîn zusammen, das man zumeist mit „denken“ übersetzt, das aber eigentlich soviel bedeutet wie „etwas bemerken und vernehmen“. Unser nous ist fähig, auch das zu bemerken und zu vernehmen, was uns im beschränkten Horizont unserer jeweiligen Privatwelt nicht gegenwärtig und deshalb nicht offenbar ist. Auch das in diesem Sinne Abwesende und Verborgene kann sich unserem Geist doch als etwas Anwesendes, Offenbares, als ein dêlon, zeigen und d.h.: ihm erscheinen. Deshalb wird der denkende Mensch im Lehrgedicht aufgefordert, auch das jeweils Nichtgegenwärtige mit seinem nous als gegenwärtig zu erblicken. 10 5 Diese historische Feststellung ist unabhängig davon, ob es sprachgeschichtlich zutrifft, dass das erste „a“ in alétheia ein alpha privativum ist. 6 Zur phänomenologischen Interpretation des Relativismus des Protagoras und zum sophistischen Verständnis der dóxa in phänomenologischer Sicht vgl. Held 1980b und das Kapitel „Die Sophistik in Hegels Sicht“ in Held 2010, 143 ff. 7D 8 Diels und Kranz 1964, 28 B 7/8. 9 Diels und Kranz 1964, 28 B 6. 10 Diels und Kranz 1964, 28 B 4. Metodo. International Studies in Phenomenology and Philosophy Vol. 1, n. 2 (2013) Klaus Held 236 Alle spätere Philosophie und Wissenschaft ist der Versuch, diese Aufforderung zu verwirklichen. Auch dafür kann die oben erwähnte Kälte als Beispiel dienen. Im vorund außerphilosophischen Leben ist es uns selbstverständlich, zu glauben, dass uns in Erscheinungsweisen wie der Kälte eine „Sache“ erscheint, beispielsweise der Wind. Erscheinen bedeutet für die natürliche Einstellung Erscheinen-von-etwas, Sich-Zeigen einer Sache; jedes Erscheinen enthält die Beziehung auf das Sein einer Sache, – ein Sein, von dem die Erscheinungsweisen getragen sind. Das Tragende ist das Zugrundeliegende, das hypokeímenon oder subiectum. Für den vorwissenschaftlich lebenden Menschen ist der Wind das Zugrundeliegende, dessen Sein in der Erscheinungsweise der Kälte offenbar wird. Die Philosophen und Wissenschaftler glauben, dass den Vielen das wahre Sein hinter dieser Erscheinungsweise verborgen bleibt, und sie machen sich anheischig, das wahre Sein zu erkennen, das in einer solchen Erscheinungsweise nur partiell oder verzerrt zum Vorschein kommt. Platon beispielsweise würde – wie dem letzten Beweisgang im Phaidon (103 d) zu entnehmen ist – sagen, dass das, was uns Menschen in der Sinnenwelt im einzelnen als kalt erscheint, an der Idee des Kalten teilhat, und dass diese Idee das Kalte ist, das wahrhaft Sein besitzt. Die neuzeitliche Erkenntnistheorie behauptet seit Descartes, dass Empfindungen wie die Kälte nur sekundäre, abgeleitete Qualitäten sind; hinter der Empfindungsqualität „kalt“ steckt als „primäre Qualität“ ein mathematisch formulierbarer niedriger Grad der Bewegung von Molekülen, und das eigentliche Sein der Kälte ist die so verstandene tiefe „Temperatur“. Der Wegbereiter für alle solchen wissenschaftlichen Erklärungen des Erscheinenden war Parmenides mit seiner These: Das Sein, das uns in der natürlichen Einstellung verborgen bleibt, weil das Erscheinen hier auf unsere jeweils maßgebenden eigenen Horizonte beschränkt bleibt, liegt doch für unseren Geist, den nous, offen. Zu jeglichem Sein, griechisch: eînai, gehört das Erscheinen als ein Sich-Zeigen für das noeîn, das „Denken“. Diese allumfassende Zusammengehörigkeit von Denken und Sein hat Parmenides auch ausdrücklich formuliert, und zwar in dem berühmten Vers: to gar autó estín noeîn te kai eînai, „dasselbe ist nämlich bemerkendes Vernehmen und Sein“.11 Protagoras bestreitet später mit seinem Relativismus die universale Offenheit des menschlichen Geistes. Aber das Bemerkenswerte ist, dass er trotz dieser Abkehr von der Philosophie an der parmenideischen Selbigkeit von Sein und bemerkendem Vernehmen festhält; denn wenn die Menschen in ihrer horizontbedingten Verschiedenartigkeit das Maß für das Sein der Sachen sind, dann bedeutet das immer noch, dass das Erscheinen der Sachen für den Menschen gleichgesetzt wird mit ihrem Sein. Platon und in seinem Gefolge Aristoteles kritisieren Protagoras und kehren zur ursprünglichen Offenheit des Denkens für das Ganze der einen gemeinsamen Welt zurück. Auch sie halten dabei an der parmenideischen Grundüberzeugung fest, dass das Sein der Sachen selbst und ihr Erscheinen untrennbar zusammengehören; Sein bedeutet für sie „Wahrsein“, wenn man unter dem Wahren im Sinne des Wortes alétheia das Hervortreten des Seins der Sachen aus der Verborgenheit in entsprechenden Erscheinungsweisen versteht. So kann man von einer ersten Epoche der Philosophie sprechen, die von der Mitte des 6. bis zur Mitte des 4. vorchristlichen Jahrhunderts reichte und die trotz aller sonstigen Divergenzen von jener Grundüberzeugung getragen war. Diese Epoche hatte ein langes Nachspiel in der lateinischen Scholastik des Früh- und Hochmittelalters, für deren Transzendentalienlehre der Lehrsatz grundlegend war: „ens et verum convertuntur“, „«seiend» und «wahr» sind austauschbare Bestimmungen“. 11 Diels und Kranz 1964, 28 B 3. Metodo. International Studies in Phenomenology and Philosophy Vol. 1, n. 2 (2013) Von Pyrrhon zu Husserl 237 In der Antike brach eine neue Geschichtsepoche an, als im ausgehenden 4. vorchristlichen Jahrhundert die Philosophenschulen des Hellenismus entstanden, von denen Epikur und die Stoiker den größten Einfluss gewannen. Für den vorliegenden Zusammenhang ist die Skepsis des Pyrrhon von Elis von besonderer Bedeutung; denn sie war ein radikal neuartiger Versuch, den Meinungsstreit philosophisch zu überwinden. Die vorhellenistischen Philosophen entschärfen den Meinungsstreit durch die Annahme, dass die Privatwelten in der einen Welt zusammengehören; wir können den Streit beenden, indem wir uns für die eine gemeinsame Welt öffnen. Im Relativismus des Protagoras wird er durch die gegenteilige Voraussetzung entschärft: Weil es keine gemeinsame Welt gibt, sondern nur partikulare Horizonte, soll man jede Erscheinungsweise als wahr gelten lassen. Die pyrrhonische Skepsis schlägt demgegenüber einen vollkommen neuen Weg ein. Im Meinungsstreit erheben alle Beteiligten für ihre Aussagen den Anspruch, sie seien wahr. Wegen dieses Anspruchs bezeichnen wir Aussagen als „Behauptungen“. Im Meinungsstreit prallen die Behauptungen aufeinander, weil das, was der eine bejaht, von seinem Gegner bestritten und damit verneint wird. Der Streit entsteht durch diesen Widerspruch zwischen Affirmation und Negation. Die Skepsis versucht systematisch zu zeigen, dass es gute Gründe dafür gibt, jeder affirmativen Behauptung eine entsprechende Negation entgegenzustellen und umgekehrt. So entsteht ein Kräfte-Gleichgewicht – isosthéneia – zwischen allen erdenklichen Affirmationen und Negationen, das es unmöglich macht, irgendeine Behauptung aufrechtzuerhalten. 12 Der Skeptiker gelangt auf diese Weise methodisch in eine Haltung der Neutralität gegenüber dem Inhalt aller möglichen Aussagen überhaupt. Die Haltung der Neutralität macht es dem Skeptiker möglich, erstmals eine Unterscheidung zu treffen, die uns heute vor allem durch die analytische Philosophie geläufig geworden ist: Jede Behauptung, die mit einer Aussage aufgestellt wird, lässt sich, wie die Analytiker sagen, ohne Veränderung ihres semantischen Gehalts in zwei Momente zerlegen, das propositionale Moment und dasjenige, wodurch die Aussage den Charakter einer Behauptung hat. Greifen wir noch einmal auf das platonische Beispiel zurück und denken wir uns einen Meinungsstreit zwischen einem robusten und einem empfindlichen Menschen über den Wind. Dem Robusten erscheint die Sache „Wind“ als warm, und so macht er die Aussage: „Der Wind ist warm“. Der propositionale Gehalt besteht hier in der Verbindung zwischen dem Prädikat „warm“ und dem Subjekt „Wind“. Das eigentliche Behauptungsmoment der Aussage ist die Affirmation, die besagt: „Ja, es ist wahr, dass die Verbindung zwischen Wärme und Wind besteht“. Der Empfindliche, dem der Wind als kalt erscheint, widerspricht dem Robusten mit der Negation: „Der Wind ist nicht warm“. Seine Behauptung lautet: „Nein, es ist nicht wahr, dass die besagte Verbindung besteht“. Nach dieser Interpretation des Meinungsstreits sind das Ja- und Nein-Sagen, die Affirmation und die Negation, Stellungnahmen zum proposionalen Gehalt der Aussage, um die es jeweils geht. Weil der Skeptiker ein Kräftegleichgewicht zwischen allen solchen Stellungnahmen herbeiführt, bleibt ihm nur noch die Möglichkeit, sich radikal aller Stellungnahmen zu enthalten. Man darf diese Enthaltung nicht mit einer Abschwächung der Affirmation oder der Negation oder mit einem Schwanken zwischen beiden Stellungnahmen verwechseln. Beides kennen wir schon aus der vorphilosophischen Sprache in vielen Formen, beispielsweise indem wir eine Behauptung mit adverbialen Bestimmungen wie „vielleicht“, „wahrscheinlich“, „möglicherweise“, „vermutlich“ usw. versehen. Mit allen so formulierten Aussagen nehmen wir noch 12 Sextus Empiricus 1967, I 8. Metodo. International Studies in Phenomenology and Philosophy Vol. 1, n. 2 (2013) Klaus Held 238 auf irgendeine Weise zum Inhalt dessen, was wir sagen, Stellung. Der Skeptiker aber unterlässt das Stellungnehmen in allen seinen Spielarten; er „hält inne“ damit. „Innehalten“, „sich mit etwas zurückhalten“ heißt im Altgriechischen epéchein. Die pyrrhonische Skepsis bezeichnet deshalb die radikale Enthaltung von allen Stellungnahmen mit einem von diesem Verb abgeleiteten Substantiv als epoché. Eine solche Enthaltung ist kein normales, aus der natürlichen Einstellung des vorphilosophischen Lebens gewohntes Verhalten, sondern es beruht auf einer eigens vollzogenen Entscheidung, d.h. aber: einem Akt unseres Willens. Eine solche Betätigung des Willens in bezug auf das Behaupten wäre nun aber gar nicht möglich, wenn das Behaupten selbst, das Affirmieren und Negieren in seinen mannigfaltigen Formen, nicht schon den Charakter eines Willensvollzuges hätte. Die Interpretation der Aussage als einer Behauptung, die eine willentliche Stellungnahme enthält, wurde durch die antike Skepsis möglich. Sie erscheint uns heute durch den Einfluss der Sprachanalytik geradezu als selbstverständlich, aber sie ist es keineswegs. Das erkennt man leicht daran, dass Aristoteles, der die Begriffe der Affirmation und der Negation in das Denken eingeführt hat, diese beiden Formen des Behauptens noch nicht für Weisen eines willentlichen Stellungnehmens gehalten hat. „Affirmation“ und „Negation“ sind die lateinischen Übersetzungen von zwei Begriffen, die bei Aristoteles katáphasis und apóphasis lauten. Katáphasis bedeutet „Zusprechen“: Die sprachlich vollzogene Verbindung, die Synthesis besteht hier darin, dass wir behaupten, einer Sache komme ein bestimmtes Prädikat zu. Wir können ihr das Prädikat aber auch „absprechen“; das ist die apóphasis. Eine affirmative Aussage über eine Sache ist nach Aristoteles dann wahr, wenn wir in der damit vollzogenen Synthesis das zusammen vorliegen lassen, was sich auch beim Erscheinen der Sache als zusammen vorliegend zeigt, und die wahre apóphasis verneint das Zusammenvorliegen dessen, was nicht als zusammen vorliegend erscheint. Aristoteles nimmt an, dass wir mit dem wahren Zusprechen und Absprechen eines Prädikats nur dem folgen, was sich zeigt, nämlich einer in dem erscheinenden Sachverhalt vorliegenden Verbundenheit bzw. Unverbundenheit. Auf diese Weise interpretiert er Affirmation und Negation entsprechend der parmenideischen Zusammengehörigkeit von Sein und Erscheinen. So können apóphasis und katáphasis für ihn nicht den Charakter einer Stellungnahme haben, d.h. der Zustimmung oder Ablehnung bezüglich einer Aussage. Bei einer solchen Stellungnahme ist unser Wille im Spiel. Solange zum Sein der Sachen selbst das Offenbarwerden gehört und solange umgekehrt das Erscheinen nichts anderes ist als ein Sich-Zeigen dieses Seins, bietet das Urteilen keinen Spielraum für eine Stellungnahme, mit der wir die Verbundenheit oder Unverbundenheit einer Sache und eines Prädikats willentlich bestätigen oder ablehnen könnten. Dass die Affirmation in der pyrrhonische Skepsis die Bedeutung einer mit dem Willen vollzogenen Zustimmung bekommt, zeigt sich u.a. daran, dass an die Stelle des aristotelischen Wortes katáphasis der Begriff synkatáthesis tritt, der zum Ausdruck bringt, dass jemand mit der Handlungsweise eines anderen übereinstimmt und ihr Beifall zollt. 13 Die Verbundenheit oder Unverbundenheit zwischen einer Sache selbst und der Weise, wie sie uns erscheint und damit prädizierbar wird, kann nur dann von unserer Entscheidung abhängen, wenn uns die Beziehung zwischen der Sache und ihrer Erscheinungsweise prinzipiell unbekannt bleibt, – schärfer formuliert: wenn wir nicht einmal wissen können, ob eine solche Beziehung überhaupt besteht. Nur unter der Voraussetzung eines solchen Nichtwissens bedarf es eines Willens, der die 13 Vgl. etwa Sextus Empiricus 1967, I 19. Metodo. International Studies in Phenomenology and Philosophy Vol. 1, n. 2 (2013) Von Pyrrhon zu Husserl 239 Beziehung eigens herstellt. Ein solches Nichtwissen bedeutet aber, dass uns das Sein der Sachen bei ihrem Erscheinen in einer radikalen Weise verborgen bleibt, d.h. dass die parmenideische Zusammengehörigkeit von Sein und Offenbarwerden nicht mehr gilt. Die durch die Relativität des Erscheinens bedingte Divergenz der Meinungen bekommt die Schärfe eines Streits um die Wahrheit, weil die Diskussionsgegner einander gegenseitig Unwahrheit und Irrtum vorwerfen. Das vorhellenistische Denken nimmt diesem Streit die Schärfe durch die Annahme, dass keine Erscheinungsweise absolut unwahr sein kann; denn jede Erscheinungsweise ergibt sich aus dem Kontext einer horizonthaften Welt, und sie alle gehören in der einen Welt zusammen. Deshalb vollzieht sich in jeder Erscheinungsweise, mag sie auch vom jeweiligen Gegner im Meinungsstreit als eine verzerrende, verstellende, einseitige, täuschende Erscheinungsweise bezeichnet werden, immer noch ein Erscheinen. Der Irrtum des Gegners im Meinungsstreit kann nie so weit gehen, dass ihm jede Sache vollständig verborgen bliebe; denn wenn das der Fall wäre, hätten die Gegner überhaupt keine Sache gemeinsam, über die sie streiten können. Ihr Streit ist nur möglich, weil sie sich gemeinsam auf das Sein einer Sache beziehen und weil zu diesem Sein gehört, dass es zum Vorschein kommt, mag dieses Zum-Vorschein-Kommen auch getrübt oder gestört sein und die Beteiligten täuschen. Auch das Erscheinen der Sachen in täuschenden Erscheinungsweisen bleibt also ein Erscheinen. Das aber bedeutet, dass niemand vollständig vom Sein der Sachen abgeschnitten ist, auch derjenige nicht, der sich irrt; es gibt kein Sein, das gänzlich verborgen bleiben könnte; auch eine falsche Aussage ist noch ein deloûn, ein Offenbarmachen. Genau das ist die parmenideische Grundüberzeugung von der Zusammengehörigkeit von Sein und Erscheinen. Diese Grundüberzeugung wurde erst aufgegeben, als sich durch die skeptische Epoché die Annahme durchsetzte, das Sein der Sachen bleibe gänzlich verborgen, es habe – griechisch ausgedrückt – den Charakter des ádelon, des Nicht-Offenkundigen. In diesem Augenblick tut sich eine Kluft auf: jenseits ihrer liegt das verborgene Sein und diesseits ihrer das dêlon, das Offenkundige, nämlich das Erscheinen, das sich konkret in Erscheinungsweisen vollzieht. Mit der Abtrennung der Offenkundigkeit des Erscheinens von der Verborgenheit des Seins wandelt sich das Verständnis von Unwahrheit grundlegend: Wegen des Abgrunds zwischen Sein und Erscheinen ist es nun grundsätzlich möglich, dass wir uns jedesmal täuschen, wenn wir glauben, in einer für uns offenkundigen Erscheinungsweise einer Sache werde ihr Sein offenbar. Die relativistische Entschärfung des Meinungsstreits bei Protagoras hatte darin bestanden, dass jede Behauptung für wahr erklärt wurde. Die skeptische Entschärfung besteht umgekehrt darin, dass keine Behauptung für sich in Anspruch nehmen kann, sie sei wahr im Sinne der alétheia, d.h. des Sich-Zeigens des Seins einer Sache in entsprechenden Erscheinungsweisen. Der Meinungsstreit lohnt sich gleichsam nicht mehr, weil von vornherein niemand, der eine Behauptung aufstellt, im Sinne der alétheia recht haben kann. Wie erwähnt, gehört zum vorphilosophischen Leben die selbstverständliche Überzeugung, dass jedes Erscheinen Erscheinen-von-etwas ist, Sich-Darbieten einer zugrundeliegenden Sache, eines subiectum, das von uns aus gesehen „hinter“ dem Erscheinen steht. Die Skepsis ist der äußerste Widerspruch der Philosophie gegen die natürliche Einstellung; denn sie entzieht das subiectum gänzlich der Zugänglichkeit für unseren Geist; das Sein der Sachen findet außerhalb dieser Zugänglichkeit statt. Die Verborgenheit dieses Seins wirft den Geist des Menschen auf das zurück, was ihm allein zugänglich ist: den Bereich der Offenkundigkeit, das Erscheinen. So bleibt dem Menschen nur noch die Möglichkeit, das subiectum nicht draußen, jenseits dieses Metodo. International Studies in Phenomenology and Philosophy Vol. 1, n. 2 (2013) Klaus Held 240 Bereichs zu suchen, sondern diesseits seiner, bei sich selbst, in seinem eigenen Geist, für den die Erscheinungsweisen offenkundig sind. Hierdurch wird der Geist des einzelnen Menschen – mein Geist – zum subiectum der Erscheinungsweisen, zum „Subjekt“ im neuzeitlichen Sinne. Die Erscheinungsweisen bleiben nicht länger Weisen des Sich-Zeigens der Sachen, sondern sie werden zu Weisen, in denen sich meinem Geist Züge seiner selbst zeigen. Die Kälte beispielsweise, die einem Menschen in der natürlichen Einstellung als eine Eigenschaft des subiectum „Wind“ erscheinen kann, wird als Empfindung in das Innere meines Geistes verlagert. Das Geschehen des Erscheinens von „Kälte“ spielt sich nicht mehr in der Beziehung zu der Sache „Wind“ ab, sondern in der Beziehung zu mir selbst als Geist. Diese Beziehung zu mir selbst bekommt in der neuzeitlichen Philosophie die Bezeichnung „Vorstellung“. Die Erscheinungsweisen werden Vorstellungen, die ich als Subjekt vollziehe. Als Vollzieher der Vorstellungen erhält der Geist den Namen „Bewusstsein“. Gegenüber der Innerlichkeit des Bewusstseins mit seinen Vorstellungen bildet das Sein der Sachen ein Außerhalb; die Sachen werden zu „Gegenständen“, die dem menschlichen Subjekt „draußen“ gegenüberstehen und auf die es sich vermittels seiner Vorstellungen bezieht. Dieser Dualismus von Innerlichkeit des Bewusstseins und „Außenwelt“ wurde zwar erst zu Beginn der neuzeitlichen Philosophie bei Descartes spruchreif, aber den entscheidenden Schritt in diese Richtung tat bereits die Skepsis mit der Epoché und dem Dualismus von Offenkundigkeit der Erscheinungsweisen und Verborgenheit des Seins. Eigentlich hat die philosophische Neuzeit nicht erst bei Descartes, sondern schon mit dem Hellenismus begonnen. Descartes hat in seinem Grundwerk, den Meditationen, unverkennbar an die skeptische Epoché angeknüpft. Er zeigt zunächst mit Argumenten, die aus der Skepsis stammen, dass es hinreichend gute Gründe gibt, sich jeder affirmativen Stellungnahme, jeder „Zustimmung“, assensio, zu enthalten: „assensionem cohibere“ 14 – das ist die lateinische Übersetzung von epéchein. Dann setzt er seine Argumentation folgendermaßen fort: Weil wir Menschen von der natürlichen Einstellung her die feste Gewohnheit haben, das Sein der Sachen zu bejahen, obwohl wir ihrer niemals gewiss sein können, gibt es nur einen Weg, uns die Enthaltung von jeder affirmativen Stellungnahme zur neuen Gewohnheit zu machen: Wir müssen annehmen, dass jede Affirmation von Sein ein Irrtum ist. 15 Diese Negation allen Seins dient aber nur dem Zweck, der Epoché zu ihrer konsequenten Durchführung zu verhelfen; sie ist ein Zweifel, der eine rein methodische Funktion hat. Auf der Grundlage dieses methodischen Zweifels ergibt sich dann die bekannte Einsicht, dass ich ein Sein nicht negieren kann: das Sein meiner selbst als des Subjekts meiner Vorstellungen, d.h. als Bewusstseins. Weil wir dieses Seins vollkommen gewiss sein können, kann Descartes auf dem fundamentum inconcussum dieser Gewissheit das Gebäude der Wissenschaft neu errichten. Husserl hat seine Phänomenologie mit einer Kritik an Descartes begründet: Der cartesianische Schritt von der Epoché zur Negation allen Seins war ein methodischer Fehler; denn diese Negation hatte die Aufgabe, die Enthaltung von allen Stellungnahmen zu unterstützen, aber eben das konnte sie nicht, weil sie selbst eine Behauptung und damit eine Stellungnahme war. Die Methode einer radikal um Wahrheit, um Überwindung des Meinungsstreits bemühten Philosophie kann nur die Epoché sein. So wird sie in der Phänomenologie erneut zur Grundlage der ganzen Philosophie wie schon einmal in der pyrrhonischen Skepsis. Weil Husserl historisch zu wenig von der Skepsis gekannt hat, hat er nicht gesehen, 14 Descartes, Meditationes de prima philosophia, I 2 und I 10. I 11. 15 Meditationes, Metodo. International Studies in Phenomenology and Philosophy Vol. 1, n. 2 (2013) Von Pyrrhon zu Husserl 241 dass seine Kritik an Descartes sich schon auf die pyrrhonische Skepsis beziehen lässt. Diese Skepsis hatte die Absicht, sich jeder Stellungnahme, jeder Behauptung zu enthalten, aber verborgenermaßen enthielt sie doch eine Behauptung; sie lautete: Zwischen den Erscheinungsweisen und dem Sein der Sachen klafft ein Abgrund. Die Skepsis stellt damit eine Behauptung über das Verhältnis von Sein und Erscheinen auf, obwohl die Epoché jede solche Behauptung verbietet. Die Phänomenologie, so wie sie von Husserl auf den Weg gebracht wurde, ist nichts anderes als die Methode einer uneingeschränkten Einhaltung der Epoché. So ist sie die Art von Skepsis, die mit sich selbst radikal ernst macht. 16 Husserls These ist, dass die Skepsis sich eben dadurch selbst überwindet. Er löst damit auf seine Weise Hegels These aus der Phänomenologie des Geistes ein, dass eine ins Äußerste getriebene Skepsis sich selbst aufhebt. 17 Hegel war der moderne Denker, der auf diese Weise für die Philosophie einen Weg in die Zukunft bahnen wollte. Der erste Weg der Philosophie war das frühe und klassische griechische Denken auf der Grundlage der parmenideischen Zusammengehörigkeit von Sein und Wahrheit und dessen erwähntes Nachspiel in der Scholastik des Mittelalters. Der zweite Weg war der des neuzeitlichen Subjektivismus, der mit der Erhebung des Bewusstseins zum subiectum bei Descartes begann. Die Phänomenologie des 20. Jahrhunderts ist der Versuch, einen dritten Weg zu konkretisieren, den von Hegel schon projektierten Weg der Philosophie in die Zukunft. Dieser Weg beginnt mit der Selbstüberwindung der pyrrhonischen Skepsis, die schon im Zeitalter des Hellenismus die Entwicklung zum neuzeitlichen Subjektivismus ermöglicht hatte. Die Phänomenologie vollbringt diese Selbstüberwindung der Skepsis, indem sie konsequent auf jede Stellungnahme zum Verhältnis von Erscheinen und Sein verzichtet; denn dieser Verzicht bedeutet, dass sie es im Unterschied zur Skepsis unterlässt, das Offenkundige – die Erscheinungsweisen – und das Sein auseinanderzureißen. Aber man würde dies missverstehen, wenn man meinte, die Phänomenologie kehre damit einfach zum vorhellenistischen Denken zurück, also zur parmenideischen Gleichsetzung von Sein und bemerkendem Vernehmen; denn auch diese Gleichsetzung ist eine Stellungnahme zum Verhältnis von Sein und Erscheinen. Die Phänomenologie gewinnt dadurch ihren Ort in der Philosophiegeschichte, dass sie sich an die Wasserscheide zwischen den Wegen des vorhellenistischen und des hellenistischem Denkens zurückbegibt und ausdrücklich die Epoché hinsichtlich der Denkentscheidung vollzieht, durch die sich diese beiden Wege gegabelt haben; die Phänomenologie nimmt nicht dazu Stellung, ob es sich bei dem Verhältnis zwischen Sein und Erscheinen um die parmenideische Zusammengehörigkeit oder um den skeptischen Abgrund handelt. Aus der uneingeschränkt radikal gewordenen Epoché ergibt sich von selbst die Aufgabe für eine künftige Philosophie auf phänomenologischer Grundlage. Die Philosophie beruht seit Heraklit auf der Überwindung der natürlichen Einstellung. Zu dieser Einstellung gehört die Überzeugung, dass alle Erscheinungsweisen den Sinn haben, Erscheinen-von-etwas, Erscheinen des Seins einer Sache zu sein. So setzt diese Überzeugung eine Struktur des Erscheinens voraus, die man in die Formel kleiden kann: „Erscheinen von Sachen in Erscheinungsweisen“. Diese Struktur ist der Sachverhalt, auf den sich die Forschungen der Philosophie beziehen müssen, wenn es ihr um die Überwindung des Meinungsstreits geht. Aber der Phänomenologe tritt in diese Forschungen ein, ohne eine Vorentscheidung darüber zu fällen, in welchem Verhältnis die Erscheinungsweisen zu den Sachen stehen; denn mit einer solchen Vorentscheidung würde er zu der Überzeugung der natürlichen Einstellung Stellung 16 In diesem Sinne wurde Husserls Phänomenologie schon interpretiert von Aguirre 1970. diesem Sinne spricht Hegel in der Einleitung der Phänomenologie des Geistes von „sich vollbringenden Skeptizismus“, Hegel 1952 67. Zur Skepsis in Hegels Phänomenologie vgl. Claesges 1996. 17 In Metodo. International Studies in Phenomenology and Philosophy Vol. 1, n. 2 (2013) 242 Klaus Held nehmen. Das verbietet ihm die konsequente Einhaltung der Epoché. Aber sie lässt ihm die Möglichkeit, bei seinen Analysen und Überlegungen von der genannten Struktur des Erscheinens auszugehen. Der Phänomenologe nimmt gegenüber dem Erscheinen von Sachen in Erscheinungsweisen die Haltung eines neutralen Beobachters ein und fragt: Wie kommen die Menschen in der natürlichen Einstellung dazu, bestimmte Erscheinungsweisen auf bestimmte Sachen zurückzubeziehen, von denen sie mit Selbstverständlichkeit annehmen, dass sie sich in diesen Erscheinungsweisen zeigen? Diese Frage ist leicht mit der Frage der klassischen neuzeitlichen Erkenntnistheorie zu verwechseln, wie das menschliche Subjekt, das Bewusstsein, aus der Immanenz seiner Vorstellungen zu den „transzendenten“ Gegenständen in der „Außenwelt“ hinausgelangt. Aber diese Frage setzt noch den Subjekt-Objekt-Dualismus voraus, der durch die konsequent eingehaltene Epoché schon überwunden ist. 18 Der Phänomenologe fragt, wie es zugeht, wenn die Menschen die für sie offenkundigen Erscheinungsweisen als ein Erscheinen von Sachen auffassen. Die Phänomenologie ist die konkrete Analyse dieses „von“. Das Erscheinen ist konkret betrachtet ein Sich-Zeigen bestimmter Sachen in den ihnen entsprechenden Erscheinungsweisen. Es gibt kein allgemeines Erscheinen, bei dem die Erscheinungsweisen austauschbar wären, sondern jede Sache kann nur in bestimmten, für sie charakteristischen Erscheinungsweisen offenbar werden. Die Forschungsarbeit der Phänomenologie besteht in einer Beschreibung der Korrelationsverhältnisse zwischen den Sachen und ihren Erscheinungsweisen, 19 die es sich radikal versagt, zu dem Sein Stellung zu nehmen, das die natürliche Einstellung den erscheinenden Sachen zuschreibt. Von welcher Art die Erscheinungsweisen einer Sache sind, entscheidet sich von den vielen Welten der Menschen, den Horizonten, her. Sie bilden jeweils die Spielräume für bestimmte Erscheinungsweisen und für das Sein der darin sich zeigenden Sachen. Demgemäß muss die phänomenologische Forschung sich vor allem auf die Analyse der Horizonte konzentrieren und konkret die Frage beantworten, welche Erscheinungsweisen sich durch welche Horizonte eröffnen. Die vorliegenden Überlegungen hatten mit der Beobachtung begonnen, dass die divergierenden Meinungen im Meinungsstreit durch die unterschiedlichen Erscheinungsweisen und also durch die Horizonte bedingt sind. Weil es auch der Phänomenologie als einer philosophischen Methode um die Überwindung des Meinungsstreits, des Streits um die Wahrheit geht, liegt ihr eigentliches Problem im Verhältnis der vielen Welten zur einen Welt. Die eine Welt ist der Verweisungszusammenhang, der sich daraus ergibt, dass alle Verweisungszusammenhänge, alle Horizonte, über sich hinausverweisen. Als der eine Verweisungszusammenhang für alle Horizonte ist die Welt der eine allumfassende Horizont. In diesem Sinne hat Husserl die eine Welt als den Universalhorizont bestimmt. Das war nicht falsch, aber einseitig; denn die Welt als Universalhorizont verweist, weil sie allumfassend ist, nicht mehr über sich hinaus; zu einem Horizont gehört aber wesentlich, dass er über sich hinaus verweist. Das bedeutet, dass die eine Welt in gewisser Weise kein Horizont sein kann. Die Horizonte sind als die Spielräume der Erscheinungsweisen die Bereiche des für uns Offenkundigen, griechisch gesprochen: des dêlon. Sofern die eine Welt kein Horizont ist, ist sie kein Bereich der Offenkun18 Vgl. hierzu Held 1980b. einer bekannten Anmerkung seines letzten Werks Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie hat Husserl bekannt, sein „ganzes Lebenswerk“ sei von der „Aufgabe einer systematischen Ausarbeitung dieses Korrelationsapriori beherrscht“ gewesen. Vgl. Husserl 1954, 169 Hua VI. 19 In Metodo. International Studies in Phenomenology and Philosophy Vol. 1, n. 2 (2013) Von Pyrrhon zu Husserl 243 digkeit. In dieser Hinsicht ist sie ein ádelon, ein Bereich der Verborgenheit. Die Welt hat gleichsam eine uns Menschen zugekehrte und eine von uns abgekehrte Seite: Uns zugewandt ist sie als Universalhorizont für alle Horizonte, als Dimension des Erscheinens; von uns abgewandt ist sie, sofern sie den Charakter der Verborgenheit hat. Sofern die Welt Universalhorizont ist, bleibt für die Phänomenologie die parmenideische Zusammengehörigkeit von Erscheinen und Sein bestehen; denn jeglichem Sein von Sachen korrelieren bestimmte horizontbedingte Erscheinungsweisen, und alle Horizonte gehören im Universalhorizont „Welt“ zusammen. Aber wegen der radikalen Epoché bezüglich des Verhältnisses von Sein und Erscheinen steht die Phänomenologie Parmenides neutral gegenüber. Für ihn wird das Sein im noeîn offenbar. Demgegenüber muss die Phänomenologie die Möglichkeit offenhalten, dass es eine Verborgenheit des Seins gibt, wie das die Skepsis behauptet hatte. Diese Verborgenheit kann freilich für die Phänomenologie nicht mehr die einer cartesianischen bewusstseinstranszendenten „Außenwelt“ sein. Es muss sich um die Verborgenheit der Welt als Kehrseite des Universalhorizonts handeln. Aber ist es überhaupt möglich, über eine solche Kehrseite zu sprechen, wenn sie den Charakter der Verborgenheit hat? Der Weg zur Beantwortung dieser Frage ergibt sich aus der radikalen Einhaltung der Epoché. Die Epoché ist diejenige Willensentscheidung, mit der wir uns jeder Stellungnahme zum Verhältnis vom Sein und Erscheinen enthalten. Aber dieses Verhältnis konnte nur dadurch zum Gegenstand einer Stellungnahme werden, dass die Epoché der pyrrhonischen Skepsis über die aristotelische Interpretation von Affirmation und Negation hinausging und dem Willen eine wesentliche Rolle bei den Behauptungen zubilligte. Diese skeptische Epoché wiederum erweist sich in der Augen der Phänomenologie als nicht radikal genug. Das lässt darauf schließen, dass eine mit voller Konsequenz eingehaltene Epoché dazu gelangen muss, die Bedeutung des Willens wieder einzuschränken. Für die subjektivistische Macht des Willens muss es eine Grenze geben. Diese Grenze könnte die Verborgenheit der Kehrseite der Welt sein. Martin Heidegger ist der Denker, mit dem Phänomenologie begonnen hat, hierüber nachzudenken. 20 Aber das wäre ein Thema neuer Überlegungen. Literatur Aguirre, A. 1970, Genetische Phänomenologie und Reduktion. Zur Letztbegründung der Wissenschaft aus der radikalen Skepsis im Denken E. Husserls, Martinus Nijhoff, Den Haag. Aristoteles 1957, „Metaphysica“, in Aristotelis Metaphysica, hrsg. von W. Jaeger, Oxford Classical Texts, Oxford. Claesges, U. 1996, „Das Doppelgesicht des Skeptizismus in Hegels Phänomenologie des Geistes“, in Skeptizismus und spekulatives Denken in der Philosophie Hegels, hrsg. von H. Fulda und R. P. Horstmann, Klett-Cotta, Stuttgart, S. 117–134. Descartes, R. 1959, Meditationes de prima philosophia, Meiner, Hamburg. Diels, H. und W. Kranz 1964, Fragmente der Vorsokratiker, Weidmann, Zürich-Berlin. Hegel, G. 1952, Phänomenologie des Geistes, hrsg. von J. Hoffmeister, Meiner, Hamburg. 20 Vgl. hierzu Held 1992 und Held 1999. Metodo. International Studies in Phenomenology and Philosophy Vol. 1, n. 2 (2013) 244 Klaus Held Held, K. 1980a, Heraklit, Parmenides und der Anfang von Philosophie und Wissenschaft. Eine phänomenologische Besinnung, De Gruyter, Berlin. — 1980b, „Husserls Rückgang auf das phainómenon und die geschichtliche Stellung der Phänomenologie“, in Phänomenologische Forschungen, 10, S. 89–145. — 1992, „Die Endlichkeit der Welt. Phänomenologie im Übergang von Husserl zu Heidegger“, in Philosophie der Endlichkeit, hrsg. von B. Niemeyer und D. Schütze, Königshausen & Neumann, Würzburg, S. 130–147. — 1999, „Heideggers Weg zu den «Sachen selbst»“, in Vom Rätsel des Begriffs. Festschrift für Friedrich-Wilhelm von Herrmann zum 65. Geburtstag, hrsg. von P.-L. Coriando, Duncker & Humblot, Berlin. — 2000, “The Controversy Concerning Truth: Towards a Prehistory of Phenomenology”, in Husserl Studies, 17/1, pp. 35–48. — 2010, Phänomenologie der politischen Welt, Peter Lang, Frankfurt a.M. Husserl, E. 1954, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie, hrsg. von W. Biemel, Martinus Nijhoff, Den Haag. Hua VI. — 1976, Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie, hrsg. von K. Schuhmann, Martinus Nijhoff, Den Haag, Bd. Erstes Buch: Allgemeine Einführung in die reine Phänomenologie. 1. Halbband. Hua III/1. Plato 1961, „Philebos“, in Platonis Opera, hrsg. von J. Burnet, Oxford Classical Texts, Oxford. Sextus Empiricus 1967, Outlines of Pyrrhonism, Heinemann, London, Cambridge Mass. Metodo. International Studies in Phenomenology and Philosophy Vol. 1, n. 2 (2013)