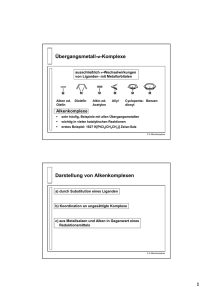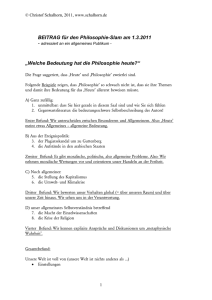Identität und Authentizität Personenkult
Werbung

Ausgabe 04 | 07/2014 1,00 € Identität und Authentizität Was heißt es, man selbst zu sein? Wie ist es möglich, dass man über die Zeit hinweg dieselbe Person bleibt? Ist es immer gut, sich treu zu bleiben? Personenkult Im Gespräch mit Barbara Vinken über Mode und Moderne Parteinahme War Heidegger Nationalsozialist? SPRACH- UND FORSCHUNGSDIENSTE STUDIERENDEN- UND BEWERBUNGSCOACHING Wir bieten Unternehmen, Organisationen, Forschungs- und Bildungseinrichtungen sowie Studierenden und Privatpersonen ein großes Spektrum an Dienstleistungen rund um Sprache und Wissenschaft. LOGOS steht für gewissenhafte Arbeit mit Liebe zur Präzision. • Lektorat • Korrektorat • Formatierungen • Exzerpte • Experteninterviews • Transkription • Interviewauswertung • Projektanträge • Recherchen • Studierendencoaching • Schreibcoaching • Prüfungsvorbereitung • Bewerbungscoaching • Kompetenzprofile Korrektorat/Lektorat Im Korrektorat prüfen und verbessern wir Ihren Text (z.B. Bachelor-/Masterarbeit, Dissertation) hinsichtlich Rechtschreibung, Grammatik, Interpunktion und Syntax. Das Lektorat schließt das Korrektorat ein und umfasst zudem die Prüfung und Verbesserung von Lesbarkeit, Stil, Aufbau, Form und Grafikeinsatz. Exzerpte Wir lesen die Bücher, zu deren Lektüre Ihnen die Zeit fehlt, und schreiben auf wenigen Seiten die wichtigsten Stellen und Gedanken heraus – präzise, strukturiert, formal korrekt. Formatierungen Wir formatieren Dissertationen nach Verlagsvorgaben und bringen Abschlussarbeiten (z.B. Bachelor/Master) in eine ansprechende und den jeweiligen Leitlinien gemäße Form. Experteninterviews Im Rahmen qualitativer Sozialforschung übernehmen wir die professionelle Durchführung, Transkription und Auswertung von Experteninterviews (für Studierende nur Transkription). Studierendencoaching Schreibcoaching – Prüfungsvorbereitung – Fachcoaching (nur in Geistes- und Sozialwissenschaften; Schwerpunkt: Philosophie). Bewerbungscoaching Optimieren von Bewerbungsunterlagen und Anschreiben – Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche – Erstellen individueller Kompetenzprofile. 2 cog!to 07/2014 Dr. Frank Schulze Lektorat LOGOS ist ein Angebot von Dr. Frank Schulze. Frank Schulze hat Philosophie, Germanistik, Politologie und Erwachsenenpädagogik studiert, verfügt über langjährige Berufserfahrung als Redakteur und Korrektor in einem Fachverlag und bei einer philosophischen Fachzeitschrift sowie als Bildungsforscher und Öffentlichkeitsarbeiter in einem Bildungsforschungsinstitut. Er ist Lehrbeauftragter für Wissenschaftstheorie und Politische Erwachsenenbildung an der Otto-FriedrichUniversität Bamberg und 2. Vorsitzender zweier philosophischer Gesellschaften. Wichtige Erfahrungen konnte Frank Schulze auch in der Hochschul-Öffentlichkeitsarbeit und im Radiojournalismus sammeln. Referenzen BW Bildung und Wissen Verlag und Software GmbH Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb) Gesellschaft für kritische Philosophie (Zeitschrift Aufklärung und Kritik) Ludwig-Feuerbach-Gesellschaft Music 2b Musikmanagement Otto-Friedrich-Universität Bamberg • • • • • • »Meine Erwartung in Ihre Arbeit wurde übererfüllt. Wir werden Sie empfehlen!« (Dirk Flesch) »Ein echtes Adlerauge! Wenn man denkt, der Text wäre perfekt, findet Frank Schulze immer noch Fehler und Verbesserungsmöglichkeiten.« (Helmut Walther) »Der Unterschied zwischen dem richtigen Wort und dem beinahe richtigen ist derselbe wie zwischen dem Blitz und einem Glühwürmchen.« (Mark Twain) Lektorat LOGOS Dr. Frank Schulze Postfach 100108 91191 Lauf a.d. Pegnitz Tel.: 0172 8413977 [email protected] www.lektorat-logos.de Editorial Liebe Leserinnen, liebe Leser, mal wieder ist bei cog!to alles ganz anders. Im Unterschied zu früheren Ausgaben haben wir versucht, die vierte Nummer von cog!to thematisch kohärenter zu gestalten und unter ein Schwerpunktthema zu stellen, dass sich wie ein roter Faden durch das Heft zieht: „Wer bin ich, und was heißt es, diese Person zu sein?“ Auf den folgenden Seiten findet ihr entsprechend Artikel, die sich umfassend mit dem Selbstverhältnis beschäftigen - was es heißt, mit sich selbst identisch zu sein, ob es immer gut ist, sich treu zu bleiben oder ob ich sein kann, wer ich will. Das sind Fragen, die, wie wir glauben, nicht nur für Studierende und nicht für Studierende der Philosophie von Interesse sind. Nicht erst mit dieser Ausgabe wollen wir uns auch an die allgemeine Öffentlichkeit und Studierende anderer Fakultäten wenden - und servieren dazu, wie immer, einen Mix leicht verdaulicher Kost und schwerer Brocken, holen hier schwierige Gedanken aus den Nischen der Philosophiegeschichte hervor und widmen uns dort den alltäglichsten Themen der Welt. Einem Interview mit Barbara Vinken über Mode folgt ein Schulenstreit zur Frage, ob man sein kann, wer man will; neben Reflexionen über Brieffreundschaft findet ihr eine Darstellung Charles Taylors Gedanken über Authentizität; ein Schwerpunkt zu Identität und Authentizität wird begleitet von Artikeln im Ideenkreis, die sich mit Liberalismus und Toleranz, Lockes Personenkonzept und der Gestaltbarkeit des Selbst beschäftigen. Die Allgegenwart von Rollen, Theater und Inszenierung beleuchtet Stefan Joller in einem Portrait Erving Goffmans, während in Parteinahme ein Interview mit dem neuen Dekan der Fakultät für Philosophie zu finden ist. Im Innenteil dieser Ausgabe findet ihr das erste mal Anzeigen, und wir verkaufen das Heft ab jetzt je Ausgabe für eine Schutzgebühr von 1,00 €. cog!to will und muss sich zunehmend selbstständig finanzieren und hat den Sprung in die Eigenständigkeit fast geschafft. Für die Organisation der Finanzierung sei Mathias Koch gedankt, der mit Miguel viele Stunden in Telefonwarteschleifen verbrachte (die bei Verlagen meist mit klassischer Musik, bei Fernbusunternehmen mit Popsongs bespielt werden, wie wir feststellten). Wir hoffen, dass euch auch die vierte Ausgabe von cog!to gefällt. Besonders würden wir uns darüber freuen, falls einer oder eine von euch Interesse daran hat mitzuarbeiten oder einfach mal unverbindlich in der Redaktion vorbeizuschauen. Eine kurze Mail an [email protected] genügt. Selbstverständlich freuen wir uns auch über Leserbriefe. Nun aber: Viel Spaß beim Lesen! Für die cog!to-Redaktion Lukas Leucht und Miguel de la Riva Impressum cog!to. Die unabhängige Zeitschrift der Studierendenschaft Philosophie Geschwister-Scholl-Platz 1, 80539 München [email protected] Gastautoren Gregor Bös, Christine Bratu, Volker Gerhardt, Stefan Joller, Erasmus Mayr, Ulrich Metschl, Jörg Noller, Michael Schultheis, Stephan Sellmaier, Oki Utamura, Niko Wolf V. i. S. d. P. Lukas Leucht Herausgeber Fachschaft Philosophie e. V. Cover Kupferstich aus Louis de la Forge (Hrsg.), L‘Homme de René Descartes et la Formation du Foetus. Le Monde ou Traité de la Lumiere. Seconde Edition, reveue & corigée. Paris, T. Girard, 1677, S. 72. Bearbeitet von Gregor Bös Chefredaktion Lukas Leucht, Miguel de la Riva Fotos und Bildbearbeitung Mathias Koch, Gregör Bös, Janina Reichmann Redaktion Fabian Heinrich, Daniel Hoyer, Mathias Koch, Sandra Müller, Miguel de la Riva, Nejma Tamoudi, Antonia Zettl Illustration Nina Gottschling Corporate Identity u. Illustrationen Rubrikseiten © ben kollektiv (www.benkollektiv.de) Layout Miguel de la Riva Artikel und Anzeigen geben die Meinung der Verfasser bzw. der Anzeigenkunden und nicht der Redaktion wieder. Die Redaktion behält sich das Recht vor, Änderungen und Kürzungen an eingereichten Artikeln vorzunehmen. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung eingereichter Texte. cog!to 07/2014 3 INHALT Wortspielplatz S . 05 Die Herrschaft des Selbst Identität und Authentizität S. 10 Warum bin ich heute derselbe wie gestern? S. 16 Echt? Gut? S. 20 Identität, Authentizität unter dem Anspruch der Wahrheit Personenkult S. 24 Schweigen über Rusty S. 26 „Das autonome Subjekt ist ein Fake!“ S. 32 Weshalb du mir nicht sagen kannst, wer du wirklich bist Schulenstreit S. 36 Von Zwiespalt, Lebenslügen und Bedauern S. 40 Selbstbestimmung und doxastischer Voluntarismus Schnittmengen- S. 46 „Es war einmal, vor einer langen Zeit...“ theorie 4 cog!to 07/2014 Ideenkreis S. 50 Die Schuld ist niemals zweifellos S. 53 Liberalismus und Toleranz S. 56 Zwischen Determination und selbstgewählten Möglichkeiten Parteinahme S. 62 War Heidegger Nationalsozialist? S. 66 Äpfel versus Birnen S. 70 Auf einen Kaffee mit dem neuen Dekan Blütenlese S. 74 Authentizität bei Charles Taylor S. 78 Zur Aktualität der Brieffreundschaft RUBRIK WORTSpielplatz Rubrikseite Wortspielplatz In Wortspielplatz findet ihr Ausgabe für Ausgabe eine Kolumne, die das gesprochene oder geschriebene Wort und seine Verwendung in den Mittelpunkt stellt. Dieses Mal setzt sich Miguel de la Riva weniger mit den semantischen Nuancen einer konkreten Vokabel auseinander, sondern fragt nach Bedeutungsebenen eines bestimmten Konzepts: „Die eigene Person sein“ cog!to 07/2014 5 Die Herrschaft des Selbst Arten und Weisen, die eigene Person zu sein Von Miguel de la Riva Was bedeutet es, die eigene Person zu sein? Der Artikel stellt drei idealtypische Verständnisse davon vor, was es heißt, die zu werden, die wir sind. Was heißt es, die eigene Person zu sein? Die Frage, die auch als Überschrift dieser Ausgabe von cog!to herhalten könnte, lässt vielfältige Interpretationen zu – und diese Vielfalt hat die Redaktion im Heft auch einzufangen versucht. Zunächst kann mit ihr die Frage aufgeworfen werden, was es heißt, Inhaber einer unverwechselbaren Identität zu sein – mit sich und nur mit sich identisch zu sein und über die Zeit zu bleiben.1 Sodann kann die Frage auf Handlungsurheberschaft abzielen: Was heißt es und wie ist es möglich, dass ich als Urheber meines Handelns, ja als Autor meines Lebens erscheine?2 Nicht zuletzt kann auch danach gefragt sein, was es heißt, authentisch zu sein bzw. sich selbst „treu zu sein“, und ob das immer gut ist.3 Das alles sind wichtige Fragen – die ich hier aber geflissentlich übergehe. Was es heißt, die eigene Person zu sein – diese Frage will ich in die Nähe von Begriffen wie „Selbstbestimmung“, „Souveränität“ oder „Autonomie“ rücken. In einem umfassenderen Sinne will ich danach fragen, was es heißt, die je eigene Subjektivität konsistent ausüben zu können: Was heißt es, sich mit der eigenen Person in seinem Handeln und in der Welt anwesend zu wissen? Damit setze ich schon voraus, dass sich Personen mit sich selbst identisch wissen; ebenso, dass ihnen ihr Handeln zurechenbar ist und sie sich als deren Urheber begreifen. Oft aber passiert es uns, dass wir handeln und uns als Akteure dieses Handelns begreifen – indes doch wenigstens ein Moment des Befremdens spüren über das, was wir da tun. Während in solchen Fällen klar bleibt, dass ich der Akteur dieser Tätigkeit bin, mag mir mein Tun doch als ein fremdes gegenübertreten, sich nicht als „meines“ anfühlen. Es gibt Fälle, scheint mir, in denen autonomes Handeln in kaum mehr als nur 1 Dieser Frage diskutieren Jörg Noller und Mathias Koch. 2 Um diese Frage geht es im Schulenstreit; auch Volker Gerhardt und Sandra Müller streifen sie. 3 Dieser Frage widmet sich Christine Bratu und, in Bezug auf Charles Taylor, Nejma Tamoudi.. 6 cog!to 07/2014 kausalem Sinne als „mein“ oder als „eigenes“ Handeln zu verstehen ist. Das Phänomen, das ich meine, lässt sich an Beispielen nur widerwillig erledigter Aufgaben buchstabieren, von denen das folgende wohl nicht das originellste und wahrscheinlich auch nicht das beste ist: Während es klar ist, dass es der Staubsaugervertreter ist, der Staubsauger feilbietet, ist nicht so klar, ob er sich in einem emphatischen Sinne als Autor dieser Handlungen versteht, sich in ihnen anwesend weiß; insbesondere dann nicht, wenn wir ihn uns als gescheiterte Existenz vorstellen, der einmal mit großer Freude und ausreichend Begabung etwas wie Philosophie studierte, um später festzustellen, dass man damit in einer „wissensbasierten Dienstleistungsgesellschaft“ vielleicht nicht ganz so weit kommt. Obwohl er mit voller Sicherheit weiß, dass er es ist, der an Türen klingelt und Waren preist, mag er ohne jeden Widerspruch sagen, dass er dazu keinen inneren Bezug hat und es nicht recht als sein Handeln begreift, dass es nicht seine Handschrift trage. Er erfährt sich dann nur als Trägerobjekt, nicht als Subjekt seines Handelns. Es tritt ihm als etwas fremdes gegenüber, obwohl er dessen Urheber und Akteur ist. Wo er sich selbst als Mittel, nicht als Zweck seines Lebens begreift, mag er tief seufzen und sagen: „Ich bin nicht der, der ich bin, nur ein Schatten meiner selbst.“ Was aber heißt es, die zu sein, die wir sind? Wie wäre ein Zustand beschaffen, in dem ich jede meiner Handlungen als meine eigene verstehen müsste? Hinsichtlich der so gestellten Frage scheinen eine persistente Identität, die Zurechenbarkeit von Handlungen und das treue Festhalten am eigenen Charakter nur Bestandsmomente des Vollzugs der eigenen Subjektivität zu sein, nicht auch Charakteristika seines Gelingens. Was es bedeutet, die zu sein, die wir sind – selbst wenn wir die drei eingangs genannten Fragen beantwortet hätten, würde das noch Rätsel aufgeben. Das Selbstverhältnis, um das es mir geht, will ich im Folgenden durch drei verschiedene Lesarten näher profilieren, die sich als einigermaßen stilisierte Idealtypen verstehe. In ihnen, wird sich zeigen, sind Selbst- und Weltverhältnisse unauflöslich ineinander verflochten. Selbstverhältnisse, will ich so plausibilieren, sind die Rückseite umfassenderer Weltentwürfe und des Platzes, den Personen in ihr einnehmen. Aus Platz- und Zeitgründen bleibt das Argument an der Oberfläche. 1. „Werde, der du bist!“ In der Antike finden sich Personen als Teile eines kosmischen, geordneten Ganzen der Wirklichkeit vor; sie sind in sehr buchstäblichem Sinne „Bürger der Welt.“ Quelle von Identität scheint hier die relative Positionierung in diesem Weltganzen zu sein. Weitgehend wird nicht unterschieden zwischen einem je eigenen persönlichen und einem menschlichen Selbst. Was wir sind, das ist vor allen Dingen durch unsere Natur und durch ihren relativen Platz im kosmischen Ganzen gefügt. Epiktet drückt es in seinen Unterredungen (2.10) so aus: „Consider who you are. First of all, a human being, that is to say, one who has no faculty more authoritative than choice, but subordinates everything else to that, keeping choice itself free from enslavement and subjection. Consider, then, what you‘re distinguished from through the possession of reason: you‘re distinguished from wild beasts; you‘re distinguished from sheep. What is more, you‘re a citizen of the world and a part of it“ Die Idee vieler antiker Ethiken geht dahin, dass „die zu werden, die wir sind“ bedeutet, dieser menschlichen Natur inne zu werden und sie zur Exzellenz oder Bestform zu entwickeln und ein Zustand, in dem das erreicht ist, wird in ihnen „Glückseligkeit“ genannt. Das bedeutet aber des Näheren: der Natur inne zu werden, die uns als Menschen kennzeichnet und von anderen Lebewesen unterscheidet. Es geht um die distinktiven Aspekte des menschlichen Wesens wie etwa „choice“ oder „reason“, die Epiktet ausführlich als unterscheidende Merkmale hervorhebt. Unser Wesen nun aber ist – wie man mit Bedauern oder auch Freude feststellen mag – nicht nur aus „choice“ und „reason“ gewebt. Die zu werden, die wir sind, ist kein leichtes Unterfangen. Um die eigenen Anlagen zur Exzellenz zu bringen sind fortlaufend Beschränkungen zu überwinden, die uns der Teil unserer Natur auferlegt, der uns mit den anderen Lebewesen gemein ist. Um seine Potentiale zur Bestform zu bringen, bedarf das Wesen, das teils Tier, teils Gott ist, darum „Selbstherrschaft.“ Es ist fortlaufend mit der Überwindung seiner Natur beschäftigt, um umso mehr seine eigentliche Natur zur Perfektion zu bringen. Insoweit finden wir in antiken Ethiken elaborierte Konzepte zum Umgang mit der eigenen Person. In ihnen wird Selbstherrschaft meist als Mäßigung oder Enthaltsamkeit buchstabiert. In der hellenistischen Ratgeberliteratur hat sich das schon in Übungen, die zur Glückseligkeit führten, verfestigt – bei Platon kreisen sie noch um Tugenden wie Besonnenheit oder Gerechtigkeit. In Analogie zur Unterteilung dreier verschiedener Stände im Staat unterscheidet er drei verschiedene Teile der Seele: einen denkenden, einen begehrenden und einen, der auf Ehre und Siegen aus ist. „Gerechtigkeit“ nun besteht in der richtigen Ordnung dieser Teile zueinander, was im Falle von Personen meint, dass der rationale auch der lenkende Seelenteil ist und die anderen ihm gehorchen. Platon schreibt entsprechend in der Politeia (580c): „der Trefflichste und Gerechteste sei auch der Glückseligste, dies sei aber der am meisten königlich Gesinnte und sich selbst königlich Beherrschende; der Schlechteste aber und Ungerechteste sei auch der Unseligste, und dies sei der am meisten tyrannisch Gesinnte und auch sich selbst sowie den Staat so tyrannisch wie möglich Beherrschende.“ 2. „Werde, der du sein sollst!“ Im Rahmen eines zweiten Verständnisses von „die sein, die wir sind“, wird Identität nicht aus der relativen Position in einem geordneten Weltganzen geschöpft, sondern aus der Gesellschaft. Was das für das Selbstsein bedeuten mag, davon kündet die uralte Anekdote, die Livius in seiner Römischen Geschichte erzählt (II, 32, 5ff.). Es herrscht Zwietracht zwischen geflüchteten Patriziern und in der Stadt verbliebenen Plebejern; um Harmonie wiederherzustellen, wird Menenius Agrippa zu den Plebejern geschickt, denen er folgende Geschichte erzählt: „Zu der Zeit, als im Menschen nicht wie jetzt alles im Einklang miteinander war, sondern von den einzelnen Gliedern jedes für sich überlegte und für sich redete, hätten sich die übrigen Körperteile darüber geärgert, daß durch ihre Fürsorge, durch ihre Mühe und Dienstleistung alles für den Bauch getan werde, daß der Bauch aber in der Mitte ruhig bleibe und nichts anderes tue, als sich der dargebotenen Genüsse zu erfreuen. Sie hätten sich daher verschworen, die Hände sollten keine Speise mehr zum Munde führen, der Mund solle, was ihm dargeboten werde, nicht mehr aufnehmen und die Zähne sollten nicht mehr kauen. Indem sie in diesem Zorn den Bauch durch Hunger zähmen wollten, habe zugleich die Glieder selbst und den ganzen Körper schlimmste Entkräftung befallen. Da sei dann klar geworden, daß auch der Bauch eifrig seinen Dienst tue und daß er nicht mehr ernährt werde als daß er ernähre, indem er das Blut, von dem wir leben und stark sind, gleichmäßig auf die Adern verteilt, in alle Teile des Körpers zurückströmen lasse, nachdem es durch die Verdauung der Nahrung seine Kraft erhalten habe. Indem Agrippa dann einen Vergleich anstellte, wie ähnlich der innere Aufruhr des Körpers dem Zorn der Plebs gegen die Patrizier sei, habe er die Menschen umgestimmt.“ Hier wird Gesellschaft als organisches Ganzes begriffen. Wer jemand ist, hängt von der relativen Positionierung in diesem Ganzen ab: Man ist sein Stand. Personen sind die, die sie sind, wenn sie ihren Platz im sozialen Kosmos kennen und sich entsprechend verhalten, d.h. sich in den Dienst der sozialen Ordnung stellen. Agrippa versucht zu überzeugen, indem er Handeln (zumindest die der Plebejer), das sich nicht in den Dienst der Ord- cog!to 07/2014 7 nung stellt, delegitimiert; schließlich benötigten, so läuft das etwas fadenscheinige Argument, die Plebs die Patrizier, weil es ein wechselseitiges Abhängigkeitsverhältnis gebe. Bis in die Neuzeit freilich wird davon ausgegangen, dass die Ordnung der Gesellschaft eine Spielart der Ordnung der Welt ist; entsprechend kann die Forderung der zu werden, der man als Person im gesellschaftlichen Ganzen ist, als Verlängerung der Forderung vorgetragen werden, der zu werden, der man als Mensch im kosmischen Ganzen ist. In beiden Fällen hat man sich, um die eigene Person zu sein, in den Dienst einer Ordnung zu stellen, die das Individuum überschreitet. Das ändert sich erst mit einem Verständnis dafür, dass Gesellschaft keine naturgegebene, sondern eine menschengemachte, als solche veränderbare, jedenfalls der Legitimation bedürftige Ordnung ist. Exemplarisch kann das an der kontraktualistischen politischen Philosophie festgemacht werden: Das Soziale – zumindest in der legitimatorischen Fiktion – ist Verhandlungssache wechselseitig unabhängiger Individuen. Wenn Identität durch das Soziale umrissen wird, dieses aber eine kontingente Ordnung ist, dann treten an die Stelle des antiken Konzepts von Selbstherrschaft Selbstkonzepte, die der Reproduktion oder dem Bruch mit der herrschenden gesellschaftlichen Ordnung dienen – oder allererst eine vernunftgemäße Ordnung hervorbringen sollen. Das im 18. Jahrhundert einsetzende Nachdenken über Autonomie und Selbstgesetzgebung ist in letzter Konsequenz auch ein Nachdenken über vernunftgemäßes menschliches Zusammenleben. Man soll, lehrt Kant, nach derjenigen Maxime handeln, von der man wollen kann, dass sie allgemeines Gesetz werde. Autonomie – das meint hier die Immanenz des Sozialen im Subjekt; ihr Vollzug in rationalem Wollen ist auf eine Konsistenzforderung hin zu beschränken, die die Individuen vor wechselseitiger Fremdbestimmung bewahrt, eine angemessene Ordnung herbeiführt. Die eigene Person, „sein eigener Herr“ sein, das findet demnach nicht jenseits oder nur in Abgrenzung von der Gesellschaft statt, sondern in ihr. 3. „Werde, der du sein könntest!“ In der fortgeschrittenen Moderne nun erleben wir Identität zunehmend nicht mehr als durch eine kosmische oder soziale Ordnung vorgefügt, sondern als etwas allererst vom Subjekt hervorzubringendes. Was bedeutet es dafür, die eigene Person zu sein, wenn sie in derselben Bewegung erst hervorzubringen ist? In einer Studie über Depression in der modernen Gesellschaft schreibt Alain Ehrenberg (2008: 18f.): „Wir sind reine Individuen geworden, und zwar in dem Sinne, dass uns kein moralisches Gesetz und keine Tradition sagt, wer wir zu sein haben und wie wir uns 8 cog!to 07/2014 verhalten müssen. Die Dichotomie erlaubt – verboten, die das Individuum bis in die […] 1960er Jahre […] bestimmte, hat ihre Wirkung verloren. […] Das Recht, sich sein Leben zu wählen, und der Auftrag, man selbst zu werden, verorten das Individuum in einer ständigen Bewegung. […] Die Grenze zwischen dem Erlaubten und dem Verbotenen schwindet zugunsten der Spannung zwischen dem Möglichen und dem Unmöglichen. […] Parallel zur Relativierung des Verbotsbegriffs schwindet auch die Bedeutung der Disziplin in der Beziehung zwischen Individuum und Gesellschaft. Es geht nun weniger um Gehorsam als um Entscheidungen und persönliche Initiative. Die Person wird nicht länger durch eine äußere Ordnung [...] bewegt, sie muss sich auf ihre inneren Antriebe stützen […] Das ideale Individuum wird nicht mehr an seiner Gefügigkeit gemessen, sondern an seiner Initiative.“ Da wir nicht mehr in dem Normengeflecht lebten, das den sozialen Klassen und Geschlechtern gebietend und verbietend den Platz in der Gesellschaft weist, sind wir uns nurmehr dazu überlassen, die zu werden, die wir sein könnten. An die Stelle einer Spannung von erlaubtverboten tritt die von möglich-unmöglich: Statt durch Gefügigkeit zeichnet sich das ideale Individuum der Gegenwart durch Initiative aus. In der Folge kommt es zu einer unternehmerischen Betriebsamkeit, die auf ständige Selbstüberbietung aus ist. Sich als „Kunstwerk“ zu begreifen, dass man mit seiner Lebensführung selbst gestalten kann, wurde so zu einer ubiquitären Formel. Die Betriebsamkeit um das Selbst wird jedoch dann zu einer notwendigen Illusion, wenn sie den Abbau von Arbeitnehmerrechten und sozialer Sicherheit unsichtbar macht. Wir erleben ein ökonomisiertes Selbstverhältnis, dessen Rückseite eine mit aller Freiwilligkeit und Intrinsik der Welt bedachte Abschöpfung von Mehrwert ist. Erst im Windschatten dieses Selbstverhältnis, habe ich den Eindruck, wird es möglich, selbstbestimmt zu handeln, ohne dieses Handeln als sein eigenes zu begreifen; erst so schließt Autonomie nicht auch Authentizität mit ein. Ein angemessenes Verständnis davon, was es heißt, die eigene Person zu sein, wird Autonomie und Authentizität nicht als unverbundene Momente des Selbstsein begreifen dürfen. Von Miguel de la Riva Literatur Ehrenberg, Alain. 2008. Das erschöpfte Selbst. Depression und Gesellschaft in der Gegenwart. Frankfurt am Main: Suhrkamp. Epictetus. 2014. Disroucses, Fragments Handbook. Oxford: Oxford University Press. Platon. 2001. Der Staat. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Titus Livius. 1991. Römische Geschichte. Buch I-III. München, Zürich: Artemis & Winkler. RUBRIK Identität und Authentizität Das Thema der Leitrubrik in dieser Ausgabe ist Identität und Authentizität. Unsere Gastautoren Jörg Noller, Christine Bratu und Volker Gerhardt nähern sich der Frage, was es heißt, die eigene Person zu sein, indem sie Fragen stellen wie: Warum bin ich heute derselbe wie gestern? Ist es an sich wertvoll, sich treu zu bleiben? Und was genau heißt es, wenn wir über eine Person sagen, sie sei „integer“? cog!to 07/2014 9 Warum bin ich heute derselbe wie gestern? Probleme und Perspektiven personaler Identität Von Jörg Noller Wie kann es sein, dass ich mit mir selbst über die Zeit hinweg numerisch identisch bleibe, Zeit meines Lebens genau ein und dieselbe Person bin, obwohl sich mein Körper materiell zum großen Teil austauscht? Das ist Kern der Frage, was es heißt, eine Person zu sein und mit ihr über die Zeit identisch zu bleiben – praktische Relevanz erhält sie durch das Problem moralischer Zurechenbarkeit, denn Lob und Tadel setzen voraus, dass ich mit derjenigen Person identisch bin, die in der Vergangenheit gut oder böse handelte. Wie aber kann personale Identität ontologisch gedacht werden? Im Sinne einer geistigen oder materiellen Substanz, oder nur durch die Kontinuität des Bewusstseins? D ie Rede von „Personen“ und „Identitäten“ ist problematisch und vieldeutig: In der Psychologie sprechen wir von eindrucksvollen Charakteren – etwa „starken Persönlichkeiten“, die in ihrer „Identität“ gefestigt sind. In der Soziologie sprechen wir von Personen im Sinne von Rollenbildern, die wir in bestimmten Kontexten einnehmen. In der Rechtswissenschaft unterscheidet man zwischen natürlichen und juristischen Personen. Man hat es also mit vielfältigen und widersprüchlichen Bedeutungen von „Person“ zu tun, und auch ein Rekurs auf die Etymologie des Wortes schafft da keine Abhilfe. In der Antike bedeutet „persona“ im Lateinischen zunächst „Maske eines Schauspielers“. Später wurde darunter auch die „Rolle“ verstanden, die ein Mensch in der Gesellschaft spielt. Die heutige ontologische Bedeutung von „vernünftiges Individuum“ und „individuelle Persönlichkeit“ erhielt das Wort erst in der christlichen Spätantike und im Mittelalter. Allerdings war der Begriff der Person in dieser Tradition nicht allein für Menschen reserviert, sondern wurde gemäß der 10 cog!to 07/2014 Trinitätslehre auch auf Gott bezogen: „ein Wesen, drei Personen“ (Spaemann 1996: 30ff.). 1. Person als Substanz Die erste philosophische Definition der Person hat in der Spätantike Boethius gegeben. Personen beschreibt er als natürlich-individuelle Einzeldinge, die über Vernunft verfügen. Boethius definiert die Person als „[e]iner verständigen Natur unteilbare Substanz (naturae rationabilis individua substantia)“ (Boethius 1988: 75). Unter diesen Begriff fallen jedoch nicht nur Menschen, sondern auch Engel, nicht zuletzt auch Gott. Tiere dagegen seien zwar natürlich-individuelle Substanzen, jedoch keine Personen, da ihnen das Vermögen der Vernunft fehlt. Im Mittelalter wurde dieser Personbegriff durch Thomas von Aquin kritisiert. Als individuelle, vernünftige Substanzen verstanden würden Personen zu sehr als Dinge betrachtet. So bleibe ihr Spezifikum – das Vermögen der Selbstbestimmung – unberücksichtigt (Thomas 1939: 43). Worauf Thomas damit hinweist, ist genau genommen der Unterschied zwischen etwas sein und jemand sein. Eine Person nur als eine vernünftige Substanz zu definieren bedeutet, sie als ein Objekt unter vielen anderen zu verstehen. Stattdessen gilt es nach Thomas, die Person als ein freies und vernünftiges Subjekt zu fassen. Die Person genießt also als Substanz einen ontologischen Sonderstatus: Sie ist eine Form autonomer Existenz und fällt damit aus der dinghaften Ordnung der Substanzen heraus. 2. John Locke oder die Entsubstanzialisierung der Person Die Kritik an der Verdinglichung der Person hat der englische Philosoph John Locke weiter radikalisiert und durch seine Subjektivitätstheorie gewissermaßen auf die Spitze getrieben. An den Personenbegriff geht Locke pragmatisch heran. Von „Personen“ sprechen wir ihm zu folge nur, um die Verantwortung für Handlungen einzelnen Individuen zuschreiben zu können. Entscheidend für die Identität von Personen ist nach Locke allein die Kontinuität des Bewusstseins. Die Identität der Person ist dadurch ontologisch unabhängig von der Identität der Substanz – sie „erstreckt sich [...] nicht weiter als das Bewußtsein“ (Locke 1981: 425). Für Locke folgt daraus die wechselseitige ontologische Unabhängigkeit von Substanz, Lebewesen und Person: „‚[D]ieselbe Substanz sein‘, ‚derselbe Mensch sein‘ und ‚dieselbe Person sein‘ sind drei ganz verschiedene Dinge“ (ebd.: 416). Zur Veranschaulichung dieser These bemüht Locke ein Gedankenexperiment: „Nehmen wir an, die Seele eines Fürsten, die das Bewußtsein des vergangenen Lebens des Fürsten mit sich führt, träte in den Körper eines Schusters ein und beseelte ihn, sobald dessen eigene Seele ihn verlassen hätte. Jeder sieht ein, daß der Schuster dann dieselbe Person sein würde wie der Fürst und nur für dessen Taten verantwortlich. Aber wer würde sagen, es sei ein und derselbe Mensch?“ (ebd.: 426f.). Das Biologische, Natürliche und Körperliche rückt so bei der Bestimmung der Person fast vollständig in den Hintergrund. 3. David Hume oder die Entpersonalisierung der Person Ausgehend von Lockes bewusstseinstheoretischer Rekonstruktion personaler Identität hat David Hume die Loslösung der Person von Dingen, Substanzen und Körpern noch weiter vorangetrieben. Seine Theorie cog!to 07/2014 11 personaler Identität gewinnt ihr Profil vor allem in Abgrenzung von derjenigen Descartes’. Descartes hatte in seinen Meditationes die These vertreten, dass der Existenz des eigenen Ichs eine noch größere Gewissheit zukomme als den evidenten Sätzen der Mathematik und Geometrie. Er war daher von einer intelligiblen Substanz (res cogitans) als Grund personaler Identität ausgegangen (Descartes 2004: 76). Humes Zugang zum Problem personaler Identität beruht auf einem Reduktionismus. Gemäß der Humeschen empiristischen Bedeutungstheorie müssen sich alle unsere Vorstellungen – diejenige personaler Identität inbegriffen – auf unmittelbare, basale Eindrücke („perceptions“), zurückführen lassen. Ein Beispiel für eine Perzeption wäre ein völlig homogener rot-Eindruck. Perzeptionen sind die nicht weiter analysierbaren Elemente der Humeschen Ontologie: Sie sind Entitäten, die „alle voneinander verschieden, unterscheidbar und trennbar“ sind und „können für sich vorgestellt werden, also für sich existieren“ (Hume 1978: 326). Humes Provokation besteht philosophiegeschichtlich darin, dass ein geistiger Zustand – das Erfassen einer Perzeption und der bewusste Gehalt einer Perzeption – keines geistigen Trägers bedarf, womit er der cartesischen Theorie das fundamentum inconcussum – das vermeintlich „unerschütterliche Fundament“ des Selbstbewusstseins – unter den Füßen wegzieht. Die Person ist nach Hume daher in Wirklichkeit nichts als eine Menge von (inneren und äußeren) Perzeptionen zu einem bestimmten Zeitpunkt: Ein Bündel von visuellen, haptischen, olfaktorischen, akustischen, inneren Eindrücken. Diese Eindruckskonstellationen sind nun aber in ständigem Fluss begriffen. Perzeptionen verhalten sich wie wechselnd auftretende dramatis personae auf einer Bühne, wobei wir allerdings keinen Eindruck dieser Bühne selbst haben (ebd.: 327f.). Den Grund dafür, dass wir dennoch geneigt sind, eine personale Einheit unserer Perzeptionen anzunehmen, findet Hume in der psychologischen Verfasstheit der Einbildungskraft. Ihre Natur besteht darin, zwischen verschiedenen Perzeptionen spontan Verbindungen der Identität und Kausalität herzustellen und diese bloß subjektiv gültigen Prinzipien in die Perzeptionen als real existierend hineinzulegen. Die ursprünglich als selbstverständlich angenommene Einheit und Identität der Person sei deshalb in Wirklichkeit nur eine gefühlte und durch die Einbildungskraft fingierte – mit modernen Worten: eine Konstruktion (ebd.: 335). 4. „Personal identity is not what matters“. Derek Parfits „no-self-theory“ Lockes und Humes anti-substanzialistische Theorien personaler Identität haben in der gegenwärtigen Philosophie durch den englischen Philosophen Derek Parfit eine provokative Aktualisierung erfahren. Wie Locke 12 cog!to 07/2014 und Hume wendet auch er sich gegen eine starke ontologische Hintergrundannahme im Sinne einer denkenden Substanz – gegen ein, wie er es nennt, „deep further fact“ (Parfit 1984: 312). Parfit geht sogar soweit, die philosophische Bedeutung von personaler Identität überhaupt zu leugnen: „[P]ersonal identity is not what matters“ (ebd.: 215). Zur Veranschaulichung seiner These bedient er sich, wie dies bereits Locke getan hatte, des Gedankenexperiments einer Bewusstseinsübertragung, nun aber im Gewand moderner sciencefiction (ebd.: 200f.): Eine Person auf der Erde begibt sich in einen Scanner, der alle Daten von Gehirn und Körper erfasst und diese sofort zum Mars teleportiert, wo ein Empfängergerät mit diesen Daten eine exakte Replik erstellt. Mit dem Betätigen des Beamvorgangs wird die gescannte und weggebeamte Person auf der Erde vernichtet, so dass danach nur noch die Person auf dem Mars existiert. In diesem Fall existieren nun zwei Interpretationsmöglichkeiten hinsichtlich der Frage nach personaler Identität: (i) Solange sich die Person auf dem Mars an die Situation unmittelbar vor dem Beamen nahtlos erinnert, handelt es sich um numerische Identität. (ii) Die Person verliert ihre numerische Identität und eine neue Person entsteht auf dem Mars, die mit dieser nur qualitativ identisch ist. Parfit konstruiert einen zweiten Fall, in dem der Beamvorgang auf der Erde nicht perfekt gelingt. Es wird zwar eine fehlerfreie Replik auf dem Mars erstellt, jedoch die Person auf der Erde nicht wie geplant vernichtet, sondern so geschädigt, dass ihr nur noch wenige Tage zum Leben bleiben und damit die Existenz beider Personen für einige Zeit überlappt. Nun treten, so Parfits Gedankenexperiment, beide Personen per Funk in Kontakt. Die Person auf dem Mars, die noch über eine unbeeinträchtigte Lebenswartung verfügt, tröstet die geschädigte Person auf der Erde und verspricht ihr, nach ihrem Tod ihre Position mit allen verbundenen Verpflichtungen einzunehmen, also ihr Leben nahtlos fortzusetzen. Dies ist ohne Probleme denkbar, denn sie besitzt dieselben qualitativen Eigenschaften wie die gesunde Person vor dem Beamvorgang. Die Person auf der Erde mag zwar über ihren bevorstehenden Tod traurig sein, doch weiß sie, dass sie in gewisser Weise – ähnlich der Interpretation (ii) des normalen Beam-Beispiels – fortexistieren wird, da ihr personaler „Nachkomme“ mit ihr qualitativ identisch ist (ebd.: 215). Für Parfit ist personale Identität deshalb keine Frage des Alles oder Nichts – der strengen numerischen Identität – sondern lässt Zwischenstufen, wie im Falle der Überlappung bei einem fehlerhaften Beamvorgang zu. Damit erhält der Tod einer Person eine ganz neue Bedeutung: „Instead of saying, ‚I shall be dead‘, I should say, ‚There will be no future experiences that will be related, in certain ways, to these present experiences‘“ (ebd.: 281). Anders als für Hume, der an der Unmöglichkeit einer Verteidigung personaler Identität verzweifelt war, ist für Parfit ein solcher schwacher Identitätsbegriff gerade begrüßenswert: „Is the truth depressing? Some Es gilt eine Theorie personaler Identität zu entwickeln, die den Einseitigkeiten einer reduktionistischen Subjektivierung und Relativierung auf der einen, der substantialistischen Objektivierung und Verdinglichung auf der anderen Seite entgeht. may find it so. But I find it liberating, and consoling. [...] I now live in the open air. There is still a difference between my life and the lives of other people. But the difference is less. Other people are closer. I am less concerned about the rest of my own life, and more concerned about the lives of others“ (ebd.). 5. Perspektiven personaler Identität Die Bewusstseinstheorien Lockes, Humes und Parfits weisen jedoch aufgrund ihrer reduktionistischen Radikalität zahlreiche Probleme auf. Der von allen drei Denkern vertretene Reduktionismus schießt über sein Ziel, die Vergegenständlichung der Person zu vermeiden, hinaus. Drei Punkte stechen dabei besonders hervor: (1) Die drei Denker verbinden mit dem Begriff der Person stets die Wirklichkeit von Fähigkeiten. Die bloße Möglichkeit einer Fähigkeit ist für sie nicht ausschlaggebend. So wären diesen Theorien zufolge nicht nur komatöse Patienten, sondern auch schlafende, geistig behinderte oder demente Menschen keine Personen mehr (wenn auch Menschen). (2) Das reine Bewusstseinskriterium vermag nicht die intersubjektive Dimension von Personalität zu fassen, weil die Person ohne spezifischen Körper über keine „Außenseite“ des Austauschs verfügt – ihre Existenz ist allein an inner- psychische Zustände gebunden. Damit droht aber die Gefahr eines Solipsismus – der Annahme der alleinigen Existenz des eigenen Selbst. (3) Mehr noch: Durch die alleinige Konzentration auf die Bewusstseinsakte droht sich die Person – wie in Humes Theorie – sogar selbst aufzulösen, da es keinen objektiv-intentionalen Bezugspunkt außerhalb ihres Bewusstseins – keine „Grenze“ – gibt, durch die sich die Person definieren kann. Mit der zunehmenden Auflösung personaler Einheit aber ist wiederum die eindeutige Zuschreibung von Handlungen und damit die Möglichkeit moralischer Zurechenbarkeit gefährdet. Eine befriedigende Theorie personaler Identität wird von derartigen Reduktionismen Abstand nehmen müssen. Es gilt vielmehr, eine Theorie personaler Identität zu entwickeln, die den Einseitigkeiten einer reduktionistischen Subjektivierung und Relativierung auf der einen, der substanzialistischen Objektivierung und Verdinglichung auf der anderen Seite entgeht. Angesichts dieses Dilemmas besteht die Herausforderung darin, die Person auf eine nicht vergegenständlichende, sondern freiheitswahrende und -ermöglichende Weise mit ihrer Natur zu verbinden. Literatur Von Jörg Noller Boethius. 1988. Die theologischen Traktate. Übersetzt von Michael Elsässer. Hamburg: Meiner. Descartes, René. 2004. Meditationen. Dreisprachige Parallelausgabe. Eingeleitet, übersetzt und erläutert von Andreas Schmidt. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. Hume, David. 1978. Traktat über die menschliche Natur. Übersetzt von Theodor Lipps. Herausgegeben von Reinhard Brandt. Hamburg: Meiner. Locke, John. 1981. Versuch über den menschlichen Verstand. Bd. 1. Übersetzt von Carl Winckler. Hamburg: Meiner. Parfit, Derek. 1984. Reasons and Persons. Oxford: Oxford University Press. Spaemann, Robert. 1996. Personen. Versuche über den Unterschied zwischen ‚etwas‘ und ‚jemand‘. Stuttgart: KlettCotta. Thomas von Aquin. 1939. Summa Theologiae. 3. Bd. Salzburg/ Leipzig: Anton Pustet. Zu unserem Gastautor: Jörg Noller ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl I der Fakultät für Philosophie an der LMU München und Redakteur des Philosophischen Jahrbuchs. Er studierte in Tübingen, München, Notre Dame und Chicago Philosophie, Literaturwissenschaft und Geschichte. Seine Dissertation schrieb er über das AutonomieProblem im Ausgang von Kant. Er interessiert sich für Theorien der Freiheit und der Person. Zusammen mit Prof. Buchheim organisiert Jörg Noller für das Wintersemester 14/15 das 1. Münchner Philosophische Kolloquium, dass sich der Frage „Was sind und wie existieren Personen?“ widmen wird. cog!to 07/2014 13 Echt? Gut? Über den vermeintlichen Eigenwert von Authentizität Von Christine Bratu Verstell dich nicht, sei du selbst! Lern mit dir klar zu kommen, so wie du eben bist – sei authentisch! Ständig werden Aufforderungen wie diese an uns gerichtet, fast erscheint Authentizität als der implizite normative Standard unserer Zeit. Doch was genau ist eigentlich gut daran, sich selbst treu zu bleiben? In Martin Scorseses Film „The Wolf of Wall Street“ Authentizität tatsächlich eine Tugend oder ist es nur dann spielt Leonardo DiCaprio den betrügerischen Börsenintrinsisch gut, authentisch zu sein, wenn das Selbst, makler Jordan Belfort. Indem er Kleinanleger*innen demgegenüber man treu bleibt, selbst wieder tugendhaft zu riskanten Aktiengeschäften verführt, bei denen sie ist? ihr weniges Erspartes aufs Spiel setzen, und dafür eine saftige Provision kassiert, kommt Jordan zu viel Geld, einem stetig anwachsenden Berg von Drogen und dem zweifelhaften Ruhm, jedem und jeder alles verkaufen zu können. Als ihm schließlich das FBI auf die Spur zu Doch zuerst braucht es ein wenig Begriffsklärung. Gekommen droht, raten seine Anwälte Jordan sich aus rade habe ich nämlich eine Lesart von „authentisch“ dem aktiven Geschäft seiner Firma zurückzuziehen. vorausgesetzt, mit der man nicht einverstanden sein Jordan tritt schweren Herzens vor die Belegschaft, um muss. Das Verständnis von Authentizität, das ich im seinen Rücktritt zu verkünden; doch noch während seiFolgenden zugrunde lege, identifiziert „authentisch ner Abschiedsrede ändert er seine Meinung: Würde er sein“ mit „sich selbst gerecht werden“ bzw. mit „sich jetzt, da ihm eine Gefängnisstrafe droht, damit aufhöselbst treu bleiben“. Das passt nicht unbedingt zur ren, mit allen Mitteln immer mehr Geld anzuhäufen, sonst üblichen Verwendung des Begriffes – jedenfalls würde er sich selbst verraten und von der Gesellschaft nicht zur Art und Weise, wie er im Rahmen desjenigen zu einem Heuchler machen lassen. Daher entschließt Diskurses verwendet wird, in dem Authentizität ihre er sich, seinen exponierten Posten zu behalten und der prominenteste Rolle spielt, nämlich dem über Kunstgeldgeile Aufsteiger zu bleiben, der er nun einmal ist – werke. Einem Kunstwerk Authentizität zu attestieren und seine Angestellten jubeln ihm dafür zu. bedeutet, es für echt und also für das Werk derjenigen In ethischer Hinsicht ist Jordan zu erklären, die bisher als Urhebekein bewundernswerter Mensch: rin angesehen wurde: Zu behaupDass Jordan Belfort sich selbst ten, dass ein Bild ein authentischer Er ist ein Betrüger, der sich am Schaden anderer gewissenlos be- und seinen Idealen treu bleibt, Modersohn-Becker sei, bedeutet, reichert; er hat keinen Respekt flößt uns Respekt ein und das dass es wirklich von Paula Modervor Frauen, sondern behandelt sie obwohl seine Ideale durchaus sohn-Becker gemalt wurde. Diese ausschließlich als Mittel zur Trieb- nicht respektabel sind. Verwendung von „authentisch“ im befriedigung; und er ist ein MateSinne von „echt“ – die auch mitrialist, dessen einziges Ideal das schwingt, wenn etwa „authentisch Haben von und Angeben mit Geld ist. Dennoch ist es thailändische Küche“ und „authentisch neapolitanische schwierig, in der oben beschriebenen Szene nicht zuPizza“ angepriesen werden – knüpft an die Wurzeln mindest einen kurzen Moment lang Achtung vor ihm des Begriffes an, da „authentikós“ im Altgriechischen zu empfinden. Dass er sich selbst und seinen Idealen „echt“ oder „verbürgt“ bedeutete. Doch in diesem Sintreu bleibt, flößt uns Respekt ein und das obwohl seine ne von einem authentischen Menschen zu sprechen ist Ideale durchaus nicht respektabel sind. Nicht heuchuninteressant: Wollen wir wirklich betonen, dass Jordan lerisch, sondern authentisch zu sein – offenbar halten Belfort ein echter Mensch ist? Im Gegensatz wozu? Zu wir das für intrinsisch wertvoll. Doch sollten wir das? Ist einem Replikanten à la Blade Runner? Von „Echt sein“ zu „treu bleiben“ 14 cog!to 07/2014 Wenn wir eine Person authentisch nennen, wollen wir vielmehr zum Ausdruck bringen, dass sie dem gerecht wird, was sie als die besondere Person ausmacht, die sie nun einmal ist. Für Jordan ist kennzeichnend, dass er ein hemmungsloser Emporkömmling ist, und er ist authentisch, sofern er sich als solcher verhält. Dabei sind es die Handlungen einer Person, in denen sich ihre Authentizität manifestiert: Jordan ist authentisch, weil er sich einen schneeweißen Lamborghini und eine riesige Yacht kauft, weil er seine Frau betrügt und weil er sich von einem FBI-Agenten, dessen Jahreseinkommen nur einen Bruchteil seines eigenen ausmacht, nicht vorschreiben lässt, was er zu tun und zu lassen hat. Authentizität ist also zunächst eine Eigenschaft von Handlungen, nämlich dem gerecht zu werden, was für die sie Ausführenden kennzeichnend ist. In Ableitung ist Authentizität zudem eine Eigenschaft der Ausführenden selbst, sofern ein ausreichendes Maß ihrer Handlungen authentisch ist. Ist es intrinsisch gut, sich selbst treu zu bleiben? Vor dem Hintergrund dieser Begriffsklärung lässt sich die Ausgangsfrage klarer formulieren: Ist es intrinsisch gut, wenn ich mir selbst treu bleibe, auch wenn sich dies in ethisch zweifelhaften Handlungen niederschlägt? Meiner Ansicht nach legt schon das Anfangsbeispiel nahe, wie wir diese Frage beantworten sollten. Doch um unsere Intuitionen noch deutlicher zutage treten zu lassen, will ich Jordans Fall verschärfen: Stellen wir uns vor, dass für einen anderen Jordan – Jordan2 – nicht nur Ehrgeiz und Habgier kennzeichnend sind, sondern auch eine rassistische und sadistische Haltung. Wenn diese radikalisierte Version von Jordan sich selbst mit ihren Handlungen gerecht werden will, muss sie Menschen nichtkaukasischer Abstammung quälen. Und weil auch Jordan2 ein authentischer Mensch ist, tut er genau das: Er beschimpft seine asiatischen Nachbarn, schmiert fremdenfeindliche Parolen an ihr Haus, verteilt Neonazi-Propaganda in der Umgebung und all das mit dem Ziel, seine Nachbarn aus der Gegend zu vertreiben. Was halten wir nun von Jordans2 hasserfülltem, aber authentischem Feldzug für eine rein kaukasische Nachbarschaft? Vernünftigerweise wird niemand behaupgut ten, dass Jordans2 Handlungen seien. Denn selbst wenn man Authentizität für eine Tugend hält, sollte sie doch nicht die einzi- ge und auch nicht die höchste Tugend sein, die man akzeptiert. Freundlichkeit, Rücksichtnahme, Offenheit, die Vermeidung von Leid sind ebenfalls intrinsisch wertvolle Verhaltensweisen und einige davon wiegen in diesem Fall sicherlich schwerer als sich selbst treu zu bleiben. Doch diese alternativen Tugenden missachtet Jordan2 aktiv. Wenn man Jordans2 Handeln als bewundernswert bewerten will, dann also nur pro tanto, d.h. nur in einer bestimmten Hinsicht, nämlich insofern es der Tugend der Authentizität entspricht. Doch insgesamt ist sein Handeln verurteilenswert, weil es viele andere und gewichtigere Tugenden vernachlässigt. cog!to 07/2014 15 „Nach Aristoteles sind Verhaltensweisen, die als tugendhaft gelten können, wenn sie auf ein lobenswertes Ziel gerichtet sind, keine Instanzen von Tugend mehr, wenn sie zur Umsetzung schlechter Absichten gebraucht werden. Es gibt keine mutigen Räuber und freigiebigen Bestecher“ Mir selbst erscheint dieses Urteil noch zu wohlwollend, weil Ausdruck einer falschen Auffassung von Tugenden. Nach dieser falschen, aber oft vertretenen Auffassung gibt es bestimmte Handlungstypen, die per se tugendhaft sind, wie etwa seiner Angst zu trotzen oder freigiebig mit seinen Gütern umzugehen. Doch tatsächlich hat Aristoteles, den ich in puncto Tugenden als Autorität bemühen möchte, eine allgemeinere Auffassung von tugendhaftem Handeln, nämlich: gewohnheitsmäßig das Angemessene tun. Nach dieser allgemeineren Auffassung gibt es keine an sich lobenswerten konkreten Handlungstypen – welche Verhaltensweise genau unsere Hochachtung verdient, hängt immer von der Handelnden und deren Situation ab. Kehren wir nun mit der aristotelischen Auffassung zurück zum Anfangsbeispiel. D.h. nehmen wir an, wir befänden uns in einer Situation, in der wir durch ein paar Tricksereien auf Kosten anderer schnell zu viel Geld kommen können. Welches Vorgehen wäre hier nun angemessen? Sicherlich nicht, die Gelegenheit am Schopf zu packen und Gelder zu veruntreuen. A fortiori wäre es auch nicht angemessen, dies auf eine Art und Weise zu tun, die unserem Wesen in besonderem Maße entspricht. Angemessen wäre vielmehr, die Situation gar nicht erst als Gelegenheit zur Bereicherung zu begreifen. Nach Aristoteles’ Auffassung sind Verhaltensweisen, die als tugendhaft gelten können, wenn sie auf ein lobenswertes Ziel gerichtet sind, also keine Instanzen von Tugend mehr, wenn sie zur Umsetzung schlechter Absichten gebraucht werden. Auf den Punkt gebracht: Es gibt keine mutigen Räuber und keine freigiebigen Bestecher – wenn überhaupt sind Räuber tollkühn und Bestecher verschwenderisch. Solange also Jordans authentische Handlungen solche sind, die wir insgesamt für verurteilenswert halten, fällt die Tatsache, dass diese Handlungen typisch für ihn sind, nicht einmal pro tanto positiv ins Gewicht. Dass Jordan von sich behaupten kann, sich selbst treu geblieben zu sein, macht sein betrügerisches Verhalten keinen Deut besser – im Kontext schlechter Handlungen ist das Merkmal, authentisch zu sein, nicht normativ relevant. 16 cog!to 07/2014 Wider unsere Intuitionen Der ein oder die andere wird diese Einschätzung problematisch finden, schließlich impliziert sie Folgendes: Menschen, bei denen Authentizität zu ethisch zweifelhaften Handlungen führt, sollten nicht authentisch handeln. Aber wollen wir wirklich jemandem raten, sich zu verstellen? Auch in meinen Ohren klingt dieser Ratschlag seltsam. Denn schon das Anfangsbeispiel hat gezeigt, dass wir intuitiv dazu geneigt sind, authentisches Handeln positiv zu bewerten. Diese Dissonanz muss man als Herausforderung annehmen, wenn man wie ich dafür argumentieren will, dass wir authentischem Handeln keinen intrinsischen Wert zumessen sollten. D.h. dass man erklären können muss, warum wir Authentizität intuitiv für bewundernswert halten, obwohl Beispiele wie das von Jordan diese positive Einschätzung mit wenig Aufwand als falsch entlarven. Warum also erscheint uns authentisches Handeln intuitiv als positiv? Diese Fehleinschätzung mag zum einen darauf zurückzuführen sein, dass mit authentischem Handeln bestimmte Zubringertugenden verbunden sind. Denn um authentisch handeln zu können, muss man über bestimmte praktische Einstellungen oder Eigenschaften verfügen, und einige davon halten wir selbst wieder für bewundernswert. So bedarf es z.B. eines gewissen Maßes an Selbstkenntnis. Wie nämlich soll man sich selbst in seinem Handeln gerecht werden, wenn man nicht weiß, welche Merkmale für die eigene Person kennzeichnend sind? Andere der Authentizität dienliche Tugenden sind Willensstärke und Mut; diese wird man insbesondere brauchen, wenn mit seinem eigenen Standpunkt gegen gesellschaftliche Erwartungen verstößt. Vielleicht sind wir also dazu geneigt, intuitiv Achtung vor authentischem Handeln zu empfinden, weil wir hinter Authentizität weitere Tugenden am Werk vermuten. Doch selbst wenn dieser Verdacht zutrifft und eine authentische Person also auch über Selbstkenntnis verfügt und willensstark und mutig ist, reicht dieser Zusammenhang nicht aus um unsere in- tuitive Wertschätzung zu begründen. Denn mit vielen der Zubringertugenden für Authentizität verhält es sich wie mit Authentizität selbst: Sie ist nur wertzuschätzen, solange sie auf wertzuschätzende Ziele gerichtet ist. Besonders deutlich wird dies am Beispiel der Willensstärke. Denn was, wenn nicht der Kirchenreformer Martin Luther, sondern ein treues Mitglied des KuKluxKlans die Worte geäußert hätte, die oft als Paradigma für Willensstärke angeführt werden: „Hier stehe ich, ich kann nicht anders!“ ist es bewundernswert, wenn eine Rassistin standhaft auf ihrer Position beharrt? Vielleicht ist es aber auch ein anderes Missverständnis, das Authentizität in unseren Augen als intrinsisch wertvoll erscheinen lässt – nämlich die Engführung von „Authentizität“ und „Nonkonformität“. Es liegt nahe, diese beiden Konzepte miteinander zu verkoppeln; denn eine Person, die authentisch handelt, folgt ihrem eigenen Urteil und hält sich nicht nur deswegen an vorgegebene Regeln, weil sie gesellschaftlich anerkannt sind. Solange die gesellschaftlich vorgeschriebenen oder erwarteten Verhaltensweisen kritikwürdig sind, ist eine solche eigenständige Haltung bewundernswert. Und lange genug waren die gesellschaftlich vorgeschriebenen oder erwarteten Verhaltensweisen kritikwürdig und manche sind es noch immer (wenn man etwa an das Leitbild seriell monogamer Heterosexualität denkt, neben dessen Ausschließlichkeit andere Liebesweisen nur langsam Platz finden). Da die Menschheit also noch im Begriff ist, sich aus ihrer selbstverschuldeten Unmündigkeit einen Ausgang zu bahnen, wäre es nicht verwunderlich, wenn sich Authentizität im Sinne von Nonkonformität zu einem positiv besetzten thick ethi- cal concept entwickelt hätte. Doch auch diese Überlegung reicht nicht aus, um authentisches Handeln als an sich bewundernswert zu rechtfertigen. Denn es ist nicht bewundernswert, sich gegen bestehende Normen aufzulehnen, sofern diese sinnvoll sind, ebenso wie es nicht bewundernswert ist, seinen eigenen Weg zu gehen, sofern dieser in die falsche Richtung führt. Sollen wir Heuchler*innen sein? Könnten wir Jordan Belfort begegnen, sollten wir ihm also das Folgende sagen: Mag schon sein, dass deine Betrügereien Ausdruck deiner Selbst und also authentisch sind. Doch das macht deine Handlungen weder in einer bestimmten Hinsicht besser noch insgesamt gut. Dass deine Wertvorstellungen und deine Wünsche mit dem in Einklang stehen, was du tust, rechtfertigt weder das eine noch das andere. Das bedeutet aber nicht, dass du dich in Zukunft verstellen und zu einem Heuchler werden solltest. Dass Authentizität nicht an sich wertvoll ist, spricht nicht für Heuchelei. Vielmehr solltest du deine Wertvorstellungen und Wünsche Stück für Stück hinterfragen und untersuchen, ob dir diese insgesamt sinnvoll erscheinen. Und wenn dies – wie zu hoffen ist! – nicht der Fall ist, dann musst du diese anpassen. Du solltest also nicht zu einem Heuchler werde, Jordan, sondern zu einem besseren Menschen. Von Christine Bratu Zu unserer Gastautorin: Christine Bratu ist wissenschaftliche Assistentin am Lehrstuhl für Philosophie IV der Ludwig-MaximliansUniversität München. Sie studierte politische Wissenschaft, Philosophie und neuere und neueste Geschichte und wurde im Sommer 2011 mit einer Arbeit zu den Grenzen legitimer staatlicher Gewalt bei Prof. Dr. Julian Nida-Rümelin promoviert. Aktuell beschäftigt sie sich mit der Frage, warum sich Menschen selbst und wechselseitig respektieren sollten. cog!to 07/2014 17 Integrität braucht Wahrheit Nichts anderes ist es mit Identität und Authentizität Von Volker Gerhardt Dass Personen ein „Selbst“ haben sollen, könnte man für eine abwegige Erfindung von Philosophen halten. Tatsächlich gibt es Autoren, die das Selbst als metaphysisches Gespenst verspotten. Nur hat der Spott den Nachteil, dass er auf den Spötter zurückfällt. Denn auch er kommt ohne sein Selbst nicht aus, das sich betroffen fühlt, wenn man ihm widerspricht, und das sich gestärkt sieht, sobald man es lobt. Jeder, der von sich aus handelt und sich dabei vor anderen auf sich selbst bezieht, bringt sich selbst ins soziale Dasein ein – ohne ein Körperteil mit dem Namen „Selbst“ zu haben. Es gibt auch sonst keinen materiellen Gegenstand, auf den sich verweisen ließe. Und dennoch zeigt sich das Selbst ganz zweifelsfrei – im Umgang mit uns selbst. Was also heißt es, ein Selbst zu haben oder gar ein Selbst zu sein? 1. Autonomie und Souveränität N ach Nietzsches oft zitiertem Wort begreift sich der Mensch als ein „nicht festgestelltes Tier“. Gleichwohl versucht dieses Tier in immer neuen Wendungen das festzustellen, was ihm an ihm selbst als wesentlich erscheint. Unter neuzeitlichen Bedingungen haben die noch stark durch den sozialen Vergleich vermittelten Feststellungen nach Art des aristos, also des „Besten“, des „Höchsten“ oder „Edelsten“, offenbar an Attraktivität verloren. Schon die platonischen Tugenden gehen von definierbaren Leistungen aus, die sich, wie die Weisheit, die Besonnenheit, die Gerechtigkeit oder die Frömmigkeit auf bestimmte sachlich ausgezeichnete Handlungsfelder beziehen. Exemplarisch ist der historisch und politisch weit vorgreifende Versuch Platons, die Tapferkeit von die Bewährung im Krieg zum mutigen Auftritt in der politischen Versammlung umzuschreiben, so dass man sie bereits mit Blick auf die Zeit um 380 v. Chr. als „Zivilcourage“ begreifen kann.1 Unter modernen Bedingungen gibt es zwei prominente Angebote, die Eigenart des Menschen so zu benennen, dass darin eine Auszeichnung einer ihm wesentlichen Fähigkeit hervorspringt. Das ist zum einen die Autonomie, die Kant als dominantes Merkmal des sich selbst bestimmenden vernünftigen Wesens ausmacht, und zum anderen die Souveränität, die Nietzsche als vorzügliche Eigenart des „freien Geistes“ hervorhebt. Beide Begriffe können angemessen natürlich nur in ihrem theoretischen Umfeld verstanden werden. Aber in aller Kürze kann man sagen, dass sie das sibi praefini1 Die Abfassungszeit des Laches, in dem Platon diese epochengeschichtliche Deutung vornimmt, wird auf die Zeit um 380 v. Chr. datiert. 18 cog!to 07/2014 ens (Pico della Mirandola [1486] 1990), die Selbstbestimermittelten Befund und decken dadurch Defizite im mung des Individuums auszeichnen, die zwar auf leibBedeutungsfeld der überlieferten Termini auf. Der erste haftige Präsenz und seelische Konstanz angewiesen ist, Begriff, die Authentizität, muss weder der Autonomie aber nicht ohne rationalen Zugriff gedacht werden kann. noch der Souveränität entgegenstehen, betont aber die Bei Kant ([1785] 2004) ist das, wie jeder weiß, durch den Einheit, genauer: die Ganzheit, ja, die Ganzheitlichkeit Anspruch auf begriffliche Konsequenz und in Erwartung der Präsenz einer Person, die sowohl ihre innere Einsteleiner menschheitlichen Generalisierung gegeben; aber lung wie auch die Überzeugungskraft ihrer Wirkung auf auch sein Kritiker Nietzsche legt alles auf Berechenbarandere umfasst. keit im sozialen Kontext an. Nach Nietzsche (1886) kann In der Authentizität liegt das Pathos des existenziellen nur der als „souverain“ gelten, der unter Beweis gestellt Denkens, das den Ernst und das Wagnis des individuelhat, dass er „versprechen darf“. Der Beleg ist durch die len Daseins bewusst macht und vom Einzelnen fordert, vorangehende Verlässlichkeit zu erbringen. sich ihm zu stellen. Damit wird weder der Anspruch an Nach allem, was man über Nietzsche weiß, könnte das Denken noch an die intellektuelle Redlichkeit ermäman auch meinen, der „souveräne Mensch“ erweise ßigt, aber den affektiven und emotionalen Anteilen des sich von vornherein als derart menschlichen Handelns wird Nach„groß“ und überlegen, dass an Es gibt bei Kant wie bei Nietzdruck verliehen. Die Folge ist, dass seiner Fähigkeit, selbst noch „die auch das Gewicht der äußeren Wirksche, neben der ohnehin beAusnahme zu beherrschen“2, gar samkeit steigt. Das gilt insbesondestehenden Geltung physischer nicht zu zweifeln ist. Doch dieser re im Vergleich mit der Autonomie, Lesart widerspricht, dass Nietz- Bedingungen, die Einbeziedie sich im Gleichmaß selbstbesche kenntlich machen will, wie hung sozialer Bedingungen stimmten Handelns genügen kann. man, als Mensch unter Menschen, innerhalb derer sich die in ihDie Souveränität hingegen ist zum souveränen Menschen wird. rem Handeln ausgezeichneten auf die Bewährung im Konflikt beEs geht um den Lernprozess, den zogen, dessen Lösung eine lenkendas „souveraine Individuum“ zu Individuen als eigenständig zu de Hand erfordert. Der souveräne durchlaufen hat. Und das schließt erweisen haben Mensch muss Gegensätzen standan dieser Stelle aus, die Souverähalten können; unter Umständen nität auf die vorgegebene „Vornehmheit“ oder gar auf hat er ihnen gelassen zuzusehen oder er muss zu ihrer den sogenannten „Übermenschen“ zu beziehen. Überwindung in der Lage sein. Also gibt es bei Kant wie bei Nietzsche, neben der Ginge es nur um den Erfolg im Umgang mit akuten ohnehin bestehenden Geltung physischer BedingunKrisen und Konflikten, brauchte von Authentizität nicht gen, zu denen insbesondere die Endlichkeit der körperdie Rede zu sein. Sie ist auf die Wirkung im persönlichen lichen Beschaffenheit gehört, die Einbeziehung sozialer Umgang mit seinesgleichen bezogen und hält ihre WirkBedingungen innerhalb derer sich die in ihrem Handeln samkeit im Urteil der anderen fest. Die Authentizität ausgezeichneten Individuen als eigenständig zu erweizeigt sich im Effekt, den sie in der individuellen Resosen haben. Und diese Eigenständigkeit zeigt sich vornanz bei anderen hat. Ihre Wirksamkeit zeigt sich in der nehmlich daran, dass sie aus eigener Einsicht handeln. Überzeugung, die vornehmlich nahe- oder näherstehenDabei gibt Kant der Vernunft den Vorrang, während de Mitmenschen von der Aufrichtigkeit, Ernsthaftigkeit Nietzsche in der Souveränität die Tugend des „freien und Entschlossenheit dessen haben, der ihnen Eindruck Geistes“ namhaft macht. macht und den sie damit für „echt“ und „unverstellt“ Der atmosphärische Unterschied ist groß, insbeund somit für authentisch halten. sondere, wenn Nietzsche die „kleine Vernunft“ des Authentizität verlangt den Eindruck aus persönliBewusstseins an die „große Vernunft des Leibes“ zu cher Nähe; man wird ihn schwerlich über die Medien binden und dem Wissen wie der Wahrheit die Schuld an vermitteln können. Da man ihn aber jederzeit auch auf der décadence aufzubürden sucht. Aber der Doppelbedie Bühne bringen, spielen und vortäuschen kann, wird zug auf die Vernunft, die auch vom Bücher schreibenman insbesondere in den öffentlichen Medien mit fortden Nietzsche nicht preisgegebene Präferenz für das gesetztem Authentizitätstheater rechnen können. AuWissen sowie die offenkundige Unverzichtbarkeit von thentizität soll dann immer auch Integrität suggerieren. Individualität, Geist und Kritik sind Indikatoren dafür, Damit haben wir den zweiten Begriff, der Autonomie dass Nietzsche nicht auf die begriffliche Kompetenz des und Souveränität vornehmlich durch den Anspruch auf Menschen verzichten mag. personale Geschlossenheit zu ergänzen sucht. Integrität könnte als interne Vorbedingung der Authentizität angesehen werden. Sie ermöglicht den andere überzeugenden Eindruck von einer Persönlichkeit, die ihr Gleichgewicht und mit ihm innere Ruhe gefunden hat. 2. Authentizität und Integrität Zwei andere neuerdings in Umlauf gekommene Begriffe ergänzen den für Autonomie und Souveränität 2 Wie Carl Schmitt es für die Souveränität des Staates definiert hat. cog!to 07/2014 19 „Rein physisch gesehen gibt es das Selbst nicht in der Art eines Gegenstands oder eines leibhaftigen Organs; daraus jedoch zu schließen, es sei gar ‚nichts‘ oder bestenfalls eine ‚Illusion‘, der weiß nichts von der manifesten Wirksamkeit der notwendig immateriellen Beziehungen in der psychischen, sozialen und kulturellen Realität“ Das klingt nach der Idylle des Groschenromans, kann aber den Abschluss einer wechselvollen Entwicklung, kann gewonnene Erfahrung und gelungene Reifung anzeigen und schließt den Gegensatz unterschiedlicher Antriebe nicht aus. Schon die Rede vom Gleichgewicht unterstellt mindestens zwei widerstreitende Kräfte, und es gehört zum Begriff der Integrität, dass er die eigene Anstrengung des Individuums mitzudenken sucht. Integrität stellt sich nicht automatisch ein; sie wird nicht als Mitgift der Natur gedacht, ist keine Eigenschaft eines jungen Menschen und kann auch nicht allein im Reflex auf Vorbilder entstehen. Sie bedarf der Arbeit an sich selbst; sie verlangt eine Selbstdisziplin, die im integren Menschen (so unterstellt der Begriff) alles Zwanghafte verloren hat und sich zu einer sich frei entfaltenden, entspannt auftretenden, durch und durch persönlichen Haltung entwickelt hat. So kann der integre Mensch auf kultivierte Weise authentisch wirken. Er könnte als Ideal des souveränen Menschen gelten und niemand könnte ihm die Autonomie seiner Selbstbestimmung absprechen, ohne dabei in Verdacht geraten zu müssen, er trenne ihn von den natürlichen und gesellschaftlichen Lebensbedingungen oder setze ihn in Opposition zur Lebenswelt. Zwar wäre das, nicht nur mit Blick auf Kant und Nietzsche, eine abwegige Unterstellung; aber sie kommt bekanntlich vor. Doch wo immer sie Anhänger findet, kann der Begriff der Integrität für ein besseres Verständnis sorgen, weil er den Menschen in der Vielfalt seiner inneren und äußeren Lebensbedingungen belässt und ihm die Zeit einer persönlichen Entwicklung zugesteht, in der er, nicht ohne eigenen Anteil, vermutlich aber auch durch günstige Umstände, zu dem hat werden können, der er ist. „Werde der du bist“ wäre die Maxime, die der integre Mensch befolgt. In philosophischen Theorien kann der Begriff der Integrität somit auch als Interpretament von Autonomie, Souveränität und Authentizität verwendet werden. Denn er ist geeignet, sie vom Verdacht einer Isolation von ihren eigenen Sinnbedingungen zu befreien. Denn wie groß der Anspruch auf eigenständiges Handeln 20 cog!to 07/2014 auch immer sein mag: Es ist stets nur als doppeltes Integral einer Vielzahl äußerer und innerer Kräfte möglich, die sowohl im Akt einer einzelnen Tat wie auch in der Summe eines Lebens einen Ausdruck finden und über dessen Gelingen man nur staunen kann. 3. Zur Fragilität des Selbst Um das Unwahrscheinliche des Zustandekommens einer zurechenbaren Handlung wenigstens anzudeuten, auch um damit den Zufall im Glück eines gelingenden Lebens erahnen zu lassen, möchte ich aus der erwähnten Vielfalt der am menschlichen Handeln beteiligten Faktoren nur einen herausgreifen, der für das Verständnis der hier behandelten Begriffe nicht unwesentlich ist: Als Philosoph oder Sachbuchautor kann man jederzeit illustrieren, dass es das Ich oder das Selbst, das als Träger zurechenbaren Handelns und seiner ethischen Attribute benötigt wird, gar nicht gibt. Das Selbst, das unter den Konditionen einer sprachfähig gewordenen menschlichen Kultur „ich“ zu sich sagen kann, ist kein eingebauter Identitätskörper, der aus jedem einzelnen Wesen genau und unverwechselbar das macht, was es ist. Es ist vielmehr das Integral eines (wie alles Lebendige) auf sich selbst bezogenen Lebensvorgangs, der nach außen wirken, nach innen überzeugen und dabei von seinesgleichen in seiner Besonderheit erkannt werden muss. In Korrespondenz mit seinesgleichen hat jeder eine Einheit darzustellen, die seinen körperlichen und geschichtlichen Konditionen entspricht und seinen sozialen und psychischen Konstellationen angemessen ist. In Übereinstimmung mit seinen Lebensdaten, seinem Geschlecht, seinem Alter oder seinem Glauben hat er in aller Veränderung eine innere Konstanz zu erweisen, die beweglich genug sein muss, um den ständig wechselnden Situationen des Lebens gerecht werden zu können. Zu denen gehören auch die widerstreitenden Kräfte in seiner eigenen Brust, zwischen denen das Selbst zu einem Ausgleich finden muss, ohne mit jeder Entscheidung als ein anderes Ich zu erscheinen.3 Rein physisch gesehen gibt es das Selbst nicht in der Art eines Gegenstands oder eines leibhaftigen Organs; daraus jedoch zu schließen, es sei gar „nichts“ oder bestenfalls eine „Illusion“, der weiß nichts von der manifesten Wirksamkeit der notwendig immateriellen Beziehungen in der psychischen, sozialen und kulturellen Realität. Die Wirklichkeit des Selbst liegt in der Wirksamkeit, die es von sich aus entfaltet und darin zugleich die Beachtung anderer findet, die es darin erkennen. Die Identität des Selbst ist eben das, was sich in Prozessen der Selbstbestimmung bildet, in sozialen Interaktionen hervortritt und sich mit ihnen wieder verliert. Sobald die psycho-physische Wirksamkeit des Organismus ihr tödliches Ende findet, dürfte auch das Selbst seine Schuldigkeit getan haben. Damit ist die Bindung des Ich wie auch des Selbst an das Leben exponiert. Das menschliche Leben, von dem hier die Rede ist, kann freilich nicht als eine rein physische, auch nicht als bloß biologische Größe gelten. Es hat immer auch eine soziale und kulturelle Dimension, wobei wir es für selbstverständlich halten, dass Gesellschaft und Kultur keine Gegeninstanzen zur Natur, sondern vielmehr selbst Formen der Natur sind, in denen sich die Evolution ausprägt (vgl. dazu Gerhardt 2013). An Ich und Selbst zeigt sich das schon daran, dass sie als Wort vorkommen, dabei an die semantischen Regeln ihres Gebrauchs gebunden sind und eine logische Bedeutung haben. 026114 Anzeige www.philo-sophos.de 210x148,5 12.03.14 16:35 Seite 1 Mit alledem sind Ich und Selbst – nicht nur innerlich und äußerlich, nicht nur psychisch und physisch, sondern auch – in ihren sachlichen Bedeutung in den Konnex des menschlichen Erkennens eingebunden, so dass gefragt werden muss, was ihnen in allem Wandel äußerer und innerer Umstände eigentlich die sachliche Konstanz verleiht, ohne die niemand die Chance hätte, mit dem Anspruch aufzutreten, etwas Bestimmtes zu sagen, wenn er die Begriffe Ich und Selbst verwendet. Auch sie müssen sich auf „etwas“ beziehen und bedürfen dabei eines Minimums an referentieller Kohärenz, mundaner Korrespondenz und intersubjektivem Konsens.4 Die wird dem Menschen durch die in jedem Einzelfall von der Geburt bis zum Tod bestehende identifizier3 Nicht von Ungefähr hat der ursprünglich aus der Logik stammende und dann in die botanische Beschreibungspraxis übernommene Terminus der Bestimmung, der bei Kant zur Bezeichnung autonomer Selbstbestimmung dient, vom 19. Jahrhundert an eine bemerkenswerte politische Karriere gemacht. Er ist heute zum festen Bestandteil des Vokabulars im Völkerrecht, in der politischen und der zivilgesellschaftlichen Praxis sowie in der Bioethik geworden. Dabei tritt er die Erbschaft des antiken Begriffs der Selbstherrschaft an, und hat Vorläufer in der Renaissance-Philosophie, deren Sprachgebrauch sich unter neuzeitlichen Bedingungen in keiner europäischen Sprache verliert. Zur Begriffsgeschichte und zur systematischen Reichweite siehe Gerhardt (1999). 4 Zur Dreifaltigkeit des Wahrheitskriteriums siehe Gerhardt (2006). Anzeige www philo-sophos.de • die Fachdatenbank für philosophische Bücher • mit Autoren- und Themenverzeichnis • zahlreiche vergriffene, antiquarische Titel • podcast – Philosophie zum Hören • newsletter • Katalog anfordern! Wiss. Versandbuchhandlung für Philosophie / Tübingen E-mail [email protected] · Fon 07071 22803 cog!to 07/2014 21 bare „Identität“ seines körperlichen Daseins geboten. Man kann sie heute bis in die genetische Konfiguration in der befruchteten Eizelle verfolgen, und sie bleibt in dieser Beständigkeit oft noch weit über die Bestattung des toten (vielleicht sogar eingeäscherten) Körpers hinaus bestehen. Wer Bauten, Kunstwerke oder wissenschaftliche Thesen hinterlässt oder zu fortgesetzten Erzählungen Anlass gibt, kann über Tausende von Jahren hinweg als derselbe angesprochen und zum Gegenstand historischer Verehrung und wissenschaftlicher Behandlung werden. Ich sage nur „Sokrates“, von dem selbst nichts Schriftliches und nichts in Stein Gehauenes überliefert ist, und jeder weiß, wen ich meine. Mit Blick auf die Identität des Individuums, um die es in der ethischen Spezifikation eines Ich oder Selbst geht, insbesondere wenn es um ein Urteil über dessen Integrität zu tun ist, kommt aber eine weitere Rahmenbedingung hinzu, die es dem Einzelnen erlaubt, selbstbewusst bei dem zu bleiben, was er für wichtig hält, um zugleich von denen, die über seine moralische Verfassung urteilen, in eben diesem Identität und Kontinuität verleihenden Bezug als der erkannt zu werden, der er ist. Das ist umständlich formuliert, läuft aber auf den einfachen Sachverhalt hinaus, dass der Einzelne in seiner integren Einheit nur erfahren werden kann, wenn er in seinem Selbst- und Weltverhältnis formal wie inhaltlich bei demselben bleiben kann, das auch seine Mitmenschen als dasselbe erkennen. Kurz: Die integre Person muss wahrhaftig sein und in ihrer Bemühung um Wahrhaftigkeit, auch von den Menschen in ihrer Umgebung als konsequent erkannt werden können. Dazu müssen auch sie sich um die Wahrheit bemühen, um die es dem integren Menschen geht. Noch kürzer: Man kann nicht Integrität verlangen und gleichzeitig die Bedeutung der Wahrheit in Abrede stellen. Literatur Gerhardt, Volker. 1999. Selbstbestimmung. Das Prinzip der Individualität. Stuttgart: Reclam. –––––. 2006. „Wahrheit und Existenz“. In: Merkur, Heft 682, 60. Jahrgang: 133-143. Wieder erschienen in: ders. 2008. Exemplarisches Denken. Aufsätze aus dem Merkur, S. 223236. München: Fink. –––––. 2013. „Kultur als Form der Natur“. In: Mitteilungen der Gesellschaft für Urgeschichte, Heft 12, Jg. 21: 91 – 104. Kant, Immanuel. [1785] 2004. Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Herausgegeben, eingeleitet und erläutert von Jens Timmermann. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. Nietzsche, Friedrich. 1887. Zur Genealogie der Moral. Leipzig: C.G. Naumann. Pico della Mirandola, Giovanni. [1486]1990. De hominis dignitate. Über die Würde des Menschen. Übersetzt von Norbert Baumgarten. Herausgegeben und eingeleitet von August Buck. Hamburg: Felix Meiner. Platon. 2014. Laches. Übersetzung und Kommentar von Jörg Hardy. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. Von Volker Gerhardt Zu unserem Gastautor: Prof. Dr. Dr. h.c. Volker Gerhardt ist Professor für praktische Philosophie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Die hier vertretene Auffassung hat er bereits in der Selbstbestimmung (Stuttgart 1999), begründet; sie ist in seinen Studien zur Partizipation und zur Öffentlichkeit (München 2007 und 2012) näher ausgeführt. In Kürze erscheint: Der Sinn des Sinns. Versuch über das Göttliche (München 2014) 22 cog!to 07/2014 RUBRIK Personenkult In Personenkult findet ihr Interviews mit Professoren unserer Fakultät und anderen interessanten Denkern und Denkerinnen. In dieser Ausgabe schweigen wir mit Christof Rapp über Platon und Aristoteles und sprechen mit Barbara Vinken über Mode und Moderne. Das Portrait ist diesmal dem Soziologen Erving Goffman und seinen Gedanken zur Allgegenwart von Theater und Inszenierung in der sozialen Interaktion gewidmet, für das wir Stefan Joller als Gastautor gewannen. cog!to 07/2014 23 Schweigen über Rusty Ein Interview ohne Worte mit Prof. Dr. Christof Rapp Herr Prof. Rapp, wo liegt die Wiege der Philosophie? Welches ist das wichtigste Buch in Ihrer Privatbibliothek? Wie sehen Sie aus, wenn Sie Aristoteles lesen? ...und wie, wenn Sie Platon lesen? 24 cog!to 07/2014 Natürlich sind Sie kein Philosophieprofessor. Als Rockstar sehen Sie folgermaßen aus... Sonnenbrille, Lederjacke, Ohrring: Wie sähen Sie eigentlich aus, wenn Sie kein Rockstar, sondern Philosophieprofessor geworden wären? Und wie sahen Sie als Student aus? Wie geht es eigentlich Rusty? Das Interview führten Mathias Koch und Daniel Hoyer. Fotos: Mathias Koch cog!to 07/2014 25 „Das autonome Subjekt ist ein Fake!“ Im Gespräch mit Barbara Vinken über Mode, Moderne, die Philosophie und den Overall Das Interview zu Vinkens Buch „Angezogen. Das Geheimnis der Mode“ (Stuttgart 2013) führten Fabian Heinrich und Miguel de la Riva cog!to: Frau Vinken, wie finden Sie eigentlich die Kleidung der Studierenden in Ihren Veranstaltungen? Barbara Vinken: Sehr gut. In der Romanistik haben wir fast 90 Prozent weibliche Studierende und die ziehen sich ausgesprochen gut an. Es war schon immer so, dass die Romanistinnen und die Kunstwissenschaftle- 26 cog!to 07/2014 rinnen die am besten angezogenen Leute an der Universität sind. cog!to: Hat sich die studentische Kleidung im Vergleich zu Ihrer Studienzeit verändert? Vinken: Zu meiner Studienzeit zog man sich konservativer an. Bei uns gab es noch dieses Ideal von der Jura-Studentin: Perlenkette, Flanell und Cashmere Twinset. Das ist fast ganz weg. Man ist heute offensiv modischer. cog!to: Mode verändert sich und wird mit schnellem Wandel assoziiert. Warum muss sich Mode eigentlich andauernd ändern? Vinken: Paradox, höchst paradox, das Ganze. Zum einen ändert sich die Mode langsamer als man denkt. Grundsätzliche Silhouettenwechsel sind nicht saisonal, sondern haben eine Spanne von mindestens 15 Jahren. Deshalb gibt es durchaus so etwas wie longue durée in der Mode. Auf der anderen Seite haben wir Ketten, die zu einer extremen Demokratisierung und damit unglaublichen Beschleunigung der Mode geführt haben. H&M und Zara haben alle sechs Wochen eine neue Kollektion. Das sind zwei fast paradox ineinandergreifende Bewegungen, die dazu geführt haben, dass das Saisonale, das die Mode eigentlich hat, in den Hintergrund geraten ist. Es ist zugunsten einer Gleichzeitigkeit verschiedener Trends zurückgetreten. Gegenwärtig sehen wir etwa zugleich den Versuch den Minirock, den unter den Knien abschließenden Rock und den Midi, den wadenlangen Rock, wiederzubeleben. Das wäre in den 50er oder 60er Jahren undenkbar gewesen, Rocklänge war nicht verhandelbarer Modestandard. Deshalb hat Saint Laurent vielleicht heute mehr recht denn je, wenn er meint, Mode sei vergänglich, Stil ewig. cog!to: Und warum ändert sich die weibliche Mode augenscheinlich schneller als die männliche? Vinken: Die Männermode hat mit dem Anzug ihre klassische Form gefunden. Wenn man sagt, der Anzug erfülle idealtypisch die Kriterien der modernen Ästhetik, dann tut das die weibliche Mode nicht. Sie ist historistischer geblieben. Wann immer es das Bestreben gab, die ästhetische Norm der Moderne in die weibliche Mode zu übertragen, etwa von Coco Chanel, gab es zugleich eine Gegenbewegung – damals den New Look von Dior. Der Männeranzug dagegen etablierte eine Norm, deren Vorteil in ihrer fast unmodischen Beständigkeit lag. Natürlich gibt es auch da Varianten, aber die sind geringer als bei der Frauenmode. Vor allem ist das ästhetische Prinzip der Moderne für den Mainstream der Männermode nie in Frage gestellt worden. Die Frauenmode, kann man sagen, besteht darin, das in Frage zu stellen. cog!to: Worin besteht dieses ästhetische Prinzip der Moderne in der Mode? Vinken: Die Ästhetik der klassischen Moderne ist bestrebt, sich vom Stigma des Modischen zu befreien – und in der Männermode ist der Anzug darauf eine gelungene Antwort. Der Anzug bedeckt alles außer Gesicht und Hände. Seine Botschaft ist, dass man auf alles Äußerliche souverän verzichten kann. Er zeigt, dass er nicht zeigt: Die Performanz besteht darin, Performanz zu löschen. C´est très raffiné. Nietzsche hat diese moderne Norm auf den Punkt gebracht: Der Geistesmensch distinguiert sich dadurch, dass er in seinen Kleidern zeigt, dass er äußerlichen Prunk und Firlefanz nicht nötig hat. Es geht um Geist und Leistung, nicht um reizendes Fleisch. Der Anzugträger hat Wichtigeres im Kopf als die Frisur, die er darauf trägt. Diesen Schritt in die Moderne, meint Nietzsche, sei nur die Mode der reifen Europäer gegangen. Abgehängt keuchen andere hinterher: die Stutzer, nichtstuende junge Männer in den Städten. Ihr Leben gilt dem Frauendienst und denen zu Gefallen kleiden sie sich ausgefallen. Und natürlich die Frauen, die geistlos eitel seien und denen es darum gehe, das Fleisch reizend zu inszenieren. Und wie macht man das? Durch Anleihen bei der Antike, aber nicht bei der klassisch-reinen Winckelmannschen, sondern bei den orientalisch-schwülen Antiken der Türken und Griechen. Interessant daran ist, dass Nietzsche hier die klassischen Topoi, die die Ideologie der Mode ausmachen, bedient, gegen die er sich sonst oft wendet: Orient und Okzident, Fleisch-Geist, oberflächlichtiefgründig, Charakter-leerer Schein. cog!to: Der Anzugträger inszeniert sich also als eine bloß mit sich selbst identische Person. Gegenpart dazu ist einerseits der Dandy oder Stutzer, andererseits die Frau. Sie schreiben in Ihrem Buch, die Moden dieser beiden stelle eine „Enklave des Orients in der Moderne“ dar. Vinken: Die Mode ist der Moderne Dorn im Auge, Stachel im Fleisch, eingeschlossener, ausgeschlossener Fremdkörper, orientalische Kolonie im Inneren. „Reform“ steht wie mit Flammenschrift über fast allen Schriften zur Mode. Es geht immer um den Auszug aus Babel. Der Orient wird diskursiv konstruiert als all das, was der Westen aus sich ausgrenzen, abspalten muss, um westlich zu werden: Der Orient fördere nicht die Selbstbestimmung, sondern unterwerfe despotisch tyrannisch; er sei nicht fortschrittsorientiert, sondern befangen im Kreislauf der Lüste; eitel an der blendenden Oberfläche spiegelnd appelliert er nicht an den Verstand, sondern an die Sinnlichkeit; er sei so dekadent wie barbarisch. Diese Topoi, die den Orient als ein Anderes stigmatisieren, werden auf die Mode übertragen. Interessant ist, dass dies auch in den Selbstzuschreibungen der Mode eine Rolle spielt: Rose Bertin, die den ersten Modeladen in Paris eröffnete, nannte ihn Au grand Mogol (Zum großen Mogul). cog!to: Ist der Anzug aber nicht auch nachteilig? Männer werden ja, verglichen mit Frauen, enorm viele Möglichkeiten genommen, sich auszudrücken und gelten als verschroben, wenn sie dieser Norm nicht entsprechen. Ist es für Männer möglich, sich jenseits des Gegensatzes von Dandy und „Geistesmensch“ respektabel zu kleiden? Vinken: Ich fürchte nicht. Aber darüber gibt es in der Modetheorie aktuell Streit. Die Modetheorie wird ja meistens von dandyesken Männern gemacht. Sie bestreiten, dass die Revolution als Einschnitt, der das Verhältnis von Mode und Geschlecht strukturell veränderte, zu sehen ist. Tatsächlich ist es auch so, dass die wichtigsten Antimoden gegen eine normierende, das Individuelle löschende Kleidung aus der Männermode cog!to 07/2014 27 ben demgegenüber, dass Sie Mode „denken“ wollen, kommen. Aber warum? Weil in ihr die Norm viel stärker dass ihr Wandel Gesetzmäßigkeiten folge. und klarer ist – und gegen eine feste Norm kann man Vinken: Ja, ich habe versucht die Geschichte der leichter rebellieren und interessantere Abweichungen Mode anders zu erzählen. Ich glaube, dass diese unfinden. Der Psychoanalytiker C.G. Flügel hat an der terstellte tyrannische Arbitrarität nicht ganz richtig ist. Zäsur der „Great Revolution“ festgehalten und witzig Wenn man die longue durée betrachtet, kann man den parallel dazu den Ausdruck der „Great Male RenunciatiWandel der Mode als ein Übertragungs-, Aneignungson“ geprägt. Die große Entsagung hatte allerdings eine und Enteignungsphänomen beschreiben. Übertragen Rückseite: indem Männer das Gewand der republikaniwird vom Männlichen ins Weibliche. Es gibt eine klare schen Demokratien überzogen, setzten sie gleichzeitig Entwicklung in Richtung Ästhetik der Moderne, less is ihren Alleinanspruch auf Funktionen in der öffentlichen more, form follows function, das Kleid an sich darf nicht Sphäre durch. Frauen bekamen einen Platzverweis aus ins Auge fallen. Chanel hat von sich gesagt, sie habe ihr dem Raum der Geschichte und wurden in die PrivatheLeben lang nichts getan, als Stück für Stück die Mänit des trauten Heims verbannt. Die Sphäre von Macht, nermode der Moderne in die weibliche Mode zu überGeld und Autorität teilten die Männer unter sich. Ein tragen. Die Listen der Mode haben da aber einen Strich Verlust also durch Entsagung, ja, aber er kommt mit eidurch die Rechnung gemacht. Damit nämlich ist nicht nem großen Gewinn. entstanden, was bezweckt war, nämlich so etwas wie cog!to: Oft wird von Mode als etwas Demokratieine endlich moderne Frauenmode. Tatsächlich kam es schem gesprochen. Heute kann sich jeder anziehen zu einer Übertragung der vormodernen männlich erotiwas er will. Kommen in der Mode aber nicht auch Unschen Zonen auf den weiblichen Körper: Beine und Po: gleichheiten zum Ausdruck? immer kürzere Röcke, immer enger sitzende Hosen. Vinken: Mode wird tatsächlich immer mit Moderne Das führte zu einer Erotisierung des ganzen weiblichen und Demokratie verbunden. Vorher gab es KleiderordKörpers von der Haarlocke bis zu den Zehenspitzen. nungen und die wurden mehr oder weniger befolgt. Die Das, was die weibliche Mode ausgeMode trennte Stände. Die vormomacht hat, also die Verdeckung der derne Mode sieht sich eher als eine Ich glaube, diese unterBeine, das Zeigen des Dekolletés, Repräsentationsmode, die gesellstellte Arbitrarität ist nicht das verführerisch schamhafte Spiel schaftliche Ordnung darstellt. Deszwischen Verhüllen und Zeigen, wegen konnte man auch „Kleider ganz richtig. Wenn man die hat sich verändert. Insofern ist die longue durée betrachtet, machen Leute“ sagen, weil die Kleigrundlegende Opposition der Mode der das Sein ausdrücken sollten. Die kann man Mode als ein der Moderne – nämlich nicht-marKleidungsnormen waren damals üb- Übergangs-, Aneignungskierte Sexualität vs. markierte Serigens nicht nur Usus, sondern bis ins und Enteignungsphänomen xualität – weder gelöscht und noch 17. Jahrhundert gesetzlich geregelt. beschreiben. vermindert, sondern verstärkt. Der Das ist in der Mode der Moderne Unisex hat – unter falscher Flagge – nicht mehr so. Man weiß heute nicht die sexuelle Differenz vertieft. mehr, wie sich nun ein Herr oder eine Dame anzuziehen cog!to: Sie schreiben an mehreren Stellen Ihres hat. Es gibt kein Regelwerk. Dennoch: Eine Trennung Buches, dass die weibliche Mode immer wieder darnach sozialen Schichten hat die Männermode weitgean scheiterte, klassisch modern zu werden... hend beibehalten, ist mit white collar vs. blue collar bzw. Vinken: … scheitert – oder diese Ästhetik zersetzt. Bürger- vs. Arbeitsuniform Klassenmode geblieben. Bei Das ist die Frage. der weiblichen Mode ist das weniger evident. Bei Fraucog!to: Warum eigentlich nicht sagen: Hand aufs en definiert sich das nicht über den Arbeits-, sondern Herz – Nietzsche und die anderen Feinde der Mode eher über den Heirats-, oder den Sexmarkt. Letztlich ist haben Recht. Eigentlich ist es schade, dass die Frauauch das eine Art Klassenmode: Manche Frauen müsenmode nie modern wird. Beauvoir etwa schreibt in sen ihre Reize unmissverständlich an den Mann brinDas andere Geschlecht: „Die Gesellschaft verlangt gen, andere haben das nicht nötig und können souvegerade von der Frau, daß sie sich zum erotischen rän über ihre Reize verfügen. Objekt macht. Das Ziel der Moden, denen sie untercog!to: In Ihrem Buch referieren sie zwei sozioloworfen ist, besteht nicht darin, sie als ein autonomes gische Modetheorien. Die eine betont den „kleinen Individuum zu enthüllen, sondern sie der männlichen Unterschied“ und betrachtet Mode als ein Medium Begierde als Beute anzubieten.“ Sollten sich Frauen sexueller Reize. Die andere betont den „feinen Unnicht doch wie Männer anziehen? terschied“ und betrachtet Mode als ein Spiel mit ZeiVinken: Viele glauben ja, dass emanzipierte Frauen chen, in dem sich die höheren von niederen sozialen und geistvolle Männer besseres zu tun haben, als auf Klassen abgrenzen – und dazu mal auf kurze, mal diese oberflächliche Blödsinnigkeit Zeit zu verschwenauf lange Röcke verfallen. In diesen Theorien würde den – die in der weiblichen Mode nur dazu diene, sich Mode als ein arbiträres Spiel mit Zeichen erscheinen; zum Objekt der männlichen Begierde zu verdinglichen. was man anzieht ist nicht an sich bedeutungsvoll, Die Frage ist, ob das so ist und ich würde sagen: Nein, sondern dient der sozialen Abgrenzung. Sie schrei- 28 cog!to 07/2014 das ist natürlich nicht so. Erst mal ist kein Mensch ein autonomes Subjekt, das ist ein Fake, und bestenfalls eine Phantasie. So sehr ich Simone de Beauvoir in vielerlei Hinsicht bewundere, aber dieses Phantasma eines autonomen Subjekt, tut mir leid, das ist phallizistische Subjektphilosophie, völlig überholt. Die Mode scheint mir, tut etwas ganz anderes. Auch den Mann enthüllt sie nicht als „autonomes Individuum“. Der Anzug schafft zum einen den politischen und gesellschaftlichen Körper der modernen Republiken. Zum anderen erschafft er so etwas wie eine falsche Transzendenz. Eine Transzendenz, die ich nicht besonders erstrebenswert finde. Denn der Anzug tut auf gewisse Weise das Gleiche, was die Kleider des Königs getan haben, bloß mit anderen ästhetischen Mitteln: Er ist die Ikone der Republiken. Er schafft diesen Amtskörper, der über das Individuelle hinaus geht. Er hebt den individuellen Körper in einem Kollektivkörper auf. Damit verleugnet der Anzug das Hier und Jetzt, die Hässlichkeit, die Entstellung, das Sein zum Tod, aber auch die Schönheit, die nur jetzt ist. Der Anzug verdrängt oder verleugnet in seiner Idealisierung das, was das Menschsein ausmacht: Vergänglichkeit, aber auch die Schönheit der Vergänglichkeit, also den Moment. Der Herr im Anzug scheint ganz Herr im Haus; aber diese narzisstische, sicherlich sehr beruhigende Illusion ist mit der Psychoanalyse ein für alle mal den Bach runter gegangen; asujeti, wie Lacan sagt, ist man eben nicht Herr im eigenen Haus: Boss. Die Hingabe an den Moment, nicht alles beherrschen zu kön- nen, der Vergänglichkeit unterworfen zu sein, – all das verleugnet der Anzug. Deswegen denke ich nicht, dass der Weg so sein sollte, wie Beauvoir das denkt, nämlich dass Frauen der vom Männlichen her gedachten Subjektnorm entsprechen sollten. Ich denke, es wäre besser, dem ins Gesicht zu blicken, was unser Dasein ausmacht – und das tut die Mode. cog!to: Und wenn Beauvoir schreibt, dass die weibliche Mode verdinglichende Geschlechterperformanzen produziert, dass sich Frauen wie Dinge betrachten, an denen zu arbeiten ist, um das Älterwerden so lange wie möglich aufzuschieben – das fänden sie nicht überzeugend? Sie würden weibliche Mode anders beschreiben? Vinken: Total anders. Wenn sie sich z.B. Vivienne Westwood anschauen, dann stellt die kein erotisches Ideal her; sie ver-rückt fetischistische, verdinglichte Vorstellungen von „Weiblichkeit“. Sie zeigt, wie diese hergestellt, wie sie gemacht werden. Insofern ist Mode ein oft abgründig ironischer, zersetzender Kommentar zu Geschlechternormen. Es geht um Ent-Stellung. Sie können – mit den Kleidern von Westwood – diese verdinglichte Sexnorm neben sich her tragen, ohne sie verkörpern zu müssen. Sie tragen die Differenz zwischen idealer Norm und ihrem individuellen Körper spazieren. Und das ist etwas, das alle interessante Mode, egal ob Sie Gaultier, Westwood, Rei Kawakubo oder Margiela nehmen, macht. Deswegen wäre es eine gute Idee, einfach mal besser hinzugucken. Dann würde man auch Anzeige Matthias Jung Gewöhnliche Erfahrung 2014. XI, 234 Seiten. ISBN 978-3-16-152483-7 fadengeheftete Broschur € 49,– Gewöhnliche, unmethodische Erfahrung formt unser Leben. Sie vollzieht sich, wenn wir als lebendige Wesen mit unserer Umwelt interagieren, und verbindet jeweils kognitive, affektive und willentliche Dimensionen. Fragen nach Sinn und Wert und Wissensfragen sind in ihr eng aufeinander bezogen. Normativ hat die Kultur der Moderne die Erfahrung gewöhnlicher Menschen enorm aufgewertet, doch gleichzeitig wird unsere Welt immer stärker von der methodischen Erfahrung der (Natur-)Wissenschaften und der von ihr ermöglichten Technik bestimmt. Ersetzt nun wissenschaftliche die gewöhnliche Erfahrung oder ergänzt und korrigiert sie diese? Wie verhalten sich Fakten und Werte zueinander und was ergibt sich daraus für unser Verständnis von Demokratie? Matthias Jung entwickelt zunächst ein integriertes Konzept gewöhnlicher Erfahrung und nimmt dabei Einsichten u. a. aus Hermeneutik, Phänomenologie, Pragmatismus und Kognitionswissenschaften auf. Daraus ergeben sich drei exemplarische Problemfelder: Wissen, Werte und Weltanschauung. Ihnen sind jeweils eigene Kapitel gewidmet. Mohr Siebeck Tübingen [email protected] www.mohr.de Maßgeschneiderte Informationen: www.mohr.de cog!to 07/2014 29 von diesen Vorstellungen – Loos etwa spricht von Mode als „schrecklichem Kapitel der Kulturgeschichte“ – loskommen. Die Mode ist nämlich nicht nur eines der reizendsten, sondern eines der geistreichsten Kapitel der Kulturgeschichte. (lacht) Sie hat unglaublichen Witz. Im Übrigen reduziert diese Vorstellung die Mode auf vollkommen vereinfachte Reiz-Reaktion-Schemata des Behaviourismus, lange Beine, blonde Haare etc., Auslöser für bedingte Reflexe. cog!to: Karl Lagerfeld hat einmal gesagt: „Jemand, der eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren.“ In ähnlicher Richtung schreiben Sie, dass Funktionskleidung noch nicht einmal dazu tauge richtig hässlich zu sein. Woher diese Abneigung? Vinken: Ausnahmsweise bin ich da mal mit Karl Lagerfeld einverstanden. Wissen Sie, das ist in etwa so wie mit der Sprache. Man kann schön sprechen und man kann langweilig platt, hässlich sprechen. Es ist besser, man spricht nicht langweilig platt. Eine Jogginghose zu tragen ist so wie hinter jedem Satz selbstbestätigend und selbstvergewissernd „genau“ zu sagen. cog!to: Sie schreiben, dass Jogginghosenträger die Stadt nicht mehr als Salon oder als Fläche, auf der man sich zeigt und zugegen ist, wahrnehmen, sondern als eine Art Parcours, den es möglichst bequem und effizient zu durchqueren gilt. Vinken: Die Verleugnung des öffentlichen Raumes bestimmt die Art, wie wir uns kleiden, sehr stark. Die Monade im survival camp ist eine offenbar verbreitete Vorstellung: „Die anderen sind zu viel, die sollten da besser weg. Ich will hier durch und ich will die auch nicht sehen, und was machen die denn da“ – they’d better vanish. Ich glaube, dass es bei Mode eher um so etwas geht wie Höflichkeit. Mode eröffnet einen Raum, in dem man sich begegnen kann, in dem man nicht sagt, wir wollen uns eigentlich gar nicht begegnen, weil was ich hier tue ist Selbstbehauptung und was du hier tust ist auch Selbstbehauptung. Then what? Dick waiving, very boring. Das ist so etwas wie Ausradieren des öffentlichen Raumes, Negation der Blicke. Sagen wir, dass das nicht eben eine wirklich anziehende Vorstellung ist. cog!to: Wir haben uns gefragt, warum Mode selten Gegenstand philosophischer Betrachtung wurde. Und wenn sich Philosophen dann doch einmal mit Mode beschäftigten, wurde sie wie z.B. bei Nietzsche als schöner Schein betrachtet, der von der Wahrheit ablenkt – tiefgründiger Betrachtung unwürdig. Woher diese Vorbehalte? Ist die Ablehnung der Mode vielleicht auch „typisch deutsch“? Vinken: Die deutschen Philosophen haben die Subjektphilosophie, von der Psychoanalyse dann vom Tisch gewischt, maßgeblich verbrochen. Das protestantische, bürgerliche, deutsche 19. Jahrhundert des selbstredend männlichen Bildungsbürgers war maßgeblich an der Konstruktion der Mode als einer orientalischen Kolonie beteiligt. Es gibt natürlich Vorläufer wie Rous- 30 cog!to 07/2014 seau und Republikaner wie Emile Zola, die den selben Topos ausgearbeitet haben. Sie können das übrigens auch heute noch in ihrem Fach sehen, etwa bei der Reaktion der deutschen Philosophie auf Bewegungen wie Dekonstruktion oder Poststrukturalismus: Man spricht von leerem Wortgeklingel, nichtssagendem, aber trügerisch verführerischem Oberflächenspiel; signifikantenverliebt. Das gehe nicht in die Tiefe und sei ethisch irrelevant, wenn nicht gar gefährlich. Man sollte in Rechnung stellen, dass diese Topoi einen erstaunlichen Beharrungscharakter haben. Die prägen unsere Art die Dinge zu sehen, oft über Jahrhunderte hinweg. Hinter unserem Rücken, wie Gadamer das sagte, bestimmen diese Gemeinplätze unser Denken. Man kann das vielleicht auch so beschreiben: Nachdem in Frankreich die Bourgeoise eher aristokratisch geprägt wurde, ist auch das Weibliche nicht ganz ausgerottet worden, was immer ein auf das Erscheinen hin ausgerichteten Moment hat. Das wird eher wertgeschätzt, als dass es automatisch mit Verachtung oder Geringschätzung, aber auch Angst und Ambivalenz, bedacht wird. cog!to: Welchen Einfluss auf die Mode haben Religionen? In romanisch-katholisch geprägten Ländern wird, hat man den Eindruck, mit Mode anders umgegangen wird als im protestantischen Kulturkreis. Vinken: Das Misstrauen gegen eine kosmische Ordnung, der der Mensch zum Schmuck und zur Zierde gereicht, ist in protestantischen Kulturen ohne Zweifel stärker ausgeprägt als in katholisch beeinflußten Kulturen. Die sich in ihrer Schönheit zeigende Welt wird als täuschendes Blendwerk begriffen; es gilt, hinter den schönen Schein zu sehen. cog!to: Die Theoretiker die Mode als arbiträres Spiel mit Zeichen betrachten, das Klassen- oder Geschlechtsgegensätze medialisiert, konzipieren auch immer ein Ende der Mode, das erreicht würde, wenn die Klassen oder Geschlechtsgegensätze überwunden sind. Loos witzelte in einem Vortrag von 1927 einmal, dass dank der „amerikanischen Weltherrschaft“ bald der Overall eingeführt werde, der dann auch die Festkleidung sein wird. Vinken: Der Overall war ja mal in Mode, und wissen Sie, wer den am meisten nach vorn brachte? Die konstruktivistischen Designer in der Sowjetunion der 1920er Jahre. Es ist aber – Loos wird das erleichtern – nicht allbeherrschend geblieben. Mode inszeniert und performiert durchaus Identität und Authentizität; gleichzeitig stellt sie diese aber auch als etwas Gemachtes aus. Man könnte sagen: Sie nimmt das alles ein bisschen auf den Arm. Und daran ist offensichtlich etwas Lustvolles, das uns sehr gefällt und von dem wir nicht lassen wollen. Diese Lust verhindert, dass wir jetzt hier im Overall sitzen – und man kann ja nur sagen: Gott sei Dank, oder? Obwohl man einwenden könnte: kommt immer drauf an, welcher Overall. Die Utopie einer modelosen Gesellschaft ist, scheint mir jedenfalls, überholt. Im Moment steht die Frage im Mittelpunkt, was mit dem Anzug passiert und ob sich darüber das Die Zeit ist eine Fassade Geschlechterverhältnis ändert. Interessanter als die Frage nach einem Ende der Mode ist, denke ich, die Frage, ob eine Mode wie etwa die des Dandys oder die Antimoden, die aus der männlichen Mode kommen, Mainstream werden könnten. Das heißt, ob wir die Geschlechterordnung der Moderne hinter uns lassen. Das würde, wenn es gut geht, mehr Mode heißen. (lacht) But only God knows. cog!to: Zum Schluss eine persönlichere Frage: Sie wurden einmal vom Monopol Magazin die „glamouröseste Professorin Deutschlands“ genannt. Wird man in der glamourfernen deutschen Universität mit einer Lust an Mode manchmal belächelt oder schief angeguckt? Vinken: Je n´y pense pas. cog!to: C´est bien. Foto: Kurt Rade Das Interview führten Fabian Heinrich und Miguel de la Riva Hermann Schmitz Phänomenologie der Zeit 336 Seiten. Gebunden € 29,– ISBN 978-3-495-48627-6 Anzeige Barbara Vinken ist seit 2004 Professorin für Allgemeine und Französische Literaturwissenschaft an der LMU München. Sie interessiert sich gerade, wie sie sagte, für Schneeberge über südlichen Seen und überhaupt alles Romanische. Zu ihren letzten Buchveröffentlichungen zählen „Flaubert – Durchkreuzte Moderne“ (Frankfurt 2009) sowie „Bestien – Kleist und die Deutschen“ (Berlin 2011) . Gerade überlegt sie, ob Deutschland ein Land für Frauen ist. Mode interessiert sie von Kindesbeinen an; ihre Mutter war Designerin. Fabian und Miguel gestehen, dass sie vor dem Interview mit einer Modetheoretikerin überlegten, was sie bloß anziehen sollten. Letztlich verfielen sie auf den Klassiker: weißes Hemd und dunkle Stoffhose. Im üblichen Verständnis gilt die Zeit als Rahmen und Ordnungsform des Geschehens. Die phänomenologische Betrachtungsweise gräbt tiefer bis zu den Schichten der Zeit, die für Identität, Subjektivität, Einzelheit und die Welt (im bestimmten Singular) benötigt werden. Zu Beginn der Untersuchung wird unter anderem die ursprünglich intensive Natur der Dauer und der Überschuss der offenen Zukunft über die geschlossene aufgedeckt. Anfang und mögliches Ende der Zeit und deren Aporien werden ebenso behandelt wie die Zeitform des Ganges der Geschichte. Ein ausführliches Schlusskapitel sichtet die Geschichte der Zeit in den Händen der Philosophen. B cog!to 07/2014 VERLAG KARL ALBER 31 Weshalb du mir nicht sagen kannst, wer du wirklich bist Erving Goffman im Portrait Von Stefan Joller Während einige das Leben extrovertierter Superstars führen und spätestens nach ihrem Ableben im Dunst der Popkultur verschwinden, machen es andere anders. Erving Goffman (1992-82) lebte als Marginal Man und avancierte nach seinem Tod zum Superstar der Soziologie: International bekannt, viel zitiert, verehrt von den Einen und verachtet von den Anderen. Mit seinen feinen Analysen des Alltags veränderte er nicht nur die Soziologie, sondern ebenso das Selbstverständnis seiner Leserschaft. E rving Goffman in der Rubrik Personenkult zu portraitieren, entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Nur wenige Wissenschaftler von seinem Format erwehrten sich derart systematisch der öffentlichen Darstellung. Es existieren gerade einmal eine Handvoll Interviews, in denen er dann auch noch betont, dass Vorstellungen von wissenschaftlicher Arbeit nicht durch Fragen an den Autor, sondern an dessen Texte geschaffen werden sollten. Hinzu kommt mit der medial vermittelten Portraitierung eine soziale Praxis, die zwar zweifelsohne zum öffentlichen Bild einer Person beiträgt, für die sich Goffman aber doch herzlich wenig interessierte – seine Faszination galt der Interaktion von Angesicht zu Angesicht. Bekannt wurde Goffman vor allem durch seine viel zitierte Theatermetapher, die heute in keiner soziologischen Einführung mehr fehlt. Bereits in seiner ersten Monografie The Presentation of Self in Everyday Life (1959; dt.: Wir alle spielen Theater) gibt sich sein charak- 32 cog!to 07/2014 teristischer Forschungs- und Darstellungsstil zu erkennen. Eine scharfe Beobachtungsgabe in Verbindung mit einer eingängigen Sprache, in der er Busfahrten oder Warteschlangen ihrer vermeintlichen Trivialität entledigt. Nach wie vor erhitzen seine Texte die Gemüter von Fachkollegen, Nachbardisziplinen und populärwissenschaftlichen Rezipienten, die darin entweder einen der bedeutendsten Soziologen des 20. Jahrhunderts oder aber die Verkörperung impressionistischer Beliebigkeit erkennen. Obschon sich Goffman kaum an kritischen Diskussionen seiner Schriften beteiligte, finden sich immer wieder Stellen, an denen er oft humorvoll – teils als überheblich attestiert – kritische Argumente aufgreift, nur um die eigene methodologische Position hochzuhalten: „Sicherlich sind viele dieser Daten von zweifelhaftem Wert, und auch meine Interpretationen – zumindest einige – mögen fragwürdig sein, aber ein tastender und vielleicht großzügiger spekulativer Ansatz zur Erforschung eines fundamentalen Verhaltensbereichs erscheint mir besser zu sein als totale Blindheit ihm gegenüber“ (Goffman 2009: 20). Mit ebensolch scharfsinniger Leichtigkeit referiert Goffman auch gerne zunächst unsystematische Beobachtungen, ohne sich in umfassenden Erklärungen der Datengrundlage zu ergehen. Nirgends erfolgt dies aber unreflektiert und grundlos. Diese stete Reflexion knüpft an die fallibilistische Haltung des amerikanischen Pragmatismus an, der Goffman durch seine Zeit an der Universität Chicago und dem Kontakt zu der äußerst prominenten Chicago School of Sociology prägte. Die urbanen Studien aus Chicago, die ohne Berührungsängste unterschiedlichste Subkulturen durch teilnehmende Beobachtung er- schließen, gingen auch an Goffman nicht spurlos vorbei. Deutlich ist diese ethnografische Ausrichtung in seinen oft mehrere Monate dauernden Feldforschungen wiederzuerkennen: Bei den Bewohnern der kleinen Shetland-Insel Unst (1959), in einer psychiatrischen Klinik (1961; 1963) oder auch in den Spielcasinos von Las Vegas (1967). Wenn Goffman also alltägliche Interaktionen mit Hilfe von Begrifflichkeiten wie jenen des Rollenspiels, der Rollendistanz, der Vorder- und Hinterbühne oder der Selbstdarstellung analytisch durchdringt, so verweist dies weniger auf einen pathetischen Ausruf der Welt als großer Bühne, denn auf Erkenntnisse seiner Studien, die selbst wiederum zur Analyse des Alltags genutzt werden können. „Wir alle spielen Theater“ - Über die Dramaturgie des Alltags Das Theater beginnt sobald „ein Einzelner mit anderen zusammentrifft“ (Goffman 1969: 5). In diesem Sinne lässt Goffman keinen Zweifel an seiner soziologischen Grundhaltung in der Tradition Georg Simmels. Wie ist Gesellschaft möglich? lautet die basale Frage, deren Beantwortung nicht das Individuum, sondern die soziale Situation fokussiert. Denn hier treffen die Darstellungen der Einzelnen auf die Erwartungen eines Publikums, welches stets interpretierend und mitunter intervenierend seinen Teil zur Aufführung beiträgt. Rollenverteilungen sind folglich dynamisch, soziale Situationen fragil und das Publikum selten nur ein Publikum. Stärker noch als im ‚echten‘ Theater sind die Rollen der Darsteller direkt von den Rückmeldungen des Publikums abhängig und können sich nicht auf die Sicherheit eines Skripts verlassen. Gelungene Darstellungen hängen sodann nicht nur von der Fähigkeit Einzelner ab, ihre verbalen und non-verbalen Ausdrucksmöglichkeiten in Abgleich mit gegebenen Requisiten und dem Bühnenbild zu kontrollieren. Ebenso bedeutend hängt das Gelingen von der Bereitschaft des Publikums ab, die dargebotene Rolle und die Inszenierungsleistung als solche zu bestätigen und damit sozial zu festigen. So versucht der Einzelne durch den Ausdruck, den er sich selbst gibt (face-work), beim Publikum wiederum Ausdrücke hervorzurufen, die seine Darstellung und somit sein Image (face) in actu bestätigen. Da das Publikum jedoch weiß, dass die Darsteller jeweils an einer idealisierten Selbstdarstellung arbeiten, wird es aufmerksam beobachten und so den Raum der Selbstinszenierung begrenzen. Aktive Intervention ist dazu meist nicht einmal nötig – bereits die Wahrnehmung der Blicke des Publikums wirkt hier disziplinierend. Goffman geht es aber nicht um einen steten Inszenierungs- und Entlarvungskampf unter Hobbesschen Wölfen. Im Anschluss an Émile Durkheim ([1912] 1994) verweist er auf den grundlegenden Willen zur Wahrung der expressiven Ordnung, deren rituelle Pflege die Handelnden voreinander schützt. Entsprechend vielfältig sind die Techniken Unpassendes zu übersehen oder zu überhören, um die Situation nicht unnötig zu gefährden. Doch auch wenn die Dramaturgie des Alltags nicht grundlegend vom Kampf aller gegen alle geprägt ist, nimmt Goffman das Spiel der Inszenierung nicht weniger ernst. Das Blut fließt zwar (meist) nur metaphorisch, auf der Bühne der Interaktion werden aber dennoch (soziale) Existenzen verhandelt. Inszenierungen entfalten ihre kreativen Räume demnach nicht zwischen Todesangst und Mordlust, sondern im spielerischen Umgang mit Requisiten und Rollenerwartungen. Die Publikumserwartungen an die Rolle dürfen jedoch nicht vollständig enttäuscht werden, da sonst die Aberkennung der Rolle und somit die Gefährdung der expressiven Ordnung droht. Zugleich wird bei allzu schematischer Erfüllung der Rollenerwartungen das Image der Darsteller leicht auf die aktuelle Rolle reduziert. So ist die in der Einführungsvorlesung strikt Folien referierende Person auf dem Podium des gefüllten Audimax voll und ganz Dozent – nicht weniger, aber eben auch nicht mehr. Die Inszenierung einer gewissen Rollendistanz kann über unterschiedliche Formen und Intensitäten des Engagements kontrolliert werden und subtil auf das ‚Mehr‘ verweisen, welches die Rolle per se nicht bietet. Zwar wird das Kernengagement durch die eingenommene Rolle vorgegeben: Der Dozent referiert über Forschungszusammenhänge und nicht über seinen favorisierten Biergarten. Doch Nebenengagements, wie das zeitgleiche Bereitstellen eines Wasserglases, helfen den Eindruck zu erwecken, der Darsteller werde nicht vom eisernen Griff der situativen Erfordernisse paralysiert. Rollendistanz meint also nicht das Ausbrechen aus einer Rolle, indem der Dozent ausschließlich private Anekdoten zum Besten gibt, sondern dass er private Anekdoten scharf auf die zuvor behandelte Problematik zurückführt und so im souveränen Spiel mit den Rollenerwartungen über die Rolle als Dozent hinauswächst. Zwischen Manipulation und Inszenierungszwang Stellt Goffman die Gesellschaft also unter Generalverdacht, wenn sich Jede und Jeder um vorteilhafte Selbstinszenierung bemüht? Ja – aber nicht im Sinne eines darstellerischen anything goes oder einer Omnipräsenz gezielter Manipulation. Natürlich ist Täuschung möglich. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Situationsdefinition allein dem Darsteller obliegt. Selbst wenn er seinen Ausdruck in manipulativer Absicht zu kontrollieren versucht, sind die Routinen zur Entlarvung berechneter Spontaneität weitaus ausgereifter als jene der Manipulation. Gleichviel ob es sich dabei um Blicke auf Hinterbühnen handelt, auf denen Darstellungen vorbe- cog!to 07/2014 33 reitet werden und Hochstapler vor ihrem Galaauftritt ein breites Lächeln aufsetzen, oder aber um das Gefühl, der schicke Anzug passe nicht so recht zu dem gerade etwas groß geratenen Schluck aus dem Weinglas. Goffman begründet die Unmöglichkeit der vollständigen Ausdruckskontrolle nicht anthropologisch durch unser animalisches Erbe, sondern über die sozialen Rahmen (frame), die der Darstellung zwingende (aber nicht statische!) Gesetze vorgeben. Diese Anbindung der Techniken der Imagepflege an situative Rahmen begrenzt den Spielraum des Einzelnen und macht zugleich auf die Notwendigkeit der Deutung aufmerksam. Jeder Einzelne muss sich fragen, was in der gegenwärtigen sozialen Situation vor sich geht. Denn nur durch diese Interpretation hat er die Chance sich angemessen zu verhalten. Selbstinszenierung ist also nicht das Handwerk der Trickdiebe, Bauernfänger und Hochstapler, sondern das Schicksal eines jeden interagierenden Individuums. Die Frage nach dem Echten, dem Authentischen, der wahren Identität, dem Maskenträger hinter der Maske, verweist auf das Problem, dass in sozialen Situationen immer nur ein Teil individueller Selbstwahrnehmung eine Bühne findet. Dieses Gefühl der stets bloß fragmentarischen Entfaltung in Gesellschaft nährt gleichzeitig das Verlangen, den sozial sichtbaren Teil des Gegenübers auf das Verborgene hin zu befragen und so die Maske zu entfernen. Während der Wegbereiter der Chicago School William James ([1890] 2010) und später auch Georg Herbert Mead ([1934] 1967) noch Identitätskonzepte entwarfen, die sich mit der Relation von Innenwelt und Außenwelt beschäftigen, vertritt Goffman hier eine radikal soziologische Position. Vor dem Hintergrund der Selbstwahrnehmung als (mehr oder minder) kohärenter Entität und der Schwierigkeit dieses positive Gefühl sozial einzulösen, fokussiert Goffman die soziale Dimension der Identität. Diese für Goffman typische Herangehensweise verleitet ihn zur provokanten These, dass im besten Falle nicht dem Darsteller, sondern der dargestellten Rolle ein Image zugeschrieben wird. Das Image ist also nicht die darstellende Person selbst, sondern dramaturgische sowie dramatische Wirkung ihrer Selbstdarstellung in einer sozialen Situation – und dadurch stets nur eine Leihgabe der Gesellschaft (Goffman 1969: 231). Die Frage, ob nun eine Darstellung authentisch ist, beantwortet Goffman aus pragmatischer Perspektive: Mit James fragt er nicht danach was wirklich ist, sondern was wirklich wirkt. In diesem Sinne kann eine Darstellung Authentizität einfordern, wenn im Wechselspiel von Rollenerfüllung und Distanz die Abweichungen als konsistent und unkontrolliert erscheinen – ob diese jedoch tatsächlich unkontrolliert erfolgten, wird pragmatisch eingeklammert. Wenn das Image also sozial konstruiert wird und sich die Selbstwahrnehmung in sozialer Interaktion auf diese Leihgabe beziehen muss, dann steckt im Verlangen nach Authentizität der Wunsch nach einer Wirklichkeit, die nur in ihrer sozialen Interpretation erfahrbar ist – oder in den Worten Goffmans: „Es besteht also ein statistisches und kein inhärentes Verhältnis zwischen Erscheinung und Wirklichkeit“ (ebd.: 66). Literatur Von Stefan Joller Durkheim, Émile. [1912] 1994. Die elementaren Formen des religiösen Lebens. Frankfurt a.M.: Suhrkamp. Goffman, Erving. 1959. The Presentation of Self in Everyday Life. New York: Doubleday & Company Inc. –––––. 1961. Asylums. Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates. New York: Doubleday Anchor Books. –––––. 1963. Stigma. Notes on the Management of Spoiled Identity. Englewood Cliffs: Prentice-Hall. –––––. 1967. Interaction Ritual: Essays on Face-to-Face Behavior. New York: Doubleday Anchor Books. –––––. [1959] 1969. Wir alle spielen Theater. 5. Auflage, München: R.Piper & Co. Verlag. –––––. [1963] 2009. Interaktion im öffentlichen Raum, Frankfurt a.M.: Campus. James, William. [1890] 2010. “The Self and Its Selves”, in: Lemert, Charles (Hrsg.). Social Theory, S. 161-166. Boulder: Westview Press, Mead, Georg Herbert. [1934] 1967. Mind, Self, and Society from the Standpoint of a Social Behaviorist. Herausgegeben von Charles W. Morris. Chicago: University of Chicago Press. Stefan Joller ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Soziologie der Universität Koblenz-Landau. Er studierte von 2005-2011 in Luzern und Konstanz Soziologie mit Schwerpunkt Organisations- und Wissenssoziologie und trat im Anschluss eine Stelle an der Universität Magdeburg an. Derzeit promoviert er über die mediale Inszenierung öffentlicher Akteure im dynamischen Feld der Skandalberichterstattung. Erving Goffman lernte auch er in einer Einführungsvorlesung kennen und stellte bald fest, dass dies nicht der erste und letzte Kontakt bleiben sollte – weder im privaten noch im wissenschaftlichen Alltag. 34 cog!to 07/2014 RUBRIK SCHULENSTREIT Im Schulenstreit wird zu kontroversen Themen in der Philosophie Stellung bezogen. Ulrich Metschl, Erasmus Mayr und Stephan Sellmaier gewannen wir diesmal dafür, die Frage zu erörtern, ob man sein kann, wer man will. cog!to 07/2014 35 Kann man sein, wer man will? Von Zwiespalt, Lebenslügen und Bedauern Von Ulrich Metschl Es gilt als ausgemacht, dass es dem modernen Subjekt offen steht, sich stets selbst neu zu erfinden. Doch unabhängig davon, ob man mit dieser Aussicht eher eine Chance oder eine Drohung verbinden will, erscheint eine solche Auffassung nicht nur der gemeinen Lebenserfahrung als übertrieben. Die Vorstellung, es könne eine voraussetzungsfreie Wahl der eigenen Ziele und Pläne ohne Risiko geben, ist für die Ethik und die Entscheidungstheorie erst recht fragwürdig. D ie Geschichte, die Ford Madox Ford seinen Helden John Dowell in dem Roman The Good Soldier erzählen lässt, mag, wie Fords ursprünglich vorgesehener Titel lautet, in der Tat „die allertraurigste Geschichte“ sein. Sie handelt von Freundschaft, Liebe, Verrat und der tragischen Verstrickung in die gesellschaftlichen Konventionen der englischen und neuenglischen Oberschicht in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg. Aber das Unheil, von dem Dowell berichtet, entfaltet sich nicht ganz mit der unausweichlichen Schicksalhaftigkeit einer griechischen Tragödie. Dowells Schuld, ohne welche eine Tragödie bekanntlich nicht zu haben ist, liegt in seiner Weigerung, den Tatsachen in Gestalt seiner ihn jahrelang hintergehenden Gemahlin Florence sowie dem schwächlichen Charakter des befreundeten Edward Ashburnham, der seiner Sentimentalität nicht Herr wird, ins Auge zu sehen. Kein übermächtiges Schicksal ist es, das die beteiligten Personen ins Verderben zieht, sondern ein grotesker Mangel an Willen zu Aufrichtigkeit seitens Dowells selbst. Sollte Unwissenheit tatsächlich ein Segen sein, dann hat John Dowell jedenfalls gründlich missverstanden, wie das gemeint sein könnte. Am Ende der Geschichte, nachdem sich nicht nur seine Gattin Florence das Leben genommen hat, sondern auch ihr Liebhaber Edward, findet sich Dowell einsam auf Edwards Landsitz wieder, nur noch der Pflege 36 cog!to 07/2014 der der geistigen Umnachtung anheimgefallenen letzten Geliebten Edwards verschrieben. Doch obwohl er sich schließlich der Wahrheit nicht mehr verweigern kann, bleibt die Frage offen, was Dowell tatsächlich wann gewusst haben könnte und wie groß sein Anteil an den schuldhaften Verstrickungen ist. Hätte er sich entscheiden können, die Dinge, die da über neun Jahre vor sich gingen zwischen Florence und Edward, früher zu wissen? War es gar eine willentliche, wenn auch nicht ganz bewusste Entscheidung, es lieber nicht zu wissen? Wäre es ihm nicht überhaupt ein Leichtes gewesen, entschlossen sein Schicksal in die Hand zu nehmen und Herr über das eigene Leben zu werden? Es bedarf jedenfalls einigen Wohlwollens, um Dowell nur in einem Zwiespalt gefangen zu sehen zwischen treuer Ergebenheit, gesellschaftlicher Konvention und einem klein bisschen Mut zur Ehrlichkeit, ein Zwiespalt, in dem er sich unseligerweise meistens für das Falsche entschied. Dowell ist kein Mann, dem man in der ganzen Geschichte recht trauen kann. Den Leser beschleicht mehr als nur ein vages Gefühl, dass ausgerechnet er der größte Schurke in dem ganzen Stück gewesen sein könnte. Wie immer sein Charakter am Ende zu bewerten ist, und der aristotelischen Idee der Tugendhaftigkeit als vernunftgemäßer Lebensform wird er sicher nicht gerecht – es bleibt der Eindruck eines Mannes, der gefangen in Konflikten zwischen Wahrhaftigkeit und Rücksichtnahme, zwischen blanker Indolenz und Selbstbeherrschung sein Leben verfehlt. Konflikt und moralische Entscheidung Konflikte wie diese, so hat uns John Dewey gelehrt, sind das Korn für die Mühlen der Ethik (Dewey & Tufts 1932). Zu welchem Zweck aber diese Mühlen betrieben werden, ist Gegenstand philosophischer Auseinandersetzung. Wer an aristotelische Tugenden glaubt, tut sich mit einem Urteil über Dowells moralisches Versagen noch vergleichsweise leicht. Wer auf der Autono- mie des Individuums besteht, die mit realen Möglichkeiten, das eigene Leben wählen zu können, einhergehen muss, tut sich schon schwerer. Sartre etwa, der Dewey, was die Rolle von Konflikten betrifft, zunächst nicht widersprochen hätte, war der Ansicht, dass das zur Freiheit regelrecht verurteilte Individuum im moralischen Konflikt den Moment findet, sein eigenes Wesen zu bestimmen (Sartre [1946] 1989). Doch diese Absage an jedes vorgängig bestehende Gefüge von moralischen Normen und Werten wäre Dewey zu weit gegangen. Für ihn war ein moralischer Konflikt vielmehr der Anlass, eine Art ethische Forschung anzustrengen. Notwendig wird eine entsprechende Untersuchung, weil die unter situativen Gegebenheiten in einen moralischen Konflikt führenden Normen und Werte mit eben diesem Konflikt ihre handlungsorientierende Funktion verloren haben. Für handelnde Personen bedeuten moralische Konflikte eine praktische Verunsicherung. Eine erfolgreiche Untersuchung würde daher mit einer Neuordnung des Wertegefüges enden müssen, die uns genauer über Reichweite und Anwendungsbedingungen der uns leitenden Normen informiert, deren uneingeschränkte Vereinbarkeit zuvor unkriAlbrecht Dürer (1471-1528), Melencolia I, 1514. Kupferstich, 24,1 x 19,2 cm. tisch unterstellt worden war. Deweys pragmatisches Bemühen um Problemlövoraus. Diese sind, als Grundlage nicht nur ethischer sung scheint bescheiden im Vergleich zu Sartres VorBeurteilungsmaßstäbe, ihrerseits nicht immun gegen stellung, sich im Akt der Wahl selbst erfinden zu könRevision. Deweys Anspruch, dass moralische Konflikte nen. Und doch kann bei genauerer Betrachtung eher bei durch eine ganz dem Geist neuzeitlicher Wissenschaft Dewey als bei Sartre von einer Wahl oder Entscheidung verpflichtete Untersuchung des Verhältnisses von Fakim eigentlichen Sinne die Rede sein. Dem jungen Mann ten und Normen (sowie des Verhältnisses der Normen in Sartres Beispiel, der sich im besetzten Frankreich untereinander) behoben werden können, wäre unplauzwischen dem Widerstand gegen die Naziherrschaft sibel ohne die Möglichkeit, moralische Normen hinterund dem Beistand für seine Mutter entscheiden muss, fragen und gegebenenfalls revidieren zu können. Die kann nichts geraten werden, weil es für diese Wahl Konflikte, in die sich Fords Antiheld Dowell verwickelt keine vorgängigen oder gar objektiven Kriterien gibt. sieht, und zwar die moralischen ebenso wie die epiDoch Sartres Versuch, diesen Voluntarismus hinterher stemischen, welche die Frage betreffen, was er wann durch die zuversichtliche Erklärung moralisch einzufanhätte wissen oder glauben müssen, sind ein Beleg gegen, dass mit jeder derartigen Wahl zugleich die Idee rade dafür, dass seine normativen Maßstäbe moralisch der Menschheit ihre Bestimmung erfährt, verleiht dem überprüft werden sollten. Existenzialismus vielleicht eine humanistische Note, sie Die Kritisierbarkeit von Entscheidungskriterien ist ist aber wenig hilfreich für Zwecke der praktischen Entdaher auch ein Hinweis darauf, dass Handlungen, die scheidungsfindung. der kritischen Selbstreflektion nicht stand halten, nicht Entscheidungen, auf eine nicht voluntaristische nur als Ausdruck von Willensschwäche gewertet werWeise verstanden, sind nicht voraussetzungsfrei. Als den sollten, bei der das erkanntermaßen Richtige aus Resultante aus situativer Einschätzung und einer Beurpsychologischen Gründen vordergründig verlockendeteilung der Optionen bzw. ihrer Folgen nach ihrer Quaren Optionen unterliegt. Doch wie Deweys Beispiel des lität oder Wünschbarkeit setzen sie normative Kriterien Bankangestellten, der der Versuchung Gelder zu verun- cog!to 07/2014 37 „Normen und Werte erweisen sich als etwas den jeweiligen Akteuren von außen Vorgegebenes – dergestalt extern bestimmte Grenzen schränken den Raum ein, innerhalb dessen ein Individuum zum Autor seiner selbst werden kann“ treuen nachgibt, klar veranschaulicht, ist Willensschwäche zwar ein psychologisches Phänomen, wirft aber keine genuin ethischen Fragen auf. Denn was am Handeln des Bankangestellten moralisch falsch ist, steht ganz außer Frage, und zwar auch für diesen selbst. Nun ist der Umstand, dass die Kriterien der individuellen wie übrigens auch der öffentlichen Entscheidungsfindung für revidierbar erklärt werden, kein Zugeständnis an Sartres Idee von Wahlfreiheit. Anpassungen, die im Gefüge der uns orientierenden Normen und Werte vorgenommen werden, dienen der Wahrung der Stimmigkeit, die mit der Kohärenz präferenzieller Ordnungen veranschaulicht werden kann. Doch auch dieser systematische Zweck ist instrumentell und ordnet sich dem Ziel der praktischen Orientierung unter. Ein lächerliches Streben nach Konsistenz mag, wie Ralph Waldo Emerson einst kühl bemerkte, der Nachtalb von Philosophen und anderen kleinen Geistern sein – doch auch wer größer denkt, kommt an kritischer Selbstüberprüfung nicht immer vorbei. Wo die Vereitelung eigener Ziele und der Verrat an den eigenen Interessen drohen, wird jedenfalls die Kohärenz der Normen und Werte, denen sich eine Person verpflichtet sieht, zu einer nicht bloß akademischen Aufgabe. Die zeitgenössische Ethik allerdings hat den moralischen Konflikt vorwiegend in einer anderen Weise gedeutet und zwar insbesondere als tragisches Dilemma, aus dem es kein schuldfreies Entkommen gibt.1 Ob Antigones Wahl zwischen Gehorsam gegen den König und ehrendem Gedenken ihres Bruders oder andere Beispiele tragischer Konflikte aus der Literatur, für die Moralphilosophie markierten solche Dilemmata vor allem das Ende der praktischen Vernunft. Grenzen des sich selbst Erfindens Wer sich in einem nicht nur scheinbaren Konflikt zwischen Alternativen entscheiden muss, für den gibt es, so eine verbreitete Auffassung, insofern keine richtige Wahl, weil keine Entscheidung allen normativen Anforderungen gerecht wird. Wie auch immer sich Antigone entscheidet, sie wird unweigerlich eine ihrer Pflichten 1 Siehe Bernard Williams (1973) sowie (1981). Andere Autoren mit einer verwandten Auffassung von moralischen Konflikten sind B. van Fraassen oder R. Barcan Marcus. 38 cog!to 07/2014 verletzen. Soweit eine handelnde Person von der Gültigkeit solchermaßen kollidierender Verpflichtungen bzw. konfligierender Normen überzeugt ist, kann sie den Konflikt nur im Bewusstsein einer tragischen Verstrickung, zumindest aber mit Reue und Bedauern hinnehmen. Anhänger der Möglichkeit genuiner moralischer Konflikte sehen in der vermeintlichen Inkonsistenz moralischer Verpflichtungen mitunter ein Argument gegen einen naiven ethischen Realismus. Unabhängig davon aber erweisen sich Normen und Werte als etwas den jeweiligen Akteuren von außen Vorgegebenes – und dergestalt extern bestimmte Grenzen schränken dementsprechend den Raum ein, innerhalb dessen ein Individuum zum Autor seiner selbst werden kann. Wieder veranschaulicht John Dowell das Gemeinte: könnte er ganz der sein, der er sein wollte, wie käme es dann je zum Gefühl des tragischen Scheiterns an den Aufgaben und Verpflichtungen als Freund, als Ehemann, ja sogar als Person in ihrer Würde? Unter Bezug auf Deweys Ethik hat Isaac Levi (1986) in dieser Hinsicht allerdings Zweifel angemeldet. Moralische Konflikte als unauflösbar zu betrachten, erfolgt, so Levi, um den Preis, den praktischen Anspruch an die orientierende Funktion von Normen und Werten aufzugeben. Diesen beizubehalten verlangt umgekehrt einen suspense of judgment hinsichtlich der Geltung normativer Urteile bzw. der darin mitgeteilten Verpflichtungen. Die existenzielle Dimension des tragischen Konflikts, auf welchen Akteure nur mit Reue reagieren können, geht zwar unter dieser pragmatischen Betrachtungsweise verloren. Wir verstehen aber vielleicht besser, in welchem Sinne Personen wählen können, wer sie sein wollen. Aufgefordert, vernünftige Entscheidungen zu treffen, die kritischer Betrachtung auch im Nachhinein Stand halten und insofern den wohlverstandenen Interessen und Zielen einer Person entsprechen, können Akteure, die sich situationsbezogen an kohärenten Normen und Werten orientieren müssen, weder an Sartres voluntaristisches fiat für eine creatio ex nihilo glauben noch sich ganz der Vorstellung extern vorgegebener Normen überlassen. Die Freiheit des autonomen Individuums ist daher immer auch die Freiheit, Normen und Werte zu hinterfragen, über deren Urheberschaft auch das autonome Individuum nicht restlos verfügt. John Dowell jedenfalls hätte sich den Ratschlag, schon um seiner eigenen Würde willen, sich den Kon- flikten zu stellen, um der zu werden, der er hätte sein können, besser rechtzeitig zu Herzen genommen. Der Rückzug in die Melancholie, der Dowells Lebenslügen begleitet, entspricht jedenfalls kaum der pragmatischen Aufforderung Deweys oder Levis, gerade angesichts moralischer Konflikte eine vernünftige Wahl zu treffen. Wenn am Ende das Bedauern bleibt Aber auch dem Vernünftigsten ist die Melancholie nicht fremd. In seiner Kritik an wohlfahrtsorientierten Ansätzen in der Verteilungsgerechtigkeit hat Ronald Dworkin (1981) darauf hingewiesen, dass man auf zwei ganz unterschiedliche Arten Erfolg haben könne. Eine Person könne zum einen insgesamt erfolgreich sein, wenn es ihr geglückt ist, insgesamt ein Leben zu führen, das ihr selbst als wertvoll und gelungen erscheint (overall success). Man könne aber auch erfolgreich sein hinsichtlich der konkreten Ziele, die man sich selbst gesetzt hat, ohne dass sich das Erreichen dieser situativ gewählten Ziele schon zu einem gelungenen Leben summiert (relative success). Wer von einer großen Musikerkarriere träumt, aber es wegen zufälliger Umstände oder auch dem Mangel an dem letzten Quäntchen Talent nur dazu bringt, gut in der musikalischen Ausbildung anderer zu sein, mag insofern immer noch erfolgreich sein – und kann doch ein insgesamt erfolgreiches Leben, gemessen an den eigenen Vorstellungen bestreiten (vgl. für das Beispiel Roemer 1996: 243). Es ist nicht klar, so Dworkin, was wir vernünftigerweise als unerfüllte Ziele eines Lebensentwurfs bedauern können, die Gegenstand egalitaristischer Kompensation sein sollten. Aber auch wenn offen bleibt, welche Form des Scheiterns als eine unverschuldete Benachteiligung gelten kann, so sind die Reue und das Bedauern über Entscheidungen, denen der erhoffte Erfolg nicht gegönnt war, doch nicht nur verständliche, sondern sogar berechtigte Reaktionen. Sie erinnern uns daran, dass auch der Vernünftigste in einer Welt handelt, in der nicht alle Pläne gelingen. Und vielleicht ist auch der Vernünftigste nicht davor gefeit, falschen Zielen nachzujagen. John Dowell mag moralisch versagt haben. Aber auch solche reineren Herzens sind nicht immer die, die sie zu sein erhofft hatten. Eben deshalb bleibt das Leben eine Herausforderung. Und genau darin beweist sich der Wert kluger Entscheidungen. Literatur Dewey, John und James H. Tufts. 1932. Ethics. 2. Auflage. New York: Holt. Dworkin, Ronald. 1981. “What is Equality? Part 1: Equality of Welfare”. Philosophy & Public Affairs 10: 185-246. Ford, Ford Madox. [1915] 2012. The Good Soldier. A Tale of Passion. Oxford: Oxford University Press. Levi, Isaac. 1986. Hard Choices. Decision Making under Unresolved Conflict. Cambridge: Cambridge University Press. Roemer, John E. 1996. Theories of Distributive Justice. Cambridge, MA: Harvard University Press. Sartre, Jean-Paul. [1946] 1989. Ist der Existentialismus ein Humanismus? Frankfurt: Ullstein. Williams, Bernard. 1973. Problems of the Self. Cambridge: Cambridge University Press. –––––. 1981. Moral Luck. Cambridge: Cambridge University Press. Zu unserem Gastautor: PD Dr. Ulrich Metschl ist mittlerweile, nicht nur altersbedingt, Senior Lecturer am Institut für Philosophie der Universität Innsbruck. Seine Interessen bewegen sich großflächig zwischen schottischer Aufklärung und Sozialwahltheorie. Von Ulrich Metschl cog!to 07/2014 39 Kann ich sein, wer ich will? Und wenn ja, wie: Selbstbestimmung und doxastischer Voluntarismus Von Erasmus Mayr und Stephan Sellmaier Autonomie beinhaltet nach einer weit verbreiteten Vorstellung, dass wir so sind, wie wir sein wollen, oder zumindest so, wie wir es gut finden, dass wir sind. Ein wunderbar einfacher Weg dahin bestünde darin, einfach unsere Vorstellung davon, wer wir sind und was gut ist, unseren Wünschen anzupassen: Aber steht uns dieser Weg offen? D ie Vorstellung, die Person zu sein, die ich sein will, und so zu sein, wie ich sein will, ist für viele Menschen ein zentraler Bestandteil ihres Bildes von einem selbstbestimmten und autonomen Leben. Dass ich mich selbst, wenn ich autonom bin, in dieser Weise bestimme, unterscheidet mich nach dieser Vorstellung gerade von Menschen, die durch äußere Umstände, ihre Erziehung oder ihre genetische Veranlagung festgelegt sind. Aber zugleich erscheint das Streben danach, sich in einer radikalen Weise selbst zu bestimmen, leicht als notwendigerweise illusorisch: Denn sogar dann, wenn ich damit, wie ich gerade bin, zufrieden sein sollte, heißt das ja noch nicht, dass ich auch so bin, weil ich es will. Ich kann mich ja auch einfach damit abgefunden haben, dass ich nicht anders sein kann und so meine Erwartungen an mich der vielleicht etwas ernüchternden Realität angepasst haben. Vor allem bei zu hochtrabenden Zielen ist es eine sinnvolle – aber auch schmerzliche – Einsicht, dass es besser ist, meine Ziele und Erwartungen an mich selbst herabzustufen und so an meine tatsächlichen Möglichkeiten anzupassen. Da eine solche resignative Anpassung der eigenen Erwartungen an die eigenen Unzulänglichkeiten nicht wirklich unserem alltäglichen Verständnis von Selbstbestimmung entspricht, erfordert dieses Verständnis wohl auch, dass ich so bin, wie ich bin, weil ich es will. Mein Wunsch, wie und wer ich sein will, und die Tatsache, dass ich so und derjenige bin, müssen nicht nur zusammenpassen, sondern diese Tatsache muss vorliegen, weil ich einen Wunsch dieses Inhalts hatte. Aber mit dieser Vorstellung von Autonomie geraten wir, wie verschiedene Philosophen betont haben, allzu schnell in einen Regress: Denn wie ich sein will, hängt selbst wiederum entscheidend davon ab, wie ich schon bin. Wurde ich in einem Mafia-Umfeld sozialisiert, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ich auch selbst ein Mafioso werden will. Dass ich sein kann, wie ich sein will, und weil ich so sein will, muss also in einem nächsten Schritt erfordern, dass ich auch die Wünsche habe, die ich habe, weil ich sie haben will. Aber warum habe ich diese Meta-Wünsche, die Wünsche zu haben, die ich gerade habe? Nun, 40 cog!to 07/2014 wenn ich mich autonom selbst bestimmen soll, dann deshalb, weil ich auch diese Meta-Wünsche haben will ... usf.1 Die Vorstellung, dass ich alle meine Wünsche deshalb habe, weil ich sie haben will, ist also illusorisch – und damit ebenso die Vorstellung, dass ich bin, wer ich bin, weil ich dies sein will. Aber sollen wir die Vorstellung, dass wir sein können, wer wir sein wollen, und weil wir dies sein wollen, deshalb einfach aufgeben? Soll vielleicht Autonomie doch lediglich erfordern, dass wir sein wollen, wer wir sind – gleichgültig, ob unser Wunsch einfach nur auf der resignierten Einsicht beruht, dass wir eh nicht anders sein können? Diese Vorstellung, die sich schon bei den Stoikern findet – die die Einsicht in das Unvermeidliche als wesentliches Charakteristikum eines freien Charakters ansahen – , hat auch heute noch ihre Sympathisanten.2 Aber sie erscheint doch als allzu weitgehend (oder pessimistisch): Sicher ist es bezüglich bestimmter Eigenschaften, die man als Person besitzt, ratsam, sich damit abzufinden, dass man sie hat, wenn man sie so- die fraglichen Eigenschaften nicht einfach haben will, sondern dass ich es auch für gut ansehe, diese Eigenschaften zu haben. Dieses Modell von Autonomie teilt mit dem zuvor untersuchten ein reflexives Element: Es ist entscheidend, dass wir unsere Charakterzüge und Wünsche in einem Prozess von Selbstreflexion auch ‚unterschreiben’ können. Aber es deutet dieses ‚Unterschreiben’ nicht im Sinne von weiteren Wünschen, sondern im Sinne von Werturteilen (vgl. Watson 1975). Wenn ich z.B. ein altruistischer Mensch bin, der gerne anderen hilft, dann macht mich nach diesem zweiten Modell nicht die Tatsache zu einem autonomen Altruisten, dass ich so sein will – sondern vielmehr die Tatsache, dass ich bei einem Nachdenken darüber, wie ich sein will, zu dem Schluss gekommen bin – oder, falls ich explizit nachdenken würde, zu dem Schluss käme – , dass es gut ist, ein Mensch mit altruistischen Motiven zu sein und nach ihnen zu handeln (weil ich z.B. einsehe, dass gute Gründe dafür sprechen, so zu sein). Dieses evaluative Modell von Autonomie hat gegenüber einem Wunschmodell den großen Vorteil, „Die Vorstellung, dass ich alle meine Wünsche deshalb habe, weil ich sie haben will, ist also illusorisch – und damit ebenso die Vorstellung, dass ich bin, wer ich bin, weil ich dies sein will“ wieso nicht ändern kann (Obwohl: Auch in diesen Fällen heißt das nicht immer, dass man auch so sein will – man kann z.B. schwere charakterliche oder intellektuelle Defizite, die man hat, zutiefst bedauern). Aber bezüglich anderer Eigenschaften erscheint ein solches Vorgehen als defaitistisch und keinesfalls autonom. Wenn ich z.B. resigniert akzeptiere, dass ich ein leichtgläubiger Mensch bin, und beschließe, damit zufrieden zu sein, dann macht mich das keineswegs autonomer, als wenn ich unglücklich über meine Leichtgläubigkeit wäre. Autonomer würde ich nur dann, wenn ich in Zukunft bei meiner Überzeugungsbildung mehr acht gäbe und es vermeiden würde, immer auf unzuverlässige Leute hereinzufallen, indem ich mir vor Augen halte, wie unzuverlässig sie sind. Hinsichtlich derjenigen Eigenschaften, die dafür mitkonstitutiv sind, wer ich bin, bin ich daher nicht automatisch autonom, sobald ich diese Eigenschaften auch haben möchte. Denn wenn ich mich mit Eigenschaften, die ich eigentlich ändern könnte, einfach aus Resignation oder auch Selbstgefälligkeit abfinde, obwohl mir eigentlich klar ist, dass diese Eigenschaften meine Selbstbestimmung untergraben, macht mich das nicht ipso facto autonom bezüglich dieser Eigenschaften. Ein vielversprechenderes und anspruchsvolleres Modell von Autonomie verlangt demgegenüber, dass ich dass es den oben dargestellten Regress zu vermeiden verspricht. Der Regress entstand, weil ich, um selbstbestimmt etwas zu wollen, nach dem früheren Modell wiederum wollen musste, dass ich dies will usf. Nach dem evaluativen Modell muss ich hingegen, um z.B. selbstbestimmt altruistisch sein zu wollen, keinen solchen weiteren Wunsch haben – es genügt, dass ich ein entsprechendes Werturteil fälle. Aber dass der oben beschriebene Regress vermieden wird, lässt das zweite oben beschriebene Problem noch bestehen: Dass ich nämlich meine Eigenschaften und Charakterzüge zwar als positiv beurteile, aber das nur tue, weil ich einfach meine Auffassung darüber, was gut ist, daran angepasst habe, wie ich selber bin – z.B. weil ich mich dann besser fühle – oder weil ich einfach begonnen habe zu glauben, dass ich die Eigenschaften, die ich als gut ansehe, auch habe (und zwar unabhängig 1 Das ist eine Variante des „paradox of self-determination“ für Verantwortung, dass sich z.B. in S. Wolf (1990), Kap. 1, oder G. Strawson (1994) findet. 2 Harry Frankfurts einflussreiches Modell von Selbstbestimmung auf der Basis einer Hierarchie von höherstufigen Wünschen lässt z.B. zu, dass „a person can become resigned to being someone of whom he does not altogether approve“, (1977), 64. cog!to 07/2014 41 n n beei n f l u s se u rc e i ne E n t s c he id hm cog!to 07/2014 du 42 e ug u ngen 3 Vgl. die Unterscheidung zwischen ‚belief‘ und ‚acceptance‘ in Cohen (1992). 4 Eine andere Art, diesen Punkt zu machen, ist es, Wahrheit als das intrinsische ‚Ziel‘ von Überzeugung ansehen, wie dies z.B. David Velleman getan hat, vgl. ‚The aim of belief‘ in Velleman (2000). er z e ng Annahme folgt oder ich zukünftig nach bestätigenden Gründen suchen möchte. Diese so gebildeten Überzeugungen sind aber hypothetische Annahmen, und nicht im strengen Sinne Überzeugungen.3 Uns geht es aber im Folgenden um die Frage, ob ich meine alltäglichen Überzeugungen direkt durch meine Entscheidungen beeinflussen kann. Könnte es beispielsweise denn nicht auch möglich sein, der zu sein, der man sein will, indem man seine Überzeugunic h m e i n gen über sich selbst seinen Wunschvorstele lungen anpasst? Wäre es beispielsweise möglich, ein guter Philosoph zu werden indem ich mich – bar jeglicher epistemischer Gründe – aus praktischen Erwägungen einfach dafür entscheide einer zu sein? Oder falls dergleichen zu weitreichende Folgen für die Kohärenz meines Weltbilds hätte, könnte ich mich nicht dafür entscheiden, bestimmte lokale mich wurmende Überzeugungen bezüglich meiner eigenen Leistungen bzw. Fähigkeiten, meinen Wunschvorstellungen anzupassen? Könnte ich nicht einfach beschließen zu glauben, dass mein letzter Aufsatz eine bahnbrechende philosophische Leistung war, weil ich dadurch sehr viel glücklicher würde – und zwar auch dann, wenn alle dafür sind, dass er von peinlichen Fehlern nur so strotzte? Diese Frage, ob wir überhaupt in der Lage sind, Überzeugungen zu bilden, weil wir das wollen oder uns entsprechend entscheiden, muss von der damit zusammenhängenden Frage getrennt werden, ob wir das auch rationalerweise tun können. Die stärkere Verneinung des doxastischen Voluntarismus würde beinhalten, dass wir gar keine echten Überzeugungen bilden, wenn wir uns einfach willkürlich entscheiden, etwas zu glauben. Die schwächere Verneinung würde nur besagen, dass wir, wenn wir das tun, notwendig irrational sind. Für die schwächere Verneinung spricht, dass wir die Adäquatheit von Überzeugungen danach bewerten, inwieweit sie die epistemischen Gründe für und wieder die Wahrheit der Aussage wiederspiegeln. Dass gute praktische Gründe dafür sprechen, eine bestimmte Überzeugung zu haben – dass z.B. der eifersüchtige Ehemann sehr viel glücklicher wäre, wenn er glauben würde, dass seine Frau ihm treu ist –, bedeutet nicht automatisch, dass diese Überzeugung auch als solche angemessen ist. Überzeugungen teilen diese Eigenschaft – dass es nur bestimmte Charakteristika sind, die sie angemessen machen können, und dass sich diese Charakteristika alle auf den Gegenstand der Überzeugung und die Beziehung der Person zu diesem Gegenstand beziehen (also auf die geglaubte Proposition und die Gründe, die aus Sicht der Person dafür sprechen, dass diese Proposition wahr ist) – mit anderen mentalen Zuständen, wie z.B. dem Gefühl der Dankbarkeit. Dass ich Üb davon, ob ich sie tatsächlich habe). Ist das nicht auch eine mögliche Strategie, meine eigenen Eigenschaften und meine Wertüberzeugungen einander anzupassen, die die Mühsalen, die mit einem tatsächlichen Ändern meiner schlechten Eigenschaften verbunden sind, vermeidet? Diese Strategie ist aber nur dann überhaupt eine mögliche Option, wenn ich meine Überzeugungen frei wählen könnte – und ob ich das kann, ist alles ann dere als klar. Sind wir bezüglich unserer UrKan teile und Überzeugungen nicht passiv in ? dem Sinn, dass es keinen Sinn macht zu fragen, ob ich mich für ein Urteil oder eine Überzeugung frei entschieden habe, weil diese Einstellungen und Akte unwillkürliche Antworten darauf sind, dass gute Gründe für die Wahrheit der fraglichen Aussage sprechen? Die meisten von uns würden diese Frage wohl bejahen. Sogenannte doxastische Voluntaristen hingegen gehen davon aus, dass wir durchaus in bestimmten Grenzen uns dafür oder dagegen entscheiden können zu glauben, dass p der Fall ist. Diese Entscheidung ist für doxastische Voluntaristen nicht auf rein epistemische Erwägungen begrenzt: Ich kann mich auch aus genuin praktischen Gründen, die nichts mit der Wahrheit oder Falschheit der Überzeugung zu tun haben, dafür entscheiden, sie zu glauben. Die Frage, ob wir uns für Überzeugungen entscheiden können oder nicht, muss streng von zwei anderen Fragen getrennt werden, die wir relativ unproblematisch bejahen können. Zum einen können wir uns sehr oft dafür oder dagegen entscheiden, etwas zu tun, was bestimmte Überzeugungen in uns indirekt herbeiführt. Es ist für mich z.B. sehr einfach, es durch eine Entscheidung zu vermeiden, dass ich eine Überzeugung hinsichtlich der Frage bilde, ob es regnet oder nicht – indem ich einfach beschließe, nicht aus dem Fenster zu schauen und die Vorhänge geschlossen zu lassen. Und es ist für mich genauso einfach herbeizuführen, dass ich eine solche Überzeugung bilde, indem ich einfach ans Fenster gehe und hinausschaue. Dass ich, indem ich beschließe, bestimmte Evidenz zur Kenntnis zu nehmen oder nicht, in dieser Weise indirekt durch meine Entscheidung beeinflusse, welche Überzeugungen ich bilde, erscheint trivialerweise möglich. Ebenso – das ist der zweite Fall – ist es für mich möglich, etwas aus praktischen Gründen als Hypothese anzunehmen, weil ich beispielsweise überprüfen möchte, was aus dieser „Ist es nicht möglich, an einer Überzeugung festzuhalten, für deren Falschheit ich gute Gründe habe? Manchmal will ich etwas nicht glauben oder etwas glauben, für das ich vermeintlich schlechte Gründe habe. Zumindest in Situationen, in denen keine durchschlagenden, nicht hinterfragbaren epistemischen Gründe vorliegen, scheint es doch möglich an Überzeugungen festzuhalten, gegen die scheinbar alles spricht“ Willi dankbar bin, erfordert, dass ich glaube, dass Willi mir etwas Gutes getan hat – wenn ich das nicht glaube, dann kann ich rationalerweise Willi nicht dankbar sein, auch wenn dieser Zustand für mich ungeheuer nützliche Folgen hätte. (Ich habe dann vielleicht gute Gründe, ein Gefühl der Pseudo-Dankbarkeit bei mir herbeizuführen, um mir diese nützlichen Folgen nicht entgehen zu lassen, aber das ist etwas anderes, als gute Gründe dafür zu haben, Willi dankbar zu sein.) Überzeugungen sind wie viele andere mentale Zustände Zustände, die durch Gründe, die sich gerade auf den intentionalen Gehalt dieser Zustände beziehen, (content-based reasons) angemessen gemacht werden, und nicht durch Gründe, die sich auf die praktischen Vorteile des Besitzes dieser Einstellungen beziehen (state-based reasons).4 Dies spricht stark dafür, dass es zumindest nicht rationalerweise möglich ist, sich aus anderen als epistemischen Gründen für oder gegen eine Überzeugung zu entscheiden. Aber sollen wir auch die stärkere Form der Verneinung der voluntaristischen These akzeptieren, dass es nicht einmal möglich ist, eine genuine – wenn auch irrationale – Überzeugung auf der Basis einer willkürlichen Entscheidung zu glauben zu bilden? Ein einflussreiches Argument für diese stärkere Verneinung hat Bernard Williams entwickelt (Williams 1970). Nach Williams stellen sich Überzeugungen für die Person, die sie hat, auch so dar, dass sie eine von dem Bestehen dieser Überzeugung (oder einer Entscheidung zu glauben) unabhängige Realität wiedergeben. Wenn ich eine Überzeugung habe, dass p, muss ich also auch der Auffassung sein, dass ich das glaube, weil p wahr ist (und nicht, dass ich meine Überzeugung unabhängig von der Wahrheit von p gebildet habe). Könnte ich mich dagegen frei und aus praktischen Gründen für eine Überzeugung entscheiden, und mich an diesen Ursprung meiner Überzeugung später erinnern, dann würde dieser Zusammenhang gesprengt. Daher würde meine Erinnerung notwendig meine Überzeugung selbst untergraben. Aber ist es nicht möglich, an einer Überzeugung festzuhalten für deren Falschheit ich gute Gründe habe? Manchmal will ich etwas nicht glauben (z.B. den Tod einer vermissten Person) oder etwas glauben, für das ich vermeintlich schlechte Gründe habe (dass eine Person ein Grubenunglück überlebt hat). Zumindest in Situationen in denen keine durchschlagenden nicht hinterfragbaren epistemischen Gründe gegen eine bestimmte Überzeugung vorliegen, scheint es doch möglich – wenn auch nicht besonders vernünftig – an Überzeugungen festzuhalten gegen die scheinbar alles spricht (besonders wenn es um negative Überzeugungen geht und ich etwas auf keinen Fall glauben will). Fälle dieser Art scheinen Williams postulierten begrifflichen Zusammenhang zu unterlaufen. Es erscheint also durchaus möglich, wenn auch nicht vernünftig, sich ausschließlich aufgrund praktischer Überlegungen für bestimmte Überzeugungen zu entscheiden. Aber ist letzteres wirklich so, d.h. sind solche Entscheidungen notwendig irrational? Könnte nicht beispielsweise die Entscheidung des Fuchses aus der bekannten Äsopfabel, die Trauben nicht mehr zu wollen, weil er die willentliche Überzeugung bildet, dass diese sauer sind, eine vernünftige Entscheidung in seiner so ausweglosen Situation sein? Und macht nicht der Fuchs genau das, was doxastische Voluntaristen für sinnvoll und möglich halten? Er passt seine erste Überzeugung bezüglich der Trauben nach seinen vergeblichen Versuchen, sie von dem für ihn viel zu hohen Weinstock zu fressen, entsprechend an. Denn das was er macht, – so lautet es zumindest in der Fabel – ist nicht eine Veränderung seines Wunsches nach süßen Trauben, sondern die Veränderung seiner epistemischen Überzeugung bezüglich der Süße der erstrebten Trauben. Die von ihm fortan als sauer geglaubten Trauben stellen für ihn kein erstrebenswertes Ziel mehr dar. So gelingt es ihm sein hoffnungsloses Unternehmen – die erstrebten Trauben zu erreichen – als nicht erstrebenswertes Ziel umzuinterpretieren. Und ist genau dies nicht eine vernünftige, rationale Strategie mit seinen eigenen Unzulänglichkeiten umzugehen? Dieses Vorgehen hilft ihm auf alle Fälle, sich mit seiner misslichen Situation zu arrangieren, indem cog!to 07/2014 43 er seine Überzeugungen bewußt seinen Bedürfnissen anpasst. Aber ist dies wirklich rational – sogar dann, wenn wir uns auf rein praktische Gründe beschränken? Wäre es nicht vernünftiger in solchen Situationen einfach einzusehen, dass man nicht die entsprechenden Mittel hat seine Ziele zu realisieren? Und ist nicht diese Einsicht gerade das, was zumindest uns Menschen immer wieder zu neuen, innovativen Ideen im Umgang mit unseren Unzulänglichkeiten antreibt? In unserem Fall, der Erfindung von Werkzeugen wie der Leiter, zu der wir schließlich nie gekommen wären, wenn wir beschlossen hätten, alles, was zu hoch hänge, sei zu sauer, als dass es sich lohnen würde, danach zu streben. Literatur Cohen, Jonathan. 1992. An Essay on Belief and Acceptance. Oxford: Clarendon Press. Frankfurt, Harry. 1977. „Identification and Externality“. In: ders. 1988. The Importance of What we Care about, S. 5868. Cambridge: Cambridge University Press. Velleman, David. 2000. The Possibility of Practical Reason. Oxford: Clarendon Press. Watson, Gary. 1975. „Free Agency“. In: ders. (Hrsg.). 1982. Free Will, S. 337-351. Oxford: Oxford University Press. Williams, Bernard. 1970. „Deciding to Believe“. In: ders. (Hrsg.). 1976. Problems of the Self, S. 136-151. Cambridge: Cambridge University Press. Wolf, Susan. 1990. Freedom Within Reason. Oxford: Oxford University Press. Von Erasmus Mayr und Stephan Sellmaier Zu unseren Gastautoren: Erasmus Mayr ist zur Zeit Junior Research Fellow am Queen‘s College Oxford. Stephan Sellmaier leitet die Forschungsstelle Neurophilosophie und Ethik der Neurowissenschaften an der LMU München (http://www.neuro.philosophie.uni-muenchen. de). Seine Forschungsschwerpunkte sind die philosophische Handlungstheorie, Theorie der Willensfreiheit und die Ethik der Neurowissenschaften. Er arbeitet zur Zeit an einer Monographie zum menschlichen Handeln im Lichte neuer Erkenntnisse der Neurowissenschaften. 44 cog!to 07/2014 RUBRIK SCHNITTMengentheorie In Schnittmengentheorie werden Artikel publiziert, die sich philosophischen Fragen interdisziplinär nähern. Diesmal beschäftigt sich unser studentischer Gastautor Michael Schultheis aus verschiedenen Perspektiven mit dem Mythos und seiner Rolle in der sozialen Konstruktion kollektiver Identität. cog!to 07/2014 45 „Es war einmal, vor einer langen Zeit...“ Die soziale Konstruktion kollektiver Identität in Mythen Von Michael Schultheis Hören wir von Mythen, dann denken wir an alte Legenden, die griechische, germanische oder eine andere Mythologie. In jedem Fall klingen sie fantastisch. Meistens handelt es sich um Geschichten und Sagen, die mehr nach einem Hirngespinst klingen als nach einer Quelle unserer Identität. Die Bedeutung dieser Erzählungen für Kollektive wie Gruppen,Völker und Nationen ist nicht offensichtlich, aber dennoch vorhanden. Unsere Identität braucht Anhaltspunkte, an welchen sie sich orientieren kann und bisweilen beziehen Menschen hier auch die kollektiven Einbildungen mit ein. Soziale, nationale, kulturelle, kollektive Identität? Was ist eine Nation? Wer ist Teil dieser Nation? Was ist meine Kultur? Wer ist Teil dieser Kultur? Wichtig ist also zu verstehen, wie Gruppen sich selbst beschreiben und Mitgliedschaft definieren. ass die eigene Identität von der Zugehörigkeit zu oder dem Ausschluss von Gruppen abhängt, lässt sich an vielen Alltagsbeispielen veranschaulichen: Sei es, dass es um Cliquen auf dem Pausenhof geht, sei es, dass man Fan einer bestimmten Sportmannschaft ist. Für unser Selbstbild ist das Verhältnis zu Gruppen von elementarer Bedeutung. Es formt die soziale Identität von Personen. Dabei gilt es, verschiedene Ebenen der Identität zu unterscheiden: Die kollektive, die kulturelle, die soziale als auch die nationale Identität. All diese Aspekte beschreiben Metaebenen des Egos und stehen in Verbindung miteinander, sind aber nicht deckungsgleich. Personen sind Teil mehrerer Gruppen und entwickeln auf dieser Grundlage eine individuelle soziale Identität. Gruppen und Individuen ihrerseits können wiederum Teil eines kulturellen Kollektivs sein und so eine Identität entwickeln, die auf Aspekten wie etwa Religion, Sprache, Nation, etc. basiert. Schließlich wird die nationale Identität im Allgemeinen als Spezialfall der kulturellen Identität betrachtet. Sie beschreibt Überzeugungen und Verhaltensweisen, die Individuen zu einer Nation vereinen. Bei dieser Variante ist besonders interessant, dass sie ganz offensichtlich eine Imagination sein muss, denn man kennt nicht alle Mitglieder seiner Gruppe und dennoch existiert im Kopf das Bild eines homogenen Kollektivs. Eine Schwierigkeit, welche alle diese Formen von Identität haben, ist jedoch die Definition der Gruppen. Das Ungefähre und Uneindeutige D 46 cog!to 07/2014 Im Grunde beschreiben Gruppenidentitäten einen simplen Sachverhalt, denn sie definieren nur, wie sich ein bestimmtes Kollektiv wahrnimmt und durch welche Mittel diese Selbstanschauung erfolgt. Nach diesem theoretischen Ansatz äußerte sich diese Form der Identität in historischen Überlieferungen, Wertvorstellungen und Mythen. Weitere Merkmale können gemeinsame wirtschaftliche Ziele und ein gemeinsamer Plan für die Zukunft sein. Folge dieser kollektiven Ansichten ist in der Regel ein gemeinsames soziales Handeln. Jedoch wirft dieser Begriff von Gruppenidentität auch einige Probleme auf. Eine prominente Kritik an dem Konzept einer kollektiven Identität im Singular stellt die empirische Kulturanthropologie dar. Sie argumentiert, dass Kultur als Fluss zu beschreiben ist. Ein Mensch gehöre mehreren Gruppierungen an, denn wir sind nicht nur Teil eines einzigen kulturellen Kollektives. Diese definieren sich zum Beispiel über eine gemeinsame Sprache, die Religion oder eine bestimmte Nation, etc. Allein diese drei Punkte zeigen aber schon ganz gut die Pluralität der menschlichen Gruppenzugehörigkeit auf, denn jede Person würde bereits jetzt drei Kollektiven angehören. Auch darf man nicht den Fehler machen, Identität mit Gruppenidentität gleichzusetzen, denn die kollektive Variante beschreibt zum Beispiel nicht die essentielin erster Instanz historische Erzählungen und Überlielen Eigenschaft einer Kultur, sondern geht aus den Geferungen, welche für sich einen gewissen Wahrheitsgewohnheiten einer Kommunikationsbeziehung hervor. halt beanspruchen. Gerade auch das Thema „Mythos“ lädt zu Kritik ein, Der Mythos wird in der Regel dafür benutzt die Urdenn die Eigenschaften dieser Erzählungen schaffen sprünge einer Kultur, eines Volkes, einer Religion, etc. eigentlich keine gemeinschaftliche Übereinkunft. Mydarzulegen (Geschichts-, Ursprungs- und Gründungsthen sind in der Regel sehr unpräzimythen). Charakteristisch für Myse. Sie sind zwar so konstruiert, dass then ist, dass sie akzeptiert werden, ein Kollektiv Bezug dazu aufbauen „Der Grund, auf dem die obwohl man kein Augenzeuge der kann, jedoch lassen sie viel Raum für kulturelle Ordnung beruht Begebenheit war. Ernst Cassirer die unterschiedlichsten Interpreta- ist das Ungefähre und führt dieses Phänomen auf die Tattionen. sache zurück, dass der Mythos nicht Uneindeutige“ Bernhard Giesen verdeutlicht unterscheidet zwischen Immanenz diesen schizophrenen Zug von Grupund Transzendenz (Cassirer 1973: pen. Er stellt in seinen Arbeiten heraus, dass der Kern 60-80). Auch unterscheidet er nicht zwischen Illusion eines Kollektivs nicht etwa gemeinsame Werte und und Wirklichkeit oder den Sphären des Lebens und des Normen sind, sondern etwas anderes: „Der Grund, auf Todes. Der Mythos trägt also dazu bei, dass die kollekdem die kulturelle Ordnung beruht, ist das Ungefähre tive Identität eine gewisse Fraglosigkeit konstruiert, und Uneindeutige“ (Giesen 2013). Es gehört also zum denn obwohl man nicht Teil der historischen GrünWesen von Erzählungen, die eine Gruppenidentität stifdungsereignissen war, werden die Mythen akzeptiert. ten sollen, dass sie vage und interpretationsbedürftig Durch diesen Sachverhalt entsteht natürlich eine sind. Es liegt also sozusagen in der Natur der Sache, gewisse Lücke, die die kollektive Identität nicht schliedass nicht trennscharf entschieden werden kann, wer ßen kann, denn diese Geschehnisse sind einfach nicht zur Gruppe gehört und wer nicht. Solche Fragen könempirisch beweisbar. Obwohl die meisten Mythen nen nicht eindeutig beantwortet werden, denn wir entnachweislich auf Fiktionen basieren – vielleicht aber scheiden individuell und unabhängig für uns selbst, wie gerade deswegen – sind die Mitglieder einer so mit eiwir diese Fragen beantworten wollen. ner Identität ausgestatteten Gruppe gezwungen, die Dies könnte auch eine Erklärung dafür sein, dass wir Erzählungen immer wieder vorzutragen und neu zu innicht nur die Elemente brauchen, welche uns als Gruppe terpretieren, denn diese Leere ist offensichtlich gerade vereinen, sondern auch die, die uns von anderen trenkein Problem für die Existenz einer kollektiven Identinen. Dieser Punkt hat natürlich dasselbe Problem, wie tät. Vielmehr sind wir angehalten uns ständig mit den die von Giesen angesprochene These zeigt, denn andeMythen unserer Gruppen zu beschäftigen und so das ren Gruppen sind ebenfalls von Uneinigkeit geprägt und Kollektiv am Leben zu erhalten. Der Mythos stellt eine daher ist es schwer eindeutige Abgrenzungsmerkmale erste Orientierungshilfe dar und fungiert damit nicht zu finden. Die Theorie einer Gruppenidentität steht also nur als historische Erzählung, sondern hat auch Einfluss auf eher wackeligen Beinen. Da es aber offenkundig ist, auf Gegenwart und Zukunft. dass es Gruppenidentitäten gibt, stellt sich die Frage, wer oder was sie stiftet. Hier ist eine eingehendere Betrachtung von identitätsstiftenden Erzählungen über die Vergangenheit nötig, oder kurz: Mythen und ihre Bei Mythen handelt sich um Illusionen, die von MenRolle innerhalb der kollektiven Strukturen. schen konstruiert werden, die sie nicht als gegeben vorfinden. Beides wird bedingungslos hingenommen und das obwohl die vermeintlich gemeinschaftlichen Elemente eher von Uneinigkeit zeugen, denn sowohl das Zunächst gilt es festzustellen, dass nicht für jede GrupKonstrukt „Gruppe“, als auch Mythen geben eigentlich penform Vergangenheitserzählungen relevant sind. Bei keine klaren Auskünfte – weder legen sie trennscharf Volksgruppen etwa ist der geographische Raum, die so fest, wer zu der Gruppe gehört und wer nicht, noch, welgenannte „Heimat“, von großer Wichtigkeit. Dieser Asche Bedeutung eine bestimmte mythische Geschichte pekt ist für andere Gemeinschaften völlig belanglos, bei hat. Claude-Levi Strauss nannte es die „leere SignifiGruppen wie etwa einem Freundeskreis steht eher die kante“ und meinte damit etwas Unkonkretes, dass in Befriedigung der sozialen Bedürfnisse im Vordergrund, seinen Augen zu allem möglichen werden konnte: „Wie während bei Sportvereinen zum Beispiel das Ausüben die Sprache ist das Soziale eine autonome Realität; die der jeweiligen Sportart die gemeinsame Konstante bilSymbole sind realer als das, was sie symbolisieren, der det. Signifikant geht dem Signifikat voraus und bestimmt Nach Erik H. Erikson ist neben diesem Faktor „Heies“ (Levi-Strauss 1978: 26). Da dieser Signifikant bei mat“ primär die gemeinsame Vorstellung der VerganMythen jedoch auf Grund fehlender empirischer Fakgenheit des Kollektivs von Bedeutung und hier kommen ten leer ist bzw. nicht genau definiert werden kann, ist die Mythen wieder ins Spiel (Erikson 1973). Diese sind es eben auch nicht möglich ihre Bedeutung eindeutig Der leere Raum Heimat und Geschichte cog!to 07/2014 47 zu bestimmen und damit festzulegen. Mythen werden somit zu etwas Uneindeutigem. Das sollte jedoch nicht als vernichtendes Urteil missverstanden werden. Nur weil etwas eine Konstruktion ist, muss das nicht heißen, dass es für die Realität nicht von Bedeutung wäre. Ein Mythos will keine wissenschaftlichen Fakten liefern, sondern entlasten und anregen. Unter anderen vertrat Hans Blumenberg die Ansicht dass uns mythologische Geschichten von dem „Absolutismus der Wirklichkeit“ befreien und wir uns erst so den Herausforderungen des Lebens stellen können. Er war der Auffassung, dass der Mensch einer Realität ohnmächtig gegenübersteht, die er nur als absolut begreifen kann. Wir beherrschen also nicht die Wirklichkeit, die Wirklichkeit beherrscht uns. Der Mythos hat nun die Funktion unsere realen Probleme erzählerisch zu verpacken, sodass es uns ermöglicht wird einen gewissen Abstand zu gewinnen. Blumenberg ist der Meinung, dass Distanz unbedingt notwendig ist um eine sinnleere und übermächtige Wirklichkeit aushalten zu können (Blumenberg 1979: 9). Dieser Punkt unterstreicht nochmal die Interpretationsfreiheit, die man bei Mythen hat, denn sie sind auf fast alle Probleme anzuwenden. So individuell wie wir diese Geschichten auslegen, so subjektiv nehmen wir auch unsere Gruppen wahr. Fakt ist aber auch, dass sie immer überflüssiger werden, denn nur noch wenige wenden diese narrative Bewältigungsmethode an und auch als Stütze der Gruppenidentität verlieren sie dadurch momentan immer mehr an Bedeutung. Es gibt natürlich Ausnahmen im Bereich der nationalen Identität und hier im Speziellen beim Nationalismus. Schließlich aber kann man aber trotzdem feststellen, dass Mythen für die Konstitution/Konstruktion einer Gruppenidentität sehr wichtig sind, jedoch spielen sie für die Mitglieder, obwohl sie natürlich von ihnen weitererzählt werden, heute keine so große Rolle mehr wie während vergangener Jahrhunderte. Wäre eine Gemeinschaft ohne Mythen denn überhaupt denkbar? Literatur Blumenberg, Hans. 1979. Arbeit am Mythos. Frankfurt am Main: Suhrkamp. Cassirer, Ernst. 1973. Philosophie der symbolischen Formen. Zweiter Teil. Das Mythische Denken. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Erikson, Erik H. 1973. Identität und Lebenszyklus. Frankfurt am Main: Suhrkamp. Giesen, Bernhard. 2013. Ungefähres. Gewalt, Mythos, Moral. Weilerswist: Velbrück Wissenschaft. Levì-Strauss, Claude. 1978. „Einleitung“. In: Mauss, Marcel. Soziologie und Anthropologie 1. Theorie der Magie, soziale Morphologie, S. 7-38. Frankfurt am Main: Ullstein. Von Michael Schultheis Michael Schultheis studiert im 6. Semester Volkskunde/ Europäische Ethnologie an der LMU München. In der Studierendenvertretung war er als Kulturreferent und Geschäftsführer tätig. In der Philosophie interessiert er sich für die Themenbereiche Identität und Kultur. 48 cog!to 07/2014 RUBRIK IDEENKreis In Ideenkreis können sehr verschiedene Artikel ihren Platz finden: Von wissenschaftlichen Analysen über journalistisch-feuilletonistische Essays bis hin zu satirischen Darstellung. Was allen Artikeln gemein ist, ist die Behandlung einer philosophischen oder artverwandten Fragestellung. In dieser Ausgabe gibt uns Mathias Koch einen Überblick über John Lockes Auffassung der Person, Fabian Heinrich erläutert, warum Forderungen nach mehr Toleranz zeigen, dass unsere Gesellschaft noch nicht liberal genug ist und Sandra Müller spürt den Möglichkeiten und Grenzen der Gestaltung des eigenen Selbst nach. cog!to 07/2014 49 Die Schuld ist niemals zweifellos John Lockes Theorie der Verantwortung auf Grundlage personaler Identität Von Mathias Koch Kann ich eine Tat begehen, ohne dass ich für sie verantwortlich bin? Ja, sagt John Locke, denn eine Tat begehe ich als Mensch, verantwortlich bin ich als Person. Das ist nicht immer das gleiche, zum Beispiel dann nicht, wenn man zu viel getrunken hat. Ich habe einem Auto den Außenspiegel weggetreten und muss mich dafür jetzt vor Gericht verantworten. Meine Verteidigungslinie verläuft in etwa so: Ich bestreite, es gewesen zu sein. Diese Form der Verteidigung ist bestechend einfach. Anstatt eine Tat aus tieferen Beweggründen zu rechtfertigen, ist man es einfach nicht gewesen. Doch bin ich ein Student der Philosophie und so ist für mich die Sache mit dem Ich, wie so manches, ein wenig komplizierter. Kann ich die Tat nicht begangen haben, obwohl ich sie begangen habe? Ich war an jenem Abend im Barschwein und hatte dort einige Zeit getrunken. Am nächsten Morgen erwachte ich in meinem eigenen Bett und war zunächst erleichtert: Soweit meine Erinnerung reicht hatte ich keine Dummheiten gemacht. Dieser Glaube hielt, bis mir meine Freunde ein Video zeigten, das sie während des Abends von mir gemacht hatten. Darin sah man mich, auf einem Tisch stehend und nur unter Schwierigkeiten das Gleichgewicht haltend, lautstark zu Kung Fu Fighting von Carl Douglas grölen. Ich schämte mich fürchterlich, als ich das Video sah. Doch je länger ich den Betrunkenen beobachtete, desto mehr wich meine Scham der Frage: War das wirklich ich? Natürlich zweifelte ich nicht an der Echtheit des Videos. Ich musste wohl oder übel anerkennen, dass ich mit dem Abgebildeten in gewisser Hinsicht identisch war. Doch ohne das Bewusstsein, in dem Augenblick auf dem Tisch gestanden und so furchtbar gesungen zu haben, blieb ich mir auf eigenartige Weise fremd. Gab es eine andere 50 cog!to 07/2014 Sicht auf die Dinge, in der ich nicht mit dem Abgebildeten identisch war? Bewusstsein und Personalität Die Erinnerung an den Abend, das Video und mein Unbehagen verblich bereits, als mir zwei Wochen später die Anzeige zugestellt wurde. Ich war schockiert, Gewalt gegen Menschen und Sachen ist mir völlig fremd, doch auf der Polizeiwache wurde mir gesagt, mehrere Zeugen hätten mich zweifelsfrei identifiziert. Mit dieser Situation ist nicht zu spaßen, dachte ich, es ist Zeit sich kundigen Rat zu holen. Meine Recherche führte mich zu John Lockes An Essay Concerning Human Understanding. Im 27. Kapitel des zweiten Buches (Of Identity and Diversity) beschäftigt er sich ausführlich mit der Frage nach diachroner Identität, das ist die Frage, nach welchen Bedingungen etwas über Zeit hinweg mit sich selbst identisch bleibt. Diese Frage lässt sich nach Locke nur beantworten, indem wir auf einen bestimmten Begriff rekurrieren und so sagen, als was etwas mit sich selbst identisch bleiben soll. Dieser Begriff, unter den wir das Ding an zwei verschiedenen Zeitpunkten subsumieren, gibt uns die Kriterien an die Hand, ob wir es mit demselben Ding dieser Art zu tun haben, oder ob es zwei verschiedene Dinge dieser Art sind. Wenn es mir also darum geht, ob ich jetzt derjenige bin, der früher betrunken gesungen und Sachen beschädigt hat, so muss im Körper einer Eiche auf bestimmich zuerst fragen, als was ich mit „Als was bin ich mit te Art organisiert sein, und zwar ihm identisch sein soll. Locke unter- mir identisch? Locke derart, dass ein einheitliches Leben scheidet drei Möglichkeiten: Identikonstituiert wird. Solange dieses unterscheidet drei tät als materieller Körper, Identität spezifische Leben erhalten bleibt, als Mensch und Identität als Person. Möglichkeiten: Identität als haben wir es mit derselben Eiche zu Jeweils, das ist der entscheidende materieller Körper, Identität tun. Dasselbe gilt nun also für den Punkt, gelten verschiedene Kriteri- als Mensch und Identität als Menschen, und das heißt für mich, en, ob ich identisch oder nicht iden- Person“ sodass ich als Mensch mit dem Betisch bin. trunkenen identisch bin. Ein materieller Körper ist genau Doch Locke würde mir sagen: solange mit sich selbst identisch, wie kein Atom den Ich bin trotzdem eine andere Person als dieser. Wie Materiehaufen verlässt oder ein neues Atom hinzukann das sein? kommt. Offensichtlich bin ich als materieller Körper Für die Identität als Person ist das Bewusstsein entnicht identisch mit mir zu jener Nacht, da sich meine scheidend. Bewusstsein begleitet all unsere Gedanken materielle Zusammensetzung seitdem fortlaufend geund Handlungen und führt diese zu einer Einheit zuändert hat, indem mein Körper manche Atome verlosammen. In dieser Einheit besteht unsere Personalität, ren und andere neu aufgenommen hat. das heißt, auf diese Einheit beziehen wir uns, wenn wir Interessanter ist die Frage, ob ich als Mensch noch von unserem ‚Selbst‘ sprechen. Indem ich mir also meiderselbe bin. Hier gibt uns Locke ein anderes Identiner Handlungen bewusst bin, eigne ich sie mir an und tätskriterium: Die Erhaltung eines organischen Ganzen. mache sie erst zu meinen Handlungen. Dabei erstreckt Darin unterscheiden wir uns nicht von Pflanzen und Tiesich das Bewusstsein nicht nur auf gegenwärtige Handren. Eine Eiche bleibt solange dieselbe Eiche, wie sie ein lungen, sondern in Form von Erinnerung auch auf verorganisches Ganzes ist, egal welche Atome sie in dieser gangene. Indem ich mir einer vergangenen Handlung Zeit aufnimmt oder abgibt. Was bedeutet das genau? im gegenwärtigen Moment bewusst bin, indem ich Während bei einem bloßen Materiehaufen die Atome mich also an sie erinnere, mache ich diese vergangene beliebig angeordnet sein können, müssen die Atome Handlung zu meiner Handlung. Anzeige [ Was bedeutet das alles ?] Die kleinen Bücher zu den großen Fragen J ER BAN ED 5, – D Zeitlose und zeitgenössische Klassiker der Philosophie, die für die Gegenwart Relevantes zu sagen haben. NEU Weitere Bände der Reihe www.reclam.de Reclam cog!to 07/2014 51 Locke veranschaulicht diesen Gedanken wie folgt: Angenommen es wäre im gegenwärtigen Moment Teil meines Bewusstseins, die Arche Noah während der Sintflut gesehen zu haben, ebenso wie es Teil meines Bewusstseins ist, gestern in den Park gegangen zu sein. So wären beide Handlungen – die Arche Noah gesehen zu haben und in den Park gegangen zu sein – Teil meiner gegenwärtigen Person, sodass ich sagen würde: Ich habe die Arche Noah gesehen und ich bin in den Park gegangen. Eine vergangene Handlung gehört nicht deshalb zu meiner gegenwärtigen Person, weil ich derselbe Mensch bin, der damals gehandelt hat und bis heute dasselbe organische Ganze geblieben ist. Es ist offenbar, dass ich nicht derselbe Mensch bin, der die Arche Noah gesehen hat (wenn es überhaupt einen Menschen gab, der sie gesehen hat). Derselbe Mensch zu sein und dieselbe Person zu sein ist nicht das gleiche. Personalität und Verantwortung Indem ich mir also im gegenwärtigen Augenblick sowohl meiner aktuellen als auch meiner vergangenen Gedanken und Handlungen bewusst bin, führe ich diese zu einer Einheit zusammen und konstituiere mich so als Person. Das bedeutet aber: Alle Handlungen, auf die sich mein gegenwärtiges Bewusstsein nicht erstreckt, an die ich mich also nicht erinnern kann, gehören nicht zu mir als Person. Wenn sich mein gegenwärtiges Bewusstsein nicht auf den Moment erstreckt, in welchem ich das Auto beschädigt habe, dann war es tatsächlich nicht ich selbst, der das getan hat, sondern ein anderer. Das heißt, es war kein anderer Mensch, aber eine andere Person. Welche Konsequenz hat diese Unterscheidung? Für Locke ist sie entscheidend für die Frage, wofür jemand verantwortlich gemacht werden darf. Verantwortung richtet sich für Locke einzig nach Identität als Person. Steht die Frage im Raum, ob ich eine bestimmte Handlung ausgeführt habe und ob ich deshalb dafür zur Rechenschaft gezogen werden kann, so bezieht sich das ‚ich‘ auf zweierlei: Was die Ausführung der Handlung betrifft, so ist mit ‚ich‘ der Mensch gemeint. Nur Menschen, nicht aber Personen führen Handlungen aus. Bei der Frage, ob ich für die ausgeführte Handlung zur Rechenschaft gezogen werde, meint das ‚ich‘ die Person. 52 cog!to 07/2014 Nur die Person, nicht aber der Mensch verantwortet Handlungen. Es spielt also keine Rolle, dass derselbe Mensch gehandelt hat, es war eine andere Person. Freispruch, ha! Leider ist es nicht ganz so einfach. Ich kann nämlich nicht beweisen, dass ich mich nicht erinnern kann. Könnte ich das, müsste ich nach Locke auf jeden Fall freigesprochen werden. Dagegen steht es außer Zweifel, dass ich derselbe Mensch bin, der das Auto beschädigt hat. Ich werde also wahrscheinlich bestraft werden, wegen der für mich ungünstigen Beweislage. Lockes Theorie der Verantwortung ist hier mit einem gravierenden Problem konfrontiert: Eigentlich soll jemand verantwortlich sein aufgrund seiner Identität als Person und nicht aufgrund seiner Identität als Mensch. Da sich meine Personalität jedoch allein durch unmittelbare Selbstzuschreibung vergangener und gegenwärtiger Handlungen konstituiert, ist sie für andere prinzipiell unzugänglich. Als einen Menschen können mich andere identifizieren, meine Personalität bleibt ihnen jedoch verschlossen. Locke war sich dessen wohl bewusst, er sah darin aber kein größeres Problem. Menschliche Gerichtsbarkeit hat für ihn nur vorübergehende Bedeutung. Eine wahre Beurteilung nach unserer Personalität erfolgt erst gegenüber Gott. Seine Allwissenheit erlaubt ihm, mein Bewusstsein zu kennen: ‚In the great Day […] no one shall be made to answer for what he knows nothing of; but shall receive his Doom, his Conscience accusing or excusing him’ (Locke 2008: 216). Während der Verhandlung habe ich versucht, dem Richter den Unterschied von Identität als Mensch und als Person zu erklären und ihm nahegelegt, sich mehr an einer göttlichen Gerichtsbarkeit zu orientieren. „Ich war es nicht, obwohl ich es eigentlich war, verstehen Sie? Es ist alles eine Frage des Begriffs!“ Ihm war diese Strategie der Verteidigung erstaunlich unzugänglich. Von Mathias Koch Literatur Locke, John. 2008. An Essay Concerning Human Understanding. Oxford: Oxford University Press. Liberalismus und Toleranz Deckungsgleich oder spannungsreich? Von Fabian Heinrich „Ich bin ein Jude. Hat nicht ein Jude Augen? Hat nicht ein Jude Hände, Gliedmaßen, Werkzeuge, Sinne, Neigungen, Leidenschaften? Mit derselben Speise genährt, mit denselben Waffen verletzt, denselben Krankheiten unterworfen, mit denselben Mitteln geheilt, gewärmt und gekältet von eben dem Winter und Sommer als ein Christ? Wenn ihr uns stecht, bluten wir nicht? Wenn ihr uns kitzelt, lachen wir nicht? Wenn ihr uns vergiftet, sterben wir nicht? Und wenn ihr uns beleidigt, sollen wir uns nicht rächen? Sind wir euch in allen Dingen ähnlich, so wollen wir‘s euch auch darin gleich tun“ (Shakespeare 2004: 43f.). Szenenwechsel. Deutschland, Februar 2014: Als im Vorfeld der jährlich stattfindenden Islamkonferenz, der Vorsitzende der türkischen Gemeinde, Kenan Kolat, dem Bundesinnenminister einen Forderungskatalog vorlegt, der die zukünftigen Themen der Konferenz bestimmen sollte, war der publizistische Aufschrei groß. In dem Katalog wurden unter anderem muslimische Seelsorger in Gefängnissen und Krankenhäusern und mehr wertschätzende Aussagen von Politikern zum Islam gefordert, um seine öffentliche Wahrnehmung zu verbessern. Größter Stein des Anstoßes war die Forderung nach einem muslimischen Feiertag in Deutschland. Kurz darauf sagte der Kölner Kardinal Meisner bei einer Veranstaltung der konservativen katholischen Bewegung „Neokatechumenaler Weg“: „Ich sage immer: eine Familie von euch ersetzt mir drei muslimische Familien.“ Etwa zur gleichen Zeit spricht Wolfgang Thierse in einem Zeitungsinterview davon, dass die Ehe zwischen Mann und Frau ein erstrebenswertes Ideal unserer Gesellschaft sei. Zwischen 1600 und 2014 liegt ein langer Weg. Da fragt man sich, warum Toleranzforderungen noch immer von so vielen Seiten so vehement geäußert werden. Eine Antwort darauf könnte so lauten: Unsere Gesellschaft ist keine klassisch liberale Gesellschaft. In einer wirklich liberalen Gesellschaft würden die beschriebenen Szenen nicht stattfinden können. Denn Liberalismus und Toleranz sind zwei sich bedingende Begriffe. Liberalismus wird in westlichen Demokratien oft falsch verstanden und nur unzureichend praktiziert. Nur aus dieser Schieflage des Liberalismus erklären sich die Toleranzforderungen. Denn eine wirklich liberale Gesellschaft ist eo ipso eine tolerante Gesellschaft. Die Gleichung ist einfach: Wer liberal ist, und so handelt, ist tolerant. Wer tolerant ist, und so handelt, ist liberal. Die Ambivalenz dieser Stelle liegt auf der Hand: Eine Toleranzforderung zur Befriedigung von Rachegelüsten. Auf der einen Seite wollen wir Shylock zustimmen und seinen Appell an Menschlichkeit unterschreiben. Auf der anderen Seite beschleicht den Leser ein unangenehmes Beklemmen. Die Wut und die Lust auf Rache für zuvor erduldetes Unrecht scheinen auf den ersten Blick verständlich, sind aber in letzter Konsequenz logische Folgen aus einer sich immer tiefer bohrenden Spirale der gegenseitigen Intoleranz. II Wollten wir den Liberalismus auf einen allgemeinen Nenner bringen, so können wir die bekannte Aussage anführen, dass die Freiheit des Einzelnen dort endet, wo die des Anderen beginnt. Diese Ansicht vertrat u.a. John Stuart Mill, einer der Gründungsväter des Liberalismus. Freiheit ist für ihn der erste und stärkste Wunsch der menschlichen Natur, der es ihm ermöglicht, sich selbst zu entfalten. Staatliche Interventionen müssen weitestgehend zurückgewiesen werden, da sie den Forderungen nach Toleranz gegenüber anderen sind in liberalen Demokratien laut und vielfältig. Dabei sind diese Forderungen nur Symptom einer Gesellschaft, in der sich der Liberalismus in einer misslichen Lage befindet. Warum es in einer wirklich liberalen Gesellschaft keiner Forderung nach Toleranz bedarf. I enedig um 1600: In Shakespeares Kaufmann von Venedig kommt es im dritten Akt auf dem Rialto zu einer beeindruckenden wie verstörenden Szene. Der Jude Shylock darf endlich seinen Anspruch auf ein Stück Menschenfleisch aus der Brust des christlichen Kaufmanns Antonio in die Tat umsetzen. Dieser hatte sich nicht an die zuvor vertraglich geregelten Bedingungen eines Zinsgeschäftes gehalten und soll nun leiden. In der Hoffnung um Milde wird Shylock von Antonio gefragt, ob er nicht lieber Gnade walten lassen wolle. Was Shylock darauf entgegnet, gehört zu den bekanntesten Toleranzforderungen der Weltliteratur: V cog!to 07/2014 53 54 cog!to 07/2014 Einzelnen in seiner freien Entfaltung behindern. Der Mensch gehört sich selbst und ist sein eigener Gesetzgeber: „über sich selbst, über seinen eigenen Körper und Geist ist der einzelne souveräner Herrscher“ (Mill 1988: 16). Der Liberalismus eröffnet also dem Einzelnen ein enorm weites Feld auf dem er sich erfahren und ausbreiten kann. Keine andere politische Idee der Geistesgeschichte räumt dem einzelnen Menschen solche Entfaltungsmöglichkeiten ein. In eine ähnliche Richtung gehen die Gedanken Immanuel Kants. Für ihn hat jeder Mensch qua seines Menschseins unveräußerliche Rechte. Kant nennt dieses Recht „Freiheit“ und führt aus: „Freiheit (unabhängig von eines Anderen nöthigender Willkür), sofern sie mit jedes Anderen Freiheit nach einem allgemeinen Gesetz zusammen bestehen kann, ist dieses einzige, ursprüngliche, jedem Menschen kraft seiner Menschheit zustehende Recht“ (AA VI. 37). Es scheint zu einer langen Tradition des liberalen Selbstverständnis zu gehören, dass die Freiheit einer Person ihre natürliche Grenze bei der Freiheit einer anderen Person findet. Im liberalen Freiheitsverständnis wird also nie nur die eigene Freiheit betrachtet, sondern ebenso die Freiheit des Anderen mitgedacht. Denn um die Grenzen meiner eigenen Freiheit zu erfahren, muss ich die Grenzen der Freiheit des Anderen kennen. Individuelle Freiheit kann man also nicht nur als ein Einzelphänomen betrachten, sondern sie koppelt sich immer auch an die Mitmenschen, deren Freiheitssphäre man nicht verletzen darf. Dieser Kernpunkt des liberalen Selbstverständnis steht in engem Zusammenhang mit der Toleranz. Denn das Ausüben meiner Freiheit kommt ganz prinzipiell immer mit einer Zumutung daher, nämlich dem Dulden der Freiheitsausübung anderer. Dabei muss man weder Sympathien, noch Akzeptanz dafür aufbringen, ja, man kann die Freiheitsauslebung eines Anderen auch schlecht heißen und ablehnen, aber eines muss sie ein Liberaler in jedem Fall: dulden. Es gibt keinen rational nachvollziehbaren Grund dafür, die Freiheiten anderer einzuschränken, weil einem persönlich diese Lebensführung missfällt. Liberalismus heißt insofern: Duldung von Andersheit. III Nun könnte mit Goethe eingewendet werden: „Toleranz sollte eigentlich nur eine vorübergehende Gesinnung sein. Sie muss zur Anerkennung führen. Dulden heißt beleidigen“ (Goethe 2006: 23). Bedarf es also mehr als Toleranz? Bedeutet dulden tatsächlich beleidigen? Zwar muss man einräumen, dass Duldung auch eine Ablehnung beinhalten kann, aber das hat zunächst keine Auswirkungen auf das friedliche Miteinander. In einer Gesellschaft unter Gleichen in dem Sinne, dass jeder Mensch die gleichen basalen Rechte und vor allem im persönlichen Lebensentwurf die gleiche Wertigkeit hat wie jeder andere auch, ist Toleranz eine durchaus ausreichende Gesinnung um ein friedliches Zusammenleben zu garantieren. An- erkennung und Akzeptanz können möglich sein, aber nicht erwartet oder eingefordert werden. Sollte der Fall eintreten, dass eine aus Ablehnung erfolgende Duldung in Übergriffe auf diese Person umschlägt, ist der Staat gefordert einzugreifen. Übergriffe sind in keinem Fall zu dulden. Doch der springende Punkt an den Forderungen nach Anerkennung und Akzeptanz ist der folgende: Eine solche Forderung, die über die Toleranz hinaus geht, kann nur in einer Gesellschaft geäußert werden, die keine gänzlich liberale ist. Nur in einer Gesellschaft, in der beispielsweise eine Religion vom Staate bevorzugt behandelt wird, wird eine andere Religion nach Anerkennung rufen. Nur in einer Gesellschaft – wie unsere aktuelle – in der eine bestimmte Lebensart als die Richtige und Gute angesehen wird, kann nach Gleichberechtigung der anderen gerufen werden. Doch gegen solch ein Verständnis des guten Lebens für alle wendet sich der Liberalismus: Das gute Leben setzt jeder selbst. Keine Gemeinschaft, keine Gesellschaft, kein Staat und kein anderes Individuum als ich selbst kann mir eine Definition über ein gutes Leben aufzwingen. Was ich als gut erachte, soll die gleiche Wertigkeit besitzen wie das, was mein Nachbar als gut erachtet. Solch ein Verständnis wird gemeinhin als Toleranz bezeichnet. IV Es zeigt sich: Liberalismus und Toleranz bedingen sich. Die Spannungen, die wir heute in den liberalen Demokratien erleben, rühren aus besagter Schieflage des Liberalismus. Eine tatsächlich liberale Gesellschaft kennt keine bevorzugte Lebensform. Eine liberale Gesellschaft kennt auch keine Steuervorteile für Ehegatten, kennt kein Betreuungsgeld und kein Rauchverbot. Was eine liberale Gesellschaft kennt, ist Verantwortung für das eigene Handeln und Toleranz für das eigenverantwortliche Handeln anderer, so sehr es einem auch widerstreben mag. Die liberale Botschaft ist daher simpel: Sei tolerant und handle verantwortungsvoll. Von Fabian Heinrich Literatur von Goethe, Johann Wolfgang. 2006. Maximen und Reflexionen. München: C. H. Beck. Kant, Immanuel. 1797. Die Metaphysik der Sitten, AA VI Mill, John S. 1988. Über die Freiheit. Stuttgart: Reclam. von Mises, Ludwig. 2006. Liberalismus. 4. Auflage. Sankt Augustin: Academia Verlag. Shakespeare, William. 2004. Der Kaufmann von Venedig, Stuttgart. cog!to 07/2014 55 Zwischen Determination und selbstgewählten Möglichkeiten Wie weit reicht die eigene Verantwortung für das Selbst? Von Sandra Müller Kann man seine Identität nach eigenen Wünschen gestalten oder ist das Selbst Spielball seiner sozialen Umgebung und des Schicksals? Die folgenden Reflexionen decken die Grenzen der Gestaltbarkeit von Identität auf: was kann als Kriterium einer gelungenen Lebensführung dienen und als Maßstab zur Beurteilung divergierender Lebenskonzepte herangezogen werden? „Das bin ich“ – fast nichts ist für uns so selbstverständlich wie diese Feststellung. Doch was ist dieses Selbst? Ist es ein Produkt unserer Entscheidung oder der gesellschaftlichen und biologischen Bedingungen denen wir unterliegen? Je mehr ich mich damit beschäftige, desto rätselhafter werden mir mein eigenes Selbst und ebenso die Lebenskonzepte meiner Mitmenschen. Denn an die eigene Wahl der Lebensverwirklichung schließt sich die Frage nach der Verantwortung als Mitglied der Gesellschaft an und damit auch die Beurteilung der Lebenswege im Vergleich. Was berechtigt einen dazu auf den eigenen Lebensentwurf stolz zu sein und anderen vorzuwerfen, sie hätten Chancen nicht genutzt oder würden sich im Wege stehen? Gibt es einen Grund dafür, dass man jemanden, der sich mit vollem Einsatz an die Spitze eines Unternehmens gekämpft hat, mehr Anerkennung zollt als dem Sohn des Chefs? Mögliche Antworten auf die Frage nach der Genese des Selbst offenbaren zunächst zwei Tendenzen. Einerseits ist man geneigt zu sagen, jeder sei für sein Leben und dessen individuelle Ausgestaltung selbst verantwortlich. Sonst würde sich eine Handlung nicht von bloßem Verhalten unterscheiden. Ein Heiratsantrag und ein zufälliger Blick, der als Flirt interpretiert wird, wären damit gleichwertig. Ebenso wenig gäbe es einen eigenen Willen, der zur Handlung veranlasst. Der Mensch wäre damit eingebettet in die natürliche 56 cog!to 07/2014 Kausalkette ohne die Möglichkeit bewusst selbst eine Ursache zu sein. Lebenspraktisch hätte dies fatale Wirkung. Denn räumt man dem menschlichen Handeln nicht zumindest eine gewisse Autonomie, Freiheit des Willens oder Eigenverantwortlichkeit ein, landet man in einer Situation der Gleichgültigkeit. Ob man sich so oder anders entscheidet, spielt keine Rolle. Bei Cicero findet sich dieser Gedanke, den man als αργὸς λόγος kennt: „Ist es über dich verhängt, von dieser Krankheit zu genesen, so magst du einen Arzt beziehen oder nicht, du wirst genesen. Ferner: ist es über dich verhängt, von dieser Krankheit nicht zu genesen, so magst du einen Arzt beiziehen oder nicht, du wirst nicht genesen. Das Eine aber oder das Andere ist vom Schicksal verhängt; folglich ist es zwecklos, einen Arzt zu gebrauchen“ (Cicero: 28f.). Dieser Schritt in Richtung Determinismus und fatum scheint gerade in unserer heutigen Zeit kontraintuitiv. Rechtzeitige Diagnose und Medikation entscheiden offenbar über das Weiterleben. Überlässt man seinen Lebensweg dem Schicksal und der göttlichen Vorsehung, kann das leicht zur Selbstaufgabe führen: Wer sollte denn dann entscheiden, urteilen oder kommunizieren? Um das zu verhindern, muss man dem Menschen einen gestalterischen Einfluss auf sein Leben einräumen. Eine erste Tendenz zur Beantwortung der eingangs aufgeworfenen Fragen sucht daher Eigenverantwort- lichkeit in einem Vermögen der Freiheit. Platon beendet seine Politeia mit einem Mythos, der skizziert, man würde sein körperliches und Zwängen unterliegendes Menschenleben in einem präexistentiellen Zustand durch Los frei wählen. Die Stoa versucht in der Das In-der-Welt-Sein als Grenze der Freiheit συγκατάθεσις einen Raum für moralische Verantwortung und Entscheidungsfreiheit zu finden. Zwar könne man äußere Umstände nicht ändern, wohl aber den Umgang mit seinem Schicksal: „Wer will, den führt das Schicksal, Doch ansonsten schleppt es ihn“ (Seneca: 107, 11). Und spätestens im Zuge der Aufklärung wird die Freiheit in Zusammenhang mit der menschlichen Vernunft gebracht. Sucht man nach Freiheit, vermutet man sie am ehesten in einem innerlichen und geistigen Vermögen. Die Grenzen des Körperlichen sind zu offensichtlich. Es ist vergänglich, begrenzt und abgegrenzt zu anderem. Die zweite Tendenz auf der Suche nach dem Selbst beschäftigt sich mit den Grenzen der menschlichen Freiheit. Nicht alles unterliegt dem eigenen Plan: wer in der Welt handelt, setzt sein Tun lebensweltlichen Einflüssen und äußeren Umständen aus, die es verändern und zu einem der Absicht gänzlich verschiedenen Ergebnis führen. Man kann das die Bedingtheit unseres Handeln durch das In-der Welt-Sein nennen. Darunter verstehe ich zunächst die Grundvoraussetzungen der Lebensgestaltung: die Beschaffenheit des eigenen Körpers als auch die kulturellen, gesellschaftlichen Strukturen, in die wir mit Eintritt in diese Welt und Zeit geworfen wurden. Es ist offensichtlich, dass eine erste wichtige Voraussetzung für das Selbst die Gesundheit ist. Deshalb wird sie in der medizinethischen Debatte auch als „Primärgut“ (Schöne-Seiffert 2008: 178) bezeichnet, denn sie sei ähnlich wie eine materielle Grundversorgung, Ausbildung und Arbeitschancen Ausgangspunkt für die Verwirklichung der eigenen Lebenspläne. Ernährung, Freizeitgestaltung, Berufswahl und Tagesablauf unterliegen zuallererst der körperlichen Beschaffenheit des Individuums, auf die der eigene Einfluss, wenn überhaupt, nur sehr gering gegeben ist. Ein weiterer Aspekt der In-der-Welt-Sein-Grenze ist kultureller und sozialer Natur. Unsere Erziehung und Bildung, die von dem jeweiligen Normenkostüm der Gesellschaft, in der wir aufwachsen abhängen, prägen uns auch dahingehend, welche Wege für uns überhaupt als gangbar erscheinen. Ein arabisch-muslimisches Mädchen einer Bauernfamilie wird andere Pläne verfolgen, als die Tochter eines westlichen Unternehmers. Anzeige [anzeige bavaria druck] cog!to 07/2014 57 Insoweit kann das In-der-Welt-Sein unser intendiertes Handeln in der Realisierung bedingen und verformen. Obwohl man eine gewisse Absicht verfolgt, sorgt die Praxis dafür, dass ein ganz anderes Ergebnis herauskommt. Wenn man zum Beispiel alles auf eine gute Ausbildung setzt und zielstrebig seine Karriere verfolgt und dann ungewollt schwanger wird. Oder immer pünktlich und zuverlässig in der Arbeit ist und betriebsbedingt gekündigt wird. Solche Verwirklichungsprobleme der gewünschten Pläne leiten zu einer weiteren Grenze der menschlichen Freiheit über. Denn selbst wenn die Absicht gelingt, heißt das nicht, dass auch die anderen das Getane so verstehen, wie es gemeint war. Hier offenbart sich eine hermeneutische Bedingtheit des Verstehens und Verstandenwerdens von Akteuren und ihren Handlungen. Missverständnisse sind dafür ein Paradebeispiel: Komplimente, die anders als beabsichtigt das Gegenüber verletzen oder konstruktive Kritik, die den anderen überfordert und damit an sich zweifeln lassen statt zu helfen. Diese hermeneutische Lücke führt zu der Frage, ob das Selbst nur so ist, wie es von einem selbst gedacht ist oder wie es die anderen verstehen. So oder so kann man aber festhalten, dass Menschen als gesellschaftliche Wesen sowohl von der eigenen Intention als auch von der Beurteilung durch die anderen geprägt werden. Doch vor einer Betrachtung des Verstehen und Verstandenwerden stellt sich die Frage, ob wir das, was wir wollen, auch wirklich wollen können. Vielleicht könnte man diese Grenze einen psychologischen oder erkenntnistheoretischen Bewusstseinszweifel nennen. Arthur Schopenhauer formuliert dieses Bedenken so: „Du kannst thun was du willst: aber du kannst, in jedem gegebenen Augenblick deines Lebens, nur ein Bestimmtes wollen und schlechterdings nicht Anderes, als dieses Eine“ (Schopenhauer: 58f.). Selbst wenn wir die Handlungen von ihrer Verwirklichung in der Welt und ihrer Sprachlichkeit trennen, darf berechtigterweise angezweifelt werden, ob wir im Denken frei sind, ob zumindest das Denken unserem Einfluss unterliegt. Denn das cogito, welches nach Descartes methodischem Zweifel übrig bleibt, ist in seiner Beschaffenheit nicht eindeutig zu erklären. Kant formuliert nicht zufällig in seinen Reflexionen über das Selbstbewusstsein, das Denkende sehr vorsichtig als „dieses Ich oder Er oder Es (das Ding), welches denkt“ (Kant 1977:343). Der zweiten Tendenz folgend, lassen sich die Grenzen der menschlichen Freiheit und damit die Grenzen, der eigenen Verantwortung für den eigenen Lebensweg auf unterschiedlichen Ebenen auffinden: dem materiellen In-der-Welt-Sein, dem hermeneutischen Kommunizieren und der theoretischen Bewusstseinskonstitution. Der Mensch als Spannungsverhältnis Die Frage, inwiefern wir unser Selbst selbst wählen und dafür verantwortlich sind, wer wir sind, führt in das Span- 58 cog!to 07/2014 nungsfeld von Freiheit und Determination. Nehmen wir die zwei Tendenzen als erste Orientierung, kommen wir zu folgender These: Es gibt eine, wenn auch begrenzte Eigenverantwortlichkeit des Menschen. Da man diese, wenn man allen Menschen gleichermaßen zugestehen muss, untersucht man hier etwas Allgemeines: die menschliche Natur. Die Rückbeziehung auf eine allgemeine menschliche Beschaffenheit ist es, was einen Vergleich von Lebenskonzepten generell rechtfertigt. Entweder jeder ist für sein eigenes Selbst verantwortlich oder niemand. Beachtet man die eben entdeckten Grenzen der menschlichen Freiheit und begibt sich innerhalb derer auf die Suche nach der menschlichen Natur, tritt man in die Spuren von Martin Heidegger. Er sucht das Allgemeine im Sein des Menschen. In Sein und Zeit schreibt er: „Das Seiende, dem es in seinem Sein um dieses selbst geht, verhält sich zu seinem Sein als seiner eigensten Möglichkeit. Dasein ist je seine Möglichkeit und es ‚hat‘ sie nicht nur noch eigenschaftlich als ein Vorhandenes.“ (Heidegger 2001:42) Das Selbst ist, als das, was es ist, stets Möglichkeit seines Seins. Das ist die natürliche und essentielle Seinsform des Daseins. Die verwirklichten Möglichkeiten sind keine bloße Dekoration eines tieferliegenden Bewusstseins. Sie sind nicht nur akzidentiell, sondern substantiell. Diese Erklärung ist nicht nur eine ontologische Daseins-Beschreibung, sondern enthält zumindest unterschwellig eine normative Komponente. Das Dasein ist erst, was es ist, wenn es sich selbst als seine Möglichkeiten begreift, sich eben nicht nur werfen lässt, sondern beginnt sich zu entwerfen. Diese Existenzverfassung des Daseins bietet für JeanPaul Sartre die Basis einer radikalen Konsequenz: hin zur Freiheit und Verantwortung des Menschen. Sich explizit auf den Daseins-Begriff von Heidegger beziehend schreibt er: „Was bedeutet hier, daß die Existenz der Essenz vorausgeht? Es bedeutet, daß der Mensch erst existiert, auf sich trifft, in die Welt eintritt, und sich erst dann definiert. Der Mensch, wie ihn der Existentialist versteht, ist nicht definierbar, weil er zunächst nichts ist. Er wird erst dann, und er wird so sein, wie er sich geschaffen haben wird. Folglich gibt es keine menschliche Natur, da es keinen Gott gibt, sie zu ersinnen. Der Mensch, er ist lediglich, allerdings nicht lediglich wie er sich auffaßt, sondern wie er sich nach der Existenz auffaßt, nach diesem Elan zur Existenz hin; der Mensch ist nichts anderes als das, wozu er sich macht“ (Sartre 2012: 149f.). In seinem Aufsatz „Der Existenzialismus ist ein Humanismus“ nennt Sartre dies das erste Prinzip des Existenzialismus. Der Mensch wird nicht gemacht, sondern er macht sich. Der Mensch wählt aus seinen Möglichkeiten, die, wie zuvor erörtert, zwar durchaus begrenzt sind, aber einen Spielraum lassen, innerhalb dessen jeder Mensch die volle Verantwortung für seine Handlungen trägt, die ihn zu dem machen, was er ist. Wenn Grundkurs Philosophie systematisch – verständlich – klar gegliedert Band 1 Gerd Haeffner (Hrsg.) Band 8,1 Heinrich C. Kuhn Philosophische Anthropologie Philosophie der Renaissance ISBN 978-3-17-018991-1. € 20,– Band 2 Harald Schöndorf ISBN 978-3-17-025215-8. € 24,99 Auch als E-Book erhältlich Band 4 Friedo Ricken Allgemeine Ethik ISBN 978-3-17-022583-1. € 26,90 Band 5 Josef Schmidt Philosophie des 17. und 18. Jahrhunderts ISBN 978-3-17-017958-5. € 20,– Band 6 Friedo Ricken Band 14 Norbert Brieskorn Rechtsphilosophie In Vorbereitung ISBN 978-3-17-009966-1. € 14,80 Band 9 Emerich Coreth/Peter Ehlen Josef Schmidt Philosophie Band 16 Günther Pöltner des 19. Jahrhunderts Band 17 Friedo Ricken ISBN 978-3-17-020607-6. € 18,– Philosophische Theologie Sozialethik ISBN 978-3-17-018671-2. Ca. € 26,– ISBN 978-3-17-022502-2. € 24,99 Auch als E-Book erhältlich Auch als E-Book erhältlich Band 8,2 Erkenntnistheorie Band 13 Friedo Ricken Band 10 Peter Ehlen/Gerd Haeffner Friedo Ricken Philosophische Ästhetik ISBN 978-3-17-016976-0. € 24,– Religionsphilosophie ISBN 978-3-17-011568-2. € 20,– Band 18 Winfried Löffler Philosophie der Antike Philosophie des 20. Jahrhunderts ISBN 978-3-17-019909-5. € 22,– ISBN 978-3-17-020780-6. € 24,80 ISBN 978-3-17-015460-5. € 23,– Band 7 Band 12 Hans-Dieter Mutschler Band 19 Norbert Brieskorn Naturphilosophie Sozialphilosophie ISBN 978-3-17-016814-5. € 16,– ISBN 978-3-17-020521-5. € 22,– Philosophie des Mittelalters In Vorbereitung Einführung in die Logik Leseproben und weitere Informationen unter www.kohlhammer.de Kohlhammer 59 cog!to 07/2014 es wirklich so ist, dass die Existenz dem Wesen vorausgeht, der Mensch nicht a priori festgelegt ist, ist er gänzlich frei und unabhängig. Wir scheinen hier dem heutigen Individualitätsbegriff eindeutig näher gekommen zu sein. Es gibt keinen Gott und auch keine feste menschliche Natur, die uns determiniert, im Gegenteil: „der Mensch ist dazu verurteilt, frei zu sein“ (Sartre 2012: 155). Trotzdem hat auch diese freie Individualität eine Grenze. Sartre erinnert den Menschen mit seinem Existenzialismus daran, dass es im Universum keine andere gesetzgebende Instanz gibt außer den Menschen selbst. Die individuellen Entscheidungen sind es, die unsere Gesellschaft kreieren und damit erst ein Allgemeines schaffen. Es gibt keine menschliche Natur, aus der man feste Richtlinien für moralische Entscheidungen ableiten kann. Alles ist menschlich und beruht auf freiem Entschluss. Als Basis dafür nennt Sartre, die menschliche conditio, die allen gemein ist. Mit seinen Handlungen verantwortet man demnach nicht nur sich selbst als Einzelnen, sondern die gesamte Menschheit. Dadurch, dass Gott wegfällt und auch eine dem Menschen über oder zugrunde liegende, von seinem verwirklichten Dasein unabhängige Seinsform, rückt die Existenz der anderen Menschen in den Mittelpunkt. Das Selbst ist auf die Wahrnehmung durch die Anderen angewiesen, sonst wäre es nichts. Diese Angewiesenheit führt zu einer Verantwortung, die Existenz zu schützen. Einer Verantwortung nicht nur für sich selbst, sondern für die gesamte Menschheit. Welche Rückschlüsse kann man aus diesen Reflexionen auf das Selbst ziehen? Der Mensch scheint ein Spannungsverhältnis zu sein: sein Selbstkonzept hat Grenzen und innerhalb dieser sind es seine selbstgewählten Möglichkeiten. Mit Kant könnte man die menschliche Natur als Antagonismus der ungeselligen Geselligkeit auffassen – hier würde sich die Spannung des eigenen Selbst zu den Anderen zeigen. Einerseits braucht man die Mitmenschen, um alle seine Anlagen zu entfalten. Andererseits sehnt man sich nach Vereinzelung, weil man doch gerne sein eigener Herr ist und sich so einrichten möchte, wie man es selber für gut hält. Auch kann man mit Heidegger auf den Kontrast zwischen Geworfenheit und Entwurf hinweisen. Einerseits ist man eben in diese Welt geworfen und durch sie determiniert. Andererseits hat man innerhalb dieser Grenzen auch schöpferische Freiheit sich zu entwerfen. 60 cog!to 07/2014 Beides ist Inhalt der natürlichen menschlichen Verfasstheit. Unser Selbst liegt wohl zwischen Individualität und Allgemeinem, zwischen Freiheit und Determination, zwischen Körper und Geist. Man hat nicht alle Möglichkeiten zur freien Selbstverwirklichung in seinem Leben zur Verfügung. Aber es liegt in der Verantwortung eines jeden Menschen, die persönliche Freiheit, dort, wo sie gegeben ist, zu nutzen. Einerseits um sich selbst zu seiner bestmöglichen Verwirklichung zu bringen und andererseits um mit diesem Konzept wiederum auf andere Menschen und deren Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung zu wirken. Versteht man die Welt als Spiel, ist man als Mensch sowohl Spielfigur, die gespielt wird, aber bisweilen auch die Instanz, die Züge macht und Regeln mitgestaltet. Und ich glaube, je mehr man sich dessen bewusst wird, wo die begrenzte menschliche Freiheit zu finden ist, desto effektiver kann man auf sie zugreifen. Will man sein Selbst oder die gewählten Selbste der Anderen beurteilen, muss man sich also fragen, ob sich das jeweilige Dasein seiner Möglichkeiten bewusst ist. Erst wenn man seine Möglichkeiten erkennt und nutzt, hat man die Verantwortung für sich und damit auch für die anderen übernommen. Erst in dieser Bewusstwerdung ist man im eigentlichen Sinne ein Selbst geworden. Von Sandra Müller Literatur Cicero, Marcus Tullius. 1828. Vom Schicksal. Aus dem Lateinischen von Georg Heinrich Moser. Stuttgart: Metzler. Heidegger, Martin. 2001. Sein und Zeit, Tübingen: Max Niemeyer . Kant, Immanuel. 1977. Kritik der reinen Vernunft. In: Werke in zwölf Bänden. Herausgegeben von Wilhelm Weischedel. Frankfurt am Main: Suhrkamp. Sartre, Jean-Paul. 2012. Der Existentialismus ist ein Humanismus und andere philosophische Essays. Hamburg: Rowohlt . Schöne-Seifert, Bettina. 2008. Grundlagen der Medizinethik. Stuttgart: Kröner. Seneca. 1965. Briefe an Lucillius. In: Gesamtausgabe II. Stoische Lebenskunst. Darmstadt: Rowohlt. Schopenhauer, Arthur. 1978. Preisschrift über die Freiheit des Willens. Hamburg: Meiner. RUBRIK PARTEINAHME Die Beiträge in Parteinahme gehen der Verbindung von Philosophie und Politik nach. Diesmal sprechen wir mit Micha Brumlik über Heideggers Verbindungen zum Nationalsozialismus, führten mit dem gegenwärtigen Dekan der Fakultät für Philosophie, Axel Hutter, ein Interview – und nicht zuletzt verteidigen Niko Wolf und Gregor Bös die Notwendigkeit von Freiräumen im Philosophiestudium. cog!to 07/2014 61 War Heidegger Nationalsozialist? Im Gespräch mit Micha Brumlik über „seinsgeschichtlichen Judenhass“, vorbegriffliche Weltverhältnisse und faschistische Philosophie Das Interview führte Miguel de la Riva cog!to: Anlässlich des Erscheinens der „Schwarzen Hefte“1 wird erneut diskutiert, ob Martin Heidegger Nationalsozialist war. Welche Verbindungen unterhielt Heidegger zum Nationalsozialismus? Micha Brumlik: Martin Heidegger war überzeugter Nationalsozialist. Er war über die ganze Zeit des Nationalsozialismus hinweg Mitglied der NSDAP und plädierte in seiner Eröffnungsrede2 als Rektor in Freiburg 1933 dafür, die Universität und das geistige Leben aus seiner von ihm so genannten „Unverbindlichkeit“ zu befreien und dem Dienst am Volksganzen zu unterstellen. Er spricht in dieser Rektoratsrede vom Arbeitsdienst, vom Wehrdienst und von dem, was er den Studierenden empfiehlt, vom Wissensdienst, die alle auch Gegenstand von NS-Propaganda waren. cog!to: Hier soll Wissenschaft in den Dienst eines politischen Projekts gestellt werden – und das sollte auch auf die Universitätsstruktur durchschlagen. Es wird berichtet, dass Heidegger als Rektor das „Führerprinzip“ an der Universität durchsetzen wollte. Was ist damit gemeint? Brumlik: Die alte Professorenuniversität war gleichsam geistesaristokratisch verfasst: Die sich selbst verwaltenden Professoren, zusammengefasst im Senat, wählten einen mehr oder weniger ohnmächtigen Rek1 Heidegger, Martin. 2014. Überlegungen II-VI (Schwarze Hefte 1931-1938). Herausgegeben von Peter Trawny. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann. Heidegger, Martin. 2014. Überlegungen VII-XI (Schwarze Hefte 1938/39). Herausgegeben von Peter Trawny. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann. Heidegger, Martin. 2014. Überlegungen XIIXV (Schwarze Hefte 1939-1941). Herausgegeben von Peter Trawny. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann. 2 „Die Selbstbehauptung der deutschen Universität“. In: Heidegger, Martin. 2000. Reden und andere Zeugnisse eines Lebensweges 1910-1976, S. 107-117. Herausgegeben von Hermann Heidegger. Frankfurt: Vittorio Klostermann. 62 cog!to 07/2014 tor, der nicht mehr als ein „primus inter pares“ war. Die Nationalsozialisten wollten das ändern – und Heidegger war einer derer, die das „Führerprinzip“ auch in den Universitäten durchsetzen wollten. Das bedeutete, dass die Rektoren nicht mehr von den Professoren gewählt, sondern von den Kultusministerien eingesetzt würden, und sie wiederum die Dekane einsetzten – und das galt am Ende der Kette dann auch für die Studentenvertreter. cog!to: Kaum ein Jahr später trat Heidegger 1934 enttäuscht von seinem Rektorat zurück. Was lief schief? Brumlik: Es funktionierte nicht so, wie er sich das vorgestellt hat – weder waren ihm die meisten Professoren zu Diensten, noch haben sich die Studierenden dieser Führerstruktur und diesem Wissensdienst unterstellt. Er merkte, dass er ein geistiger Führer des Führers der nationalsozialistischen Bewegung sein wollte – damit jedoch nicht einmal an der Universität durchschlagen konnte. Zudem wurde ihm von anderen, ebenfalls überzeugt nationalsozialistischen Professoren Nihilismus vorgeworfen, womit er nicht gerade das Vertrauen der nationalsozialistischen Machthaber erwarb. cog!to: Könnte man meinen, dass Heideggers nationalsozialistisches Engagement eine kurze, zeitgeistbedingte Episode war – und er sich später davon abwendete? Brumlik: Ich glaube nicht. Die kürzlich erschienenen „Schwarzen Hefte“ zeigen, dass Heidegger ein überzeugter Nationalsozialist blieb, wenn auch auf eigene Weise. Freilich wollte er sich von dem abheben, was als biologistische oder rassistische Weltanschauung vertreten wurde, er wollte das nationalsozialistische Prinzip tieferlegen – noch hinter die Metaphysik zurück. Der Herausgeber Trawny spricht, was den Antisemitismus angeht, von einem „seinsgeschichtlichen“ Antisemitismus, also Judenhass. cog!to: In den „Schwarzen Heften“ finden wir keit zu geben. Das erinnert an den „heroischen RealisSätze wie: „Aus der vollen Einsicht in die frühere mus“ aus der konservativen Revolution in der Weimarer Täuschung über das Wesen und die geschichtliche Republik: Dem, was nicht plan- und steuerbar ist, ins Wesenskraft des Nationalsozialismus ergibt sich erst Auge zu sehen – aber zu versuchen sich in ihm zu bedie Notwendigkeit seiner Bejahung und zwar aus haupten. Heidegger dachte, dass man auf dem Weg zu denkerischen Gründen.“3 Wie kam ein Philosoph wie einem neuen Weltverhältnis zunächst das Christentum Heidegger dazu, den Nationalsozialismus so offensiv überwinden müsse, um eine neue Gottesvorstellung zu zu bejahen? entwickeln – und damit mittelbar auch das Judentum. Brumlik: In Sein und Zeit4 stellte Heidegger in einer In den Schwarzen Heften ist es die Größe, die durch das Weiterentwicklung der Phänomenologie Husserls die Bestreben die Welt planerisch zu gestalten die VerbinFrage nach dem Sein neu – und damit auch die Frage dung zum Ursprung verloren hat: „Eine der verstecktenach dem Menschen als demjenigem Seiendem, dem sten Gestalten des Riesigen und vielleicht die älteste ist es in seinem Sein um sein Sein geht. Heideggers erklärdie zähe Geschicklichkeit des Rechnens und Schiebens tes Vorhaben war es, das, was er für Metaphysik hielt, und Durcheinandermischens, wodurch die Weltlosigzu destruieren und eine ursprünglichere Welterfahrung keit des Judentums gegründet wird.“5 Dieses gleichsam manipulative Verhalten, das hier den Juden zugeschriephilosophisch zu erschließen. Insofern war er ein Gegben wird, begründet Weltlosigkeit – und das heißt zuner begrifflich arbeitender Philosophie. Und das sollte gleich, sich dem Geschick der Geschichte nicht mehr zu auch seinen Ort im Politischen vorzeichnen – Politik stellen: „Prophetie ist die Technik der Abwehr des Gesollte etwas „tieferem“ als lediglich Verfassungen o.Ä. schicklichen der Geschichte. Sie ist ein Instrument des entspringen. In Sein und Zeit lesen wir: „Dasein ist MitWillens zur Macht. Dass die großen Propheten Juden sein“, und später versucht er das im Begriff des Volkes sind, ist eine Tatsache, deren Geheimnis noch nicht gezu situieren. Schon in der Rektoratsrede meinte Heidacht worden (mit Antisemitismus degger, dass sich Politik aus einer hat die Bemerkung nichts zu tun, ursprünglicheren Sphäre heraus dieser ist so töricht und so verwerfentwickeln könnte. Vor diesem Dieser Rückgang auf den lich wie das blutige und vor allem Hintergrund, verbunden mit sei- Mythos, diese Abkehr von der unblutige Vorgehen des Christennen in der Tat oberflächlichen rationalistischen Tradition, tums gegen die Heiden).“6 Er meint politischen Ansichten, die viele diese Abwehr des reflexiven Intellektuelle in der Weimarer Re- Denkens – das ist faschistische also, er hätte eine nüchterne philosophische Feststellung getroffen publik vertraten – sie konnten mit Philosophie – aus Briefen geht aber eindeutig Demokratie nichts anfangen, wahervor, dass er Antisemit war. ren überzeugt, dass Kapitalismus cog!to: Wir haben bei Heidegger also eine Kritik nicht gut ist, sahen in der angelsächsischen Welt einen am neuzeitlichen Selbst- und Weltverhältnis; die hat Gegner „deutschen Wesens“ und deutscher Politik – etwas mit einem instrumentellen Weltverhältnis zu kommt er dazu, den Nationalsozialismus als politische tun, mit „Planen“ und „Rechnen“; das begründet Option ernst zu nehmen und im Nationalsozialismus in „Weltlosigkeit“ – und wird am Judentum festgeBezug auf das Volk so etwas eine Wiederbelebung einer macht. ursprünglicheren Sphäre zu vermuten. Brumlik: Genau so ist es, weil das Judentum mit seicog!to: In Sein und Zeit übt Heidegger eine Kritik ner Geschichtstheologie bei den Propheten den Anan einem Selbst- und Weltverhältnis, das er „seinsspruch erhebt die Geschichte in die Bahnen eines gottvergessen“ nennt und paradigmatisch im neuzeitgewollten Weltverhältnisses zu stellen. Da ist Heideglichen Rationalismus und einem von „Planen“ und ger ganz dagegen. Geschichte soll, wie im heroischen „Rechnen“ geprägten, instrumentellen NaturverRealismus, dem Geschick offen sein, dem, was unplanhältnis zum Ausdruck komme. Dabei scheint Heidegbar auf eine Person oder auf ein Volk zukommt. ger zunächst der Ansicht, dass die nationalsozialisticog!to: Angesichts der antisemitisch anmutenden sche Bewegung mit diesem „Rechenhaften“ bricht, Äußerungen: Finden wir in den schwarzen Heften einen Neuanfang im Seinsverhältnis markiert und eine Auseinandersetzung mit dem Judentum? Man daher zu bejahen ist. Später jedoch ordnet er den Nakönnte annehmen, dass Heidegger eine Kritik am Jutionalsozialismus selbst den „Machenschaften“ und dentum nicht aus Antisemitismus übt, sondern weil dem „Rechenhaften“ zu – bejaht ihn aber nichtsdeer es wie das Christentum oder die griechische Phistoweniger. Brumlik: Ja! Und das auch noch in Vorlesungen von 3 Heidegger, Überlegungen VII-XI, a.a.O., S. 408. 1953, wo er darüber nachdenkt, ob es neben den bei4 Heidegger, Martin. 1927. Sein und Zeit. Tübingen: Max Nieden Gestalten rechenhafter Politik – also dem von ihm meyer. so genannten Bolschewismus und dem amerikanischen 5 Heidegger, Überlegungen VII-XI, a.a.O., S. 97 Kapitalismus – etwas anderes gibt, das diese ursprüng6 Heidegger, Martin. Anmkerungen II-V. Im Erscheinen. Zit. liche Welterfahrung aufnimmt und, anders als die plan. Trawny, Peter. 2014. Heidegger und der Mythos der jüdinenden Bolschewiki und das planende angelsächsische schen Weltverschwörung. Frankfurt am Main: Klostermann, Kapital, bereit ist, dem Schicksal wieder eine MöglichS. 93. cog!to 07/2014 63 losophie zu „seinsvergessenen“ Weltanschauungen zählt. Brumlik: In den Schwarzen Heften gibt es mit dem Judentum keine Auseinandersetzung im engeren Sinne – eher kurzschlüssige Äußerungen: „Die Juden ‚leben‘ bei ihrer betont rechnerischen Begabung am längsten schon nach dem Rasseprinzip, weshalb sie sich auch am heftigsten gegen die uneingeschränkte Anwendung zur Wehr setzen.“7 Er will zeigen, dass Judentum, Christentum und griechische Philosophie die Seinsvergessenheit verstärken – und da muss man die ernsthafte philosophische Frage stellen: Kann es ein Philosophieren geben, das hinter Begriffe und Metaphysik zurück geht und eine ursprünglichere Erfahrung erschließt, wie sie vielleicht Menschen in schriftlosen Kulturen hatten? Heideggers Ziel war es, solches Denken und Erleben philosophisch zu nobilitieren. cog!to: Wollte Heidegger diese Texte veröffentlichen? Oder handelt es sich um kurzweilige Notizen, denen man eine gewisse Anfälligkeit für den Zeitgeist nachsehen mag? Brumlik: Es handelt sich nicht um flüchtig hingeworfene Tagebuchnotizen, sondern um ausformulierte, artikulierte Texte. Die Editoren gehen davon aus, dass er sie nicht veröffentlichen wollte oder erst nach seinem Ableben veröffentlicht sehen wollte. Meine Vermutung wäre: Als eine Art philosophisches Vermächtnis, gleichsam als letztes Wort des Denkers an die Nachwelt. cog!to: Haben wir bei Heidegger nach 1945 irgendeine Distanzierung oder Revision seiner nationalsozialistischen und antisemitischen Überzeugungen? Brumlik: Nein, überhaupt nicht. Nach dem Krieg wird Heidegger die „Fabrikation von Leichen“ mit industrieller Landwirtschaft oder Massentierhaltung vergleichen. Einen Begriff von der Würde und vom Leiden einzelner Menschen hat er einfach nicht. Ihn interessierte der Mensch als philosophische Größe, nicht aber als Individuum mit eigener Würde. Er dachte nicht in solchen Kategorien. cog!to: Was bedeutet das dafür, Heidegger als Philosoph zu lesen? Geht seine nationalsozialistische Gesinnung aus der Philosophie, die wir in Sein und Zeit finden, folgerichtig hervor – oder haben wir es mit einem Heidegger zu tun, der den Boden seiner 7 Heidegger, Überlegungen XII-XV, a.a.O., S. 56 früheren Auffassungen verlassen musste, um Nationalsozialist zu werden? Brumlik: Das ist eine schwierige Frage. Natürlich kam es dazu nicht mit zwingender logischer Konsequenz. Sie sprachen von „folgerichtig“, und das finde ich schlüssig. Heidegger versucht tiefer zu gehen als die Metaphysik der klassischen Philosophie und ihrer Begriffe. Dann musste es mit einer gewissen Folgerichtigkeit dazu kommen, dass wenn Begriffe von Welt, von Moral, von Metaphysik nichts mehr gelten und man sich auf vermeintlich ursprüngliche, mythische Erfahrungen bezieht, dieser Mythos auch bebildert und ausbuchstabiert wird – im Guten wie im Schlechten. Für ihn war das Christentum eine Form der Metaphysik – und er wusste, dass im Christentum griechisches Denken und Judentum zusammenkommen. Wenn man hinter beides zurück will, muss man es kritisieren und versuchen, wie er sagt, es zu „verwinden“. Daraus folgen dann antisemitische Äußerungen, die sich mit der politischen Programmatik des Nationalsozialismus ausgezeichnet vertragen, wenn auch nicht in ihrer biologistischen Spielart. cog!to: Man könnte fast glauben, Heidegger sei ein nationalsozialistischer Denker gewesen, den man zu den Akten legen sollte. Brumlik: Sein und Zeit wird als eine alltagsphänomenologische Wende Bestand haben. Dann aber fand statt, was Heidegger als „Kehre“ seines Denkens bezeichnete. Diese besteht im Anspruch auf ursprünglichere Weltbezüge zurückzukommen und die Begriffe und Kategorien dessen, was als westliches Denken bezeichnet wird, hinter sich zu lassen. Dieser Rückgang auf den Mythos, diese Abkehr von der rationalistischen Tradition, diese Abwehr des reflexiven Denkens, das ist faschistische Philosophie. Man kann diesen Weg, wie Heidegger zeigt, mit äußerst anspruchsvollen denkerischen Mitteln gehen – aber den Mythos als Weltverhältnis zu erneuern und politisch auszubuchstabieren, darin scheint mir die Gefahr und bei manchen vielleicht die Attraktivität dieses Denkens zu liegen. Das Interview führte Miguel de la Riva Mitarbeit: Sandra Müller und Janina Reichmann Foto: Janina Reichmann Zu Micha Brumlik: Micha Brumlik ist Emeritus für Erziehungswissenschaften an der Goethe-Universität Frankfurt und seit 2013 Seniorprofessor am Zentrum für Jüdische Studien Berlin/Brandenburg. Er interessiert sich insbesondere für entwicklungsbezogene Moralforschung sowie Religionsphilosophie. Zu seinen letzten Veröffentlichungen zählt „Messianisches Licht und menschliche Würde. Politische Theorie aus den Quellen des Judentums“ (Baden-Baden 2013). Derzeit forscht er über die jüdischen Schüler Hegels. 64 cog!to 07/2014 „Wir kommen nie zu Gedanken. Sie kommen zu uns.“ Heidegger Martin Heidegger: umstritten wie kein Zweiter. Dennoch gilt er als einer der bedeutendsten Philosophen des 20. Jahrhunderts. Das Handbuch erklärt die Gründe für die anhaltende Faszination, die von Heideggers Schaffen ausgeht, stellt die zentralen Werke vor und erklärt wichtige Schlüsselbegriffe. In der 2. Auflage mit neuen Begriffen, wie Mitsein, Sprache und Seinsgeschichte. Ebenfalls neu: die Rezeption durch Oskar Becker und Franz Rosenzweig sowie die Wahrnehmung Heideggers in Musik, Kunst, Film und neuen Medien. Unter Mitwirkung von 50 internationalen HeideggerForschern Mit neuen Begriffen und Beiträgen zur Rezeptionsgeschichte Thomä (Hrsg.) Heidegger-Handbuch Leben – Werk – Wirkung 2., überarb. und erw. Auflage 2013. 624 S. Geb. € 59,95 ISBN 978-3-476-02268-4 [email protected] www.metzlerverlag.de cog!to 07/2014 65 Äpfel versus Birnen Eine Replik auf Marisa Kurz´ „Ausgebrannte Chemiker, faule Philosophen“ Von Niko Wolf und Gregor Bös Geisteswissenschaftler nutzen ihre akademische Freiheit um in der Sonne auf dem Bauch zu liegen, während Naturwissenschaftler vor dem Burnout stehen. Für Marisa Kurz scheint das mehr als nur ein Vorurteil zu sein – und eine große Ungerechtigkeit. Zwei Doppelstudenten antworten ihr. Liebe Marisa, am 25.03. hast du auf Spiegel Online den Artikel „Stress im Studium: Ausgebrannte Chemiker, faule Philosophen”1 veröffentlicht. In der folgenden Debatte sahen viele ihre Vorurteile gegenüber Studierenden in den Geisteswissenschaften endlich bestätigt – und das von einer Biochemie- und Philosophiestudentin, die es ja „wissen muss!“ Dort sammeln sich faule Nichtstuer, denen Noten hinterhergeworfen werden, während nebenan in den Naturwissenschaften alle bis zum Burnout schuften. Als Philosophie- und Physikstudenten kennen auch wir beide Seiten, kommen aber zu einem ganz anderen Bild. Dabei möchten wir uns aber nicht an der alten Grundsatzfrage reiben, was ein Hochschulstudium leisten soll. Im Studium muss sowohl für freie Entfaltung und kritisches Denken als auch für die Vorbereitung auf einen Arbeitsmarkt Raum sein. Was uns interessiert, ist der Vorwurf ungleicher und vor allem ungerechter Anforderungen in geistes- und naturwissenschaftlichen Fächern. Dabei hat die Fairness, die du vermisst, folgende, zunächst plausibel scheinende Ansprüche: (1) Unterschiedliche Studiengänge sollten möglichst ähnliche Anforderungen an ihre Studierenden stellen. (2) Innerhalb eines Studiengangs sollten Studierende nach Leistung differenziert werden, damit sich „Leistung auch lohnt.“ 1Online abrufbar unter http://tinyurl.com/qchtpon 66 cog!to 07/2014 Dabei nimmst du an, dass die „idealen Studenten”, die sich über das vorgeschriebene Mindestmaß hinaus mit ihrem Fach auseinandersetzen, nicht der Regelfall sind: „Natürlich sollte ein idealer Philosophiestudent einen Anspruch an sich selbst haben: Aber handelt es sich auch nur bei der Mehrheit der Studenten um ideale Studenten?” Für die Mehrheit der Studierenden gelte daher folgendes: (3) Studierende verhalten sich üblicherweise wie kleine, profitmaximierende ECTS-Unternehmer: Sie versuchen mit möglichst geringem Aufwand möglichst viele Credit Points mit möglichst guten Noten zu ergattern. Fairness innerhalb eines Studiengangs In einem naturwissenschaftlichen Studium besuchen alle Studierende eines Jahrgangs die gleichen Vorlesungen und schreiben die gleichen Prüfungen. Dadurch sind die Leistungen zumindest innerhalb eines Jahrgangs vergleichbar. Ein Philosophiestudium ist aber ganz anders aufgebaut: Es gibt kaum ein Seminar, in dem nicht der Zweitsemester und die Masterstudentin miteinander diskutieren. Ihre Hausarbeiten gehen dann aber von ganz anderen Vorkenntnissen aus. Schließlich bescheinigt selbst beim Abschluss jedes Bachelorzeugnis ganz andere Studieninhalte. Um Vergleichbarkeit zu schaffen, müsste der Aufbau des Philosophiestudiums dem der naturwissenschaftlichen Studiengänge angenähert werden, mit einem linear gegliederten, klar definierten Wissenskanon. Wie in der Physik klassische Mechanik vor Quantenmechanik gelehrt wird, müssten Studierende der Philosophie erst Methodenkurse und Veranstaltungen in antiker und mittelalterlicher Philosophie besuchen, um irgendwann zeitgenössische Autoren zu lesen. Das wäre absurd und widerspräche dem Konzept einer philosophischen Bildung. In der philosophischen Forschung gibt es keine Großprojekte mit vorhandenen Fragen, in die man sich eingliedern kann, nachdem man einen Studienkanon durchlaufen hat. Stattdessen wird von jedem Einzelnen erhebliche Selbständigkeit erwartet. Und »Wieder versuchen. Wieder scheitern. Besser scheitern« Samuel Beckett: »Wostward Ho« he c s i r Baye ie des m e d a s k n A e b i Schre L i t e r a t u rhaus München Seminare zum literarischen Schreiben für Studierende der Universitäten Bamberg, Bayreuth, Erlangen, LMU München, TU München, Regensburg Neue Ausschreibungen, Infos unter www.literaturhaus-muenchen.de/akademie cog!to 07/2014 67 „Statt strengere Bewertungen zu fordern, sollte man fragen, ob sich Leistungen in der Philosophie überhaupt in eine objektive Rangordnung bringen lassen“ auf dem Arbeitsmarkt bescheinigt der Philosophieabschluss keine spezifischen Fachkenntnisse, sondern allgemeine Fähigkeiten, für die es keine einheitliche und überprüfbare Vermittlung gibt. Darin, und nicht im Versagen der Dozierenden, liegt auch begründet, dass das Notenspektrum nicht voll ausgeschöpft wird. In der Folge sollte man statt strengere Bewertungen zu fordern besser fragen, ob sich die Leistung von Studierenden in der Philosophie überhaupt in eine objektive Rangordnung bringen lässt. Fairness zwischen Studiengängen Gleichzeitig kann man aber auch kein allgemeines Anforderungsniveau von grundverschiedenen Studiengängen erwarten. Als Kriterium für faire Ansprüche unterschiedlicher Studiengänge vergleichst du den verpflichtenden Arbeitsaufwand. Das geht aber an den Inhalten der jeweiligen Studiengänge völlig vorbei: Während in den Naturwissenschaften die Qualifikation für Arbeitsmarkt oder Wissenschaft und das Fachstudium Hand in Hand gehen, hat das Philosophiestudium für das spätere Arbeitsleben oft nur unterstützende Relevanz – neben allgemeinen Fähigkeiten, die das Studium vermittelt, muss man noch berufsspezifische Kenntnisse erwerben. Es ist daher nur vernünftig, dass neben dem Studium Raum für eigene Projekte und Qualifikationsmaßnahmen bleibt. Und auch diejenigen, die an der Universität bleiben möchten, brauchen Freiraum, um abseits der Seminare einen Fuß im Feld zu fassen und eigene Forschungsfragen zu entwickeln. Diese Fragen finden sich nämlich nicht beim Abschütteln von Prüfungsstress, sondern beim Querlesen in der Bibliothek. Du schreibst außerdem, dass es in Philosophie sehr viel einfacher ist, sich durch das Studium treiben zu lassen, ohne die Frage zu stellen, ob man hier denn wirklich seine Bestimmung gefunden hat. Diese Kritik können wir gut nachvollziehen, und die hohe Abbrecherquote, auch in späteren Semestern, stellt tatsächlich ein Problem dar. Ein Grund dafür ist sicherlich, dass Philosophie für die meisten kein Schulfach ist – zu beurteilen, ob einem das liegt oder nicht, dauert länger als bei Fächern die man schon seit Jahren kennt. Außerdem lässt sich das Studium eben auch nicht so klar strukturieren wie in den Naturwissenschaften – man braucht länger, um sich zurechtzufinden. Gerade deswegen ist die Erweiterung der Pflichtleistungen der falsche Ansatz. Dadurch fördert man nur das Credit-Sudoku: Je schwieriger es ist, den Minimalanforderungen zu entsprechen, desto weniger Studierende schaffen es, eigene Fragestellungen zu entwickeln. Auch wenn man erst lernen muss mit ihr umzugehen, hat die Freiheit im Philosophiestudium ihren wohlverdienten Platz. Es ist schade, wenn du diese Freiheit in deinem Studium nur als fehlenden Druck wahrnehmen konntest. Aber bitte mache sie anderen nicht kaputt, indem du das alte Klischee bekräftigst, dass es sich dabei um einen Freibrief zum Faulenzen handelt. Viele Grüße, Niko und Gregor Zu unseren Gastautoren: Niko Wolf (Fahrer) ist gegenwärtig Sprecher der Fachschaft Philosophie an der LMU München. Gregor Bös (Beifahrer) ist aktives Fachschaftsmitglied. Beide studieren im vierten Semester Philosophie und Physik. Wenn Sie Ihre Freiheit nicht fürs Studium einsetzen, fahren Sie mit dem Auto über den Balkan. 68 cog!to 07/2014 Reihe »zur Einführung« Herbst 2013 / Frühjahr 2014 ISBN 978-3-88506-068-0 14,90 Euro ISBN 978-3-88506-697-2 15,90 Euro ISBN 978-3-88506-072-7 14,90 Euro ISBN 978-3-88506-080-2 13,90 Euro ISBN 978-3-88506-081-9 13,90 Euro ISBN 978-3-88506-062-8 13,90 Euro ISBN 978-3-88506-069-7 12,90 Euro ISBN 978-3-88506-665-1 13,90 Euro ISBN 978-3-88506-075-8 14,90 Euro ISBN 978-3-88506-076-5 13,90 Euro ISBN 978-3-88506-077-2 13,90 Euro cog!to 07/2014 69 Auf einen Kaffee mit dem neuen Dekan Im Gespräch mit Axel Hutter über seine neue Position, die Studierendenzahl an der Fakultät und das Verhältnis von traditioneller und moderner Philosophie Das Interview führten Mathias Koch und Daniel Hoyer cog!to: Sie sind als neuer Dekan gewählt. Welche Ziele verfolgen Sie? Gibt es eine Art Agenda? Axel Hutter: Jedenfalls nicht in dem Sinne, dass man wie ein Politiker antritt mit einem Programm und deshalb von den Kollegen gewählt wurde, weil man eben dieses Programm vertreten hat. Als Dekan sorgt man dafür, und zwar möglichst unauffällig und im Hintergrund, dass die Selbstverwaltung der Fakultät sowie die Forschung und Lehre an den einzelnen Lehreinheiten möglichst gut und liberal funktionieren. Diese Aufgabe hat einen sehr kleinen direktiven Anteil, und einen großen kooperativen Anteil. cog!to: Kennen Sie einen konkreten Fall, an dem Sie in diese Richtung Einfluss nehmen konnten? Hutter: Wichtig ist diese Funktion zum Beispiel bei Berufungsverhandlungen. Dort ist der Dekan meist der Vorsitzende, aber nicht in dem Sinne, dass er Dinge vorgibt oder dergleichen, sondern dass er versucht, eine möglichst zielführende Sachdiskussion in Gang zu bringen. Die Fakultät hat in ihren Gremien immer eine kollegiale Verfassung, die Mitglieder begegnen sich auf Augenhöhe. Der Vorsitzende versucht die Institution des kollegialen Austausches am Leben zu halten und diesen Austausch möglichst zu erleichtern. cog!to: Unsere Fakultät wächst rasant. Wir erleben das in Seminaren, Sie haben den Blick von oben auf diese Situation. Welche Chancen erwachsen daraus, welche Herausforderungen gilt es zu meistern? Hutter: Das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt. Wir haben einen moderaten Zuwachs an Hauptfachstudierenden und einen besonders starken Zuwachs an Nebenfachstudierenden. Im Augenblick sind wir nach SLK das zweitnachgefragteste Nebenfach der Universität. 70 cog!to 07/2014 cog!to: Wie bewertet die Fakultät das? Hutter: Das ist eine komplexe Frage. Die Zahl der Studierenden wird von der Fakultät selbst unter verschiedenen Aspekten betrachtet, genau wie sie von der Hochschule und der Politik unter verschiedenen Aspekten betrachtet wird. Es gibt dabei zwei Extreme unter den Betrachtungsweisen. Eine besagt: Die Zahl der Studierenden ist völlig irrelevant, die harte Währung, auf die es ankommt, ist die Forschungsleistung. Die Vorbilder sind hier etwa Cambridge und Oxford, die von der Studierendenzahl eher kleine Universitäten sind. Für diese Universitäten ist es gerade ein Zeichen der Stärke, dass sie Zugangsbeschränkungen haben. Die andere Betrachtungsweise wäre, die Universität in erster Linie als Lehrbetrieb zu sehen. Dann ist die Studierendenzahl das Wichtigste. Die Politik ist hin- und hergerissen, geht aber eher in die letzte Richtung und macht die Mittelzuweisung abhängig von den Einschreibungen. Und da steht die LMU im Vergleich zu den anderen bayerischen Universitäten zurzeit nicht besonders gut da, auch weil die LMU die bayerische Universität mit den meisten sogenannten „kleinen“ Fächern ist. Vor diesem Hintergrund ist es gut, dass wir als Studienfach nachgefragt werden. Wir müssen hier einen Mittelweg finden, zum Beispiel: Den Bachelor eher offen und liberal mit geringen oder gar keinen Zulassungsbeschränkungen gestalten, den Master hingegen mit klar definierten Aufnahmekriterien. cog!to: Welche Lehrer spielten in Ihrem Werdegang eine wichtige Rolle? Hutter: Wichtig waren für mich Michael Theunissen, bei dem ich später auch promoviert habe, und Ernst Tugendhat. Was ich von meinen Lehrern gelernt habe und nun selbst versuche weiterzugeben, ist ein starkes anfangs, der Versuch, die Philosophie auf eine neue Interesse an der klassischen deutschen Philosophie von Grundlage zu stellen, immer wieder vorkommt. Die Kant bis Hegel, und zwar in einer Weise, die diese grosehr schematische Entgegenstellung von 2000 Jahren ßen philosophischen Entwürfe aus dem Museum einer Tradition und einer Form von Neuheit in der analytirein historischen Betrachtung herausholt und versucht, schen Philosophie, die es vorher nicht gab, ist historisch die originalen Einsichten, die damals Epoche gemacht wenig überzeugend. Es gibt meiner Einschätzung nach haben und die bis heudrei Typen von te die ganze Welt inter- Was ich von meinen Lehrern gelernt habe und nun philosophischem essieren, in eine SpraDenken. Es gibt weiterzugeben versuche ist ein starkes Interesse che zu übersetzen, die einmal die Traditian der klassischen deutschen Philosophie, wir heute sprechen und onspflege, die aus und zwar in einer Weise, die diese großen verstehen. Das ist keine der Philosophiegeleichte Aufgabe! Wie schichte gewonnephilosophischen Entwürfe aus dem Museum bei jeder guten Überne Standards übt rausholt und die Einsichten, die damals Epoche setzung muss man und weitergibt. gemacht haben und bis heute die ganze Welt dabei das Kunststück Dann gibt es selteinteressieren in eine Sprache zu übersetzen, die fertigbringen, das Orine, starke Zäsuren, wir heute sprechen und verstehen ginal zu erhalten und wo sich der Ton, trotzdem die sachlidie Sprache, auch chen Einsichten für heutige Zeitgenossen zugänglich die Referenzpunkte deutlich ändern, beispielsweise bei zu machen. Von meinen Lehrern habe ich das gelernt: Descartes oder Kant. Doch auch hier gilt: Die Fragen, Sich einerseits in eine Tradition der klassischen Philosodie sich die verschiedenen Philosophen stellen, müsphie zu stellen, daraus aber andererseits den Impuls zu sen verwandt sein. Wenn sie völlig anders wären, dann einer sehr gegenwärtigen, auch gegenwartskritischen wäre es nicht mehr Philosophie. Es mag aber sein, dass Philosophie zu entnehmen. Tugendhat ist zum Beispiel die Aversion und die Kritik an der Art und Weise, wie ein Denker, der eine moderne, an der analytischen Phiman bisher gefragt hat, überwiegt, sodass es erstmal losophie geschulte Rezeption der klassischen Tradition so scheinen kann, als würden die Fragen selbst verabanstrebt. schiedet. Der dritte Typ thematisiert die Vermittlung cog!to: Wie genau kann man das Verhältnis von zwischen Bruch und Fortsetzung. Bei diesem Typ stellt Tradition und dem neuen analytischen Projekt sich nicht nur die Frage, wie sich bestimmte Autoren fassen? selbst verstanden haben, sondern eben auch, wie man Hutter: Ich würde vorwegschicken, dass auch inihre Texte heute verstehen kann. Ich glaube, dass phinerhalb der sogenannten Tradition die Geste des Neulosophische Texte der Tradition umso zukunftsträchti- cog!to 07/2014 71 ger und lehrreicher sind, je mehr diese Anbindung an die eigene Sprache und das eigene Fragen gelingt. Ich denke hier zum Beispiel an Wittgenstein, der die Neuausrichtung seines Denkens im Tractatus ganz stark in den Dienst von Fragen stellt, die uralt sind. cog!to: Bleiben wir bei Wittgenstein. Wenn man den Tractatus liest, dann kommt man gegen Ende zu Sätzen wie „Die Logik ist transzendental“, „Die Ethik ist transzendental“, „Ethik und Ästhetik sind eines“, bei denen man aus einer analytischen Erwartung heraus fragt, inwiefern hier tatsächlich etwas verständlicher geworden ist. Hutter: Ich verstehe den Tractatus sehr stark von dem Gedanken der Grenzziehung her. Zentral ist dabei die etwas paradoxe Struktur, dass man eine Grenze zieht, ohne beide Seiten auf gleich verständliche Weise thematisieren zu können. Man kann aber Wittgenstein zufolge eine Grenze verständlich machen, indem man die eine Seite möglichst präzise abschreitet. In der Folge ergibt sich eine Dreiteilung des Denkens: Es gibt Begriffe, die diesseits der Grenze liegen, das sind die unproblematischen Begriffe bei Wittgenstein. Es gibt die extrem problematischen Begriffe, die jenseits der Grenze liegen. Die interessanten Begriffe aber, die auf der Grenze liegen, sind die transzendentalen Begriffe. cog!to: Lassen sich diese grenzziehenden Begriffe aus einer diesseitigen Position heraus formulieren? Hutter: Wittgensteins ziemlich tiefsinnige Antwort ist: Nein, sie lassen sich nicht formulieren, aber sie zeigen sich in jeder Formulierung. Wenn wir überhaupt etwas formulieren, bewegen wir uns innerhalb eines durch die Grenze konstituierten Feldes von Möglichkeiten. Die Logik ist da das beste Beispiel. Jeder Satz, der verständlich ist, ist den logischen Regeln gemäß gebaut. Für Wittgenstein war das Logische selbst zwar in jedem Satz am Werke, ließ sich aber durch keinen Satz aussagen. Sein sehr gutes Beispiel dafür ist die Tautolo- gie: Warum Tautologien wahr sind, und zwar in einem unüberbietbaren Sinne, lässt sich nicht sagen, es zeigt sich. cog!to: Was meint er damit? Man könnte zum Beispiel eine Wahrheitstafel anschreiben und derart ein Erklärungsbild geben, das darstellt, warum eine Tautologie wahr ist. Hutter: Für Wittgenstein waren solche Erklärungsversuche ein Missverständnis der frühen analytischen Philosophie. Er würde sagen, jeder Begründungsversuch begeht einen Zirkelschluss. Weil die Begründung der Tautologie immer nur funktioniert, wenn die Regel, dass Tautologien wahr sind, bereits gilt. Sie können schlicht keinen Beweis führen, bei dem Sie die Frage, ob Tautologien wahr oder falsch sind, einklammern und offen lassen. cog!to: Sie planen gerade ein neues Projekt, das sich Narrative Ontologie nennt. Was verstehen Sie darunter? Hutter: Das knüpft ganz gut an Wittgenstein an. Die Idee des Projektes ist, dasjenige, was Wittgenstein mit dem Bereich des Zeigens im Auge hat, sprachlich zugänglich zu machen. Anders gewendet: Wie kann man dasjenige, was sich der Normalsprache der Rationalität notwendig entzieht, aber zugleich dasjenige ist, was erst diese Normalsprache der Rationalität möglich macht, einer sprachlichen Darstellung zugänglich machen, ohne dabei die Differenz beider Bereiche zu verschleiern? Das Projekt einer Narrativen Ontologie besteht nun konkret darin, zu prüfen, ob die narrative Eigenlogik von Erzählungen und Geschichten Ressourcen bereitstellt, an denen man sich hinsichtlich dieser Frage philosophisch schulen kann. Das Interview führten Mathias Koch und Daniel Hoyer Zu Axel Hutter: Axel Hutter studierte in Berlin Philosophie, Germanistik, Musikwissenschaft und Medizin. Er promovierte bei Michael Theunissen über Schellings Spätphilosophie und war wissenschaftlicher Mitarbeiter am Hegel-Archiv der Universität Bochum. Seit 2006 ist er Professor an der philosophischen Fakultät der Universität München, seit 2013 steht er der Fakultät als Dekan vor. Aktuell umfasst sein Aufgabengebiet den deutschen Idealismus und Hegel. 72 cog!to 07/2014 RUBRIK BLÜTENLESE In Blütenlese finden sich Artikel zu wissenschaftlichen Arbeiten der Studierenden und Promovierenden der Münchner Philosophie, aber auch regelmäßig Rezensionen von Neuerscheinungen sowie Berichte von Konferenzen und anderen Veranstaltungen in der Philosophie. In dieser Ausgabe gibt uns Nejma Tamoudi einen Einblick in Charles Taylors Gedanken über Authentizität, dem Thema ihrer Magisterarbeit. Oki Utamura rezensiert den kürzlich erschienen Briefwechsel zwischen Paul Auster und John M. Coetzee und fragt danach, ob und wie sich Freundschaften literarisch darstellen lassen. cog!to 07/2014 73 Authentizität bei Charles Taylor Grundlagen und Reichweite eines vielschichtigen Begriffes Von Nejma Tamoudi Der Ruf nach authentischer Selbstentsprechung gilt als eines der wesentlichen Merkmale unserer Zeit. Charles Taylors hieran anschließende Überlegungen zum Begriff der Authentizität führen in eine komplexe ideengeschichtliche Analyse, an deren Ende die These steht, dass auch die radikale Selbstsetzung des modernen Subjektes eines gemeinschaftlichen Sinn- und Bedeutungszusammenhanges bedarf, welcher diese allererst als authentisch auszuzeichnen vermag. E in wesentlicher Schwerpunkt des Denkens Charles Taylors lässt sich in dessen Überlegungen zur (Patho-)Genese des modernen Selbst- und Weltverständnisses finden. Die Moderne versteht er dabei als einen Raum potentieller Selbstentfaltung, welcher sich anhand der drei Fluchtpunkte einer in der Vernunft gründenden menschlichen Würde, der Güte der Natur sowie der Ablehnung einer theistischen Grundlegung von Welt definieren lässt. Folglich sieht sich das moderne Subjekt in seinem Dasein stets an das spannungsreiche Gegen- und Miteinander zweier Geisteshaltungen verwiesen, welche die Bezugnahme auf metaphysischtheologische Gewissheiten entweder zugunsten einer Aufwertung des Vernünftigen oder aber des Natürlichen aufgegeben haben. Die damit einhergehende schrittweise Ermächtigung des subjektiven Standpunktes bei gleichzeitig zunehmender Verinnerlichung unserer Quellen praktischer und theoretischer Erkenntnis muss als grundlegend für ein Verständnis des Authentizitätsbegriffes bei Taylor aufgefasst werden. Zwischen desengagiertem Loslösen und engagiertem Einfühlen Die Aufwertung des Vernünftigen geht Taylor zufolge mit einer Prädominanz des Epistemischen einher, welche sich in der erkenntnistheoretischen Grundhaltung des Desengagements gegenüber der Welt zeigt. Ihre Wurzeln liegen in den neuzeitlichen Bestrebungen einer 74 cog!to 07/2014 Entteleologisierung der Wirklichkeitsbezüge, welche das Erkennen von Welt auf die szientistische Methode einer Entzauberung und Objektivierung zurückführen. An die Stelle affektiven Bezugnehmens auf einen als sinn- und bedeutungsvoll erlebten Kosmos tritt ein evidenzbasierter, naturwissenschaftlicher Weltzugriff, dessen oberster Maßstab die gesicherte Erkenntnis in Form von Gewissheit ist – paradigmatisch vertreten in der cartesianischen Wende zur Innerlichkeit. Das darin zutage tretende fundamentum inconcussum samt seiner Unterscheidung einer beeinflussbaren Außen- und einer autonomen Innenwelt führt letztlich zu einer Abwendung vom Objekthaft-Sinnlichen sowie einer Hinwendung zum Subjekthaft-Geistigen. Treibende normative Kraft hinter diesen Bestrebungen sei das Ideal der Freiheit von jeglichen Formen sinnlicher sowie paternalistischer Fremdbestimmung. Die erkenntnistheoretische Haltung eines solchen, Taylor zufolge, naturalistischen Standpunktes geht folglich mit der Annahme eines unbeteiligten, sich von allen naturhaften sowie sozial bedingten Welten distanzierenden Beobachters einher und findet dabei nicht nur Anwendung auf die zu erfassende Objektwelt, sondern darüber hinaus auch auf das erkennende Subjekt selbst. Diese Radikalisierung der desengagierten Grundhaltung führt dabei zu einem nur mehr in seinem Vermögen Dinge als Objekte zu fixieren und prozedural den Regeln des richtigen Schließens zu folgen bestimmten Erkenntnissubjekt. Rationalität ist folglich – wie bspw. im lockeschen Aufklärungsdenken – keine primäre Eigenschaft des Denkinhaltes, sondern wesentliches Merkmal des Denkprozesses selbst. Aufgrund dieses neuzeitlichen Vorgangs einer radikalreflexiven (Selbst-)Objektivierung des Geistes versteht Taylor das naturalistische Erkenntnissubjekt im Sinne eines ausdehnungslosen Punktes reinen Vermögens, welcher herabgesetzt zu einem weiteren Erkenntnisgegenstand unter vielen, als radikal verdinglichtes Erkenntnisobjekt gilt. Das dabei angenommene apodiktische Modell theoretischer und praktischer Vernunft, welches jegliche Ad hominem-Modelle der Welterfassung zurückweist, führe – damals wie heute – zu einer Verdrängung der Ideale, welche die Verlagerung der Quellen unseres Wissens von der Welt in das autonome Vernunftsubjekt ursprünglich motivierten. Diese szientistisch orientierte Geisteshaltung, welche sich in einem durch Neutralität und radikale Freiheit erzeugten Wertevakuum wähne, beziehe sich dabei lediglich um den Preis der Inartikuliertheit grundlegender normativer Ideale wie Autonomie oder Freiheit auf die vorhandenen brute data (vgl. Taylor 1985b; 1995a; 1995b; 1996; 2002). Die zweite, neben dem Naturalismus für Taylor entscheidende, ideengeschichtliche Strömung findet sich im romantischen Expressivismus des 18. und 19. Jh., dessen Wurzeln bis ins augustinische Streben nach einer Verinnerlichung unserer erkenntnistheoretischen und moralischen Quellen zurückreichen. Wie sich am Begriff der Natur zeigen lässt, zielt diese zwar ebenfalls auf eine Ermächtigung des Subjektes zum primären Bezugspunkt allen Selbst- und Weltverständnisses, ohne dabei jedoch auf eine Herauslösung aus umfassenden Ordnungen zu drängen: So richtet sich das Desengagement naturalistischer Strömungen lediglich auf die Natur als das Sinnlich-Begehrende des Menschen oder als rational wahrnehmbare sowie beeinflussbare Außenwelt. Der romantische Expressivismus hingegen begreift diese als Quelle des Erfahrbaren, Erstrebenswerten und Guten. Natur bezieht sich dabei auf eine im Menschen angelegte innere Stimme, welche als Ursprung aller welterschließenden Affekte sowie moralischen Intuitionen gilt. An die Stelle des allgemeinen Vernunftsubjektes tritt somit eine kreativ-emanzipatorische Aufwertung der Empfindsamkeit, welche das Horchen auf das Innerste sowie den hierdurch geschaffenen Zugang zur Naturordnung als je individueller Erfahrung von Welt gegenüber einer übermächtig erscheinenden allgemeinen Vernunft zu verteidigen sucht. Taylor zufolge richtet sich die romantisch-expressive (Selbst-)Erkenntnis folglich weniger auf Freiheit durch Desengagement, denn auf Freiheit durch Selbstbestimmung. Indem das menschliche Subjekt dabei – wie bspw. im rousseauschen sentiment de l’existence – als Wesen mit unendlicher Tiefe begriffen wird, könne es jedoch nie zur völligen Selbsttransparenz gelangen. Der romantische Expressivismus verweise folglich auf eine reflexive Haltung, welche sich nicht in der Durchsichtigkeit reiner Potentialität vernünftigen Schließens, sondern in der Empfindsamkeit für die eigene innere Stimme zeige. Die Rückbesinnung auf die innere Natur als Grundlage von Welterfahrungen geht Taylor zufolge mit der Annahme einher, dass es keine von unseren Äußerungen unabhängige, externe Ordnung gebe. Vielmehr müssen Welt- und Bedeutsamkeitsstrukturen stets in Abhängigkeit von unseren Expressionen verstanden werden. Dies gilt letztlich auch für die Subjektkonstitution selbst, welche – in Anlehnung an die herdersche Originalität – auf der Verwirklichung unserer je unverwechselbaren Art des Menschseins basiert. Das darin zutage tretende normative Ideal der Authentizität vermag den Differenzen zwischen den Menschen insofern Gewicht beizumessen, als es sich auf die je individuelle Herstellung einer Verbindung zum Gefühl für das eigene Dasein als Grundlage unseres theoretischen sowie praktischen Umgangs in und mit der Welt bezieht. Die Verlagerung unserer Erkenntnis- und Moralquellen ins Subjekt führt folglich nicht zu einem konsequentialistischen Verständnis als Mittel zum Zweck richtigen Handelns – wie bspw. im Rahmen augustinischer Innerlichkeit. Vielmehr verweise sie, so Taylor, auf einen Autonomie- und Freiheitsbegriff, welcher in der Fähigkeit zur Selbstbestimmung der eigenen Natur gründet (vgl. Taylor 1995c; 1996; 2002; 2009). Kritik einer ‚Kultur der Authentizität‘ Der Einfluss der beiden genannten Geisteshaltungen auf das moderne Zeitalter lässt sich Taylor zufolge besonders deutlich in einer heute weitverbreiteten Form des Individualismus nachweisen, welcher zunächst der rational-desengagierten Haltung zu entspringen scheint. Indem diese jegliche über das Ich hinausweisenden Bedeutungshorizonte sowie Quellen der Erkenntnis ablehnt, führt sie nicht nur zu einer Zurückweisung des an sich Wertvollen, sondern überdies auch zu einem atomistischen Gesellschaftsverständnis, welches das soziale Ganze lediglich ausgehend vom Individuum begreift (vgl. Taylor 1985a). Die Reichweite solch eines methodologischen Individualismus zeige sich bspw. in der Hochachtung des millschen Schadenprinzips und seines Achtungsgebots mit Blick auf Ideale wie Freiheit, Gleichheit und Toleranz. Diese Wertschätzung individueller Freiheit enthalte jedoch zugleich expressivistische Anteile, welche der subjektiven Wende neuzeitlicher Kultur entspringen. Die Betonung einer romantischen Vertiefung ins eigene Ich entspricht dabei einer gegen Konformismus und Instrumentalismus gewandten Haltung ganzheitlicher Selbstentfaltung, wie sie sich bspw. in der offenkundig expressivistisch orientierten Kulturrevolution der 1960er zeigte. Aber auch die gegenwärtige Konsumkultur lasse noch immer das Streben nach dem je Individuell-Authentischen erkennen. Indem der von Taylor beschriebene Individualismus sowohl eine distanzierte Haltung gegenüber ethisch Wertvollem als auch die Wertschätzung des je Individuellen betont, leiste er einem mildem Relativismus Vorschub, welcher für keine übergreifenden Ideale mehr einzutreten vermag. „Ein solches Eintreten beinhaltet nämlich (…), daß manche Lebensformen tatsächlich höher stehen als andere, und vor derartigen Ansprüchen schreckt die Kultur der Toleranz gegenüber der individuellen Selbstverwirklichungsethik zurück“ (Taylor 1995c: 24). Unsere Kultur beschreibe folglich eine sich in die Moderne als dem entzauberten Zeitalter einfü- cog!to 07/2014 75 gende Kultur der Authentizität, welche die Existenz umfassender Horizonte derart zur Disposition stellt, dass die Einzelnen in ihrer Sinnsuche stets auf das eigene Selbst zurückgeworfen werden. Laut Taylor ist es eben diese, zur Formulierung kohärenter Lebensgeschichten entscheidende, Suche nach Bedeutungs- und Sinnstrukturen, welche nicht nur zentrales Moment individueller Selbstverwirklichung, sondern überdies Daseinsgrundlage unserer selbst als handlungsfähige Akteure ist. Indem sie somit zugleich als Teil der Identitätskonstitution des Einzelnen zu begreifen ist, stellt sie keine monologische Entäußerung dar, sondern muss über die Dialogizität menschlicher Vernunft in den Bereich der Anerkennung durch signifikante Andere verwiesen werden: „Ein Selbst bin ich nur im Verhältnis zu bestimmten Gesprächspartnern: in einer Hinsicht im Verhältnis zu den Gesprächspartnern, die im Prozeß der Selbstbestimmung eine wesentliche Rolle gespielt haben; in einer anderen Hinsicht im Verhältnis zu denen, die jetzt von maßgeblicher Bedeutung sind für mein fortwährendes Erfassen der Sprachen der Selbstverständigung“ (Taylor 1996: 71). Diese, auf die Ontogenese des Selbst bezogenen, anthropologischen Annahmen holt Taylor zudem normativ ein, wenn er mit Blick auf die Kultur der Authentizität die Zurückweisung feststehender sowie die Wertschätzung flexibler, stets neu zu verhandelnder Identitäten betont. Auch wenn der jeweilige Selbstentwurf einer subjektiven Empfindung oder Einstellung entspringt, muss folglich doch ein gemeinsam geteilter Bedeutungsund Werteraum angenommen werden, innerhalb dessen das Authentische überhaupt erst als ein solches erkenn- sowie abgrenzbar wird. So gilt: „Wer (…) den Versuch macht, zu einer sinnvollen Selbstdefinition zu gelangen, muß sein Dasein vor einem Horizont wichtiger Fragen führen“ (Taylor 1995c: 50). Da die wertenihilistische Zurückweisung eines gegebenen Horizontes als metaphysischer Restbestand auf einer Gleichsetzung von authentischer Selbstwahl und spontaner Selbstsetzung innerhalb eines moralischen Projektionismus beruhe, übersehe sie, dass eine derartig radikale Wahlfreiheit nicht zu realisieren sei. Der Verlust des Bedeutungshorizontes würde auch der authentischen Selbstwahl ihre Ausrichtung nehmen. Das der Selbstverwirklichungsethik innewohnende Neutralitätsgebot gegenüber dem Wert- und Bedeutungsvollen gilt Taylor somit als Trugschluss. Und dies insofern, als es auf Verinnerlichungs- sowie Subjektivierungsbewegungen beruht, welche ursprünglich motivierende Ideale – wie bspw. dasjenige der Authentizität als Treue zu sich selbst – in Vergessenheit haben geraten lassen. Taylor strebt nun keineswegs die Re-Etablierung einer altertümlichen Sittlichkeitsvorstellung oder gar Metaphysik an. Vielmehr ist es sein Ziel den reduktionistischen Ontologien desengagierter Vernunft eine reichhaltigere, normative Seinsweise von Welt gegenüberzustellen, deren Ermöglichungsbedingungen in bestimmten, qualitative Unterscheidungen vorgeben- 76 cog!to 07/2014 den, gemeinsam geteilten Horizonten liegen. Indem er dabei auf eine, dem romantischen Expressivismus entnommene Ausdrucksanthropologie verweist, öffnet er die jeweiligen Sinn- und Bedeutungszusammenhänge zugleich für einen Pluralismus der Weltanschauungen. Der Mensch als expressives Wesen ist in seinem praktischen und theoretischen Umgang in und mit der Welt zwar stets an ursprünglich gegebene Zusammenhänge verwiesen. Diese sind aufgrund der in den verschiedenen Selbstentwürfen beständig betriebenen (Re-)Konstituierungen von Selbst und Welt jedoch immer nur vorläufig und somit potentiell veränderbar (vgl. Taylor 1992; 1995c; 1996; 2007). Wiedergewinnungsbewegung als alternative Modernekritik Taylors Überlegungen zur Authentizität beruhen also auf dem Problem einer Engführung expressivistischer sowie rationaler Verinnerlichungsbestrebungen, wobei ihr Ziel in einer (Re-)Artikulierung der hierbei verlorengegangenen Quellen unserer Wahrnehmung von Welt liegt. Die Motivation zur Wiedergewinnung derselben findet sich für Taylor in der Gefahr einer zunehmenden Trivialisierung des Authentizitätsbegriffs im Sinne eines populärkulturellen Narzissmus oder egozentrierten Hedonismus. Zugleich wirkt darin aber auch das Bewusstsein für einen ethischen Mangel, wie er sich in den immer lauter werdenden Forderungen nach einer Beseitigung normativer Leerstellen sowie in der kommunitaristischen Kritik einer Abnahme solidarischer Bindungen liberaler Gesellschaften zeigt. Dabei ist es durchaus zutreffend, dass die taylorsche Modernekonzeption in so manchem Punkt kritikwürdig ist. Sei es mit Blick auf die Monokausalität seiner ideengeschichtlichen Rekonstruktion, welche der Vielfalt an Traditionslinien nicht gerecht zu werden scheint und sich damit dem Vorwurf allzu vorschneller Verallgemeinerungen gegenübersieht. Oder aber mit Blick auf das spannungsreiche Verhältnis zwischen authentischer Selbstentfaltung einerseits und Rückgebundenheit an gemeinschaftliche Wertehorizonte andererseits. V.a. mit Blick auf Taylors politische Theorie sowie die darin im Rahmen eines Liberalismus der Differenz vertretenen Sonderrechte zur Wahrung kultureller Authentizität wird dieser Punkt weiter an Gewicht gewinnen. Letztlich stellt Taylors philosophischer Ansatz eine spannende Alternative zu klassischen Ansätzen der Modernekritik dar, welche sich aus einer ungewöhnlichen Verbindung französischer Existenzialphänomenologie mit heideggerscher Daseinsanalytik und Deutschem Idealismus speist. Die Rückführung der gegenwärtigen Kultur samt ihres Authentizitätsideals auf das spannungsreiche Gegeneinander unterschiedlicher ideengeschichtlicher Einflüsse wird dabei nicht von einer kulturpessimistischen Haltung geleitet. Vielmehr muss das taylorsche Denken als ein emanzipatorisches Projekt verstanden werden, welches an die Grundlagen unseres politischen, sozialen und ethischen Selbstverständnisses rührt um auf diesem Weg ein Bewusstsein für das eigene Gewordensein zu ermöglichen. So gilt: „Ein Mensch der Moderne, der beide Vermögen [das Expressive und Rationale, N.T.] anerkennt, befindet sich von vornherein in einem Zustand der Spannung“ (Taylor 1996: 679). Die dabei angestoßene Reflexionsbewegung strebt eine Wiedergewinnung der Grundlagen des gegenwärtigen Selbst- und Weltverständnisses der Menschen an, welche – stets aufs Neue geleistet – eine reichhaltigere, d.h. authentischere Seinsweise ermöglichen soll. Von Nejma Tamoudi Literatur Taylor, Charles. 1985a. „Atomism“. In: ders. Philosophy and the Human Sciences. Philosophical Papers 2, S. 187-210. Cambridge, New York: Cambridge University Press. –––––. 1985b. „Rationality“. In: ders. Philosophy and the Human Sciences. Philosophical Papers 2. S. 134-151. Cambridge, New York: Cambridge University Press. –––––. 1992. „Was ist menschliches Handeln?“ In: ders. Negative Freiheit? Zur Kritik des neuzeitlichen Individualismus, S. 9-51. Frankfurt am Main: Suhrkamp. –––––. 1995a. „Explanation and practical reason”. In: ders. Philosophical Arguments, S. 34–59. Cambridge, MA: Harvard University Press. –––––. 1995b. „Overcoming epistemology“. In: ders., Philosophical Arguments, S. 1-19. Cambridge, MA: Harvard University Press. –––––. 1995c. Das Unbehagen an der Moderne. Frankfurt am Main: Suhrkamp. –––––. 1996. Quellen des Selbst. Die Entstehung der neuzeitlichen Identität. Frankfurt am Main: Suhrkamp. –––––. 2002. „Humanismus und moderne Identität“. In: ders. Wieviel Gemeinschaft braucht die Demokratie? Aufsätze zur politischen Philosophie, S. 218–270. Frankfurt am Main: Suhrkamp. –––––. 2007. A Secular Age. Cambridge, MA, London, UK: Harvard University Press. –––––. 2009. Multikulturalismus und die Politik der Anerkennung. Frankfurt am Main: Suhrkamp. Anzeige Neue Schriftenreihe zum Deutschen Idealismus Band 1 soeben erschienen Thomas Sören Hoffmann (Hrsg.) Die Philosophien Kants und des Deutschen Idealismus stehen für eine ungemein schöpferische und exempla­ rische Epoche des philosophischen Denkens. Während die Erträge dieser Epoche bis heute als keineswegs ausgeschöpft gelten können, definiert die Stellung zu ihr noch immer das denkerische Niveau: etwa insofern sich mit ihr Reduktionismen aller Art verbieten, insofern hier Geschichte und Systematik des Denkens nicht gegeneinander ausgespielt werden können oder insofern die Philosophie sich hier darauf verpflichtet hat, niemals nur „Metawissenschaft“ zu sein, sondern in umfassendem Maßstab „konkret“ zu denken. Die Publikationsreihe „Begriff und Konkretion“ will die Präsenz und bleibende orientierende Kraft dieser Epoche aufzeigen. Mit einem international besetzten wissenschaftlichen Beirat trägt sie dabei der Tatsache Rechnung, dass die klassische deutsche Philosophie längst global rezipiert und fortgeschrie­ ben wird. Das Recht als Form der „Gemeinschaft freier Wesen als solcher“ Fichtes Rechtsphilosophie in ihren aktuellen Bezügen Fichtes Vernunftrechtslehre zählt zu den überzeugendsten Versuchen philosophischer Rechtsbegründung. Ausgehend von der Frage, wie der Freiheitsanspruch der Subjektivität unter Bedingungen der Endlichkeit gewahrt werden kann, entwickelt Fichte ein Konzept vom Recht als konkretem Freiheitsgedanken, der basale Anerkennungsvollzüge und Urrechte ebenso einschließt wie den Bezug auf eine im Leib individuierte Freiheit. Der vorliegende Band, aus dem Gespräch von Philosophie und Rechtswissenschaft entstanden, würdigt Fichte entlang der verschiedenen Sphären des Rechts in umfassender Hinsicht. 299 Seiten, 2014 ISBN 978-3-428-14279-8 € 79,90 Auch als E-Book erhältlich www.duncker-humblot.de cog!to 07/2014 77 Zur Aktualität der Brieffreundschaft Anmerkungen zu: John M. Coetzee und Paul Auster: Here and Now Von Oki Utamura Es ist nicht leicht, eine Freundschaft authentisch darzustellen. Here and Now gelingt dies um den Preis der Belanglosigkeit. Dennoch hat der Briefwechsel zwischen Paul Auster und J.M. Coetzee einen Vorzug: Im technisierten Zeitalter des globalen Kapitalismus erinnert er an den Briefwechsel als veritables Medium einer Freundschaft. Der vorliegende Briefwechsel ist der Freundschaft gewidmet. Er beginnt in medias res: „Dear Paul, I have been thinking about friendships, how they arise, why they last—some of them—so long, longer than the passional attachments of which they are sometimes (wrongly) considered to be pale imitations. I was about to write a letter to you about all of this, starting with the observation that, considering how important friendships are in social life, and how much they mean to us, particularly during childhood, it is surprising how little has been written on the subject“ (Auster & Coetzee 2013: 14.-15. 6. 2008). Wie entstehen Freundschaften? Weshalb haben sie Bestand? Coetzees Brief gibt darauf keine befriedigende Antwort. Gegen Ende des Buches findet sich aber ein Hinweis: „Dear John, […] A couple of days ago, I had a startling revelation about the effect our correspondence has had on me. We have been at it for close to three years now, and in that time you have become what I would call an ‚absent other,‘ a kind of adult cousin to the imaginary friends little children invent for themselves. I discovered that I often walk around talking to you in my head, wishing you were with me so I could point out the strange-looking person who just walked past me on the sidewalk, remark on the odd scrap of conversation I just overheard […]. So there you are, John, inside my head as I talk to you, and nothing like this has ever happened to me—probably because I have never corresponded with anyone so regularly—and the effect, I can assure you, is an entirely pleasant one“ (22. 4. 2011). Inzwischen ist aus dem Briefwechsel eine Brieffreundschaft entstanden. Hatte Coetzee jenen Brief vier Mo- 78 cog!to 07/2014 nate nach seiner ersten persönlichen Begegnung mit Auster verfasst (Klappentext), offenbart dieser, dass sich Coetzee inzwischen – nach fast drei Jahren – einen festen Platz in Austers Leben erschrieben hat. Mit dieser Feststellung lässt sich der Briefwechsel selbst als Antwort auf beide Fragen verstehen: Wie entstehen Freundschaften? Weshalb haben sie Bestand? Here and Now nimmt zu diesen Fragen Stellung, indem es Entstehung und Verlauf dieser Freundschaft darstellt. Probleme, eine Freundschaft darzustellen Aber eine Freundschaft darzustellen, ist kein triviales Unterfangen. Die Frage nach den Bedingungen ihrer Möglichkeit ist eine philosophische Frage. Ihre Klärung trägt zum Verständnis dessen bei, was eine Freundschaft überhaupt ist. Dies und mehr hat Alexander Nehamas (2010) in einem bemerkenswerten Aufsatz klären können. Er nennt drei Probleme, welche die Darstellung einer Freundschaft aufwirft. Das erste Problem betrifft den visuellen Aspekt: Es gibt kein sichtbares Merkmal, das eine Freundschaft mit Sicherheit identifiziert. Nehamas führt dies anhand eines rinascimentalen Gemäldes vor. Es zeigt zwei Männer, die gemeinsam ein beschriebenes Blatt in ihren Händen halten. Nur aus diesem Blatt geht ihre Freundschaft hervor, denn es beinhaltet einen Auszug aus Ciceros Über die Freundschaft. Dieses Bild einer Freundschaft bedarf also eines Textes, geschriebener Rede, um die Freundschaft darzustellen. Hingegen sind Motive wie Sex and Crime visuell zugänglicher: „The visual indications of sexuality or killing are many but their range is limited. Friendship is different: it has no sure signs. In painting, friends […] can be doing almost anything together. And so they can in the world as well.“ Das zweite Problem betrifft den zeitlichen Asden bewältigt es mühelos: Die Darstellung der Freundpekt. Dem muss die glaubwürdige Darstellung einer schaft erfolgt im Briefwechsel textuell, nicht visuell. Freundschaft Rechnung tragen, denn „Friendship is Durch den abgedeckten Zeitraum der 79 Briefe (Juli manifested only through a series of actions that occur 2008–August 2011) kommt auch der zeitliche Aspekt over time“. Nehamas bestreitet nicht, dass sich eine zum Tragen. Aber das dritte Problem bleibt bestehen: Freundschaft in einer Einzelhandlung bewahrheiten Here and Now muss denen, die an der Freundschaft unkann. Doch er weist darauf hin, dass die Authentizität beteiligt sind, langweilig und belanglos erscheinen. dieser Handlung beglaubigt werden muss. Dazu bedarf Dies wird in Terry Eagletons Rezension von Here auch die nobelste Einzelhandlung einer alltägliche Rahand Now (2013) deutlich: In der Times Literary Supplemung. Fehlt diese, so ment erhebt der britibüßt die Darstellung sche Literaturkritiker an Glaubwürdigkeit zwei Vorwürfe. Erstens ein: „Passion between kritisiert er den Inhalt friends, in any case, has des Briefwechsels. Sein always proved suspivernichtendes Urteil: cious: Achilles’ desper„Fans of baseball might ate mourning for Pafind it more rewarding troclus’ death and his than friends of fiction.“ bloody revenge in The Mit dem Namen der Iliad prompted classiAutoren locke das Buch cal Athens to see them seine Leser – aber nur, as lovers; and in Monum sie zu enttäuschen. taigne’s ardent descripDenn die beiden Litetion of his feelings for raten korrespondieren Étienne de la Boétie, öfter und leidenschafthis readers have somelicher über Sport als times felt the stirrings über Bücher. Als zweitof lust.“ er Vorwurf tritt die Diese alltägliche Ideologiekritik hinzu Rahmung führt zum (Eagleton 2007): „It is dritten Problem: die a Romantic delusion to Belanglosigkeit der suppose that writers Ereignisse, die unter are likely to have someFreunden üblich sind. thing of interest to say Um eine Freundschaft about race relations, als solche darzustellen, nuclear weapons or muss ihre Alltäglichkeit economic crisis simply zum Ausdruck komby virtue of being writJacopo da Pontormo (1494-1557), Freundschaftsbildnis, men. Dann aber müsers“ (Eagleton 2013). ca. 1522, Öl auf Holz, 88,2 x 68 cm. sen die dargestellten Es sei eine Anmaßung, Ereignisse allen – außer den beteiligten Freunden dass Auster und Coetzee ihre – zwar gelegentlich interselbst – belanglos erscheinen: „To establish a friendessanten – Ausführungen an die Öffentlichkeit tragen. ship, a novel would have to include many inconsequenDenn, was die behandelten Themen betrifft, bezeutial moments and events, only against the background ge Here and Now vor allem die fachliche Inkompetenz of which […] would we be able to tell that the characters seiner Autoren. Und dafür gäbe es keinen Bedarf: „This act out of friendship and not out of duty, love or reckbook fills a much needed gap.“ lessness. […] But the events through which a friendship Doch obwohl Eagletons Kritik auf richtigen Beobis manifested, if they are to serve their purpose, must achtungen beruht, wird sie dem Anliegen der Autoren be represented as insignificant, and a narrative of insignicht gerecht. Ein angemesseneres Urteil fällt Martin nificant events is unlikely to absorb its readers.“ Riker (2013): „They did not set out to make a book, but to make a friendship, and this fact accounts for many of the book’s weaknesses as well as its strengths.“ Denn weshalb sollte eine Brieffreundschaft Rücksicht auf Unbeteiligte nehmen? Warum sollte Fachkompetenz Voraussetzung für den freien Meinungsaustausch unter Freunden sein? Dies lädt freilich zur Gegenfrage Als veröffentlichte Brieffreundschaft ist Here and Now ein: Wozu die Veröffentlichung einer solchen Brieffreundmit diesen drei Problemen konfrontiert. Die ersten beischaft? Die Belanglosigkeit des vorliegenden Briefwechsels cog!to 07/2014 79 Der Briefwechsel als Medium der Freundschaft kompetenz zur Geltung. Als Schriftsteller üben sich Auster und Coetzee regelmäßig in der Schöpfung literarischer Welten. Dies geht aber mit grundsätzlichen Entscheidungen darüber einher, mit welchen technischen und medialen Requisiten jene Welten auszustatten sind. Solche Entscheidungen erfordern eine Sensibilität für das Verhältnis von Technisierung und Lebenswelt (Blumenberg 1981). Dies zeigt sich, wenn Coetzee die Verbreitung von Mobiltelefonen nicht nur mit neuen Überwachungs­möglichkeiten assoziiert. Zugleich bringt er die Verbreitung jener Technologie mit neuen Organisationsmöglich­keiten des Ehebruchs in Verbindung, wie sie Ehebruchromane bis dato nicht gekannt haben (14. 3. 2011). Diese schriftstellerische Sensibilität kommt auch dann zum Ausdruck, wenn sich Coetzee zum Einsatz der Technik in seinen Werken äußert: Weder Inhalt noch literarische Qualität zeichnen Here and Now aus. Seine inhaltliche Vielfalt ist zwar überraschend. Es enthält kultivierte, durchaus interessante Überlegungen zu Freundschaft, Sport, Sprache, Literatur und Kultur, Politik (Wirtschaftskrise, Israel, Südafrika) sowie zur schriftstellerischen Existenz. Doch insgesamt ist Eagleton zuzustimmen: Oftmals sind diese Überlegungen dilettantisch. Zudem verhindert die inhaltliche Vielfalt das Entstehen von literarischer Dichte. Bestenfalls enthält Here and Now gut bis sehr gut geschriebene Briefe, wie sie unter kultivierten Freunden ausgetauscht werden. Aber das Bemerkenswerte an Here and Now ist seine Medialität als Briefwechsel. Dieser Veröffentlichung „The telephone is about as far as I will go in a book, kommt der Verdienst zu, an eine altehrwürdige Kulturand then reluctantly. Why? Not only because I’m not technik zu erinnern: die briefliche Korrespondenz. Ihre fond of what the world has turned into, but because if Qualitäten bleiben auch im digitalen Zeitalter bestepeople (‚characters‘) are continually going to be speakhen. Im Gegensatz zu Telefonaten und Online-Chats ing to one another at a distance, then a whole gamut setzen Briefe eine größere Planung, Isolation und Reof interpersonal signs and signals, verbal and nonverflexion voraus. In der Abwesenheit des anderen verbal, voluntary and involuntary, has to be given up. Diafasst, transportieren sie schriftliche Rede. So muss ein logue, in the full sense of the term, just isn’t possible guter Brief anderen Ansprüchen genügen als ein gutes over the phone“ (7. 4. 2011). Gespräch: Während Letzteres wechselseitige Aufmerksamkeit erfordert, setzt Ersteres einseitige Arbeit vorDoch Coetzees Betonung der räumlichen Präsenz wirft aus, deren Resultate sich aber wiederholter Lektüren zugleich die Frage auf, ob eine Brieffreundschaft nicht eignen. Diese erbrachte Vorleistung macht Briefe zum letztlich doch hinter einer Freundschaft zurückbleiben Medium einer besonderen Wertschätzung. muss, die auf räumlicher Präsenz beruht. So hatte AriDarin ähneln sich analoge und elektronische Briestoteles sogar behauptet, dass sich Freunde dadurch fe. Doch sie unterscheiden sich in ihrer Materialität: auszeichnen, dass sie in räumlicher Nähe zueinander Die Briefe zwischen Auster und Coetzee wurden – maleben (1995: 1157b16-25). nuell oder maschinell – auf Papier Dem ist aber zu entgegnen, dass geschrieben, dem Briefkasten oder auch die räumliche Präsenz nur Telefax überantwortet, und schließ- Das Bemerkenswerte an eine medial vermittelte ist. Denn lich dem Empfänger ausgestellt. Als Here and Now ist seine Meselbst dort, in der Begegnung von analoge Briefe üben sie eine mate- dialität als Briefwechsel. Der Angesicht zu Angesicht, ist Unmitrielle Präsenz aus: Bei mangelnder Veröffentlichung kommt der telbarkeit niemals gegeben: Auch Ordnung fallen sie einem zufällig Verdienst zu, an eine altehr- die Luft ist ein Medium für das Sein die Hände und wandern von der hen und Hören (Aristoteles 1995: Wahrnehmung in die Imagination. würdige Kulturtechnik zu 418b11-419b2). Ein solches Medierinnern Dort vergegenwärtigen sie uns ihum ist auch der Brief – nur eben ein ren Absender. Zwar beansprucht es anderes. Demnach geht es weniger mehr Zeit, sie zu sammeln und zu ordnen, als es E-Mails darum, die verschiedenen Medien gegeneinander auserfordern (Soentgen 2014). Doch Briefe von Freunden zuspielen. Wichtiger ist es, zum einen, die verschiedeversüßen solche ‚belanglose‘ Tätigkeiten: Ihr Lohn ist nen Medien auf die jeweiligen Gestaltungsmöglichkeiweder käuflich noch konsumierbar. Denn Freundschaften hin zu befragen, die sie einer Freundschaft bieten; ten sprechen uns persönlich an. Sie lassen uns Belangzum anderen, den Gebrauch der Medien den situativen loses als bedeutsam, bewegend, gar als transformativ Anforderungen einer jeden Freundschaft anzupassen: erleben: Sie verändern uns, wer wir sind und sein wollen So manche SMS erfordert als Antwort nicht eine weite(Nehamas 2010: 280ff.). re SMS, sondern einen schnellen Rückruf – sei es auch nur, um kurz die eigene Anteilnahme zum Ausdruck zu bringen. Mit diesem Hinweis auf die Medialität jeglicher Kommunikation lässt sich die Frage nach der ReleAls Erinnerung an ein altehrwürdiges Medium kommt vanz räumlicher Nähe relativieren. Nicht diese ist in in Here and Now also doch – pace Eagleton – eine Fachden Vordergrund zu stellen, sondern die innere Nähe, Die schriftstellerische Fachkompetenz 80 cog!to 07/2014 die sich innerhalb einer Freundschaft für die Freunde selbst schrittweise einstellt und dort – bisweilen facie ad faciem – kultiviert wird. Da sich aber Freundschaften durch ein Höchstmaß an Individualität auszeichnen (Nehamas 2010), wird nur im Einzelfall zu klären sein, welche Arten der Kommunikationen sich wie auf eine Freundschaft auswirken: ob die eine einer anderen vorzuziehen ist. Hier scheint allein eine experimentelle Haltung weiterführend. Es ist nicht im Voraus zu klären, welche Rolle die räumliche Präsenz in einer bestimmten Freundschaft einzunehmen vermag. Alleinfalls gibt es ein äußeres Kriterium für die Qualität einer Freundschaft: Die beständig kultivierte Belanglosigkeit des Alltäglichen, die von den Freunden selbst als Bereicherung wahrgenommen wird – oder für Außenstehende: wahrgenommen zu werden scheint. So zeigt auch Here and Now, gerade durch seine über drei Jahre beständig kultivierte Belanglosigkeit, dass der Briefwechsel für die Autoren zum veritablen Medium einer Freundschaft geworden ist – und für andere auch werden könnte. Literatur Auster, Paul und John M. Coetzee. 2013. Here and Now. Letters: 2008 – 2011. London: Faber and Faber / Harvill Secker. Aristoteles, The complete works of Aristotle. Herausgegeben von Jonathan Barnes. 2 Bde. Princeton: Princeton University Press. Blumenberg, Hans. 1981. „Lebenswelt und Technisierung unter Aspekten der Phänomenologie“. In: ders. Wirklichkeiten in denen wir leben; S. 7-54. Stuttgart: Reclam. Eagleton, Terry. 2007. Ideology. An introduction. London: Verso. –––––. 2013. „What am I to make of this, John?“. In: The Times Literary Supplement. http://www.the-tls.co.uk/tls/public/ article1266164.ece Nehamas, Alexander. 2010. „The Good of Friendship“. In: Proceedings of the Aristotelian Society 110 (3): 267-294. Riker, Martin. 2013. „Pen Pals. ‚Here and Now‘ by Paul Auster and J. M. Coetzee“. In: The New York Times (online). http:// www.nytimes.com/2013/03/17/books/review/here-andnow-by-paul-auster-and-j-m-coetzee.html Soentgen, Jens. 2014. „Outlook™, der sanfte Tyrann“. In: Merkur 780 (Mai): 471-476. Von Oki Utamura Anzeige cog!to 07/2014 81 cog!to stellt sich vor Miguel de la Riva Chefredaktion Bachelor Philosophie und Soziologie, 6. Semester Hielt bei cog!to im letzten Jahr alles und jeden am Laufen. [email protected] Lukas Leucht Chefredaktion Bachelor Philosophie und Volkswirtschaftslehre, 6. Semester Hat cog!to gegründet, argumentiert öfter für die absurde Idee einer perfekten Alltagssprache, ist aber sehr liberal, wenn man sich nicht daran hält. [email protected] Sandra Müller Redakteurin und Autorin Master Philosophie, 4. Semester Weitestgehend ausgelastet mit der Herausforderung sich selbst und andere zu verstehen und das in treffende Formulierungen zu kleiden. [email protected] Mathias Koch Redakteur und Autor Bachelor Philosophie und Soziologie, 4. Semester Cineast und Kaffeehausbewohner, interessiert sich für Deutschen Idealismus und mathematische Philosophie. [email protected] Fabian Heinrich Redakteur und Autor Master Philosophie, 2. Semester Studierte in Hamburg Kunstgeschichte und Philosophie und interessiert sich für praktische Philosophie, Kant und Ästhetik. [email protected] Daniel Hoyer Redakteur Bachelor Philosophie und Rechtswissenschaft, 6. Semester Hat mal was zu Kants Freiheitsbegriff gemacht. [email protected] Nejma Tamoudi Autorin Magister Artium Politikwissenschaft, Philosophie sowie Religionswissenschaften Ihr philosophisches Interesse liegt im Bereich modernekritischer sowie sozialphilosophischer Fragestellungen. [email protected] Nina-Maria Gottschling Illustratorin Bachelor Physik und Philosophie, 2. Semester Interessiert sich für Zeichnen. [email protected] 82 cog!to 07/2014 Dir gefällt, was Du siehst? Du willst Studierende und Lehrende an deiner Fakultät kennenlernen? Du liebst das Spiel mit Sprache und Philosophie und wolltest schon immer mal was aus dem einen Text machen, der in Deiner Schublade gammelt? Oder bist ambitionierter Hobby-Fotograf, der Bilder schießt, die zum Nachdenken anregen? Vielleicht willst du auch nur ein Thema vorschlagen, über das in diesem Heft schon längst hätte geschrieben werden müssen oder mal auf einen Kaffee vorbeischauen und „Hallo“ sagen. In jedem dieser und in vielen anderen Fällen bist du bei cog!to richtig und herzlich willkommen! Wir sind immer auf der Suche nach frischen Köpfen und neuen Ideen. Kurze Mail an [email protected] genügt! Vorträge|Kolloquien|Projekte Publikationen Werner-Ross-Stipendium Die 1919 in München-Schwabing durch Persönlichkeiten wie: Ernst Bertram, Hugo von Hofmannsthal, Thomas Mann, Richard Oehler, Heinrich Wölfflin, Friedrich Würzbach gegründete weltweit erste Nietzsche-Gesellschaft e.V. lebt im heutigen Nietzsche-Forum München e. V. weiter. Denken mit Friedrich Nietzsche bedeutet eine offene Einladung an Philosophie, Wissenschaft und Kunst in die Agora lebhafter gegenwartsbezogener Diskurse mit international bedeutenden Wissenschaftlern und Forschern und deren anregenden Vorträgen. jour fixe: letzter Montag im Monat, 19.00 in der Seidlvilla in München-Schwabing, am Nikolaiplatz 1b Der Eintritt ist für Studenten frei. Das Nietzsche-Forum München e. V. vergibt alljährlich das Werner-Ross-Stipendium für Projekte im Kontext der Philosophie Friedrich Nietzsches. Einsendeschluss ist jeweils der 1. Juni. Informieren Sie sich ausführlich über unsere homepage www.nietzsche-forum-muenchen.de oder: [email protected] cog!to 07/2014 83 cog!to 07/2014