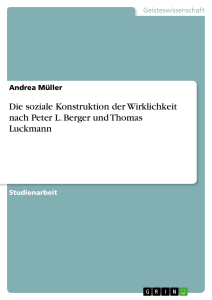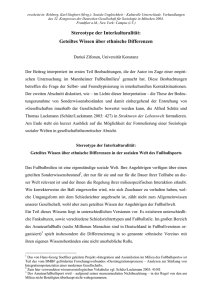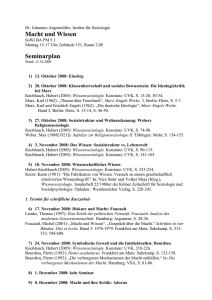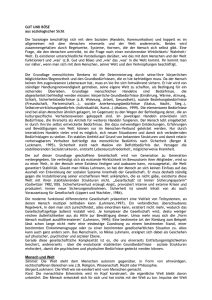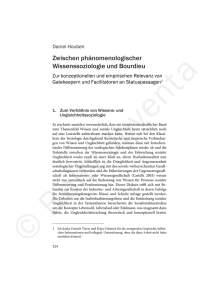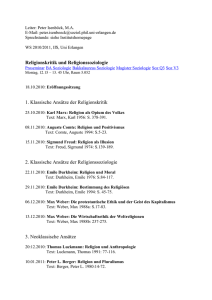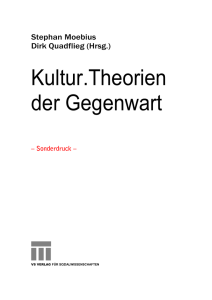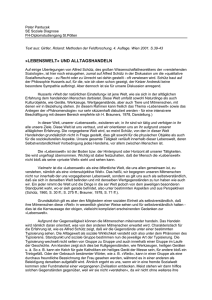Schuetzeichel 1..864 - und Religionssoziologie
Werbung

Claudia Wild: "Schützeichel"/24.10.2007/Seite 161 Thomas Luckmann Bernt Schnettler 1. Wissenssoziologie: Thomas Luckmann (geb. 1927) hat zusammen mit Peter L. Berger die Wissenssoziologie auf eine vollkommen neue Basis gestellt. Ihr zuerst 1966 veröffentlichtes Buch The social construction of reality (dt. 1969) stellt einen markanten Wendepunkt in der wissenssoziologischen Theorieentwicklung dar. Es führt die Wissenssoziologie heraus aus ihrer bis dato bestehenden Verengung auf Ideologiekritik und Weltanschauungsanalyse und formt sie zu einer allgemeinen Gesellschaftstheorie um, in deren Zentrum nun nicht mehr vornehmlich die Analyse von intellektuellen Sonderwissensbeständen und die Ideengeschichte stehen. Im Mittelpunkt steht nun vielmehr die Frage, wie das, was den Gesellschaftsmitgliedern als Wirklichkeit entgegentritt selbst das Produkt sozialer Konstruktionen ist. Damit rückt die Frage nach dem Alltagswissen und nach den Strukturen des Wissens in der Welt des Alltags an zentrale Stelle. Die Prozesse der Externalisierung, Objektivierung und Internalisierung von Wirklichkeit markieren die Konturen dieses Theorieprogramms. Zugespitzt lautet die zentrale Fragestellung der Gesellschaftlichen Konstruktion der Wirklichkeit: Wenn alle menschliche Erfahrung im subjektiven Erleben gründet, wie kann aus subjektiven Wirklichkeiten eine dem Menschen gegenüberstehende objektive Realität entstehen? »Wie ist es möglich, daß subjektiv gemeinter Sinn zu objektiver Faktizität wird? [...] Wie ist es möglich, daß menschliches Handeln (Weber) eine Welt von Sachen [Durkheim] hervorbringt?« (1969: 20). Die Autoren setzen damit das von Alfred Schütz (Schütz 1932; Schütz/Luckmann 2003) [? Alfred Schütz] begonnene Programm einer phänomenologisch und anthropologisch begründeten allgemeinen Sozialtheorie konsequent fort. Diese zielte auf die Herausarbeitung der universal-anthropologischen Strukturen der Lebenswelt [? Phänomenologisch fundierte Wissenssoziologie]. Der Luckmannsche Theorieansatz beinhaltet allerdings wesentliche Akzentverschiebungen gegenüber dem noch sehr viel deutlicher sozialphilosophisch ausgerichteten Begründungsansatz von Alfred Schütz (vgl. Knoblauch/Schnettler 2004). Dies wird besonders deutlich an der kategorischen Trennung, mit der Luckmann Konstitutions- und Konstruktionsanalyse voneinander unterscheidet: Die mit den Methoden der Phänomenologie durchgeführten Bewusstseinsanalysen dienen dazu, die allgemein menschlichen Strukturen der Orientierung in der Welt aufzudecken. Als Proto-Soziologie stellen sie aber keine soziologische Analyse im eigentlichen Sinne dar; sie dienen vielmehr der Klärung jener universal-anthropologischen Vorbedingungen, unter denen die konkreten Handelnden ihre jeweilige historische Wirklichkeit hervorbringen, die der Gegenstand soziologischer Konstruktion ist. Luckmann verwendet die Begriffe ›Konstitution‹ und ›Konstruktion‹ (Luckmann 2003) analog zur Trennung zwischen Protosoziologie und Soziologie. Mithilfe der phänomenologischen Konstitutionsanalyse werden allgemeine Fragen untersucht, beispielsweise danach, wie die ›Gegenstände‹, Ereignisse und Erlebnisse der alltäglichen Lebenswelt dem Einzelnen konkret entgegentreten oder welchen Anteil das Bewusstsein an der Erfahrung hat und ob es sich dabei um einen gemeinsamen Erfahrungsstil handelt. Dies mündet als Umsetzung der ausführlichen Konstitutionsanalysen in der umfassenden Beschreibung einer universellen Matrix allgemein menschlicher Orientierungen in der Welt: den Strukturen der Lebenswelt. 161 Claudia Wild: "Schützeichel"/24.10.2007/Seite 162 Thomas Luckmann In den zuerst 1979 und 1984 erschienenen Strukturen der Lebenswelt (Schütz/Luckmann 2003) entfaltet sich diese Konstitutionsanalyse in Form einer ›Protosoziologie‹ (Luckmann 1991), welche als Einlösung des von Schütz beabsichtigten Programms einer philosophischen Begründung der Sozialwissenschaften verstanden werden muss (Endreß 2006). In der auf Husserl zurückgehenden Fassung ist Lebenswelt kein Modebegriff, sondern die Bezeichnung eines anspruchsvollen Forschungsprogramms (Luckmann 2002c). Sie ist nicht dem sozialen System gegenübergesetzt wie bei Habermas. Vielmehr bildet die Lebenswelt den umgreifenden Sinnhorizont für die ›mannigfachen Wirklichkeiten‹ (Schütz 1971), weshalb sie das ›Insgesamt von Sinnwelten‹ (Honer 1999: 64) darstellt. Aus phänomenologischen Analysen lassen sich jedoch umstandslos keine Aussagen zur Struktur konkreter historischer Sozialwelten ableiten. Diese können nur jeweils als Ergebnisse empirischer Untersuchungen gewonnen werden. Mit der Gesellschaftlichen Konstruktion der Wirklichkeit wird dazu die wissenssoziologische Theoriebasis gelegt. Dabei weist der soziale Konstruktivismus Luckmanns sehr eigene Züge auf, die ihn nicht nur von ähnlich klingenden Ansätzen wie dem radikalen Konstruktivismus der Systemtheorie oder dem angelsächsischen sozialen Konstruktionismus (Burr 1995) unterscheiden, sondern ihn sogar in eine deutliche Opposition zu diesen setzen. Denn die Grundthese der Sozialen Konstruktion lautet, dass die Wirklichkeit aus den handelnden Akten der Gesellschaftsmitglieder hervorgeht, sich verfestigt und zu stabilen Strukturen gerinnt, die wiederum anschließendes Handeln determinieren – und zwar auf eine angebbare, systematische Weise, die alles andere als voraussetzungslos ist und auch keinesfalls die Wirklichkeit als eine reine Konstruktion des (individuellen) Bewusstseins begreift. Ganz im Gegenteil: Berger und Luckmann rekonstruieren die Faktoren der gesellschaftlichen Konstruktion als dialektischen Prozess von ›Externalisierung‹, ›Objektivierung‹ und ›Internalisierung‹. Wesentlich ist dabei, dass sie ihre Theorie – sehr viel deutlicher als Schütz – an der soziologischen Theorie ausrichten. Während bei Schütz anfänglich Bergsons Lebensphilosophie und von Mises’ ökonomische Grenznutzentheorie sowie später Husserls transzendentale Phänomenologie eine wichtige Rolle spielen, beziehen sich Berger und Luckmann explizit auf die Wissenssoziologie und binden diese in die grundlegenden Fragen der soziologischen Klassiker von Durkheim über Weber bis zu Parsons ein. Konstitution und Konstruktion sind also terminologisch auseinander zu halten (Luckmann 1999), obwohl freilich beide auf ihre Weise an der sozialen Praxis beteiligt sind. Die phänomenologische, protosoziologische Analyse zielt auf die Konstitution invarianter Strukturen der Lebenswelt durch Bewusstseinsakte. Demgegenüber bezieht sich die auf ihr ›aufbauende‹ soziologische Analyse auf die Konstruktion von individuellen und gesellschaftlichen Wissensbeständen und von sozialen Institutionen durch soziales Handeln. Anthropologische Bedingungen und Bewusstseinsleistungen bilden den konstitutionslogischen Rahmen, innerhalb dessen die gesellschaftliche Konstruktion erfolgen kann: Denn was immer Menschen zusammen tun, sie tun es in den – sozial und kulturell durchaus variablen – Grenzen ihres Leibes und den Strukturen des menschlichen Bewusstseins. 2. Handlungstheorie: Wesentlich ist, dass die Wirklichkeit im Handeln hergestellt wird. Damit rückt die Theorie des sozialen Handelns in den Kern der Theorieanlage (Luckmann 1992). Aber wenngleich sie eine grundlegende Stellung in seinem Werk einnimmt, käme es gleichwohl einem Missverständnis gleich, Luckmanns Theorieansatz auf Mikrosoziologie verkürzen zu wollen. Zu übersehen ist nämlich nicht, dass die Handlungstheorie zwar an der Interaktionssituation ansetzt, über die Scharnierstelle der Institutionalisierung aber konsequent einen Erklärungsansatz für den Prozess der Genese sozialer Ordnung insgesamt liefert. Es muss deshalb eigens 162 Claudia Wild: "Schützeichel"/24.10.2007/Seite 163 Bernt Schnettler hervorgehoben werden, dass die Theorie ihren Ausgang zwar in den Handlungen nimmt, aber auf eine Gesellschaftstheorie zielt (Pawlowski/Schmitz 2003: 60) – in einer Art und Weise, die den Einfluss von Durkheim und Gehlen sehr deutlich werden lässt. Damit findet sich schon bei Luckmann eine systematische Verknüpfung von Handlungs- und Strukturtheorie, deren Ähnlichkeit mit der späteren Vorstellung der ›strukturierenden Struktur‹ bei Giddens und Bourdieu unübersehbar ist. Die Luckmannsche Handlungstheorie knüpft an eine Tradition an, die schon mit Aristoteles’ Entdeckung der Wahlfreiheit und Zurechnungsfähigkeit des Handelns beginnt. Sie setzt sich fort mit dem Problem der Verträglichkeit von Handlungsfreiheit und Determinismus, welches die Stoiker und Augustinus diskutierten, und reicht über Machiavelli, Hobbes, den Utilitarismus, bis hin zu Pareto und Mead. Vor allem aber sind es Weber und wiederum Schütz, deren Ansätze am deutlichsten von Luckmann aufgenommen werden: Ausgehend von deren Bestimmung versteht Luckmann Handeln als eine besondere Form des Verhaltens (Weber 1984 [1921]). Phänomenologisch zeichnet sich Handeln durch seine Ausrichtung auf einen Zukunftsentwurf aus; sozial ist es, insofern dessen Entwurf auf einen ›anderen‹ gerichtet ist. Soziales Handeln kann sich dabei auf eine Reihe unterschiedlicher Arten von ›anderen‹ beziehen – auf Mitmenschen, Vormenschen, Zeitgenossen, hoch individualisierte Einzelne oder aber anonyme soziale Typen (vgl. Schütz 1932: 198 ff.; Schütz/Luckmann 1979: 87 ff.). Mit beiden Vorgängern teilt Luckmann auch den methodologischen Individualismus und lehnt den Begriff des ›kollektiven Akteurs‹ oder des ›Kollektivhandelns‹ strikt ab. Ebensowenig folgt er den Verengungen anderer Handlungstheorien, Handeln auf den Sonderfall der Rationalität zu reduzieren. Bei Weber war die Aufdeckung der Sinnstrukturen des Handelns allerdings nur unzureichend erfolgt und lediglich postuliert worden. Deshalb kritisierte Schütz vollkommen zu Recht (Schütz 1991 [1932]: 24 ff.), dass dieser Grundbegriff der ›sinnverstehenden Soziologie‹ bei Weber unterbestimmt geblieben war (ausf. hierzu: Eberle 1999). Schütz präzisierte den Sinnbegriff mithilfe phänomenologischer Konstitutionsanalysen. Den spezifischen Sinn von Handlungen versteht er als eine Form der ›Intentionalität‹, die sich durch eine besondere Zeitstruktur auszeichnet, nämlich einen Entwurf ›modi futuri exacti‹. Mit Handlungen soll etwas erreicht werden, was zuvor entworfen wurde. Selbstverständlich werden nicht alle Handlungen immer wieder vorentworfen, denn sie können aufgrund der Fähigkeiten des Bewusstseins zur Sedimentierung und Routinisierung (vgl. weiter unten) habitualisiert werden. Der Entwurfscharakter wird somit nur bei jenen Handlungen klar bestimmbar, die unabdingbar in weiten Teilen neu – oder stets wieder neu – entworfen werden müssen. Luckmann nimmt diese Grundzüge der Handlungstheorie seines Lehrers Schütz auf, führt sie mit der genauen begrifflichen Analyse des Institutionalisierungsvorgangs und der Legitimierung aber über dessen Ansatz hinaus und arbeitet sie zu einer umfassenden Theorie der Genese sozialer Ordnung aus: Mit Schütz geht Luckmann davon aus, dass alle Wirklichkeit durch und in unseren Handlungen konstruiert wird: »Zweifelsohne ist Handeln die Grundform des gesellschaftlichen Daseins des Menschen [...] Gesellschaft ist und war immer – von den Anfängen der Menschheit bis zum heutigen Tag – ein konkreter Handlungszusammenhang von Mitmenschen.« (1992: 4). Terminologisch unterscheidet er wie schon Schütz zwischen der ›Handlung‹ (als abgeschlossenem Ergebnis des Handelns) und dem ›Handeln‹ (als aktuellem Vollzug). Er differenziert außerdem zwischen drei Hauptformen des Handelns, die er als ›Denken‹, ›Wirken‹ und ›Arbeit‹ bezeichnet (vgl. 1992: 40–47): Während Denken ein auf das Bewusstsein beschränktes Handeln meint (beispielsweise Kopfrechnen), ist Wirken dadurch gekennzeichnet, dass diese Art der Tätigkeit in die Umwelt eingreift (sprechen, Äpfel pflücken, sich prügeln, etc.). Arbeit ist schließlich jenes Wirken, welches eine ›beachtliche Umweltveränderung zum Ziel hat‹ und ›bei dem der Eingriff in die 163 Claudia Wild: "Schützeichel"/24.10.2007/Seite 164 Thomas Luckmann gemeinsame Umwelt der Handelnden schon in den wechselseitig aufeinander ausgerichteten Entwürfen angelegt ist‹ (etwa: für andere Pfade in den Schnee stapfen). Ferner ist zwischen ›mittelbarem‹ und ›unmittelbarem‹ sowie ›einseitigem‹ und ›wechselseitigem‹ Handeln (1992: 110–124) zu unterscheiden. Luckmann betont, dass unter den vier möglichen Kombinationen dem unmittelbar wechselseitigen Handeln aufgrund seiner sozialen Ursprünglichkeit eine prominente Stellung zukommt. Denn dieser Typus sozialen Handelns von Angesicht zu Angesicht bildet das Fundament aller historischen Gesellschaften: »Die Handelnden stehen sich sozusagen im Original gegenüber: Sie können sich sehen, hören, berühren, sprechen, geschlechtlich miteinander verkehren, töten, zusammen arbeiten« (2002d: 108). Erst die gesellschaftliche Ausdifferenzierung des Wissensvorrates sowie die Verfügbarkeit von Kommunikationsmedien kann in spezifischen Gesellschaften im Zusammenhang mit der Orientierung an hochgradig anonymisierten Typen zu einer Verlagerung des Gewichts von unmittelbaren zu mittelbaren Interaktionen führen, wie dies etwa in der modernen Industriegesellschaft der Fall ist (Luckmann 1984). 3. Genese sozialer Ordnung: Interaktion, Institutionalisierung und Legitimierung: Handeln in der Gesellschaft orientiert sich folglich nicht allein an solitären Entwürfen, sondern verläuft primär in Prozessen wechselseitigen sozialen Handelns (›Interaktion‹). Grundlegend ist die schon bei Schütz angelegte Einsicht, dass die »sinngebenden Akte nicht ausschließlich in der Bewußtseinssphäre des Subjekts zu suchen« sind (Srubar 1991: 172). Im unmittelbaren wechselseitigen sozialen Handeln wird sozialer Sinn erzeugt, werden Muster und Regelmäßigkeiten der Interaktion und deren Deutung hervorgebracht, ausgehandelt und durchgesetzt, aufrechterhalten oder verändert. Diese verdichten und verfestigen sich in wiederholten Versuchen zusehends, überwinden auf diese Weise ihre ursprüngliche Partikularität und Subjektivität und gerinnen schließlich zu erwartbaren, objektivierten Bestandteilen der Wirklichkeit. Sie werden zu sozialen Institutionen – zu »Gestalten eigenen Gewichts« (Gehlen 1964: 71). Soziale Institutionen bilden sich dort aus, wo Akteure regelmäßig einem sich wiederholenden sozialen Problem begegnen und dieses routinemäßig lösen müssen; wo es also typischer Lösungen für ebenso typische gemeinsame Handlungsprobleme bedarf. In jedem Falle trifft dies für die Art und Weise zu, in der Menschen zusammen leben, arbeiten und kommunizieren, ebenso aber für Fragen der Ausbreitung, der Stabilisierung und der Begrenzung politischer Macht, und selbstverständlich auch für Erfahrungen mit dem Außeralltäglichen. Die regelmäßige Wiederholung von Deutungsmustern und die ebenso regelmäßige Koordination davon abgeleiteter und sich darauf beziehender Handlungen treibt den Institutionalisierungsprozess voran, entlastet die Akteure von der Aufgabe, Lösungen und ›Antworten‹ stets neu zu entwickeln und macht sie füreinander in ihrer Wahrnehmung, in ihrem Fühlen, Denken und Handeln zugänglich und damit einschätzbar. Institutionen stellen also das ›objektivierte‹ Ergebnis früherer Handlungsketten dar. Wie aber entstehen sie? Und wie wird ihre ›Existenz‹, sind sie einmal entstanden, gesichert? Luckmanns Theorie der Institutionsgenese (2002d) schließt eine zwischen soziologischen Handlungs- und Strukturtheorien oft klaffende Lücke. Jenseits des soziologischen Allgemeinplatzes, Institutionen entstünden im Handeln und einmal entstanden, steuerten sie ihrerseits vermittels verinnerlichter ›Normen‹ und äußerer ›Zwänge‹ das Handeln ihrer Mitglieder, zeigt Luckmann detailliert die einzelnen Schritte auf, bei denen aus Handlungen festgefügte ›Strukturen‹ hervorgehen: Der erste wesentliche Schritt vom Handeln zur Institution stellt die bereits in der Wiederholung des Handelns zugrunde gelegte Tendenz zur Routinisierung dar. Luckmann knüpft hier an die von Arnold Gehlen hervorgehobene Entlastungsfunktion von Handlungsroutinen an 164 Claudia Wild: "Schützeichel"/24.10.2007/Seite 165 Bernt Schnettler (1964: 22 ff.): Ein Großteil unser täglichen Verrichtungen beruht auf Handlungsroutinen, die uns der Notwendigkeit entheben, unsere gesamten Handlungsvollzüge mit höchster Bewusstseinsspannung auszuüben. Routinen (elementare Körpertechniken wie Gehen, Zähneputzen, ebenso wie fortgeschrittene ›Kulturtechniken‹, etwa Schreiben, Autofahren oder Klavierspielen) werden im Alltag gleichsam ›automatisch‹ und mit geringerer Anstrengung vollzogen. Sie gehen jedoch zurück auf die explizit und häufig mühsam gelernte Koordination einzelner, mit hohem Bewusstseins- und Lernaufwand eingeübter ›echter‹ Handlungen (beobachtbar ebenso beim Erlernen des aufrechten Ganges wie beim Einstudieren eines Musikstückes). Grundsätzlich kann jegliche Handlung routinisiert werden (beispielsweise bestimmte individuelle Handlungsabfolgen, die unser morgendliches Aufstehen begleiten). Für die Institutionalisierung gesellschaftlichen Handels sind diese aber weniger relevant. »Institutionalisiert werden nur bestimmte Formen gesellschaftlichen Handelns: regelmäßig wiederkehrendes wechselseitiges Wirken [...] bzw. genauer: regelmäßig wiederkehrende wechselseitige – und selbstverständlich gesellschaftliche – Arbeit« (Luckmann 2002d: 111). Es sind vor allem zwei Aspekte, welche die Institutionalisierung gesellschaftlicher Arbeit fördern: nämlich die intersubjektive Wichtigkeit und die Geschichtlichkeit. Auf einer ersten Stufe lenken solche Institutionen bereits die Handlungsvollzüge der Beteiligten, indem sie eine bestimmte, einmal gegebene Lösungsmöglichkeit in eine Selbstverständlichkeit überführen, und dadurch eine primäre Form sozialer Kontrolle darstellen. Allerdings handelt es sich noch nicht um Institutionen im vollen Sinne, weshalb Luckmann sie als ›Proto-Institutionen‹ bezeichnet. Der Institutionalisierungsprozess gelangt auf eine zweite Ebene, wenn einmal gefundene ›institutionalisierte‹ Handlungsvollzüge tradiert, das heißt an eine ›Folgegeneration‹ weitergegeben werden müssen. Diese Stufe zeichnet sich durch den Einbezug eines Dritten aus und wird institutionelle Ordnung genannt. Das Problem ist offensichtlich: Treten Neue hinzu, so reichen Verweise auf die bloße Üblichkeit einer gefundenen Lösung oft nicht aus. Eingespielte Gewohnheiten sind Außenstehenden nicht per se plausibel, was die Notwendigkeit von ›Legitimierungen‹ nach sich zieht. Zu sozialen Institutionen im vollen Sinne werden gemeinsame Typisierungen und Habitualisierungen also erst, wenn sie tradiert und legitimiert werden (Berger/Luckmann 1969: Kap II.2; Luckmann 2001). Erst deren Weitergabe an Dritte – ihre soziale ›Vererbung‹ – löst sie von konkreten Akteuren und von historisch einzigartigen Umständen ab und überträgt sie auf typische Situationen, worauf sich ihre Objektivität schließlich begründet. (Die fundamentale strukturelle Veränderung ›sozialer Kreise‹ durch das Hinzukommen des Dritten hat in ähnlicher Weise schon Simmel (1968 [1908]) hervorgehoben. Zur Soziologie des Dritten vgl. ebenso Fischer (2000) und Lindemann (2006).) Denn waren die gefundenen institutionalisierten Interaktionsvollzüge den ursprünglichen Beteiligten (den ›Institutionsschöpfern‹) unmittelbar einsichtig (›so machen wir das‹), so bedarf es gegenüber den ›Nachkommen‹ expliziter Legitimierungen (›so-und-nicht-anders macht man das‹). Mit Legitimierungen entstehen aber nun Sinngebilde, die sich von der unmittelbaren Vollzugswirklichkeit des Handelns zunehmend ablösen, ja sogar in ein diametrales Verhältnis zu dieser treten können. Legitimationen ähneln also durchaus dem, was Pareto ›Derivationen‹ nennt. Ebenso knüpft Luckmann hier implizit an die ideologiekritische Linie der Wissenssoziologie an, wenngleich der Begriff der Legitimierung zum einen den Prozesscharakter der Sinnschöpfung hervorhebt und zum anderen die Wertneutralität betont. Inwiefern nämlich Legitimationen die tatsächlichen Ursachen, Funktionen oder Ziele einer bestimmten institutionalisierten Praxis widerspiegeln oder nicht, ist keine apriorisch, sondern nur empirisch lösbare Frage. Im Einzelnen lassen sich vier Legitimierungsstufen unterscheiden. Sie dienen dazu, »Bedeutungen, die ungleichartigen Institutionen schon anhaften, zu Sinnhaftigkeiten zu integrieren« 165 Claudia Wild: "Schützeichel"/24.10.2007/Seite 166 Thomas Luckmann (Berger/Luckmann 1969: 99): Auf der ersten, vortheoretischen Ebene handelt es sich dabei um die Begriffe selbst, in die als sprachliche Objektivationen fundamentale legitimierende Erklärungen gleichsam eingeschrieben sind (wie etwa die Bezeichnung ›Bruder‹ bereits im Ansatz das diesem gegenüber angemessene Verhalten impliziert). Auf der zweiten Ebene finden sich ›theoretische Postulate in rudimentärer Form‹, bei denen in pragmatischer Weise explizite Verhaltensmaßregeln formuliert werden, etwa in Form von normativen kommunikativen Gattungen wie Sprichwörtern, Lebensweisheiten oder Legenden (›unter Brüdern gibt es keinen Streit‹). Auf der dritten Stufe finden sich ›ausformulierte Legitimationstheorien‹ (etwa ein praktischer Kodex ›brüderlichen‹ Verhaltens im Sport), die mit wachsendem Umfang und zunehmender Komplexität die Ausbildung eines Expertenstandes nach sich ziehen können. Ist aber die Rolle solch ›hauptamtlicher Legitimatoren‹ erst einmal etabliert, so tendiert deren Theoretisieren leicht dazu, über die Praxis hinauszugreifen und eine gewisse Autonomie zu erlangen. Das kann in die Formulierung umfassender ›Theorien‹ münden (die ›Idee der Brüderlichkeit‹), welche die Einzelgebiete praktischen Handelns transzendieren und auf eine erschöpfende Sinndeutung zielen. Solch ›Symbolische Sinnwelten‹ sind schließlich dadurch charakterisiert, dass sie als übergreifende Weltdeutung (als Kosmologie, ›Heiliger Baldachin‹) alle einzelnen Sinnbereiche menschlicher Existenz integrieren und einen außeralltäglichen, die Alltagserfahrung übersteigenden Verweisungscharakter tragen. Auch sie sind selbstverständlich Produkte gesellschaftlicher Objektivationen. Vermittels ihrer allumfassenden Sinndeutung kommt der symbolischen Sinnwelt jedoch eine besondere Rolle im Ensemble der verschiedenen Legitimierungsstufen zu: »Sie setzt Ordnung beziehungsweise Recht« als ›höchstmögliche Integrationsebene für alle widersprüchlichen Sinnhaftigkeiten‹ (Berger/Luckmann 1969: 104). Hier schließt die für die Luckmannsche Wissenssoziologie ebenso zentrale Religionssoziologie (Luckmann 1991) an, auf deren Entfaltung und die an sie erfolgten Anschlüsse (vgl. WohlrabSahr 2003) hier nicht eingegangen werden kann (vgl. dazu aber Knoblauch 1999: 109 ff., Schnettler 2004: 21 ff.) 4. Wissenssoziologische Anschlüsse – Sozialität des Wissens, Wissensverteilung und die Rolle der Kommunikation: In der mit den Legitimierungen implizierten Ablösung der Kommunikationsebene von der Ebene der Handlung ist bereits eine Wende angelegt, die von Luckmann später konsequent vollzogen wird (Luckmann 2002a). Die Untersuchung der Rolle zunächst der sprachlichen, später auch der nichtsprachlichen Kommunikation rückt in den Mittelpunkt seines empirischen wie theoretischen Interesses (Luckmann 1979) und mündet in einer eigenständigen Theorie kommunikativer Gattungen als Grundformen der gesellschaftlichen Vermittlung von Wissen (Luckmann 1986). Diese Auffassung der Gesellschaftlichkeit des Wissens und seiner handlungsorientierenden Funktion verbindet Thomas Luckmann nicht nur mit Weber und Schütz. Sie bringt vielmehr einen erfahrungswissenschaftlichen Konsens zum Ausdruck, den Luckmann mit so unterschiedlichen Theoretikern wie Durkheim, Mauss und Halbwachs [? Durkheim und die École sociologique], Scheler [? Max Scheler], Mannheim [? Karl Mannheim], A. Weber und Merton [? Soziologie des wissenschaftlichen Wissens] teilt: Die subjektiven und die gesellschaftlichen Wissensbestände sind sozial produziert und determiniert, sie sind sozial vermittelt und verteilt – und sie sind die unhintergehbaren Voraussetzungen jeglichen menschlichen Handelns (vgl. zur ›Sozialität‹ des Wissens ausf. Knoblauch 2005b: 341 ff.). Wie aber wird individuelles Handeln durch gesellschaftliches Wissen geformt? Was sind die wissensabhängigen Voraussetzungen menschlichen Handelns? Während ›Sinn‹ auf einer ersten Ebene vom einzelnen Bewusstsein erzeugt wird, bezeichnet ›Wissen‹ die in einer Gesellschaft 166 Claudia Wild: "Schützeichel"/24.10.2007/Seite 167 Bernt Schnettler sozial objektivierten und deshalb legitimen Sinndeutungen. Phänomenologisch betrachtet ist Wissens nichts anderes als sedimentierte Erfahrung. Soziologisch ist Wissen aber das, was in einer bestimmten Gesellschaft als Wissen gilt, und damit ist unauflöslich mit der Kommunikation verbunden. Unterschieden werden müssen dabei verschiedene Wissensformen: Gesellschaftliches Wissen erstreckt sich von ›einfachen‹ körperlichen Fertigkeiten, wie etwa die Art zu essen oder zu gehen, bis hin zu hoch komplexen Formen theoretischen Sonderwissens. Eine Bedingung gilt dabei stets: Wissen muss subjektiv erworben werden – sei es durch eigene Erfahrung oder über den Umweg der ›sozialen Ableitung‹ aus jenem Sinnreservoir, das dem Subjekt als etwas historisch Vorgegebenes und sozial Auferlegtes – als »soziohistorisches Apriori« (1980a: 127) – entgegentritt. Luckmann (2002b) fragt nach eben diesem Strukturzusammenhang von subjektivem und gesellschaftlichem Wissensvorrat und richtet seine Argumentation auf eine analytische Differenzierung verschiedener Ebenen der ›Determination‹ individuellen Handelns. Bereits biologisch bedingte Unterschiede des Geschlechts und des Alters führen zu einer ungleichen Wissensverteilung: Frauen wissen etwa besser über die Menstruation, Alte besser über Krankheiten Bescheid. Zu weiteren Differenzierungen kommt es, wenn die Gemeinschaften Bestände an Sonderwissen ausgliedern und auf Experten (wie Priester oder Schamanen, Schmiede oder Ärzte) verteilen (zur Struktur des Expertenwissens vgl. Schütz 1972, Sprondel 1979, sowie Hitzler/Honer/ Maeder 1994). Je komplexer und ausdifferenzierter sich die Sozialwelten darstellen, umso mehr gewinnt der gesamtgesellschaftliche Wissensvorrat an Volumen, während sich zugleich das Ausmaß und die Qualität intersubjektiv geteilten Wissens verringert. Die soziologisch bedeutsamste Ebene der gesellschaftlichen Wissensverteilung ist deshalb die Sozialstruktur: Über sie wird Allgemeinwissen von Spezialwissen getrennt, wird der Zugang zu Prozessen der Wissensaneignung geregelt und systematisch auf typische Gesellschaftsmitglieder beschränkt. Dergestalt erweist sich die sozialstrukturelle Differenzierung von klassen-, schicht- und milieuspezifischen Wissensvarianten – dessen, was Pierre Bourdieu die soziale Verteilung des ›symbolischen Kapitals‹ nennt – als ein generatives und dabei zugleich stabilisierendes Moment im System sozialer Ungleichheiten. Legitimierungen sind folglich umso erforderlicher, je größer das Ausmaß der inneren funktionalen Differenzierung einer institutionellen Ordnung ist, was dazu führt, dass der Bereich des geteilten Wissensvorrats der Mitglieder abnimmt. Denn im Zuge der internen funktionalen Differenzierung der Institutionen kommt es zur Ausbildung von spezifischen Mitgliedsrollen. Dieser Prozess führt es mit sich, dass der ursprünglich homogene und gleichverteilte Wissensvorrat der in die institutionelle Ordnung Involvierten sich in Teil- und Spezialwissen aufsplittert. Für komplexe institutionelle Ordnungen ist die primäre Vermittlung des Sinns der Ordnung wesentlich, da sie eine wichtige Funktion für die Integration ihrer Mitglieder ausübt, und zwar umso stärker, je weiter ihre Mitgliedsrollen und die damit verbundenen Wissensvorräte differenziert sind. Den sekundären Legitimationen kommt hingegen eine besondere Rolle für das Verständnis der ›Rationalität‹ von Institutionen zu. Denn die vermeintliche Rationalität der Institution darf nicht verwechselt werden mit ihrer ›inneren Logik‹: »Die Logik steckt nicht in den Institutionen und ihrer äußeren Funktionalität, sondern in der Art, in der über sie reflektiert wird« (Berger/ Luckmann 1969: 68). Hier liegt ein Ansatz, der unmittelbar zu einer sozialkonstruktivistischen Organisationsforschung und -theorie führt, denn »Organisationen können als historische Ausprägungen institutioneller Ordnungen angesehen werden« (Knoblauch 1997: 11). »Wie alle Institutionen basieren deswegen auch Organisationen auf einem Unterfutter primärer Legitimationen, die in einem engen Zusammenhang mit den pragmatischen Anforderungen der Institutionen selber stehen«, zu denen etwa Zielformulierungen, die Darstellungspraktiken einer ›Corporate 167 Claudia Wild: "Schützeichel"/24.10.2007/Seite 168 Thomas Luckmann Identity‹, besondere Mythen, Geschichten und Zeremonien oder die ›Unternehmensphilosophie‹, also ganz allgemein die zur ›Organisationskultur‹ zählenden Elemente gehören. Wenngleich aber Handeln und Wissen immer sozial determiniert sind, bleiben sie doch stets rückgebunden an die Subjektivität. Damit wendet sich Luckmann nicht nur gegen positivistische und materialistische Wissenstheorien. Seine Sozialtheorie vermeidet damit den Soziologismus vieler anderer Theorieansätze, die einer phänomenologischen Begründung der Sozialwissenschaft kritisch gegenüberstehen und die These vertreten, dass weder das Subjekt noch menschliche Akteure überhaupt konstitutiv für die Soziologie seien. Durch drei aktuelle Debatten wird die Luckmannsche Wissenssoziologie gegenwärtig herausgefordert: Zum einen ist argumentiert worden, dass eine soziologische Definition des Handlungsbegriffs auf das subjektive Kriterium der Intentionalität verzichten könne. So plädieren Rammert/Schulz-Schaeffer (2002) für einen ›gradualisierten‹ Handlungsbegriff und Schulz-Schaeffer (2005), der sich eingehend auch mit den Annahmen der phänomenologisch begründeten Handlungstheorie auseinander setzt, reduziert Handlungen auf Zuschreibung und auf das ›beobachtbare Prozessieren von Selektivität‹, was letztlich Handeln auf Wirken begrenzt und Denken als Form des Handels nicht mit berücksichtigen kann – obwohl diese Form des Handelns nicht nur unter wissenssoziologischer sondern auch unter kulturgeschichtlicher Betrachtung höchst relevant ist, insofern es für weite Teile gravierender Veränderungen sozialer Wirklichkeiten ursächlich verantwortlich zeichnet. Eine zweite Auseinandersetzung mit dem sozialkonstruktivistischen Ansatz ergibt sich aus der Debatte um die Postsozialität. Wie Luckmann hervorhebt, sind die Grenzen der Sozialwelt kein Bestandteil der universalen Strukturen der Lebenswelt, sondern Folge sozialer Konstruktionen und damit von Gesellschaft zu Gesellschaft variabel (Luckmann 1980). Beispiele aus der Kulturanthropologie zeigen, dass diese Anderen dabei keineswegs menschliche Subjekte sein müssen. Unter bestimmten Bedingungen mag man auch mit Yamswurzeln, Ahnen, Haustieren oder Softwareagenten ›interagieren‹, sofern diese in der gegebenen Kultur als anerkannte Handlungspartner gelten. Ebenso wie die ›universale Projektion‹, die dem frühkindlichen Animismus gleicht, der erst im Verlauf der Interaktionsgeschichte kulturell eingeschränkt wird, so sind es keine konstitutiven (also phänomenologisch-universalen) Elemente, sondern die jeweiligen sozialen (also historisch wandelbaren) Konstruktionen, die festlegen, wer als Gegenüber in Frage kommt und entlang welcher – verschiebbaren – Linie die Unterscheidung zwischen Unähnlichen und Nichtdazugehörigen, Exkludierten verläuft. Es wäre allerdings ein theoretischer Kurzschluss, diese Konstrukte erster Ordnung umwegslos in eine Theorie der Postsozialität zu überführen (Knoblauch/Schnettler 2004). Die Vorzüge des wissenssoziologischen Ansatzes von Thomas Luckmann zeigen sich schließlich anhand einer dritten aktuellen Auseinandersetzung. Wie Stegmaier eindrücklich (2006) zeigen kann, lassen sich die Herausforderungen der Wissenssoziologie durch die Thesen der aktuellen Hirnforschung mit einer phänomenologisch begründeten Handlungsund Wissenstheorie durchaus beantworten. Und damit ist die an Luckmann anschließende Wissenssoziologie keineswegs erschöpft. Literatur Berger, Peter L. und Thomas Luckmann (1969): Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Frankfurt am Main: Fischer. Burr, Vivien (1995): An Introduction to Social Constructionism. London: Routledge. Eberle, Thomas S. (1999): Sinnadäquanz und Kausaladäquanz bei Max Weber und Alfred Schütz. In: Ronald Hitzler et al (Hg.): Hermeneutische Wissenssoziologie. Standpunkte zur Theorie der Interpretation. Konstanz: UVK, S. 97–119. 168 Claudia Wild: "Schützeichel"/24.10.2007/Seite 169 Bernt Schnettler Endreß, Martin (2002): Formation und Transformation sozialer Wirklichkeit. Eine Untersuchung zur phänomenologisch begründeten Soziologie und Sozialtheorie. Universität Tübingen: unveröff. Habilitationsschrift. Endreß, Martin (2006): Alfred Schütz. Konstanz: UVK. Fischer, Joachim (2000): Der Dritte. Zur Anthropologie der Intersubjektivität. In: Wolfgang Eßbach (Hg.): wir/ihr/sie. Identität und Alterität in Theorie und Methode. Würzburg: Ergon, S. 103–138. Gehlen, Arnold (1964): Urmensch und Spätkultur. Philosophische Ergebnisse und Aussagen. Wiesbaden: Athenaion. Hitzler, Ronald/Honer, Anne/Maeder, Christoph (Hg.) (1994): Expertenwissen. Die institutionalisierte Kompetenz zur Konstruktion von Wirklichkeit. Opladen: Westdeutscher Verlag. Honer, Anne (1999): Bausteine zu einer lebensweltorientierten Wissenssoziologie. In: Ronald Hitzler u. a. (Hg.): Hermeneutische Wissenssoziologie. Standpunkte zur Theorie der Interpretation. Konstanz: UVK, S. 51–67. Knoblauch, Hubert (1995): Kommunikationskultur: Die kommunikative Konstruktion kultureller Kontexte. Berlin: De Gruyter. Knoblauch, Hubert (1997): Die kommunikative Konstruktion postmoderner Organisationen. Institutionen, Aktivitätssysteme und kontextuelles Handeln. In: Österreichische Zeitschrift für Soziologie 22(2): 6–23. Knoblauch, Hubert (1999): Religionssoziologie. Berlin und New York: de Gruyter. Knoblauch, Hubert (2005a): Thomas Luckmann. In: Dirk Kaesler (Hg.): Aktuelle Theorien der Soziologie. München: Beck, S. 127–146. Knoblauch, Hubert (2005b): Wissenssoziologie. Konstanz: UVK/UTB. Knoblauch, Hubert/Schnettler, Bernt (2004): Vom sinnhaften Aufbau zur kommunikativen Konstruktion. In: Manfred Gabriel (Hg.): Paradigmen akteurszentrierter Soziologie. Wiesbaden: VS, S. 121–137. Lindemann, Gesa (2006): Die Emergenzfunktion und die konstitutive Funktion des Dritten. Perspektiven einer kritisch-systematischen Theorieentwicklung. In: Zeitschrift für Soziologie 35: 82–101. Luckmann, Thomas (1979): Soziologie der Sprache. In: René König (Hg.): Handbuch der empirischen Sozialforschung, Bd. 13. Stuttgart: Enke, S. 1–116. Luckmann, Thomas (1980): Über die Grenzen der Sozialwelt. In: Ders.: Lebenswelt und Gesellschaft. Paderborn: Schöningh, S. 56–92. Luckmann, Thomas (1984): Von der unmittelbaren zur mittelbaren Kommunikation (strukturelle Bedingungen). In: Tasso Borbé (Hg.): Mikroelektronik. Die Folgen für die zwischenmenschliche Kommunikation. Berlin: Colloquium, S. 75–84. Luckmann, Thomas (1986): Grundformen der gesellschaftlichen Vermittlung des Wissens: Kommunikative Gattungen. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie Sonderheft 27: 191–211. Luckmann, Thomas (1991): Protosoziologie als Protopsychologie? In: Max Herzog/Carl F. Graumann (Hg.): Sinn und Erfahrung. Phänomenologische Methoden in den Humanwissenschaften. Heidelberg: Asanger, S. 155–168. Luckmann, Thomas (1992): Theorie des sozialen Handelns. Berlin/New York: De Gruyter. Luckmann, Thomas (1999): Wirklichkeiten: individuelle Konstitution und gesellschaftliche Konstruktion. In: Ronald Hitzler u. a. (Hg.): Hermeneutische Wissenssoziologie. Standpunkte zur Theorie der Interpretation. Konstanz: UVK, S. 17–28. Luckmann, Thomas (2001): Einige Bemerkungen zum Problem der Legitimation. In: Cornelia Bohn/Herbert Willems (Hg.): Sinngeneratoren. Fremd- und Selbstthematisierung in soziologisch-historischer Perspektive. Konstanz: UVK, S. 339–345. Luckmann, Thomas (2002a): Das kommunikative Paradigma der ›neuen‹ Wissenssoziologie. In: Hubert Knoblauch u. a. (Hg.): Thomas Luckmann: Wissen und Gesellschaft. Ausgewählte Aufsätze 1981–2002. Konstanz: UVK, S. 201–210. Luckmann, Thomas (2002b): Individuelles Handeln und gesellschaftliches Wissen. In: Hubert Knoblauch u. a. (Hg.): Thomas Luckmann: Wissen und Gesellschaft. Ausgewählte Aufsätze 1981–2002. Konstanz: UVK, S. 69–89. 169 Claudia Wild: "Schützeichel"/24.10.2007/Seite 170 Thomas Luckmann Luckmann, Thomas (2002c): Lebenswelt. Modebegriff oder Forschungsprogramm? In: Knoblauch, Hubert u. a. (Hg.): Thomas Luckmann: Wissen und Gesellschaft. Ausgewählte Aufsätze 1981–2002. Konstanz: UVK, S. 45–53. Luckmann, Thomas (2002d): Zur Ausbildung historischer Institutionen aus sozialem Handeln. In: Hubert Knoblauch u. a. (Hg.): Thomas Luckmann: Wissen und Gesellschaft. Ausgewählte Aufsätze 1981–2002. Konstanz: UVK, S. 105–115. Luckmann, Thomas (2003): Von der alltäglichen Erfahrung zum sozialwissenschaftlichen Datum. In: Ilja Srubar/Steven Vaitkus (Hg.): Phänomenologie und soziale Wirklichkeit. Entwicklungen und Arbeitsweisen. Opladen: Leske + Budrich, S. 13–26. Pawlowski, Tatjana/Schmitz, H. Walter (Hg.) (2003): 30 Jahre ›Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit‹. Gespräch mit Thomas Luckmann. Aachen: Shaker Verlag. Rammert, Werner/Schulz-Schaeffer, Ingo (2002): Technik und Handeln. Wenn soziales Handeln sich auf menschliches Verhalten und technische Abläufe verteilt. In: Werner Rammert/Ingo Schulz-Schaeffer (Hg.): Können Maschinen denken? Soziologische Beiträge zum Verhältnis von Mensch und Technik. Frankfurt am Main, New York: Campus, S. 11–64. Schnettler, Bernt (2004): Zukunftsvisionen. Transzendenzerfahrung und Alltagswelt. Konstanz: UVK. Schnettler, Bernt (2006a): Thomas Luckmann. Konstanz: UVK. Schnettler, Bernt (2006b): Thomas Luckmann: Kultur zwischen Konstitution, Konstruktion und Kommunikation. In: Stephan Moebius/Dirk Quadflieg (Hg.): Kultur. Theorien der Gegenwart. Wiesbaden: VS, S. 170–184. Schulz-Schaeffer, Ingo (2005): Zugeschriebene Handlungen. Ein Beitrag zur Theorie sozialen Handelns. TU Berlin: Habilitationsschrift. Schütz, Alfred (1932): Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt. Wien: Springer. Schütz, Alfred (1971): Über die mannigfaltigen Wirklichkeiten. Gesammelte Aufsätze I. Den Haag: Nijhoff, S. 237–298. Schütz, Alfred (1972): Der gut informierte Bürger. Gesammelte Aufsätze II. Den Haag: Nijhoff, S. 85–101. Schütz, Alfred (1991 [1932]): Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt. Frankfurt am Main: Suhrkamp (zuerst Wien 1932). Schütz, Alfred und Thomas Luckmann (2003): Strukturen der Lebenswelt. Konstanz: UVK/UTB (zuerst 1979 bzw. 1984). Simmel, Georg (1968 [1908]): Die quantitative Bestimmtheit der Gruppe. Soziologie. Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung. Berlin: De Gruyter, S. 32–100. Sprondel, Walter M. (1979): ›Experte‹ und ›Laie‹. Zur Entwicklung von Typenbegriffen in der Wissenssoziologie. In: Walter M. Sprondel/Richard Grathoff (Hg.): Alfred Schütz und die Idee des Alltags in den Sozialwissenschaften. Stuttgart: Enke, S. 140–154. Srubar, Ilja (1991): ›Phänomenologische Soziologie‹ als Theorie und Forschung. In: Max Herzog/Carl F. Graumann (Hg.): Sinn und Erfahrung. Phänomenologische Methoden in den Humanwissenschaften. Heidelberg: Asanger, S. 169–182. Stegmaier, Peter (2006): Die Bedeutung des Handelns – Zum Verhältnis von Wissenssoziologie und neuropsychologischer Hirnforschung. In: Jo Reichertz (Hg.): Akteur Gehirn? Oder das vermeintliche Ende des handelnden Subjekts. Wiesbaden: VS: S. 101–119. Weber, Max (1984 [1921]): Soziologische Grundbegriffe. Tübingen: Mohr. Wohlrab-Sahr, Monika (2003): ›Luckmann 1960‹ und die Folgen. Neuere Entwicklungen in der deutschsprachigen Religionssoziologie. In: Barbara Orth/Thomas Schwietring/Johannes Weiß (Hg.): Soziologische Forschung. Stand & Perspektiven. Opladen: Leske + Budrich, S. 427–448. 170