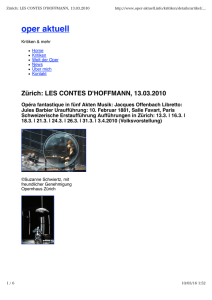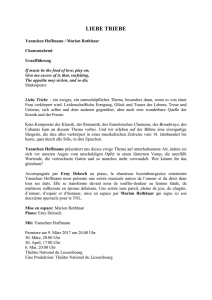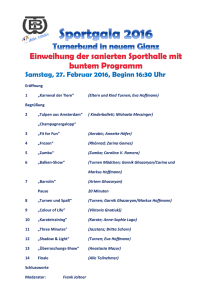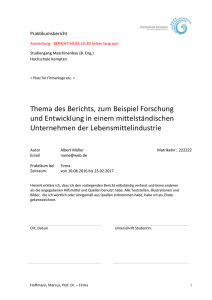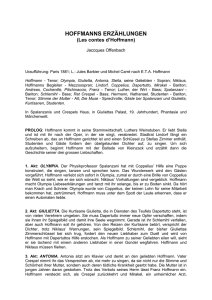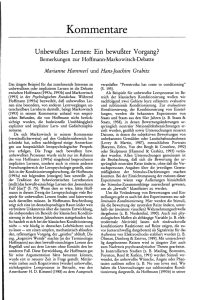Lothar TSCHAPKA Jacques Offenbachs Oper Les Contes d`Hoffmann
Werbung
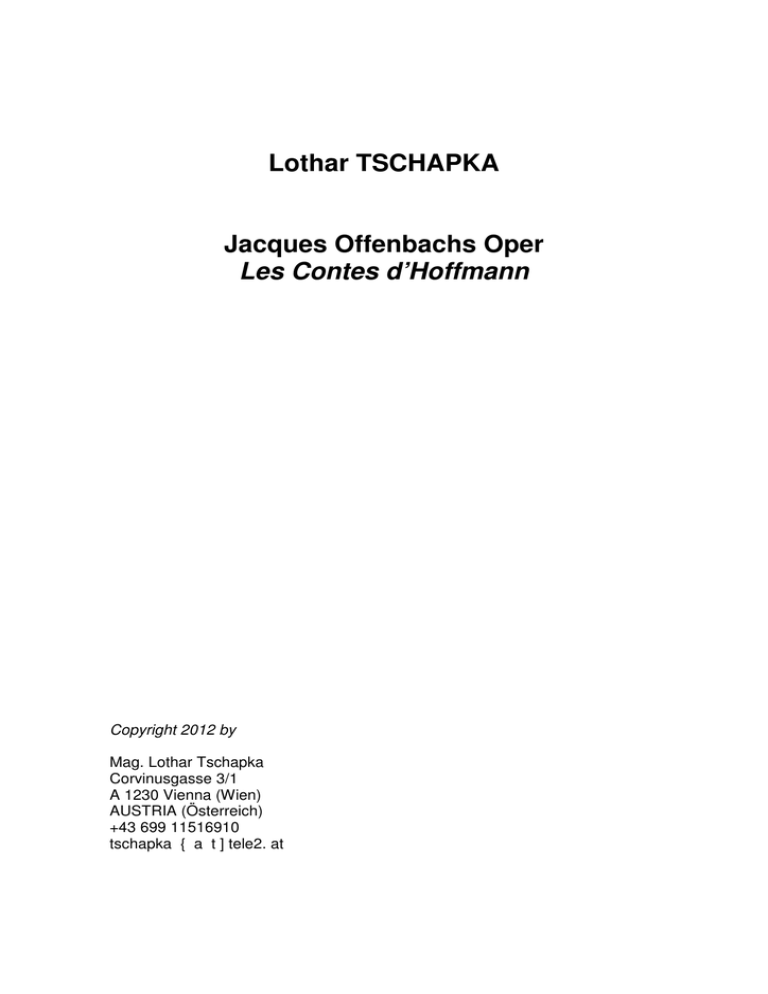
Lothar TSCHAPKA
Jacques Offenbachs Oper
Les Contes d’Hoffmann
Copyright 2012 by
Mag. Lothar Tschapka
Corvinusgasse 3/1
A 1230 Vienna (Wien)
AUSTRIA (Österreich)
+43 699 11516910
tschapka { a t ] tele2. at
Les Contes d’Hoffmann – ein Sonderfall des Opernrepertoires
Jacques Offenbachs Les Contes d’Hoffmann, uraufgeführt 1881 an der Pariser
Opéra Comique, kommt im Repertoire der heute gespielten Opernwerke aus
drei Gründen eine Sonderstellung zu.
Zum Ersten gibt es von keinem anderen Werk der internationalen Spielpläne
eine derart verwirrende Fülle an verschiedenen Fassungen, Einrichtungen und
Bearbeitungen, die parallel an Theatern erlebt werden können. Die Gründe
hiefür sind bekannt: Als Jacques Offenbach am 5. Oktober 1880 verstarb,
waren die Proben für die Uraufführung eben erst angelaufen, eine Endfassung
des Werks lag noch nicht vor. Vorangegangen war ein jahrelanges Tauziehen
zwischen Offenbach und verschiedenen Theatern um die Gestalt seiner Oper.
Hatte Offenbach den Hoffmann zunächst als Opéra comique, dann als
durchkomponierte Opéra lyrique in fünf Akten (jedoch ohne Ballett!) mit einem
Bariton in der Hauptrolle konzipiert, so machten Theaterpleiten die
Übersiedlung des Uraufführungsprojekts an die Opéra Comique notwendig.
Deren Direktor Carvalho knüpfte einschneidende Änderungsbedingungen an
die Übernahme des Werks, unter anderem die Transposition der Titelpartie,
außerdem mussten gemäß der Pariser Theaterkonvention für eine Aufführung
an der Comique gesprochene Dialoge anstelle der Rezitative verwendet
werden.
Bei Offenbachs Tod lagen lediglich der mehr oder weniger vollendete
Klavierauszug der ersten vier Akte sowie Skizzen zum fünften Akt von der Hand
des Komponisten vor. Um die Uraufführung zu ermöglichen, wurde der
Komponist Ernest Guiraud, der bereits mit einer Rezitativfassung von Bizets
Carmen als Bearbeiter hervorgetreten war, mit der Fertigstellung der Partitur
beauftragt. Rollenumbesetzungen sowie weitere kurzfristige Eingriffe Carvalhos
hatten zur Folge, dass das Werk bereits bei seiner Uraufführung am 10.
Februar 1881 in einer gegenüber Offenbachs Konzeption stark veränderten und
gekürzten Version erklang. Diese Änderungen wurden in den folgenden
Druckfassungen nur teilweise revidiert und Offenbachs autographe Skizzen
zudem verstreut, so dass Les Contes d’Hoffmann für die nächsten knapp
hundert Jahre weltweit nur in apokrypher Gestalt rezipiert wurde: Guiraud hatte
für die Publikation eine durchkomponierte Fassung erstellt, die die Grundlage
der allermeisten Produktionen bildete. Bald setzten jedoch weitere
Bearbeitungsbestrebungen ein. So wurde für Aufführungen in Monte Carlo im
Jahr 1904 ein Sextett mit Chor sowie in Berlin 1905 die auf einem Motiv aus
Offenbachs Operette Le Voyage dans la Lune beruhende sogenannte
Spiegelarie nachkomponiert, Zufügungen, die auch in die gedruckten Ausgaben
übernommen wurden und noch heute an manchen Bühnen zu hören sind.
In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts kam es zu Bemühungen um die
Rekonstruktion einer originaleren Werkgestalt. Unter Verwendung des der Oper
zugrundeliegenden Theaterstücks legte Walter Felsenstein 1958 in Ost-Berlin
eine Version vor, in der Guirauds Rezitative völlig gestrichen und durch Dialoge
2
ersetzt sind. In offensichtlicher Unkenntnis der autographen Quellen strichen
Felsenstein und sein musikalischer Mitarbeiter Voigtmann jedoch auch jede
Menge originaler Offenbach-Musik, so dass sich ihre Version heute als Torso
von lediglich historischem Interesse präsentiert. Erst mit der Auffindung von
1250 originalen Manuskriptseiten durch Antonio de Almeida im Jahr 1970 war
der Weg für quellenkritische Neuausgaben bereitet: die Fassung von Fritz
Oeser aus dem Jahr 1977 stellte die „Gesamtarchitekur“ des Werks - unter
anderem die korrekte Reihenfolge der Akte, die Rolle der Muse und die
Apotheose im Schlussbild - wieder her. Die Auffindung weiterer Quellen, unter
anderem des originalen Finales zum Giulietta-Akt, machte die Oeser-Fassung
jedoch bald obsolet und führte schließlich zur Version von Kaye und Keck, die
sämtliche vorhandenen autographen Quellen berücksichtigt und zudem die
Guiraud-Rezitative zur Disposition stellt. Damit liegt den Theatern nun alles vor,
was Offenbach an Musik zum Hoffmann hinterlassen hat; wegen der
zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten teilweise parallel vorhandener
Musiknummern ergibt sich für die Produktionsteams erst recht die Qual der
Wahl. In der Praxis ist heute auf den Bühnen teilweise ein wildes Gemisch aus
Guiraud, Oeser und Kaye-Keck, sogar mit unsystematischen Wechseln
zwischen Dialog- und Rezitativfassung, zu erleben. Vielerorts möchte man auch
auf die apokryphe, aber durch die Aufführungsgeschichte etablierte Spiegelarie
nicht verzichten. Noch stärker als früher gilt also: Soviele Produktionen des
Hoffmann, soviele Fassungen! Eine allgemein gültige Werkgestalt ist damit in
weitere Ferne gerückt denn je; die Quellenfunde haben vielmehr klargemacht,
dass es nicht geben kann, was es nie gegeben hat: eine von Offenbach
vollendete Fassung des Stücks!
Der zweite Grund, der Les Contes d’Hoffmann zu einem Sonderfall des
Repertoires macht, ist die „Doppelgesichtigkeit“ ihres Komponisten: als
Jugendlicher von Deutschland nach Paris gekommen, wurde Offenbach zum
Starkomponisten der französischen Operette und verhalf sich und dem Genre
zu Weltruhm. Seinen Versuchen, im „ernsten“ musiktheatralischen Fach zu
reüssieren, wie der Oper Die Rheinnixen oder der Bühnenmusik zu Sardous La
Haine, blieb größerer Erfolg verwehrt. Auch die von Jean-Christophe Keck
betreuten kritischen Ausgaben dieser Stücke seit der Jahrtausendwende
führten lediglich zu Aufführungen in Städten wie Ljubljana, St. Pölten oder
Montpellier, kaum aber in den großen Musikzentren der Welt! Erst mit Les
Contes d’Hoffmann, dem Projekt seiner letzten Lebensjahre, konnte Offenbach
– freilich posthumen – Erfolg im „ernsten“ Fach und einen fixen Platz in den
Opernspielplänen erringen. Trotz einzelner Opéra-bouffe-Anklänge wie dem
Gästemenuett oder dem Couplet des Frantz hebt sich die Tonsprache des
Werks deutlich von jener der Operetten ab. In die Musikgeschichte ist
Offenbach jedenfalls doppelt eingegangen: als Operettenkomponist - und als
Schöpfer der Contes d’Hoffmann.
Von den bekannten Komponisten des 19. Jahrhunderts erwiesen sich vielleicht
Rossini und Donizetti als ähnlich vielseitig wie Offenbach. Im 20. Jahrhundert
erreichten noch Schostakowitsch und – auf andere Art – Leonard Bernstein
3
eine vergleichbare Spannbreite. Im Abstand der Musiksprache von Offenbachs
Operetten zu der seines Hoffmann ist sicherlich schon jene Dichotomie der
Genres erkennbar, die im 20. Jahrhundert zur Aufspaltung der Musik in die
sogenannten U- und E-Bereiche führen sollte.
Die dritte Besonderheit der Contes d’Hoffmann besteht darin, dass sie die
Literatur-, Musiker- und Künstleroper par excellence sind; kein anderes Werk
des aktuellen Musikthaterrepertoires weist eine solche Dichte an Verweisen auf
Kunst, Künstler, Dichtung und Fiktion, Musik und Gesang und damit einen so
stark autoreferentiellen Charakter auf.
Gewiss thematisieren auch Stücke wie Palestrina, Ariadne auf Naxos, die
Meistersinger, Cardillac (auch dies nach einem Stoffe Hoffmanns!) oder die
verschiedenen Vertonungen des Orpheus-Mythos die Rolle von Kunst und
Künstlern, des Singens und der Musik oder stellen Fragen des künstlerischen
Schöpfungsprozesses oder künstlerischer Schaffenskrisen ins Zentrum.
Bedingt durch die Mehrfachbegabung des historischen E.T.A. Hoffmann als
Dichter, Musiker und Zeichner sowie die zentrale Rolle, die Fragen von Kunst
und Künstlertum in seinem Œuvre, besonders in den der Oper
zugrundeliegenden Erzählungen, spielen, treten diese Themen in den Contes
jedoch in besonders hoher Intensität und wechselseitiger Interdependenz auf.
Gerade die Wiederherstellung der Rahmen- und Musenhandlung ab den
1970er Jahren hat klargemacht, was aus früheren Versionen in diesem Ausmaß
nicht ablesbar war: dass die Berufung zur Kunst und die Bestimmung zum
Schreiben zentrales Thema und übergeordnetes „Programm“ der Contes
d’Hoffmann sind und die Funktion der drei Mittelakte für das Werkganze erst
aus diesem Kontext heraus verstehbar wird.
Dies gibt Anlass, nach Libretto und literarischen Quellen von Les Contes
d’Hoffmann zu fragen.
Libretto und literarische Quellen der Contes d’Hoffmann
E.T.A. Hoffmanns Werke waren in Frankreich ab den 1820er Jahren in
Übersetzungen verbreitet und übten starken Einfluss auf die französische
Phantastik bis hin zum Symbolismus aus. Das französische Autorenduo Jules
Barbier und Michel Carré – Verfasser der Libretti unter anderem für Gounods
Faust und Roméo et Juliette – gestaltete 1851 aus mehreren Erzählungen des
deutschen Dichters ein Sprechstück mit dem Titel Les Contes d’Hoffmann.
Dieses dürfte Offenbach gesehen haben, jedenfalls begann 1873, nachdem
1867 der Komponist Hector Salomon ein Contes-Libretto von Barbier und Carré
verworfen hatte und 1870 das ebenfalls auf E.T.A. Hoffmann fußende Ballett
Coppélia von Delibes erschienen war, Offenbach die Zusammenarbeit mit Jules
Barbier (Carré war bereits verstorben) als Librettisten einer Opernfassung der
Contes d’Hoffmann.
4
Wie bereits das Sprechstück gliedert sich auch die Oper Les Contes
d’Hoffmann in fünf Akte, wobei die beiden äußeren eine Rahmenhandlung
bilden, in der der Dichter E.T.A. Hoffmann als Hauptfigur und Erzähler dreier
Geschichten – diese bilden die drei Mittelakte – eingeführt wird. Anders als in
den literarischen Originalen tritt der Dichter auch in den drei Erzählungen als
Protagonist auf.
Die Rahmenhandlung ist großteils eine Schöpfung Barbiers und Carrés und
nimmt nur eher losen Bezug auf hoffmannsche Vorlagen: sie verarbeitet Motive
aus den Erzählungen Don Juan, Klein Zaches, genannt Zinnober sowie – im
lautmalerischen „Krick-krack“-Refrain des Klein-Zack-Liedes – Nussknacker
und Mäusekönig. Als dramaturgische Klammer zwischen Rahmenhandlung und
Mittelakten schufen die Autoren eine Reihe von Figuren, die sich neben
Hoffmann in wandelnder Gestalt ebenfalls durch das gesamte Stück ziehen; es
sind dies die (in keinem der Ursprungstexte vorkommende) Muse Hoffmanns,
die bereits im 1. Akt die Züge von dessen (bei Hoffmann ebenfalls nicht
belegtem) Begleiter Nicklausse annimmt, weiters die Figur der vier Bösewichter,
die der vier Diener und – nicht zuletzt – die der vier Frauen, der Geliebten
Hoffmanns. Nach dem Willen der Autoren sollten diese Rollen auch
durchgehend mit denselben Sängerinnen und Sängern besetzt sein.
Im ersten Akt (oder Prolog) treten nach wenigen Eröffnungstakten – Offenbach
war kein Freund langer Ouvertüren – in Lutters Weinkeller in Berlin die Geister
des Alkohols auf, gefolgt von der Muse, die ankündigt, was im Folgenden
passieren wird: Im nebenliegenden Opernhaus gastiert die gefeierte Sängerin
Stella in Mozarts Don Giovanni und wird versuchen, ihre frühere
Liebesverbindung mit Hoffmann zu erneuern. Sie, die Muse, müsse dies
zugunsten Hoffmanns verhindern. Zu diesem Zweck nimmt sie die Gestalt des
Nicklausse an, in dieser wird sie ihn durch alle Akte begleiten. Als nächste Figur
tritt Conseiller Lindorf auf: er ist Hoffmanns Gegenspieler in der Liebe und
trachtet diesen in der Gunst Stellas auszustechen. Aus diesem Grund fängt er
einen Liebesbrief Stellas an den Dichter ab, der eine Einladung zum
Stelldichein samt Schlüssel zu ihrem Zimmer enthält. Im Übrigen baut Lindorf
darauf, dass Hoffmann sich durch Alkoholgenuss selbst außer Gefecht setzen
werde, und bleibt, um das Weitere zu beobachten: In der Theaterpause
stürmen Studenten, Freunde Hoffmanns, den Keller, später kommt auch ein
übel gelaunter Hoffmann hinzu, in dem die Nähe Stellas den Schmerz der
seinerzeitigen Trennung wachruft. Er singt für die Freunde das Lied von KleinZack, und unter Alkoholeinfluss beschließt man, statt zur Opernaufführung
zurückzukehren, Hoffmann die Geschichten seiner drei großen Lieben erzählen
zu lassen. Natürlich handelt es sich bei den drei Episoden nur um
Versinnbildlichungen seiner Liebe zu Stella; wie real oder fiktiv die Erzählungen
innerhalb der Stückwirklichkeit sein sollen, bleibt jedoch unbenannt.
Der zweite Akt (oder Olympia-Akt) schildert die Liebe Hoffmanns zur Puppe
Olympia und ist weitgehend getreu an Teile der Erzählung Der Sandmann aus
den Nachtstücken angelehnt: Der Physiker Spalanzani hat sein Meisterstück
5
vollbracht und die lebensechte Puppe Olympia gebaut. Durch ihre Vorführung
erhofft er sich Einnahmen, die den Verlust seines Vermögens beim Bankrott
seines Bankiers wettmachen sollen. Lediglich für die Konstruktion von Olympias
Augen musste sich Spalanzani an den diabolischen, rätselhaften Brillenhändler
Coppélius (eine der Personifikationen des Lindorf aus dem Prolog) wenden.
Dieser Coppélius drängt Hoffmann eine Zauberbrille auf, durch die ihm Olympia
lebendig erscheint und ihn in heftiger Liebe entbrennen lässt: als sie vor
versammelter Gesellschaft singt, bemerkt er nicht den mechanischen Charakter
ihres Vortrags und ihrer Bewegungen. Coppélius, dem Spalanzani Olympias
Augen mit einem ungedeckten Wechsel abgelöst hat, zerstört aus Rache vor
Spalanzanis Gästen die Puppe. Hoffmanns Zauberbrille ist ebenfalls
zerbrochen, und unter heftigem Spott der Anwesenden muss er erkennen, dass
er eine Automate geliebt hat.
Der dritte Akt (oder Antonia-Akt) ist mit gewissen Modifikationen der Erzählung
Rat Crespel aus dem ersten Band der Serapionsbrüder nachgebildet. Das Motiv
des Arztes, der seine Patienten zu Tode bringt, wurde vermutlich Hoffmanns
Novelle Signor Formica entnommen. Das Mädchen Antonia hat von ihrer
Mutter, einer gefeierten Sängerin, Stimme und Begabung geerbt, jedoch auch
eine körperliche Anlage, die das Singen zur Lebensbedrohung macht. Die
Mutter ist dieser heimtückischen Krankheit wie auch der Behandlung durch den
diabolischen Docteur Miracle – wieder Lindorf in disguise! – zum Opfer gefallen.
Antonias Vater Crespel ist mit dem Mädchen nach München geflohen, um sie
von ihrem Geliebten Hoffmann fernzuhalten, der in Unkenntnis ihrer Krankheit
mit ihr zu singen pflegte. Hoffmann und Nicklausse haben Antonias Aufenthalt
herausgefunden und verschaffen sich heimlich Zutritt zum Haus. Hoffmann
erfährt zufällig von Antonias gefährlicher Anlage und nötigt ihr das Versprechen
ab, nie mehr zu singen. Miracle stachelt jedoch ihren Ehrgeiz an, und
gemeinsam mit der Stimme der verstorbenen Mutter bringt er Antonia zum
Singen; sterbend bricht sie zusammen.
Der vierte Akt (auch Giulietta- oder Venedig-Akt) lehnt sich an Motive aus
Hoffmanns Geschichte vom verlorenen Spiegelbild aus den Abenteuern der
Sylversternacht an; als weitere Quelle kommt noch die kurze Erzählung Die
Gesellschaft im Keller in Frage. Giuliettas Diener Pitichinaccio ist nach einer
Figur aus Signor Formica geformt. Da dieser Akt bei der Uraufführung ganz
gestrichen und anschließend nur in der starken Bearbeitung und Kürzung
Guirauds, später mit den erwähnten apokryphen Hinzufügungen, verfügbar war,
weicht hier die Rekonstruktion von Kaye und Keck besonders stark von allen
vorherigen Fassungen ab: Bei einem Venedig-Aufenthalt verliebt sich Hoffmann
in die Kurtisane Giulietta und tötet sogar ihren Liebhaber, den schattenlosen
Schlemihl (eine Übernahme aus Chamissos Erzählung; in der hoffmannschen
Vorlage wird Schlemihl lediglich kurz und ironisch erwähnt). Für ihre Liebe
verlangt Giulietta auf Geheiß des dämonischen Dapertutto, einer weiteren
Personifikation Lindorfs, von Hoffmann sein Spiegelbild. Als dieser sich
hintergangen sieht, tötet er in einem hochdramatischen (erst 1993
wiederaufgefundenen) Finale Giulietta und Pitichinaccio.
6
Im fünften Akt (oder Epilog) kommt es ebenfalls zu starken Abweichungen der
rekonstruierten Fassungen von der früheren Aufführungspraxis: Die drei
Liebesabenteuer sind erzählt, Hoffmann ist stark betrunken. Inzwischen ist
nebenan die Giovanni-Aufführung mit triumphalem Erfolg der Stella zu Ende
gegangen. Sie kommt in Lutters Keller, auf der Suche nach Hoffmann. Dieser
entsagt jedoch der Liebe zu ihr, wird in seinem Schmerz von der Muse getröstet
und, sozusagen im Sinne freudscher Triebsublimierung, seiner eigentlichen
Bestimmung, der Kunst, zugeführt: ”Des cendres de ton cœur réchauffe ton
génie... On est grand par l'amour et plus grand par les pleurs…”
Wie der Großteil der Rahmenhandlung hat auch dieses Finale keine direkte
Entsprechung in den literarischen Vorlagen; das Motiv der Apotheose könnte
dem Schluss von Hoffmanns Novelle Der goldne Topf entlehnt sein, in dem der
Student Anselmus seiner Alltagssorgen enthoben und in ein sagenhaftes
Atlantis entrückt wird. Michail Bulgakow gab seinem – durch Hoffmann
beeinflussten – Roman Мастер и Маргарита (Der Meister und Margarita, 192840) ein ähnliches Ende.
Wie bereits erwähnt, erhält die Gesamthandlung der Contes d’Hoffmann erst
durch das Apotheose-Finale rückwirkend ihren eigentlichen Sinn. Dieses war
fester Bestandteil von Offenbachs Konzeption und erklang bereits bei einer
internen Aufführung einiger Nummern aus dem Hoffmann in Offenbachs
Wohnung am 18. Mai 1879; nach dessen Tod und kurz vor der Uraufführung
wurde es jedoch aus dem Stück gestrichen und erst knapp hundert Jahre
später durch Fritz Oeser wiedereingeführt.
Phantastik und Wahnsinn in Les Contes d’Hoffmann
Die phantastischen und dämonischen Elemente in den Contes d’Hoffmann sind
in hohem Maße bereits durch die literarischen Vorlagen E.T.A. Hoffmanns
vorgegeben; Barbier und Carré haben lediglich das heterogene Material
dramaturgisch vereinheitlicht – unter anderem durch die Schaffung
„durchgehender“ Figuren – und im Übrigen mit einem durchaus hoffmannesken
Pandämonium skurriler Charaktere, wie der vier Diener, angereichert.
E.T.A. Hoffmann war seinerseits von Schauerromantik und englischer Gothic
Novel stark beeinflusst, etwa stellt sein Roman Die Elixiere des Teufels
eigentlich eine Bearbeitung des Monk von Matthew Gregory Lewis dar. In der
Phantastik vieler Werke Hoffmanns (wie auch der unzähliger Volksmärchen,
Mythen usw.) muss zwischen „Kräften des Guten“ wie dem Nussknacker aus
Nussknacker und Mäusekönig und bösen, teuflischen Elementen wie dem
Mäusekönig oder eben Coppola-Coppelius und Dapertutto unterschieden
werden. Analog finden sich auch in der Oper Les Contes d’Hoffmann
Repräsentanten beider Prinzipien: für das „übersinnliche Gute“, den
Protagonisten Schützende steht die Muse, vergleichbar mit der guten Fee im
7
Klein Zaches; das Teuflische ist durch Hoffmanns Antagonisten LindorfCoppélius-Miracle-Dapertutto verkörpert. Diesem hat Offenbach ein eigenes
Auftrittsmotiv zugedacht, ein „barock gestelzte[s] Baßmotiv“ (OESER 1977) mit
einem charakteristischen Triller:
Oeser hat darauf hingewiesen, dass (fast) „[i]mmer wenn Lindorf und seine
Zerrbilder auftreten, [...] das Wörtchen ‚diable’ [fällt]“ (OESER 1977).
Es entspricht auch durchaus der hoffmannschen Gedankenwelt, dass Figuren
aus einer realen, „bürgerlichen“ Sphäre wie etwa Archivarius Lindhorst aus dem
Goldnen Topf (im Guten) oder Coppola aus dem Sandmann (im Bösen) eine
zweite, wunderbare Existenz in einer phantastischen Parallelwelt führen und
zwischen beiden Seinsformen changieren können. Der Kontrast zwischen
(spieß-)bürgerlicher Rolle im Hier und wunderbarem Sein im Dort verstärkt
dabei oft die karikierende Zeichnung der ersteren. Insofern ist auch der ältliche,
lebensgierige Conseiller Lindorf mit seinen alter egos als Brillenhändler und
Augensammler, teuflischer Arzt und Sammler von Spiegelbildern nicht eine
reine Erfindung Barbiers und Carrés, sondern der Gedankenwelt E.T.A.
Hoffmanns durchaus gut nachempfunden.
Zwei Szenen der Oper, in denen das Unheimliche und Wahnhafte eine
besondere Rolle spielen, seien zuletzt noch genauer betrachtet: zum einen die
Arie der toten, rein automatischen Puppe Olympia, die Hoffmann lebendig
erscheint, und zum anderen das Terzett, in dem Antonia von Miracle und der
Stimme der Mutter in den Tod getrieben wird.
8
Spalanzani hat Olympia so kunstvoll konstruiert, dass sie vor den Gästen eine
Arie zum Besten geben kann; bereits deren dümmlicher Text deutet allerdings
auf Olympias Automatenhaftigkeit hin. Um das Mechanische ihres Vortrags
auch musikalisch zu charakterisieren, trennt Offenbach die Textwörter der Arie
durch Achtelpausen voneinander, ein Effekt, der schon unmittelbar vor
Olympias Arie im Stottern von Spalanzanis Diener Cochenille anklingt.
Olympias Koloraturen weisen ebenfalls in die Richtung einer unbeseelten, rein
„puppenhaften“ Kunst. Gleichzeitig liefert Offenbach (wie auch schon Hoffmann
in der literarischen Vorlage) hier eine bissige Satire auf äußerliches, lediglich
auf Zurschaustellung technischer Virtuosität abzielendes Primadonnentum. In
der Puppe Olympia soll die kalte und oberflächliche Seite von Stellas Charakter
versinnbildlicht sein. In den folgenden Akten stehen dann Antonia für das
Künstlertum, aber auch den Ehrgeiz, und Giulietta für die Falschheit und
Treulosigkeit, die Hoffmann in Stella sieht. Leider besteht hier nicht der Raum,
um auf die Frage einer möglichen misogynen Grundtendenz der Contes
d’Hoffmann näher einzugehen; es sei lediglich angemerkt, dass in der Oper die
Figuren von Nathanaels Verlobter Clara und Spikhers deutscher Ehefrau
wegfallen, die in den Original-Erzählungen als charakterstarke Antagonistinnen
zu Olimpia und Giulietta auftreten.
Mannigfach sind die Deutungen, die die Figur der Olympia im Lauf der Zeit
erfahren hat. Sigmund Freud meinte, unter Bezugnahme auf die hoffmannsche
Novelle, die belebte Puppe sei eigentlich die Erfüllung eines Kinderwunsches
und daher nicht unheimlich, das Unheimliche der Handlung gehe vielmehr vom
„Augensammler“ Coppola-Coppelius aus, die von ihm ausgelöste Angst vor
dem Verlust der Augen stehe für männliche Kastrationsangst (FREUD 1919).
Heutigen Inszenierungen bietet die Olympia-Figur einen breiten Spielraum,
etwa wurde sie in einer Wiener Produktion im Sommer 2012 von der
Darstellerin Marlis Petersen als Persiflage auf das deutsche Model Heidi Klum
gestaltet.
Das Terzett zwischen Antonia, Miracle und der Stimme der Mutter stellt eine der
musikalisch dichtesten, wenn nicht die dichteste Nummer des Stücks dar und
wurde bereits bei der Uraufführung begeistert akklamiert. Es zerfällt in einen
langsamen und einen schnellen Teil. Im langsamen ruft die Stimme der
verstorbenen Mutter nach Antonia und fordert sie auf, ihr Erbe als gefeierte
Sängerin anzutreten:
9
Die punktierten Viertel im - normalerweise selten anzutreffenden - 12/8-Takt
wirken dabei extrem langgezogen, in Verbindung mit der Melodieführung
vorwiegend in Primen entsteht der Eindruck des Rufens aus weiter Ferne.
Typologisch reiht sich dieser Teil in die lange Tradition der sogenannten
Ombra- und Orakel-Szenen, wie wir sie etwa aus Glucks Alceste kennen. Ein
Beispiel aus einer französischen Oper in größerer zeitlicher Nähe zu Les
Contes d’Hoffmann sind die Auftritte des Geists in Ambroise Thomas’ Hamlet
(1868), zu dem ebenfalls Barbier und Carré das Libretto geliefert haben.
Im schnellen Teil des Terzetts steigert sich Antonia, immer wieder angefeuert
von Miracle, in ein ekstatisches, wahnhaftes Singen. Um das unnatürliche,
schnappende Luftholen der Kranken, zu Tode Gehetzten musikalisch
auszudrücken, setzt Offenbach Achtelpausen mitten in ihre Textwörter bzw.
mots phonétiques. Besonders gut erkennbar ist dies im Vergleich zur
rhythmischen Führung der Stimmen Miracles und der Mutter, die hier übrigens
stets auf einem Ton, dem e, verweilt:
10
Am Ende der Szene bricht Antonia sterbend zusammen. Der österreichische
Psychiater Erwin Ringel ließ 1985 in seinem vielbeachteten Vortrag an der
Universität Wien zum Thema Der Arzt in der Oper dieses Terzett live vorführen
und nannte Miracle als opernhaftes Beispiel für Mediziner, die in vollkommener
Inversion ihres Berufs Patienten töten, statt sie zu heilen. Wer damals meinte,
dass so etwas nicht mehr vorkomme, wurde durch die wenige Jahre später
publik gewordene Geschichte des englischen Arztes Dr. Shipman eines
besseren belehrt.
Tatsächlich wirkt das Motiv des mörderischen Arztes, verbunden mit Miracles
Fähigkeit, die Stimme der verstorbenen Mutter heraufzubeschwören, besonders
erschreckend. Gleichzeitig bedeutet es natürlich auch ein gerüttelt Maß an
romantischer Ironie, wenn ausgerechnet in einer Oper Musik und Singen als
todbringend gezeigt werden. Doch sind es gerade diese – durch die
zugrundeliegenden chefs-d’œuvre E.T.A. Hoffmanns vorgezeichneten –
ironischen Brechungen und Ambivalenzen, die den besonderen inhaltlichliterarischen Reichtum der Contes d’Hoffmann ausmachen!
11
LITERATUR
BRANDSTETTER, Gabriele (Hg.) (1988): Jacques Offenbachs "Hoffmanns
Erzählungen": Konzeption, Rezeption, Dokumentation. Laaber: Laaber.
(Thurnauer Schriften zum Musiktheater, 9.)
DIDION, Robert (1991): Les Contes d’Hoffmann. In: Pipers Enzyklopädie des
Musiktheaters, hg. Carl Dahlhaus et al., 4. München, Zürich: Piper. 571-81.
FREUD, Sigmund (1919): Das Unheimliche. In: Imago 5, 297-324.
HEINZELMANN, Heinz (2003): Jacques Offenbach: „Hoffmanns Erzählungen“.
Entstehungsgeschichte und derzeitige Quellenlage. In: ÖMZ 58 (7), 15-31.
KAYE, Michael / KECK, Jean-Christophe (2009): Vorwort. In: OFFENBACH,
Jacques: Les Contes d’Hoffmann (Hoffmanns Erzählungen). Fantastische Oper
in fünf Akten. Kritische Ausgabe von Michael Kaye und Jean-Christophe Keck.
Klavierauszug mit Gesang (französisch/deutsch). Berlin: Boosey & Hawkes,
Bote & Bock. V-XV.
LAMB, Andrew (1992): Les Contes d’Hoffmann. In: The New Grove Dictionary
of Opera, hg. Stanley Sadie, 1. London: Macmillan. 923-25.
OESER, Fritz (1977): Vorwort. In: OFFENBACH, Jacques: Hoffmanns
Erzählungen (Les Contes d'Hoffmann). Quellenkritische Neuausgabe von Fritz
Oeser. Klavierauszug. Kassel: Alkor-Edition (AE 333). XI-XXIII.
PESCHEL, Enid Rhodes / PESCHEL, Richard E. (1985): Medicine, Music, and
Literature. The Figure of Dr. Miracle in Offenbach’s Les contes d’Hoffmann. In:
Opera Quarterly 3 (2), 59-71.
Copyright 2012 by
Mag. Lothar Tschapka
Corvinusgasse 3/1
A 1230 Vienna (Wien)
AUSTRIA (Österreich)
+43 699 11516910
tschapka { a t ] tele2. at
12