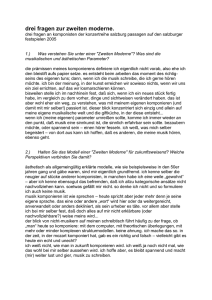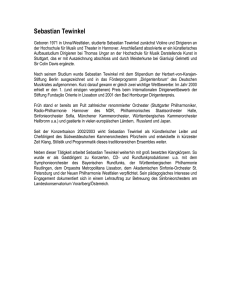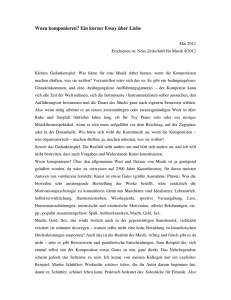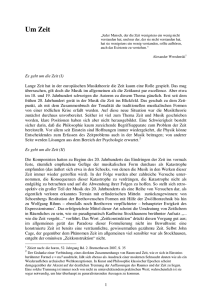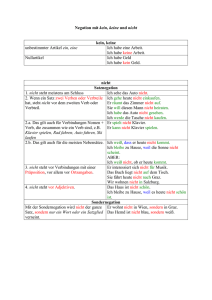Meine sehr geehrten Damen und Herren, au
Werbung

Ist die Ausübung einer Begabungsvielfalt auf einheitlichem Niveau dauerhaft möglich? Meine sehr geehrten Damen und Herren, aus Anlass der Verleihung des Musikförderpreises 2008 des Kulturfonds Baden an Frank Düpree habe ich mir Gedanken darüber gemacht, ob die Ausübung einer Begabungsvielfalt - bei ihm zweifelsohne vorhanden - auf einheitlichem Niveau dauerhaft möglich ist. Mir passiert es in meinem Berufsleben immer wieder, dass ich gefragt werde: „Sie spielen Klavier, Sie unterrichten Klavier an einer Musikhochschule….“ kurzes nachdenkliches Schweigen …. „und was noch ??“ Taucht eine so geartete Frage nach einem meiner Konzerte auf, kann ich doch eventuell die in den Augen meines Gegenübers nach meiner ehrlichen negativ ausfallenden Antwort kurz aufflackernde Enttäuschung relativieren. Aber ich muss es hinnehmen, dass ich von manchen Zeitgenossen als Fachidiotin eingeschätzt werde, kennen sie doch einen Musiklehrer vor Ort, der Unterricht in den Fächern Klavier, Keyboard, Orgel Akkordeon, Diatonische Harmonika, Gitarre, E-Gitarre, E-Bass und Blockflöte erteilt! Natürlich habe ich auch in anderen Instrumenten eine gründliche Ausbildung genossen, aber dennoch: Mit „noch was“ kann ich nicht dienen, ich bin professionell gesehen eine Nur-Pianistin und Nur-Klavierpädagogin. Das Präfix Nur wird üblicherweise mit der Tätigkeit einer Hausfrau verknüpft und hat immer noch einen abwertenden Beigeschmack, auch wenn in der Werbung neuerdings von „Familienmanagerin“ die Rede ist. Anmerken, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, darf ich, dass es mir als Pianistin noch nie am Instrument langweilig geworden ist! Zu reich und zu groß ist der Kosmos der Kompositionen, zu gewaltig die Herausforderung, sich neue und auch alte unbekannte Werke verschiedener Stilrichtungen anzueignen, die eigene Interpretation von Repertoirestücken immer wieder zu überdenken, mit frischen Augen zu sehen und mit frischen Ohren zu hören. Peter Röbke von der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien drückt es so aus: „So wie jede Welle im Meer eine eigene und einmalige Gestalt hat, so hat auch jede Melodie eine eigene Gestalt und jeder musikalische Verlauf seine energetische Unverwechselbarkeit – und das bedeutet eine unaufhörliche Faszination für den, der musiziert und immer wieder aufs neue den musikalischen Wellenbewegungen nachspüren kann und muss.“ Zitat Ende. Das Sprichwort „Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr...“ gilt auf jeden Fall für die hohen Leistungsanforderungen für Profis im instrumentalen Bereich. Deshalb sollten Eltern ein musikalisches Hänschen schon von allerfrühester Jugend an nicht nur gewähren lassen, sondern auch intensiv unterstützen, wenn es sich für Musik im allgemeinen, sogar für mehrere Instrumente bzw. mehrere musikalische Gebiete interessiert. Die Neugier, die kleine Kinder im Umgang mit Klängen mitbringen, erstreckt sich zunächst auf alles - egal ob Vogelgezwitscher, Hundegebell, Autohupen oder das Geräusch eines vorbei fahrenden Motorrades. Und das alles ist ja letztlich auch Musik, hat Komponisten inspiriert und wurde quasi nachkomponiert: Die Vögel exzessiv von Olivier Messiaen, der Kuckuck von LouisClaude Daquin, die Henne von Jean-Philippe Rameau, das Hundegebell von Antonio Vivaldi, die Autohupen von George Gershwin in „Ein Amerikaner in Paris“ und selbst das Motorrad im Posaunenkonzert von Jan Sandström. Die Alltags-Instrumente der Erwachsenen reizen die Kleinen: das Schlagen des Schneebesens, das Scheppern der Kochtöpfe, der pfeifende Wasserkessel, das Klappern der PC-Tastatur – dann zuweilen mit einer Mischung aus Neugier und Angst: die Bohrmaschine oder der Rasenmäher. Dem Baby drücken die Eltern mit Holzrassel, Klapperkugel die ersten eigenen „Perkussionsinstrumente“, mit Quietschtieren „Melodieinstrumente“ in die Hand. die ersten Und was motiviert das Krabbelkind in musizierenden Familien zu ersten Stehversuchen? Da ist dieser Kasten… mit weißen und schwarzen Tasten…. auf dem Mama, Papa, Bruder oder Schwester so interessante Klänge zaubern. Genauso, wie das Kind die Sprachlaute und den Gesang nachahmt – man spricht abschätzig und nahezu diffamierend von der Papageienmethode, obwohl diese Methode gerade beim Spracherwerb die überragende Rolle spielt – versucht es auch andere Tätigkeiten zu imitieren. Auch hier wird oft ein tierisch abwertender Begriff gebraucht: nachäffen. Und so drückt das Kind vorsichtig eine Taste, wie es das beobachtet hat, oder traktiert – genügend Halt vorausgesetzt – das Instrument mit der ganzen Patschhand – wie es das nicht unbedingt beobachtet hat, aber unbedingt ausprobieren muss. Bald jedoch ist es an der Zeit, dass die Spielereien mit der Musik in gute Bahnen gelenkt werden. Verantwortliche Eltern müssen jetzt handeln – im Fall unseres Preisträgers Frank Düpree ist das ideal geschehen! Hier greift sofort die wesentliche Bedeutung eines qualifizierten Anfangsunterrichts! Aber auf welchem Instrument? „Die Musiker-Instrumenten-Beziehung, so könnte man auf den ersten Blick meinen, beginnt in dem Moment der Auswahl eines Instruments. Doch das“, so schreibt Karin Nohr, „woran sich die Auswahl orientiert, beeinflusst bereits die Einstellung zum Instrument. Von Anfang an ist das Instrument ein projektiv aufgeladener und mit – oft elterlichen – Vermächtnissen symbolisch angereicherter Gegenstand.“ Die Wahl des Instruments kann auf verschiedene Art geschehen: Durch permanente musikalische Äußerungen eines Kindes – in welcher Form auch immer -, welche die Eltern zur musikalischen Förderung praktisch drängen, dann durch den Wunsch des Kindes, dasselbe Instrument wie eine enge Bezugsperson zu spielen, durch sanften oder weniger sanften Druck der Eltern, ein bestimmtes Instrument i h r e r Wahl zu erlernen, durch überraschendes Sichverlieben des Kindes in ein Instrument, nachdem es schon ein anderes einige Jahre gespielt hat, und schließlich durch Zufall, der auch mit dem Ehrgeiz der Eltern zu tun haben kann, wie zum Beispiel bei dem Pianisten Gerald Moore, dessen Eltern wünschten, er solle es einem Nachbarskind gleichtun, ja es gar übertreffen. Welch wunderbare Aufgabe für eine Lehrerpersönlichkeit, mit einem jungen Menschen gemeinsam das Zauberland der Musik mit seinen verschiedenen Regionen zu betreten und dessen Geheimnisse und Schätze nach und nach zu entdecken! Um die musikalische Entwicklung des anvertrauten Schützlings erfolgreich zu fördern, bedarf es einer pädagogisch-didaktisch fundierten und zugleich geschickten Vorgehensweise. Schon 1789 schrieb Daniel Gottlob Türk in seiner „Klavierschule“: „Das Wichtigste, wofür man anfangs zu sorgen hat, ist ein guter Lehrer. Das Vorurtheil: Die Anfangsgründe kann man bey jedem lernen, ist fast allgemein. Die Erfahrung bestätigt es, dass ein geschickter und gewissenhafter Lehrer seine Schüler in einigen Monaten weiter bringt als ein schlechter die Seinigen in einem ganzen Jahre“. Soweit also Daniel Gottlob Türk, der auf musikpädagogischem Gebiet zu den erfolgreichsten und auch fortschrittlichsten Persönlichkeiten seiner Zeit gehörte. Ein kluger Lehrer regt von Anfang an die Denkfähigkeit des Schülers an. Er erklärt dem Schüler viele Aspekte eines Stückes, das er sich aneignen soll, und sei es auch noch so klein und einfach. Er lehrt den Schüler, Form und Aufbau zu erkennen, Strukturen und Zusammenhänge, also die inneren Gesetze eines Stückes, zu erfassen – dadurch kann er den Schüler im Lauf der Zeit motivieren, sich selbst auch mal als Komponisten auszuprobieren. Er regt den Schüler an, eine Klangvorstellung zu entwickeln. Dabei wird er zwangsläufig auf andere Instrumente zu sprechen kommen und selbstverständlich auch auf die Urform des Musizierens, das Singen. So kann durchaus der Wunsch des Schülers entstehen, sich zusätzlich auf einem weiteren Gebiet der Musik zu betätigen. Ein verantwortungsvoller Lehrer wird mit beschreibenden Worten den Ausdrucks- und Nuancenreichtum der Musik darzulegen versuchen, er wird den Schüler durch Querverbindungen zu anderen Künsten wie der Dichtkunst zum Beispiel dahin führen, die Spannungsverläufe eines Werkes emotional zu erleben, den Wechsel zwischen Erregung und Ruhe, zwischen Spannung und Entspannung, zwischen Wachsen und Reduktion. Das Musizieren fordert Aufmerksamkeit und Konzentration. Es gehört das Lesen und Entziffern des Notentextes dazu – da kann man die Gedanken nicht abschweifen lassen. Das Gelesene muss umgesetzt werden: die Auge-Hand-Koordination wird geschult. Harmonische Zusammenhänge müssen erkannt werden. Bei jeder musikalischen Tätigkeit, ob Instrumentalspiel, Dirigieren, Singen, Komponieren etc. muss man auf seine Aufgabe focusiert, aber nicht eingeengt sein. Viele der oben aufgezählten Parameter gilt es gleichzeitig zu realisieren. Natürlich macht eine verlässliche, solide technische „Ausrüstung“, die sich aber niemals verselbständigen und von der Musik abkoppeln darf, das Verwirklichen einer künstlerischen Vorstellung erst möglich. So muss man Gerhard Mantel recht geben, der feststellt: „Das Lernen selbst verläuft nicht linear. Es wird bestimmt durch LernEreignisse auf allen Ebenen.“ Lern-Ereignisse geschehen auch durch Miteinandermusizieren – ein verantwortungsvoller Pädagoge mit Motivationskraft sorgt für solche regelmäßigen „Interaktionen“. Dadurch wird auch die persönliche Entwicklung der jungen Musiker nachhaltig geprägt. Das Nebeneinander verschiedener musikalischer Tätigkeiten ist nicht immer selbstverständlich gewesen. Im Mittelalter gab es ausübende Musiker und Musiktheoretiker - aber nie in einer Person. Später waren Komponisten fast immer auch ausübende Musiker. Im 18. Jahrhundert trennten sich die verschiedenen Genres voneinander; im 19. Jahrhundert spielte das Virtuosentum, das sich nur auf ausübende Künstler bezog, eine entscheidende Rolle im musikalischen Leben. Im 20. Jahrhundert schließlich war die Trennung in die Bereiche Komposition, Interpretation, Musikpädagogik und Musikwissenschaft soweit vorangeschritten, dass von vier unterschiedlichen Berufen die Rede sein kann. Fakt ist jedenfalls, dass bei einem Multitalent eine musikalische Tätigkeit die andere befruchtet. Das Denken, die Vorstellung eines Musikwerkes, sei es ein bereits geschaffenes oder ein noch zu schaffendes, wird aus verschiedenen Perspektiven möglich. In der Musikgeschichte gibt es schöne Beispiele dafür, denen wir uns nun zuwenden möchten. So hat Antonín Dvořák, der ein tüchtiger Bratscher war, die Bratschen in seinen Orchestersätzen und Kammermusikwerken weit weniger stiefmütterlich behandelt als andere Komponisten. Als eine absolute Ausnahmeerscheinung fällt Hector Berlioz auf, der zwar als Chorist tätig war, aber kein Instrument spielte. Ausgerechnet er galt als der Klangfarbenspezialist, der mit seiner „Abhandlung über Instrumentation und Orchestrierung“ Maßstäbe setzte. Er hat eben nicht – wie die meisten Komponisten – vom Klavier her gedacht, einen Klaviersatz instrumentiert, sondern direkt die Klangfarbe mitkomponiert, ohne ein eigenes Lieblingsinstrument zu bevorzugen. Begabungsvielfalt als Anlass und deren konsequente Ausübung auf einheitlich hohem Niveau war und ist im Musikerberuf die bewunderte Ausnahme. Bei den Organisten-Komponisten denkt man an Johann Sebastian Bach, Anton Bruckner und CharlesMarie Widor, bei den Pianisten-Komponisten an Wolfgang Amadeus Mozart, der aber ebenso gut Violine spielte, dann an Ludwig van Beethoven, Béla Bartók, Dmitri Schostakowitsch und natürlich an die komponierenden Virtuosen Frédéric Chopin und Franz Liszt. Viele Mehrfachbegabungen beschränken sich früher oder später auf einen Bereich, wie Paul Klee, der bereits als Zehnjähriger im Berner Stadtorchester geigte, um sich später auf Malerei und Grafik festzulegen. Oder sie werden im Rückblick nachfolgender Generationen auf eine ihrer Qualitäten reduziert, nämlich auf die, welche den nachhaltigsten Einfluss auf die Weiterentwicklung des Genres hatte - so passiert bei E.T.A. Hoffmann, der nicht nur Schriftsteller, sondern auch Komponist, Zeichner und ganz nebenbei Jurist war. Doch seine „Lebens-Ansichten des Katers Murr nebst fragmentarischer Biographie des Kapellmeisters Johannes Kreisler in zufälligen Makulaturblättern“ hatten einen solch großen Einfluss auf die Literatur: auf Balzac, Dickens, Baudelaire, Poe und Kafka, dass seine braven, aber nicht innovativen Kompositionen darüber fast vergessen wurden oder aber umgekehrt – wegen der Bedeutung des Autors Ernst Theodor Amadeus Hoffmann nicht vergessen worden sind. In die Reihe der Simultan-Musiker passt auch bestens Serge Rachmaninoff. Zusätzlich zu seiner Klavierausbildung widmete er sich schon als Teenager dem Komponieren – einer Tätigkeit, die ihn später aus einer großen Lebenskrise retten sollte. Auch als Dirigent trat Rachmaninoff immer wieder auf. Übrigens war das Klavierkonzert Nr. 1 C-Dur op. 15 von Ludwig van Beethoven – wir hören es heute Vormittag - das einzige der fünf Klavierkonzerte, das Rachmaninoff öffentlich spielte. Er vergötterte dieses Werk geradezu. Über Leonard Bernstein hieß es, er sei „Der beste Komponist unter den Dirigenten, der beste Pianist unter den Komponisten…“. Unter dieser Beurteilung litt er. Schließlich bedeutet sie eine Einschränkung. Und er selbst sagte: „Alles, was ich tue – Komponieren, Dirigieren, Klavierspielen – , bedeutet den Versuch, meine Gefühle und Gedanken über Musik mit anderen Menschen zu teilen.“ In einem Konzert für junge Zuhörer erläuterte er seine Geistesverwandtschaft zu Gustav Mahler: „Manche meinen, Mahler habe besser dirigiert als komponiert. Ein Dirigent habe zu sehr die Musik anderer im Kopf, als dass er etwas Eigenständiges schreiben könne. Ich bin da ganz anderer Meinung. Mahlers Musik ist fantastisch und durchaus eigenständig. Natürlich ist es nicht leicht, gleichzeitig Dirigent und Komponist zu sein. Ich sollte es wissen, denn ich habe das gleiche Problem, und das ist einer der Gründe dafür, warum ich Mahler mag. Es ist so, als seien zwei Menschen in einem einzigen Körper gefangen. Der eine ist Dirigent und der andere Komponist. Und beide sind eine Person namens Mahler oder Bernstein. Man fühlt sich wie ein Doppelmensch.“ Zitat Ende. Weil sich nicht jeder als Doppelmensch wohl fühlt, satteln viele Musiker im Laufe ihrer Karriere um: Bruckner war lange Zeit ein gefeierter Organist, bevor er erst mit Ende 30 ernsthaft zu komponieren begann. Matthias Rexroth, um in der Gegenwart anzukommen, hat Oboe studiert, bevor er als Countertenor zum Star avancierte. Als Hornist begann Klaus Florian Vogt, der jetzt vor allem als Lohengrin ein umjubelter Heldentenor ist. Manche fahren zunächst zweigleisig, wie Julia Fischer, die zwar fast ausschließlich als Geigerin konzertiert, aber ebenfalls ausgebildete Pianistin ist - und davon mit Sicherheit auch als Geigerin profitiert, weil sie von Anfang an das harmonische Verständnis und die orchestrale Klangvorstellung mitbringt. Zudem gibt es einige Sänger und Instrumentalisten, welche dirigieren. Manche sind darunter, die umschwenken, weil die Geschmeidigkeit ihrer Stimme nachlässt oder ihre technischen Fertigkeiten auf dem Instrument nachlassen. Böse Zungen sagen auch, sie seien schlicht zu faul zu üben. Es gibt allerdings auch solche, die sich einen Spaß aus dem Dirigieren machen, wie der Jazzvokalist Bobby McFerrin. Er wurde von einem Kritiker als „der einarmige Bandit unter den Dirigenten“ bezeichnet, nachdem er - mit dem linken Arm auf dem Rücken und dem Dirigentenstab neckisch in die Rastalocken gesteckt – Felix Mendelssohn Bartholdys „Italienische Sinfonie“ dem Münchner Rundfunkorchester überlassen hatte, um gelegentlich auf deren Aktionen zu reagieren – statt zu dirigieren. Dennoch wird im renommiertesten deutschsprachigen Musiklexikon: „Die Musik in Geschichte und Gegenwart“, kurz MGG, Bobby McFerrin als Jazzsänger und Dirigent bezeichnet. Weit mehr verdient hat den „Doppelstatus“ Trevor Pinnock, der zwölf Jahre nach seinem Debüt als Cembalist seine Aktivitäten mehr und mehr auf das Dirigieren verlagerte, sich allerdings auf das Repertoire bis einschließlich der Wiener Klassik beschränkt. In die Cembalist-plus-Dirigent-Schublade gehören auch Ton Koopman und Gustav Leonhardt. Die Liste der dirigierenden Pianisten ist weit länger. Alphabetisch angefangen bei Vladimir Ashkenazy, gefolgt von Daniel Barenboim, welcher der Tradition des 19. Jahrhunderts folgend einer der wenigen vom Konzertflügel aus dirigierenden Pianisten ist, in einer Doppelrolle, in der wir heute auch Frank Düpree erleben. Barenboim lebt den Spagat zwischen Dirigieren und Klavierspielen und ist ungeheuer produktiv. Bei seinen Klavierinterpretationen wird seine orchestrale Klangvorstellung deutlich – er sieht, hört und gestaltet Klavierwerke mit „Orchesterfarben“. Kritisch äußerte sich mir gegenüber sein Schwiegervater Dmitri Baschkirov, selbst ein renommierter Konzertpianist, über das Verhältnis von Quantität zu Qualität: „Daniel sollte weniger Stücke und diese intensiver vorbereiten, er spielt zu viele.“ Wenn man dann alphabethisch fortfährt, kommt man zu Christoph Eschenbach bis Christian Zacharias. Wie steht es um die Multi-Instrumentalisten und zwar jene, die nicht nur zwei oder mehr Instrumente beherrschen, sondern sich auch auf die Konzertbühne wagen? Bis auf die bereits erwähnte Julia Fischer wäre da noch Kolja Lessing zu nennen, der überdies ein ausgefallenes Repertoire pflegt: von Georg Philipp Telemanns Violinfantasien bis zum Klavierwerk von Wladimir Vogel. Im Jazz gibt es die Mehrfachinstrumentalisten öfter, meist mit nahe liegenden Kombinationen wie Klarinette und Saxophon oder Trompete und Flügelhorn. Klavier und Schlagzeug – wie Frank Düpree das praktiziert - ist aber auch im Jazz eine seltene Verbindung. Gerade mal zwei der ganz Bekannten sind es, die zunächst klassisches Klavier studierten und später als Schlagzeuger in Jazzbands spielten: Jack DeJohnette und Art Blakey. Kenny Clarke begann im Kindesalter mit Klavier und Orgelspiel, um dann ebenfalls Jazz-Schlagzeuger zu werden. Ihm wird ein bedenkenswerter Satz über Dirigenten nachgesagt: „Die meisten Dirigenten werden uralt, weil ihre Tätigkeit eine sehr gesunde Mischung von regelmäßiger Gymnastik mit uneingeschränkter Autorität ist.“ Ob das stimmt? Die „uneingeschränkte Autorität“, die darf man getrost bezweifeln. „Doppelmensch Bernstein“, der ja als Komponist, Dirigent und Pianist eigentlich ein Tripelmensch war, sah sich vor einem Konzert der New Yorker Philharmoniker zu einer Ansprache genötigt: „Keine Angst, Mister Gould ist hier. Er wird gleich auftreten…. Sie werden eine, man könnte sagen, einigermaßen unorthodoxe Aufführung von Brahms d-mollKonzert hören - eine Aufführung, die sich deutlich von allem unterscheidet, was ich je gehört habe oder was ich mir je auf diesem Gebiet erträumt habe, deren Tempi ungewöhnlich breit sind und die regelmäßig von Brahms´dynamischen Anweisungen abweicht. Ich kann nicht sagen, dass ich mit Mister Goulds Konzept vollkommen einverstanden bin, was die interessante Frage aufwirft: Warum dirigiere ich das überhaupt? Ich dirigiere es, weil Mister Gould ein wirklicher, ein ernsthafter Künstler ist, so dass ich alle seine Ideen, die er in bester Absicht entwickelt, ernst nehmen muss. Und sein Konzept ist so interessant, dass ich denke, Sie sollten es sich anhören.“ Einheitlich hohes Niveau bei verschiedenen musikalischen Gebieten zu erreichen und dauerhaft zu halten ist ein anstrengendes Unterfangen, meine Damen und Herren! Die Gefahr der Zerstreuung, des permanenten Springens von einer musikalischen Tätigkeit in die andere kann innerhalb der geliebten Musik zu einer Art Heimatlosigkeit führen – kann, muss aber nicht! Es kann auch der innere Wunsch, ja künstlerische Drang motivierend wirken, sich in mehreren musikalischen Genres zu beweisen. Dabei muss allerdings die „innere Qualitätskontrolle“ des Musikers jederzeit wirksam sein! Unserem Preisträger Frank Düpree, einem „Quadrupelkünstler“, wünsche ich, dass er nicht nur die „Einzelhaft am Klavier“ pflegt oder im eigenen Saft schmort, sondern sich auch mit Streitgesprächen, Überzeugungsarbeit und Charme für sein Konzept einsetzt, egal ob als Pianist, Dirigent, Komponist oder Schlagzeuger. Sollte er aber bei kritischer Bilanzierung merken, dass es besser wäre, sich auf einen Bereich zu beschränken, um dort Optimales zu leisten, zum Beispiel wenn im professionellen Leben in diesem Bereich die meisten Aufgaben auf ihn zukommen, dann sollte er sich darauf konzentrieren. Auch für ein ausschließliches musikalisches Gebiet gilt Robert Schumanns Feststellung aus den „Musikalischen Haus- und Lebensregeln“: „Es ist des Lernens kein Ende.“ Langeweile wird bei dem nachschaffenden Musiker nie aufkommen; dazu ist der im Lauf der Jahrhunderte geschaffene musikalische Kosmos zu gigantisch groß und verschiedenartig!! Und als Komponist macht man wirklich alles selbst, muss aus seiner eigenen Energie schöpfen und seinen eigenen ästhetischen Postulaten entsprechend Neues schaffen. Oder Frank Düpree betreibt das, was er im professionellen Musikerleben – und ich zweifle keine Sekunde, dass er diesen Beruf ergreifen wird – zurückstellen oder gar einstellen muss, nur zu seinem Privatvergnügen. Bisher war unser Preisträger nie in der Gefahr, das angestrebte hohe Niveau zu verlassen. Er weiß genau, dass von fröhlichem Dilettantismus auf der Konzertbühne grundsätzlich abzuraten ist. Es ist nämlich nicht so, dass der gute Ruf, den ein Musiker in einem Bereich genießt, auf andere Tätigkeiten unbedingt positiv abfärbt – sondern eher umgekehrt: Ein guter Ruf ist schnell „verspielt“. Falls es Frank Düpree gelingt, weiter auf so hohem Niveau seine verschiedenen Begabungen zu pflegen, dann gehört er zu den wenigen bewunderten Ausnahmen. Die Unterstützung durch Hans Zender im Dirigieren, Ursula Euteneuer-Rohrer in der Komposition, Manfred Rohrer im Schlagzeug und durch mich im Klavier ist ihm sicher. Auf jeden Fall wünsche ich ihm, dass er weiterhin das Podium und das Studier- und Übezimmer als sein Zuhause betrachtet. Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, danke ich fürs Zuhören! Sontraud Speidel 21. September 2008, 11 Uhr, Lustgartenhalle Karlsruhe-Hohenwettersbach Anlässlich der Verleihung des Musikförderförderpreises 2008 des Kulturfonds Baden e.V. an FRANK DÜPREE ***************************************************** .