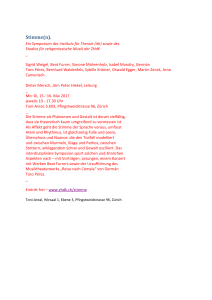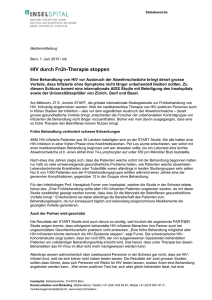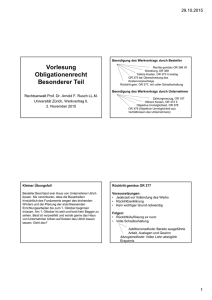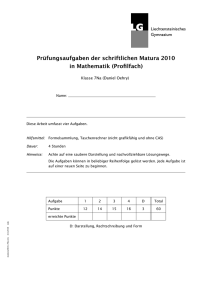Wolfgang Hofer Beat Furrer – Skizzen zu einem Porträt
Werbung
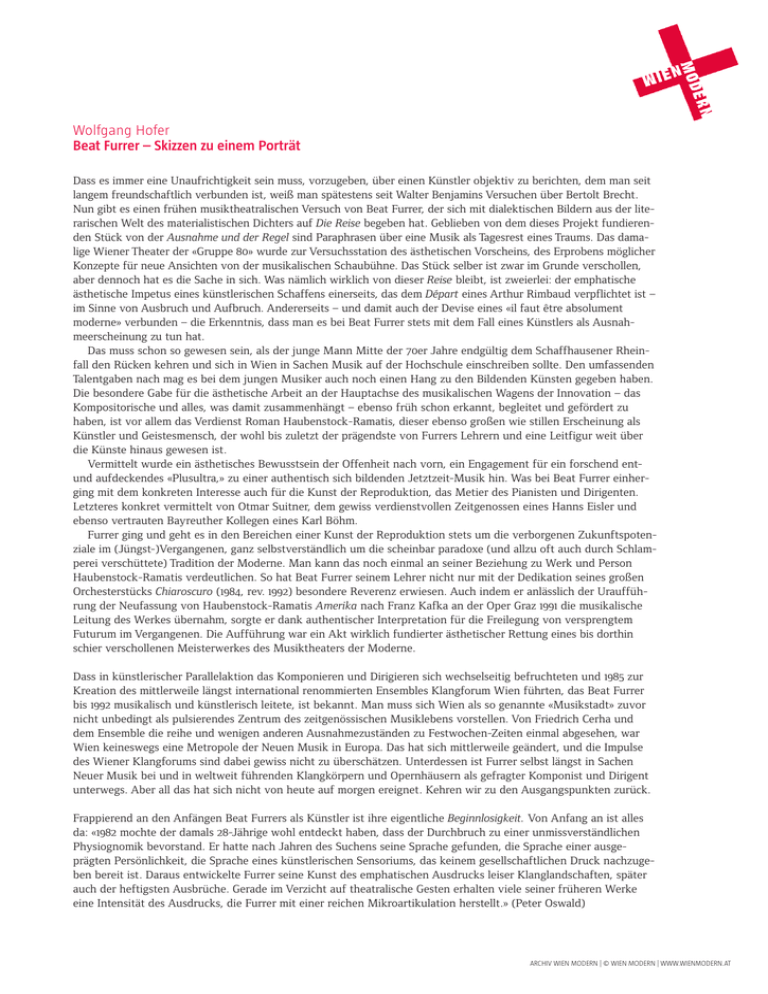
Wolfgang Hofer Beat Furrer – Skizzen zu einem Porträt Dass es immer eine Unaufrichtigkeit sein muss, vorzugeben, über einen Künstler objektiv zu berichten, dem man seit langem freundschaftlich verbunden ist, weiß man spätestens seit Walter Benjamins Versuchen über Bertolt Brecht. Nun gibt es einen frühen musiktheatralischen Versuch von Beat Furrer, der sich mit dialektischen Bildern aus der literarischen Welt des materialistischen Dichters auf Die Reise begeben hat. Geblieben von dem dieses Projekt fundierenden Stück von der Ausnahme und der Regel sind Paraphrasen über eine Musik als Tagesrest eines Traums. Das damalige Wiener Theater der «Gruppe 80» wurde zur Versuchsstation des ästhetischen Vorscheins, des Erprobens möglicher Konzepte für neue Ansichten von der musikalischen Schaubühne. Das Stück selber ist zwar im Grunde verschollen, aber dennoch hat es die Sache in sich. Was nämlich wirklich von dieser Reise bleibt, ist zweierlei: der emphatische ästhetische Impetus eines künstlerischen Schaffens einerseits, das dem Départ eines Arthur Rimbaud verpflichtet ist – im Sinne von Ausbruch und Aufbruch. Andererseits – und damit auch der Devise eines «il faut être absolument moderne» verbunden – die Erkenntnis, dass man es bei Beat Furrer stets mit dem Fall eines Künstlers als Ausnahmeerscheinung zu tun hat. Das muss schon so gewesen sein, als der junge Mann Mitte der 70er Jahre endgültig dem Schaffhausener Rheinfall den Rücken kehren und sich in Wien in Sachen Musik auf der Hochschule einschreiben sollte. Den umfassenden Talentgaben nach mag es bei dem jungen Musiker auch noch einen Hang zu den Bildenden Künsten gegeben haben. Die besondere Gabe für die ästhetische Arbeit an der Hauptachse des musikalischen Wagens der Innovation – das Kompositorische und alles, was damit zusammenhängt – ebenso früh schon erkannt, begleitet und gefördert zu haben, ist vor allem das Verdienst Roman Haubenstock-Ramatis, dieser ebenso großen wie stillen Er­scheinung als Künstler und Geistesmensch, der wohl bis zuletzt der prägendste von Furrers Lehrern und eine Leitfigur weit über die Künste hinaus gewesen ist. Vermittelt wurde ein ästhetisches Bewusstsein der Offenheit nach vorn, ein Engagement für ein forschend entund aufdeckendes «Plusultra,» zu einer authentisch sich bildenden Jetztzeit-Musik hin. Was bei Beat Furrer einherging mit dem konkreten Interesse auch für die Kunst der Reproduktion, das Metier des Pianisten und Dirigenten. Letzteres konkret vermittelt von Otmar Suitner, dem gewiss verdienstvollen Zeitgenossen eines Hanns Eisler und ebenso vertrauten Bayreuther Kollegen eines Karl Böhm. Furrer ging und geht es in den Bereichen einer Kunst der Reproduktion stets um die verborgenen Zukunftspotenziale im (Jüngst-)Vergangenen, ganz selbstverständlich um die scheinbar paradoxe (und allzu oft auch durch Schlamperei verschüttete) Tradition der Moderne. Man kann das noch einmal an seiner Be­ziehung zu Werk und Person Haubenstock-Ramatis ver­deutlichen. So hat Beat Furrer seinem Lehrer nicht nur mit der Dedikation seines großen Orchesterstücks Chiaroscuro (1984, rev. 1992) besondere Reverenz erwiesen. Auch indem er anlässlich der Uraufführung der Neufassung von Haubenstock-Ramatis Amerika nach Franz Kafka an der Oper Graz 1991 die musikalische Leitung des Werkes übernahm, sorgte er dank authentischer Interpretation für die Freilegung von versprengtem Futurum im Vergangenen. Die Aufführung war ein Akt wirklich fundierter ästhetischer Rettung eines bis dorthin schier verschollenen Meisterwerkes des Musiktheaters der Moderne. Dass in künstlerischer Parallelaktion das Komponieren und Dirigieren sich wechselseitig befruchteten und 1985 zur Kreation des mittlerweile längst international renommierten Ensembles Klangforum Wien führten, das Beat Furrer bis 1992 musikalisch und künstlerisch leitete, ist bekannt. Man muss sich Wien als so genannte «Musikstadt» zuvor nicht unbedingt als pulsierendes Zentrum des zeitgenössischen Musiklebens vorstellen. Von Friedrich Cerha und dem Ensemble die reihe und wenigen anderen Ausnahmezuständen zu Festwochen-Zeiten einmal abgesehen, war Wien keineswegs eine Metropole der Neuen Musik in Europa. Das hat sich mittlerweile geändert, und die Impulse des Wiener Klangforums sind dabei gewiss nicht zu überschätzen. Unterdessen ist Furrer selbst längst in Sachen Neuer Musik bei und in weltweit führenden Klangkörpern und Opernhäusern als gefragter Komponist und Dirigent unterwegs. Aber all das hat sich nicht von heute auf morgen ereignet. Kehren wir zu den Ausgangspunkten zurück. Frappierend an den Anfängen Beat Furrers als Künstler ist ihre eigentliche Beginnlosigkeit. Von Anfang an ist alles da: «1982 mochte der damals 28-Jährige wohl entdeckt haben, dass der Durchbruch zu einer unmissverständlichen Physiognomik bevorstand. Er hatte nach Jahren des Suchens seine Sprache gefunden, die Sprache einer ausgeprägten Persönlichkeit, die Sprache eines künstlerischen Sensoriums, das keinem gesellschaftlichen Druck nachzugeben bereit ist. Daraus entwickelte Furrer seine Kunst des emphatischen Ausdrucks leiser Klanglandschaften, später auch der heftigsten Ausbrüche. Gerade im Verzicht auf theatralische Gesten erhalten viele seiner früheren Werke eine Intensität des Ausdrucks, die Furrer mit einer reichen Mikroartikulation herstellt.» (Peter Oswald) ARCHIV WIEN MODERN | © WIEN MODERN | WWW.WIENMODERN.AT In der Stille des Hauses wohnt ein Ton – der Titel eines auf die Poetik Friederike Mayröckers anspielenden Ensemblestücks verweist ebenso programmatisch wie leitmotivisch in Furrers frühe Klangwelten. Radikale Versenkung in die Kunst der Nuance und subtile Auslotung noch der kleinsten Details formieren sich zu imaginären Mittelpunkten von stets sich erweiternden Klanghorizonten. Es geht um Entgrenzungen, um die Freisetzung und Sprengung etablierter Formwelten. Das kleine kompositorische Organon dafür konstituiert sich in mobileartigen Modulen, die als zunächst «unabhängige Stimmen» im Rahmen eines konstruktiven Gesamtplans dann den Grundrissen einer größeren musikalischen Ökonomie einverleibt werden. So ist die musikalische Architektonik der frühen Stücke stets geprägt von der Artikulation neuer formaler Lösungen bei gleichzeitig strengster Fokussierung auf ein bestimmtes, in sich reduziertes Ausgangsmaterial. Aus einem Minimum an Materialsubstanz soll ein maximaler Reichtum an formalen Strategien und Lösungen destilliert werden. Das gilt für das frühe Bläsertrio ebenso wie für das erste Streichquartett. Auch für das Klavierstück Voicelessness mit seiner Idee des zeilenartigen Formaufbaus bei permanenter Verschiebung und Transformation in der Wiederholung; und schließlich die extensiveren Werke Poemas oder Illuminations, womit Furrer gleichsam mit dem Bateau ivre Rimbauds und den Ultimi Cori (nach Ungaretti) unterwegs ist und ästhetischen Kurs hält – auf Die Blinden zu: das erste umfassende Stück für Musik und Szene. Maurice Maeterlincks merkwürdiges, fast lyrisch in sich gekehrtes «drame statique» wird radikalisiert und dem Gestenrepertoire eines musikdramatischen Endspiels angenähert. Furrers Blinden-Variationen protokollieren dabei eine situative Zuständlichkeit, worin jegliches noch mögliches Mouvement zu erstarren droht. Der Erdenrest, der bleiben mag, atmet Luft von Becketts Erwartungslosigkeit. En passant eine kleine Szene aus En attendant … – Pozzo: Eines Tages wurde ich wach und war blind wie das Schicksal. Ich frage mich manchmal, ob ich nicht noch schlafe. / Estragon: Wann war das? / Pozzo: Ich weiß nicht. / Wladimir: Doch nicht früher als gestern? / Pozzo: Fragen Sie mich nicht! Die Blinden haben keinen Zeitsinn. Die Zeichen der Zeit sehen sie auch nicht – Nichts mehr wird kommen. Auch kein Godot. Nur der glücklose Engel der Verzweiflung hat noch seinen Auftritt mit einem finalen Eclat aus dem Gegenlicht der Blendung von Rimbauds Nuit d’enfer. Indem er in der Schlussszene der Blinden zu seinem nächtlichen Flug anhebt, wird der ultimative Aufstand geprobt, freilich in einem Himmel als Abgrund von morgen. Dort ist das Meer – Nachts steig ich hinab … Das Stück selber ist vom Umriss und seinen äußeren Konturen her rasch erzählt: Mit einer Beschwörung des Lichts hebt die Szenerie um die Blindenwelt an, als erlebten die Schattenwesen aus Platons Höhlengleichnis den «Aufschwung der Seele in die Gegend der Erkenntnis». Die ist freilich den Blinden nicht wirklich gegeben. Führungslos ausgesetzt, sucht ein Häuflein Verlorener im Niemandsland ihrer Inselregion nach Orientierung. Bildlos/weglos befinden sie sich im Zustand der Erwartung ihres Endes. Irgendetwas geht seinen Gang. Aber kaum etwas ereignet sich. Dass es so weitergeht, führt in die eigentliche Katastrophe. Dennoch gibt es in diesem Dunkel der ungelebten Augenblicke noch Horizonte von Hoffnung. Auf der Suche nach dem verlorenen Dasein ziehen zwei Gesangslinien mit Hölderlins blinden Sängern aus Patmos ihre Spuren gegen die «unendliche Nacht. – Rings um die Erde tönt’s. Wo endest du?» – Das Ende werden die Blinden nicht gut bestehen. Auftritt Rimbauds Racheengel aus der Fremde, dieser Meister der Phantasmagorien, dem in der alles endenden Höllennacht jedes zu Schemen und Schatten wird. Die Trugbilder, die er wahrnimmt, sind nicht mehr von dieser Welt. Ob noch Lieder zu singen sein werden, jenseits der Menschen? Oder ist uns – wäre weiter zu fragen – gerade ob der Hoffnungslosigkeit dieser Protagonisten so etwas wie Hoffnung gegeben? Dann gäbe es auch – mit Ernst Bloch zu sprechen – ein Glück der Blinden: «Als ein gestaltetes Sehnen und Treiben an sich, als ein Lied, das einsam hinzieht oder sich mit anderen verschlingt und immer unsichtbare menschliche Züge darstellt. Glück der Blinden geht damit an, unter wie über den Dingen, die vorhanden sind. Der Ton spricht zugleich aus, was im Menschen selber noch stumm ist.» Vielleicht gehören die späten Verse der Ingeborg Bachmann hierher, worin enigmatische Engelsstimmen verkünden: «Du sollst ja nicht weinen / sagt eine Musik // Sonst / sagt / niemand / etwas.» Das wäre Musik als Einspruch (gemeint in Enigma ist übrigens der Kinder-Glockenchor vom gütigen Gott aus Gustav Mahlers Dritter Symphonie). Noch in der höllischsten Nacht wären Mutmaßungen über die Möglichkeiten eines anderen Zustands denkbar. Samt musikalischer Skulpturen, ja einer Klangkuppel des Trostes gegenüber dem Trauerspiel in blinder, ewiger Nacht. Was Furrers Musik diesbezüglich zum Ausdruck bringt, in ihrem differenzierten und vielgestaltigen Geflecht auch «sagt», hat der Komponist selber einmal so formuliert: «Vielleicht kann man schon singen, was man noch nicht sagen kann. Die Textebenen der Blinden scheinen zunächst nichts miteinander zu tun zu haben. Wie fremde, sich durchdringende Räume. Es gibt keinerlei gegenseitige Erklärungsmodelle. Platon klärt weder Hölderlin noch Maeterlinck noch vice versa. Aber es gibt bestimmte Schnittpunkte. Wenn die junge Blinde die Vision einer Welt beschwört, in der sie noch zu sehen vermochte, berührt sich das mit einer Hölderlin’schen Emphase, worin beinahe etwas Utopisches aufleuchtet. Das wäre so ein Berührungspunkt in der dritten Szene. Und demgemäß gibt es mehrere Vernetzungen. Zum Beispiel auch in der letzten Szene: Jetzt sind wir nicht mehr in dieser Welt. Während die Blinden auf ihr Ende wartend verharren, ist der Rimbaud-Auftritt quasi eine Erinnerung an die Kindheit. Die Texte und Ebenen verschränken sich wie eine falsche Übersetzung. Die Geräusche der Meereswellen und der Schritte, die sich den Blinden vermeintlich nähern, verwandeln sich musikalisch in das Ticken einer Uhr, die die Erscheinung der Höllennacht begleitet. Und das Delirium im Satanischen markiert einen Punkt, wo alles endgültig zerbricht.» Dennoch sollen sie sichtbar bleiben, die Horizonte der ­Hoffnung an den Rändern der gestundeten Zeit. Noch einmal Beat Furrer: «Eine meiner Lieblingsstellen ereignet sich in der sechsten Szene, wo die Blinden das Mondlicht auf ihrer Haut spüren und die Sterne über sich hören. Die musikalischen Gestalten in diesem Bild werden aufgefächert in einem dichten Geflecht von Flageolett-Klängen, über denen ein hohes E ­exponiert bleibt. Das hat eine Magie, als ob für einen Moment ein anderes Licht aufgeht. Hier artikuliert sich das Gefühl eines Raums in seiner Veränderung. Die Flageoletts sind zwar nicht die Sterne, aber Musik wird zum Moment einer Erfüllung einer dramatischen Situation, wo das Wort zum Klang werden muss.» So ist Beat Furrer mit Maeterlincks Theatralik des «L’Inconnu» ausgezogen, eine musikalische Schaubühne zu entdecken, deren Ereignisformen über die Grenzen des Sagbaren hinausführen. Dergestalt kann auf authentische Weise etwas geschehen wie die Neugeburt dramatischer Szenarien aus dem Geist der Neuen Musik. Gebündelt und fokussiert erscheint im Ganzen eines Musiktheaters aufgehoben, was sich an Latenz und Tendenz in den einzelnen Werken auf dem Weg dorthin sedimentiert hat. Das alles hat sich gegen Ende der 1980er Jahre ereignet. Im Laufe der letzten Dekade des vorigen Jahrtausends haben sich diese Prozesse in der Entwicklung des Gesamtwerks weiter präzisiert und verdichtet. Das zweite große Werk für Musik und Theater ist Narcissus. Uraufführung 1994 beim steirischen herbst in Graz. Das streng konturierte Stück schillert zwischen dem unvermittelt monodramatischen Geschehen um den Protagonisten und den kollektiv erklingenden Kommentaren des Chores in harter, schroffer Fügung. Es ist, als wäre dieses Stück einer verfehlten Selbstbegegnung in kohlschwarze Hieroglyphen des undurchdringlichen Dunkels nicht gelebter Augenblicke gemeißelt. Quasi so, als würden die Zeitmaße einer negativen Dialektik um Narcissus echolos auspendeln. Nun sind die Wege der Kunst nicht eben immer ganz logisch und einfach so gerade ausgerichtet. Viel eher führt eine labyrinthisch verschlungene Bahn der einzelnen Werke zum nicht immer sogleich absehbaren Ziel. Und insgesamt gehorcht das musikalische Œuvre Beat Furrers der Logik eines besonderen Produziertseins. Man kann es – cum grano salis – folgendermaßen formulieren: Die Fragestellungen der früheren Werke geleiten späterhin zu immer präziser werdenden Prägungen der kompositorischen Problemfelder. Die einzelnen Werke sind konstruktive Versuchsanordnungen, die fortschreitende Werkgenealogie liest sich wie eine Bildergalerie in verschiedenen Klangbeschreibungen. Still, Spur, Studie, Übermalung, Quartett, Stimmen – all diese Stücke sind chiffrierte Vermessungen im Hinblick auf die Verfertigung einer genaueren akustischen Kartographie des Ocean Incognito der Neuen Musik. Schon für Franz Marc war das innovative Potenzial der Kunst als Imago des Exodus (und umgekehrt – worauf Ernst Bloch immer wieder, utopisch verschworen, gerne hinwies), also die Malerei nichts anderes als ein «Auftauchen an einem anderen Ort». Konsequenterweise bleibt Beat Furrer immer weiter auf der Suche nach neuen, offenen Formen einer kommenden Musik. So ist sein Schaffen stets als umfassende Recherche in aestheticis angelegt und nicht nur als Arbeit an den einzelnen Werken zu verstehen. Sondern – durch diese hindurch – als ästhetische Arbeit an der Musik insgesamt. Die Utopie der Kunst überflügelt dabei die Werke. Und Arnold Schönbergs Devise vom einzelnen Werk als «Bruchstück wie alles» wird umfunktioniert in «für alles». Die einzelnen Werke sind wie kunstvoll behauene Felsbrocken, herausgeschlagen aus dem großen Steinbruch eines rätselhaften Felsgebirges. Diese wiederum werden dergestalt umgeformt, dass das Ganze schließlich ein Surplus annehmen wird und also mehr ist als das Ensemble oder die Summe seiner Teile. Von da her vielleicht mag auch Furrers ausgeprägter Hang zum Musiktheater herkommen. Ist dieses doch auch heute noch und besonders bei Furrer eine extrem artifiziell erweiterte Form dessen, was seit Richard Wagner Gesamtkunstwerk heißt. Für den alten Meister und immer noch abgründigen Mythenschmied war die Musik definierbar als «Kunst des Übergangs». Theodor W. Adorno hat seinen Lehrer Alban Berg einen «Meister des kleinsten Übergangs» genannt. Demgemäß wäre Beat Furrer mit seiner Klangwelt der Gesten eines fein ausdifferenzierten Raffinements in der Reduktion, der – oft fast bis zum Zerreißen – hoch gespannten Fragilität der Konstruktion, der subkutan angelagerten Energetik der Ex­pression samt Potenzialen zur Sprengkraft mit Zeitzündung folgerichtig der musikalische Meister der minimalsten Übergänge, ohne im Geringsten mit Minimal Music irgendetwas gemein zu haben. Ohnedies kommt man Furrers Ästhetik mit herkömmlichen Kategorien und Etikettierungen nicht wirklich bei. Es gilt, Augenmerk und Hörsinn auf das Besondere zu konzentrieren, das wiederum von Fall zu Fall ein klein wenig und doch ganz anders zugleich sein kann. So wäre denn Studie II einfach als harmonisch transformierte Klangbeschreibung im Sinne einer Übermalung von Studie zu verstehen, während Stimmen den perkussiven Klangsatz von Quartett komplett in eine andere Klanglichkeit verwandeln, ins Vokale projizieren und also vollkommen aufheben im Doppelsinn des Wortes. Authentische Neue Musik ist ein Linienziehen im Unsichtbaren. Und man liegt nicht falsch, wenn man etwa im kleinen Instrumental-Ensemble von Gaspra (1989) – musikalisches Emblem eines in den Gravitationsfeldern unseres Sonnensystems versprengt her­umirrenden Asteroiden – plötzlich wieder Schönberg/Georges «Luft von anderem Planeten» spürt. Wollte man schließlich authentische Jetztzeit-Musik als Evokation des Unabgegoltenen im Neuen definieren, so wäre auf ein Schlüsselwerk in Beat Furrers kompositorischer Entwicklung zu rekurrieren, dass im Verlaufsprozess des gesamten Œuvres eine entscheidende Zäsur markiert – Nu’un (nuun) für zwei Klaviere und Orchester aus dem Jahr 1996. Hier ist definitiv alles – vollkommen beginnlos (imaginär auch endlos?) da. Oder, wie Furrer es lapidar formuliert: «Kein Anfang, alles von Anfang an anwesend.» Will sagen, alle musikalischen Schichten und Parameter sind potenziell oder latent präsent, während sich im Formverlauf des Stückes einzelne Aspekte aus der Hintergrund-Perspektive in den Vordergrund direkter musiksprachlicher Artikulation verschieben. Manchmal scheint es fast, als würden sich die Pianos in den reißenden musikalischen Strom hineinvexieren, um alsbald wieder daraus aufrauschend emporgeschleudert zu werden. Die Tiefendimensionen des Raumes beginnen gewissermaßen zu mäandern, ja der musikalische Raum wird selber entzeitlicht, als würde die vergehende Zeit still gestellt – ganz im Sinne der Gottheit Nu aus der bretonischen Mythologie, die es vermochte, Zeit insgesamt aufzuheben. Jene Stoffe, aus denen die alten Mythen gewoben wurden, werden dergestalt selber entzeitlicht, musikalisch säkularisiert und mit ästhetischen Tigersprüngen aus dem Vergangenen wirksam in die Jetztzeit versetzt. Genauso ist die Kunst im­stande, Augenblicke aufzuheben. Und gedehnte Momente im Wortsinn sind jene Stücke, die im Vorfeld die Genese des großen Musiktheaters Begehren (anlässlich der Eröffnung von Graz, Kulturhauptstadt Europas 2003 szenisch uraufgeführt) flankieren: Aria und Orpheus books. Beide Stücke sind episierende musikalische Blöcke, jeweils Erzählungen in statu nascendi oder morendi konstituierend. Doch während sich Orpheus books mit chorischen Stimmen zum großen Orchestersatz hin entfalten, zieht sich Aria – als exponierter Sologesang, zuletzt nur noch von Kantilenen einsamer Flötentöne (Klarinette – sic?) begleitet, an die Ränder des Verstummens zurück. Als «Stückwerk wie alles» sind sie die Ecksätze, die markanten Prägesiegel am Eingang und Ausgang des Werks. Begehren: Zwei Figuren, ein Mann und eine Frau. Namenlose Protagonisten. Kein Paar, vielmehr Passanten in einer Passagenwelt der Gegenwart, an deren Horizonten mythische Bilder aus der Geschichte von Orpheus und Eurydike durchschimmern. Der Hadesgang. Der verbotene Blick. Die falsche Bewegung. Zwei Figuren also: getrennt/vereint auf der Suche nach ihrer (gemeinsam?) verlorenen Zeit, Geschichte und Erfahrung. Zwei Versuche, hinter das Dasein zu blicken. Zwei Versuche, mittels Erinnerung und Wiederholung verschollene Utopien im Licht des Begehrens neu zu entdecken. Eine Hoffnung, die bis zuletzt unerfüllt bleibt. Vergebliche Parallelaktionen im Schatten der Einsamkeit. (Selbst-)Be­gegnungen finden nicht statt. Was bleibt, ist das Dunkel der (un-)gelebten Augenblicke. Und die Gestalt der Frage: Gibt es ein Heraus, aus diesem einsamen Weg? Durch das Begehren? Das wäre im Grunde die ganze Geschichte, gäbe es da nicht jenen Eingriff, wonach es dem mythischen Sänger einer weißen Magie hier verwehrt ist, sich im Medium des Gesangs auszudrücken. Gegen Ende erst, wenn er dem Geschehen schier abhanden kommt, versucht er zu singen, was er nicht sagen konnte. Wortlos freilich, ohne semantischen Ausdruck. Sein melismatischer Zwischenruf ins Entbehrte wird umhüllt und verschleiert von Frau/Stimme, die resümiert: «nie erreichbar / was ersehnt / nicht hier / nirgendwo / deine Einsamkeit / verdoppelt die meine.» Indem der Mann zuletzt zur Randfigur des Geschehens wird, bleibt nur die Einsicht, die ihm schon am Eingang des Stücks dämmerte: «was war / was gewesen ist / wieder / Leere / durchquert / Es sei zu Ende.» Am Ende wird er von der Gravitationskraft des Begehrens, worin er zunächst so dominierte, in den Hintergrund gerückt, im Vordergrund allein die Frau mit ihrer Schluss-«Aria» ins Offene. Sie, die zunächst nur wie von fern mit einem Frageruf aus dem Entbehrten in das Geschehen eintritt – «O-r-phe-us / Hörst du?» – könnte zuletzt mit seinen Worten ihrer beider Schicksal umschreiben: »Ich suchte …» So ist dieses Parabelspiel um die Dialektik der Einsamkeit auch ein doppeltes Monodram, angesiedelt in einem Niemandsland der Ortlosigkeit. Und vielleicht ist um der scheinbaren Hoffnungslosigkeit der beiden Figuren uns hier dennoch und abermals Hoffnung gegeben. Aufgehoben in dem vielgestaltigen Kollektiv des Chores, der dem Beziehungsnetzwerk der beiden Protagonisten einverwoben ist, wie ein Geflecht aus inneren Stimmen. Zum Ausdruck kommt darin das potenziell Mögliche hinter dem Realen. Und – dass etwas bleiben wird: nach all dem Geschehen und den Ereignissen in diesem Raum- und Zeitvorbei des Begehrens. Nämlich: das Begehren. So viel zuvor zu einem Musiktheater authentischer Moderne, von dem man zu Recht sagen kann, dass es Epoche gemacht hat. Die Oper als Kunstform wird hier radikal neu besichtigt und dabei in vollkommen neue Angeln gehoben. Das Stück ist insgesamt ein hoch reflektierter Mythenrekurs im Sinne von Revision – mehr noch: dezidiert der Versuch, den Ursprung von Oper vom Quellgrund her neu aufzudecken mit dem Ziel, die Oper als Genre und Gestalt neu zu situieren. So wird in diesem Begehren die Oper als Endspiel und als Spiel vom Ende infrage gestellt, als Gattung gänzlich modifiziert und umdefiniert zugleich. Mythentradition wird noch einmal vollkommen musikalisch und in Territorien eines epischen Musiktheaters überführt. Das eigentliche Drama ereignet sich nach dem großen Erschrecken – a terrendo werden sie wieder aufgeblättert und entfaltet: Orpheus books. In den dramatischen «dialogues intérieurs» dieses Begehrens werden epische Zonen imaginärer Zwischenräume erschlossen. Die musikalische Schaubühne wird zum offenen Reflexionsraum. Die Umfunktionierung der alten Mythen und Zeichen entspringt den Strukturen und Gesten einer umfassend-umdeutenden Klangbeschreibung, vergleichbar vielleicht einem Prozess der Verwandlung, wie ihn Botho Strauß einmal im Partikular einem alten keltischen Epos abgelauscht hat: «Ich sehe jedes Mal genauer hin und seh sie jetzt / von ihrem Ausgangspunkt – / Eurydike schaut selbst zurück im Augenblick, / da Orpheus sich (wie immer) nach ihr wendet, / und unter halb gehobenem Schleier prüft sie / den zurückgelegten Weg. / Blickt also sie zugleich mit ihm zurück, / obschon ins Leere, so dass sein Rückblick nie ihr Antlitz / traf, vielleicht dann … Man muss die Anordnung / leicht variieren und leicht variiert den ganzen Vorgang / unermüdlich wiederholen, bis er schließlich gelingt / der Aufstieg, man ist auf bestem Weg.» Die Anordnung leicht variieren und leicht variiert den ganzen Vorgang unermüdlich wiederholen, bis er schließlich ge­lingt, der Aufstieg – damit wird an eine Konstellation gerührt, worin sich Tradition neu erschließt. Und genau in diesem Sinne hütet Beat Furrer mit seinem Stück vom Begehren die Fährten der orphischen Spur. Mit unaufhaltsam aufsteigenden Linien des Instrumental­ensembles heben die Klangfiguren um Orpheus über die drei ersten Szenen hinweg an. Die Toten werden in ihrem seltsamen Licht verharren, gespeist aus dem Dunkel jener Gegenschräge, deren Schatten uns blendet. In diesem Licht einer negativen Utopie, einer vielfachen Blendung, setzt Furrer mit seiner Topos­forschung an, um die scheinbar verlorenen Exponenten des alten Mythengewirks in einem imaginären Heute freizusetzen. Im Jetzt. Orpheus und Eurydike werden zu Namenlosen, zu Protagonisten in einem Niemandsland unserer Gegenwart. Nur von einem anonymen Chorus als Übersetzer, Kommentator und Handlungsträger begleitet. Sie werden allesamt heimatlos bleiben. Ohne Ort, nirgends. Aus verschiedenen Perspektiven wird der gebrochene Mythos in seiner Ortlosigkeit immer wieder umkreist, gespiegelt und reflektiert. Furrers Klanghorizonte heben dabei die Augenblicke auf, bündeln somit Zeit und Geschichte. Das Drama des Begehrens wird dergestalt zu einer Art Mythenstenogramm, einer Schicksalsmusik, worin es niemandem so recht vergönnt ist, dem Bann zu entrinnen. Die Suche nach dem anderen Zustand endet in verdoppelter Einsamkeit. Sieht man genauer noch hin, so wirkt das musikalische Szenengewebe wie von fern, lontanissimo, den geheimen Rändern des Mythos abgerungen. Durch die Schleier der Zeiten hindurch scheint jedoch vieles genauer singbar werden zu müssen, was an Dunklem vielleicht vergeblich zu sagen war. So Ingeborg Bachmann: «Die Saite des Schweigens, gespannt auf die Welle von Blut / griff ich dein tönendes Herz / verwandelt ins Schattenhaar der Nacht / der Finsternis schwarze Flocken / beschneiten dein Antlitz // Und ich gehör dir nicht zu / Beide klagen wir nun.» Es ist, als hätten die Furien des Verschwindens beiderlei Geschlechts gesprochen. Dialektik der Einsamkeit. Im Dunkel der Traumtiefe gibt es keine Zwischenräume. Zufluchtsorte nur für verlorene Schlafwandler des Glücks. Das ästhetische Schild vor dieser Terra incognita ist überschrieben mit dem Emblem «Betreten verboten». Es gibt kein Zurück. Diesen Zonen dennoch fundiertes Futurum abgelistet zu haben, zählt nicht zu den geringsten Meriten einer kompositorischen Idee einer Umfunktionierung von Mythen, Zeiten und Welten, die ihrer Sprache scheinbar noch mächtig waren. Weshalb es in Furrers Begehren auch nicht ohne zweierlei Trauermusiken abgeht. Als Klage, Eingedenken und Einspruch. Die schwebend-flottierenden Figuren des Mythengestricks vermögen es nicht, sich frei zu bewegen. Hinter den allzu bekannten Wegen erst setzen sich andere Horizonte frei. So wird der Mythos zum Stoff, aus dem andere Träume werden mögen. Umfasst von einem völlig neuen Klang. Subtile Mythen-Metamorphose und raffinierteste Klang-Osmotik vereinigen sich dabei zum Orpheus-Palimpsest. Bleiben die Fragen, abermals ins Offene: Ob Einsamkeit auch teilbar, das große Versehen, der ominös – vielleicht doppelt – verkehrte Blick tilgbar wären im namenlosen Raum? Und denkbar, dass wahre Wiederholung möglich sei, wenn auch nur im Vorüberwandeln, unvermerkt und nebenbei? Es ist, als wären Furrers namenlose Gefährten des Schicksals endlos verfangen im Schuldzusammenhang des Lebendigen und im Triebleben von Klangfiguren, worin ihr Solopsismus kein Ipse mehr finden kann. Sie mögen ihrer eigenen Wege gegangen sein. Verloren sein, wie alle – vergeblich – Liebenden. Um sich in einem «unverhofften Wiedersehen» dennoch auch wieder finden zu können. Wie alle – wirklich – Liebenden? Im Zeichen vielleicht – des tieferen, wahrhaftigen Begehrens. Gäbe es einen Schleier über dieser Geschichte, würde sich zuletzt ein Vorhang darüber schließen und man sagte sich tatsächlich ganz betroffen, «Vorhang zu. Und alle Fragen offen». Allein dem ist nicht so, und dem war auch in der Ästhetik der Aufführungspraxis nicht so. Reinhild Hoffmanns subtile szenische Choreographie erstreckte sich mit den darstellenden Künstlern aus dem alten Mythengeschlecht in einen raumlosen Raum, bei der Uraufführung angesiedelt in einer rahmenlos figuralen Bilderwelt auf offener Bühne, einem skulpturalen Zentralpark der abstrakten Gefühle, entworfen von der Avantgarde-Architektin Zaha Hadid. Solche Akzentuierung der szenischen Realisierung ist umso bedeutsamer, als Beat Furrer sich in seinem Opernschaffen zunehmend (auch aus klanglichen Gründen) auf antikisierendes Quellgebiet bezieht. Insbesondere auf Ovid und dabei wiederum auf spezifische Stellen aus dem Kompendium der Metamorphosen. Naturgemäß ereignen sich solche Annäherungen durchaus im Sinne des Satzes von Karl Kraus – «Ursprung ist das Ziel». Antike wird dabei bereits im Lichte von Furrers profunder Erfahrung ins Akut unserer Gegenwart versprengt. Es findet also immer musikalische Umbeleuchtung und Umfunktionierung des Mythos statt. Aus dem tiefen Brunnen des Vergangenen tritt dabei freilich nicht nur ein ins Heute gewandeter Orpheus hervor. Der Künstler selbst kann darüber zu einem Ödipus der Moderne werden. Ganz so, wie es Adorno in der Philosophie der neuen Musik anschaulich beschrieben hat: «Die Kunstwerke versuchen sich an den Rätseln, welche die Welt aufgibt, um die Menschen zu verschlingen. Die Welt ist die Sphinx, der Künstler ihr verblendeter Ödipus und die Kunstwerke von der Art seiner weisen Antwort, welche die Sphinx in den Abgrund stürzt.» Dieses Rätselspiel vom Fragen samt der gesammelten Weisheiten der lösenden Antwort leuchtet allemal ein – auch und besonders im Hinblick auf die Herausbildung einer wirklich mündigen Musik. Allein da ist noch diese mephistophelisch verschlungene List der Vernunft mit dem klassisch abgründigen Satz. «Und löst sich manches Rätsel, so knüpft sich manches auch …» Denn im Kosmos der Kunst, diesem «rätselhaften Felsgebirge», gibt es immer wieder unerwartet Neues zu ent­decken. Und kaum hat man ein Werk zu Ende geschrieben, könnte es wieder von vorne losgehen. So ist es Beat Furrer nach dem Begehren ergangen. Unmittelbar nach dem Stück vom Begehren hat sich ein neues und anderes Kraftwerk der Gefühle vor ihm aufgetürmt wie eine unabwendbare «Anrufung»: «Ich hatte die Vorstellung, dass Invocation dort beginnt, wo Begehren aufhört», hat er anlässlich der Züricher Uraufführung dieses Musiktheaters im Juli 2003 bemerkt. Das Geschehen ist grundiert von Marguerite Duras’ Erzählung Moderato cantabile. Furrer weiter: «Invocation ist ein Überbleibsel des französischen Originals. Der Titel bezieht sich auf die siebente Szene, die eine Anrufung des Dionysos mit einem orphischen Hymnos enthält. Angesprochen sind hier Kräfte, die auch bei Duras das Nebeneinander der thematischen Schwerpunkte – Schrei, Klavierstunde, Fest – zusammenhalten. Diese Kräfte – genauer: diese erotischen Kräfte, sie haben durchwegs zwei Seiten. Einerseits sind sie Bedingung für das Leben, kreieren sie Leben, andererseits zerstören sie.» Das Begehren und der Eros. Eine Gleichung mit vielen Unbekannten. Abermals tritt in Invocation die klassische Konstellation einer insgeheim un­heimlichen Zweierbeziehung ins Zentrum des Geschehens. Die Frau und der Fremde. – Beat Furrer: Man stelle sich vor: Eine Stadt, irgendwo am Meer. Eine Frau mit ihrem kleinen Sohn bei der Klavierstunde. Mitten in den Vortrag der Diabelli-Sonatine «Moderato cantabile» gellt der Schrei einer Frau von draußen ins Zimmer – «eine lang anhaltende Klage stieg auf, so laut, dass das Brausen des Meeres daran zerschellte». Es war Mord. In dichten Bildern und knappen Sätzen wird von Marguerite Duras ein Drama aufgefächert, in dem sich der anfangs noch anonyme Mordfall auf einer anderen Ebene zu wiederholen scheint. Der Klang ist bereits Bestandteil dieser merkwürdig zeitlosen Bilder und Momente: Das Rauschen des Meeres, Diabellis Sonatine, der Schrei, der Lärm der anonymen Menschenmenge auf der Straße und in den Kneipen. Die Form der Erzählung, die Vorwegnahme des Schreis, der zugleich als Vor- wegnahme des Endes der (linearen) Geschichte erscheint, lässt diesen quasi thematisch im Raum stehen: Die Erzählzeit wird zur Perspektive eines Raumes. Die Musik soll diese sich verändernden Perspektiven (Kamera-Einstellungen) schaffen – dies entspricht meinen Vorstellungen von zeitlicher Verdichtung (Gleichzeitigkeit) linearer Verläufe (Bewegungsabläufe). Alles ist von Anfang an anwesend – Dinge (Figuren) treten hervor und wieder zurück. Während Duras­’ Erzählung das Verlangen thematisiert, ist der Fokus meines kompositorischen «Blickes» auf Frau/Stimme gerichtet, auf deren Intimität, auf den «dramatischen» Raum zwischen kultivierter «Opernstimme» und der Unmittelbarkeit der körperlichen Expression – Atem, Schrei … Der Mann aus der unheimlichen Fremde kommt in Furrers Adaptation des Duras-Stücks quasi nur am Rande vor. Das szenische Drama ist als monologischer Bewusstseinsstrom der Frau konzipiert, die sich immer mehr in eine fiktive Traumwelt imaginiert. Konsequenterweise wird die eigentliche Geschichte dieser «liaison dangereuse» im Dunkel einer Klangszene gespiegelt, die dem Werk wie eine Insel im fremden Geschehen eingelagert ist. Es ist dies wiederum eine kleine Geschichte aus Ovids Metamorphosen – und sie heißt bezeichnenderweise Fama. Noch einmal Beat Furrer: «Fama hat ein Haus gebaut an der Grenze der drei Welten, und dieses Haus ist aus Erz mit offenen Türen und offenen Fenstern. Und alles, was auf der Welt ge­sprochen, geschrien, gelogen, geflucht wird, kommt in diesem Haus zusammen und vermischt sich zu einem einzigen Klang. Für mich war das als Topos wichtig. Auch musikalisch ist das eine Art Insel; es ist ein ruhiger, irisierender, in sich bewegter Chorklang, der die Obertöne eines ganz tiefen C absucht.» Dergestalt treten denn doch auch die dissoziierten Verhältnisse der maskulinen Welt wie Schemen und Schatten – ge­wissermaßen in Sub- oder Diskontur – ins Zentrum des Ge­schehens. Mag sein, dass hier die Schönheit einer Musik nichts anderes ankündigt, «als des Schrecklichen Anfang». Am Ende ist nichts mehr geheuer und zugleich alles ungewiss. Abermals Mord oder gar Doppelmord? Ein Detektivroman auf musikalischer Bühne mit ungewissem Ausgang. Frau/Stimme artikuliert sich zuletzt aber vielleicht mit einer Paraphrase auf den ungeheuer düsteren Satz der Ingeborg Bachmann, die man einst in Rom sprechen sah und hörte: «Die Männer sind doch alle krank!» Die verdutzte Gegenfrage des Journalisten – «Wie bitte?» – parierte sie souverän mit dem Nachsatz: «Wussten Sie denn das nicht?» Sphinx-Sirene spricht. Ob das aber auch in Umkehrung gelten mag – angewandt auf das zweite Geschlecht? Welche Fragen. Es ist Zeit umzukehren. Oder man müsste die Fama noch weiter und genauer befragen. Das Welthaus hat viele Kammern. Und Beat Furrer konnte vom Faszinosum der Fama nicht loslassen. Hat sich an ihrer geheimnisvoll-unendlichen Mannigfaltigkeit kompositorisch festgesaugt. Die Idee einer Musik als geronnener Architektur wird in vielfältigen Spiegelungen und Brechungen neu reflektiert. Eine Art «Klangtheater» mit Instrumental-Ensemble und einer Schauspielerin, die eine Figur wie Fräulein Else im Zu­stand ihrer Auslöschung spielt. Diese große Klangszenenfolge hat abermals Christoph Marthaler mit seinem melancholischen Blick auf die unerträgliche Leichtigkeit unseres Das(ch)eins zur Kenntlichkeit verfremdet. Das Stück von der Fama selber spielt in einem riesigen, nach oben offenen, mit verschiedenen Klappen und Spalten versehenen Kubus. Das Publikum mitten darin. Und die Musiker draußen und drinnen in steter Bewegung. Schier magische Klangverwandlungen finden statt, es ereignet sich also eine Musik im Zwischenreich des absoluten Übergangs, der permanent schwebenden Metamorphose. Dieser nun wahrhaft «geheime Block» generiert eine Architektur aus Klang, in deren geistigen Räumen sich innere Strukturen stets weiter verzweigen. Als Kunst der Nuance, der feinst abgestuften Schattierungen. Exakte Phantasie ist – nach Walter Benjamins Wort – Interpolation im Kleinsten. Vielleicht ist es hier so, als sei ein unendliches Lichtspektrum auskomponiert. Am Ende dieser musikalischen Toposforschung im Licht des Utopischen schälen sich aus dem Rundumklang Frau/Stimme und damit konkret korrespondierende Begleitfiguren der Klarinette heraus. In einer so singulären Konstellation, wie es sie seit der von Klarinetten-Kantilenen umrankten vokalen Er­scheinung der Kundry nicht mehr gegeben haben mag – als Halluzination einer ungesungenen Schrift. Dergestalt hat Beat Furrer hier der Kunst wieder etwas wie «Heimat» geschaffen, «worin noch niemand war», die auch – wenngleich und wie immer ephemer – eine Bleibe werden könnte. Dieser Aufenthaltsort ist vielleicht auch ein Ort für Zufälle. Jedenfalls aber hat er nun einen Namen, und zwar für alle Ewigkeit. Er heißt Fama. Und die Fama sagt: «Die Augenblicke der Phantasie sind die eigentlichen Feiertage in der Geschichte.» Wolfgang Hofer: Beat Furrer – Skizzen zu einem Porträt, in: Katalog Wien Modern 2005, hrsg. von Berno Odo Polzer und Thomas Schäfer, Saarbrücken: Pfau 2005, S. 37-42.