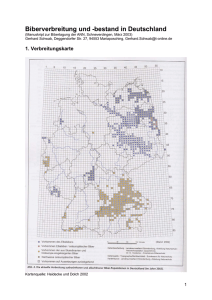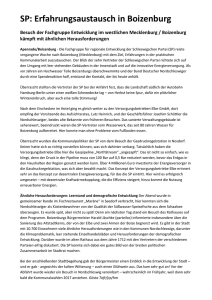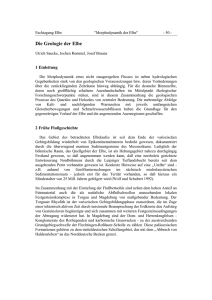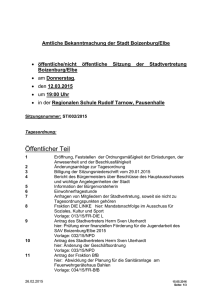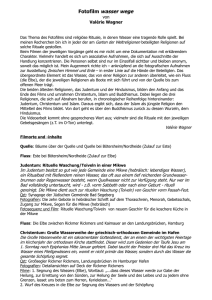Sport und Gesundheit: gesellschaftliche und ökonomische
Werbung

Sport und Gesundheit: gesellschaftliche und ökonomische Perspektiven Martin Elbe, Timo Schädler, Johann-Wilhelm Weidringer und Christian Werner Zusammenfassung In diesem Beitrag werden zentrale gesellschaftliche und ökonomische Perspektiven von Sport und Gesundheit miteinander verknüpft. Sport und Gesundheit sind komplexe und vielschichtige Prozesse, die sich wechselseitig beeinflussen. Der positive Einfluss von körperlicher Aktivität auf die Gesundheit gilt als unbestritten, dennoch zeigt sich das Bewegungsverhalten der Menschen großen Schwankungen unterworfen. Ein großer Teil der gesundheitsorientierten Sportprogramme findet in Vereinen statt, wo wichtige sozialintegrativen Einstellungen und Kompetenzen erworben werden, z. B. in der Übernahme eines Ehrenamts. Neben Modernisierungstendenzen sollten Vereine auch auf gesellschaftliche Entwicklungen der Individualisierung und Ausdifferenzierung verschiedener Lebensstile reagieren. Schlüsselwörter: Sport, Bewegung, Gesundheit, Gesundheitssystem, soziale Integration, Ehrenamt. Abstract This paper deals with the interconnection of social and economic perspectives of sport and health. Sport and health are described as complex, multilayered and interdependent processes. The positive effects of physical activity on health are common sense, however, the peoples’ activities are subject to large scale fluctuations. A great part of health-oriented sports programs take place in sport clubs, where useful attitudes and skills of social inclusion might be acquired, e. g. via voluntary work. Sport clubs have to face the pressure of modernization as well as processes of individualization and differentiation of various lifestyles. Keywords: sports, physical activity, motion, health, heath care system, social inclusion, voluntary work. Seite 6 Zeitschrift für Gesundheit und Sport Problemstellung Es ist ein alter Traum der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, eine Kennzahl zu bestimmen, die das Maß menschlicher Bedürfnisbefriedigung angibt. Wäre das gesichert möglich, dann ließe sich – je nach Denkmodell – auch das Wohlbefinden der Menschen optimieren. Bekanntermaßen ist aber die Bestimmung eines sozial-ökono­ mischen Optimums ebenso willkürlich wie die Erstellung von Glücksindizes. Das Problem hierbei ist, dass die Menschen kaum Einigkeit darüber erzielen können, welche Werte denn nun allgemein gültig zu sein haben: Materieller Wohlstand? Erfolg? Glück? Gesundheit? Gesundheit scheint unter den beispielhaft angeführten Kriterien das am einfachsten Bestimmbare zu sein: Gesundheit ist die Abwesenheit von Krankheit – so lautet stark verkürzt bekanntlich eine mögliche Definition.1 Aber auch diese negative Definition von Gesundheit hilft nicht wirklich weiter, denn nun stellt sich die Frage: Was ist krank? Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat versucht, dieses Problem dadurch zu lösen, dass sie eine positive Definition von Gesundheit vorschlug: Gesundheit ist „… ein Zustand vollkommenen körperlichen, psychischen und sozialen Wohlbefindens und nicht allein das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen.“ (Ulich & Wülser, 2005) Diese Definition von Gesundheit als Utopie war weder für die Wissenschaft noch für die Praxis eine große Hilfe. Seit gut 25 Jahren vertritt die WHO daher die Auffassung, dass Gesundheit die Fähigkeit und Motivation sei, ein wirtschaftlich und sozial aktives Leben führen zu können. Mit der Ottawa-Charta der WHO von 1986 wird die Gesundheitsvorstellung somit explizit auf Einen komplexeren Zugang zur Gesundheit stellen wir mit dem Salutogeneseansatz nach Antonovsky (1997) später vor. 1 Heft 1/2011 den wirtschaftlichen und sozialen Kontext bezogen (Ulich & Wülser, 2005). Mittlerweile werden in Gremien der WHO zur umstrittenen Fortschreibung der Gesundheitsdefinition auch Aspekte zur Ausformulierung zeitgenössischer wie perspektivisch gültiger Dimensionen von u. a. Ethik und Migration diskutiert. Der Grad der Gesundheit einer Gesellschaft lässt sich nach dieser Vorstellung anhand der gesellschaftlichen Teilhabe, insbesondere am Arbeitsprozess, bestimmen. Neben dem Ausmaß an grundsätzlicher Teilhabe an der Erwerbsgesellschaft (für die die Arbeitslosenstatistik eine gute Maßzahl liefert, wobei eine deutlich positive Korrelation zwischen Arbeitslosigkeit und Krankheit besteht), zeigen hierbei insbesondere die krankheitsbedingten Fehlzeiten an, wie gesund (also wirtschaftlich und sozial aktiv) die Menschen in einer Population sind. Die Arbeitslosenquote in Deutschland liegt im Jahr 2011 bei ca. 7 % – dieser vergleichsweise niedrige Wert deutet auf ein hohes Maß an gesellschaftlicher Teilhabe und damit Gesundheit in Deutschland hin. Aber: Diejenigen, die Arbeit haben, sind nicht automatisch gesund. Im Durchschnitt aller Branchen sind Arbeitnehmer zwölf Tage im Jahr krank gemeldet, wobei die Dauer der Krankmeldungen vom 15. bis zum 65. Lebensjahr kontinuierlich ansteigt (baua, 2011). In zahlreichen Berufen steigen speziell nach dem 50. Lebensjahr die krankheitsbedingten Fehlzeiten stark an. Dies wird sich aufgrund des demographischen Wandels in den nächsten Jahren noch deutlich verstärken, wobei insbesondere chronische Krankheiten vielfach bis zum Verlust der Erwerbsfähigkeit führen können (Badura & Wagner, 2008). Betrachtet man die krankheitsbedingten Fehlzeiten nach Diagnosen, dann fällt auf, dass die Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und Seite 7 Elbe, Schädler, Weidringer & Werner des Bindegewebes mit 23,7 % der Fälle die mit Abstand häufigste Diagnosegruppe ist (baua 2011). Neben den Erkrankungen des Stützund Bewegungsapparats, sind insbesondere Atmungssystem-, Herz-Kreislauf- sowie Stoffwechsel-Erkrankungen häufige Ursachen für Arbeitsunfähigkeit. Aber auch psychische Erkrankungen zählen mit 9,3 % zu den häufigsten Ursachen, wobei zu beachten ist, dass zwischen physi­ schen und psychischen Erkrankungen (insbesondere Depression, Burn-out und psychosomatischen Erkrankungen) vielfach ein enger Zusammenhang besteht. „Ursächlich dafür sind vor allem Wechselwirkungen zwischen unspezifischen Einflüssen, wie zum Beispiel chronischem Stress oder mangelhafter sozialer Integration, und krankheits­spezifischen Risikofaktoren, wie etwa Rauchen, Bewegungsarmut oder körperliche Fehlbelastung.“ (Badura & Wagner, 2008). Ausgehend von rund 27 Millionen Pflicht- und freiwillig Versicherten der Gesetzlichen Krankenversicherung schätzt die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin für das Jahr 2009 insgesamt 459,2 Millionen Arbeitsunfähigkeitstage und damit einen Ausfall an Bruttowertschöpfung von 75 Milliarden Euro (baua, 2011). Während also der Anteil derjenigen, die aufgrund von Arbeitslosigkeit in Gesundheit und gesellschaftlicher Teilhabe deutlich eingeschränkt sind, einen relativ niedrigen Wert erreicht hat, ist festzustellen, dass auch diejenigen, die aktiv am Erwerbsleben teilnehmen, gesundheitliche Einschränkungen erfahren und im Gesundheitssystem Kosten verursachen. Natürlich stehen dem wiederum Leistungen gegenüber, die das Gesundheitssystem erbringt – Krankheit verursacht eben nicht nur Kosten, vielmehr sind Krankheit und Gesundheit selbst ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Seite 8 Während das Hauptaugenmerk im Gesundheits­­system bisher primär auf Heilung und Wiedereingliederung (Kuration und Rehabilitation) lag, tritt die Prävention in den letzten Jahren zunehmend in den Vordergrund. Präventionsmaßnahmen haben den Vorteil das Auftreten von Krankheit zu verhindern, also direkt zur Gesundherhaltung beizutragen. Dieser Perspektive widmet sich auch der Ansatz der Salutogenese (Antonovsky, 1997), der davon ausgeht, dass Menschen durch Steigerung ihres Kohärenzsinns (Bedeutsamkeit, Sinnhaftigkeit und Handhab­ barkeit der alltäglichen Lebenswelt) ihr individuelles Gesundheitsempfinden steigern können. Aus dieser Perspektive ist Gesundheit als lebenslange Funktion und nicht als momentaner Zustand zu bewerten – aus volks­ wirtschaftlicher Sicht geht es damit um die Optimierung von Gesundheitsleistungen und -kosten im Lebensverlauf via Prävention, Kuration, Rehabilitation. Eine Schlüsselrolle kommt in allen drei Aspekten der Gesundheit der Bewegung, genauer: dem Sport zu. Relevanz: Sport und Gesundheit Sport ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor geworden, der in Deutschland 1,4 % des Brutto­inlandprodukts ausmacht, damit z. B. die Textilindustrie in ihrer Bedeutung überholt hat, und etwa 700.000 Arbeitsplätze bereitstellt (DOSB, 2006). In Anbetracht der demographischen Entwicklung und Zunahme chronischer Erkrankungen stehen immer stärker Maßnahmen gesundheitsbewusster regelmäßiger Bewegung, wie sie insbe­ sondere über die Sportvereine angeboten werden, im Mittelpunkt. Laut der WHO sparen körperlich aktive Menschen dem Gesundheitssystem ca. 500 Euro pro Jahr, wobei Gutachten belegen, dass generell ca. 40 % der Kosten im Gesundheitssystem Zeitschrift für Gesundheit und Sport Sport und Gesundheit: gesellschaftliche und ökonomische Perspektiven verhaltens­bedingt entstehen. Neben falscher Ernährung und Genussmittelmissbrauch ist Bewegungsmangel einer der wichtigsten Faktoren. „Volkswirtschaftler sprechen von bis zu 30 Mrd. Euro, die in Deutschland über Bewegungsprogramme eingespart werden. Sportvereine leisten mit ihren Programmen zur gesundheitlichen Prävention und Rehabilitation einen bedeutenden Beitrag zur Förderung der Volksgesundheit und zur Entlastung des Sozialstaates“ (DOSB, 2006). Politik und Wissenschaft versuchen seit einigen Jahren dem Bewegungsmangel entgegenzusteuern. Allerdings zeigt sich das Bewegungsverhalten bei vielen Menschen als eine Verhaltensweise, die über die gesamte Lebensspanne hinweg betrachtet starken Schwankungen unterworfen ist und meist nicht als ein Verhalten mit lebenslanger Routine angesehen werden kann (vgl. Schwarzer, 2004; Woll, 2004; Fuchs, 2003). Insbesondere Veränderungen individueller Zeit- und Finanzbudgets, die oft mit Berufseinstieg oder Familiengründung verbunden sind, werden als kritische Phase mit einer hohen Ausstiegswahrscheinlichkeit (Drop-out) für die sportliche Betätigung angesehen. Hingegen steigt Studien zufolge mit dem Eintritt in das Rentenalter die Bereitschaft für den Beginn einer körperlichen Aktivität an (Breuer & Wicker, 2007). Als Reaktion auf die Umkehrung der Alterspyramide sind gerade der Seniorensport und die Zielgruppe 50+ bei den Sportanbietern in den Fokus gerückt. Das Bewegungsverhalten ist also ein motivationaler Prozess mit Unterbrechungen, Entscheidungen und Neuorientierungen (Schwarzer, 2004; Woll, 2004). Sportliche Aktivität oder Inaktivität geht in hohem Maß aus den gemachten Erfahrungen und früheren Verhalten hervor (Woll, 2004). Wer bereits einmal an einem Trainingsprogramm teilgenommen hat, wird auch später wahrscheinlich erneut an einem Programm teilnehmen. Demnach ist „frühere Aktivität […] ein guter Prädikator für spätere Aktivität“ (Schwarzer, 2004). Oftmals spielen der Spaß an der Ausübung, das anschließende Wohlbefinden oder die soziale Anerkennung in der Bezugsgruppe eine größere Rolle als das Wissen um die gesundheitlichen Wirkungen von Sport (Schwarzer, 2004). Das Gesundheitsmotiv wird als Begründung für die sportliche Betätigung zwar häufig angegeben, ist aber als alleiniger Beweggrund oftmals keine stabile Motivationsgrundlage (Fuchs, 2003). Das gemeinsame Sporterlebnis, das Erleben von Sport steht mit im Vordergrund und dieser sozial-integrativen Wirkung ist sich der Sport sehr wohl bewusst. Erst mit zunehmendem Lebensalter steigt auch das Gesundheitsmotiv signifikant an (Breuer & Wicker, 2007), wobei generell sportlich Inaktive Gesundheit als Motiv angeben (Bös & Brehm, 2003), auch wenn dies nicht zwangsläufig zur Handlungsauslösung führt. Der Verein: Integration und Sport Speziell in Deutschland wurde sportliche Aktivität lange Zeit mit der Mitgliedschaft in einem Sportverein gleichgesetzt und bereits 1995 erklärte der Dachverband die Förderung von „Sport und Gesundheit“ zur zentralen gesundheitspolitischen Aufgabe der angeschlossenen Verbände und Vereine (Bös & Brehm, 2003). Sportvereine dienen dabei nicht nur der direkten Gesundheitsförderung ihrer Mitglieder durch Bewegung sondern auch der sozialen Förderung durch Integration und damit einer gesundheitsförderlichen Teilhabe an der Gesellschaft. Der Sportverein biete benachteiligten Gruppen, Menschen mit Migrationshintergrund, Ausländer/innen, aber auch bildungs- und partizipationsfernen Schichten eine Möglichkeit zum Erwerb Elbe, Schädler, Weidringer & Werner des Sozialkapitals und somit zur sozialen Integration. Vorstellungen vom Sportverein als Sozialstation zur Linderung gesellschaftlicher Desintegrationsprozesse gehören zum Standardvokabular der staatlichen und verbandlichen Sportpolitik und werden generationsübergreifend postuliert. Warum wird dem organisierten Sport seit Jahrzehnten solch eine hohe Integrationsfunktion und soziale Bedeutung zugemessen? Der organisierte Sport stellt in Deutschland nicht nur eine wirtschaftliche, sondern auch eine zentrale Quelle sozialen Kapitals dar – mit über 90.000 Vereinen und rund 28 Mio. Mitgliedern (Breuer & Wicker, 2010) ist er die erfolgreichste Freiwilligenorganisation Deutschlands. In diesem Sinne wird in der Literatur das Argument der „großen Zahl“ geführt, d. h. je größer die Zahl der im Sport organisierten Personen, desto höher die Gemeinwohlorientierung. Anders als andere kulturelle und soziale Vereinigungen ermögliche insbesondere der Sportverein eine aktive Beteiligung, ein geselliges Miteinander, ein freiwilliges Engagement seiner Mitglieder/ innen und dadurch die Aneignung neuen Wissens, neuer Fertigkeiten und Kompetenzen, die auch in andere soziale Lebenswelten hineinreichen können. Vor, während und nach dem Sporttreiben ergeben sich zahlreiche Kontaktmöglichkeiten, d. h. in der Regel (Gesprächs-)Situationen, die einem sozialen Gefüge förderlich sind. Besonders Spielsportarten knüpfen erstens an die traditionellen Formen der Zusammengehörigkeit an und fordern zweitens den Mannschafts- oder Teamgeist, die „organisierte Kollektivität“ (Auernheimer, 1988). Ferner gelten Sportvereine als Orte der Geselligkeit, in denen neben dem eigentlichen Sportangebot Feste (Saisoneröffnung, Weihnachtsfeier, Sportlerehrung etc.) oder ganz einfach das „gemeinsame Bier nach Seite 10 dem Sport“2 regelmäßige Interaktionen der Mitglieder auf formelle und informelle Art und Weise fördern. Aufgrund der weitgehend freiwilligen Mitgliedschaft biete der Sportverein eine Fülle von Sozialisationsgelegenheiten zur „selbsttätig-produktiven Konstitution von Persönlichkeit“ (Cachay & Thiel, 2000). Kinder und Jugendliche bauten hier in Kommunikation mit den anderen Mitgliedern ein erstes vielfach lebenslang prägendes Fundament von Situationsdefinitionen, Erwartungs­typisierungen, Norm- und Wert­ orientierungen, Handlungsmustern und Einstellungen auf (Hurrelmann, 2006; Bös & Brehm, 2003). Sportintegration und -sozialisation könne gesellschaftliche und indivi­du­ elle Fehlentwicklungen, bedingt durch Eingliederungsbzw. Integrations­ schwierigkeiten oder auch sozialisatorischen Brüchen wie anhaltender Arbeitslosigkeit kompensieren und dabei unterstützen, dass im Sport erworbene Einstellungen und Kompetenzen (z. B. Fairplay, Toleranz, Team­geist etc.) sich auch in anderen Lebens­ bereichen wie Schule, Ausbildung, Ehe und Familie niederschlagen. Insgesamt könne Sport also integrationsfördernd und persönlichkeitsbildend (z. B. durch Entwicklung moderner bzw. demokratischer Geschlechtsidentitäten) wirken. Sportvereine sozialisieren somit auch für den Beruf und tragen dadurch (speziell in der Phase der sekundären Sozialisation) zu einem gesundheitsorientierten Lebensstil junger Menschen bei, der dann auch in der betrieblichen Sozialisation im Erwachsenenalter weiter wirkt (Elbe, 1997). Sportvereine sind nach den bisherigen Funktionszuschreibungen anscheinend in der Lage, doppelte Integrationsleistungen zu erbringen. Die beiden genannten Wenn alkoholfrei, dann durchaus auch im Sinne eines Elektrolytersatzes physiologisch wertvoll. 2 Zeitschrift für Gesundheit und Sport Sport und Gesundheit: gesellschaftliche und ökonomische Perspektiven Perspektiven auf die Integrationsleistungen von Sportvereinen (Integration im und durch Sport) basieren mitunter auf ähnlichen Argumentationsmustern: Sie böten erstens einen geeigneten sozialen und organisatorischen Rahmen für die Realisierung von Vorstellungen ihrer Mitglieder. Die Mitglieder integrieren sich in die Gemeinschaft und binden sich an die Organisationen. Zweitens könnten Sportorganisationen zur Vergesellschaftung ihrer Mitglieder beitragen, d. h. die Mitglieder erwerben durch die Partizipation im Verein auch habitualisierte Dispositionen, die sie auf andere gesellschaftliche Handlungsfelder übertragen könnten. Der organisierte Sport stellt quantitativ nach wie vor den bedeutsamsten Träger ehrenamtlichen Engagements in Deutschland dar. Insgesamt engagieren sich in den Sportvereinen Mitglieder in 1,85 Mio. ehrenamtlichen Positionen, davon 0,85 Mio. auf der Vorstandsebene und 1,0 Mio. auf der Ausführungsebene (Breuer & Wicker, 2010). Jedoch hat die Diskussion um neue Formen des freiwilligen Engagements seit einigen Jahren Konjunktur. Dabei ist beim Ehrenamt sowohl eine individuelle Ebene (persönliche Bereicherung und Verwirklichung) als auch eine organisationale Ressource (Arbeitskraft) zu sehen. Es lässt sich feststellen, dass die Vereinsarbeit nicht mehr nur ausschließlich durch das ehrenamtliche Engagement der Mitglieder, sondern teilweise auch von bezahlten Mitarbeitern getragen wird. Schon Mitte der 80er Jahre kommt Anders (1984) in seiner Sportvereinsanalyse zu der Feststellung, dass die ehrenamtliche Führung als zentrales Strukturelement nicht letztlich aufgrund der gewandelten Bedürfnisse der Sportreibenden, des zunehmenden Aufgabenkatalogs der Vereine und gewandelter Anforderungen an den Verein, mehr und mehr zurück gehen wird und eine weitere Entwicklung vermehrt hauptamtliche Mitarbeiter in den Vereinen Heft 1/2011 erfordert. Dieser Professionalisierungsdruck der Sportorganisationen (Horch, 1999) zwinge die Vereine und Verbände, mehr Hauptamtliche einzustellen und das bereits vorhandene Personal in Ehren- und Hauptamt zu qualifizieren, wenn sie Wachstumschancen wie stärker professionalisierte Organisationen nutzen wollten. Der Professionalisierungs- bzw. Modernisie­ rungs­druck kommt einer Vermarktlichung der Sportorganisationen „von oben“ gleich (Nährlich, 2000), die einerseits zu Entkoppelungsprozessen zwischen Indivi­ duum und Organisation im Sinne eines Managements von Ungewissheit (Elbe, 2011) und andererseits zu einer zunehmenden Dienstleistungsorientierung führt (Dürr, 2008), wodurch die Vereine ihre sozialintegrative Funktion verlören. Mitglieder würden zu Kunden, das Verhält­nis untereinander distanzierter und im Verhältnis zum Verein rationalkalkuliert, sachbezogener. Sportorganisationen müssten sich entscheiden, um entweder als „strikt marktorientierte und hoch-professionalisierte Dienstleistungsunternehmen“, oder aber als „primär sozial-kulturell orien­tierte Gemeinschaften mit geringem Professionalisierungsgrad und rudimentärer Marktorientierung“ (Zimmer, 1997) zu bestehen. Mittlerweile hat die Praxis bewiesen, dass insbesondere kleine Vereine von ihren Mitgliedern getragen werden und auch ohne marktwirtschaftliche Ausrichtung überlebensfähig sein können.3 Zum anderen kommt es zu einem Modernisierungsdruck „von unten“ im Sinne einer Wahrnehmungsänderung des Ehrenamts (Zimmer & Priller, 2007, 1997). Ein Wertewandel im Ehrenamt hin zur stärkeren Aus steuerrechtlicher Sicht ist hier der Aspekt der Gemeinnützigkeit von erheblicher Bedeutung, ebenso der sog. „Übungsleiterfreibetrag“ von bis zu 2.100 Euro p. a. gem. § 3 Artikel 26, EStG, der damit einen deutlichen Anreiz für sportförderndes, ehrenamtliches Engagement in Vereinen liefert. 3 Seite 11 Elbe, Schädler, Weidringer & Werner Bedeutung von Selbstverwirklichung und zu einer Pluralisierung des Lebensstils ist auszumachen, welcher entscheidenden Einfluss auf die ausgeübten Tätigkeiten hat. Das Ehrenamt wird als ein Medium für Prozesse von Selbstverwirklichung und Selbstfindung betrachtet, das sich in die jeweils biographische Phase des Einzelnen einfügt. In der Sportpraxis zeigen sich auch hier Tendenzen, dass die Übernahme eines Amtes insbesondere von jüngeren Generationen keineswegs als „Ehre“, sondern als „Last“ empfunden wird. Mit den Modernisierungsprozessen und der zunehmenden Individualisierung können Individuen ferner auch scheitern, mit der Folge von gesellschaftlichen Bindungsverlusten (Beck, 1986) und zunehmender Ungewissheit (Elbe, 2011). Gerade der Sport zeichnet gerne ein „trauliches“ Bild von sich, in dem er in der modernen, organisationsdurchdrungenen Gesellschaft Marginalisierung entgegenwirkt und mit seinen Vereinen einen Ort der Zuflucht, Gemeinschaft und Orientierung bietet. Neben der körperlichen Gesunderhaltung diene der vereinsgebundene Sport damit auch der gesellschaftlichen Integration und somit insgesamt einer physisch-psycho-sozialen Gesundheitsförderung. Alltag und Individualisierung Wie bereits angedeutet, hat sich im Zuge der Individualisierung der Gesellschaft eine Verschiebung der institutionellen Bindungsbereitschaft der Einzelnen vollzogen, die dazu führt, dass speziell unter jungen Menschen die Bereitschaft, im Verein aktiv zu werden, rückläufig ist. Speziell die Sportsoziologie (z. B. Bette, 2010; Prohl & Scheid, 2009; Heimann, 2007; Cachay & Thiel, 2000) hat in den letzten Jahren darauf hingewiesen, dass auch im Sport eine zunehmende Differenzierung wirksam Seite 12 wird und neben traditionellen Formen des vergemeinschafteten Sports in Vereinen zunehmend individualisierter Sport ohne langfristig-relationale Bindung an eine spezifische Organisation tritt. Dies hat zur Folge, dass speziell privatwirtschaftliche Sportangebote, z. B. in Fitness-Studios, auf transaktionaler Vertragsbasis oder auch Angebote zum Gesundheitssport, die teilweise von Krankenkassen gefördert werden, zunehmend nachgefragt werden und damit zu einer Individualisierung der Bewegung im Alltag beitragen. Der privatwirtschaftliche Teil des Sportangebots vereinigt einen großen Teil des Wachstums in der Sportbranche auf sich, wobei Fitness als individualisiertes Angebot eine besondere Bedeutung hat (Trosien, 2009). Mit dieser Entwicklung werden zweierlei Trends befördert: Zum einen wird der Körper im Rahmen der Institutionalisierung des Lebenslaufs (Elbe, 2011; Kohli, 2003) selbst zur Institution und damit zum Gegenstand von Inszenierung (Heinemann, 2007; ApuZ, 2007) und freier Gestaltung zugänglich. Eben die Individualisierung lässt Vergemeinschaftung des Sports im Verein dann unattraktiv erscheinen – der Sport wird rationalisiert zur gesellschaftlichen relevanten Bewegung des Individuums. Damit wird aber zugleich Gesundherhaltung zur gesellschaftlichen Pflicht. Nicht sportlich aktiv zu sein erscheint als Präkariatsmerkmal und verwerflich, was weder im Einzelfall noch aus volkswirtschaftlicher Sicht hinnehmbar sei: „… dass sowohl aus Gründen der Volksgesundheit als auch aus Kostengründen ein weiterer Anstieg der Inaktivität nicht hingenommen werden darf und die Bestrebungen zur Erhöhung des bewegungsaktiven Anteils der Bevölkerung hohe Priorität haben“ (Martin et al., 2001). Allerdings weisen weniger als 20 % der erwachsenen Bevölkerung ein hohes Maß an wünschenswerter körperlich-sportlicher Zeitschrift für Gesundheit und Sport Sport und Gesundheit: gesellschaftliche und ökonomische Perspektiven Aktivität auf (Bös & Brehm, 2003). Es gilt also gesundheitspolitische Wunschvorstellungen von gesellschaftlichen Realitäten zu unterscheiden. Die positive Wirkung von gezielter Bewegung auf die Gesundheit soll hier nicht bestritten werden, gute Belege hierfür finden sich z. B. in der Metaanalyse von Woll & Bös (2004), die nachweisen, dass Gesundheitssport einen generell positiven Effekt auf vielerlei Erkrankungen und Mortalitätsursachen hat.4 Der neue Körper-Kult hat allerdings auch weitere Konsequenzen: Es besteht die Gefahr, dass die Selbstinszenierung des Körpers so dominant wird, dass hieraus selbst Gesundheitsgefahren erwachsen. In Zusammenhang mit aktivem Training in Fitness-Studios weist Kläber (2010) nach, „… wie sehr Techniken der medikamentösen Körpermodellierung unter Ignorierung von Gesundheitsschäden und Nebenwirkungen bereits im modernen Alltag angekommen sind.“ Und diese Aussage bezieht sich nicht auf Leistungssportler! In diesen Rahmen wirtschaftlicher und sozialer Bedeutung von Sport und Gesundheit haben sich die nachfolgenden Analysen zur Studie „Wie fit ist Deutschland?“ einzuordnen. Insbesondere ist dabei dem zunehmenden Trend der Ökonomisierung sowohl von Sport, als auch von Gesundheit Rechnung zu tragen. Die individuell gesundheitsförderlichen Effekte sind nicht zu bestreiten – die gesamtgesellschaftliche Wirkung aber sehr wohl diskutierenswert. Nicht verschwiegen werden soll, dass ältere Metaanalysen diesen Zusammenhang bei weitem nicht so klar nachweisen konnten (Bös & Brehm, 2003), allerdings wurde bereits hier die Notwendigkeit differenzierter Analysen angemahnt, wie sie von Woll & Bös 2004 vorgelegt wurden. 4 Heft 1/2011 Literatur Anders, G. (1984): Struktur des Vereinssports. In: Carl (Hrsg.), Handbuch Sport. Band 2. Düsseldorf, S. 821–839. Antonovsky, A. (1997): Salutogenese. Zur Entmystifizierung der Gesundheit. Tübingen: dgvt. APuZ – Aus Politik und Zeitgeschichte (2007): Körperkult und Schönheitswahn. 18/2007. Auernheimer, G. (1988): Der sogenannte Kulturkonflikt. Orientierungsprobleme ausländischer Jugendlicher. Frankfurt am Main: Campus Verlag. Badura, B. & Walter, U. (2008): Betriebliches Gesundheitsmanagement: Lohnende Investition in die Gesundheit der Mitarbeiter. In: Deutsches Ärzteblatt 2008 150(3): A-90. baua – Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (2011): Arbeitswelt im Wandel. Zahlen-Daten-Fakten. Dortmund: baua. Beck, U. (1986): Risikogesellschaft: Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag. Bette, K.-H. (2010): Sportsoziologie. Bielefeld: transcript. Bös, K. & Brehm, W. (2003): Bewegung. In: Schwarz, F. et al. (Hrsg): Das Public Health Buch. Gesundheit und Gesundheitswesen. 2. Aufl. München: Urban & Fischer, S. 156–162. Breuer, C. & Wicker, P. (2010): Sportentwicklungsbericht 2009/2010. Analyse zur Situation der Sportvereine in Deutschland. Breuer, C. & Wicker, P. (2007): Sportentwicklungsbericht 2007/2008. Analyse zur Situation der Sportvereine in Deutschland. Cachay, K. & Thiel, A. (2000): Soziologie des Sports. Zur Ausdifferenzierung und Entwicklungsdynamik des Sports der modernen Gesellschaft. Weinheim und München: Juventa. Seite 13 Elbe, Schädler, Weidringer & Werner DOSB – Deutscher Olympischer Sportbund (2006): Staatsziel Sport. Positionspapier des Deutschen Olympischen Sportbundes. Frankfurt: DOSB. Dürr, F. (2008): Faktoren der Mitgliederzufriedenheit im Sportverein. Bedeutsamkeit von VereinsbewertungsMerkmalen für die globale Zufriedenheit sportlich aktiver Mitglieder ohne ehrenamtliches und berufliches Engagement. Dissertation. Heidelberg: Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Elbe, M. (2011): Ungewissheit im institutionellen Wandel. Individuelle Ressourcen als Potenzial. In: Jeschke, S. & Isenhardt, I. & Hees, F. & Trantow, (Hrsg.). Enabling Innovation. Innovationsfähigkeit – deutsche und internationale Perspektiven. Berlin/Heidelberg: Springer. (im Erscheinen) Elbe, M. (1997): Betriebliche Sozialisation: Grundlagen der Gestaltung personaler und organisatorischer Anpassungsprozesse. Sinzheim: Pro Universitate. Fuchs, R. (2003): Sport, Gesundheit und Public Health. Göttingen: Hogrefe. Heinemann, K. (2007): Einführung in die Soziologie des Sports. Grundlagen für Studium, Ausbildung und Beruf. 5. Aufl. Schorndorf: Hofmann. Hurrelmann, K. (2006): Einführung in die Sozialisationstheorie. 9. Auflage. Weinheim und Basel: Beltz Verlag. Horch, H.D. (1999): Professionalisierung im Sportmanagement. Beiträge des 1. Kölner Sportökonomie-Kongresses. Aachen: Meyer und Meyer. Kläber, M. (2010): Körper-Tuning. Medikamentenmissbrauch im FitnessStudio. In: Sport und Gesellschaft – Sport and Society 3/2010, S. 213–235. Kohli, M. (2003): Der institutionalisierte Lebenslauf: ein Blick zurück und nach vorn. In: Allmendinger, J. (Hrsg.): Entstaatlichung und soziale Sicherheit. Verhandlungen des 31. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Soziologie in Leipzig 2002. Opladen: VS-Verlag für Seite 14 Sozialwissenschaften. Martin, B. et al. (2001): Volkswirtschaftlicher Nutzen der Gesundheitseffekte der körperlichen Aktivität: erste Schätzungen für die Schweiz. In: Schweizerische Zeitschrift für Sportmedizin und Sporttraumatologie 2/2001, S. 84–86. Nährlich, S. (2000): Management in NonprofitOrganisationen. Eine praxisorientierte Einführung. Opladen: Leske & Budrich. Prohl, R. & Scheid, V. (2009) (Hrsg.): Sport und Gesellschaft. 6. Aufl. Wiebelsheim: Limpert. Schwarzer, R. (2004): Psychologie des Gesundheitsverhaltens. Einführung in die Gesundheitspsychologie. Göttingen: Hogrefe. Trosien, G. (2009): Sportökonomie. Ein Lehrbuch in 15 Lektionen. 2. Aufl. Aachen: Meyer & Meyer. Ulich, E. & Wülser, M. (2005): Gesundheitsmanagement in Unternehmen. Arbeitspsychologische Perspektiven. 2. Aufl. Wiesbaden: Gabler. Wagner, P. (2007): Beginnen, Dabeibleiben und Aufhören. In: Fuchs, R.; Göhner, W.; Seelig, H. (Hrsg.): Aufbau eines körperlichaktiven Lebensstils. Göttingen: Hogrefe, S. 71–88. Woll, A. (2004): Diagnose körperlichsportlicher Aktivität im Erwachsenenalter. In: Zeitschrift für Sportpsychologie, Jg. 11., Heft 1, S. 54–70. Woll, A. & Bös, K. (2004): Wirkung von Gesundheitssport. In: Bewegungstherapie und Gesundheitssport 20/2004, S. 1–10. Zimmer, A. & Priller, E. (2007): Gemeinnützige Organisationen im gesellschaftlichen Wandel. Ergebnisse der Dritte-SektorForschung. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften. Zimmer, A. (1997): Vereine - Basiselement der Demokratie. Opladen: Leske & Budrich. Zeitschrift für Gesundheit und Sport Sport und Gesundheit: gesellschaftliche und ökonomische Perspektiven Kontakt Prof. Dr. Martin Elbe Dipl.-Sportwiss. Timo Schädler Prof. Dr. med. Johann Wilhelm Weidringer Prof. Dr. Dr. Christian Werner H:G Hochschule für Gesundheit und Sport Kontaktadresse Prof. Dr. Martin Elbe H:G Hochschule für Gesundheit und Sport Vulkanstraße 1 10367 Berlin [email protected] Heft 1/2011 Seite 15
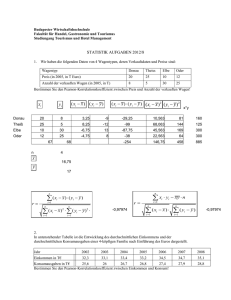


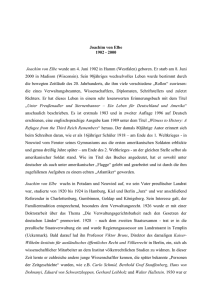
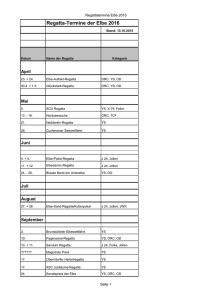
![GK100079 Böhmische Masse [ELB]](http://s1.studylibde.com/store/data/002177849_1-0eddfc07fc5c038120f5d136b08134ef-300x300.png)