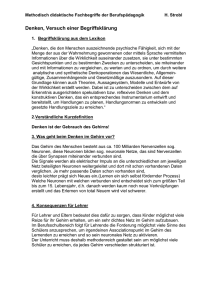Führen mit Hirn Systemdenken und aktuelle
Werbung

Führen mit Hirn Systemdenken und aktuelle Erkenntnisse aus der Gehirnforschung für nachhaltig wirksames Führungsverhalten Das Gehirn Das Gehirn des Menschen wiegt etwa 1,4 kg und macht damit etwa 2% des Körpergewichts aus. Es verbraucht jedoch mehr als 20% der Energie des gesamten Körpers. Von jeglicher Nahrung, die wir zu uns nehmen, geht ein Fünftel an das Gehirn. In knappen Zeiten stellt das Gehirn damit einen unglaublichen Luxus dar. Da die Zeiten während der evolutionären Entwicklung des Menschen nahezu immer knapp waren, muss ein Gehirn große Vorteile bieten, denn es hat in jedem Fall einen großen Nachteil: Es kostet uns sehr viel Energie. Wer zur Nahrungsaufnahme nicht die Kühlschranktür öffnen kann, sondern Wurzeln oder Bucheckern suchen muss, der wäre ohne Gehirn zunächst scheinbar besser dran, denn er bräuchte dann 20% weniger zu suchen. Wir haben aber nun einmal ein Gehirn und das aus gutem Grund: Es enthält einige Milliarden Neuronen, die für irgendetwas in der Welt stehen können. Dadurch ermöglicht das Gehirn dem Menschen Dinge zu tun, die andere Lebewesen nicht können. Menschen sind dank ihres Gehirns unglaublich flexibel, bevölkern den gesamten Erdball und sind sogar erste Schritte auf dem Mond gegangen. Gewiss, Tiger haben schärfere Zähne, Elefanten sind stärker, Geparden schneller, Eisbären vertragen Kälte besser, Wale können besser schwimmen und Albatrosse besser fliegen. Im Gegensatz zu all diesen vom Aussterben bedrohten Tieren ist der Mensch jedoch, dank seines Gehirns, nicht auf eine Sache besonders spezialisiert, sondern kann sich auf die verschiedensten Umgebungen, Aufgaben und Probleme einstellen. Kurz: Er kann lernen, und zwar besser als alle anderen Lebewesen auf der Welt, und das Organ mit dem das geschieht, sind nicht Zähne, Muskeln, Fell, Flossen oder Flügel, sondern ist das Gehirn. Was bedeutet das für mich als Führungskraft? Unser Gehirn ist für das Lernen optimiert. Es lernt nicht irgendwie mehr „schlecht als recht“, sondern kann nichts besser und tut nichts lieber. Lernen ist buchstäblich kinderleicht. Der Säugling kann nach wenigen 100 Tagen greifen, laufen, singen und kommunizieren. Lernen macht uns in aller Regel keine Probleme, es sei denn, irgendetwas läuft in unserem Kopf schief - ständiger Stress, Überforderung, Ängste und andere Energieblockaden. Als Führungskraft bin ich Energiemanager: Eines der stärksten Entwicklungs- und Lernhemmnisse ist die ständige Konzentration auf aktuelle Ereignisse… ‚Der DAX fiel heute auf 16 Punkte…’ ;Ein Ende der Finanzkrise ist nicht abzusehen…’ Solche Erklärungen sind zwar in sich wahr, aber sie lenken unsere Aufmerksamkeit von den langfristigen Veränderungen ab, die hinter den Ereignissen stehen und sie verhindern, dass wir die Ursachen dieser Muster überhaupt wahrnehmen und begreifen. Erforderlich ist hier das so genannte Systemdenken, zum Beispiel: Wolken ziehen auf, der Himmel verdunkelt sich, die Blätter kräuseln sich nach unten und wir wissen, dass es regnen wird. Wir wissen aber auch, dass der Niederschlag nach dem Unwetter viele Kilometer entfernt ins Grundwasser fließt und dass der Himmel morgen wieder aufklaren wird. Obwohl diese Ereignisse räumlich und zeitlich voneinander getrennt sind, gehören sie doch zu demselben Muster. Die Ereignisse beeinflussen sich gegenseitig, auch wenn wir dieses Wechselspiel normalerweise gar nicht wahrnehmen. Das System eines heftigen Regens Seite 1 von 9 können wir nur verstehen, wenn wir über die Einzelteile hinausblicken und das Ganze betrachten. Die Geschäftswelt und unsere Unternehmen sind ebenfalls Systeme. Wir neigen dazu, uns auf „Schnappschüsse“ von isolierten Systemzahlen zu konzentrieren und wundern uns, warum die größten Probleme scheinbar unlösbar sind. Wichtig wäre es, systemisch zu denken, d. h. ein Rahmenwerk zu sehen, ein Set von Informationen und Instrumenten, damit wir übergreifende Muster erkennen und besser begreifen. Als Führungskräfte können wir in einer Organisation kein generatives Lernen fördern, wenn das Denken der Menschen von kurzfristigen Ereignissen beherrscht wird. Wenn wir uns auf Ereignisse konzentrieren, sind wir bestenfalls in der Lage, ein bevorstehendes Ereignis vorauszusagen, um optimal zu reagieren. Wir können aber nicht lernen, kreativ mit der Ausgangssituation so umzugehen, dass unser Unternehmen langfristig überleben kann. Wir alle kennen das Gleichnis vom „Gekochten Frosch“: Wenn man einen Frosch in einen Topf mit kochendem Wasser setzt, wird er sofort versuchen, herauszuklettern. Wenn der Topf Zimmertemperatur hat, bleibt er ganz ruhig sitzen. Steht der Topf nun auf einer Wärmequelle und wird die Temperatur allmählich erhöht, geschieht folgendes: Während die Temperatur von 20° auf 30° Celsius steigt, bewegt sich der Frosch nicht. Er wird tatsächlich alle Anzeichen von äußerstem Wohlbehagen zeigen. Während die Hitze nach und nach zunimmt, wird der Frosch immer schlapper und schlapper, bis er unfähig ist, ‚rauszukraxeln’. Obwohl der Frosch durch nichts gehindert wird, sich zu retten, bleibt er sitzen. Warum? Weil der innere Wahrnehmungsapparat des Frosches auf plötzliche Veränderungen in seiner Umwelt eingestellt ist und nicht auf systemisch langsam wachsende. Etwas Ähnliches geschah bei der Wirtschaftskrise. Wir müssen wahr-nehmen lernen, langsame, allmähliche Entwicklungen erkennen, unser hektisches Tempo drosseln und dem Subtilen genauso viel Aufmerksamkeit widmen, wie dem Dramatischen. Wie schaffen wir Entschleunigung? Wie verhindern wir, dass unser Denken auf eine einzelne Frequenz eingestellt ist? Das sind alles Führungsaufgaben: Die richtigen Dinge tun, statt nur die Dinge richtig zu tun. Warum sollten wir als Führungskraft etwas vom Lernen und dem Organ des Lernens, dem Gehirn verstehen? Denn… ob wir es wollen oder nicht, wir lernen immer. Seit ca. 100.000 Jahren ist der Prozess der Hirnentwicklung abgeschlossen. An der für die Hirnentwicklung zuständigen genetischen Ausstattung des Menschen hat sich nichts mehr verändert. Entscheidend geändert hat sich seit dem aber all das, was bestimmt, wie und wofür Menschen ihr Gehirn nutzen: die gesellschaftlichen Beziehungen, das über den Erwerb von Sprache, Schrift und Datenspeicher akkumulierte und zur Weitergabe verfügbare Wissen, das Ausmaß an Kommunikation und die damit verbundenen Möglichkeiten für die Übertragung von Wissen, von Fähigkeiten und Fertigkeiten sowohl zwischen unterschiedlichen Kulturen als auch von einer Generation zur nächsten. Die durch die kulturelle Entwicklung und Überlieferung bestimmte Lebenswelt des Menschen wurde immer komplexer, vielfältiger und reichhaltiger. In dieser Welt hatten die Menschen im Verlauf ihrer individuellen Entwicklung die Möglichkeit, eine Vielzahl unterschiedlichster Seite 2 von 9 Herausforderungen zu bewältigen. Sie konnten zeitlebens immer mehr und immer wieder neue Erfahrungen machen und in Form bestimmter neuronaler Verschaltungen in ihrem Gehirn verankern. Damit war auch ihr durch diese Verschaltungen gelenktes Denken, Fühlen und Handeln prinzipiell bis ins hohe Alter veränderbar geworden. Nur… auch heute noch leben die meisten Menschen unter Bedingungen, die dazu führen, dass sie prinzipiell vorhandene Möglichkeiten zur Ausbildung eines hochkomplexen, vielfach vernetzten und zeitlebens lernfähigen Gehirns nicht ausschöpfen können. Und auch heute sind die meisten Menschen auf unserer Erde gezwungen, ihr Gehirn zeitlebens auf eine sehr einseitige Weise zu nutzen und nur für ganz bestimmte Zwecke einzusetzen. Das gilt nicht nur für diejenigen, die tagaus, tagein damit beschäftigt sind, ihre wichtigsten Grundbedürfnisse zu befriedigen, indem sie versuchen, ausreichend Nahrung heranzuschaffen, lebensgefährliche Übergriffe, Bedrohungen und Krankheiten abzuwenden und einen ruhigen Platz zum Schlafen zu finden und vielleicht noch einen Sexualpartner zu gewinnen und eine Familie zu gründen. Das gilt für all jene, die irgendwann in ihrem Leben eine bestimmte Strategie zur Bewältigung ihrer Ängste und zur Aufrechterhaltung ihrer inneren Ordnung gefunden haben. Sie müssen diese gefundene Strategie immer wieder zwanghaft in der gleichen Weise einsetzen, weil sie glauben, dass sich damit alle anderen Probleme ebenfalls lösen lassen. Die dabei in ihrem Hirn aktivierten Verschaltungen werden so immer effizienter verknüpft und gebahnt, bis aus den anfänglichen kleinen „Nervenwegen“ allmählich „feste Straßen“ und schließlich sogar „breite Autobahnen“ entstanden sind. Aus der primären Bewältigungsstrategie ist dann ein eingefahrenes Programm geworden, das das gesamte weitere Denken, Fühlen und Handeln der betreffenden Menschen bestimmt. Zwanghaft sind sie darum bemüht, immer wieder solche Bedingungen zu schaffen und aufrecht zu erhalten, unter denen sie die Zweckmäßigkeit ihrer einmal entwickelten Fähigkeiten unter Beweis stellen können. Solange ihnen das gelingt, werden sie bei der Bewältigung bestimmter Aufgaben immer besser, immer effizienter und immer erfolgreicher. Sie scheitern aber meist kläglich, sobald sich die Verhältnisse ändern und neue Herausforderungen auf sie zukommen, die mit den alten, eingefahrenen Verschaltungsmustern in ihrem Hirn nicht zu bewältigen sind. Auch ein solch einseitig programmiertes, immer auf die gleiche Weise für dieselben Zwecke benutztes Gehirn bleibt eine Kümmerversion dessen, was daraus hätte werden können. Man denke an Computerfreaks, die von Kindesbeinen an so intensiv auf den Tastaturen ihrer PC’s herumgehackt und sich in eigenen Computerwelten bewegt haben, dass sie später als Erwachsene außer Stande sind, ein direktes Gespräch zu führen und sich statt dessen lieber ihrem Blackberry widmen, auch bei Meetings und als Führungskräfte für ihre Mitarbeiter gar nicht mehr „greifbar“ sind. Es gibt mathematische Genies, die außerstande sind, eine Möwe von einer Gans zu unterscheiden und Fußballartisten, die kaum bis drei zählen können. Es gibt Geigenvirtuosen, die weder Schwimmen noch Fahrradfahren und Schachmeister, die weder Singen noch Tanzen können. Es ist also nicht immer von Vorteil, ein Gehirn zu besitzen, dessen endgültige Verschaltungen durch die Art und Weise bestimmt wurden, wie man sein Gehirn benutzt oder zu benutzen gezwungen ist. Was aus unserem plastischen, lernfähigen Gehirn wird, ob wir die in ihm vorhandenen Möglichkeiten zur Ausbildung komplexer Verschaltungsmuster nutzen können, hängt eben Seite 3 von 9 ganz entscheidend von den Bedingungen ab, in die wir hineingeboren wurden und unter denen wir glauben, unser Leben gestalten zu müssen. Wie es Gerald Hüther in seinem sehr lesenswerten Buch „Bedienungsanleitung für ein menschliches Gehirn“ an Beispielen bringt: Wo es nicht genug zu Essen gibt, wo das eigene Leben und das der Familie in der man aufwächst, ständig in Gefahr ist, beschränkt sich jeder Austausch mit anderen Menschen auf das, was zur Überwindung dieser Not beiträgt. Wo Neid und Missgunst herrschen und jeder des anderen Feind ist, kann keine gefühlte Zusammengehörigkeit entwickelt werden. Dann wird jede Form des Austauschs mit anderen Menschen von der Notwendigkeit zur Selbstbehauptung und Selbstdarstellung bestimmt. Nun kann sich aber kein Mensch die Bedingungen aussuchen, unter denen er aufwächst und die ersten wichtigen Erfahrungen macht, die darüber entscheiden, wie und wofür er sein Gehirn benutzt und welche Verschaltungsmuster dort ausgebildet und stabilisiert werden. Was sich in der jüngsten Etappe der Evolution entscheidend verändert hat, waren nicht die zur Ausbildung eines hochkomplexen, vielfach vernetzten und zeitlebens lernfähigen menschlichen Gehirns erforderlichen genetischen Anlagen, sondern die zur Entfaltung dieser Möglichkeiten notwendigen Voraussetzungen. Diese mussten im Verlauf der bisherigen Entwicklungsgeschichte erst allmählich von Generation zu Generation geschaffen und aufrechterhalten werden. Jeder Entwicklungsschritt, jede Entdeckung und jede Erfindung, die die Menschen eines bestimmten Kulturkreises machten, versetzte sie in die Lage, die bisherige Art der Nutzung ihres Gehirns zu erweitern und auszudehnen und in dem Maß, wie sie davon Gebrauch machten, konnten auch die in ihrem Hirn angelegten Verschaltungsmuster zunehmend komplexer ausgeformt werden. Auch heute ist dieser Prozess der fortschreitenden Optimierung unserer eigenen Entwicklungsbedingungen nicht abgeschlossen. Er ist natürlich auch in den verschiedenen Kulturen unterschiedlich schnell abgelaufen und unterschiedlich weit vorangekommen. Auf diese Weise kam es zu einer von Generation zu Generation immer stärken werdenden Kanalisierung der Entwicklungsbedingungen ihrer Nachkommen. Die damit einhergehende Einschränkung der Nutzungsmöglichkeiten des Gehirns dieser Nachkommen begünstigte die Bahnung ganz bestimmter, besonders intensiv genutzter Verschaltungen auf Kosten anderer, weniger häufig aktivierten Nervenzellverbindungen. Der über einige Generationen mit dieser zunehmenden Spezialisierung erzielte Vorteil verwandelte sich jedoch immer dann in einen fatalen Nachteil, wenn sich die äußeren Bedingungen zu verändern begannen und es auf andere Fähigkeiten und Fertigkeiten, Vorstellungen und Handlungskonzepte ankam. Höchst interessant ist in diesem Zusammenhang die Veränderung der Anforderungen an CEO’s in Großunternehmen zu immer mehr technisch versierten Menschen, weg von zum Beispiel Juristen1. Die Bedingungen ändern sich und ändern sich zwangsläufig: Auf der Ebene des Einzelnen schon allein dadurch, dass jeder Mensch älter wird, sich mit anderen austauscht, Erfahrungen hinzugewinnt, aber auch Kompetenzen verliert und neue Lösungen suchen muss. Auf der 1 Wirtschaftswoche, Ausgabe 42 v. 12.10.2009 Seite 4 von 9 Ebene der Familie kommen neue Einflüsse durch den Ehepartner und seiner Familie dazu. Auf der Ebene einzelner Schichten und Gruppierungen entstehen Veränderungen durch die Entwicklung neuer Technologien, die Nutzung neuer Ressourcen und den damit einhergehenden strukturellen Veränderungen innerhalb der Gesellschaft. Auf der Ebene ganzer Kulturen erfolgt eine zunehmende Vermischung durch verstärkten Kontakt, Handel und Austausch mit anderen Kulturen. Wichtig für uns Führungskräfte als Changemanager: Bei aller Komplexität gilt: Die Menschen mit ihrem lernfähigen Gehirn sind in der Lage, ihren Wissensschatz zu erweitern, neue Fähigkeiten zu erwerben und neue Erfahrungen zu machen. Und überall wird dieses Wissen, werden diese Fähigkeiten und Vorstellungen an andere Menschen weitergegeben, von anderen Menschen übernommen und mit anderen Menschen ausgetauscht. Geschah das bisher in der Vergangenheit meist unfreiwillig und unbewusst (Handel, Kriege, Migrationen etc.) lässt sich dieser Prozess der Weitergabe und des Austausches von Informationen zwischen Menschen aus unterschiedlichen Familien, Schichten, Gruppen, Ländern und Kulturen bewusst und gezielt gestalten. Wir sind damit erstmals in der Lage, die bisher noch immer kanalisierend auf die endgültige Nutzung des Gehirns wirkenden Entwicklungs- und Lebensbedingungen gezielt zu erweitern, um auf diese Weise einseitige Bahnungen bestimmter neuraler Verschaltungsmuster in unseren Gehirnen zu verhindern. Es ist also eine ganz gravierende Führungsaufgabe mitzuhelfen, diese einseitigen Programmierungen bei sich und den Mitarbeitern schrittweise zu öffnen, um die genetischen Potenzen zur Ausbildung eines zeitlebens lernfähigen, komplexvernetzten menschlichen Gehirns nutzen zu können, zu einer subtileren Wahrnehmung und Verarbeitung von Veränderungen unserer äußeren Welt und zu immer intensiverem Austausch mit anderen Menschen, zur effizienteren Aufrechterhaltung unserer inneren Welt und nicht zuletzt zur Gestaltung optimaler Entwicklungsbedingungen auch für unsere Kinder. Während man früher annahm, dass sich das Gehirn des Menschen ab dem Zeitpunkt der Geburt kaum noch verändert, dass es sich beim Gehirn um einen relativ statisches Organ handelt, hat man gerade im vergangenen Jahrzehnt – das nicht umsonst „das Jahrzehnt des Gehirns“ genannt wird, folgendes erkannt: Das Gehirn ist nicht statisch, sondern viel mehr äußerst plastisch, d. h. es passt sich den Bedingungen und Gegebenheiten zeitlebens an. Es ist wie wir heute wissen, die Lebenserfahrung eines jeden Menschen, die sein Gehirn zu etwas Einzigartigem macht. Man bezeichnet die Anpassungsvorgänge im zentralen Nervensystem an die Lebenserfahrung eines Organismus ganz allgemein als Neuroplastizität. Man hat inzwischen auch erkannt, dass die Vernetzung der Hirnregionen der entscheidende Faktor für ein spezielles Persönlichkeitsmerkmal ist. Dabei spielen auch der Einfluss der Gene, auf der die Struktur des Gehirns aufbaut und die Vernetzung während der Entwicklung, eine Rolle. Die Hirnforscher waren insgesamt höchst verwundert über das Ausmaß an nutzungsabhängiger Veränderbarkeit des menschlichen Gehirns. Die Erkenntnisse konsequent zu Ende gedacht heißt: unser Gehirn wird so, wie wir es benutzen oder als Führungskräfte es unsere Mitarbeiter benutzen lassen! Seite 5 von 9 Speziell im Führungsbereich und im Changeprozess ist wichtig: Die meisten der Defizite sind durch ständige Wiederholungen einmal eingeschlagen und entweder für richtig erachtet oder als nie ernsthaft hinterfragte Strategien der Wahrnehmung, des Fühlens, Denkens und Handelns fest im Gehirn verankert worden. Eine uralte chinesische Weisheit lautet: Nicht dort, wo du es schon zur Meisterschaft gebracht hast, sollst du dich weiter erproben, sondern dort, wo es dir an solcher Meisterschaft mangelt. Die Weiterentwicklung unserer Gehirne mit denen man sowohl sehen als auch fühlen, sowohl riechen als auch hören, sowohl tanzen als auch musizieren, sowohl rational denken als auch intuitiv etwas spüren kann, ist also eine echte Herausforderung für uns selbst als Führungskräfte und für unsere Mitarbeiter Eine wichtige Gehirnregion dabei ist der Hippocampus, unser „Neuigkeitsdetektor“. Das bedeutet, dass wir die bisher erkannten Führungsmethoden und –stile nochmals gründlich überdenken müssen. Ein neu erkanntes Führungsinstrument, das „Storytelling“, kann dabei sehr hilfreich sein. Einzelheiten machen nur im Zusammenhang Sinn und es ist dieser Zusammenhang und dieser Sinn, der die Einzelheiten interessant macht. Nur dann, wenn Fakten in gewissem Sinn interessant sind, werden sie auch beachtet. Hilfreich bei diesen Erkenntnissen sind die Methoden der Positronen-Emmissons-Tomografie PET und die funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT). Wichtig für mich als Führungskraft ist auch: Die Übertragung eines Nervenimpulses von einem Neuron zum anderen geschieht an einer Synapse. Sie kann mehr oder weniger stark sein und es hängt von der Stärke der synaptischen Verbindung ab, ob ein Impuls einen großen oder einen kleinen Effekt auf die Erregung des nachfolgenden Neurons hat. Der gleiche Impuls kann also an verschiedenen Synapsen ganz unterschiedlich wirken. Ist die synaptische Verbindung stark, wird das nachfolgende Neuron stark erregt, ist die Verbindung schwach, geschieht am nachfolgenden Neuron wenig. Die Information aus diesen Impulsen wird von Neuronen dann wie folgt verarbeitet: Die eingehenden Impulse werden an den Synapsen gewichtet (bewertet), d. h. mehr oder weniger stark übertragen. Je nach Stärke der Übertragung kann der gleiche Input das eine Neuron erregen, das andere jedoch nicht. Da die Neuronen die Eigenschaft besitzen, entweder zu feuern oder nicht, ist ein geringer Effekt identisch damit, dass überhaupt nichts passiert. Das Gehirn besteht also im Wesentlichen aus Nervenzellen sowie aus Faserverbindungen zwischen den Neuronen. Nachdem die bei jedem Menschen anders arbeiten, brauchen wir uns also nicht zu wundern, wenn Informationen unterschiedlich oder auch gar nicht aufgenommen werden. Das bedeutet: Das Gehirn des Menschen wiegt nur zwei Prozent seines Körpergewichts, verarbeitet jedoch ungeheure Mengen an Informationen. Der großen Zahl von Verbindungen des Gehirns mit der Welt steht eine noch größere Zahl innerer Verbindungen gegenüber. Setzt man die Zahl der Verbindungen der Neuronen des Gehirns und der Verbindungen des Gehirns zur Außenwelt ins Verhältnis, so ergibt sich, dass auf jede Faser, die in die Großhirnrinde hineingeht oder sie Seite 6 von 9 verlässt, zehn Millionen interne Verbindungen kommen. Kurz: Wir sind neurobiologisch gesprochen vor allem mit uns selbst beschäftigt. In und mit diesen Verbindungen findet im Gehirn Informationsverarbeitung in Form von Wahrnehmen und Denken statt. Dieses Netzwerk enthält weder Zuordnungsregeln noch Regelvorschriften. Es beherrscht ganz einfach nur die richtige Zuordnung aufgrund der Stärken der richtigen Verbindungen zwischen den Neuronen. Für uns als Sender ist immer ungewiss, was wirklich beim Einzelnen ankommt. Etwas Können steckt also in der Vernetzung der Neuronen und insbesondere in den Stärken der synaptischen Verbindungen der Neuronen. Das Paradoxe – viel Können und wenig Wissen Das bedeutet eine eigenartige Schlussfolgerung, aber es ist dennoch so: Fast alles was wir gelernt haben, wissen wir nicht. Aber wir können es. Warum? Im Vergleich zu unserem Können ist unser Wissen bei Licht betrachtet unglaublich bescheiden. Das bezieht sich nicht nur auf die Sprache, sondern auf die unterschiedlichsten Lebensbereiche. Bei unserem sprachlichen Können wird die Sache besonders augenfällig, denn das Können bezieht sich ja gerade auf die Struktur, in der Wissen allgemein vermittelt wird, nämlich die Sprache. Selbst und gerade im Hinblick auf die Sprache ist das, was wir gelernt haben, nur zu einem ganz kleinen Teil sprachlich (als Wissen) vorhanden. Der größte Teil unserer sprachlichen Kompetenz ist viel mehr in uns gerade nicht sprachlich vorhanden, sondern besteht im Können, nicht aber im Wissen. In anderen Bereichen unserer Kompetenz ist es ohnehin klar – man kann sich den Mantel anziehen und sich den Schuh binden. Wenn wir aber einem außerirdischen Wesen mitteilen wollten, wie wir das genau machen, so würden wir uns ganz schön anstrengen müssen. Das erklärt, weshalb schriftliche logische Anweisungen ebenso wie knappe logische Informationen unsere Mitarbeiter oft gar nicht erreichen. Wir müssen lernen, bildhaft, metaphorisch zu sprechen. Dabei hilft es, das implizite Wissen der Mitarbeiter zu nutzen und für TUN zu sorgen. Man spricht auch vom „Wissen, dass etwas soundso ist“ (explizit) und vom „Wissen, wie etwas geht“ (implizit). Wenn von Wissen allgemein die Rede ist, so sind nicht selten beide Formen des Wissens gemeint. Für den Führungsalltag ist diese Erkenntnis jedoch durchaus hilfreich, wollen wir doch mit unserer Arbeit die benötigten Ergebnisse erzielen. Emotionale Führung Spätestens seit Goleman ist uns allen bewusst, Emotionen spielen beim Führen eine wichtige Rolle. Aber wie genau sieht diese Rolle aus? Was sind Emotionen? Kann man Emotionen überhaupt neurowissenschaftlich untersuchen? Man kann! Das Handicap: Es gibt bis heute keine befriedigende Definition von Emotionen. Gehen wir deshalb von einigen halbwegs akzeptierten Voraussetzungen aus: Emotionen haben eine Stärke (viel/wenig) und eine Valenz (gut – schlecht bzw. positiv - minus negativ), lassen sich also auf mindestens zwei Dimensionen beschreiben. Sie haben einen kognitiven, einen qualitativ/gefühlsmäßigen und einen körperlichen Aspekt. Natürlich müssen wir uns auch bewusst machen, dass die Worte „Gefühl“ und „Emotionen“ in verschiedenen Sprachen (z. B. Deutsch und Englisch) andere Bedeutungshöfe haben und Seite 7 von 9 auch innerhalb unserer Sprache leider uneinheitlich gebraucht werden. Gehen wir hier einfach pragmatisch vor. Aufregung: Dabei sein Akute emotionale Erregung kann dazu führen, dass wir bestimmte Dinge besser behalten, das gilt sowohl im Positiven als auch im Negativen. Wichtig ist immer die Verbindung des Stoffs zu unserer Welt, die nun mal nicht in Schubfächern nach einzelnen Themen eingeteilt ist. Was den Menschen umtreibt, sind nicht Fakten und Daten, sondern Gefühle, Geschichten und vor allem andere Menschen. Wir brauchen also erlebnisreiches Arbeiten: TUN statt sagen FRAGEN, statt sagen Die Amygdala – unsere Mandelkerne Zwei kleine (mandelförmige) Ansammlungen von Neuronen, die tief im Temporalhirn gelegen sind, ganz in der Nähe des vorderen Endes des Hippocampus, tragen dazu bei, dass wir unangenehme Erlebnisse sehr rasch lernen und in Zukunft vermeiden. Es ist der Teil des Gehirns, der bei Stress als biologisch sinnvolle Anpassung an Gefahr im Verzug reagiert. Die Reaktion des Mandelkerns läuft automatisch ab und sichert das Überleben des Organismus. Zum Fürchten lernen, braucht man den Mandelkern Die Mandelkerne tragen dazu bei, dass wir unangenehme Erlebnisse sehr rasch lernen und in Zukunft vermeiden. Diese Angst verändert auch den Geist. Angst produziert einen ganz bestimmten kognitiven Stil, der das rasche Ausführen einfacher gelernter Routinen erleichtert, aber das lockere Assoziieren erschwert. Wer z. B. Prüfungsangst hat, der kommt einfach nicht auf die einfache, aber etwas kreative Lösung, die er ja normalerweise leicht finden würde. Wer unter dauernder Angst lebt, wird sich leicht in seiner Situation „festfahren“, „verrennen“. Der ist „eingeengt“ und kommt aus seinem gedanklichen Käfig nicht heraus. Was bedeutet das für uns als Führungskräfte? Eine positive Grundstimmung ist eine Voraussetzung für eine gute Zusammenarbeit. Eine große Herausforderung in der heutigen Zeit, wo in vielen Unternehmen die Angst ein „Dauerbrenner“ ist. Fazit Emotionen sind nicht die Widersacher des Verstandes. Sie können es aber sein. Hier hat die Neurobiologie der Emotionen im vergangenen Jahrzehnt das Bild der Gefühle als Gegenspieler vernünftigen Erlebens und Verhaltens umgekrempelt und praktisch auf den Kopf gestellt. Emotionen helfen uns beim Zurechtfinden in einer komplizierten und immer komplizierter werdenden Welt. Unser Körper signalisiert Freude oder Unbehagen, lange bevor wir es merken – warum? Er stellt sich auf Extremsituationen sehr rasch ein, wie insbesondere die Stressforschung zeigt. Akuter Stress ist eine biologisch sinnvolle Anpassung an Gefahr im Verzug, während leichter Stress, wahrscheinlich über den Sympatikus vermittelt, zu verbessertem Arbeiten führen kann. Starker und insbesondere chronischer Stress hat negative Auswirkungen auf das Gedächtnis. Seite 8 von 9 Produktives Arbeiten findet statt, wenn positive Erfahrungen gemacht werden. Dabei sind auch positive Sozialkontakte wichtig. Möglichst Arbeit in Gemeinschaft, mit gemeinschaftlichen Aktivitäten bzw. gemeinschaftlichem Handeln. Begegnungen mit Neuem setzt Dopamin frei, Substanz der Neugier und des Suchtverhaltens. Immer dann, wenn der Organismus eine bestimmte Erwartung hat und das Ergebnis des Verhaltens besser ist als die Erwartung, entsteht Spaß an der Arbeit. Eine wichtige Erkenntnis: Motivation lässt sich nicht erzeugen, Menschen sind von Natur aus motiviert, sie können gar nicht anders denn sie haben ein äußerst effektives System hierfür im Gehirn eingebaut. Hätten wir dieses System nicht, dann hätten wir als Spezies gar nicht überlebt. Dieses System ist immer in Aktion, man kann es gar nicht abschalten, es sei denn, man legt sich schlafen (und auch dann können wir ja noch träumen!). Die Frage danach, wie man Menschen motiviert, ist daher in etwa so sinnvoll wie die Frage: Wie erzeugt man Hunger? Die einzig vernünftige Antwort lautet: „Gar nicht, denn er stellt sich von allein ein.“ Vielmehr stellt sich die Frage: „Wie vermeide ich die Demotivationskampagnen?“ Unsere Gesellschaft ist voll davon. Nicht die Leistung und der Einsatz eines Menschen regelt sein Gehalt, sondern der „Angestelltentarif“. Wir verleihen Preise an den Besten (der ja ganz offensichtlich keine Motivationsprobleme hat) und demotivieren alle anderen Bewerber. Preise sollten nie durch Bewerbungsverfahren vergeben werden. Sie sind sonst höchst demotivierend für alle – bis auf einen. Je mehr sich bewerben, desto mehr demotivieren sie. Wenn ich einen heraushebe und lobe, wird dafür gesorgt, dass sich alle anderen nicht so gut fühlen. Sachen, mit denen wir aktiv und mit Spaß umgehen, motivieren von selbst. Bin ich selbst begeistert, überträgt sich meine Begeisterung auf die anderen. Die Person des Führenden ist dessen stärkstes Medium! Als Führungskraft muss ich in der Lage sein, über Sachverhalte interessante Geschichten zu erzählen. Medien sind nur unterstützend. Inzwischen ist ja auch das Storytelling als erfolgreiches Hilfsmittel im Führungsalltag anerkannt. Das setzt voraus, dass ich als Führungskraft im Hier und Jetzt lebe, wahr-nehme, mich in Mitarbeiter einfühlen kann, mir und meiner eigenen Erlebnisse und Gefühle bewusst bin und kreativ mit eigenen Erlebnissen umgehe. Angelika Hamann Seite 9 von 9