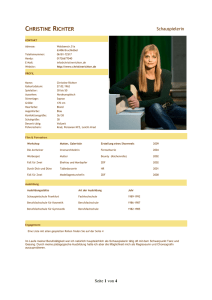Ein Eiermann mit Vergangenheit Mit der Uraufführung des Schanz
Werbung

Ein Eiermann mit Vergangenheit Mit der Uraufführung des Schanz-Stückes „Altensalzkoth“ erinnert das Schlosstheater Celle an Eichmann in der Heide Von Heinrich Thies Für Otto Lindhorst ist es ein bisschen, als blicke er in einen Spiegel und höre sich selbst beim Reden zu. Auf der Bühne nämlich steht ein Bauer wie er und erzählt von einem berühmt-berüchtigten Mann, der sich in der Nachkriegszeit auf seinem Hof einquartiert und Wand an Wand mit ihm gewohnt hat: Adolf Eichmann alias Otto Heninger. Der Organisator des Judenmords lebte von 1946 bis 1950 unerkannt unter falschem Namen in dem Heidedorf Altensalzkoth bei Celle als Waldarbeiter und Hühnerzüchter. Das Schlosstheater Celle hat dieses denkwürdige Geschichtskapitel jetzt auf die Bühne gebracht – mit einem Stück von Peter Schanz, das sich als „Recherche in unserer Nachbarschaft“ versteht. Der erfolgreiche Dramatiker, der gerade mit Stücken über die „Prinzessin von Zelle“ und die Pornokönigin Beate Uhse hervorgetreten ist, lässt Zeitzeugen ebenso zu Wort kommen wie Adolf Eichmann in Gestalt einer lebensgroßen Puppe. Natürlich hat sich Schanz auch mit Otto Lindhorst unterhalten, der noch ein Schuljunge war, als Eichmann in seinem Elternhaus lebte. Der heute Achtzigjährige sitzt mit seiner Frau bei der Uraufführung von „Altensalzkoth“ in der ersten Reihe und lauscht, was sein deutlich jüngeres Ebenbild auf der Bühne, mit einer Einblendung als Otto L. bezeichnet, über den einstigen Mieter erzählt: „Der war ganz hilfsbereit und hat mir immer zurecht geholfen, mit den Maschinen und so… Er konnte immer ganz interessant erzählen und wusste immer alles, was so los war.“ Nur mit der Kirche habe Eichmann nichts am Hut gehabt. Stets habe er gesagt: „Ich verbitte mir, wenn ich mal sterbe, dass da ´n Pfaffe mitläuft.“ Lindhorst fühlt sich korrekt zitiert. „Genauso war das“, sagt der alte Herr nach der Aufführung. „Der war ganz nett.“ Auch seine Frau findet das Stück „wunderbar“. Dieser Ansicht sind aber nicht alle in der Familie. Lindhorsts Nichte fand es so unerträglich, „wie die Dorfbewohner in dem Stück lächerlich gemacht werden“, dass sie herausgelaufen ist. Auch ihre 17-jährige Nichte Pia meint, dass die Leute im Dorf „diskriminiert“ werden. Nicht ganz ohne Grund. Die Frauen mit Kopftuch und Kittelschürze etwa wirken schon ziemlich dusselig. Doch der Skandal bleibt aus. Der Applaus ist laut, anhaltend und von Bravorufen durchsetzt. Dabei verlangt dieses Stück dem Publikum einiges ab. Es erzählt keine Geschichte, sondern dokumentiert Geschichte – auf unterschiedlichen Ebenen und aus wechselnden Perspektiven. Ein Kaleidoskop der Nachkriegszeit aus Sicht der Einheimischen, der „Besatzer“, der entlassenen Häftlinge, der Flüchtlinge. Die Darsteller springen – bravourös – von einer Rolle in die andere, sprechen ins Publikum, sprechen miteinander, durcheinander oder im Chor. Es beginnt mit einem Vorspiel, in dem sich fünf Theaterbesucher über das umgebaute Schlosstheater unterhalten („Ich fand es vorher besser“) und ihre Erwartungen zu dem bevorstehenden Theaterereignis austauschen, das einer schon gleich als „Nazi-Scheiße“ abqualifiziert. Dann wird ein Kiefernwald sichtbar, und die Annäherung an den Kriegsverbrecher in der Heide nimmt ihren Lauf. Während (wie einst Eichmann) jemand im Hintergrund Holz hackt, werden Erinnerungen wach: „Er hatte gute Manieren“, heißt es da. „Er war so tierlieb, so freundlich mit seinen Hühnern…“ Nein, eigentlich kann niemand etwas Schlechtes über den „Eiermann“ sagen, der seine Eier auch an die früheren Lagerinsassen in Bergen-Belsen verkauft haben soll, die noch nach dem Krieg jahrelang als Verschleppte an ihrer Leidensstätte ausharrten. Was die Mitbewohner an Eichmann vor allem schätzten, war seine Musikalität: „Er konnte so zauberhaft Geige spielen.“ Peter Schanz, der sein Stück auch selbst inszeniert hat, gibt dieser Musik breiten Raum. Es sind nicht nur heimattümelnde Weisen wie „Auf der Lüneburger Heide“ oder „Kein schöner Land“, die sich durch das Stück ziehen, sondern auch klassische Stücke von Beethoven und Mozart. Das Verstörende an Eichmann war ja gerade die Verbindung von humanistischer Bildung und der technischen Abwicklung eines beispiellosen Massenmords. Die Musik in „Altensalzkoth“ spielt aber nicht nur für die Täter, sondern verleiht ebenso den Opfern Ausdruck. Die Musiker entlocken ihren Instrumenten auch Kleszmer-Klänge – Ulrich Jokiel mit dem Akkordeon und Johann-Michael Schneider mit der Strohgeige, einer rumänischen Fiedel mit Metalltrichter. Die Inszenierung entwickelt auf diese Weise eine Wärme, die dem Stück emotionale Tiefe verleiht. Besonders bewegend aber wird es, wenn Theatermusiker Jokiel sich in Jacob R. verwandelt und erzählt, wie er als Kind jüdischer Eltern 1948 in Bergen-Belsen geboren wurde und die Spätfolgen des Holocaust mit der Muttermilch aufsog – eine Geschichte, die Parallelen zur Lebensgeschichte des jüdischen Musikers aufweist. „Altensalzkoth“ bleibt nicht in der Vergangenheit. In einem Epilog geht das Stück auch auf die aktuelle Debatte um Straßennamen ein, die an lokale Nazi-Mitläufer erinnern sollten – zum Beispiel an Hanna Fueß, nach der bis 2011 in Celle ein Weg benannt war. Dabei hatte die Löns-Freundin in der Celleschen Zeitung noch in der Nachkriegszeit ausschließlich über die Leiden der Alteingesessenen geschrieben. Es gab Zeiten, da hätte diese Art von Vergangenheitsbewältigung im Schlosstheater Celle heftige Proteste ausgelöst. Dass jetzt der Beifall überwiegt, ist aber wohl nicht nur eine Frage des Inhalts, sondern auch der hervorragenden Ensembleleistung. Weitere Aufführungen um 20 Uhr bis 13. März.

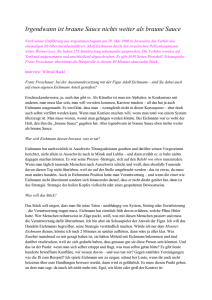




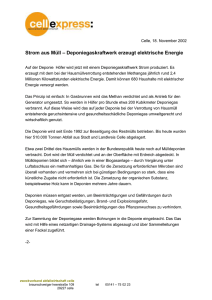
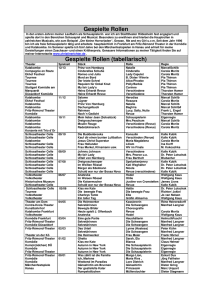
![2014-04-23 Antrag Nachnutzung der Kasern[...]](http://s1.studylibde.com/store/data/007629890_1-c22027f62d7ef4413e0e3984e2e48a3a-300x300.png)