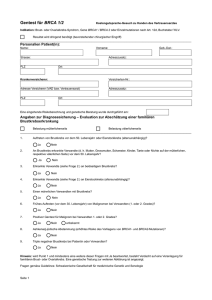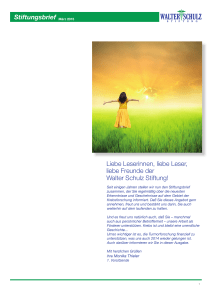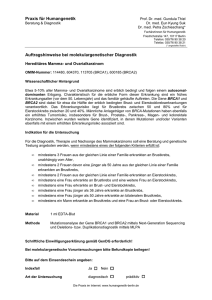Genetische Testung: Fluch oder Segen
Werbung
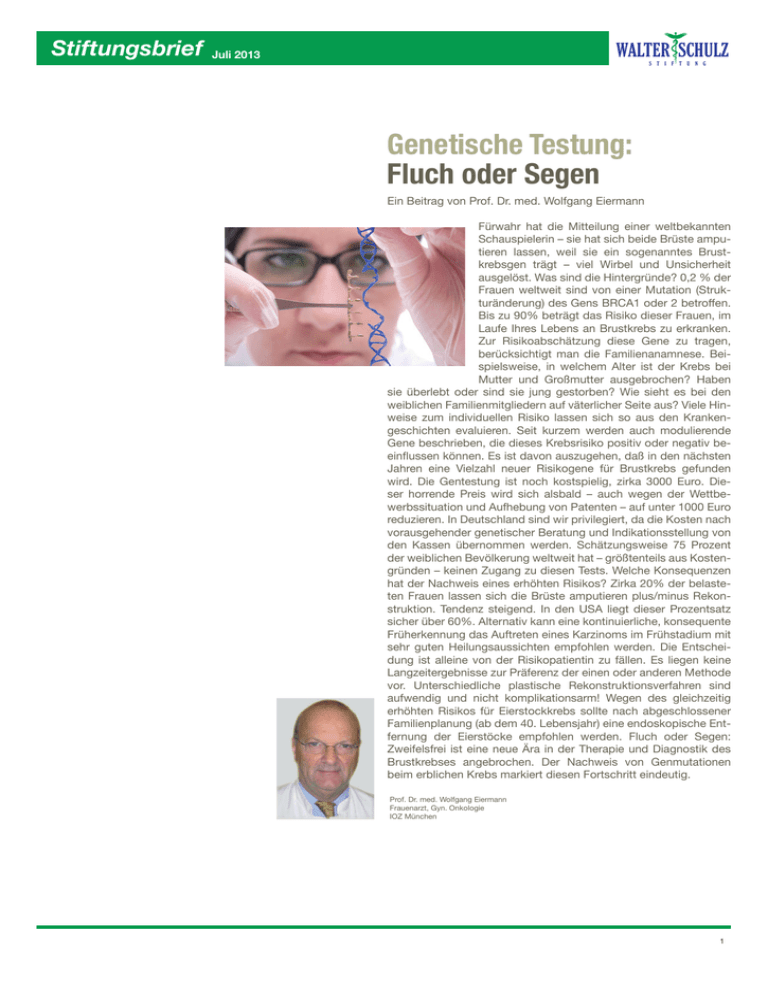
Stiftungsbrief Juli 2013 Genetische Testung: Fluch oder Segen Ein Beitrag von Prof. Dr. med. Wolfgang Eiermann Fürwahr hat die Mitteilung einer weltbekannten Schauspielerin – sie hat sich beide Brüste ampu­ tieren lassen, weil sie ein sogenanntes Brust­ krebsgen trägt – viel Wirbel und Unsicherheit ausgelöst. Was sind die Hintergründe? 0,2 % der Frauen weltweit sind von einer Mutation (Struk­ turänderung) des Gens BRCA1 oder 2 betroffen. Bis zu 90% beträgt das Risiko dieser Frauen, im Laufe Ihres Lebens an Brustkrebs zu erkranken. Zur Risikoabschätzung diese Gene zu tragen, berücksichtigt man die Familienanamnese. Bei­ spielsweise, in welchem Alter ist der Krebs bei Mutter und Großmutter ausgebrochen? Haben sie überlebt oder sind sie jung gestorben? Wie sieht es bei den weiblichen Familienmitgliedern auf väterlicher Seite aus? Viele Hin­ weise zum individuellen Risiko lassen sich so aus den Kranken­ geschichten evaluieren. Seit kurzem werden auch modulierende Gene beschrieben, die dieses Krebsrisiko positiv oder negativ be­ einflussen können. Es ist davon auszugehen, daß in den nächsten Jahren eine Vielzahl neuer Risikogene für Brustkrebs gefunden wird. Die Gentestung ist noch kostspielig, zirka 3000 Euro. Die­ser horrende Preis wird sich alsbald – auch wegen der Wettbe­ werbssituation und Aufhebung von Patenten – auf unter 1000 Euro reduzieren. In Deutschland sind wir privilegiert, da die Kosten nach vorausgehender genetischer Beratung und Indikationsstellung von den Kassen übernommen werden. Schätzungsweise 75 Prozent der weiblichen Bevölkerung weltweit hat – größtenteils aus Kosten­ gründen – keinen Zugang zu diesen Tests. Welche Konsequenzen hat der Nachweis eines erhöhten Risikos? Zirka 20% der belaste­ ten Frauen lassen sich die Brüste amputieren plus/minus Rekon­ struktion. Tendenz steigend. In den USA liegt dieser Prozentsatz sicher über 60%. Alternativ kann eine kontinuierliche, konsequente Früherkennung das Auftreten eines Karzinoms im Frühstadium mit sehr guten Heilungsaussichten empfohlen werden. Die Entschei­ dung ist alleine von der Risikopatientin zu fällen. Es liegen keine Langzeitergebnisse zur Präferenz der einen oder anderen Methode vor. Unterschiedliche plastische Rekonstruktionsverfahren sind aufwendig und nicht komplikationsarm! Wegen des gleichzeitig erhöhten Risikos für Eierstockkrebs sollte nach abgeschlossener Familienplanung (ab dem 40. Lebensjahr) eine endoskopische Ent­ fernung der Eierstöcke empfohlen werden. Fluch oder Segen: Zweifelsfrei ist eine neue Ära in der Therapie und Diagnostik des Brustkrebses angebrochen. Der Nachweis von Genmutationen beim erblichen Krebs markiert diesen Fortschritt eindeutig. Prof. Dr. med. Wolfgang Eiermann Frauenarzt, Gyn. Onkologie IOZ München 1 Stiftungsbrief Juli 2013 Gene und Umwelt wirken bei Brustkrebs gemeinsam Drei Faktoren spielen bei der Entstehung von Brustkrebs eine Rolle: die Gene, die Umwelt und das persönliche Verhalten. Daß genetische und umweltbedingte Risiken dabei in Wechselwirkung treten, ermittelte jetzt erstmals die Arbeitsgruppe Genetische Epidemiologe am Deutschen Krebsforschungszentrum um Profes­ sorin Jenny Chang-Claude. Dafür stellte sie die Ergebnisse von 24 internationalen Studien mit mehr als 34.000 Brustkrebspatientin­ nen und 41.000 gesunden Frauen zusammen. Die nur für fünf Pro­ zent der Frauen gefährlichen Hochrisikogene BRCA1 und BRCA2 erhöhen das Risiko um das Zehnfache. Die Erbgutvergleiche zeig­ ten außerdem, daß 20 genetische Varianten das Brustkrebsrisiko moderat beeinflussen. Zu den Umwelt- und Verhaltenseinflüssen zählen das Alter bei der ersten Regelblutung, Anzahl der Gebur­ ten, Dauer des Stillens, Gewicht, Größe, Hormoneinnahme zur Empfängnisverhütung oder in der Menopause, Genuß von Alkohol, Rauchen und körperliche Aktivi­ tät. So erhöhten mehr als 20 Gramm Alkohol am Tag das Risiko bei der genetischen Variante CASP8 um 45 Prozent, vier und mehr Kinder bei der genetischen Variante LSP1 um 26 Prozent, obwohl normalerweise mehrere Geburten das Brustkrebsrisiko senken. In einer weiteren Untersu­ chung von mehr als 70 For­ schungseinrichtungen wurden 49 neue genetische Risikofaktoren für Brustkrebs und acht für Eier­ stockkrebs identifiziert. Sie kom­ men in der deutschen Bevöl­ kerung häufig vor und bedeuten jeweils Risikoänderungen zwi­ schen 3 und 30 Prozent, so daß sich die Zahl bekannter geneti­ scher Faktoren für diese häufigen Tumorerkrankungen verdoppelte. Wie sie mit Umweltfaktoren zu­ sammenhängen, wird jetzt er­ forscht. 2 Stiftungsbrief Juli 2013 Krebskranke erhalten kaum Opiate Die AOK Hessen stellte in einer Versichertenstichprobe fest, daß 77 Prozent der mit stärksten Schmerzmitteln behandelten Patien­ ten chronische Schmerzpatienten sind und nicht, wie vermutet, Tumorpatienten. Die Medizinische Hochschule Hannover spricht von einem „alarmierenden Trend“ von Fehlversorgung. Eine Kölner Forschungsgruppe dokumentiert mit dem Universitätsklinikum Dresden, daß immer mehr hochpotente Opioide verordnet werden und länger behandelt wird. Doch eine länger als drei Monate dau­ ernde Behandung von nicht tumorbedingten Schmerzen führe zu keiner bleibenden Linderung. Bei chronischen Schmerzen würde oft das Zusammenwirken von biologischen, psychischen und sozi­ alen Faktoren übersehen. Hingegen habe jeder zweite Krebskranke in seinem letzten Lebensjahr keine Opioide erhalten, von einer angemessenen Behandlung könne also keine Rede sein. Metastasen-Stammzellen bei Brustkrebs entdeckt Erstmals wurden Krebszellen im Blut von Brustkrebspatientinnen entdeckt, die Metastasen auslösen können. Eine große Anzahl deutet auf einen ungünstigeren Krankheitsverlauf hin, so daß die Wissenschaftler vom Deutschen Krebsforschungszentrum von Biomarkern sprechen. Einzelne abgesiedelte Krebszellen, die in der Blutbahn zirkulieren, sind verantwortlich für die Entstehung von Metastasen und Hauptursache für die Krebssterblichkeit. Diese Metastasen-Stammzellen lassen sich an drei Molekülen erkennen: Sie tragen ein typisches Eiweiß auf ihrer Oberfläche, das der Zelle hilft, sich im Knochenmark festzusetzen. Ein Signalmolekül schützt vor Angriffen des Immunsystems. Ein Oberflächenrezeptor steigert die Wanderbereitschaft und Invasionsfähigkeit der Zellen. Der Stammzellexperte Prof. Andreas Trumpp sieht in der Entdeckung einen vielversprechenden Bio­ marker für den Verlauf von me­ tastasierendem Brustkrebs, vor allem aber neue therapeutische Ansätze für fortgeschrittenen Brustkrebs. Gegen zwei der Moleküle wurden bereits Anti­ körper entwickelt, die ihre Funktion blockieren. Eine Sub­ stanz, die den Rezeptor hemmt, zeigt schon gute Wirkung bei einer bestimmten Form von Lungenkrebs. Der Wirkstoff kann möglicherweise auch bei Brustkrebsmetastasen helfen. 3 Stiftungsbrief Juli 2013 Es fehlt an Nachsorge Mit der überstandenen Krebserkrankung kann der Patient nicht nahtlos sein vorheriges Leben wieder aufnehmen. Die Onkologin Georgia Schilling vom Hubertus-Wald-Tumorzentrum der Universi­ tätsklinik Hamburg-Eppendorf beobachtete mittel- und langfristige Folgen. Über Gesundheitsprobleme klagen 53 Prozent der Lang­ zeitüberlebenden, 49 Prozent über nichtmedizinische. Die Zellgifte aus Chemotherapien können Herz, Lunge, Niere, Magen und Darm, das Hormonsystem angreifen. Die Nebenwirkungen der neuen bio­ logischen Therapien, die die Krebstherapie zu einer chronischen Behandlung werden lassen, sind noch zu wenig untersucht. Die Strahlenbehandlung kann zur vorzeitigen Menopause, Sterilität, Osteoporose, Knochen- und Phantomschmerzen, Mißempfindun­ gen oder chronischer Müdigkeit führen. Die ständige Angst vor einem Rückfall löst psychosoziale Schwierigkeiten bis zur Berufs­ unfähigkeit oder Depressionen aus. Oft wird die gesamte Lebens­ planung in Frage gestellt. Allerdings stellte die Onkologin auch fest, daß viele der Langzeit­ überlebenden ihr Gesundheitsverhalten nicht geändert haben. 58 Prozent sind übergewichtig, 23 Prozent rauchen weiterhin, 82 Prozent essen nicht die empfohlenen Mengen an Obst und Gemüse, nur jeder Zweite treibt regelmäßig Sport. Die amerikanische Krebsgesell­ schaft sieht es als dringend notwendig an, eine umfassen­ de Nachsorge zu entwickeln, bei der derartige Erfahrungen einbezogen werden und die nicht nur regelmäßige Blut- und bildgebende Untersuchungen umfassen. Bestrahlung während der Operation Bestrahlung während der Entfernung eines Brustkrebstumors wird von 55 Brustzentren als Standardtherapie angeboten, darunter auch vom Klinikum Höchst in Zusammenarbeit mit dem Nordwest­ krankenhaus in Frankfurt am Main. Diese Bestrahlung eines Tumor­ herdes bis maximal 3,5 Zentimeter mit einem mobilen Miniaturrönt­ genbeschleuniger ist gezielter, effektiver und schonender als die bisherigen Bestrahlungen nach der Operation. Wenn das um den Tumor liegende Brustgewebe umgehend 15 bis 40 Minuten lang bestrahlt wird, verkürzt sich die Behandlungsdauer um gut eine Woche, das Risiko eines Rückfalls wird halbiert. Und die Methode kann nach einem Rückfall erneut angewandt werden. 4 Stiftungsbrief Juli 2013 Narkosen haben Einfluß auf Krebstherapie Der Narkosearzt kann Einfluß auf die Krebstherapie nehmen, verlautete bei der Jahrestagung der Anästhesisten in Nürnberg. Narkotika zum Inhalieren verringern oder unterdrücken die natürli­ chen Killerzellen gegen die im Blut wandernden Tumorzellen, von denen weitere durch die Operation in die Blutbahn geschwemmt werden. Um das dringend benötigte Abwehrsystem zu schonen, sollte der Anästhesist lokale Betäubungen anwenden. Dazu eignet sich der Epiduralkatheter im Rückenmark, der wie bei der Geburts­ hilfe Nervenleitungen in ausgewählten Körpersegmenten blockiert. Bestimmte Lokalnarkosemittel können bei Lungenkrebs das Anwachsen von Metastasen blockieren. Welche Wirkungen die Narkose und die Gabe verschiedener Medikamente auf das Tumor­ wachstum haben, wird gegenwärtig in Studien ermittelt. Daß Brust­ krebspatientinnen erheblich länger leben, wenn sie Betablocker zur Blutdrucksenkung nehmen, ist bereits erwiesen. Rauchen ... ... im Auto ist mit mitfahrenden Kindern bisher in Kanada, Australi­ en, einigen amerikanischen Staaten und – einzig in Europa – in Griechenland verboten. Die britische Fachzeitschrift „Tobacco Control“ veröffentlichte eine Studie über die auf dem Rücksitz ge­ messenen Feinstaubkonzentrationen. Danach sind sie zehnmal so hoch wie in Nichtraucherautos, selbst bei Lüften, Durchzug und geöffneten Fenstern wurden die von der Weltgesundheitsorganisa­ tion festgelegten Maximalwerte überschritten. Kinder, vor allem im Sicherheitssitz, sind dem Rauch besonders ausgesetzt, weil sie eine schnellere Atmung haben. ... in der Schwangerschaft kann noch die Enkel belasten. Das briti­ sche Forschungsjournal „Biomed Central“ berichtet von Tierversu­ chen an einem kalifornischen Institut, nach denen das durch Niko­ tin entwickelte Asthma ins Genom geschrieben und an die Nach­ kommen weitergegeben wird. Bei der Befragung von Kindern ergab sich, daß sie doppelt so häufig Asthma bekamen, wenn ihre Groß­ mütter in der Schwangerschaft geraucht hatten. 5 Stiftungsbrief Juli 2013 Screening-Programm soll mehr Sicherheit bringen Das Mammographie-Screening, die Röntgenuntersuchung der weiblichen Brust, ist seit 2005 zu einer regelmäßigen Früherken­ nungsmaßnahme geworden. Dazu fordern die Krankenkassen alle zwei Jahre Frauen zwischen 50 und 69 Jahren auf; bei jüngeren Frauen fallen wegen der Gewebedichte die Ergebnisse zu oft falsch positiv aus. Die Statistik hat errechnet, daß eine von 200 Frauen dadurch vor dem Krebstod gerettet werden kann, doch erst Lang­ zeituntersuchungen bringen mehr Klarheit. Die bisher gründlich­ sten Daten liegen vom größten deutschen Bundesland, NordrheinWestfalen, vor. Danach wurden 78 Prozent der Krebsfälle entdeckt, doch hatten trotz eines negativen Ergebnisses weitere 22 Prozent der Frauen vor dem nächsten Screening einen positiven Befund. Dieses sogenannte Intervallkarzinom entspricht, wie das Deutsche Ärzteblatt berichtet, den Zahlen in anderen europäischen Ländern. Erklärt wird dieser meist durch Selbst­ untersuchung entdeckte Tumor damit, daß er erst nach dem Screening aufge­ treten und rasant gewachsen ist, daß minimale Anzeichen nicht wahrgenom­ men oder als gutartig eingestuft worden sind oder daß eine empfohlene an­ schließende Gewebeprüfung nicht oder fehlerhaft gemacht wurde. Daß es sich in Nordrhein-Westfalen bei den Inter­ vallkarzinomen zu 44 Prozent um große Tumoren handelte, weist auf die Entste­ hung zwischen zwei Screenings hin. Um das Screening-Programm zu ver­ bessern, müßte die Anonymität der Krebsregister aufgehoben werden, da­ mit die Screening-Ergebnisse mit den Röntgenaufnahmen des Intervallkarzi­ noms verglichen werden können. Gentest könnte Krebsbehandlung verbessern Forscher der Universität Cambridge haben bei der Untersuchung von 30 Frauen mit fortgeschrittenem Brustkrebs charakteristische Veränderungen der von den Tumorzellen freigesetzten DNA festge­ stellt. Der eindeutige Unterschied zwischen Tumor- und normalen Zellen des Körpers könnte als Indiz für die Wirkung einer Therapie gelten. Die Forscher hoffen, mit größeren Studien die genetische Information für eine effektivere Krebsbehandlung liefern zu können. (Quelle: New England Journal of Medicine) 6 Stiftungsbrief Juli 2013 Verlorene Lebensjahre durch Krebs Die International Agency for Research on Cancer in Lyon hat er­ rechnet, daß der Menschheit im Jahr 170 Millionen Lebensjahre durch den vorzeitigen Tod durch Krebs oder die extreme Beein­ trächtigung der Lebensqualität verlorengehen. Der Krebs von Darm, Lunge, Brust und Prostata hat einen Anteil bis zu 50 Prozent, ein Viertel wird von Tumoren durch Infektionen verursacht. Darmspiegelungen als sichere Vorsorgemethode Beim Darmkrebs hat das Wort Vorsorge im Gegensatz zu anderen Krebsarten seine Berechtigung, weil sich mit einer Darmspiegelung etwa die Hälfte aller Neuerkrankungen und Sterbefälle vermeiden läßt. Nach der aktuellen Studie des Deutschen Krebsforschungs­ zentrums nimmt nur ein Fünftel der Berechtigten die seit 2002 für Versicherte ab 55 Jahren angebotene Früherkennungsmöglichkeit wahr, dabei lassen sich aber gerade bei der Koloskopie noch wäh­ rend der Untersuchung Vorstufen gut entdecken und entfernen. Befürchtete Verletzungen bei der Untersuchung sind äußerst selten und oft verursacht durch einen großen Polypen, andere Vorfälle sind nicht häufiger als bei anderen gesundheitlichen Kontrollen. In Deutschland erkranken jährlich etwa 65.000 Menschen an der für beide Geschlechter zweithäufigsten Krebsart, 2010 starben 26.000 Menschen an Darmkrebs. Bei jedem Dritten wurde bei der Spiege­ lung ein Polyp entdeckt, bei jedem vierten Mann handelte es sich um ein für die Krebsentstehung verantwortliches Adenom. Bei Frauen fanden sich nur in 16 Prozent der Fälle Adenome, Männer profitieren also noch stärker von der Koloskopie. 7 Stiftungsbrief Juli 2013 Risiko für Brustkrebs läßt sich reduzieren Brustkrebs ist der häufigste Krebs der Frau, rund 70.000 Frauen erhalten jährlich diese Diagnose. Von ihnen tragen aber nur fünf bis zehn Prozent die erbliche Veranlagung zu dieser Krankheit. Die amerikanische Professorin Mary-Claire King von der Universität Washington entdeckte die Brustkrebsgene BRCA1 und BRCA2, das Risiko für ihre Trägerinnen ist von 24 Prozent vor 1940 auf heu­ te 60 bis 80 Prozent gestiegen. Als Gründe nennt King hauptsäch­ lich Gewichtszunahme und Bewegungsmangel, hinzu kommen ein hormonelles Ungleichgewicht, Rauchen und fettreiche Ernährung. In Deutschland gibt es 15 Zentren für familiären Brust- und Eier­ stockkrebs, wo sich Frauen ausführlich beraten lassen können. Ob sie sich bei genetischer Vorbelastung für die Entfernung des Brust­ drüsengewebes und der Eierstöcke entscheiden, ist eine individu­ elle Entscheidung. In jedem Fall müssen sich die betroffenen Frau­ en mit den Möglichkeiten der Früherkennung, regelmäßige gynäko­ logische Untersuchungen, Ultraschall, Mammografie, Kernspinto­ mografie, regelmäßig betreuen lassen. Der überwiegende Teil der Brustkrebsfälle ist jedoch nicht erblich bedingt und wird als syste­ mische Erkrankung angesehen, bei der verschiedene Organe betroffen sind. Der Umweltmediziner Klaus-Dietrich Runow gilt als Pionier der Umweltmedizin in Deutschland und gründete 1985 das IFU (Institut für Functional Medicine & Umweltkrankheiten). Er ver­ tritt in seinem gerade erschienenen Buch „Krebs – eine Umwelt­ krankheit?“ die Meinung, daß wir zum großen Teil das Krebsrisiko selbst reduzieren können. Verhaltensänderungen bei Ernährung, Nährstoffversorgung, Umweltbelastung und körperlicher Aktivität könnten zwei Drittel aller Krebserkrankungen vermeiden. (Informationen bei: BRCA Netzwerk e.V. unter www.brca-netzwerk.de mit Liste der 15 Zentren für familiären Brust- und Eierstockkrebs) Impressum: Walter Schulz Stiftung Gemeinnützige Stiftung zur Förderung der medizinischen Krebsforschung Verwaltungssitz Fraunhoferstraße 8, 82152 Planegg/Martinsried Tel.: +49 (89) 76 70 35 06 Fax: +49 (89) 76 69 25 E-Mail: [email protected] www.walter-schulz-stiftung.de Jede Spende zählt! Wenn Sie die Arbeit unserer Stiftung unterstützen möchten: Unser Spendenkonto Raiffeisenbank München-Süd Kto.-Nr. 100 21 75 06 BLZ 701 694 66 Wir freuen uns sehr über Ihre Hilfe! Vorstand Monika Thieler (1. Vorsitzende) Prof. Dr. med. Wolfgang Eiermann Otto Schwarz Prof. Dr. med. Heinz Höfler (Vors. Wiss. Beirat) Verantwortlich für den Inhalt: Walter Schulz Stiftung Pressestelle: WWS!werbe.de, Renate Schnell 60599 Frankfurt/Main, Gemündener Straße 26 Fon +49 (69) 96 74 15 55, Fax +49 (69) 96 74 15 56 E-Mail: [email protected] 8