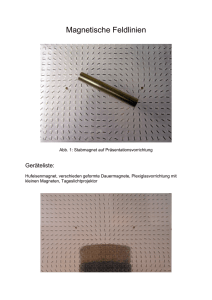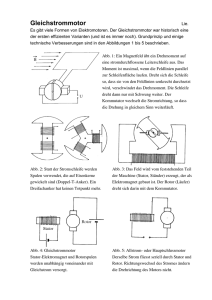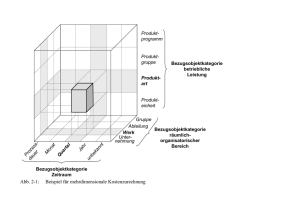Krankheitsbewältigung bei neuroimmunologischen
Werbung

Krankheitsbewältigung bei neuroimmunologischen Erkrankungen Heinz Weiß Meine sehr geehrten Damen und Herren, als ich eingeladen wurde, einen Beitrag zum diesjährigen Rheinfelder Symposium „Psychosomatik und Neurowissenschaften“ beizusteuern, hatte ich zunächst daran gedacht, einen Überblick über die neurologische Psychosomatik als ganze zu geben. Dies wäre auch aus historischen Gründen reizvoll gewesen. Denn Psychoanalyse und Psychosomatik haben ihre Wurzeln ja in der Neurologie. Dann erschien mir dieses Thema aber doch zu umfassend und ich entschloß mich, mich auf ein Teilgebiet Darstellungen zur zu beschränken, neurologischen welches in Psychosomatik einschlägigen oft nicht die Berücksichtigung findet, die ihm im klinischen alltag zweifellos zukommt – nämlich auf Fragen der Krankheitsverarbeitung und der Krankheitsbewältigung. Wir haben hierzu in den letzten Jahren eine Reihe von Forschungen durchgeführt. Bevor ich aber auf diese Ergebnisse – speziell zur Krankheitsverarbeitung bei neuroimmunologischen Erkrankungen wie der Multiplen Sklerose, der Myasthenia gravis oder dem Guillain-Barré-Syndrom zu sprechen komme, möchte ich doch einige allgemeine Überlegungen zur Psychosomatik in der Neurologie anstellen. Dabei verstehe ich die neurologische Psychosomatik nicht als Randbereich zur Differentialdiagnose und Psychotherapie einiger „psychogener“ Krankheitsbilder wie etwa der Konversionsstörungen oder 1 der funktionellen Syndrome, sondern als Teil der Neurologie. Tatsächlich liegen ja gerade bei den letztgenannten Krankheitsbildern gar nicht so selten zusätzliche organische Krankheitsbefunde vor, um die herum sich der „psychogene“ Anteil der Erkrankung organisiert - und werden umgekehrt organische neurologische Erkrankungen oft so weit von psychischen Belastungen überlagert, daß der limitierende Faktor in der Behandlung oftmals nicht in den somatischen Behandlungs- möglichkeiten, sondern in der Compliance und Krankheitsbewältigung des Patienten liegt. Deswegen handelt mein heutiger Beitrag von psychosomatischen Aspekten neurologischer Erkrankungen und nicht von psychogenen Erkrankungen in der Neurologie. Und aus dem gleichen Grund möchte Forschungsergebnisse ich zur Ihnen heute auch vorwiegend Krankheitsverarbeitung bei neuroimmunologischen Erkrankungen vorstellen und nicht so sehr theoretische Überlegungen zur Psychodynamik und Psychotherapie. Eine Schwierigkeit der Integration einer psychosomatische Betrachtungsweisen in die somatische Medizin liegt ja manchmal darin, daß diese - wie ich meine oft zu unrecht - mit den somatischen Fächern um die „richtige“ Ätiologie, das „umfassendere“ Krankheitsverständnis, die „bessere“ Therapie u.s.w. konkurriert. Ich halte diese Abgrenzungen für wenig fruchtbar und denke im Gegenteil, daß somatische Behandlung und Psychotherapie ihre Möglichkeiten nur dann voll ausschöpfen können, wenn sie sich gegenseitig ergänzen und eng miteinander kooperieren. Dann erschließt sich in der Tat ein breites Feld von Indikationen, bei denen psychosomatische Interventionsmöglichkeiten die neurologische Diagnostik und Therapie sinnvoll ergänzen und begleiten können (Abb. 1). 2 Abb . 1 Die Konversionssyndrome und die funktionellen Störungen in der Neurologie habe ich bereits erwähnt. Diese umfassen bekanntlich ein weites Spektrum, welches von der psychogenen Lähmung über komplexe dissoziative Störungen, wie psychogene Anfälle, amnestische Syndrome bis hin zum psychogenen Schwindel oder chronischen Schmerzsyndromen, reichen kann. Hier kommt es darauf an, psychosomatische Überlegungen frühzeitig in die Diagnostik und Therapie miteinzubeziehen; denn wir wissen, wie schnell diese Krankheitsbilder chronifizieren und wie leicht es gerade hier auch iatrogen zu einer Verstärkung Krankheitsvorstellungen Untersuchung an 53 kommen Patienten und Fixierung kann. mit In einer an bestimmte retrospektiven psychosomatischen und psychoneurotischen Krankheitsbildern, die Reimer und Mitarbeiter 1979 publizierten, betrug die durchschnittliche Dauer vom Symptombeginn bis zur ersten psychosomatischen Konsultation bei Frauen 7,5 Jahre. Besonders ausgeprägt waren diagnostischer Delay undinadäquate Vorbehandlung, wenn die Patienten somatoforme Beschwerden präsentierten. Wenn Sie bedenken, dass die meisten Patienten in diesem Zeitraum kaum symptomfrei waren, immer wieder neuer Diagnostik und erfolglosen Behandlungsversuchen unterzogen wurden, so wird die sozioökonomische Bedeutung dieses Problems sofort deutlich. Oft sind dann beim ersten psychosomatischen Kontakt die Krankheitsvorstellungen und Lebensumstände (z.B. durch Berentung, Tranquilizer- oder Schmerzmittelabusus) bereits so fixiert, dass es außerordentlich schwierig ist, diese Patienten für ein psychosomatisches Behandlungsangebot zu gewinnen. Oft fühlen sie sich durch eine 3 psychosomatische Sichtweise gekränkt, verletzt, mit ihren körperlichen Symptomen nicht ernst genommenen, so dass ein großer Teil der Bemühungen zunächst darauf gerichtet sein muss, eine Vertrauensbeziehung herzustellen. Dies wird am ehesten gelingen, wenn man auch den somatischen Beschwerdeanteil ernst nimmt und die Ängste und subjektiven Erklärungsmodelle der Patienten zunächst einmal als solche akzeptiert. Die Situation wird weiter kompliziert, wenn Medikamentenabusus, Rückzugstendenzen, fixierende Lebensumstände oder komorbide Persönlichkeitsstörungen hinzukommen. Dann haben wir es mit dem Vollbild des „schwierigen Patienten“ zu tun, der die ArztPatientbeziehung häufig abbricht und immer wieder in einen Zyklus von unrealistischer Hoffnung, Enttäuschung und kränkender Zurückweisung gerät. In anderen Fällen stellt sich die Situation jedoch einfacher dar und es gelingt relativ schnell, eine Schwindelsymptomatik mit einer Selbstwertkrise, ein Schwächegefühl mit einer Depression oder eine Schmerzsymptomatik mit einem unerträglichen inneren Spannungszustand in Verbindung zu bringen. Immerhin stellen diese Patienten nicht nur für den Neurologen, sondern auch für uns als Psychosomatiker eine Herausforderung dar, und lassen sich Fortschritte oft nur dann erzielen, wenn es gelingt, gemeinsam eine längerfristige Behandlungsperspektive zu vermitteln. In einer Untersuchung an 70 konsekutiven Patienten, die wir im Rahmen des psychosomatischen Konsiliardienstes an der Würzburger Neurologischen Universitätsklinik sahen (Schubert 2001), konnten wir diesen klinischen Eindruck bestätigen (Abb. 2): Abb. 2 4 Etwa ein Drittel dieser Patienten erhielt jeweils die Diagnose einer somatoformen Störung oder einer Anpassungsstörung bei neurologischer Grunderkrankung, wie z.B. einer Multiplen Sklerose oder einer Myasthenie. Bei 21% wurde eine Konversions- bzw. dissoziative Störung diagnostiziert. 11% erhielten eine andere psychische Erstdiagnose, wie z.B. eine dysthyme Störung. Vergleicht man nun die drei drei Hauptdiagnosegruppen in Hinblick auf die Einschätzung der Motivation, der globalen Prognose und der Qualität der therapeutischen Arbeitsbeziehung durch psychotherapeutisch erfahrene Untersucher, so ergeben sich signifikant günstigere Werte für Patienten mit Anpassunsgstörung bei neurologischer Grunderkrankung gegenüber bei den somatoformen bzw. dissoziativen Störungen. Es sind also die gleichen Patienten, die Neurologen und Psychosomatiker im klinischen Umgang als „schwierig“ erleben. Ich möchte mich nun im Folgenden vor allem der dritten Patientengruppe zuwenden, jenen Patienten mit zugrunde liegender neurologischer Erkrankung und zusätzlichen psychischen Problemen - nicht weil diese Patienten „leichter“ zu behandeln sind, sondern weil ich glaube, dass es sich hierbei um eine große, klinisch relevante Patientengruppe handelt, welche von der Psychosomatik bislang eher vernachlässigt wurde. Tatsächlich haben wir es hier aber mit einer Vielzahl von verschiedenen, z.T. komplexen psychischen Krankheits-bildern zu tun, deren adäquate Diagnose und psychotherapeutische Mitbehandlung eine Verbesserung nicht nur der psychischen Situation, sondern auch der Lebensqualität und des Umgangs mit der neurologischen Erkrankung verspricht. Ein Beispiel hierfür wären etwa die posttraumatischen Belastungsstörungen nach vorausgegangener neurologischer Erkrankung: So 5 behandelte ich vor einiger Zeit gemeinsam mit den neurologischen Kollegen eine 54jährige, sehr jugendlich wirkende Patientin, bei der aus völliger Gesundheit heraus ein Kleinhirninsult, glücklicherweise ohne wesentliche neurologische neurologischer Behandlung und einer Residuen, kardiologischer aufgetreten Abklärung, Hypercholesterinämie und war. Nach Marcumarisierung, entsprechenden Verlaufskontrollen entwickelte die Patientin rasch das Vollbild einer posttraumatischen Belastungsstörung: Sie kam in ihrem Denken von dem bedrohlichen Ereignis nicht mehr los, fürchtete dessen Wiederkehr, vor der sie sich durch zwanghafte Selbstbeobachtung zu schützen suchte. Jede Unregelmäßigkeit ihres Herzschlags, jeder kurze Schwindel löste Panik in ihr aus. Sie zog sich immer mehr in die häusliche Umgebung zurück, konnte aus Angst vor einer Wiederholung des Ereignisses nicht mehr einschlafen. Nachts traten Alpträume auf, in denen sie vom Rettungswagen abgeholt werden mußte. Gleichzeitig versuchte sie das Ausmaß ihrer Ängste vor ihrem Ehemann und den Kindern herunterzuspielen, um diese nicht zu beunruhigen. Die Vorstellung, in einer Situation, in der sie nicht gerettet werden könnte, einen erneuten Schlaganfall zu erleiden, führte dazu, daß sie das Haus nur noch zu einigen wenigen Besorgungen verließ, große Teile des Stadtgebiets mied, nicht mehr Auto fuhr, eine Agoraphobie und schließlich depressive Symptome entwickelte, so daß sie immer häufiger Tranquilizer einnahm, sich von Freundinnen und Bekannten zurückzog, was wiederum das Ausmaß ihrer ängstlichen Selbstbeobachtung erhöhte. Im Verlauf einer Psychotherapie, die sich anfangs in wöchentlicher Frequenz über den Zeitraum von einem Jahr hinzog, gelang es der Patientin, ihre Angstsymptome schrittweise zu überwinden. Dabei spielte die Bearbeitung ihres Vermeidungsverhaltens, von Konflikten, die innerhalb der Familie aufgetreten waren, aber auch von biographischen Hintergründen, wie dem Schlaganfall ihrer Mutter, 6 die lange in einem tetraplegischen Zustand pflegebedürftig war, eine wichtige Rolle. Am Ende ihrer Psychotherapie konnte die Patientin wieder ein normales Leben führen, was, wie ich meine, auch damit zusammenhing, daß die psychische Problematik neurologischerseits so rasch identifiziert und in die Behandlungsplanung miteinbezogen worden war. Nicht immer jedoch stellt sich die Situation so erfreulich dar. In vielen Fällen wird den psychischen Problemen in Zusammenhang mit schweren körperlichen Erkrankungen nicht die nötige Beachtung geschenkt, und auch die psychosomatische Forschung hat erst in den letzten Jahren damit begonnen, den posttraumatischen Belastungsstörungen im Kontext schwerwiegender Erkrankungen oder einschneidender Behandlungsmaßnahmen ihre Aufmerksamkeit zuzuwenden. In anderen Fällen erfordert die Situation eine Beurteilung komplexer Zusammenhänge, wenn etwa am Zustandekommen einer Depression organische Veränderungen, maladaptive Bewältigungsstrategien, komorbide Persönlichkeitsmerkmale und psychosoziale Belastungen beteiligt sind. Ein Beispiel wäre etwa die Depression nach Schlaganfall. Ein weiteres Beispiel ist die Multiple Sklerose, bei der psychische Belastungen von der Bewältigung der Diagnosemitteilung bis hin zur Akzeptanz krankheitsbedingter Einschränkungen im Zusammenspiel mit der Persönlichkeit des jeweiligen Patienten eine wichtige Rolle spielen. Ich möchte dies kurz am Beispiel einer 49jährigen Multiple SklerosePatientin illustrieren, die die Praxis einer Allgemeinärztin aufsuchte: Diese Patientin, von Beruf Chefsekretärin, fiel vor allem durch ihr perfektes Auftreten und ihr makelloses Äußeres auf. Über Jahre hinweg 7 war sie nur gelegentlich in der Praxis aufgetaucht, um sich Rezepte für Antazida abzuholen. Erst als sie wegen einer Fußverletzung vorstellig wurde, fiel auf, dass sich die Patientin weigerte, sich zur körperlichen Untersuchung auszuziehen. Die niedergelassene Kollegin, die aus diesem Grund nicht einmal ein EKG ableiten konnte, fand in einer Reihe von Gesprächen, zu denen die Patientin zunächst nur widerwillig und höchst misstrauisch erschien, dass sie seit zehn Jahren an einer Multiplen Sklerose litt. Gleichzeitig mit der Diagnose der Erkrankung hatte sie zuhause alle Spiegel entfernt bzw. zugehängt, weil sie es nicht mehr ertragen konnte, ihr eigenes Bild zu sehen. Alle Schübe - oder vermeintlichen Schübe – des im großen und ganzen sehr benignen Krankheitsverlaufs hatte sie selbst mit Kortikoiden behandelt, die sie sich heimlich von einer asthmakranken Freundin besorgte. Nur wegen der Nebenwirkungen hatte sie sich in der Praxis Antazida geholt. Vor einem halben Jahr nun hatte diese Patientin einen Knoten in ihrer linken Brust bemerkt. Widerum löste dieses Ereignis solch katastrophale Angst in ihr aus, dass sie sich mit dieser Realität nicht auseinandersetzen konnte. Seither behielt sie denselben Büstenhalter tag und Nacht, sogar beim Duschen und Baden, an. Hinterher trocknete sie ihn auf der Haut mit einem Fön. Der Büstenhalter – wie auch das Verhängen der Spiegel – diente hier als Container für eine katastrophale Realität, eine Realität, die mit solcher Vernichtungsangst verbunden war, dass das Abnehmen der Schutzschicht – ähnlich dem Bersten einer schützenden Hülle – mit massiver Verfolgungs- und Fragmentierungsangst verbunden war. Charakteristisch für die Borderline-Organisation dieser Patientin war der Umstand, dass ein anderer Teil ihrer Persönlichkeit geradezu perfekt an die Realität angepasst war. Durch die Untersuchung und die Gespräche mit der Ärztin drohte diese Spaltung zusammenzubrechen. Für uns alle überraschend gelang es ihr dann doch, eine Beziehung zu 8 dieser Kollegin aufzubauen. Nach einem halben Jahr regelmäßiger Gespräche ließ sie sich schließlich untersuchen und befindet sich mittlerweile mit einem neuen Schub ihrer Erkrankung in neurologischer Behandlung. Der Knoten in der Brust hat sich aber als ein Produkt ihrer Phantasie herausgestellt. In diesem Fall war die Anerkennung der Realität von Krankheit und Beeinträchtigung mit solch massiver Angst verbunden, dass sie nur notdürftig verklebt oder omnipotent verleugnet werden konnte – und somit auch lange Zeit keine adäquate medizinische Behandlung zustande kam. Fehl- und Missrepräsentationen der Erkrankungssituation scheinen nach unserer Erfahrung bei MS-Patienten gerade in der frühen Erkrankungsphase durchaus eine Rolle zu spielen. Sie haben möglicherweise – wie im beschriebenen Fall – mit der Abwehr von Bedrohungsgefühlen und depressiven Ängsten zu tun, von denen sich manche Patienten überwältigt fühlen. Andererseits können depressive Zustände bei Multiple SklerosePatienten auch direkt mit den immunologischen Veränderungen in Verbindung stehen. So wurden die hohe Prävalenz depressiver Syndrome (in neueren Untersuchungen 30-45%; Abb. 3) und die gegen- Abb. 3 über vergleichbaren Altersgruppen um das Doppelte bis 7,5fache erhöhten Suizidraten bei MS-Patienten (Sadovnick et al. 1991 [hier war 9 Suizid die dritthäufigtse Todesursache unter 3126 MS-Patienten: 18 v. 119 Sterbefällen mit bek. Todesursache = 15,1%; Stenager et al. 1992) häufig direkt mit den entzündlichen ZNS-Veränderungen bzw. den dadurch bedingten kognitiven Defiziten in Zusammenhang gebracht (Dalos et al. 1983, Schiffer u. Babigian 1984; Schiffer 1987, Callanan et al. 1989, Jennekens-Schinkel et al. 1990, 1990, Feinstein et al. 1993, zus. Strenge 1994). Demgegenüber haben andere Autoren auf die Bedeutung reaktiver Komponenten und die Bedeutung von Krankheitsbewältigungsprozessen aufmerksam gemacht (Seidler 1985; Görres et al. 1988) und auf die Bedrohung des Selbstbildes, der psychosozialen Identität sowie Verlustängste hingewiesen. McIvor und Mitarbeiter (1984) konnten an 120 Patienten mit spinaler klinischer Manifestation zeigen, daß die Ausprägung einer Depression in hohem Ausmaß von der psychosozialen Unterstützung durch Familienmitglieder und Freunde abhängig ist. Und auch neuere Arbeiten (Muthny et al. 1992a) legen nahe, daß Lebensqualität und emotionales Befinden vor allem in der Frühphase Krankheitsbewältigungsprozesse einer und MS psychosoziale eng an Unterstützung gebunden sind. Offenbar ist Depressivität im Verlauf einer Multiplen Sklerose sehr differenziert zu bewerten, wobei prämorbide Persönlichkeitsmerkmale, psychosoziale Belastungen, Bewältigungsstrategien, krankheitsbedingte Medikamentennebenwirkungen jeweils ZNS-Veränderungen in unterschiedlicher und Weise miteinander interagieren (Abb. 4): Abb. 4 10 In einer eigenen retrospektiven Untersuchung an 109 Patienten (Holler 1996) war negative emotionale Befindlichkeit sogar signifikant mit eher kürzerer Krankheitsdauer (< 2 Jahre) und niedrigem EDSS-Score (> 3) korreliert - auch dies ein Hinweis dafür, daß vor allem jüngere Patienten in der Zeit nach Diagnosestellung durch die Ungewißheit über den weiteren Krankheitsverlauf und die Verunsicherung ihrer psychosozialen Identität besonders belastet sind. In einer weiteren Untersuchung haben wir prospektiv den Verlauf von Krankheitsverarbeitung, Depressivität und einigen immunologischen Parametern in den ersten 12 Monaten nach Diagnosestellung bzw. nach einem akuten Schub überprüft (Kahl et al. 2001). Dabei zeigte sich eine deutliche Abnahme der Depressivität im Verlauf des ersten Behandlungsjahres (Abb. 5) Abb. 5 Hierin spiegeln sich offenbar sowohl Behandlungseffekte wie auch die Stabilisierung von Bewältigungsmustern nach der initialen Reaktion auf die Diagnosemitteilung wider. Interessanterweise waren unter den immunologicschen Parametern die Werte für TNF-α zu jedem einzelnen Untersuchungszeitpunkt signifikant mit den BDI-Summenscores korreliert (Abb. 6 u. 7.) Abb. 6 u. 7 11 In einer weiteren Fragestellung beschäftigten wir uns mit den subjektiven Überzeugungen der Patienten, was mögliche Ursachen ihrer Erkrankung anbelangt (Weiß 1997). Wie wir heute wissen, können solche „subjektive Theorien“ relativ unabhängig von den „objektiven“ Informationen über die medizinischen Krankheitsursachen gebildet werden und oft auch parallel zu diesen weiterbestehen (vgl. Riehl-Emde et al. 1989, Faller 1990, 1993, 1998, Muthny et al. 1992, Küchenhoff u. Mathes 1994). Für die Krankheitsbewältigung wie auch für die daraus abgeleiteten Verhaltensweisen, wie z.B. die Inanspruchnahme paramedizinischer Behandlungsangebote, kommt ihnen eine wichtige Bedeutung zu. In einer Untersuchung an 71 MS-Patienten fanden sich bei etwas mehr als der Hälfte solche subjektive Vorstellungen zu möglichen Krankheitsursachen (Mehl et al. 1998; Mehl 2001; Abb. 8). Abb. 8 Diese reichten von Veranlagung, Umweltfaktoren wie Amalgam bis hin zu persönlichem Stress, belastenden Kindheitserlebnissen und Schuldvorstellungen. Vergleicht man nun die Patienten mit und ohne Krankheitsursachenvorstellungen (Abb. 9), so finden sich bei den ersteren häufiger die Angabe einer belastenden Situation am Krankheitsbeginn sowie höhere Depressionswerte. Abb. 9 12 Noch deutlicher wird dieser Unterschied, wenn man die subjektiven Ursachenvorstellungen nach extern-körperlichen und intern-psychischen wie persönlicher Stress, Sorgen und Ängste, schlechte Kindheit etc. gruppiert (Abb. 10) Abb. 10 Letztere Untergruppe zeigt im Vergleich eindeutig die höchsten Depressionswerte (Abb. 11) Abb. 11 Man ist deshalb zu der Vorstellung gelangt, daß subjektive Krankheitstheorien weniger als Indikatoren für eine psychosomatische Krankheitsentstehung als vielmehr als Hinweise auf eine depressive Krankheitsverarbeitung zu verstehen sind. Sie stellen gewissermaßen eine Art von „Hadern“ mit dem Schicksal dar (Faller 1993, 1998, S. 50 ff.) - ein Befund, der bei verschiedenen anderen Krankheitsbilder ähnlich darstellt. Wir haben die gleiche Frage bei Patienten nach Erstdiagnose einer Myasthenia gravis untersucht (Knieling et al. 1995). Auch hier sah ein gutes Drittel (35%) von 46 Myastheniepatienten in einem relativ kurzen 13 Zeitraum (< 1 Jahr) nach Diagnosestellung subjektiv einen Zusammenhang zwischen psychosozialen Belastungsfaktoren und dem Erkrankungsbeginn. Diese Patientengruppe blieb über die weiteren Untersuchungszeitpunkte nach 6 bzw. 18 Monaten stabil. Im Vergleich zu jenen 65%, die kein subjektives psychosoziales Erklärungsmodell bildeten, erschienen diese Patienten testpsychologisch anfangs depressiver, erregbarer, in ihrem Köreprerleben stärker verunsichert und auch weniger sozial orientiert. Krankheitsdependente Variablen wie Schweregrad, hingegen Myasthenietyp keinen Einfluß oder auf Medikamentendosierung die Bildung einer hatten subjektiven Krankheitstheorie. Im weiteren Verlauf bildeten sich die Unterschiede zwischen den Vergleichsgrppen jedoch zurück und nach 1 1/2 Jahren erschienen Patienten mit psychosozialem Erklärungsmodell sowohl in der Selbsteinschätzung der Krankheitsbewältigung wie auch in der Fremdbeurteilung durch psychotherapeutisch erfahrene Untersucher tendenziell sogar etwas weniger depressiv (Abb. 12 u. 13) Abb. 12 u. 13 Möglicherweise Erklärungsmodells läßt also sich die zunächst Bildung als eines Ausdruck psychoszialen einer stärkeren psychischen Vulnerabilität verstehen. Im weiteren Verlauf könnte die subjektive Theorie aber durchaus dazu beitragen, die Krankheitserfahrung sinnvoll in den Lebenskontext zu integrieren und damit auch weitere Bewältigungsschritte zu ermöglichen. 14 Andererseits sind es gerade jene Patienten mit leichten, generalisierten myasthenen Symptomen und depressiven Zügen, die ihre Krankheitserscheinungen mit psychischen Belastungen in Zusammenhang bringen, welche häufig Anlaß zu diagnostischen Fehleinschätzungen geben. Wurde bei den von uns untersuchten Patienten primär eine psychische Störung vermutet, so betrug der Zeitraum bis zur richtigen Diagnosestellung 46 satt 11 Monate (Schalke et al. 1993; Abb. 14) Abb. 14 Hier handelt es sich um das gleiche Phänomen, wie ich es eingangs bei den funktionellen Syndromen beschrieben habe, allerdings mit dem Unterschied, daß in diesem Fall eine psychische Diagnose (bis hin zu kontraindizierten Behandlungversuchen mit Benzodiazepinen u.s.w.) die Diagnose der somatischen Erkrankung erschwert. Wie wichtig andererseits gerade die Mitbehandlung der psychischen Belastungen für die Vermeidung krisenhafter Verschlechterungen und die Optimierung der Interventionsmöglichkeiten medikamentösen ist, wird durch und die chirurgischen Einschätzung der behandelnden Neurologen selbst nahegelegt. Wir führten hierzu eine Fragebogenuntersuchung an 200 Myastheniepatienten durch (Möhler 1998, Abb. 15). Ab. 15 15 Die behandelnden Neurologen diagnostizierten in der Hälfte der Fälle emotionale Unausgeglichenheit, bei 43 % klinische Depressivität. Bei 28% vermuteten sie eine psychogene Überlagerung der myasthenen Symptome, bei 20% bzw. 29% Aggravations- oder Dissimulationstendenzen sowie bei 24% Über- oder Unterdosierung der Cholinesterasehemmer. Krankheitsadaptation und Compliance waren eng mit den Merkmalen emotionale Stabilität und Abwesenheit depressiver Symptome korreliert (Abb. 16-20). Abb. 16-20 Darüber hinaus fanden sich Zusammenhänge zwischen der Qualität der Arzt-Patienten-Beziehung, emotionaler Stabilität (Ärzteeinschätzung) sowie Lebenszufriedenheit in der Selbsteinschätzung der Patienten (FPISkala). Unter den krankheitsdependenten Variablen war Depressivität vor allem mit Generalisierung und aktueller Krankheitsschwere (Myasthenie-Score n. Besinger u. Toyka) korreliert. Hinsichtlich der Compliance und compliance-bezogener Bewältigungs-strategien zeigte sich eine relativ gute Übereinstimmung zwischen der Ärztebeurteilung und der Selbsteinschätzung der Patienten (Sixt 1997). Alle diese Befunde geben einen Hinweis darauf, wie eng körperliche Erkrankung, psychisches Befinden, Krankheitsbewältigung und Arzt-Patient- Beziehung miteinander verbunden sind. Ich möchte dies abschließend noch an einem Krankheitsbild der neurologischen Intensivmedizin aufzeigen, welches häufig mit einer psychischen Extrembelastung einhergeht - dem akuten Guillain-Barré16 Syndrom. Wir haben hierzu seit 1990 systematisch Untersuchungen an intensivbehandelten Patienten mit Guillain-Barré-Syndrom durchgeführt. Wie Ihnen bekannt ist, geht diese durch zelluläre und humorale Mechanismen vermittelte Autoimmunerkrankung des peripheren Nervensystems häufig mit aufsteigenden Lähmungen, Sensibilitätsstörungen sowie unter Umständen lebensbedrohlichen Störungen des vegetativen Nervensystems einher. Sind die Lähmungen sehr ausgeprägt, ergibt sich die Notwendigkeit zu maschineller Beatmung und liegen gleichzeitig multiple Hirnnervenausfälle vor, so befindet sich der Patient bis zur allmählichen Rückbildung der neurologischen Ausfälle oft wochenlang in einem Zustand extremer Deprivation. Funktionell liegt ein peripheres Locked-in-Syndrom mit weitgehender Einschränkung aller Bewegungs- und Verständigungsmöglichkeiten vor. Ausgehend von Beobachtungen, daß es in diesem Zustand der Hilflosigkeit und des Ausgeschlossenseins von aktiver Kommunikation oft zu schweren psychischen Veränderungen kommt (vgl. zus. bei Lauter 1997), kontaktierten wir diese Patienten während des gesamten stationären Behandlungsverlaufs im Abstand von wenigen Tagen, wobei wir versuchten, unter Ausnutzung minimaler motorischer Restfunktionen und durch Einsatz entsprechender Kommunikationstechniken etwas über das Krankheitserleben und die Krankheitsverarbeitung in dieser Extremsituation zu erfahren (Abb. 21). Abb. 21 17 Parallel wurden auch die behandelnden Ärzte, das Pflegepersonal und die Angehörigen der Patienten kontinuierlich befragt, um deren Einschätzung der psychischen Situation des Patienten kennenzulernen. Dabei zeigte sich, daß fast alle Patienten, die an ausgeprägteren Lähmungen litten, zunächst über eine Zunahme von Träumen berichteten, die in ihrer Intensität oft als unheimlich-wirklich beschrieben wurden und in einigen Fällen von der Realität kaum zu unterscheiden waren. Oft war diese Krankheitsphase mit massiven Ängsten verbunden, die von Angst, keine Luft zu bekommen, Ungewißheit über den weiteren Verlauf, verzweifelter Angst, sich nicht mitteilen zu können, bis hin zu wahnhaften Verarbeitungsformen reichten (Abb. 22). Abb. 22 84% erlebten während des stationären Aufenthaltes ausgeprägte Ängste, 71% zeigten depressive Symptome, und fast jeder fünfte Patient hatte vorübergehend jede Hoffnung auf Besserung verloren. Während der maximalen Ausprägung der neurologischen Symptome fanden wir bei 23,1% der 52 Patienten produktiv-psychotische Symptome wie Halluzinationen und Wahnbildungen, darunter in sieben Fällen (13,5%) oneiroide Psychosen i.S. länger andauernder traumartiger, szenisch gestalteter Psychosen. Wie die nachfolgende Abbildung (Abb. 23) zeigt, war das Auftreten psychotischer Symptome eng mit dem Schweregrad der neurologischen Ausfallserscheinungen, insbesondere dem Vorliegen einer schweren 18 Tetraparese (KG < 2), multiplen Hirnnervenfunktionsausfällen und maschineller Beatmung assoziiert, so daß wir sie am ehesten als Ausdruck des Deprivationseffektes verstehen. Dabei erwies sich die Kombination von Tetraparese und maschineller Beatmung als bester Prädiktor. Lagen zusätzlich multiple Hirnnervenfunktionsausfälle vor, so lag die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten psychotischer Symptome bei fast 85%. Abb. 23 Daneben zeigte auch die Höhe der Liquoreiweißkonzentration einen signifikanten Zusammenhang mit dem Auftreten psychotischer Symptome (Abb. 24): Abb. 24 Bei allen Patienten mit einer maximalen Liquorproteinkonzentration von mehr als 400mg/dl traten psychotische Symptome auf, was für die mögliche zusätzliche Bedeutung einer Schrankenstörung bzw. proinflammatorischer Cytokine spricht. Kontrollierte man allerdings den klinischen Schweregrad in der multivarianten Statistik, so erwies sich dieser Zusammenhang nur noch als tendenziell signifikant. Kraniale Computer- und Kernspintomographien, die bei 24 von 52 Patienten - darunter sieben psychotische Patienten - durchgeführt 19 wurde, zeigten dagegen keinerlei Hinweise auf das Vorliegen struktureller entzündlicher ZNS-Läsionen. Ich möchte nun abschließend noch etwas ausführlicher auf die Krankheitsbewältigung und das Traumerleben dieser Patienten eingehen. Wie bereits erwähnt, befanden sich die am schwersten betroffenen Patienten ja in einem Zustand, in dem sie sich weder bewegen noch aktiv kommunizieren konnten. In dieser extremen Deprivation kann das Träumen als ein konstruktiver Versuch verstanden werden, mit dem Verlust der Kommunikations- und Bewegungsmöglichkeiten fertigzuwerden und die damit verbundenen emotionalen Erfahrungen zu symbolisieren. Betrachten wir die Träume inhaltsanalytisch (Abb. 25), so finden wir in der Tat in der Phase zunehmender und maximaler neurologischer Symptomausprägung ein Überwiegen von Flucht- und Katastrophenszenarien, während kompensatorische Traumbilder - wie z.B. Traumszenen, in denen der Patient wieder gehen kann oder bei seinen Angehörigen zuhause ist vermehrt erst in der Rückbildungsphase auftreten. Abb. 25 Das intensive Träumen läßt sich somit als ein Versuch der Repräsentation der Krankheitssituation und damit auch einer Ersetzung der fehlenden äußeren Kommunikation durch ein In-Beziehung-Treten mit Bildern der inneren Welt verstehen. Dadurch wird es dem Patienten möglich, die Erfahrung von Ohnmacht und Beziehungslosigkeit bis zu einem gewissen Grad zu bearbeiten. Gelingt es jedoch nicht, die alptraumhafte Situation auf solche Weise in Traumbilder zu trans20 formieren, so entwickeln sich möglicherweise jene Derealisationszustände, Wahnideen und produktiv-psychotischen Phänomene, wie wir sie bei einem Teil der Patienten beobachten konnten. Eine besonders interessante Situation stellt dabei die Ausbildung eines Oneiroids dar, wie wir es vor allem bei den am schwersten betroffenen Patienten feststellen konnten. Diese Patienten gerieten entweder über ein mit Panik verbundenes psychotisches Zwischenstadium oder direkt über vermehrtes Träumen in einen Zustand hinein, in dem sie trotz fehelender medikamentöser Sedierung wie „weggetreten“ erschienen und für uns praktisch nicht mehr erreichbar waren. Oneiroide Psychosen wurden bei Guillain-Barré-Patienten wiederholt beschrieben (vgl. Schmidt-Degenhard 1992). Sie lassen sich wie ein langer Traum während des Wachzustandes verstehen, den der Patient mit absoluter sinnlicher Gewißheit erlebt. Im Gegensatz zu einzelnen Halluzinationen sind die oneiroiden Erfahrungen szenisch strukturiert, und anders als im Wahn wird halluzinativ eine neue Wirklichkeit kreiert und nicht nur die vorhandene Realität falsch interpretiert. Nach unserer Auffassung kristallisiert sich das oneiroide Erleben aus Erfahrungen im Grenzbereich von Wachen, Halluzinieren und Träumen (vgl. Meltzer 1983) beschrieb. In der imaginären Welt des Oneiroids erlebten die Patienten Erfahrungen, die teilweise mit Erleichterung, teilweise aber auch mit Angst und Bedrohung verbunden waren: Die genauere Betrachtung der oneiroiden Psychose zeigt allerdings, daß auch hier der Kontakt mit der Wirklichkeit nie ganz aufgehoben war: So erlebte sich ein 23jähriger Patient, während er panplegisch und maschinell beatmet auf der Intensivstation lag, als Mitarbeiter auf einem großen Landgut, dessen Besitzer der Chefarzt war. Er fuhr mit dem Auto durch die Stadt, wurde aber immer wieder von Frauen - den Kranken21 schwestern - angehalten, die ihn auszogen und wuschen. In einem anderen Bild spazierte er durch eine morgendliche Parklandschaft, stolperte dabei über einen herumliegenden Ast und entdeckte entsetzt, daß er den Schlauch der Beatmungsmaschine abgerissen hatte... Ein anderer Patient projizierte im Zustand der oneiroiden Psychose Panik und Bedrohung in seine Besucher, während er sich selbst durch die Maschinen, an die er angeschlossen war, in absoluter Sicherheit wähnte. In seinem oneiroiden Erleben mußten die Besucher durch einen engen Schlauch kriechen, um auf die Intensivstation zu gelangen, und drohten dabei zu ersticken. Die Plasmapheresebehandlung erlebte er so, daß er seinem Bruder Blut spendete und ihm damit das Leben rettete ... Versucht man das Oneiroid unter der Perspektive der Modellbildung zu verstehen, so könnte man sagen, daß die oneiroide Welt einen Ort relativer Sicherheit bietet, an den sich der Patient zurückziehen und an dem er psychisch überleben kann. Ganz offenkundig haben wir es beim Oneiroid mit einem psychotischen Zustand zu tun - jedoch mit einem Zustand, der den Patienten bis zu einem gewissen Grad vor weiterer Desintegration und Fragmentierung schützt. Es handelt sich hier um ein ähnliches Phänomen, wie wir es von gewissen akuten psychotischen Zuständen kennen, bei denen es zu einer vorüber-gehenden Entlastung von unerträglicher Angst kommen kann, sobald sich aus dem Chaos psychotischen Erlebens ein Wahn konturiert. Andererseits bleibt dem Patienten aber auch der Kontakt mit depressiven Gefühlen der Ohnmacht, der Abhängigkeit und Ausweglosigkeit erspart. In seinem Buch Psychic Retreats hat der britische Psychoanalytiker J. Steiner (1993) solche hochorganisierte seelische Rückzugszustände 22 beschrieben. Ein Aspekt dieser komplexen Rückzugs-Organisation besteht darin, daß sie es unterschiedlichen Versionen der Wirklichkeit erlaubt, scheinbar widerspruchslos zu koexistieren. Ein anderer Aspekt ist darin zu sehen, daß ein „Psychic Retreat“ sowohl vor psychotischer Fragmentierung wie auch vor dem Überwältigtwerden durch depressive Gefühle bis zu einem gewissen Grad Schutz gewährt (Abb. 26). Abb. 26 Natürlich sind solche Zustände nur selten stabil und ständig vom Zusammenbruch in die eine oder andere Richtung bedroht. Wir haben bei unseren oneiroiden Patienten beide Phänomene beobachtet: Meist war das Ende des Oneiroids mit intensiver Verzweiflung und depressiven Gefühlen verbunden. Manchmal existierte das Oneiroid aber auch noch eine Zeit lang neben der Realität her oder kehrte als Residualwahn vorübergehend zurück, was meist mit intensiver Verfolgungsangst verbunden war. Gerade in dieser Phase des Übergangs erwies sich ein enger Kontakt mit dem Patienten als besonders wichtig, um seine Angst und Verzweiflung durchzuarbeiten und ihm zu ermöglichen, mit verschiedenen Aspekten der Realität und seiner Umgebung in Beziehung zu treten. Welche Rolle spielt in dieser Situation der Kontakt mit der Umgebung der Intensivstation? Ist der Patient überhaupt noch in der Lage, mit anderen in Beziehung zu treten und deren Zuwendung zu registrieren? Erstaunlicherweise besonderer Weise scheinen auf den Guillain-Barré-Patienten emotionalen Kontakt sogar mit in nahen Bezugspersonen angewiesen zu sein. Fragt man die Patienten nämlich, 23 was ihnen bei der Bewältigung ihrer Extremsituation am meisten geholfen hat (Abb. 27), so stehen regelmäßige Besuche durch ihre Angehörigen sowie ein Gefühl der Sicherheit, das ihnen die Umgebung der Intensivstation vermittelt, an erster Stelle. Abb. 27 Wie aber stellt sich umgekehrt die psychische Situation des Patienten aus der Sicht der am Behandlungsprozeß Beteiligten dar? Wir sind dieser Fragestellung im Sinne eines Mehrebenenansatzes anhand eines Fragebogens nachgegangen, mit dessen Hilfe Ärzte, Angehörige und Pflegepersonal kontinuierlich über den gesamten Behandlungszeitraum hinweg den psychischen Zustand der Patienten einschätzten (vgl. Kohler 1999). Aus den 14 parallelisierten Items dieses Fragebogens wurden zwei Faktoren „Hoffnung“ und „Anspannung“ gebildet und sowohl für das Stadium der Zunahme und maximalen Symptomausprägung wie auch während der Rückbildungsphase für die drei Beobachterebenen getrennt berechnet (Abb. 28 u. 29). Abb. 28, 29 Dabei zeigte sich, daß die Angehörigen ihren schwer erkrankten Familienmitgliedern im Vergleich zum Pflegepersonal und zu den behandelnden Ärzten durchweg mehr Hoffnung zuschrieben. Dieser Unterschied war varianzanalytisch - unabhängig vom klinischen Schweregrad - in beiden Krankheitsphasen signifikant, während sich in 24 Hinblick auf die Skala „Anspannung“ keine Unterschiede zwischen den drei Beurteilerebenen ergaben. Interessanterweise nahmen die Angehörigen die Patienten während der Rückbildungsphase auch als weniger ängstlich, interessierter an der Umgebung und weniger belastend im Umgang wahr (Abb. 30). Abb. 30 Wenn wir diese Befunde in Zusammenhang mit dem Umstand sehen, daß die Patienten selbst oft völlig hoffnungslos waren, aber gerade im Kontakt mit den Angehörigen die wichtigste Unterstützung sahen, so könnte man vermuten, daß diese Unterstützung auch darauf beruht, daß die Angehörigen im Vergleich zu Pflegepersonal und behandelnden Ärzten in ihre schwer erkrankten Familienmitglieder mehr eigene Hoffnung projizieren. Dies macht sie möglicherweise zu „Hoffnungsträgern“ in einem Zustand, in dem der Patient selbst kaum noch kommunizieren kann und, wie wir wissen, zeitweilig jede Hoffnung verliert. Für die psychische Unterstützung des schwer erkrankten Guillain-Barré-Patienten kommt deshalb - neben psychopharmakologischen Maßnahmen - v.a. dem Aufrechterhalten der Kommunikation eine besondere Bedeutung zu. Hierbei kann der enge Kontakt mit Angehörigen, die für den Patienten einen Teil seiner vertrauten Lebenswelt repräsentieren, eine wichtige Hilfe sein. So sehr die Hoffnung, die Angehörige dem Patienten vermitteln können, für diesen von entscheidender Bedeutung ist, so sehr muß man allerdings auch sehen, daß deren Einschätzung zum Teil auf Projektion beruht und insofern unrealistisch ist. Auch für die Angehörigen stellt nämlich die Erkrankungssituation eine erhebliche psychische Belastung dar, so daß 25 sie vor Überforderung geschützt werden müssen und oft selbst psychosozialer Unterstützung bedürfen. Ich möchte damit meine Ausführungen abschließen. Sie konnten nur einen kleinen Teil des Themas „Psychosomatische Aspekte neurologischer Erkrankungen“. Sicher sind dabei vor allem die klassischen psychosomatischen Krankheitsbilder in der Neurologie dabei zu kurz gekommen. Ich wollte aber zum Ausdruck bringen, daß Psychosomatik in der Neurologie mehr umfaßt als Differentialdiagnose und Psychotherapie einiger spezieller Krankheitsbilder, sondern überall dort sinnvoll zum Tragen kommt, wo Krankheitsbewältigungs-prozesse mit über Therapie, Verlauf und Lebensqualität entscheiden. 26 Literatur Callanan, M., Logsdail, S., Ron, M., Warrington, E. K. (1989), Cognitive impairment in patients with clinically isolated lesions of the type seen in multiple sclerosis. A psychometric and MRI study. Brain, 112, 361-374. Dalos, N. P., Rabins, P. V., Brooks, B. R., O’Donnel P. (1983), Disease activitiy and emotional state in multiple sclerosis. Ann. Neurol. 13, 573-577. Faller, H. (1990), Subjektive Krankheitstheorien, Coping und Abwehr - Konzeptuelle Überlegungen und empirische Befunde, in: Muthny, F. A. (Hg.), Krankheitsverarbeitung. Berlin, Heidelberg: Springer. Faller, H. (1993), Subjektive Krankheitstheorien: Determinanten oder Epiphänomene der Krankheitsverarbeitung? Zschr. Psychosom. Med. 39, 356 - 374. Faller, H. (1998), Krankheitsverarbeitung bei Krebskranken. Göttingen, Bern, Toronto, Seattle: Hogrefe. Feinstein, A., Ron, M., Thompson, A. (1993), A serial study of psychometric and magnetic resonance imaging changes in multiple sclerosis. Brain 116, 569-602. Görres, H. J., Ziegler, G., Friedrich, H., Lücke, G. (1988), Krankheit und Bedrohung. Formen psychosozialer Bewältigung der Multiplen Sklerose. Z. Psychosom. Med. 34, 274-290. Holler, M. (1996), Untersuchung zur emotionalen Befindlichkeit bei Multiple SklerosePatienten. Psychol. Diplomarbeit, Philosophische Fakultät III, Univ. Würzburg. Jennekens-Schinkel, A., Laboyrie, P., Lanser, J., van der Velde, E. A. (1990), Cognition in patients with multiple sclerosis. After four years. J. Neurol. Sci. 99, 229-247. Kahl, K. G., Kruse, N., Faller, H., Weiß, H. (2001), Expression of tumor necrosis factor-α and interfernon-γ m RNA in blood cells correlates with depression, scores in patients with multiple sclerosis (unveröffentl. Manuskript). Knieling, J., Weiß, H., Faller, H., Lang, H. (1995), Psychosoziale Kausalattribution bei Myasthenia-gravis-Patienten. Eine Längsschnittstudie zur Bedeutung subjektiver Krankheitstheorien nach Diagnosestellung und im weiteren Verlauf. Psychother. Psychosom. med. Psychol. 45, 373-380. Kohler, J. (1999), Mehrebeneneinschätzung zur Krankheitsbewältigung von Intensivpatienten mit Guillain-Barré-Syndrom. Eine vergleichende Untersuchung an Angehörigen, Pflegepersonal und behandelnden Ärzten. Med. Dissert. Univ. Würzburg. Küchenhoff, I., Mathes, L. (1994), Die mediale Funktion subjektiver Krankheitstheorien. Eine Studie zur Verbindung qualitativer und quantitativer Methoden, in: Faller, H., Frommer, I. (Hg.), Qualitative 27 Psychotherapieforschung. Grundlagen und Methoden. Heidelberg: Ansanger, S. 158-179. Lauter, V. (1997), Krankheitserleben und psychische Veränderungen bei intensivbehandelten Patienten mit akutem Guillain-Barré-Syndrom. Med. Diss. Univ. Würzburg. Mc Ivor, G. P., Riklan, M., Reznikoff, M. (1984), Depression in multiple sclerosis as a function of length and severity of illness, age, remissions, and perceived psychosocial support. J. Clin. Psychol. 40, 1028-1033. Mehl, K. (2001), Krankheitsursachenvorstellungen bei Multiple Sklerose-Patienten, Med. Dissertation, Univ. Würzburg, in Vorbereitung. Mehl, K., Dragicevic, E.-M., Eisenhauer, K. G., Kahl, H., Weiß, H. (1998), Zu Krankheitsursachenvorstellungen bei Patienten mit Multipler Sklerose. Aktuelle Neurologie 25, 13 (Abstract). Möhler, B. (1998), Die Rolle der Arzt-Patient-Beziehung bei Myasthenia gravis - eine Querschnittuntersuchung bei 200 Myastheniepatienten. Dissertation, Med. Fakultät d. Univ. Würzburg. Muthny, F. A., Bechtel, M., Kiessling, W. R., Melbert, G. (1992a), Psychosoziale Belastungen und „Lebensqualität“ bei Patienten mit Multipler Sklerose in der stationären Rehabilitation. Praxis der Klinischen Verhaltensmedizin und Rehabilitation 5, 159-166. Muthny, F. A., Bechtel, M., Spaete, M. (1992b), Laienätiologie und Krankheitsverarbeitung bei schweren körperlichen Erkrankungen. Psychother. Psychosom. med. Psychol. 42, 41 - 53. Reimer, C., Hempfing, L., Dahme, B., (1979), latrogene Chronifizierung in der Vorbehandlung psychogener Erkrankungen. Prax. Psychother. Psychosom. 24,124-133. Riehl-Emde, A., Buddeberg, C., Muthny, F. A., Landolt-Ritter, C., Steiner, R., Richter, D. (1989), Ursachenattribution und Krankheitsbewältigung bei Patientinnen mit Mammakarzinom. Psychother. Psychosom. med. Psychol. 39, 232-238. Sadovnick, A. D., Eisen, K., Ebers, G. C., Paty, D. W. (1991), Cause of death in patients attending multiple scleorsis clinics. Neurology 41, 1193-1196. Schalke, B., Weiß, H., Amos, K., Karl, W., Knieling, J., Pagel, G., Toyka, K. V. (1993), Die Bedeutung psychosozialer Faktoren für Diagnostik, Krankheitsbewältigung und Therapie bei Myasthenia gravis. Medizinische Genetik 5, 331-332 (Abstract). Schiffer, R. B. (1987), The spectrum of depression in multiple sclerosis. An approach for clinical management. Arch. Neurol. 44, 596-599. 28 Schiffer, R. B., Babigian, H. (1984), Behavioral disorders in multiple sclerosis, temporal lobe epilepsy and amyotrophic lateral sclerosis. Arch. Neurol. 41, 1067-1069. Schmidt-Degenhard, M. (1992), Die oneiroide Erlebnisform. Zur Problemgeschichte und Psychopathologie des Erlebens fiktiver Wirklichkeiten. Berlin, Heidelberg, New York: Springer. Schubert, G., (2001), Zur Evaluation psychosomatischer Konsiliartätigkeiten am Beispiel des psychosomatischen Konsiliardienstes an der Neurologischen Klinik und Poliklinik der Universität Würzburg. Dissertation, Med. Fakultät der Univ. Würzburg. Seidler, G.H. (1985), Die psychosoziale Verarbeitung einer Erkrankung an Multipler Sklerose. Ergebnisse einer empirischen Untersuchung an 27 Männern. Z. Psychososom. Med. 31, 61-80. Sixt, B. (1997), Zur Krankheitsverarbeitung bei Myasthenia gravis. Eine Querschnittuntersuchung an 200 Myasthenie-Patienten. Dissertation, Med. Fakultät d. Univ. Würzburg. Smith, M. Y., Redd, W. H., Peyser, C., Vogl, D. (1999), Post-traumatic stress disorder in cancer: a review. Psycho-Oncology 8, 521-537. Steiner, J. (1993), Orte des seelischen Rückzugs. Pathologische Organisationen bei psychotischen, neurotischen und Borderline-Patienten. Stuttgart: Klett-Cotta 1998. Stenager, E.N., Stenager, E., Koch-Henriksen, N., Brönnum-Hansen, H., Hyllested, K., Jensen, K., Bille-Brahe, U. (1992), Suicide and multiple sclerosis: an epidemialogical investigation. J. Neurol. Neurosurg. Psychiat. 55, 542-545. Strenge, H. (1995), Multiple Sklerose, in: Ahrens, S., Hasenbring, M., SchultzVenrath, U., Strenge, H., Psychosomatik in der Neurologie. Stuttgart, New York: Schattauer, S. 259-335. Weiß, H. (1997), Die Bedeutung subjektiver Modelle für die Bewältigung neuroimmunologischer Erkrankungen, in: Herold, R., Keim, J., König, H., Walker, Ch., Ich bin doch krank und nicht verrückt. Moderne Leiden - Das verleugnete und unbewußte Subjekt in der Medizin. Tübingen: Attempto, S. 6380. Prof. Dr. med. H. Weiß Abteilung für Psychosomatische Medizin Robert-Bosch-Krankenhaus Auerbachstr. 110 70376 Stuttgart 29