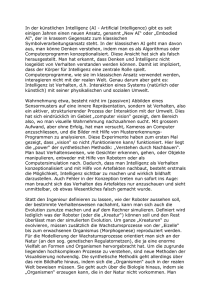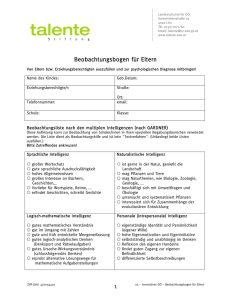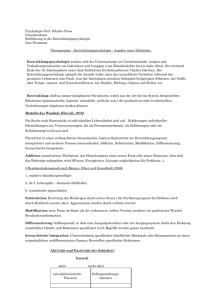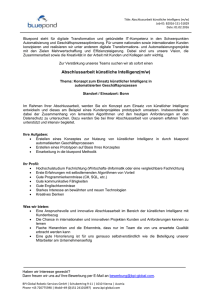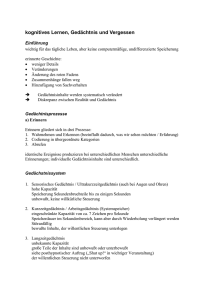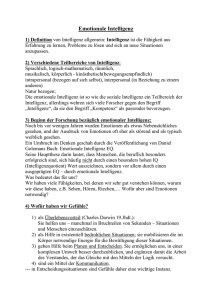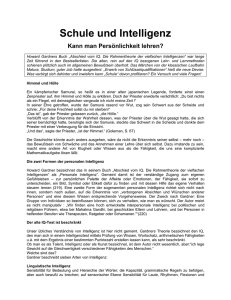vernetzte neuronen und neue ideen
Werbung

GERHARD ROTH INSTITUT FÜR HIRNFORSCHUNG VERNETZTE NEURONEN UND NEUE IDEEN GEHIRN, INTELLIGENZ UND KREATIVITÄT © G. Roth, 2009 WERKZEUGHERSTELLUNG BEI DER NEUKALEDONISCHEN KRÄHE weirmovie.mov DEFINITIONEN VON INTELLIGENZ Wechsler (1964): „Intelligenz ist die zusammengesetzte oder globale Fähigkeit des Individuums, zweckvoll zu handeln, vernünftig zu denken und sich mit seiner Umgebung wirkungsvoll auseinander-zusetzen“. Stern und Neubauer (2007): „Intelligenz ist die Fähigkeit, sich in neuen Situationen aufgrund von Einsicht zurechtzufinden, Aufgaben mithilfe des Denkens zu lösen, wobei nicht auf eine bereits vorliegende Lösungen zugrückgegriffen werden kann, sondern diese erst aus der Erfassung von Beziehungen abgeleitet werden muss“. Oder einfach ausgedrückt: Intelligenz ist kreatives Problemlösen unter Zeitdruck. MERKMALE VON KREATIVITÄT NACH J. ASENDORPF (1) schnelles Erkennen des Problems; (2) rasches Hervorbringen unterschiedlicher Ideen, Symbole und Bilder; (3) Flexibilität des Denkens, Wechsel der Bezugssysteme und Finden von Alternativen; (4) Um- und Neuinterpretation gewohnter Dinge und Wege; (5) schnelles Erfassen der Realisierbarkeit allgemeiner Pläne; (6) seltene und unkonventionelle Gedankenführungen und Denkresultate. WIE WIRD INTELLIGENZ GEMESSEN? Intelligenztests messen die individuellen kognitiven Leistungsfähigkeit in verschiedenen Bereichen (verbal – nichtverbal) im Vergleich zu einer nach Alter eingeteilten Normstichprobe. Die Verteilung der so gemessenen Intelligenz ist normalverteilt (Gauss‘sche Glockenkurve). Eine durchschnittliche Intelligenz ist als ein Intelligenzquotient von 100 definiert. Innerhalb des Bereichs plusminus einer Standardabweichung liegen rund 68% aller Werte. Dies entspricht einem IQ-Bereich zwischen 85 und 115 und bedeutet, dass die Intelligenz der meisten Menschen eng beieinander liegt. Menschen mit einem IQ von 115 und mehr gelten als hochbegabt, solche mit einem IQ von 135 als höchstbegabt. Sie machen rund 1% der Bevölkerung aus. VERTEILUNG DER INTELLIGENZLEISTUNG (IQ) Normal intelligent: IQ 85-115 (68%) Hochbegabt: IQ > 115 (14%) „Höchstbegabt“: IQ > 135 (1%) INTELLIGENZ, GENE UND UMWELT Eineiige Zwillinge weisen einen Korrelationskoeffizienten von 0,67 – 0,78 auf (Amelang und Bartussek, 1998; Asendorpf, 2004). Dabei gehen allerdings gemeinsame vorgeburtliche, geburtliche und früh-nachgeburtliche Prägungsprozesse mit ein. Zwischen dem IQ von früh adoptierten Kindern und dem ihre Adoptiveltern besteht eine Korrelation von 0,09 und 0,15, während zwischen dem IQ dieser Kinder und dem ihrer biologischen Eltern, die sie nie gesehen haben, eine Korrelation von 0,4 besteht. Nach heutigen Erkenntnissen, vor allem der Zwillingsforschung, ist Intelligenz im hochgradig angeboren. Die Entwicklung der Intelligenz stabilisiert sich schnell und ist mit ca. 15 Jahren abgeschlossen. Die Intelligenz einer Person mit sechs und mit vierzig Jahren korreliert mit einem Korrelationskoeffizienten von 0,6. Die Intelligenz eineiiger, kurz nach der Geburt getrennter Zwillinge korreliert mit einem Korrelationskoeffizienten zwischen 0,67 – 0,78. Andere Persönlichkeitsmerkmale und Begabungen sind weniger deutlich genetisch bedingt (Korr.-Koeff. von 0.4-0.7). Man nimmt an, dass Umwelteinflüsse eine Auswirkung im Bereich von 20 IQ-Punkten haben. KREATIVITÄT UND INTELLIGENZ Kreativität und Intelligenz sind nicht identisch, hängen aber eng miteinander zusammen (Korr.-Koeff. 0,4-0,5). Höher als 0,5 ist der Zusammenhang zwischen der Leistung im Verbalteil eines IQ-Tests und Kreativität (gemessen mit Kreativitäts-Skalen) Hohe Intelligenz ist zwar nicht gleichbedeutend mit hoher Kreativität ist, aber hohe Kreativität eine überdurchschnittliche, insbesondere sprachliche Intelligenz voraussetzt. Intelligenz hat offenbar eher etwas mit basalen Eigenschaften kognitiver Prozesse, Kreativität dagegen mehr mit komplexeren Eigenschaften dieser Prozesse zu tun. NEUROBIOLOGISCHE GRUNDLAGEN DER VON INTELLIGENZ UND KREATIVITÄT Seitenansicht des menschlichen Gehirns (nach Nieuwenhuys et al. 1991) Bewusstsein und Intelligenz sind beim Menschen unabtrennbar an Aktivitäten der Großhirnrinde (Cortex cerebri) gebunden. Der Cortex enthält ca. 15 Milliarden Neurone und 500 Billionen Synapsen. Funktionale Gliederung der Großhirnrinde BEWEGUNGSVORSTELLUNGEN MOTORIK SOMATOSENSORIK KÖRPER RAUM SYMBOLE DENKEN PLANUNG ENTSCHEIDUNG ARBEITSGEDÄCHTNIS SEHEN SPRACHE BEWERTUNG SOZIALE REGELN AUTOBIOGRAPHIE OBJEKTE GESICHTER SZENEN HÖREN/SPRACHE PET-Untersuchungen zum Nachweis einer „generellen Intelligenz“ (Duncan et al., Science 289 (2000)) Allgemeine Intelligenz korreliert am besten mit der Effektivität des Arbeitsgedächtnisses. Das Arbeitsgedächtnis besteht aus einem verbal-auditorischen und einem visuellen Teil. Es ist in seinen Ressourcen und seiner Geschwindigkeit hochgradig beschränkt und stellt beim Problemlösen den kognitiven „Flaschenhals“ dar. Untersuchungen zeigen, dass intelligente Menschen ein effektiver arbeitendes Arbeitsgedächtnis haben als weniger intelligente. Arbeitsgedächtnis als Integrationszentrum Expertenwissen Arbeitsgedächtnis Zellulärer Aufbau der Großhirnrinde (Cortex) Beim Menschen ca. 15 Milliarden Nervenzellen Zeichnung von S. Ramón y Cajal CORTICALE SYNAPTISCHE KONTAKTE (beim Menschen ca. 400 Billionen) PRÄSYNAPSE ERREGUNGSÜBERTRAGUNG AN EINER CHEMISCHEN SYNAPSE POSTSYNAPSE MÖGLICHE NEUROBIOLOGISCHE KORRELATE HÖHERER INTELLIGENZ („Neural Efficiency-Hypothese) • Schnellere Verarbeitungskapazität und damit „Kostenersparnis“ • Effizientere neuronale Verschaltung („Pruning“) • Stärkere Myelinisierung • Höhere Automatisierung des Wissens Zu erwarten ist deshalb: Das Gehirn, insbesondere das Stirnhirn, intelligenterer Menschen treibt weniger Aufwand und arbeitet effizienter. Der Aufwand wird in „Routinen“ verlagert, die im parietalen Cortex gespeichert sind. Roland Grabner, Universität Graz, Aljoscha Neubauer, Universität Graz, Elsbeth Stern, MPI Berlin/ETH Zürich Vergleich der kortikalen Aktivierung von überdurchschnittlich und unterdurchschnittlich intelligenten Taxifahrern bei der Bearbeitung von Aufgaben zum Taxifahren und beim Lösen von Intelligenztestaufgaben Grabner, R., Stern, E., & Neubauer, A. (2003). When intelligence loses its impact: Neural efficiency during reasoning in a highly familiar area. International Journal of Psychophysiology, 49, 89–98 IQ niedrig IQ hoch Taxifahrer-Aufgabe (Berufsroutine) Intelligenz-Aufgabe Die Leitungsgeschwindigkeit der Axone wird durch die Dicke der Markscheiden (das Myelin) bestimmt. Gliazellen (blaue Punkte = Zellkerne) bilden die Markscheiden der Nervenzellaxone. Weiße Substanz in mikroskopischer Ansicht Elektronenmikroskopisches Bild Querschnitte durch myelinisierte Axone, die von Oligodendrozyten myelinisiert werden. Je dicker die Myelinschicht, desto schneller die Leitungsgeschwindigkeit Eine Dendrogliazelle umhüllt mehrere Axone auf eine Länge von 1-2 mm. Durchmesser (µm) 1- 3 2- 5 10 - 20 Leitungsgeschwindigkeit nicht myelinisiert myelinisiert 5 - 20 10 - 30 60 -120 Mesolimbisches System: Nucleus accumbens Nucleus accumbens (projiziert stark zum Stirnhirn!) Ventrales Tegmentales Areal Antrieb/Motivation: Dopaminerges System Belohnung und Wohlbefinden:Hirneigene Opiate und andere „hedonische“ Stoffe. Ventrales Tegmentales Areal MÖGLICHE GESCHLECHTSSPEZIFISCHE HIRNUNTERSCHIEDE HIRNVOLUMEN UND INTELLIGENZ Gehirnvolumen (GV) bei Männern um ca. 10% größer als bei Frauen (1350 vs. 1220 Gramm). Differenz verschwindet bei Berücksichtigung des geringeren durchschnittlichen Körpervolumens und der dickeren subkutanen Fettschicht der Frauen (!!!). Die Korrelation zwischen GV und IQ variiert in unterschiedlichen Studien zwischen 0 und 0.6 und liegt im Mittel zwischen 0.3 und 0.4. Die beste Korrelation findet man in Hinblick auf frontale, temporale und parietale Cortexareale, Hippocampus und Cerebellum (Luders et al., im Druck). Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Korrelation zwischen Gehirnvolumen und IQ wurden nicht gefunden. Gehirne von Frauen zeigen relativ zum Gesamtvolumen mehr graue Substanz, Gehirne von Männern mehr weiße Substanz (Luders et al., 2005). Die Bedeutung ist unklar. Der vielzitierte Befund eines größeren Balken (Corpus callosum) bei Frauen (Driesen und Raz, 1995) konnte nicht bestätigt werden. Einige Autoren finden keine geschlechtsspezifischen Unterschiede (Jäncke et al. 1997), andere sogar gegenteilige Befunde (Sullivan et al., 2001). Neueste Befunde (Luders et al., 2007) zeigen zwar eine signifikante Korrelation zwischen der Dicke des posterioren CC und dem IQ, aber keine geschlechtsspezifischen Unterschiede. Wernicke-Areal: Einfaches Wortverständnis, Lexikon Broca-Areal: Syntax, Grammatik, komplexes Wort- und Satzverständnis Es finden sich bei Frauen ein erhöhtes relatives Volumen und mehr graue Substanz im Broca- und Wernicke-Sprachareal und eine erhöhte Neuronenzahl im Wernicke-Sprachareal (Harasty et al., 1997; Witelson et al. 1995; Luders et al., 2005). Stärkere bilaterale Aktivierung bei sprachlichen Aufgaben bei Frauen, mehr unilaterale (linke) Aktivierung bei Männern (Shaywitz et al., 1995). Im Allgemeinen wird eine stärkere Lateralisierung von Funktionen bei Männern gefunden – es gibt aber auch Gegenbefunde. Bei räumlicher Navigation ergeben sich deutliche Aktivitätsunterschiede zwischen Mann und Frau: Frauen zeigen mehr Aktivierungen im rechten Frontal- und Scheitellappen, Männer im linken Hippocampus. Frauen orientieren sich eher an Wegmarken, Männer nehmen eher abstrakte Koordinaten (Himmelsrichtungen, Entfernungen). Bei gleichguten Leistungen in mentaler Rotation werden bei Männern und Frauen Unterschiede in parietalen Regionen gefunden. Starke Hormonabhängigkeit kognitiver Aufgaben: Auf dem Höhepunkt des Östrogenspiegels verstärkt sich der Unterschied sprachlich vs. visuell-räumlich (z.B. mentale Rotation) zwischen Frauen und Männern. Dieser Unterschied gleicht sich bei niedrigem Östrogenspiegel mehr aus. Ein erhöhter Testosteron-Spiegel steigert bei Frauen die Fähigkeit zur mentalen Rotation, während ein (weiter) erhöhter Testosteronspiegel bei Männern deren Fähigkeit zur mentalen Rotation verschlechtert (umgekehrte U-Kurve). WAS IST MIT DEM GEHIRN DER INTELLIGENTEN RABENVÖGEL LOS? EVOLUTION DER GROSSHIRN-RINDE SALAMANDER SCHILDKRÖTE EIDECHSE OPOSSUM Seitenansicht des menschlichen Gehirns (nach Nieuwenhuys et al. 1991) SECHSSCHICHTIGER AUFBAU DER GROSSHIRNRINDE DER SÄUGETIERE Schnitt durch das Endhirn (Taube) Übersichtsfärbung Klüver Barrera Hyperpallium Isocortex? Hippocampus Allocortex Mesopallium Nidopallium Septum Mediales Striatum Globus pallidus Subcorticales Endhirn Laterales Striatum olfaktorischer Cortex Wahrscheinlich gibt es ganz allgemeine neurobiologische Grundlagen für Intelligenz. Diese sind: (1) Starker uni- und multimodaler sensorischer Input (2) Ein großer assoziativer Gedächtnisspeicher mit vielen erregenden Projektionsneuronen und wenigen hemmenden Interneuronen. (3) Eine typische Verknüpfungsarchitektur mit dichter lokaler und spärtlicher globaler Verknüpfung. (4) Eine hohe und schnelle Plastizität synaptischer Kontakte. (5) Ein Arbeitsgedächtnis, in dem selektierte Inhalte vorübergehend neu zusammengeschaltet werden. Zumindest im Prinzip könne man das nachbauen! WIE WERDE ICH INTELLIGENT UND KREATIV? (1) (Allgemeine) Intelligenz und Kreativität sind relativ stark genetisch bedingt. (2) Beide sind zudem deutlich abhängig von einer Förderung in Kindheit und Jugend. Dies macht rund 20 IQ-Punkte aus. (3) Kreativ-kognitive Leistung hängt ab von allgemeiner Intelligenz, Wissen, Motivation und Fleiß. Diese vier Faktoren können sich zumindest teilweise ersetzen. (4) Intelligentes und kreatives Problemlösen ist sehr stressanfällig. Man sollte in Fällen, in denen solches Problemlösen gefordert wird, Stress in jedem Fall vermeiden und sich, wenn man keine Lösung findet, eine „Auszeit“ nehmen. (5) Bei komplexen Problemsituationen sollte man vom rationalen auf intuitives Problemlösen umschalten. INTUITIVES PROBLEMLÖSEN UND ENTSCHEIDEN Unsere Intuitionen werden geleitet vom Erfahrungsgedächtnis. Es arbeitet vorbewusst und ist in der Großhirnrinde angesiedelt. Es stellt mit rund 15 Milliarden Nervenzellen und 400 Billionen Synapsen ein gigantisches assoziatives Netzwerk dar. Es arbeitet analog, nicht digital wie das Arbeitsgedächtnis, und hat deshalb eine viel höhere Verarbeitungskapazität. Es braucht jedoch Zeit (eine Stunde oder „die Nacht darüber schlafen“), und seine Lösung ist sprachlich nicht im Detail wiedergebbar – ist eben „intuitiv“. ZUSAMMENFASSUNG Intelligenz und Kreativität sind anders als andere Persönlichkeitsmerkmale stark genetisch bedingt, aber doch in Grenzen (um rund 20 IQ-Punkte) durch Umwelt und Training veränderbar. Wissen, Motivation und Fleiß stärken die Intelligenz, können sie aber auch zumindest teilweise ersetzen. Intelligenz und Kreativität korrelieren stark mit den Eigenschaften von Netzwerken im präfrontalen Cortex („Arbeitsgedächtnis“). Dabei gilt, dass intelligente und kreative Menschen das AG effektiver nutzen, d.h. diesen Flaschenhals schneller durchlaufen und überdies intuitiv „Abkürzungen“ vornehmen. Hochintelligente und hochkreative Leistungen entstehen mehr durch intuitive als durch logisch-rationale Prozesse im so genannten „Vorbewussten“, das identisch ist mit dem Wissensgedächtnis der Großhirnrinde.