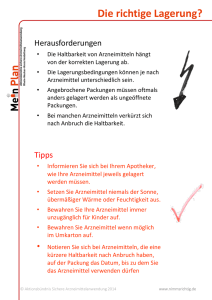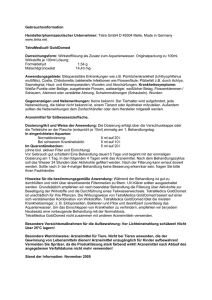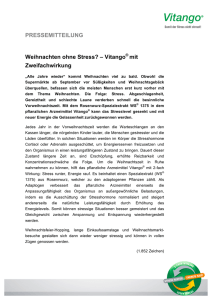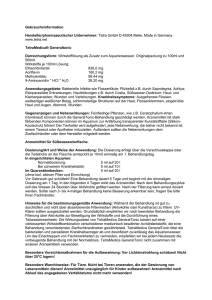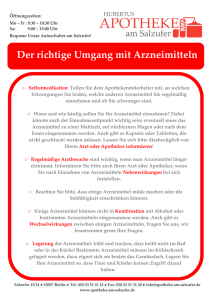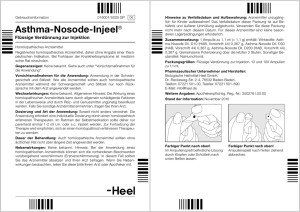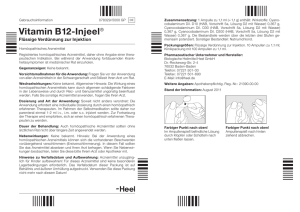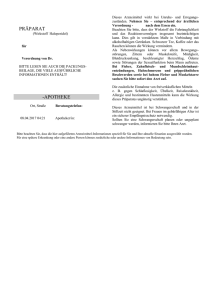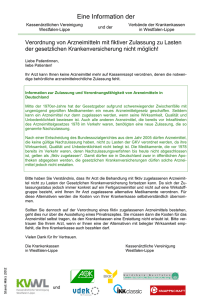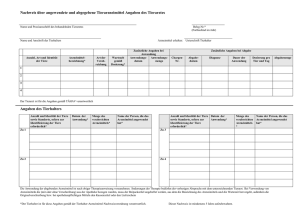Seite als PDF speichern
Werbung

- Pharmaargumente - Vielfalt der Arzneimittel Pharma Argumente Arzneimittel –alle gleich? Gibt es zu viele Arzneimittel? Vielfalt ist eine Frage des Wettbewerbs. Es muss unterschieden werden zwischen Arzneimitteln und Wirkstoffen. Solange es nicht heilbare Krankheiten gibt, gibt es zu wenige Arzneimittel. Nach den Angaben des Bundesinstitutes für Arzneimittel und Medizinprodukte gab es am 18.10.2016 exakt 47.133 verschreibungspflichtige Arzneimittel, 19.535 apothekenpflichtige und 33.776 freiverkäufliche Arzneimittel. 1.719 davon waren betäubungsmittelrezeptpflichtig. Über das sogenannte T-Rezept, das Sonderrezept für keimschädigende Substanzen, waren 13 Arzneimittel zu erhalten. In der Roten Liste 2016 sind 27.849 Medikamente gelistet. Diese sind zusammengefasst in 5.246 Präparateinträgen mit 6.373 Darreichungsformen und 18.252 Preisangaben von 409 pharmazeutischen Unternehmen. 3.598 Darreichungsformen sind rezeptpflichtig, 113 unterliegen der Betäubungsmittelverschreibungsverordnung, 2.149 sind apothekenpflichtig, 501 sind auch für den Verkehr außerhalb der Apotheken zugelassen. Diese Zahlen scheinen den Eindruck zu erwecken, dass es zu viele Arzneimittel in Deutschland gibt. Wird doch häufig auch in Medien kolportiert, in anderen Ländern seien es viel weniger. Doch diese Zahlen haben nichts mit den einzelnen Wirkstoffen zu tun. Hinter diesen hohen Zahlen verbirgt sich zum einen eine Besonderheit der amtlichen Zählung in Deutschland und zum anderen gibt es unterschiedliche Anbieter, die ein- und denselben Wirkstoff auf den Markt bringen, aber auch unterschiedliche Wirkstärken und Darreichungsformen eines einzelnen Wirkstoffes. Denn jede dieser Arzneimittelvarianten zählt in der amtlichen Zählung in Deutschland als ein Arzneimittel. Wenn es also z. B. 10 Anbieter gibt, die einen Wirkstoff jeweils als Tabletten in Packungen zu 10, 20, 50 und 100 Stück mit 25, 50 und 100mg anbieten dann zählen diese Produkte in Deutschland als 120 Arzneimittel. Diese Vielfalt im Angebot ist aber unbedingt notwendig, zum einen um Therapieoptionen für den Arzt zu eröffnen und zum anderen, um Wettbewerb im Gesundheitswesen und im Arzneimittelmarkt im Besonderen zu gewährleisten. Und es gibt eigentlich zu wenig Arzneimittel, denn viele Krankheiten sind noch immer nicht therapierbar. Dies gilt besonders für sogenannte seltene Erkrankungen (Orphan diseases), die nur wenige Patientinnen und Patienten weltweit betreffen. Sind neue Arzneimittel nicht fast immer nur Scheininnovationen? Die Pharma-Industrie hat kein Interesse an Scheininnovationen. Fast 60% der Wirkstoffe in der frühen Nutzenbewertung haben laut Aussagen des G- Fast 60% der Wirkstoffe in der frühen Nutzenbewertung haben laut Aussagen des GBA einen attestierten Zusatznutzen erhalten. Es gibt einen Unterschied zwischen Schritt- und Scheininnovation. Pharmazeutische Unternehmen können nur dann erfolgreich am Markt sein, wenn ihre Produkte sicher und wirksam sind. Daher lohnt es sich nicht, Medikamente zu entwickeln, die letztendlich keinen Nutzen für den Patienten haben. Neue Arzneimittel beziehungsweise Weiterentwicklungen bewährter Wirkstoffe, werden nicht „zum Schein“ auf einen Neuigkeitswert hin „getrimmt“. Sie müssen einen (Zusatz)nutzen gegenüber etablierten Therapiemethoden aufweisen. Nur so kann das entwickelnde Unternehmen seine Wettbewerbsposition stärken und ausbauen. Auch der Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) stellte nach 205 Wirkstoffen, die einer Frühen Nutzenbewertungen nach § 35a SGB V unterzogen wurden, bei 57 Prozent einen Zusatznutzen fest. Der G-BA bescheinigt allerdings diesen Zusatznutzen häufig nur für sehr kleine Patientenpopulationen (d. h. nur Teilen der Patienten, für die das Arzneimittel zugelassen ist). Dies erlaubt den Krankenkassen dann eine bessere Position gegenüber den Herstellern, wenn die Höhe des zu gewährenden Rabatts verhandelt wird. Wird die Wertung im Hinblick auf diese Teilpopulationen analysiert, erhalten lediglich 40 Prozent der Wirkstoffe einen attestierten Zusatznutzen. Höchst problematisch dabei ist die Tatsache, dass von den restlichen 60 Prozent nur für 29 Teilpopulationen kein Zusatznutzen aufgrund der Studienergebnisse belegt werden konnte. Die anderen negativen Bescheide (immerhin 228 von 257 Teilpopulationen) wurden aufgrund bürokratischer Formalien („Nachweis unvollständig“) oder z.B. wegen Abweichungen von der zweckmäßigen Vergleichstherapie erteilt.5 Als Fazit kann festgestellt werden, dass der vielgehörte Vorwurf, die pharmazeutischen Unternehmen lieferten keine „echten“ Innovationen, nicht durch die G-BA-Zahlen belegt werden kann. 5 BPI-Maris, Stand 15.09.2016. Jeder Marathon wird durch einzelne Schritte bewältigt Die Weiterentwicklung von bewährten Wirkstoffen ist mitentscheidend für den medizinischen Fortschritt. Auch eine veränderte Darreichungsform kann entscheidende Vorteile bringen. Der Vorwurf, pharmazeutische Unternehmen würden lediglich kleine Veränderungen an altbekannten Wirkstoffen vornehmen, wird demagogisch eingesetzt: Das Wirkprinzip eines neuen Arzneimittels bei der Krankheitsbekämpfung ist meistens bereits bekannt: Interaktion mit einem Zielmolekül (Blockierung, Hemmung etc.) oder die Substanzklasse sind gut charakterisiert (Protein, „small molecule“, Kombination etc). Zum Zeitpunkt der Markteinführung ist die pharmakologische Wirkung nicht in allen möglichen Anwendungsgebieten getestet worden. Für diese noch nicht getesteten Anwendungsgebiete ist das Arzneimittel daher auch nicht zugelassen – hier ist weitere Forschung bis zu einer Zulassung auch für diese Anwendungsgebiete erforderlich. Auch die Art und Weise der Darreichung und der Formulierung kann noch weiterentwickelt werden, um eventuell auftretende Nebenwirkungen zu vermeiden. Die Ausweitung der Einsatzmöglichkeiten eines Wirkstoffes wird Schritt für Schritt erprobt. Es wird zwischen Schritt- und Sprunginnovationen unterschieden. Eine Sprunginnovation ist beispielsweise die Entwicklung eines völlig neuen Wirkprinzips beziehungsweise eine noch nicht angewandten Substanzklasse zur Bekämpfung einer Krankheit. Klassisches Beispiel ist die Entdeckung des Penicillins als erstes im Labor hergestelltes Antibiotikum im vergangenen Jahrhundert oder die Anwendung antiretroviraler Therapien im Kampf gegen die Immunschwäche AIDS. Eine Sprunginnovation war ebenfalls die Anwendung von Antiköpern gegen Krebserkrankungen. Dem Einsatz eines derartigen Medikaments sind zwar zahlreiche und jahrelange Studien vorausgegangen, eine Erprobung auf „breiter Front“ konnte jedoch noch nicht stattfinden. Erst weitere Erfahrungen bei der Behandlung einer heterogenen Patientenpopulation führen Schritt für Schritt zu einer immer weiter verbesserten Medikation. Es gibt viele Arten von Schrittinnovationen, die den Patienten direkt zugutekommen können, unter anderem sind das: - Eine Verbesserung der Darreichungsform (Galenik) - Die Kombination mit anderen Wirkstoffen - Die Anwendungsausweitung eines Wirkstoffes auf ein neues Indikationsgebiet Ein gutes Beispiel für die Bedeutung von Schrittinnovationen ist die Therapie gegen die Immunschwäche AIDS: Mussten HIV-Patienten in den achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts nach einem streng einzuhalten Tagesdosisregime zahlreiche Tabletten einnehmen, brauchen sie heute in der Regel nicht nur weniger Pillen. Deren Einnahmezeiten sind auch noch deutlich flexibler geworden. Verschreibungspflicht vs. Verschreibungsfreiheit Ziel der Verschreibungspflicht ist zum einen die präventive ärztliche Kontrolle und zum anderen die ärztliche Überwachung der Reaktionen der Patienten auf die Therapie. Neue Wirkstoffe können frühestens drei Jahre nach Zulassung aus der automatischen Verschreibungspflicht herausgenommen werden. Der Status sagt nichts über die Wirksamkeit, nur über das Risikoprofil bzw. die Anwendungserfahrungen des Arzneimittels. Es gibt Arzneimittel, die in der Apotheke nur gegen Vorlage eines ärztlichen Rezeptes zu beziehen sind. Dieses sind die verschreibungspflichtigen Arzneimittel. Andere Arzneimittel sind hingegen ohne ärztliches Rezept zu kaufen. Man nennt diese Arzneimittel over-the counter Arzneimittel (kurz: OTC-Arzneimittel), die der Patient im Rahmen der Selbstmedikation anwendet. Wie sind die unterschiedlichen Vertriebswege in Deutschland geregelt und welche Ziele verfolgen sie? Die Unterstellung eines Arzneimittels unter die Verschreibungspflicht soll die Anwendungssicherheit solcher Stoffe erhöhen, deren Wirkungen in der Wissenschaft noch nicht allgemein bekannt sind, die wegen der Art der zu behandelnden Erkrankung eine ärztliche Indikationsstellung erfordern oder deren Anwendung wegen eines möglichen Missbrauchspotentials ärztlich überwacht werden soll. Ziel der Verschreibungspflicht ist also zum einen die präventive ärztliche Kontrolle und zum anderen die ärztliche Überwachung der Reaktionen der Patienten auf die Therapie. Die Rechtsgrundlagen für die Verschreibungspflicht sind im § 48 des Arzneimittelgesetzes zu finden. Hiernach wird das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie durch eine Rechtsverordnung (Arzneimittelverschreibungsverordnung - AMVV) mit Zustimmung des Bundesrates Stoffe oder Zubereitung von Stoffen oder Gegenstände zu bestimmen, die nur bei Vorliegen einer ärztlichen, zahnärztlichen oder tierärztlichen Verschreibung abgegeben werden dürfen. Die Kriterien für die Unterstellung eines Stoffes oder der Zubereitung eines Stoffes oder Gegenstände unter die Verschreibungsflicht sind gemäß Arzneimittelgesetz folgende: Die im Arzneimittel enthaltenen Stoffe, sind in der medizinischen Wissenschaft nicht allgemein bekannt. Dieses sind neue Wirkstoffe. Die Stoffe oder Zubereitungen aus Stoffen oder Gegenstände können die Gesundheit des Menschen, oder sofern sie zur Anwendung bei Tieren bestimmt sind die Gesundheit des Tieres, des Anwenders oder der Umwelt auch bei bestimmungsgemäßem Gebrauch unmittelbar oder mittelbar gefährden. Die Stoffe, Zubereitung aus Stoffen oder Gegenstände werden häufig nicht bestimmungsgemäß gebraucht und gefährden dadurch die Gesundheit von Mensch und Tier unmittelbar oder mittelbar. Sofern Stoffe, Zubereitung aus Stoffen oder Gegenstände zur Anwendung bei Tieren bestimmt sind, deren Anwendung eine tierärztliche Diagnose erfordert oder Auswirkungen haben können, die die späteren diagnostischen oder therapeutischen Maßnahmen erschweren oder überlagern. Der Gesetzgeber ist ebenfalls ermächtigt die Verschreibungspflicht aufzuheben, wenn der Grund der bei der Anwendung des Arzneimittels gemachten Erfahrungen, die Voraussetzungen für eine Verschreibungspflicht nicht oder nicht mehr vorliegen. Das Arzneimittel ist dann rezeptfrei in der Apotheke verfügbar. Bei Stoffen, die in der medizinischen Wissenschaft nicht allgemein bekannt sind (neue Wirkstoffe) kann dieses frühestens drei Jahre nach Inkrafttreten der zugrundeliegenden Rechtsverordnung die Verschreibungspflicht aufgehoben werden. Es besteht auch die Möglichkeit für Stoffe oder Zubereitung aus Stoffen vorzuschreiben, dass sie nur abgegeben werden dürfen, wenn in der Verschreibung bestimmte Höchstmengen für den Einzel- und Tagesgebrauch nicht überschritten werden. So ist der Wirkstoff Omeprazol zur Behandlung von Sodbrennen und saurem Aufstoßen in einer Einzeldosis von 20 mg und einer Tageshöchstdosis von 20 mg für eine maximale Anwendungsdauer von 14 Tagen und in einer maximalen Packungsgröße von 280 mg Wirkstoff, von der Verschreibungspflicht ausgenommen. Vor Erlass der Verordnung über die Verschreibungspflicht sind Sachverständige anzuhören. Das Bundesministerium für Gesundheit hat hierzu gemäß § 53 des Arzneimittelgesetzes einen Sachverständigenausschuss zu berufen. Dem Ausschuss gehören Sachverständige aus der medizinischen und pharmazeutischen Wissenschaft sowie Sachverständige der Arzneimittelkommissionen der Ärzte, Tierärzte und Apotheker an. Die Vertreter der medizinischen und pharmazeutischen Praxis und der pharmazeutischen Industrie nehmen ohne Stimmrecht an den Sitzungen teil. Der Sachverständigenausschuss tagt zweimal im Jahr beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM). Der Ausschuss befasst sich mit Anträgen auf die Unterstellung oder Entlassung aus der Verschreibungspflicht und beschließen nach eingehender Beratung ein Votum, d.h. eine Entscheidungsempfehlung für den Gesetzgeber. Im nächsten Schritt erstellt das Bundesministerium für Gesundheit im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie einen Entwurf der geänderten Arzneimittelverschreibungsverordnung. Dieser wird der Fachöffentlichkeit zur Kommentierung zur Verfügung gestellt. Im weiteren Verordnungsgebungsverfahren ist die Zustimmung des Bundesrates zur Rechtsverordnung notwendig. Das Verordnungsgebungsverfahren endet mit der Publikation der Änderungsverordnung zur Arzneimittelverschreibungsverordnung, die jeweils Ende Juni und Ende Dezember eines Jahres im Bundesgesetzblatt erfolgt. Interessant ist, dass sich die Verschreibungspflicht in Europa unterscheidet. So ist sie wie dargestellt in Deutschland wirkstoffbezogen, in anderen europäischen Ländern wird sie auf die Krankheit, also die Indikation bezogen. Dadurch ergeben sich unterschiedliche Stati für ein- und dasselbe Arzneimittel, das damit in einem Land verschreibungspflichtig, in einem anderen verschreibungsfrei sein kann. Was sind OTC-Arzneimittel? OTC-Arzneimittel werden in apothekenpflichtige und freiverkäufliche Arzneimittel unterteilt. OTC-Arzneimittel sind bis auf wenige Ausnahmen generell nicht mehr Bestandteil des GKV-Leistungskatalogs. Grundsätzlich lassen sich verschreibungspflichtige und rezeptfreie Arzneimittel unterscheiden. Die nicht verschreibungspflichtigen werden weitgehend zum Bereich der Selbstmedikation gezählt und auch als OTC-Arzneimittel bezeichnet. Die drei Buchstaben „OTC“ stehen für „over the counter“, was im deutschen so viel bedeutet wie „über den Ladentisch“, weil sie von den Patienten direkt ohne ein ärztliches Rezept meist in der Apotheke gekauft werden können. OTC-Arzneimittel werden in apothekenpflichtige und freiverkäufliche Arzneimittel unterteilt, letztere sind auch in anderen Verkaufsstätten als Apotheken, wie zum Beispiel Drogerien, Reformhäusern oder im Lebensmittelhandel erhältlich. Andere Gesundheitsprodukte, wie Nahrungsergänzungsmittel, Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diäten) oder Kosmetika, werden nicht der Gruppe der OTC-Arzneimittel hinzugerechnet. Jedes Arzneimittel muss bevor es auf den Markt kommt ein aufwändiges Zulassungsverfahren durchlaufen, in dem dessen Qualität, Sicherheit und Unbedenklichkeit belegt wird. Speziell für OTC-Arzneimittel stehen nur solche Wirkstoffe zur Verfügung, über die schon jahrelange Erfahrungen vorliegen und die über ein ausgezeichnetes NutzenRisiko-Profil verfügen. Neue Arzneistoffe sind aus Sicherheitsgründen zunächst automatisch für drei Jahre verschreibungspflichtig, selbst wenn Prüfungen ergeben haben, dass sie nur sehr geringfügige Nebenwirkungen haben. Nach frühestens drei Jahren können Hersteller einen Antrag auf Entlassung in die Nicht-Verschreibungspflicht stellen, dem, nach Überprüfung der Studienlage und wenn keine anderen Bedenken vorliegen, stattgegeben wird. Mit Inkrafttreten des „GKV-Modernisierungsgesetzes“ werden seit dem 01. Januar 2004 die Kosten für OTC-Arzneimittel von der Gesetzlichen Krankenversicherung den Patienten im Allgemeinen nicht mehr erstattet. Dieser Eingriff ist aus therapeutischer Sicht sachlich nicht gerechtfertigt, sondern erfolgte allein aus finanziellen Erwägungen. In der Praxis bedeutet die vermeintliche Kostenersparnis eine massive Einschränkung der Therapiefreiheit des Arztes. Eine Übernahme der Kosten ist nur noch für Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr und bei Jugendlichen mit Entwicklungsstörungen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr möglich. Für Erwachsene bestehen dann Ausnahmen, wenn die Mittel als Therapiestandard zur Behandlung schwerwiegender Erkrankungen gelten. Seit dem 01. Januar 2012 haben die gesetzlichen Kassen allerdings die Möglichkeit ihre Satzungsleistungen um nicht verschreibungspflichtige, apothekenpflichtige Arzneimittel zu erweitern. Einige Krankenkassen haben von dieser Möglichkeit der Verbesserung der Versorgung ihrer Versicherten Gebrauch gemacht und erstatten im Rahmen ihrer Satzungsleistungen die Kosten für bestimmte OTC-Arzneimittel wieder. Damit kommen sie dem Wunsch vieler Versicherten nach einer besonders schonenden und sicheren Therapie nach. Die Ausgestaltung des Umfangs und die Modalitäten der Erstattung kann jede Kasse individuell in ihrer Satzung festlegen. Häufig wird zur Abrechnung der Kaufbeleg verbunden mit einer ärztlichen Verordnung auf dem Grünen Rezept oder auf einem Privatrezept verlangt. Generika, die Billiglösung? Generika intensivieren den Wettbewerb. Qualitätsanforderungen und Sicherheitsbestimmungen sind genauso hoch wie bei Originalpräparaten. Generika sind Arzneimittel, die nach Ablauf eines Patentes in Konkurrenz zum wirkstoffgleichen Originalpräparat treten. Der Generikaanbieter kann dabei für die Zulassung auf die Unterlagen des Erstanbieters verweisen (sog. bezugnehmende Zulassung). Da der gleiche Wirkstoff eingesetzt wird, muss der Großteil der bereits durchgeführten Untersuchungen vom Generikaanbieter nicht wiederholt werden – sein Aufwand ist dramatisch geringer. Diesen Kostenvorteil kann er mit dem Preis weitergeben. Da in der Regel zahlreiche Generikaanbieter nach Patentablauf in den Markt eintreten, die untereinander und mit dem Erstanbieter im Wettbewerb stehen, führt generischer Wettbewerb in der Regel zu stark sinkenden Preisen. Generika werden unter den gleichen Qualitätsanforderungen und den gleichen Sicherheitsbestimmungen produziert, wie jedes Originalpräparat. Mittlerweile werden etwa 70% der in Deutschland getätigten ärztlichen Verordnungen durch Generika abgedeckt. Generika können also eine preiswerte Lösung sein, eine Billiglösung sind sie hingegen nicht. Warum braucht man eigentlich altersgerechte Arzneimittel? Arzneimittel wirken bei jedem unterschiedlich. Wirkstoffe werden in der Regel bei jungen Erwachsenen getestet. Wir benötigen mehr Medikamente für Kinder und für eine immer älter werdende Bevölkerung. Lebende Organismen sind ein Wunder unzähliger ineinandergreifender chemischer Reaktionen. Eine Zahl soll das verdeutlichen: Ein erwachsener Mensch besteht aus rund 100 Billionen, d.h. 100.000 Milliarden Zellen. Im Verlauf der Evolution haben sich einige grundsätzliche metabolische Wege etabliert, die bei allen Lebewesen recht einheitlich ablaufen. Das konzertierte Zusammenspiel aller Reaktionen in einem Organismus kann jedoch von Individuum zu Individuum unterschiedliche ausgeprägt sein. Je komplexer das Lebewesen, je höher es in der Evolutionsskala einzustufen ist, umso wahrscheinlicher, dass trotz grundlegender Gleichheit (alle Säugetiere wandeln Zucker in Energie um), Variationen in dem konzertierten Ablauf aller Reaktionen die einzelnen Individuen voneinander unterscheiden (einige Säugetiere können schneller und effizienter, Zucker in Energie umwandeln, sind demnach schneller und agiler oder lagern nicht so viel Fett an aufgrund nicht verbrauchter Zuckerreserven). Daher ist es nicht verwunderlich, dass nicht jedes Medikament bei allen Menschen gleich wirkt beziehungsweise deren Stoffwechsel beeinflusst. Dank der immer schneller verfügbaren Erkenntnisse der Pharmakogenetik (einer wissenschaftlichen Disziplin, die den Einfluss genetischer Eigenschaften auf die Wirksamkeit von Arzneimitteln erforscht), geht die moderne Medizin verstärkt den Weg der „Personalisierung“. Vielfach werden daher Medikamente nicht allen Patienten mit einer bestimmten Krankheit verschrieben, kann doch in einigen Fällen mit einem diagnostischen Test vor der Einnahme festgestellt werden, ob und wie ein Arzneimittel auf ein Individuum wirken wird. Und wenn es bei Erwachsenen in der Behandlung bereits zu einer Stratifizierung (d.h. Aufteilung in Teilgruppen) aufgrund ihres unterschiedlichen Metabolismus kommt, um so einfacher ist es zu verstehen, dass Patientengruppen, die allein wegen ihres Alters noch nicht (Kinder) beziehungsweise nicht mehr (ältere und alte Menschen) über die volle Stoffwechselausstattung oder –geschwindigkeit verfügen, nicht als Nutzer jeden Medikamentes infrage kommen. Denn häufig werden Wirkstoffe im Laufe ihrer Entwicklung bei jungen Erwachsenen getestet. Kinder dürfen metabolisch betrachtet nicht als „kleine Erwachsene“ behandelt werden. Sie können manche Wirkstoffe nur langsam verstoffwechseln (sie bräuchten dann eine geringere Dosis als die eines erwachsenen Patienten). Oder das Arzneimittel birgt das Potential in sich, in die Entwicklung von Körperfunktionen nachhaltig eingreifen und damit dem jungen Patienten einen bleibenden Schaden als Nebenwirkung zuzufügen. Ähnlich verhält es sich bei älteren Patienten, bei denen sich im Zuge des Alterungsprozesses Stoffwechselwege verlangsamen, verschwinden oder schlicht und einfach gestört sind. Sowohl bei Kindern als auch bei älteren bis sehr alten Menschen ist es daher wichtig, auf die Spezifika ihres jeweiligen Metabolismus einzugehen, um sie mit effektiven und möglichst nebenwirkungsarmen Medikamente versorgen zu können. Zudem gewinnt die Verbesserung der Gesundheitsversorgung älterer Menschen aufgrund der demographischen Entwicklung westlicher Industrienationen immer mehr an Bedeutung. Die EU-Kommission hat immerhin die Tatsache erkannt, dass die meisten für Kinder verschriebenen Medikamente eigentlich „off-label“, also außerhalb des zugelassenen Anwendungsgebietes, angewandt werden. Aus diesem Grund hat sie Ende 2006 die Verordnung (EG) Nr. 1901/2006 verabschiedet, mit der sie sicherstellen möchte, dass neue und bereits auf dem Markt befindliche Medikamente auch die spezifischen Bedürfnisse der Kinder berücksichtigen. Derzeit wird in Deutschland die Entwicklung von Kinderarzneimitteln auf Basis bewährter Wirkstoffe (Genehmigung für die pädiatrische Verwendung - Paediatric use marketing authorisation (PUMA )) durch die Aut-idem-Regelung, d. h. den Austausch in der Apotheke, torpediert. Diese führt heute dazu, dass zugelassene Kinderarzneimittel gegen nicht für Kinder zugelassene Standardmedikamente ausgetauscht werden, wenn es sich um den gleichen Wirkstoff handelt und nimmt damit der Entwicklung von Arzneimitteln mit bewährten Wirkstoffen für Kinder die wirtschaftliche Grundlage.6 6 25 to 35 PIP applications possible PUMA – only 3 PUMA so far / Präsentation Paolo Tomasi EMA, 2013. Was sind eigentlich „Orphans Drugs“? Orphan Drugs sind Arzneimittel gegen seltene Erkrankungen. Bei einer seltenen Erkrankungen leiden in Europa allerhöchstens fünf von 10.000 Menschen an dieser Krankheit. Ziel der europäischen Union ist es, dass mehr Arzneimittel für die Betroffenen zur Verfügung stehen. Die Forschung ist in diesem Feld besonders aufwändig. Haben Sie schon einmal von der Ahornsirupkrankheit, dem Katzenaugensyndrom oder der Collagen-Kolitis gehört? All dies sind tatsächlich existierende, seltene Erkrankungen. Geschätzte 5.000 bis 8.000 verschiedene, meist erblich bedingte, seltene Leiden sind aktuell bekannt. Häufig stehen Patienten mit ihrer seltenen Krankheit allein auf weiter Flur, denn ein solches Leiden betrifft in Europa allerhöchstens fünf von 10.000 Menschen, meistens noch viel weniger. Für die Hersteller ist die Arzneimittelentwicklung sehr aufwändig. Wer nur für ganz kleine Patientengruppen forscht und produziert, muss daher sicher sein, dass die Medikamente am Ende auch den Patienten erreichen und angemessen erstattet werden. Um den wirtschaftlichen Nachteil der Entwicklung und Zulassung dieser Arzneimittel für seltene Erkrankungen (Orphan Drugs) zu kompensieren und der Entwicklung eine bessere wirtschaftliche Grundlage zu geben, haben das Europäische Parlament und der Rat die Verordnung (EG) 141/2000 für Orphan Drugs erlassen. Diese verfolgt das Ziel, Anreize für die Erforschung, Entwicklung und das Inverkehrbringen von Arzneimitteln für seltene Leiden zu schaffen und ein Gemeinschaftsverfahren für die Ausweisung von Arzneimitteln als Orphan Drug festzulegen. Seit Januar 2000 ist diese Verordnung direkt in allen Mitgliedstaaten rechtlich wirksam. Mit der Verordnung wurden für pharmazeutische Unternehmen EU-weit vergleichbare Anreize geschaffen, wie sie sich im internationalen Umfeld schon lange bewährt hatten und dort auch Forschung & Entwicklung für Orphan Drugs vorangebracht haben: Zu nennen wären hier die USA mit dem „Orphan Drug Act“ von 1983, Japan mit seiner „Orphan Drug Legislation“ von 1993, Singapur mit der „Orphan Legislation“ von 1997 sowie Australiens „Orphan Legislation“ aus dem Jahre 1998. Mit dieser europäischen Verordnung über Arzneimittel für seltene Leiden wurden die ersten wichtigen positiven Schritte getan, um den industriepolitischen Standortnachteil für die europäische pharmazeutische Industrie im Bereich der Erforschung seltener Erkrankungen zu reduzieren. Dies kommt den Patienten in den europäischen Mitgliedstaaten unmittelbar zugute, weil auf diesem Weg wirksame Arzneimittel gegen ihre Leiden von der Industrie gezielter entwickelt werden können. Seit im Jahr 2000 die neue Orphan Drug Verordnung in Kraft trat, nahm die Forschung im Bereich der seltenen Erkrankungen stark zu. Mehr als 60 dieser Spezialpräparate wurden seitdem zugelassen. Um Missbrauch dieser Verordnung auszuschließen, wurden in Europa spezifische Kriterien für die Ausweisung eines Arzneimittels als Orphan Drug angelegt, die wissenschaftlich zu belegen sind. So muss der Ansatz für eine Entwicklung medizinisch plausibel sein und der Nachweis erbracht werden, dass das Arzneimittel für die Diagnose, Verhütung oder Behandlung eines Leidens bestimmt ist, das lebensbedrohend ist oder eine chronische Invalidität nach sich zieht, für das es noch keine therapeutische Alternative gibt. Als epidemiologisches Kriterium für die EU gilt, dass eine Prävalenz von höchstens 5 Patienten von 10.000 Personen gefordert wird, d. h. EU-weit nicht mehr als 5 von 10.000 Bürgern von der Krankheit betroffen sind. Darüber hinaus können auch wirtschaftliche Kriterien, wie die fehlende Möglichkeit, mit dem betreffenden Arzneimittel aufgrund zu geringer Patientenzahlen eine ausreichende Rendite (return on investment) zu erwirtschaften, bei der Entscheidung über den Orphan Drug-Status Berücksichtigung finden. In jedem Fall ist ergänzend zum Nachweis der a) geringen Prävalenz oder b) des nicht ausreichenden Gewinns zur Refinanzierung der notwendigen Investitionen ergänzend nachzuweisen, dass es in der Europäischen Union noch keine zufriedenstellende zugelassene Methode für die Diagnose, Verhütung oder Behandlung des betreffenden Leidens gibt oder dass das Arzneimittel – sofern eine solche Methode besteht – für die betroffenen Patienten von erheblichem Nutzen sein wird. Biotechnologie – die Zukunft? Die Biotechnologie erlaubt die Entwicklung von Medikamenten für bislang unheilbare Krankheiten. Mit biotechnologischen Methoden können Moleküle in hoher Reinheit hergestellt werden, die im menschlichen Organismus vorkommen. Arzneimittel können “maßgeschneidert” werden. Die Anwendungen moderner Methoden der Biotechnologie eröffnen vielfältige neue Wege bei der Behandlung von bislang unheilbaren Krankheiten beziehungsweise bei der Verbesserung bereits etablierter Therapien. Ein gutes Beispiel ist hier der Einsatz monoklonaler Antikörper (mAK), oder im englischen mab, monoclonal antibody (MAB), in der Krebsbehandlung: Noch vor 1965 überlebten lediglich etwa 20% der Erkrankten die ersten fünf Jahre nach der Diagnose. Heute sind es 70%. Das ist größtenteils auf eine bessere Vorsorge zurückzuführen, aber auch auf innovative Krebsmedikamente wie den Antikörper Trastuzumab, der z.B. nach einem diagnostischen Vortest bei etwa 20% aller Brustkrebspatientinnen eingesetzt werden kann. Der Einsatz von mAK in Therapie und Diagnostik bewährt sich. In der Onkologie ist es teilweise die einzige Hoffnung auf eine Verbesserung des Krankheitsverlaufes bzw. auf eine Verlängerung der Lebenserwartung. Immer mehr Medikamente stammen aus den Laboren der biopharmazeutisch tätigen Unternehmen. 2014 waren fast 400 Firmen an der Erforschung und Entwicklung sowie der Vermarktung von Biopharmazeutika beteiligt. In Deutschland sind bereits mehr als 220 Medikamente auf biotechnologischer Basis zugelassen. Das entspricht einem Anteil von 22 Prozent am Gesamtumsatz im Pharma-Markt. Die Zahl der biopharmazeutischen Präparate in der klinischen Pipeline betrug 2014 mehr als 600. Insgesamt hat sich die Zahl der Medikamentenkandidaten in der Klinik seit 2006 mehr als verdoppelt.7 Dank der modernen Methoden der Molekularbiologie ist es heute sogar möglich, sehr kleine Patientenpopulationen zu behandeln und gar zu heilen. Die Biotechnologie erlaubt es aber auch, für die Medikamentenproduktion wichtige Prozesse kostengünstiger und nachhaltiger zu gestalten. Die aufwendige chemische Synthese von beispielsweise Insulin oder dessen Extraktion aus der Bauchspeicheldrüse von Tieren ist bereits seit etwa 40 Jahren durch die Herstellung im Fermentern mit gentechnisch modifizierten Mikroorganismen ersetzt worden. Das war ein historischer Durchbruch, da es damit gelang, die mengenmäßig eingeschränkte Gewinnung aus natürlichen Quellen wie den o.g. Bauchspeicheldrüsen durch einen technischen Prozess zu ersetzen, mit dem Insulin – und andere Biomoleküle – in nahezu beliebigen Mengen und ohne Verunreinigungen gewonnen werden kann. Bei Erkrankungen, bei denen dem Patienten ein körpereigenes Molekül fehlt oder in zu geringer Menge vorhanden ist, kann dieses nunmehr als Arzneimittel zugeführt und ersetzt werden – und dies auch bei hochkomplexen Molekülen wie z.B. Faktor VIII (Gerinnungsfaktor, bei Bluterkrankheit) oder Erythropoetin (EPO, Steigerung der Blutbildung, z.B. bei Nieren- und Krebserkrankungen). 7 BCG-Report Medizinische Biotechnologie in Deutschland 2015. Besondere Therapien Homöopathie und Anthroposophische Medizin blicken auf eine lange Tradition zurück. In der Europäischen Union nutzen mehr als 100 Millionen Menschen die Homöopathische und Anthroposophische Medizin. Die Therapierichtungen Homöopathie und Anthroposophische Medizin blicken auf eine lange Tradition zurück. Heute sind sie aktueller denn je, nutzen doch immer mehr Menschen diese Therapieformen zur Behandlung von akuten und chronischen Erkrankungen. Dies liegt auch an der wachsenden Erkenntnis, dass sich Krankheit und Gesundheit nicht auf einzelne Ursachen reduzieren lassen, sondern vom Menschen als Gesamtpersönlichkeit abhängen. Homöopathische und anthroposophische Arzneimittel helfen Patienten, sind nebenwirkungsarm und preiswert. Sie leisten damit einen großen Beitrag zur Verbesserung und zum Erhalt von Gesundheit und Lebensqualität. In der Europäischen Union haben mehr als 100 Millionen Menschen Erfahrung mit der Homöopathischen und Anthroposophischen Medizin. Über 120.000 Ärzte und Therapeuten, davon allein in Deutschland etwa 60.000, verordnen regelmäßig Arzneimittel dieser Therapierichtungen. Außerhalb Europas ist die Homöopathie insbesondere in den USA, in Mittel- und Südamerika, Asien, Indien und Südafrika vertreten, die Anthroposophische Medizin vor allem in Nord- und Südamerika sowie in Australien und Neuseeland. In Deutschland produzieren etwa 100 pharmazeutische Unternehmen mit hoch qualifizierten Mitarbeitern anthroposophische und homöopathische Arzneimittel. Homöopathie und Anthroposophie sind ganzheitliche Therapieformen. Das bedeutet, dass Krankheit als individueller Prozess verstanden wird, der den Menschen in seiner Gesamtpersönlichkeit betrifft. Homöopathische und anthroposophische Arzneimittel unterstützen die natürliche Fähigkeit des Menschen, Krankheiten selbst zu überwinden, indem sie die Selbstheilungskräfte des Patienten anregen. Beide Therapierichtungen sind wissenschaftlich fundiert, werden nach festgelegten Regeln in der Praxis individuell angewandt und mit modernen wissenschaftlichen Methoden kontinuierlich weiterentwickelt. Schulmedizin und Universitäten begegnen ihnen mit wachsender Aufmerksamkeit und steigender Akzeptanz. Homöopathie – was ist das? „Ähnliches möge mit Ähnlichem geheilt werden“ Neben den millionenfachen therapeutischen Erfolgen und einer Fülle von gesicherten Erkenntnissen aus der Erfahrungsmedizin belegen auch wissenschaftliche Untersuchungen auf der Grundlage der evidenzbasierten Medizin die Wirksamkeit von homöopathischen Arzneimitteln. Die Homöopathie geht auf den Arzt und Apotheker Dr. Samuel Hahnemann (1755-1843) zurück. Grundlage ist das Ähnlichkeitsprinzip, das Hahnemann mit „Similia similibus curentur“ also „Ähnliches möge mit Ähnlichem geheilt werden“ zum Ausdruck brachte. Die Behandlung nach homöopathischen Grundsätzen basiert auf der Verfügbarkeit eines über 200 Jahre gewachsenen Arzneimittelschatzes und wird zunehmend mit wissenschaftlichen Erkenntnissen der modernen Forschung untermauert. Der Arzneimittelschatz ergibt sich aus der kontrollierten Verarbeitung von zahlreichen natürlichen Ausgangsstoffen, vorwiegend Pflanzen, Mineralien sowie tierischen Materialien. Die Produktion erfolgt nach höchsten internationalen Standards in modernen pharmazeutischen Unternehmen. Die Vielfalt von Arzneimitteln ist unabdingbare Voraussetzung für die Therapiequalität. Das Arzneimittelspektrum vervielfacht sich durch das Angebot verschiedener homöopathischer Darreichungsformen in unterschiedlichsten homöopathischen Verdünnungen (Potenzen). Von Hersteller zu Hersteller variierend, können so von einem Unternehmen bis zu 400.000 homöopathische Fertigarzneimittel aus etwa 1.600 unterschiedlichen Ausgangsstoffen bereitgestellt werden. Sie werden bei einer Vielzahl akuter und chronischer Erkrankungen eingesetzt – entweder durch Verordnung/Empfehlung durch Fachkreise (Arzt, Apotheker) oder direkt durch den Patienten selbst. Neben den millionenfachen therapeutischen Erfolgen und einer Fülle von Erkenntnissen aus der Erfahrungsmedizin belegen auch wissenschaftliche Untersuchungen auf der Grundlage der evidenzbasierten Medizin die Wirksamkeit von homöopathischen Arzneimitteln. Die Grundlagen der Anthroposophischen Medizin Anthroposophische Medizin zählt zu den komplementärmedizinischen Therapien. Durch eine erweiterte Betrachtungsweise des Menschen erhalten Ärzte neue Einblicke in die Zusammenhänge von Gesundheit und Krankheit. Sie wird in über 80 Ländern praktiziert und im Rahmen von Forschungsprojekten weiterentwickelt. Die Anthroposophische Medizin (Anthroposophie, griech. „die Weisheit vom Menschen“) basiert auf der zu Beginn des 20. Jahrhunderts von Rudolf Steiner entwickelten anthroposophischen Geisteswissenschaft. Sie erweitert die naturwissenschaftlich ausgerichtete Schulmedizin und zählt zu den komplementärmedizinischen Therapien. Durch eine erweiterte Betrachtungsweise des Menschen erhalten Ärzte neue Einblicke in die Zusammenhänge von Gesundheit und Krankheit. Dieser Ansatz gewinnt in dem heute viel diskutierten Prinzip der Salutogenese (Gesunderhaltung) neue Aktualität. Eine individuelle, eigenverantwortliche Medizin, in der konventionelle zusammen mit komplementären Arzneimitteln für eine bestmögliche Therapie des Patienten angewendet werden, wird dadurch befördert. Die Anthroposophische Medizin ist eine der bedeutendsten integrativen Therapierichtungen in ganz Mitteleuropa. Weltweit wird sie in über 80 Ländern praktiziert und im Rahmen von Forschungsprojekten weiterentwickelt. Anthroposophische Arzneimittel werden aus Natursubstanzen – Mineralien (z.B. Quarz, Kalk, Antimonit) und Metallen (z.B. Silber, Gold, Eisen), Heilpflanzen (z.B. Ringelblume, Arnika, Eichenrinde) und tierischen Bestandteilen (z.B. Biene, Ameise, Schlangengifte) – hergestellt, die zu Arzneimitteln mit nur einem Wirkstoff oder in Kombination zu Kompositionsarzneimitteln verarbeitet werden. Auch bei ihnen gibt es verschiedene Darreichungsformen und Potenzen. Zahlreiche der verwendeten Heilpflanzen kommen aus dem biologisch-dynamischen Anbau oder aus zertifizierten Wildsammlungen. Wie sind die regulatorische und erstattungsrechtlichen Rahmenbedingungen für die Homöopathie und Anthroposophische Medizin? Seit 1976 sind die Homöopathie und die Anthroposophische Medizin neben der Phytotherapie in Deutschland als „besondere Therapierichtungen“ sowohl im Arzneimittelrecht als auch im Sozialgesetzbuch (SGB V) verankert. Homöopathische und anthroposophische Medikamente unterliegen den Regelungen des deutschen und europäischen Arzneimittelrechts; sie sind zugelassen oder registriert. Die arzneimittelrechtlichen Regelungen werden konkretisiert und ergänzt durch das Europäische Arzneibuch, das Deutsche Homöopathische Arzneibuch sowie den Anthroposophisch-Pharmazeutischen Kodex. Die Arzneimittelqualität und das Herstellungsverfahren entsprechen den aktuellen EU-Standards für die pharmazeutische Industrie. Seit 1976 sind die Homöopathie und die Anthroposophische Medizin neben der Phytotherapie in Deutschland als „besondere Therapierichtungen“ sowohl im Arzneimittelrecht als auch im Sozialgesetzbuch (SGB V) verankert. Wegen ihrer sehr guten Verträglichkeit und äußerst geringen Nebenwirkungsquote sind homöopathische und anthroposophische Arzneimittel mit wenigen Ausnahmen nicht verschreibungspflichtig. Die Gesetzliche Krankenkasse erstattet sie bei Kindern bis zum vollendeten 12. Lebensjahr und Jugendlichen mit Entwicklungsstörungen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr sowie bei Erwachsenen in besonderen Fällen. Die homöopathischen und anthroposophischen Unternehmen führen ihre Arzneimittel mit Tradition und Expertise in die Zukunft. Hochmoderne Fertigungsanlagen und hervorragend ausgebildete Mitarbeiter sind die tragenden Elemente. Ziel ist es, mit ganzheitlichen, wirksamen, risikoarmen und preiswerten Therapien einen entscheidenden Beitrag für ein effizientes und bezahlbares Gesundheitswesen zu leisten. Was für einen wichtigen Beitrag Homöopathika und Anthroposophika leisten zeigen die beiden aktuellen Beispiele wie die Aufnahme eines homöopathischen Arzneimittels in eine DEGAM-S3-Leitlinie sowie auch der Beitrag der Medikamente zur Lösung des Problems Antibiotika-Resistenzen. Entscheidend ist allerdings, dass die politischen Rahmenbedingungen stimmen. Die Besonderheiten beider Therapierichtungen, die ihrer hohen Individualität in der Anwendung und der Vielfalt der Arzneimittel geschuldet sind, müssen bei allen deutschen und europäischen Gesetzgebungsverfahren angemessen berücksichtigt werden. Nur so kann sichergestellt werden, dass homöopathische und anthroposophische Medikamente auch in Zukunft der gesamten Bevölkerung zur Verfügung stehen und dass, Therapievielfalt und Patientenautonomie erhalten bleiben. Auch die politische Unterstützung und Förderung der Forschung auf diesen Therapiegebieten durch Errichtung von entsprechenden Lehrstühlen ist ein wichtiger Ansatz, weitere Erkenntnisse zu erlangen, von denen die gesamte Medizin profitieren kann. Die Pflanze, die hilft Bis vor ca. 200 Jahren waren Phytopharmaka die einzigen Medikamente, die den Menschen zur Verfügung standen. Für pflanzliche Arzneimittel gelten, wie auch für chemisch-synthetische Präparate, die rechtlichen Bestimmungen des Arzneimittelgesetzes. Die meisten pflanzlichen Arzneimittel sind frei verkäuflich, nur wenige Phytopharmaka unterliegen der Verschreibungspflicht. Die Verwendung von pflanzlichen Arzneimitteln, auch Phytopharmaka genannt, hat eine sehr lange Tradition in Deutschland. Bis vor ca. 200 Jahren waren sie neben anderen aus der Natur gewonnenen Substanzen die einzigen Medikamente, die den Menschen zur Verfügung standen. Aber auch heute erfreuen sich Arzneimittel pflanzlichen Ursprungs großer Beliebtheit in der Bevölkerung, da sie meist schonender und nebenwirkungsarm sind. Die moderne Phytotherapie, das Heilen mit Pflanzen bzw. deren Zubereitung, ist fester Bestandteil der modernen Arzneitherapie. Verwendet werden entweder die ganze Arzneipflanze oder nur bestimmte Teile, wie z.B. Wurzeln, das Kraut bzw. Blätter, Blüten, Früchte oder die Rinde, die meist getrocknet, aber auch frisch verarbeitet werden können. Die pflanzlichen Ausgangsstoffe werden dann entweder als Tee zubereitet oder in anderer Weise, wie z.B. als Extrakt, Saft, Tinktur oder Pulver therapeutisch angewendet. Im Gegensatz zu chemisch-synthetischen Arzneimitteln, die meist nur einen isolierten Stoff enthalten, handelt es sich bei pflanzlichen Zubereitungen um Vielstoffgemische, die verschiedenste Wirkungen entfalten können. Bei pflanzlichen Arzneimitteln wird die Gesamtheit der Inhaltsstoffe als Wirkstoff angesehen. Neben den klassischen Arzneitees liegen pflanzliche Arzneimittel heutzutage in allen üblichen Darreichungsformen wie Tabletten, Kapseln, Dragees oder Tropfen vor, die mit modernsten Verfahren und Technologien hergestellt werden. Für pflanzliche Arzneimittel gelten, wie auch für chemisch-synthetische Präparate, die rechtlichen Bestimmungen des Arzneimittelgesetzes. Um die Marktfähigkeit zu erlangen, werden vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) die Wirksamkeit, Unbedenklichkeit und die Qualität der Produkte nach strengen Vorgaben überprüft. Hierzu müssen vom Hersteller Ergebnisse z.B. aus pharmakologisch-toxikologischen und klinischen Prüfungen oder aus Monografien, wissenschaftlicher Fachliteratur oder Erfahrungsberichten vorgelegt werden. Eine Besonderheit stellen die „traditionellen“ pflanzlichen Arzneimittel dar. Hierbei handelt es sich um solche Präparate, für die eine mindestens 30-jährige medizinische Anwendung (davon 15 Jahre in der EU) ohne gravierende Sicherheitsbedenken belegt werden kann. Solche Präparate basieren somit vornehmlich auf überlieferten Erfahrungen und müssen über keinen wissenschaftlichen Wirkungsnachweis verfügen. Durch ihre langjährige Verwendung gelten sie als wirksam und sicher. Daneben gibt es aber auch pflanzliche Arzneimittel, die z.B. standardisierte Spezialextrakte enthalten und deren Wirksamkeit und Unbedenklichkeit durch klinische Prüfungen untersucht und bestätigt worden sind. Sie erfüllen somit die gleichen Kriterien wie chemisch-synthetische Wirkstoffe, weisen aber in der Regel eine geringere Nebenwirkungsrate auf. Die Anforderungen an die pharmazeutische Qualität von Arzneimitteln sind sehr hoch und für alle Phytopharmaka gleich. So muss die Herstellung von pflanzlichen Arzneimitteln sehr genau dokumentiert und sichergestellt werden, dass die Präparate immer eine konstante Qualität aufweisen. Die meisten pflanzlichen Arzneimittel sind frei verkäuflich, nur wenige Phytopharmaka unterliegen der Verschreibungspflicht. Definitionen Arzneimittel, Medizinprodukte, Nahrungsergänzungsmittel, Nahrungsmittel, Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diäten) Nahrungsergänzungsmittel sind Lebensmittel. Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke sind für das Diätmanagement von Patienten vorgesehen. Medizinprodukte wirken nicht pharmakologisch, sondern physikalisch. Arzneimittel zeichnen sich dadurch aus, dass sie einen medizinisch-pharmakologischen Effekt verursachen, der insbesondere zur Heilung oder Linderung von Krankheiten dienen soll, sodass der therapeutische Effekt einen zentralen Stellenwert einnimmt. Der Effekt entsteht durch Wechselwirkungen (Bindungen, chemischen Reaktionen) zwischen dem Wirkstoff und Molekülen im menschlichen Organismus. Arzneimittel werden denn auch für ein bestimmtes Therapie- oder Anwendungsgebiet eingesetzt. Einen nahezu identischen Zweck nehmen auch Medizinprodukte ein. Nur, worin unterscheiden sich nun Arzneimittel von Medizinprodukten? Medizinprodukte wirken nicht pharmakologisch, sondern physikalisch, d. h. eine Wechselwirkung mit Molekülen menschlicher Zellen oder anderen Organismen (Bakterien) findet bei der physikalischen Wirkungsweise nicht statt. Auch Medizinprodukte, die wie Arzneimittel auch als chemische Stoffe vorkommen, können wissenschaftlich belegt heilende Wirkungen entfalten. Nahrungsergänzungsmittel sind in einer gesonderten Verordnung geregelt, der sogenannten Nahrungsergänzungsmittel-Verordnung. Es handelt sich bei diesen Produkten um Lebensmittel, die dazu bestimmt sind, die allgemeine Ernährung zu ergänzen und zur Erhaltung der Gesundheit und des Wohlbefindens beizutragen. Sie sind ein Konzentrat von Nährstoffen oder sonstigen Stoffen mit ernährungsspezifischer oder physiologischer Wirkung allein oder in Zusammensetzung, die in dosierter Form, insbesondere als Kapseln, Pastillen, Tabletten, Pillen und anderen ähnlichen Darreichungsformen, in den Verkehr gebracht werden. Unter dem Begriff Nahrungsmittel bzw. Lebensmittel lassen sich eine Vielzahl von Produkten einordnen, wie Lebensmittel für den normalen Verzehr, Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diäten), neuartige Lebensmittel sowie Nahrungsergänzungsmittel. Für die Begriffsdefinition verweist das deutsche LFGB (Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch) auf Artikel 2 der Basisverordnung (Verordnung (EG) Nr. 178/2002), wonach Lebensmittel als „Stoffe oder Erzeugnisse, die dazu bestimmt sind oder von denen nach vernünftigem Ermessen erwartet werden kann, dass sie in verarbeitetem, teilweise verarbeitetem oder unverarbeitetem Zustand vom Menschen aufgenommen werden“ definiert werden. Hierzu zählen auch Getränke, Kaugummi sowie Stoffe – einschließlich Wasser –, die dem Lebensmittel bei der Herstellung, Ver- oder Bearbeitung absichtlich zugesetzt werden. Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diäten) sind mit der Verordnung (EU) Nr. 609/2013 mit etlichen Veränderungen auf europäischer Ebene neu geregelt. Sie sind anders als Nahrungsergänzungsmittel für das Diätmanagement von Patienten vorgesehen. Für diese Personengruppe reicht eine Modifizierung der normalen Ernährung, die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln oder andere Lebensmittel für eine besondere Ernährung nicht aus. Die Patienten haben eine eingeschränkte, behinderte oder gestörte Fähigkeit zur Aufnahme, Verdauung, Resorption, Verstoffwechselung oder Ausscheidung gewöhnlicher Lebensmittel oder bestimmter darin enthaltener Nährstoffe. Ein solches Speziallebensmittel enthält Mineralstoffe, Vitamine und weitere Nährstoffe in hochdosierter Form. Wird es als einziges Nahrungsmittel aufgenommen, spricht man von einem vollständigen Speziallebensmittel, ansonsten von einem ergänzenden Speziallebensmittel. Was kommt mit der personalisierten Medizin? Diagnosen werden präziser. Therapien werden zielgerichteter und nebenwirkungsärmer. Die Prävention wird immer leichter. Die Medizin ist im Grunde genommen schon immer „personalisiert“ gewesen. Jeder (gute) Arzt oder Apotheker ist auf die Spezifika eines einzelnen Patienten eingegangen. Jede Operation im Krankenhaus wird auf die individuellen Eigenschaften eines Behandelten abgestimmt durchgeführt werden. Die Anwendung von Medikamenten wird mit wachsendem Kenntnisgewinn immer weiter stratifiziert (d.h. auf Teilgruppen zugeschnitten) werden. Die Patientengruppen können dadurch gezielter behandelt werden, z.B. in dem von vorneherein durch Tests ermittelt werden kann, ob ein Patient auf das Arzneimittel positiv anspricht oder nicht. Frauen reagieren anders als Männer auf viele Wirkstoffe, Kinder oder ältere Menschen anders als junge Erwachsene. Dank der Fortschritte auf dem Gebiet der modernen Bio- und Zelltechnologie sowie der Pharmakologie ist es bereits heute durch geeignete Testverfahren schon möglich, immer mehr Therapien, die Wirkung von Medikamenten, deren Dosierung und Darreichungsformen genauer und präziser vorauszusagen. Das mündet letztendlich in einer erhöhten Wirksamkeit der verabreichten Medikamente und geringeren Nebenwirkungseffekten. Bereits heute stehen 37 Wirkstoffe der deutschen Gesundheitsversorgung zur Verfügung, die nur dann verabreicht werden dürfen, wenn zuvor ein diagnostischer Test auf die Medikamentenwirksamkeit hin durchgeführt wird. Für weitere sieben Wirkstoffe wird ein solcher Test empfohlen. Auch das Gebiet der Regenerativen Medizin kann getrost als eine weitere Form der Individualisierung im Gesundheitsbereich gezählt werden: Ein gutes Beispiel ist die Regeneration beschädigten Knorpels in Gelenken. Dem Patienten werden über eine Biopsie Knorpelzellen entnommen, im Labor vermehrt und auf einem bioabbaubaren Träger in der gewünschten Form zum Wachsen gebracht. Anschließend wird ihm der neue Knorpel eingesetzt. Dies reduziert die Verwendung von körperfremden Prothesen und damit die Wahrscheinlichkeit einer Abstoßungsreaktion. Obwohl bereits heute schon zahlreiche personalisierte Anwendungen eingesetzt werden (Knorpel-Regeneration, Brust- bzw. Lungenkrebsdiagnose und –Therapie u.ä.), wird die Zahl künftig weiter anwachsen. Dank der modernen Methoden der Molekulardiagnostik wird das Thema der Prävention eine neue Bedeutung bekommen und maßgeschneiderter werden: Die Prädisposition für mache Krebsarten oder für Kardiovaskuläre Erkrankungen lässt sich heute durch einen Gentest ermitteln. Entsprechende Vorsorgemaßnahmen (häufigere Untersuchungen, gesündere Ernährung, mehr Bewegung) können somit frühzeitig durchgeführt werden. Sind Biosimilars die besseren Generika? Die Biosimilar-Produktion ist sehr aufwendig. Der Wettbewerb belebt das Geschäft. Einsparungen für das Gesundheitssystem? Biosimilars sind Nachahmerpräparate von Biotech-Arzneimitteln nach deren Patentablauf, die häufig als Generika missverstanden werden. Biosimilars (meistens Arzneimittel auf Proteinbasis) sind nicht besser als „Generika“, sie sind einfach anders. Im Gegensatz zu Generika kann ein Biosimilar aufgrund der Komplexität dieser Moleküle und des Herstellungsprozesses durch lebende Zellen (Bakterien oder tierische Zellkulturen) keine exakte Kopie eines Originalproduktes sein. Eine exakte Kopie eines Biopharmazeutikums gelänge nur dann, wenn der gesamte Herstellungsprozess mit allen darin angewandten Schritten und unter Zuhilfenahme der gleichen biologischen Produktionszwischenstufen exakt gleich kopiert werden könnte. Hier macht aber die Biologie den Kopisten einen Strich durch die Rechnung. Ein genaues „Nachkochen“ ist nicht möglich. Daher wird in der Herstellung von Biopharmazeutika häufig von „the process is the product“ gesprochen, da die Eigenschaften des Produktes maßgeblich vom Herstellungsprozess abhängen. Biosimilars sind nicht völlig identisch zum Originalwirkstoff und erfordern deshalb aufwendigere Zulassungsverfahren und Überwachungsmaßnahmen als klassische Generika. Hauptgründe für diese Unterschiede sind die verschiedenen Organismen, auf denen das Zielprotein exprimiert wird, und die anderen angewendeten Verfahren wie Abtrennung und Reinigung. Häufige Unterschiede sind andersartige Glykosylierungsmuster, was Konsequenzen hat vor allem für die Pharmakokinetik hat. Bereits 2014 zeichnete sich ein Paradigmenwechsel ab: Erstmalig liefen dann mit einem Umsatz von 369 Millionen Euro mehr Biopharmazeutika aus dem Patent als chemische Wirkstoffe (283 Millionen Euro Umsatzvolumen).8 Es wird geschätzt, dass bis Ende 2020 Biopharmazeutika mit einem Marktwert von 43 Mrd. Euro ihren Patentschutz verlieren werden. Die zukünftige Bedeutung der Biosimilars wird offensichtlich, wenn man das Volumen der anstehenden Patentabläufe mit deren aktuellen Marktbedeutung vergleicht: Heute gibt es im Marktsegment der Biosimilars mehrere Wirkstoffe: Epoetin, Filgrastim,Somatropin, Follitropin alfa, Insulin glargin sowie die Antikörper Infliximab und seit Ende 2015 nun auch Etanercept. Diese stehen für einen GKV-Umsatz im Jahre 2014 von 100 Millionen Euro. Demgegenüber muss das gesamte Marktsegment der Biopharmazeutika gesehen werden, das noch nahezu vollständig patentgeschützt ist und etwa sieben Milliarden Euro umfasst.9 Es gibt viele Stimmen, die den verstärkten Einsatz von Biosimilars befürworten, denn sie versprechen sich hohe Einsparungen im Gesundheitssystem davon. Das Berliner IGES-Institut hat 2013 eine Studie zum Thema Einsparpotential im Gesundheitssystem dank Biosimilars vorgestellt. Laut Ergebnisse der Studie könnten bis 2020 die Gesundheitssysteme von acht EU-Staaten durch den Einsatz von Biosimilars insgesamt bis zu 33,4 Milliarden Euro einsparen - allein in Deutschland sieht IGES ein Einsparpotential von bis zu 11,7 Milliarden Euro.10 8 31.03.2016: http://www.sandoz.de/medien/pressemitteilungen/120524.shtml. 9 in Milliarden Euro AVP. 10 31.03.2016: http://www.sandoz.de/medien/pressemitteilungen/120524.shtml, http://www.iges.com/kunden/gesundheit/forschungsergebnisse/2013/biosimilars/index_ger.html. Zurück zur Übersicht - Hinweis: Dieses PDF-Dokument wurde automatisch von www.bpi.de erzeugt.