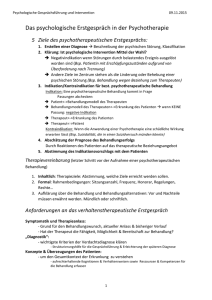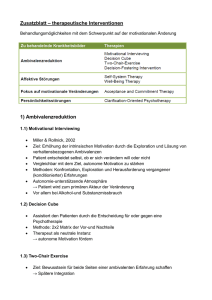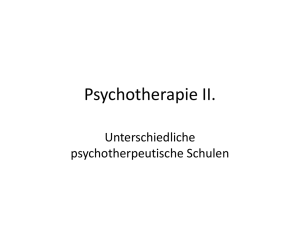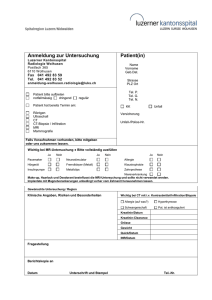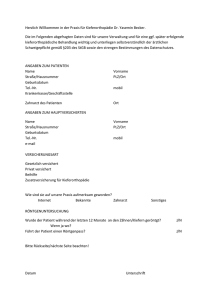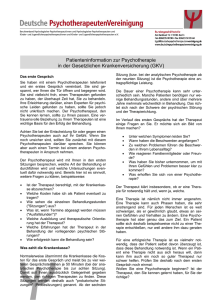Skript
Werbung

Schwerpunkt Wirkfaktorengestützte Fallkonzeption und Therapieplanung Originalia Originalia Wirkfaktorengestützte Fallkonzeption und Therapieplanung in der praktischen Anwendung – Eine Kurzform Armita Tschitsaz & Christoph Stucki Zusammenfassung: Vorgestellt wird eine Fallkonzeption, die ein Störungs- und Erklärungsmodell beinhaltet und der Therapieplanung zu Beginn einer Psychotherapie dient. Ziel ist es, ein integratives, schulen- und störungsunabhängiges Behandlungsmodell zu entwickeln, in dem die Patienten- und die Therapeutenperspektive einbezogen und empirisch gesicherte, für den praktischen Alltag einsetzbare Therapiemethoden und allgemeine Wirkfaktoren angewendet werden. Zudem soll die Fallkonzeption den Kriterien der differentiellen Indikation sowie einer individualisierten Therapieplanung gerecht werden. Im alltäglichen stationären und ambulanten Psychotherapiesetting fehlen die zeitlichen und personellen Ressourcen für eine sehr ausführliche Therapieplanung, so dass der Wunsch nach einer kürzeren Variante aufkommt. Die Fallkonzeption beschreibt Art und Ausmaß der Erkrankung, der psychosozia­ len Umstände des Patienten und macht Aussagen über seine Therapieziele, Ressourcen, Kognitionen, Bewältigungsfertigkeiten, systemische Verhältnisse, motivationale Ziele und somatische Erkrankungen. Die Entstehungsbedingungen und Funktionalität der Erkrankung werden erfragt. Anhand einer Fallvignette wird die Fallkonzeption illustriert. Schlüsselwörter: Fallkonzeption, individualisierte Therapieplanung, allgemeine Wirkfaktoren, integrative Psychotherapie, Therapiebeziehung, Motivation, Plananalyse Common and specific factor based case conceptualization and treatment planning in its practical application – a short form Abstract: A case formulation will be introduced, which incorporates both an explanatory model and an individualized treatment rationale for psychotherapeutic treatment planning. The aim is to conceptualize an integrative treatment model, which neither depends on therapeutic school nor on disorder specific rationales. Clients and therapeutic perspectives are to be combined with empirically supported therapeutic principles, which will include specific factors and common factors due to individual client needs. Criteria of differential indication and individualized treatment are to be followed. In daily routine, therapists need a concrete and manageable case conceptualization. Treatment planning includes patient information regarding to therapy aims, strengths, cognitions, coping skills, systemic conditions, motivational aims, course and functionality of disorder as well as treatment planning instruments like therapeutic principles, motiveorientated therapeutic relationship another change mechanisms. A single case will be introduced. Keywords: Case formulation, individualized treatment rationale, common factors, integrative therapy, therapy relationship, motivation, plan analysis Einleitung und theoretische Grundlagen Die Wirksamkeit von Psychotherapie Die Wirkung und Wirkungsweise von therapieeinflussnehmenden Faktoren sowie deren Zusammenhang zum Therapieerfolg werden in aufwendigen Forschungsdesigns untersucht. Die empirische Befundlage weist mit 0.8 hohe Effektstärken für die Effektivität von Psychotherapie auf (Lambert & Ogles, 2004). Zur Untersuchung der Ebenen von therapeutischer Wirksamkeit differenziert Pfammatter (2012) in seiner Taxonomie therapieschulenunabhängig zwischen der Ebene therapeutischer Techniken und allgemeiner Wirkfaktoren und grenzt diese von der störungs-, patienten- und therapeutenspezifischen Ebene ab. Verhaltenstherapie & psychosoziale Praxis, 45. Jg. (2), 399-417, 2013 vpp_02_2013_01.indb 399 399 06.05.2013 23:03:12 Originalia Die Ebene der therapeutischen Techniken beinhaltet eine Sammlung von therapieschulenspezifischen Interventionsstrategien wie positive Verstärkung, Exposition, Rollenspiel, Problemlösetraining, Fokussieren, Leer-/Zwei-Stuhl-Technik, zirkuläres Fragen, Skulpturarbeit, paradoxe Intention, reflektierendes Team, freie Assoziation, therapeutische Abstinenz, Übertragungsdeutungen, Widerstandsanalyse etc. Studien zur Effektivität dieser Psychotherapiemethoden bestätigen die Wirksamkeit vieler Behandlungsmethoden (Lambert & Ogles, 2004) und diskutieren sogar den therapeutischen Einfluss auf neurobiologische Korrelate (Berger & Caspar, 2009), weisen aber auch auf den Umstand hin, dass nur circa 15 % des Therapieerfolgs auf die angewandten Techniken zurückzuführen sei (Norcross & Lambert, 2011). Flückiger, Del Re, Wampold, Symonds und Horvath (2011) finden sogar nur eine Varianzaufklärung von 1 % bei Manualtreue. Unter allgemeinen Wirkfaktoren werden die drei Bereiche Therapiebeziehung, motivationale Aspekte des Patienten und Ebene therapeutischer Veränderungsprozesse verstanden. Die Therapiebeziehung wird durch Empathie, Zielübereinstimmung, Arbeitsallianz etc. beschrieben. Die motivationalen Aspekte des Patienten beinhalten Veränderungsbereitschaft oder Engagement. Die Ebene therapeutischer Veränderungsprozesse meint eine Ansammlung therapeutischer Wirkprinzipien (Caston­guay & Beutler, 2006) wie die Klärungsarbeit, korrektive Erfahrungen, Achtsamkeit, kognitive Umstrukturierung, Ressourcenaktivierung, Emotionsregulation etc. Der Einfluss dieser allgemeinen Wirkfaktoren auf das Therapieergebnis konnte empirisch belegt werden, wie z. B. die Wirkung der therapeutischen Beziehung (Horvath, Del Re, Flückiger & Symonds, 2011) mit etwa 7.5 % Varianzaufklärung,1 der Einfluss von Erwartung und Motivation auf der Patientenseite (CritsChristoph et al., 2007; Baskin, Tierney, Minami & Wampold, 2003; Ilardi & Craighead, 1999) oder der Ansatz der klärungsorientierten Psychotherapie nach Sachse (Kupper & Tschacher, 2006; Sachse, Püschel, Fasbender & Breil, 2008). Insbesondere die kontroversen Diskussionen über die Befundlage von Place1 Die homogenen Befunde über die Wirkung der Therapiebeziehung erscheinen besonders beeindruckend vor dem Hintergrund, dass die Gestaltung der therapeutischen Beziehung und das Sich-Einbringen in Abhängigkeit der Ausbildung der Therapeuten verschieden sein kann, z. B. in dem motivorientierten Ansatz (Grosse Holtforth & Castonguay, 2007), in der Gesprächstherapie (Sachse et al., 2008), im CBASP (McCullough, 2000) etc. 400 vpp_02_2013_01.indb 400 A rmita Tschitsaz & Christoph Stucki bo- und RCT-Studien verdeutlichen die ungeklärte Frage über das Verhältnis, in dem die einflussnehmenden Faktoren auf Psychotherapie wirken (Baskin et al., 2003; Fässler, Meiss­ner, Schneider, Linde, 2010; Herbert & Gaudiano, 2005; Raz et al., 2011; Tschuschke, 2005; Wampold, 2007). So werden in der Literatur die unterschiedlichsten Angaben über das Ausmaß des Einflusses von Manualtreue (Adhärenz), aber auch von Erwartungen auf das Therapieergebnis gemacht: Die Spannbreite geht von 15 % (Norcross & Lambert, 2011) bis über 40 % (Baskin et al., 2003; Ilardi & Craighead, 1999) und auch hier wird diskutiert, ob die Therapiebeziehung ein Mediator für den Zusammenhang zwischen Erwartung und Ergebnis darstellt (Arnkoff, Glass & Shapiro, 2002). Grosse Holtforth, Krieger, Bochsler und Mauler (2011) konnten nachweisen, dass nur das Ausmaß an positiven Erwartungen das Therapieergebnis prädizieren, nicht aber das negativer Erwartungen. Auch das Zusammenwirken von therapeutischen Techniken und allgemeinen Wirkfaktoren ist Gegenstand der Psychotherapieforschung, wobei es darum geht, das Zusammenspiel dieser beiden Faktoren im therapeutischen Prozess zu untersuchen. So konnte in aufwendigen Prozessstudien einerseits die Effizienz therapeutischer Techniken (Trijsburg et al., 2002; Tschitsaz & Lutz, 2009) auf das Therapieergebnis analysiert werden. Andererseits wurde der Einfluss allgemeiner Wirkfaktoren wie der therapeutischen Beziehung (Elliott, Bohart, Watson & Greenberg, 2011; Flückiger et al., 2011), plötzlicher Symptomveränderungen (Kelly et al., 2007; Lutz & Tschitsaz, 2007) und deren Rückmeldungen im Therapieverlauf (Lambert & Shimokawa, 2011; Lutz et al., 2006), Erwartung, Motivation oder Bindungsstil von Patient und Therapeut (Kazdin, 2007; Schulte, 2005; Stucki, 2004; Swift, Callahan & Vollmer, 2011) analysiert. Die Diskussion über die Wirkungsweise von Psychotherapie ist derzeit noch nicht abgeschlossen, wobei von einem multifaktoriellen Geschehen zwischen Manualtreue, allgemeinen Wirkfaktoren sowie Patienten- und Therapeutenmerkmalen ausgegangen wird (Norcross & Lambert, 2011; Orlinsky, Rønnestad & Willutzki, 2004; Pfammatter & Tschacher, 2012). Demgemäß fordert die Fallkonzeption über die therapeutischen Techniken hinaus den Einbezug verschiedener Sichtweisen der Beteiligten sowie allgemeiner Wirkfaktoren. Swift und Kollegen (2011) konnten die Hypothese stützen, dass die Berücksichtigung der Präferenz (für ein Therapieverfahren, eine Rolle oder einen Therapeuten) zu effektiveren Therapieresultaten führt. Ihre Metaanalyse ergab, dass die Abbruchrate niedriger und die Symptomverringerung höher war, Verhaltenstherapie & psychosoziale Praxis 06.05.2013 23:03:12 Wirkfaktorengestützte Fallkonzeption und Therapieplanung wenn die Patienten ihr gewünschtes Verfahren erhielten. Dabei spielte es keine Rolle, ob sie den gewünschten Therapieansatz, die gewünschte Rolle in der Therapie oder den gewünschten Therapeuten erhielten. Unter Berücksichtigung dieser Befunde erhalten die Patientenperspektive sowie deren Erwartungen einen wichtigen Stellenwert in der Therapieplanung. Individuelle Therapieplanung Eine individuell ausgerichtete Therapieplanung erscheint nicht nur vor dem Hintergrund der Implikation unterschiedlicher empirisch gesicherter Wirkfaktoren notwendig, sondern auch unter Berücksichtigung von Komplexität und Komorbidität eines jeden Patienten. Die oben dargestellten Befunde zur Wirksamkeit allgemeiner Wirkfaktoren bekräftigen die Argumente für eine differentielle Therapieplanung, indem der individuelle Patient die passenden Wirkprinzipien erhält. Der Vorteil von Manualen ist eine Beschreibung und Operationalisierung von Interventionen, die eine Grundlage zur Standardisierung von Prozessen für unterschiedliche Anwender bietet und die Transparenz erhöht. Die Situation im klinischen Setting erfordert eine Reduktion von Komplexität, wobei Leitlinien ein Instrument zur Strukturierung der Vorgehensweise darstellen. Gleichzeitig werden damit aber auch allgemeine Wirkfaktoren wie Therapiebeziehung, Therapeutenpersönlichkeit etc. vernachlässigt. Manualspezifische Interventionsstudien beziehen Komorbiditäten häufig zu wenig oder gar nicht mit ein, was nicht der Realität des therapeutischen Alltags entspricht. In einer Studie konnten Döpfner, Kinnen und Petermann (2010) den Umgang mit Manualen sowie die Risiko-Nutzen-Einschätzung unter Therapeuten erfragen. Es zeigte sich, dass sich fast 80 % der Befragten an Manuale halten und dies nicht von der Therapieerfahrung abhängig ist. Nur eine Minderheit mahnt Flexibilität und Individualisierung an, in der praktischen Umsetzung scheinen jedoch die meisten ihre Manuale individuumsorientiert einzusetzen. Die Autoren legen daher eine individuelle, wirkfaktorenbasierte Therapieplanung nahe. Die Empfehlung einer individuellen, patientenorientierten Therapieplanung unter Berücksichtigung der allgemeinen und spezifischen Wirkfaktoren wird auch von der Task Force Sektion Psychotherapie der APA2 2 Die APA (American Psychological Association) ist eine wissenschaftliche Organisation, die den Berufsstand der Psychologen in den USA vertritt. Die genannte Task Force Sektion Psychotherapie – eine Expertengruppe – beschäftigt sich mit der Frage, inwiefern die verschiedenen Aspekte der therapeutischen Beziehung den Therapieerfolg vorhersagen können. Originalia aufgrund von Meta-Analysebefunden abgegeben (Norcross & Lambert, 2011; Wampold, 2007). Eine selektiv prognostisch orientierte Indikation wurde in einer stationären Katamnesestudie (Schulz, Lotz-Rambaldi, Koch, Jürgen & Rüddel, 1999) untersucht, in der die Patienten in Abhängigkeit eines vorgegebenen Kriterienkatalogs (Diagnose, Behandlungsanliegen, Patientenwünsche, Patientenmerkmale wie soziale Kompetenz etc.) unterschiedlichen Behandlungsbedingungen zugeführt wurden. Die Evaluation ergab positive Befunde, die die Autoren als Bestätigung der differentiellen Indikationsstellung interpretierten. Eckert, Frohburg und Kriz (2004) konnten in einer Patientenbefragung nachweisen, dass der wahrgenommene Therapieerfolg bei über 55 % von den Passungen3 abhängt, die im Allgemeinen Modell von Psychotherapie (Orlins­ ky et al., 2004)4 angenommen werden. Caspar und Grosse Holtforth (2009) diskutieren in einem Überblicksartikel, inwiefern Responsiveness, d. h. ein Sich-Einstellen des Therapeuten auf die Besonderheiten eines Patienten, einer rein störungsspezifischen Therapie überlegen sei, wobei Responsiveness eine Form der Individualisierung über den gesamten Therapieverlauf meint statt nur zu Beginn der Therapie. Gemäß dem Ansatz sollte sich der Therapeut regelmäßig neu auf die Patientenmerkmale und die motivationale Ebene des Patienten einstellen und dementsprechend die therapeutischen Wirkprinzipien und die motivatonale Beziehungsgestaltung anpassen. Die beiden Autoren argumentieren mit der unterschiedlichen Wirkung therapeutischer Interventionen auf jeden Einzelfall, in der Literatur „AptitudeTreatment-Interaction“ genannt. Kramer et al. (2011) konnten die positive Wirkung des ResponsivenessAnsatzes empirisch untermauern, indem sie in der Therapie von Borderline-Störungen einen positiven Zusammenhang zwischen hoher motivorientierter Beziehungsgestaltung in der frühen Therapiephase (als Operationalisierung von Responsiveness) einer3 Gemäß dem allgemeinen Modell von Psychotherapie werden vier wechselhafte Übereinstimmungen („Passung“) gefordert: Die Art der Erkrankung des Patienten und sein dazu entwickeltes subjektives Krankheitsmodell, das Behandlungsmodell (Therapieverfahren) des Therapeuten sowie die therapiebezogenen und interpersonalen Merkmale des Patienten auf der einen und des Therapeuten auf der anderen Seite. 4 Das Allgemeine Modell (Generic Model; Orlinsky et al., 2004) beschreibt den psychotherapeutischen Prozess als hochkomplexes Interagieren von Interventionen, Patienten- und Therapeutenmerkmalen, Umgebungs- und Gesellschaftsfaktoren etc. 45. Jg. (2), 399-417, 2013 vpp_02_2013_01.indb 401 401 06.05.2013 23:03:12 Originalia seits und anderseits dem Erwerb interpersonaler Fertigkeiten sowie einer positiven Therapiebeziehung aufzeigen konnten. Vor dem Hintergrund der Befunde bedeutet dies den Anspruch an ein integratives, störungs­ übergreifendes Behandlungsmodell, das die Patienten- sowie die Therapeutenperspektive einbezieht, sich auf empirisch gesicherte Therapiemethoden stützt und somit eine individuell zugeschnittene Therapie plant. Die Allgemeine Psychotherapie Ein Beispiel, Psychotherapie zu integrieren und individuumsorientiert anzuwenden, wurde von Grawe eingeführt. In seinem Modell der Allgemeinen Psychotherapie (Grawe, 2004; Grosse Holtforth & Grawe, 2004) schlägt er die Berücksichtigung allgemeiner und spezifischer Wirkfaktoren auf empirisch gesicherter Datenlage vor. Das Störungsverständnis stützt sich bei ihm einerseits auf das Funktionsmodell des psychischen Geschehens, das die vier Grundbedürfnisse Lust, Bindung, Kontrolle und Selbstwerterhöhung vorsieht (Epstein, 1990), die mittels motivationaler Schemata erreicht respektive deren Verletzung vermieden werden sollen. Dabei stellen Annäherungsziele die Mittel dar, um Grundbedürfnisse zu erreichen, während Vermeidungsschemata vor deren Verletzung schützen sollen. Grawe (2004) stützt sein Funktionsmodell mittels zahlreicher empirischer Befunde aus Neuro-, Motivations- und Differentialpsychologie. Gemäß Carver und Scheier (1998) gibt es im psychischen Geschehen zwei funktional voneinander unabhängige Subsysteme der Selbstregulation: das Annäherungund Vermeidungssystem. Diese beiden Systeme lassen sich neurobiologisch unterscheiden (Gray & McNaughton, 2003) und konnten in der Differential­ psychologie als unabhängige Temperamentstypen klassifiziert werden (Diener & Lucas, 1999; Elliot & Thrash, 2002). Die Operationalisierung motivationaler Schemata und deren Zielkomponenten können induktiv mittels einer Plananalyse (Caspar, 2009) erfolgen. Annäherungs- und Vermeidungsziele stehen im Konflikt zueinander, wenn bei jeder Aktivierung von Annäherungszielen gleichzeitig Vermeidungsziele aktiviert sind;5 der Mensch erlebt einen motivationalen Konflikt. Eine Übersicht über die empirische Befundlage zur Existenz und Erfassung von Vermeidungsschemata sowie dem Zusammenhang zwischen Wohlbefinden, Psychopathologie und interpersonalen Problemen bietet Grosse Holtforth (2008). 5 402 vpp_02_2013_01.indb 402 A rmita Tschitsaz & Christoph Stucki Die Therapieplanung basiert zudem auf der Konsistenztheorie. Sind gleichzeitig aktivierte psychische Prozesse unvereinbar, erlebt der Mensch Inkonsistenz, was die Entstehung und Aufrechterhaltung psychi­ scher Erkrankungen begünstigt. Diese Inkonsistenz teilt sich in Diskordanz und Inkongruenz. Diskordanz meint den Konflikt zwischen zwei innerpsychischen Schemata, während Inkongruenz die Diskrepanz zwi­ schen der realen Wahrnehmung und den aktivierten Zielen meint. Ziel der Allgemeinen Psychotherapie ist die Reduktion von Inkonsistenz, die korrelativ mit Wohlbefinden und Symptomausprägung zusammenhängt (Grawe, 2004). Gemäß dem Vulnerabilitäts-Stress-Modell wird die Entwicklung psychopathologischer Symptome wahrscheinlicher, wenn große Vulnerabilitäten/ Verletzlichkeiten und einschneidende Lebensereignisse (Stressoren) aufeinander treffen. Die Verletzung von Grundbedürfnissen in der Kindheit sowie genetische Prädispositionen führen zu der Entwicklung von Vulnerabilitäten, die wiederum nachfolgend auf die Bedürfnisentwicklung Einfluss nehmen. Ungünstige Belastungen oder Anforderungen in der Gegenwart sind Stressoren, die zu Inkonsistenzen führen, die den Nährboden für die Entstehung psychischer Erkrankungen bilden. Inkongruenzen können im Störungsmodell auslösende und/oder aufrechterhaltende Faktoren sein. Ziel der Therapie ist die Entwicklung einer emotionalen Widerstandsfähigkeit (Resilienz) durch die Bearbeitung von Emotionsregulation und Inkongruenzquellen, die den Umgang mit Inkonsistenzerfahrungen erleichtert. Trachsel, Gurtner, von Känel und Grosse Holtforth (2010) analysierten in einer Risikogruppe von Arbeitslosen den Konflikt zwischen dem Ausdruck von Emotionen versus der Angst vor negativen Konsequenzen bei Ausdruck von Gefühlen. Das Unterdrücken des Emotionsausdrucks wird als Vulnerabilitätsfaktor für die Entwicklung von Depressionen in stressauslösenden Verhältnissen angenommen. Es zeigte sich, dass der Konflikt, Emotionen auszudrücken, die Gesundheit von Personen mit Depressionen besonders dann zu belasten scheint, wenn diese ein hohes Inkongruenzerleben haben. Für die Therapieplanung der Allgemeinen Psychotherapie wird eine Fallkonzeption des Patienten zu Beginn der Therapie angefertigt (Grosse Holtforth & Grawe, 2004; Itten, Trösken & Grawe, 2004). Diese Fallkonzeption hat den Anspruch, patientenorientiert, individuell maßgeschneidert und detailliert die Lebens- und Behandlungssituation des Patienten zu erfassen sowie die Planung der therapeutischen Interventionen. Verhaltenstherapie & psychosoziale Praxis 06.05.2013 23:03:12 Wirkfaktorengestützte Fallkonzeption und Therapieplanung Entwickelt und evaluiert wurden die Konzepte der Therapieplanung zunächst im universitären Rahmen, wobei die Interventionen an einer universitären Psychotherapieambulanz angewandt wurden. Auch in der Ausbildung von Psychologischen Psychotherapeuten dient die Fallkonzeption als Behandlungsrahmenmodell. In einem zweiten Schritt etablierten sich die Konzepte im stationären Rahmen, die Qualitätssicherung wurde durch Diagnostik und Supervision in den Kliniken sichergestellt. Da die Fallkonzeption aufgrund ihrer Ausführlichkeit und der Ressourcenknappheit der BehandlerInnen für den praktischen Einsatz schwer umzusetzen ist, bedarf es einer kürzeren Variante. Gleichzeitig sollen Einflussfaktoren wie die Behandlungsperspektive oder die Erwartungen vor dem Hintergrund neuerer Forschungsbefunde berücksichtigt werden. Fallkonzeption und Therapieplanung in der Anwendung – Eine Kurzform Tritt ein Patient in ein stationäres Setting ein, werden in einem Erstgespräch und der nachfolgenden Diagnostik vielfältige Informationen zu Anamnese, Symp­ tomatik, Genogramm etc. im Team erhoben. Im Rahmen einer Fallkonzeption wird anhand dieser Informationen zunächst ein Problemverständnis für die Situation des Patienten sowie die Entstehung und Aufrechterhaltung seiner Schwierigkeiten erstellt. In einem zweiten Schritt wird daraus eine Therapieplanung abgeleitet, die auf die spezifischen Probleme des Patienten und seine Situation abgestimmt ist. Die Einführung einer einheitlichen Fallkonzeption dient der Koordination im Behandlungsteam, der Verbesserung der Behandlungsqualität wie auch der Weiterbildung von Therapeuten. Die von uns vorgeschlagene Kurzvariante erfragt zunächst die Belastungen und Symptome. Problembereiche, Belastungen, Konflikte: Die Beschreibung der Probleme geht über die Nennung von ICD-Diagnosen hinaus. Beschrieben werden sollen psychische und somatische Probleme, psychosoziale Belastungen (z. B. Arbeitslosigkeit, Partnerverlust, Schulden etc.) und Konflikte (z. B. interaktionelle Probleme am Arbeitsplatz, in Paarbeziehungen, motivationale Konflikte etc.). Das Festlegen von Therapiezielen zu Beginn der Behandlung ist ein fester Bestandteil der verhaltenstherapeutischen Tradition (Kanfer, Reinecker & Schmelzer, 2006; Schulte, 2005) und dient der Therapiestruk- Originalia turierung, der Motivierung des Patienten und einem Hinarbeiten auf einen erwünschten Sollzustand. Strauss und Burgmeier-Lohse (1995) untersuch­ ten die Aufnahmebereitschaft von Patienten für bestimmte therapeutische Vorgehensweisen und fanden heraus, dass Übereinstimmungen zwischen den Auffassungen des Patienten und des Therapeuten im Hinblick auf die Ziele der Therapie und deren Realisierung maßgeblich für die Qualität der therapeutischen Beziehung und den Therapieerfolg sind. Auch Studien zur Therapiebeziehung konnten nachweisen, dass eine Übereinstimmung der Therapieziele (Bordin, 1994) die Therapieallianz stärkte. Insbesondere in Berücksichtigung dieser Befunde werden in der Fallkonzeption die Interessen und Ziele beider Perspektiven erfragt. Kanfer et al. (2006), Willutzki und Koban (2004) sowie Grosse Holtforth und Castonguay (2007) bieten einen ausführlichen Überblick über Therapiezielherleitung und empirische Belege der Effektivität. Behandlungsziele: – Anliegen/Auftrag/Ziele PatientIn: Hier werden die vom Patienten formulierten Behandlungsanliegen und Therapieziele beschrieben. Die Ziele sind realisierbar und inhaltlich unproblematisch. Die Anliegen sollen zudem konkret gehalten werden, d. h. über allgemeine Formulierungen hinausgehen (z. B. „wieder auf Leute zugehen können“, „wieder mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren können“ statt „gesund werden“ oder „es soll mir besser gehen“). – Anliegen/Auftrag/Ziele anderer (inkl. Therapeuten): Häufig werden Anliegen anderer an die Behandlung herangetragen. Dies können Anliegen von Angehörigen („Entlastung“, „Pause“, „mehr Mithilfe“, „keine Wutausbrüche mehr“), Arbeitgebern („Belastbarkeit erhöhen“, „wieder arbeitsfähig machen“), ambulanten Therapeuten („diagnostische Einschätzung“, „Medikamentenumstellung“, „Abwesenheitsüberbrückung“) oder anderen Personen sein. Anliegen werden häufig nicht explizit formuliert, schwingen aber „implizit“, d. h. unausgesprochen, mit. Anliegen können nicht zuletzt auch vom Therapeuten an den Patienten herangetragen werden („er muss gesund werden, sonst bin ich ein schlechter Therapeut“, „er sollte mit Rauchen aufhören“, „er sollte sich von der Partnerin trennen, die tut ihm nicht gut“). – Vereinbarte Ziele und Schwerpunkte der Therapie: Uneinheitliche Anliegen können 45. Jg. (2), 399-417, 2013 vpp_02_2013_01.indb 403 403 06.05.2013 23:03:12 Originalia eine Behandlung erschweren. Anliegen, für die der Patient keine Motivation mitbringt, sind in der Regel schwer umzusetzen. Anliegen anderer können u. U. aber durchaus legitim sein (z. B. „Entlastung der Angehörigen bei schwer beeinträchtigten Patienten“). Nach der Sammlung der Anliegen sollen daher hier die mit dem Patienten gemeinsam vereinbarten (und realisierbaren) Ziele und Therapieschwerpunkte formuliert werden. In einem zweiten Schritt werden vor dem Hintergrund der oben aufgeführten Allgemeinen Psychotherapie die motivationalen Schemata und ihre Zielkomponenten des Patienten mittels plananalytischer Überlegungen erfragt. Das plananalytische Vorgehen konnte für die Erfragung instrumentellen Verhaltens für unterschiedliche Patientengruppen skizziert werden und dient insbesondere dem Verstehen von auffälligem Verhalten (Caspar, 2009; Caspar & Berger, 2011). Persönlichkeitsstil/Pläne/Schemata: In diesem Teil der Fallkonzeption geht es um das psychische Funktionieren des Patienten. Hier wird beschrieben, mit welchen Strategien Patienten ihre (Grund-)Bedürfnisse befriedigen. Es wird angenommen dass Menschen, die ihre Bedürfnisse befriedigen können, psychisch gesünder sind, während mangelnde Befriedigung von Grundbedürfnissen ein hohes Risiko für psychische Erkrankungen darstellt. Viele Patienten wenden Strategien an, die kurzfristig durchaus hilfreich, mittelfristig aber dysfunktional sind, hohe Kosten verursachen und eine gute Befriedigung von Grundbedürfnissen verhindern. (z. B. „über Beschwerden klagen“ bringt kurzfristig häufig Mitleid und Zuwendung (Bindung), mittelfristig können sich aber andere von einem abwenden; insbesondere wenn die Strategie im Übermaß angewandt wird. „Zwanghaftes Kontrollieren“ hilft zwar kurzfristig ein Gefühl der Kontrollierbarkeit zu erzeugen, aber mittelfristig nicht, das Gefühl von Unsicherheit besser auszuhalten. Gleichzeitig führt die damit verbundene Anstrengung, Zeitverlust und eventuell das Gefühl, nicht normal zu sein, erst recht dazu, das Leben nicht mehr im Griff zu haben). Es werden hier Verhaltensweisen („klagt über Beschwerden“, „kontrolliert ständig“ etc.) beschrieben, die der Therapeut beobachtet, die der Patient erzählt oder die Dritte berichten. Es werden auch „Pläne“ formuliert, die die Grundlage des Verhaltens sind („sei immer nett und freund- 404 vpp_02_2013_01.indb 404 A rmita Tschitsaz & Christoph Stucki lich, dann werden sich andere nicht von dir abwenden“, „vermeide Fehler“ etc.). Die Pläne sind in der Regel dem Patienten nicht bewusst. Die erfolgreiche Aktivierung von Patientenressourcen im therapeutischen Prozess konnten Flückiger, Caspar, Grosse Holtforth und Willutzki (2009) in einer aufwendigen Prozessstudie nachweisen. Der Fokus auf die Kompetenzen und persönlichen Ziele der Patienten gelang besser, wenn die Therapeuten zu Therapiebeginn kurz ein Ressourcenaktivierungstraining erhielten, und dieser Fokus nahm direkten Einfluss auf das Therapieergebnis bezüglich Selbstbewusstsein, Bewältigungs- und Klärungserfahrun­ gen. Ressourcenaktivierung: Ressourcen PatientIn – Therapeutische Interventionen: Als Ressource eines Patienten kann alles bezeichnet werden, was dem Patienten hilft, mit einem Problem/einer Situation besser umzugehen: Stärken, Wissen, Fähigkeiten, soziales Umfeld, aber auch Ziele und Wünsche können Ressourcen sein. Therapeutische Interventionen können „kleine Verstärkungen“ („das haben Sie gut gemacht“) sein, aber auch die Durchführung längerer Ressourceninterventionen beinhalten: z. B. Situationsanalysen aus Ressourcenperspektive (wann tritt ein Problem nicht auf?); Ressourcenimaginationen; Genogramm aus Ressourcenperspektive, etc.). Ressourcen müssen nicht immer inhaltlich thematisiert werden, sondern können auch prozessual aktiviert werden, d. h. ohne dass diese explizit angesprochen werden (z. B. sich über Wissensgebiet des Patienten unterhalten, sich Werke aus der Ergotherapie zeigen lassen, dem Patienten Verhalten zutrauen etc.). Ziel der motivorientierten Beziehungsgestaltung ist die Herstellung bedürfnisbefriedigender Erfahrungen im therapeutischen Kontext. Der Therapeut unterstützt dabei die Umsetzung der Annäherungsziele und hält die Aktivierung der Vermeidungsziele gering oder bearbeitet die dahinter liegenden Befürchtungen mittels gezielter therapeutischer Interventionen (Grosse Holforth & Castonguay, 2007). So könnte z. B. die Befürchtung vor Zurückweisung mit der Methode der kognitiven Umstrukturierung inhaltlich thematisiert werden oder prozessual, indem der Patient die Erfahrung der Zurückweisung nicht machen muss, wenn er seinem Annäherungsziel (z. B. sich autonom verhalten, sich für sich einsetzen o. Ä.) Verhaltenstherapie & psychosoziale Praxis 06.05.2013 23:03:12 Wirkfaktorengestützte Fallkonzeption und Therapieplanung folgt. Gleichzeitig beinhaltet motivorien­tierte Beziehungsgestaltung, dass der Therapeut erkennt, wenn ein Patient maladaptive Strategien und Verhaltensweisen zur Befriedigung seiner Bedürfnisse einsetzt und diese dann auf einer höheren motivationalen Ebene befriedigt (Stucki, 2008). Therapeut und Patient können so eine emotionale Bindung aufbauen, und der Patient erlebt „korrektive Erfahrungen“ (Grosse Holtforth & Castonguay, 2007). Erstmalig lieferte die Berner Therapievergleichsstudie (Grawe, Caspar & Ambühl, 1990) empirische Hinweise auf den positiven Effekt der motivorientierten Beziehungsgestaltung, in der die interaktionelle Verhaltenstherapie (IVT6) in manchen Ergebnismaßen den anderen Therapieansätzen, vor allem in der Patientenperspektive, überlegen war. Zudem hing der Therapieerfolg in der IVT weniger von Patienteneigenschaften ab und auch die Anzahl der Therapieabbrüche war geringer. Caspar, Grossmann, Unmüssig und Schramm (2005) untersuchten den Einfluss spontaner motivorientierter Beziehungsgestaltung auf das Ergebnis von interpersonaler Therapie bei 22 depressiven stationären Patienten. In dieser Studie war das spontane Therapeutenverhalten, das den wichtigsten motivationalen Zielen der Patienten entsprach, mit besseren Therapieergebnissen verbunden. Stucki (2004) analysierte das Beziehungsverhalten von Therapeuten in den ersten drei Sitzungen bei 30 ambulanten Patienten mit allgemeiner Psychotherapie, die die systematische Umsetzung der Prinzipien der motivorientierten Beziehungsgestaltung vorsieht. Es zeigt sich, dass Therapeuten ihr Verhalten besser an die motivatio­ nalen Ziele der Patienten anpassten, wenn ihre Patienten ihre Beziehung positiv einschätzten. Patienten, die ihre therapeutische Beziehung als nicht positiv angaben, erfüllten gleichzeitig die Kriterien einer interpersonellen Auffälligkeit. Dieses Ergebnis deckt sich mit den Befunden von Caspar und Grosse Holtforth (2009), nach denen die Anwendung der motivorientierten Beziehungsgestaltung bei interpersonell auffälligen Patienten schwieriger zu realisieren sei als bei interpersonell unauffälligen. Für die therapeutische Beziehungsgestaltung bedeute dies, dass der Fokus „auf ein bestimmtes Segment im interpersonalen Zirkel“ gerichtet sein sollte (ebd.). Originalia Beziehungsgestaltung: – Beziehungsgestaltung – Therapeutisches Vorgehen: Eine individuelle motivorientierte Beziehungsgestaltung ermöglicht dem Patienten, bedürfnisbefriedigende korrektive Erfahrungen in der therapeutischen Beziehung zu machen und dient dem Aufbau von Beziehungskredit, der notwendig ist, um problemaktivierende Interventionen erfolgreich durchführen zu können. Unterschieden werden dabei Annäherungsziele, die der Therapeut in seinem Beziehungsverhalten verstärkt und Vermeidungsziele, die der Therapeut nur so weit aktiviert, wie es nötig ist. Erreicht werden soll eine möglichst gute Passung von Beziehungsverhalten des Therapeuten mit dem motivationalen Funktionieren des Patienten: Annäherungsziele (AZ) PatientIn: Beispiele: „verstanden werden“, „selbst entscheiden können“ Vermeidungsziele (VZ) PatientIn: Beispiele: „blamiert werden“, „kritisiert werden“, „im Stich gelassen werden“. Der Therapeut überlegt sich, mit welchen Verhaltensweisen und Interventionen er die Motive des Patienten unterstützen kann (Annäherungsziele) und wie er als Therapeut die Vermeidungsziele des Patienten so wenig wie nötig aktiviert(Vermeidungsziele). Beispiel: AZ „verstanden werden“: Therapeut hört besonders genau zu; fragt nach, ob er den Patienten richtig verstanden hat; vergisst Gesagtes nicht; lässt den Patienten viel erzählen und erklären etc. Beispiel: AZ „selbst entscheiden können“: Therapeut gibt mehrere Möglichkeiten vor, Patient kann wählen; Therapeut hebt hervor, wie wichtig ihm die Meinung des Patienten ist etc. Beispiel: VZ „blamiert werden“: Therapeut lässt Patienten nicht „auflaufen“; schützt ihn vor Gesichtsverlust (z. B. in Gruppentherapie); vermeidet Überforderung des Patienten; konfrontiert nur, wenn Beziehungskredit da ist. Beispiel: VZ „im Stich gelassen werden“: Therapeut signalisiert unbedingten Rückhalt, steht hinter dem Patienten, auch wenn dieser sich kritisch äußert; er bereitet Austritt, respektive (Therapeuten)-Wechsel gut vor; bespricht, wie der Patient sich Unterstützung verschaffen kann usw. 6 Eine Weiterentwicklung der IVT ist die Allgemeine Psychotherapie. Die Erarbeitung eines Erklärungsmodells zu auslösenden und aufrechterhaltenden Faktoren sowie – – – – – – 45. Jg. (2), 399-417, 2013 vpp_02_2013_01.indb 405 405 06.05.2013 23:03:13 Originalia der Einsatz entsprechender empirisch gesicherter Interventionen stellt das Herzstück der verhaltenstherapeutischen Tradition dar. Ein plausibles Erklärungsmodell dient zur Orientierung, Kontrolle und Einsicht in die therapeutischen Arbeit. Die Identifikation von auslösenden und aufrechterhaltenden Bedingungen unter Berücksichtigung von emotionalen, kognitiven, situativen oder systemischen Aspekten wird anschaulich von Kanfer et al. (2006) in dem SORCK-Modell dargestellt. Die Notwendigkeit eines Ordnungssystems mithilfe von Erklärungsmodellen unter Berücksichtigung des Krankheitsverständnisses des Patienten sowie der positive Einfluss dieser Erklärungsmodelle auf Therapieprozess und -ergebnis wurden von Bhui und Bhugra (2002) nachgewiesen. Forschungsbefunde zeigen, dass die Entwicklung von Erklärungsmodellen in der Therapie Einfluss auf emotionales Coping, Behandlungspräferenzen, Mitarbeit, Therapiebeziehung und Behandlungszufriedenheit nimmt (Ghane, Kolk & Emmelkamp, 2010). Sulz et al. (2011) haben in einer empirischen Untersuchung die subjektiven Einstellungen, motivationalen Ziele, Emotionen und Schemata von 103 Patienten einer qualitativen Analyse unterzogen. Die Autoren gehen aufgrund ihrer Befunde von der Effektivität von Verhaltensanalysen innerhalb der Fallkonzeption auf den Therapieerfolg aus, da die therapeutische Arbeit an diesen konzipierten individuellen Aspekten zu zufriedenstellenden Effektstärken führte. Störungsmodell und therapeutische Interven­ tionen: Erklärungs- und Veränderungsmodell PatientIn: Hier werden Fragen zum Störungsmodell des Patienten beantwortet: – Wie erklärt sich der Patient, wie es zu seinem Problem gekommen ist? – Geht er davon aus, dass sein eigenes Verhalten zum Problem geführt hat oder sieht er die Ursache in der Erkrankung, den Umständen oder den Fehlern der anderen? Was denkt der Patient, was es braucht, damit es ihm wieder besser geht? – Kann er selbst etwas dazu beitragen oder geht er davon aus, dass Medikamente oder der Therapeut die Veränderungen herbeiführen? Die Notwendigkeit, die subjektive Perspektive des Patienten einzubeziehen, hat bereits Fiedler (2003) in seinem Konzept der integrativen Psychotherapie vorgenommen; in seinem Modell werden die Pati- 406 vpp_02_2013_01.indb 406 A rmita Tschitsaz & Christoph Stucki entensicht zu Therapiezielen, Erwartungen, Motivation und Erklärungsmodell erfragt. Die Übereinstimmung zwischen der Therapeuten- und Patientensicht bezüglich des Krankheitsmodells, von Orlinsky und Kollegen als Passung3 bezeichnet (2004), gehört zu einem der Faktoren, der den Therapieerfolg determiniert (Eckert et al., 2004). Erklärungs- und Veränderungsmodell TherapeutIn: Hier werden Fragen zum Störungsmodell des Therapeuten beantwortet: – Entstehung der Störung: Wie erkläre ich mir als Therapeut die Entstehung der Störung – An welchen Faktoren muss ich ansetzen, um eine Veränderung zu bewirken? (Faktoren der Entstehung und Aufrechterhaltung einer Störung können nicht immer auseinandergehalten werden, respektive dienen häufig der Entstehung und Aufrechterhaltung einer Störung. Psychische Störungen können allerdings häufig fortbestehen, auch wenn die Faktoren, die zur Entstehung geführt haben, mittlerweile nicht mehr bestehen. Daher kann eine Unterscheidung von Entstehungs- und Aufrechterhaltungsfaktoren sinnvoll sein.) Als aufrechterhaltende Faktoren werden die Eigendynamik der Störung erfragt, motivationale und systemische Perspektive, Copingstrategien, Entwicklungsanforderungen und körperliche/biologische Aspekte. Therapeutisch fließt hier einerseits störungsspezifisches Wissen über die zu behandelnde Erkrankung des Patienten ein, z. B. Expositionstraining für Zwangserkrankte (s. o.; Castonguay & Beutler, 2006; Lambert & Ogles, 2004). In der oben erwähnten Studie von Sulz und Kollegen (2011) werden, in Anlehnung an Kanfers Modell, innerhalb der Reaktionskette selbstverstärkende Faktoren erfragt sowie Interventionsvorschläge gegeben. Anderseits nehmen therapeutische Wirkprinzipien Einfluss, die oben detailliert dargestellt wurden. Perspektive der Eigendynamik der Störung: Sich selbst verstärkende Prozesse Welche Faktoren der Störung führen dazu, dass die Störung aufrechterhalten wird und sich noch verstärken kann? Hier werden sich selbst verstärkende Prozesse möglichst konkret beschrieben (Beispielangaben): – Angst: Negative Bewertungsprozesse (z. B. Katastrophisierung), Selbstbeobachtung, Checking-Verhalten, Vermeiden. Verhaltenstherapie & psychosoziale Praxis 06.05.2013 23:03:13 Wirkfaktorengestützte Fallkonzeption und Therapieplanung – Depression: Negative Bewertungsprozesse (z. B. Übergeneralisierung), Grübeln, Inaktivität, sozialer Rückzug, Vermeiden. – Sucht: Biologische Prozesse (z. B. Toleranzentwicklung), psychische Abhängigkeit, Gefühl der Scham, sozialer Rückzug. – Essstörung: Biologische Prozesse (z. B. körperliche Folgeerscheinungen bei Untergewicht), Gefühl der Kontrolle, Wegfallen von Spannung. – Borderline: Aufmerksamkeitsgewinn, Gefühl der Kontrolle, Wegfallen von Spannung. Welche Interventionen sind notwendig, um die oben beschriebenen selbstverstärkenden Prozesse zu unterbrechen? (Beispielangaben) – Angst: Psychoedukation, Kognitive Umstrukturierung, Übungen zur Demonstration der Effekte der Selbstbeobachtung, Konfrontationsübungen etc. – Depression: Psychoedukation, Kognitive Umstrukturierung, Aktivitätenaufbau, soziale Verstärkung etc. – Sucht: Psychoedukation, 4-Felder-Entscheidungmatrix, Stimuluskontrolle, Konfrontationsübungen etc. – Essstörungen: Psychoedukation, Normalisierung des Essverhaltens, Bearbeitung der Körperschemastörung, Selbstkontrolltechniken etc. – Borderline: Skills, Stresstoleranzübungen, emotionales und soziales Kompetenztraining, etc. Vor dem theoretischen Hintergrund, dass motivationale Konflikte als implizites Wissen von Schemata zu verstehen sind, ist eine empirische Erfassung dieser Konflikte schwierig. In der Vergangenheit hat das Team um Lauterbach eine computerbasierte Konfliktdiagnostik entwickelt, um eine empirische Methode zur objektiven Erfassung innerpsychischer Konflikte zu entwickeln. Das Programm erfragt Kognitionen (wertende Einstellungen, selbstzugeschriebene Realitäten, Meinungen zu den Wechselwirkungen) zu ausgewählten Lebensbereichen und prüft ihre Konflikthaftigkeit anhand struktureller Merkmale. Die Untersuchung von Patienten- und sympto­matisch unbelasteteren Gruppen bestätigt einen hohen Zusammenhang von persönlicher Konfliktbelastung mit psychosomatischer oder psychiatrischer Symptombelastung (Lauterbach & Newman, 1999). Stangier, Ukrow, Schermelleh-Engel, Grabe und Lauterbach (2007) untersuchten den intrapersonalen Konflikt bezüglich Zielen und Werten bei Menschen mit Originalia Depressionen anhand der oben beschriebenen Computerdiagnostik. Patienten zeigen mehr und stärker ausgeprägte Konflikte als Gesunde; zudem weisen Pfadanalysen darauf hin, dass interpersonale Probleme das Ausmaß an erlebten intrapersonalen Konflikten verstärken. In einer jüngeren Studie wurde ein spezifischer Annäherungs-Vermeidungskonflikt in einer Risikogruppe von Arbeitslosen analysiert (Trachsel et al., 2010). In Anlehnung an das Vulnerabilität-StressModell gingen die Autoren davon aus, dass einem gehemmten Emotionsausdruck bei Depressionspatienten der Konflikt zwischen dem Wunsch nach Emotionsausdruck und der Angst vor dem Erleben von negativen Konsequenzen zugrunde liege. Die Umfrage bestätigte den Zusammenhang zwischen dem Konfliktausmaß und der Depressivität. Kelly et al. (2011) erfragen Konflikte zwischen Zielen und Ambivalenzen bezüglich Ziele per Fragebogen, d. h. auf expliziter Ebene. Die Autoren interpretieren ihren Befund, dass depressive Symp­ tome bei Menschen mit niedrigem Konfliktlevel und hoher Ambivalenz stark ausgeprägt waren, als Hinweis auf das Vorhandensein von impliziten motivationalen Konflikten, die den Nährboden für depressive Symptome bilden. Motivationale Perspektive: – Konflikte zwischen Zielen/Motiven ausgeprägtes Vermeidungsverhalten: Motivationale Konflikte und zu stark ausgeprägte Vermeidungsziele sind Risikofaktoren für die Entstehung und Aufrechterhaltung psychischer Störungen. Hier werden die wichtigsten motivationalen Konflikte und ausgeprägte Vermeidungsziele des Patienten beschrieben. Beispiele für Konflikte: – Beispiel 1: Vermeide im Stich gelassen, in Beziehungen enttäuscht zu werden vs. Wunsch nach Nähe, Offenheit, Verlässlichkeit in Beziehungen: Je mehr der Patient sich auf eine Beziehung einlässt, sich öffnet, desto größer wird seine Angst, der anderen Person nicht zu genügen, von ihr im Stich gelassen zu werden und damit in Beziehungen (erneut) enttäuscht und verletzt zu werden. Je weniger der Patient sich andererseits auf Beziehungen einlässt, desto größer wird sein Wunsch nach Nähe und Beziehung sein. – Beispiel 2: Vermeide Versagen, vermeide Minderwertigkeitsgefühle vs. Wunsch 45. Jg. (2), 399-417, 2013 vpp_02_2013_01.indb 407 407 06.05.2013 23:03:13 Originalia nach Eigenständigkeit, bedingungsloser Akzeptanz: Je mehr der Patient zu sich steht, seinen eigenen Weg geht, desto stärker wird seine Angst, den Anforderungen und Erwartungen nicht zu genügen und zu versagen. Je mehr der Patient andererseits ein Versagen um jeden Preis vermeidet, eigene Entscheidungen und Risiken nicht eingeht, desto stärker wird das Gefühl werden, nicht so zu leben, wie ihm das entspricht. – Beispiel 3: Vermeide Abhängigkeit, Ausgenutzt werden vs. Wunsch nach Hilfe, Sicherheit, Unterstützung. Je mehr der Patient Hilfe und Unterstützung sucht und annimmt, desto stärker wird seine Angst, abhängig und ausgenutzt zu werden. Je mehr der Patient andererseits versucht, Abhängigkeit um jeden Preis zu vermeiden, desto stärker wird das Gefühl werden, auf sich allein gestellt zu sein, keine Unterstützung im Leben zu erhalten. Therapeutische Interventionen: Motivationale Konflikte können einerseits in biographischer Arbeit mit dem Patienten thematisiert und geklärt werden. Andererseits sollen dem Patienten korrektive Erfahrungen ermöglicht werden, die zu Schemaveränderung führen können. Dafür genutzt werden kann u. a. wiederum die therapeutische Beziehung. So kann dem Patienten Unterstützung und Rückhalt geboten werden und dabei gleichzeitig darauf geachtet werden, dass keine Abhängigkeit (von der Person des Therapeuten) entsteht. Der Therapeut kann eine stabile, verlässliche Beziehung anbieten, die Konflikte aushält und die weiterbesteht, auch wenn der Patient sich öffnet und schambesetzte Themen einbringt. Der Therapeut kann den Patienten besonders dann unterstützen, wenn er „seinen Weg geht“, wenn er sich etwas zutraut, auch wenn er einmal Fehler macht und Versagen riskiert usw. Bewältigungsfertigkeiten und Emotionsregulationsstrategien bilden einen wesentlichen Faktor für den Umgang mit den Vulnerabilitäten des Patienten. Die Effektivität therapeutischer Strategien zum Aufbau von Bewältigungsfertigkeiten in Bezug auf Problemverhalten, Emotionen und Neubewertungen sind bereits empirisch nachgewiesen (Kämmerer et 408 vpp_02_2013_01.indb 408 A rmita Tschitsaz & Christoph Stucki al., 2006; Kanfer et al., 2006; Sulz et al., 2011). Noeker und Petermann (2008) schlagen in ihrem empirisch belegten Modell einen Entwicklungspfad vor, der sich als Ergebnis von positiv bewältigten Belastungsepisoden versteht, die die Person durch die Anwendung funktionaler kognitiver Schemata und kompetenter Bewältigungsfertigkeiten erreicht. Eine Interaktion zwischen dem therapeutischen Angebot (hier: emotionale Aktivierung) und der nachfolgenden Emotionsregulation der Patienten konnte von Znoj und Kollegen (2004) gefunden werden. In der Studie zeigte sich, dass die Patienten in der Anfangsphase erfolgreicher Therapien auf vertiefende Bearbeitungsangebote distanzierend rea­ gierten und auf niederschwellige Bearbeitungsangebote mit weniger nonverbalem Ablenken. In der Endphase fanden sich keine signifikanten Zusammenhänge zwischen dem therapeutischem Angebot und nachfolgender Emotionsregulation mehr. Die Therapieeffektivität der Aneignung von Emotionsregulationsfertigkeiten zur Reduktion negativer Affektzustände nach einer Gruppentherapie konnte zudem von Berking et al. (2012) nachgewiesen werden. Die Fähigkeit zur Emotionsregulation (als eine der Strategien im Umgang mit Emotionen) erwies sich hier als Mediator zwischen dem Erwerb von Fertigkeiten im Umgang mit Emotionen und dem Symptomlevel. Eine Ausnahme bildete die Fertigkeit „Akzeptieren/ Tolerieren von negativen Gefühlen“, die direkt mit einem niedrigen Symp­tomlevel zusammenhängt, die Emotionsregulationsfähigkeit kein Mediator darstellt und somit in der Prävention zur Entstehung von psychischen Problemen relevant sein könnte. Coping-Perspektive: Ungünstige Problembewältigungsstrategien/ ungünstige Emotionsregulation: Hier wird möglichst konkret beschrieben, wie der Patient mit Problemen umgeht. Geht der Patient die Probleme an oder umgeht oder vermeidet er eine Konfrontation damit? Kann er veränderbare Probleme lösen? Kann er nicht veränderbare Probleme aushalten? Insgesamt soll hier überlegt werden, ob die Strategien günstig sind und der Zielerreichung dienen oder ob sich durch die Art der Problemlösung ein neues Problem ergibt (z. B. Vermeidungsverhalten, Suchtverhalten, Interaktionsprobleme etc.). Mit welchen Interventionen kann ich die Kompetenzen des Patienten im Umgang mit Problemen verbessern? Mögliche Interventionen: Psychoedukation, Analyse des Umgangs mit Problemen, Problemlöse- Verhaltenstherapie & psychosoziale Praxis 06.05.2013 23:03:13 Wirkfaktorengestützte Fallkonzeption und Therapieplanung techniken, Skills zur Emotionsregulation, Alternativen zu ungünstigem Verhalten wie Sucht, Vermeiden etc. Die Einbindung des Systems des Patienten konnte als therapeutisch effektiv nachgewiesen werden (Sexton, Alexander & Mease, 2004). Familie und Freundeskreis kommen bei der Behandlung von Symptomen eine besondere Bedeutung zu, da ihre Unterstützung den Patienten motivieren und stabilisieren kann. Eine Verbesserung familiärer Kommunikationsfertigkeiten unterstützt zudem die Bewältigungskompetenzen des Patienten. Anderseits kann das System bei der Aufrechterhaltung von Symp­ tomen eine dysfunktionale Rolle einnehmen, was in Therapiegesprächen aufgedeckt und in neuem Verhalten eingeübt werden kann. Die Therapiebeziehung als Mediator beeinflusst das Therapieergebnis in systemischen Therapien ebenso wirkungsvoll wie in der Einzeltherapie. Auch Patienten- und Therapeutenmerkmale wie Symptomausgangslage etc. stellen die gleichen Moderatoren dar wie für die Einzeltherapie bereits nachgewiesen (Friedlander, Escudero, Heatherington & Diamond, 2011; Sexton et al., 2004). Interpersonelle Perspektive: Ungünstiges Beziehungsverhalten, ungünstige aktuelle Beziehungen: Hier soll das Interaktionsverhalten des Patienten möglichst konkret beschrieben werden. Wie gestaltet er seine Beziehungen? Wie verhält er sich? Erreicht er mit diesem Verhalten seine Ziele? Insgesamt soll hier überlegt werden, ob das Beziehungsverhalten des Patienten günstig ist oder sich durch die Art der Beziehungsgestaltung neue Probleme ergeben (aufrechterhaltende Faktoren). – Wie sieht das Beziehungsnetz des Patienten aus? Welche Beziehungen, welche Aspekte von Beziehungen sind eine Ressource, welche sind problematisch? – Mit welchen Interventionen kann ich das Beziehungsverhalten des Patienten verbessern? – Wie kann ich hilfreiche Beziehungen verstärken, nutzen, ungünstige verändern? Mögliche Interventionen: Paargespräche, Bezugspersonen einladen, Interaktionsanalysen, Rollenspiele, CBASP etc. Perspektive der Entwicklungsanforderungen: In welcher Lebenssituation befindet sich der Patient? Welche „Aufgaben“ hat der Patient zu Originalia bewältigen? Was muss er lernen? Hier soll beschrieben werden, welche Anpassungsleistungen vom Patienten gefordert werden und welche Schritte bzw. Verhaltensweisen dazu notwendig sind, z. B. Eigenständigkeit, Ablösung, Akzeptanz, Abgrenzung etc. Eine Betrachtungsmöglichkeit ist die Einnahme der Lebensentwicklungsperspektive, wobei angenommen wird, dass in Lebenszeiträumen unterschiedliche Lebensthemen im Vordergrund stehen, die Veränderungs- und Anpassungsleis­ tungen erfordern (z. B. Ausbildung eigener Identität, Beziehungsaufnahme in Adoleszenz, Etablierung in Beruf und Familienfrage im jungen Erwachsenenalter, Umgang mit Einschränkungen im Alter etc.). Veränderungs- und Anpassungsleistungen können aber auch unvorhersehbare Ereignisse erfordern (z. B. Trennungen, Verluste, Krankheit, Kündigung etc.). Phasen der Veränderung mit Anpassungsanforderungen erhöhen die Instabilität und können die Entstehung psychische Erkrankungen begünstigen. Mit welchen Interventionen kann ich Anpassungsleistungen des Patienten unterstützen? Mögliche Interventionen: z. B. Eigenständigkeit: Unterstützung, wenn Patient eigene Schritte unternimmt, ihn dazu auffordern, ermutigen. Abgrenzung: Rollenspiele, Gruppe, Beziehungsgestaltung etc. Die Interaktion körperlichen Leidens mit Wohlbefinden, psychischer Erkrankung und Therapieergebnis erscheint im Bereich der Psychosomatik und der somatoformen Störungen besonders deutlich (Martin & Rief, 2011). Zusätzliche Einschränkungen erleben zudem Patienten mit chronisch-somatischen Erkrankungen, wobei die Arbeitsgruppe um Rief den modulierenden Effekt von Psychotherapie nachweisen konnte (Glombiewski, Hartwich-Tersek & Rief, 2010). Patienten mit somatischen Erkrankungen können zudem psychische Beeinträchtigungen aufgrund organischer Ursachen aufweisen, z. B. Schilddrüsen- und Koronarerkrankung oder Asthma (Altshuler et al., 2001; Larisch et al., 2004; Smith & Gerdes, 2012). Auch der Einfluss medikamentöser Behandlungen auf das Wohlbefinden wird diskutiert, wie z. B. Beta-Blocker (Bolling & Kohlenberg, 2004; Ko et al., 2002). Ferner ist zu beachten, die therapeutischen Interventionen an den psychischen Zustand der Patienten anzupassen, wie z. B. die Belastbarkeit bei einer Schwangerschaft. 45. Jg. (2), 399-417, 2013 vpp_02_2013_01.indb 409 409 06.05.2013 23:03:13 Originalia Somatisch-biologische Perspektive: Welche körperlichen Erkrankungen, Probleme sind beim Patienten vorhanden? Welche genetischen Vorbelastungen gibt es? Welche Medikamente (auch zu körperlichen Leiden) nimmt der Patient ein und wie wirken sich diese auf sein Befinden aus? Gibt es Interaktionseffekte? Welche Nebenwirkungen sind zu erwarten? Können Abhängigkeiten (physisch und psychisch) entstehen? Hier werden alle körperlichen/biologischen Aspekte beschrieben, die für den Patienten und dessen Behandlung von Bedeutung sind und die die psychische Erkrankung mitbeeinflussen. Mögliche Interventionen: Genaue diagnostische Abklärung, Pharmakotherapie, Psychoedukation, Interventionen zur Erhöhung der Compliance etc. Eine Fallvignette Die Nutzung der Fallkonzeption wird im Folgenden anhand der Therapieplanung eines jungen Mannes veranschaulicht, der sich aufgrund von depressiven Symptomen in stationäre Behandlung begibt. Einige persönliche Daten wurden zum Zweck der Anonymi­ sierung modifiziert. Befunde: Problembereiche, Belastungen, Konflikte: Der Patient gibt an, unter depressiven Symp­ tomen, insbesondere Antriebslosigkeit, Grübeln und Zukunftsängsten (Angst vor Jobverlust, Angst zu vereinsamen) zu leiden. Er berichtet von Konflikten am Arbeitsplatz, die er als „Mobbing“ erlebt. Ihm werde vorgeworfen, dass er im Umgang mit Mitarbeitenden aufbrausend und impulsiv sei. Privat lebe er isoliert, so dass er unter Einsamkeit leide und den Wunsch nach einer Beziehung habe. Es besteht ein Suchtmittelmissbrauch. Persönlichkeitsstil/Schemata: Das Verhalten und die motivationalen Ziele zur Erfüllung der Grundbedürfnisse werden hier erfragt und mittels Plananalyse hypothesengeleitet interpretiert. Im Gespräch fallen z. B. auf, dass der Patient nur zurückhaltend Auskunft über sich und seine Probleme gibt und auf Nachfragen gereizt reagiert. Er überprüft und hinterfragt Aussagen des Behandlungsteams genau und es fällt ihm schwer, Bedingungen zu akzeptieren (z. B. dass das Behandlungsteam sich über sein Verhalten und das Vorgehen austauscht). Aus motivationaler Sicht dient dieses Verhalten zunächst dem Bedürfnis nach Kontrolle und könnte gleichzeitig in den Plänen begründet sein, sich niemandem anzuvertrauen, um Blamage und letztlich Zurückweisung zu vermeiden. Dadurch 410 vpp_02_2013_01.indb 410 A rmita Tschitsaz & Christoph Stucki kann der Selbstwert und das Bindungsbedürfnis geschützt werden. Weitere Verhaltensweisen zum Selbstwertschutz könnten sein, dass der Patient dazu neigt, anderen die Schuld zu geben, über „ungerechte“ Behandlung klagt und ein Krankheitsmodell mit wenig Selbstverantwortlichkeit beschreibt („Ich hoffe, auf die Wirkung der Medikamente“, „die Ärzte müssen mir helfen“). Andere Verhaltensweisen zur Befriedigung und Schutz des Bindungsbedürfnisses könnten sein, dass der Patient im Kontakt mit Mitpatienten bevorzugt den Clown spielt, andere zu beeindrucken versucht und sich gleichzeitig um Mitpatienten kümmert, denen es nicht gut geht. Die Strategie, sich „von der positiven Seite zu zeigen“, dient vermutlich dem Ziel, von anderen gemocht zu werden und sich Beziehung zu sichern. Verhaltensweisen, die dem Bedürfnis nach Lust/ Vermeidung von Unlust dienen, könnten sein, dass der Patient dazu neigt, Unangenehmes hinauszuschieben, wodurch er unangenehme, bedrohliche und unkontrollierbare Situationen, aber auch Anstrengung (kurzfristig) vermeiden kann. Behandlungsziele: Der Patient formuliert für sich als Therapieziel, nicht mehr depressiv zu sein, den Arbeitswiedereinstieg zu schaffen und einen besseren Umgang mit Konflikten zu erlernen. Gleichzeitig fordert der Arbeitsgeber als Behandlungsziel, den Patienten wieder „arbeitsfähig“ und belastbarer zu machen. Die betagten Eltern des Patienten wünschen sich, dass ihr Sohn, der häufig bei ihnen ist, mehr Eigenverantwortung übernehmen und sich mehr Unterstützung suchen sollte. In der Therapie werden dann als gemeinsame Ziele definiert, einen günstigeren Umgang mit depressiven Symptomen zu finden sowie insbesondere Problemlöseverhalten und Emotionsregulation zu verbessern, um Belastungen und Konflikte früher zu erkennen und adäquat darauf reagieren zu können. Ressourcenaktivierung und Beziehungsgestaltung: Der Patient benötigt erstmals psychiatrische Hilfe, hat sein Leben bisher trotz Belastungen weitgehend selbständig gemeistert. Er ist belesen, weiß viel, ist früher viel gereist, intelligent, genau und differenziert. Ressourcenaktivierung könnte beinhalten, die gesunden Phasen zu betonen, den Patienten über seinen früheren, günstigeren Umgang mit Problemen zu befragen und ihn generell viel über seine Interessen und Erfahrungen berichten zu lassen, um der depressiven Sichtweise eine realistischere entgegenzusetzen. In der Beziehungsgestaltung sollte insbesondere dem Wunsch nach Kontrolle und Autonomie bei Verhaltenstherapie & psychosoziale Praxis 06.05.2013 23:03:13 Wirkfaktorengestützte Fallkonzeption und Therapieplanung Angst vor Blamage und Zurückweisung Rechnung getragen werden. Die Selbstbestimmung sollte also gestärkt werden, bedingungslose Akzeptanz, Rückhalt und Solidarität vermittelt werden. Eine spezifische motivorientierte Beziehungsgestaltung könnte so aussehen, dass dem Patienten viel Mitbestimmung über den Therapieprozess gegeben wird, dass er seine Vorschläge jederzeit einbringen und das „Tempo“ vorgeben kann. Übernahme von Selbstverantwortung, Selbstöffnung oder Eingestehen von Schwächen sollten verstärkt werden. Dem Patienten sollte vermittelt werden, dass der Therapeut hinter ihm steht, auch wenn ungünstige Verhaltensweisen (z. B. Impulsivität) nicht gut geheißen werden. Störungsmodell und therapeutische Interventionen: Störungsmodell und therapeutische Interventionen werden aus der Patienten- und der Therapeutenperspektive erfragt. Auffallend am Erklärungs- und Veränderungsmodell des Patienten ist, dass er wenig Eigenverantwortlichkeit und eigene Einflussmöglichkeiten bezüglich Entstehung wie auch Veränderung der Probleme wahrnimmt: „Ich werde am Arbeitsplatz gemobbt. Die anderen haben etwas gegen mich. Die Probleme am Arbeitsplatz haben mich depressiv gemacht.“ Veränderung verspricht sich der Patient durch die Einnahme der „richtigen“ Medikamente und Verbesserung der Bedingungen am Arbeitsplatz. Hilfreich für die Behandlung könnte entsprechend sein, dass der Patient bereit sein wird, Medikamente regelmäßig einzunehmen, andererseits bedarf es einer Motivationsarbeit, um die Bereitschaft des Patienten zu erhöhen, eigene Verhaltensweisen kritisch zu hinterfragen und zu verändern, z. B. im Umgang mit Belastungen und Konflikten. Im Entstehungs- und Veränderungsmodell des Therapeuten stehen als auslösende Faktoren die Dauerbelastung und damit Überforderung am Arbeitsplatz sowie akute Stressoren wie Konflikte mit dem Vorgesetzten im Vordergrund. Gleichzeitig ist von einer familiären Vorbelastung hinsichtlich depressiven Reagierens auszugehen. Interaktionelle Schwierigkeiten (Impulsivität) scheinen für die Probleme am Arbeitsplatz mit verantwortlich zu sein. Für die beschriebenen unterschiedlichen Entstehungs- und Veränderungsmodelle zwischen Patient und Therapeut wäre es eine wichtige Intervention, ein gemeinsames Erklärungs- und Veränderungsmodell zu entwickeln und entsprechend daraus spezifisch die weiteren therapeutischen Interventio­nen in gemeinsamer Arbeit abzuleiten (z. B.: „Wenn mein Umgang mit Frustration und Wut zu Konflikten führt, Originalia muss ich andere Möglichkeiten der Emotionsregulation erlernen“). Als aufrechterhaltende Faktoren werden die Eigendynamik der Störung, Motivation und Systemik, Copingstrategien, Entwicklungsanforderungen und Somatik beschrieben. Als Eigendynamik der Störung kann zunächst der selbstverstärkende Mechanismus der Depressivität beschrieben werden. Depressives Erleben führt zu Schwarz-Weiß-Denken, selektiver Wahrnehmung und Bewertung von Person, Situation und Interkation sowie Übergeneralisierungen, was Selbstabwertung und Minderwertigkeitsgefühle fördert, soziale Unsicherheit und damit sozialen Rückzug verstärkt, die die Depressivität erhöhen. Selbstabwertung, Soziale Unsicherheit und sozialer Rückzug können weiter den Umgang mit Konflikten erschweren und zum Rückzug anderer Menschen führen, was als „Mobbing“ erlebt werden kann. An therapeutischen Interventionen sind bewährte Techniken der kognitiv-behavioralen Depressionsbehandlung (kognitive Umstrukturierung, positive Verstärkung, Aktivierung) denkbar. Ergänzend aufgrund der interpersonellen Probleme auch Interventionen im Umgang mit Konflikten, sozialer Kompetenz und Emotionsregulation (vgl. auch unten). Aus motivationaler Perspektive steht beim Patienten die ausgeprägte Angst vor Blamage, Schwäche und Gefühlen von Minderwertigkeit im Vordergrund, bei gleichzeitigem Wunsch nach Rückhalt, Akzeptanz und Solidarität. Er meidet unvorhersehbare oder Blamage auslösende Situationen. Als Interventionsmöglichkeit könnte einerseits die therapeutische Beziehung genutzt werden, um dem Patienten korrektive Erfahrungen im Hinblick auf seine Annäherungs- und Vermeidungsziele zu ermöglichen. Der Therapeut könnte spezifisch darauf achten, dem Patienten Rückhalt zu geben, auch wenn er vom Patienten gegebenenfalls herausgefordert oder kritisiert wird. Er sollte darauf achten, den Patienten zunächst nicht in blamable Situationen zu bringen, Problemaktivierung gut zu dosieren und den Patienten immer wieder dann zu verstärken, wenn er sich öffnet, Eigenverantwortung übernimmt und Verletzlichkeit zulässt und nicht mit Angriff oder Selbstinszenierung überspielt. Andererseits könnten mit dem Patienten Entstehungsbedingungen der Angst vor Blamage erarbeitet und der Umgang damit besprochen werden. Aus interpersoneller Perspektive (ungünstiges Beziehungsverhalten, ungünstige aktuelle Beziehungen) fällt zunächst auf, dass der Patient situationsund personenübergreifend ungünstige interpersona45. Jg. (2), 399-417, 2013 vpp_02_2013_01.indb 411 411 06.05.2013 23:03:13 Originalia le Verhaltensweisen zeigt. Er wird am Arbeitsplatz im Umgang mit Mitarbeitern als aufbrausend und impulsiv erlebt, im Kontakt zum Behandlungsteam als misstrauisch und rechthaberisch. Im Austausch mit Mitpatienten fällt er als Spaßmacher auf, versucht andere zu beeindrucken und sich positiv darzustellen. All diesen Verhaltensweisen gemeinsam ist, dass er damit wenig Sympathien erweckt, gegebenenfalls andere zwar beeindruckt, aber vermutlich wenig nahe Beziehung herstellt. Sein Beziehungsverhalten löst eher Abwehr und Rückzug aus, so dass sich das Gefühl, nicht gemocht und ausgegrenzt zu werden (Mobbing), verstärkt. Der Patient leidet unter Einsamkeit, verfügt über wenig soziale Kontakte. Es sind wenige Kollegen vorhanden, mit denen er sich in der Kneipe trifft. Die Beziehung zu den Eltern ist konflikthaft. Die (betagten) Eltern wünschen sich mehr Selbständigkeit des Sohnes und sind gleichzeitig in Sorge um ihn und verwöhnen ihn gerne zu Hause. Mögliche therapeutische Interventionen könnten intendieren, dem Patienten mehr Bewusstsein für sein eigenes (problematisches) Beziehungsverhalten und dessen Wirkung auf andere zu vermitteln. Dies könnte z. B. in konkreten interpersonalen Situationsanalysen, in Rollenspielen oder Videoanalysen gewonnen werden. Gleichzeitig könnte der Patient alternative Verhaltensweisen identifizieren und einüben. Ungünstige interpersonelle Beziehungsmuster und unterschiedliche Beziehungserwartungen sind häufig wirkungsvoll im Mehrpersonensetting anzugehen. Einerseits sinnvoll könnten entsprechend gruppentherapeutische Interventionen sein, z. B. soziales Kompetenztraining oder interpersonelle Gruppentherapien der Depression wie z. B. CBASP in der Gruppe (Cognitive Behavior Analysis System of Psychotherapy), andererseits könnten Angehörigengespräche mit den Eltern oder dem Arbeitsgeber des Patienten geplant werden. Im Bereich der dysfunktionalen Bewältigungsstrategien (Coping) ist zunächst der übermäßige Alkoholkonsum des Patienten zu benennen. Generell ist festzustellen, dass der Patient über wenige günstige Strategien verfügt, unangenehme Gefühle (insbesondere Ärger, Minderwertigkeitsgefühl und Einsamkeitsgefühle) auszuhalten oder zu verändern. Es fällt ihm schwer, Gefühle zu identifizieren, bei Schwierigkeiten verharrt er lageorientiert, um dann schließlich impulsiv zu reagieren. Es fällt ihm schwer, Probleme anzusprechen und sich Unterstützung zu suchen und anzunehmen. Therapeutische Interventionen würden beinhalten, zunächst den Umgang des Patienten mit Proble- 412 vpp_02_2013_01.indb 412 A rmita Tschitsaz & Christoph Stucki men zu analysieren und dysfunktionale von funktionalen Strategien abzugrenzen. Sinnvoll könnte ein Training emotionaler Kompetenzen sein. Es sollten Alternativen zum Alkoholmissbrauch bei emotionaler Labilität erarbeitet werden. Eine weitere Möglichkeit wäre, das Hilfesuch- und Unterstützungsverhalten des Patienten zu verbessern, z. B. anhand der Erfahrungen, die der Patient in der Therapie und mit dem Therapeuten macht. Als Entwicklungsanforderung für den Patienten könnte beschrieben werden, seinen Selbstwert und seine Lebenszufriedenheit nicht nur über die Arbeit zu definieren und vom Erfolg im Beruf abhängig zu machen. Es gilt, die Kompetenz zu entwickeln, die ganz persönlichen Lebenswerte und Ideale zum Maßstab zu nehmen, ohne sich von den Beurteilungen anderer abhängig zu machen. Als therapeutische Interventionen könnte mit dem Patienten in der Therapie seine persönliche Werteskala exploriert werden, es könnten Erfolg und Zufriedenheit ausdifferenziert werden und generell selbstwertstärkende, z. B. ressourcenaktivierende, Interventionen gefördert werden. Weiter könnte die therapeutischen Beziehung genutzt werden, um nicht-leistungsbezogenes, nicht-konkurrierendes Verhalten zu verstärken, z. B. wenn der Patient sich empathisch oder selbstfürsorglich verhält. In Bezug auf die somatischen bzw. biologischen Aspekte der Behandlung sind zunächst die Wirkungen der Pharmakotherapie zu berücksichtigen. Aufgrund von Einschlafproblemen wurde eine Behandlung mit Mirtazapin begonnen. Ungünstige Auswirkungen könnten sich einerseits bezüglich zusätzlicher Gewichtszunahme ergeben, da der Patient bereits leichtes Übergewicht hat. Andererseits könnte durch Mirtazapin die zentral-dämpfende Wirkung von Alkohol verstärkt werden bei gleichzeitigem Alkoholkonsum. Ansonsten zeigt sich der Patient in der somatischen Untersuchung gesund, wenn auch mit seinem Gewicht nicht zufrieden; er möchte mehr Sport treiben. Zu den somatisch biologischen Aspekten würde ebenfalls die Hypothese einer genetischen Vorbelastung für depressive Erkrankungen gehören, die beim Patienten anzunehmen ist, da depressive Störungen in dessen Familie gehäuft auftreten. Wichtige therapeutische Interventionen wären die Aufklärung des Patienten bezüglich Wirkung und Nebenwirkungen der Pharmakotherapie, im Fallbeispiel sollten insbesondere die Auswirkungen von Mirtazipin auf Appetit und Gewichtszunahme einerseits, andererseits die verstärkende Wirkung bei Alkoholkonsum thematisiert werden. Generell Verhaltenstherapie & psychosoziale Praxis 06.05.2013 23:03:13 Wirkfaktorengestützte Fallkonzeption und Therapieplanung könnte der Patient für ein Bewegungs- und Sportprogramm gewonnen werden. Fazit Auf Basis der Patientenangaben über Lebensgeschichte und Entstehungsbedingungen der Symptome wird ein Störungs- und Erklärungsmodell aufgestellt, das eine Vielfalt von Informationen über die Person aufgrund unterschiedlicher Perspektiven integriert. Die Verankerung therapeutischer Interventionen mit der empirischen Befundlage zu ihrer Wirksamkeit spielt dabei eine besondere Rolle. Die Notwendigkeit einer individualisierten Therapieplanung unter Berücksichtigung der Patientensicht wurde bereits durch die Arbeitseinheit um Grawe (Itten et al., 2004) vorgeschlagen. Empirisch gestützt wurde der Ansatz der differentiellen Therapieplanung von Grawe, Caspar und Ambühl (1990) in einer großen Vergleichsstudie, in der die Überlegenheit eines patientenorien­ tierten Psychotherapieansatzes mit einer motivorientierten Beziehungsgestaltung aufgezeigt wurde. In einem experimentellen Versuchsplan konnten Grosse Holtforth, Grawe, Fries und Znoj (2008) aufzeigen, dass bei höherem Inkonsistenzerleben der Patienten die Allgemeine Psychotherapie, die zusätzlich motivationale Klärung beinhaltet, einer störungsspezifischen Therapie überlegen ist. Gleichzeitig fanden sich jedoch keine Unterschiede hinsichtlich wahrgenommener Güte der Therapiebeziehung durch Patienten und Therapeuten, Einsatz bewältigungs­ orientierter Techniken und Therapieerfolg (Symp­ tombelastung, Wohlbefinden, interpersonale Proble­ me) in den beiden Bedingungen. Ziel war es, eine Therapieplanung zu erstellen, die integrativ, schulen- und störungsunabhängig anwendbar ist. Die vorgeschlagene Fallkonzeption schließt die Patienten- und die Therapeutenperspektive ein und es werden empirisch gesicherte und für den praktischen Alltag einsetzbare Therapiemethoden und allgemeine Wirkfaktoren angewandt. Die Fallkonzeption wird den Kriterien der differentiellen Indikation sowie einer individualisierten Therapieplanung gerecht. Im alltäglichen stationären und ambulanten Psychotherapiesetting fehlen die zeitlichen und personellen Ressourcen für eine sehr ausführliche Therapieplanung, so dass die vorgeschlagene kürzere Variante für den erfahrenen Therapeuten eine Alternative bietet. Praktische Erfahrungen mit der Therapieplanung gemäß vorgeschlagener Fallkonzeption wurden bisher in zwei psychiatrischen Kliniken im Raum Zürich gemacht, wobei sie als konzeptuelles Rahmenmodell einer Originalia interdisziplinären integrativ-psychiatrischen Behandlung dient (Tschitsaz & Poppe, 2012). Eine Anwendung der Fallkonzeption mit Modifikation für das Burnout-Syndrom wird derzeit realisiert (Ballweg, Seeher, Tschitsaz, Bridler & Cattapan, in review). Literatur Altshuler, L. L., Bauer, M., Frye, M. A., Gitlin, M. J., Mintz, J., Szuba, M. P., Leight, K. L. & Whybrow, P. C. (2001). Does thyroid supplementation accelerate a tricyclic antidepressant response? A review and metaanalysis of the literature. American Journal of Psychiatry, 158, 1617–1622. Arnkoff, D., Glass, C. & Shapiro, S. (2002). Expectations and preferences. In J. C. Norcross (Ed.), Psychotherapy relationships that work: evidencebased responsiveness (pp. 325–46). New York: Oxford University Press. Ballweg, T., Seeher, C., Tschitsaz, A., Bridler, R. & Catta­ pan, K. (in review). SymBalance: Ein theoriebasiertes, integratives Therapiekonzept zur Behandlung von Burnout. Swiss Archives of Neurology and Psychiatry. Baskin, T. W., Tierney, S. C., Minami, T. & Wampold, B. E. (2003). Establishing specificity in psychotherapy: a meta-analysis of structural equivalence of placebo controls. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 71 (6), 973–979. Berger, T. & Caspar, C. (2009). Gewinnt die Psychotherapie durch die neurobiologische Erforschung ihrer Wirkmechanismen? Zeitschrift für Psychia­ trie, Psychologie und Psychotherapie, 57 (2), 77–85. Berking, M., Poppe, C., Luhmann, M., Wuppermann, P., Jaggi, V. & Seifritz, E. (2012). Is the association between various emotion-regulation skills and mental health mediated by the ability to modify emotions? Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 43, 931–937. Bhui, K. & Bhugra, D. (2002). Explanatory models for mental distress: implications for clinical practice and research. British Journal of Psychiatry, 181, 6–7. Bolling, M. & Kohlenberg, R. J. (2004). Reasons for quitting serotonin re-uptake inhibitor therapy: paradoxical psychological side effects and patient satisfaction. Psychotherapy and Psychosomatics, 73 (6), 380–385. Bordin, E. S. (1994). Theory and research on the therapeutic working alliance: new directions. In A. O. Horvath & L. S. Greenberg (Eds.), The working 45. Jg. (2), 399-417, 2013 vpp_02_2013_01.indb 413 413 06.05.2013 23:03:13 Originalia alliance: theory, research, and practice (pp. 13–37). New York: Wiley. Carver, C. S. & Scheier, M. F. (1998). The self-regulation of behavior. Hillsdale, NJ: Erlbaum. Caspar, F. (2009). Plananalyse und Schema-Analyse. Verhaltenstherapie & Verhaltensmedizin, 30, 24–34. Caspar, F. & Berger, T. (2011). Allgemeine Psychotherapie, In B. Dulz, S. C. Herpertz, O. F. Kernberg & U. Sachse (Hrsg.), Handbuch der Borderline-Störungen (2. Aufl.) (S. 667–680). Stuttgart: Schattauer. Caspar, F. & Grosse Holtforth, M. (2009). Responsiveness – eine entscheidende Prozessvariable in der Psychotherapie. Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie, 38, 61–69. Caspar, F., Grossmann, C., Unmüssig, C. & Schramm, E. (2005). Complementary therapeutic relationship: therapist behavior, interpersonal patterns, and therapeutic effects. Psychotherapy Research, 15, 91–102. Castonguay, L. G. & Beutler L. E. (2006). Principles of therapeutic change that work. Oxford: University Press. Chambless, D. L. & Ollendick, T. H. (2001). Empirically supported psychological interventions: controversies and evidence. Annual Review of Psychology, 52, 685–716. Crits-Christoph, P., Connolly Gibbons, M. B., Barber, J. P., Hu, B., Hearon, B., Worley, M. & Gallop, R. (2007). Predictors of sustained abstinence during psychosocial treatments for cocaine dependence. Psychotherapy Research, 17 (2), 250–263. Diener, E. & Lucas, R. E. (1999). Personality and subjective well-being. In D. Kahnemann, E. Diener & N. Schwarz (Eds.), Well-being: the foundations of hedonic psychology (pp. 213–229). New York: Russell Sage Foundation. Döpfner, M., Kinnen, C. & Petermann, F. (2010). Aktuelle Kontroverse. Kindheit & Entwicklung, 19 (2), 129–138. Eckert, J., Frohburg, I. & Kriz, J. (2004). Therapiewechsler. Psychotherapeut, 49, 415–426. Elliott, R., Bohart, A. C., Watson, J. C. & Greenberg, L. S. (2011). Empathy. In J. C. Norcross (Ed.), Psychotherapy relationships that work: evidence-based responsiveness (2nd Ed.) (pp. 132–152). New York: Oxford University Press. Elliot, A. J. & Thrash, T. M. (2002). Approach-avoidance motivation in personality. Approach and avoi­ dance temperaments and goals. Journal of Personality and Social Psychology, 82, 804–818. Epstein, S. (1990). Cognitive-experiential self theory. In L. A. Pervin (Ed.), Handbook of personality (pp. 165–192). New York: Guilford. 414 vpp_02_2013_01.indb 414 A rmita Tschitsaz & Christoph Stucki Fässler, M., Meissner, K., Schneider, A., Linde, K. (2010). Frequency and circumstances of placebo use in clinical practice: a systematic review of empirical studies. BMC Medicine, 8, 15. Fiedler, P. (2003). Integrative Psychotherapie bei Persönlichkeitsstörungen. Göttingen: Hogrefe. Flückiger, C., Caspar, F., Grosse Holtforth, M. & Willutzki, U. (2009). Working with the patient’s strengths: a micro-process approach. Psychotherapy Research, 19, 213–223. Flückiger, C., Del Re, A. C., Wampold, B. E., Symonds, D. & Horvath, A. O. (2011). How central is the alliance in psychotherapy? A multilevel longitudinal meta-analysis. Journal of Counseling Psychology, 59 (1), 10–17. Friedlander, M., Escudero, V., Heatherington, L. & Diamond, G. (2011). Alliance in couple and family therapy. In J. C. Norcross (Ed.), Psychotherapy relationships that work: evidence-based responsiveness (2nd Ed.) (pp. 132–152). New York: Oxford University Press. Ghane, S., Kolk, A. & Emmelkamp, P. (2010). Assessment of explanatory models of mental illness: effects of patient and interviewer characteristics. Social Psychiatry and Epidemiology, 45, 175–182. Glombiewski, J. A., Hartwich-Tersek, J. & Rief, W. (2010). Depression in chronic pain: prediction of pain intensity and pain disability in cognitive-behavioral treatment. Psychosomatics, 51, 130–136. Grawe, K. (2004). Neuropsychotherapie. Göttingen: Hogrefe. Grawe, K., Caspar, F. & Ambühl, H. (1990). Die Berner Therapievergleichsstudie: Wirkungsvergleich und differentielle Indikation. Zeitschrift für Klinische Psychologie, 19 (4), 338–361. Gray, J. A. & McNaughton, N. (2003). The neuropsychology of anxiety: an enquiry into the functions of the septo-hippocampal system. Oxford: University Press. Grosse Holtforth, M. (2008). Early career award: avoidance motivation in psychological problems and psychotherapy. Psychotherapy Research, 18 (2), 147–159. Grosse Holtforth, M. & Castonguay, L. G. (2007). Beziehungen und Techniken in der Kognitiven Verhaltenstherapie – ein motivorientierter Ansatz. Verhaltenstherapie & psychosoziale Praxis, 39 (2), 335–350. Grosse Holtforth, M. & Grawe, K. (2004). Inkongruenzanalyse und Fallkonzeption in der Psychologischen Therapie. Verhaltenstherapie & psychosoziale Praxis, 36 (1), 9–21. Grosse Holtforth, M., Grawe, K., Fries, A. & Znoj, H. (2008). Inkonsistenz als differenzielles Indika- Verhaltenstherapie & psychosoziale Praxis 06.05.2013 23:03:13 Wirkfaktorengestützte Fallkonzeption und Therapieplanung tionskriterium in der Psychotherapie. Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie, 37 (2), 103–111. Grosse Holtforth, M., Krieger, T., Bochsler, K. & Mauler, B. (2011). The prediction of psychotherapy success by outcome expectations in inpatient psychotherapy. Psychotherapy and Psychosomatics, 80, 321–322. Herbert, J. D. & Gaudiano, B. A. (2005). Moving from empirically supported treatment lists to practice guidelines in psychotherapy: the role of the place­ bo concept. Journal of Clinical Psychology, 61 (7), 893–908. Horvath, A. O., Del Re, A. C., Flückiger, C. & Symonds, D. (2011). Alliance in individual psychotherapy. In J. C. Norcross (Ed.), Psychotherapy relationships that work: evidence-based responsiveness (2nd Ed.) (pp. 25–69). New York: Oxford University Press. Ilardi, S. & Craighead, W. (1999). Rapid early response, cognitive modification, and non-specific factors in cognitive behavior therapy for depression: a reply to Tang and DeRubeis. Clinical Psychology: Science and Practice, 6, 295–299. Itten, S., Trösken, A. & Grawe, K. (2004). Fallkonzeption und Therapieplanung in der Psychologischen Therapie: ein Beispiel. Verhaltenstherapie & psychosoziale Praxis, 36 (1), 23–40. Kämmerer, A., Wahl, H.-W., Becker, S., Kaspar, R., Himmelsbach, I., Holz, F. & Miller, D. (2006). Psychosoziale Unterstützung von älteren Menschen mit einer chronischen Sehbeeinträchtigung. Zeitschrift für Gesundheitspsychologie, 14 (3), 95– 105. Kanfer, F. H., Reinecker, H. & Schmelzer, D. (2006). Selbstmanagementtherapie. Heidelberg: Springer. Kazdin, A. E. (2007). Mediators and mechanisms of change in psychotherapy research. Annual Review of Clinical Psychology, 3 (1), 1–27. Kelly, M. A. R., Cyranowski, J. M. & Frank, E. (2007). Sudden gains in interpersonal psychotherapy for depression. Behaviour Research and Therapy, 45 (1), 2563–2572. Kelly, M. A. R., Morse, J. Q., Stover, A., Hof kens, T., Huisman, E., Shulman, S., Eisen, S. V., Becker, S., Weinfurt, K., Boland, E. & Pilkonis, P. A. (2011). Describing depression: congruence between patient experiences and clinical assessments. British Journal of Clinical Psychology, 50 (1), 46–66. Ko, D. T., Hebert, P. R., Coffey, C. S., Sedrakyan, A., Curtis, J. P. & Krumholz, H. M. (2002). Betablocker therapy and symptoms of depression, Originalia fatigue, and sexual dysfunction. JAMA, 288, 351–357. Kramer, U., Berger, T., Kolly, S., Marquet, P., Preisig, M., de Roten, Y., Despland, J. & Caspar, F. (2011). Effects of motive-oriented therapeutic relationship in early-phase treatment of borderline personality disorder. The Journal of Nervous and Mental Disease, 199 (4), 244–250. Kupper, Z. & Tschacher, W. (2006). Anwendung – Effektivität – Aufrechterhaltung. Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie, 35 (4), 276–285. Lambert, M. J. & Ogles, B. M. (2004). The efficacy and effectiveness of psychotherapy. In M. J. Lambert (Ed.), Bergin and Garfield’s handbook of psychotherapy and behavior change (5th Ed.) (pp. 139–193). New York: Wiley. Lambert, M. J. & Shimokawa, K. (2011). Collecting client feedback. In J. C. Norcross (Ed.), Psychotherapy relationships that work: evidence-based responsiveness (2nd Ed.) (pp. 203–223). New York: Oxford University Press. Larisch, R., Kley, K., Nikolaus, S., Sitte, W., Franz, M., Hautzel, H., Tress, W. & Müller, H. W. (2004). Depression and anxiety in different thyroid function states. Hormone and Metabolic Research, 36, 650–653. Lauterbach, W. & Newman, C. (1999). Computerized intrapersonal conflict assessment in cognitive therapy. Clinical Psychology & Psychotherapy, 6, 357–374. Lutz, W., Lambert, M. J., Harmon, C. J., Tschitsaz, A., Schürch, E. & Stulz, N. (2006). The probability of treatment success, failure and duration: what can be learned from empirical data to support decision making in clinical practice? Clinical Psychology & Psychotherapy, 13 (4), 223–232. Lutz, W. & Tschitsaz, A. (2007). Plötzliche Gewinne und Verluste im Behandlungsverlauf von Angststörungen, depressiven und komorbiden Störungen. Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie, 36 (4), 298–308. Martin, A. & Rief, W. (2011). Relevance of cognitive and behavioral factors in medically unexplained syndromes and somatoform disorders. Psychiatric Clinics of North America, 34, 565–578. McCullough, J. P. (2000). Treatment for chronic depression: cognitive behavioral analysis system of psychotherapy. New York: Guilford. Noeker, M. & Petermann, F. (2008). Resilienz: Funktionale Adaptation an widrige Umgebungsbedingungen. Zeitschrift für Psychiatrie, Psychologie und Psychotherapie, 56 (4), 255–263. 45. Jg. (2), 399-417, 2013 vpp_02_2013_01.indb 415 415 06.05.2013 23:03:13 Originalia Norcross, J. N. & Lambert, M. J. (2011). Evidence-based therapy relationships. In J. C. Norcross (Ed.), Psychotherapy relationships that work (pp. 3–24). New York: Oxford University Press. Orlinsky, D. E., Rønnestad, M. H. & Willutzki, U. (2004). Fifty years of psychotherapy process-outcome research: continuity and change. In M. J. Lambert (Ed.), Bergin and Garfield’s handbook of psychotherapy and behavior change (5th Ed.) (pp. 307–390). New York: Wiley. Pfammatter, M. & Tschacher, W. (2012). Wirkfaktoren der Psychotherapie – eine Übersicht und Standortbestimmung. Zeitschrift für Psychiatrie, Psychologie und Psychotherapie, 60 (1), 67–76. Raz, A., Campbell, N., Guindi, D., Holcroft, C., Déry, C. & Cukier, O. (2011). Placebos in clinical practice: comparing attitudes, beliefs, and patterns of use between academic psychiatrists and nonpsychia­trists. La Revue Canadienne de Psychiatrie, 56 (4), 198–208. Sachse, R., Püschel, O., Fasbender, J. & Breil, J. (2008). Klärungsorientierte Schemabearbeitung – Dysfunktionale Schemata effektiv verändern. Göttingen: Hogrefe. Schulte, D. (2005). Messung der Therapieerwartung und Therapieevaluation von Patienten (PATHEV). Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie, 34 (3), 176–187. Schulz, H., Lotz-Rambaldi, W., Koch, U., Jürgen, R. & Rüddel, H. (1999). Ein-Jahres-Katamnese statio­ närer psychosomatischer Rehabilitation nach differenzieller Zuweisung psychoanalytisch oder verhaltenstherapeutisch orientierter Behandlung. Psychotherapie Psychosomatik Medizinische Psychologie, 49, 114–130. Sexton, T. L., Alexander, J. & Mease, A. (2004). Levels of evidence for the models and mechanisms of therapeutic change in family and couple therapy. In M. J. Lambert (Ed.), Bergin and Garfield’s handbook of psychotherapy and behavior change (5th Ed.) (pp. 139–193). New York: Wiley. Smith D. F. & Gerdes L. U. (2012). Meta-analysis on anxiety and depression in adult celiac disease. Acta Psychiatrica Scandinavica, 125, 189–193. Stangier, U., Ukrow, U., Schermelleh-Engel, K., Grabe, M. & Lauterbach, W. (2007). Intrapersonal conflict in goals and values of patients with unipolar depression. Psychotherapie and Psychosomatics, 76, 162–170. Strauß, B. & Burgmeier-Lohse, M. (1995). Merkmale der „Passung“ zwischen Therapeut und Patient als Determinante des Behandlungsergebnisses in der stationären Gruppentherapie. Zeitschrift für Psychosomatische Medizin, 41, 127–140. 416 vpp_02_2013_01.indb 416 A rmita Tschitsaz & Christoph Stucki Stucki, C. (2004). Die Therapiebeziehung differentiell gestalten. Bern: unveröffentlichte Dissertation. Stucki, C. (2008). Motivorientierte Beziehungsgestaltung – Konsistenztheoretischer und neuropsychotherapeutischer Hintergrund, Anforderungen und Handlungsanweisungen für Therapeuten. In M. Hermer & B. Röhrle (Hrsg.), Handbuch der therapeutischen Beziehung. Tübingen: dgvtVerlag. Sulz, S. K. D., Heiss, D., Linke, S., Nützel, A., Hebing, M. & Hauke, G. (2011). Schemaanalyse und Funktionsanalyse in der Verhaltensdiagnostik: Eine empirische Studie zu Überlebensregel und Reaktionskette zum Symptom. Psychotherapie in Psychiatrie, Psychotherapeutischer Medizin und Klinischer Psychologie, 16 (1), 143–157. Swift, J. K., Callahan, J. L. & Vollmer, B. M. (2011). Preferences. In J. C. Norcross (Ed.), Psychotherapy relationships that work (pp. 301–315). New York: Oxford University Press. Trachsel, M., Gurtner, A., von Känel, M. L. & Grosse Holtforth, M. (2010). Keep it in or let it out? Swiss Journal of Psychology, 69 (3), 141–146. Trijsburg, R. W., Lietaer, G. C. F. J., Gorlee, M., Klouwer, E., Hollander, A. M. den & Duivenvoorden, H. J. (2002). Development of the Comprehensive Psychotherapeutic Interventions Rating Scale (CPIRS). Psychotherapy Research, 12, 287–317. Tschitsaz, A. & Lutz, W. (2009). Identifikation und Aufklärung von Veränderungssprüngen im individuellen Psychotherapieverlauf. Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie, 38 (1), 13–23. Tschitsaz, A. & Poppe, C. (2012). Psychotherapie im Sanatorium Kilchberg – Ein Konzept. Kilchberg, unveröffentlichtes Dokument. Tschuschke, V. (2005). Die Psychotherapie in Zeiten evidenzbasierter Medizin: Fehlentwicklungen und Korrekturvorschläge. Psychotherapeutenjournal, 2, 106–115. Wampold, B. E. (2007). Psychotherapy: the humanistic (and effective) treatment. American Psychologist, 62 (8), 857–873. Willutzki, U. & Koban, C. (2004). Enhancing motivation for psychotherapy: the elaboration of positive perspectives (EPOS) to develop patients‘ goal structure. In M. Cox & E. Klinger (Eds.), Handbook of motivational counselling (pp. 337–356). Chichester: Wiley. Znoj, H., Nick, L. & Grawe, K. (2004). Intrapsychische und interpersonale Regulation von Emotionen im Therapieprozess. Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie, 33 (4), 261–269. Verhaltenstherapie & psychosoziale Praxis 06.05.2013 23:03:14 Wirkfaktorengestützte Fallkonzeption und Therapieplanung Zu den AutorInnen Dr. Armita Tschitsaz war bis 2005 Forschungsassis­ tentin am Lehrstuhl für Klinische Psychologie und Psychotherapie der Universität Bern und hat derzeit die Fachstelle Psychotherapie am Sanatorium Kilchberg inne. Zusätzlich ist sie als Supervisorin und Dozentin tätig. Ihre Schwerpunkte sind Psychotherapie für Depressionen und CBASP, Persönlichkeitsstörungen, Therapie und Prävention von Burnout, Therapieplanung und Psychotherapieverlaufsforschung. Dr. Christoph Stucki war bis 2005 Assistent am Lehrstuhl für Klinische Psychologie und Psychotherapie der Universität Bern und von 2005 bis 2011 Leitender Psychologe der Klinik am Zürichberg in Zürich. Derzeit arbeitet er als Leitender Psychologe Originalia der Poliklinik für Psychiatrie der Universitären Psychiatrischen Dienste Bern. Zusätzlich ist er als Supervisor und Dozent tätig. Seine Schwerpunkte sind therapeutische Beziehungsgestaltung, Therapieplanung, Psychotherapie für Depressionen, CBASP und Persönlichkeitsstörungen. Korrespondenzadresse Dr. phil. Dipl.-Psych. Armita Tschitsaz Fachstelle Psychotherapie Sanatorium Kilchberg Alte Landstr. 70 8802 Kilchberg Schweiz E-Mail: [email protected] 45. Jg. (2), 399-417, 2013 vpp_02_2013_01.indb 417 417 06.05.2013 23:03:14