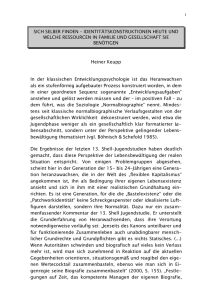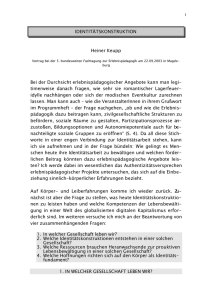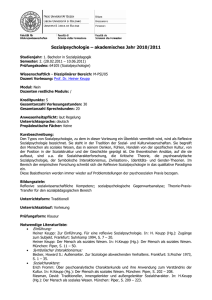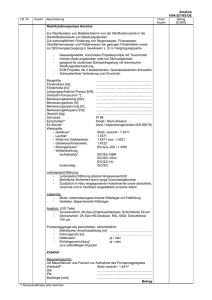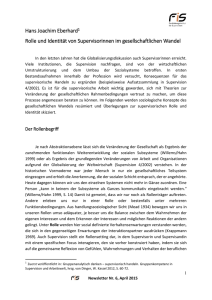Diplomarbeit „…und plötzlich war es still.“ – Identitätsarbeit von
Werbung
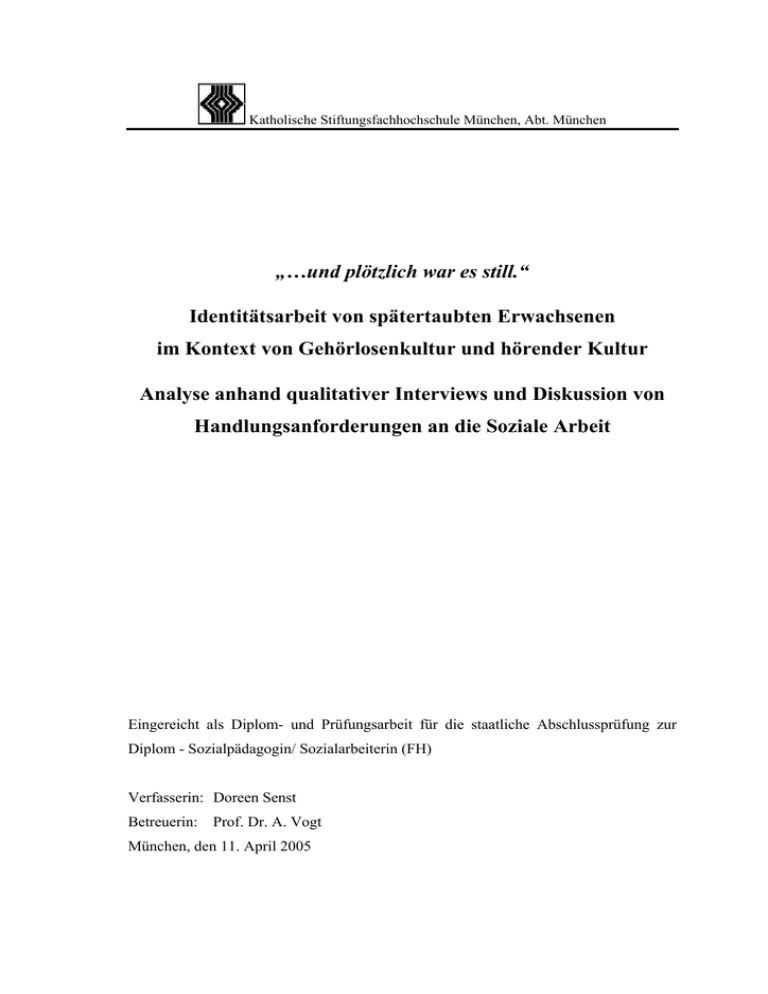
Katholische Stiftungsfachhochschule München, Abt. München „…und plötzlich war es still.“ Identitätsarbeit von spätertaubten Erwachsenen im Kontext von Gehörlosenkultur und hörender Kultur Analyse anhand qualitativer Interviews und Diskussion von Handlungsanforderungen an die Soziale Arbeit Eingereicht als Diplom- und Prüfungsarbeit für die staatliche Abschlussprüfung zur Diplom - Sozialpädagogin/ Sozialarbeiterin (FH) Verfasserin: Doreen Senst Betreuerin: Prof. Dr. A. Vogt München, den 11. April 2005 Für Judith Angela Ziegler und für Ingelore 2 Danksagung Ich möchte mich bei all meinen Freunden und Freundinnen bedanken, die mich während der letzten Monate und Wochen in vielfältiger Weise unterstützten. Vor allem geht mein Dank an Judith Angela Z. und Anna M. für den anregenden fachlichen Austausch, an Christine G., die sich stets meinen Fragen und Nöten im Hinblick auf die technische Gestaltung dieser Arbeit annahm, an Anke Marion F. und Katrin M. für ihre Unterstützung zur Bewältigung meiner beruflichen Nebentätigkeit und an Katrin Sch. sowie Sebastian F., die sich korrigierend dieser Arbeit annahmen. Darüber hinaus bedanke ich mich besonders bei Tilmann G., der in dieser Zeit stets an mich dachte, mich immer wieder zum Lachen brachte und mir einen schönen Konzertabend schenkte. Schließlich gilt mein Dank auch Yvonne K., Maria G., Pia A., Stephanie D., Simone R., Claudia F., Jennifer E. und Johannes S., die für meine Situation Verständnis zeigten und mir den nötigen Freiraum gewährten. Ihnen allen möchte ich ganz herzlich für die emotionale Unterstützung in den letzten Wochen danken. Mein besonderer Dank gilt meinen Eltern, die mir mein Studium finanziell ermöglichten. Abschließend bedanke ich mich bei den interviewten Personen, die mit ihrer Bereitschaft, mir einen Einblick in ihr Leben zu gewähren, den entscheidenden Rahmen dieser Arbeit formen. Da es zur vorliegenden Thematik kaum Fachliteratur gibt, konnte die Studie nur mit ihrer Unterstützung in dieser Form angefertigt werden. Dafür bedanke ich mich herzlich. 3 INHALTSVERZEICHNIS 1 Einleitung................................................................................................................. 8 2 Allgemeine Grundlagen des Hörens und seine Schädigungen.......................... 10 2.1 Anatomie und Physiologie des menschlichen Hörorgans............................... 10 2.2 Klassifikationen von Hörschädigungen .......................................................... 11 2.2.1 Art und Ausmaß des Hörschadens.......................................................... 11 2.2.1.1 Schallleitungsschwerhörigkeit ............................................................ 11 2.2.1.2 Schallempfindungsschwerhörigkeit.................................................... 12 2.2.1.3 Schädigung des Hörnervs oder im Gehirn.......................................... 13 2.2.2 Zeitpunkt des Eintretens der Hörschädigung.......................................... 13 2.2.2.1 Prälinguale Gehörlosigkeit ................................................................. 13 2.2.2.2 Postlinguale Gehörlosigkeit................................................................ 14 2.2.3 3 Anthropologische Bedeutung des Hörens............................................... 15 Kommunikationstheoretische Aspekte unter Berücksichtigung der Ertaubung im Erwachsenenalter .................................................................................. 17 3.1 Der Ablauf eines Kommunikationsprozesses ................................................. 17 3.2 Das Kommunikationsmodell nach Schulz von Thun ..................................... 18 3.2.1 Die Anatomie einer Nachricht aus der Sender-Perspektive.................... 18 3.2.2 Die Anatomie einer Nachricht aus der Empfänger-Perspektive............. 19 3.2.3 Zusammenfassung .................................................................................. 20 3.3 Auswirkungen des Hörverlustes auf die Mehrdimensionalität der Kommunikation .............................................................................................. 21 3.4 Möglichkeiten und Grenzen des Lippenabsehens für postlingual ertaubte Erwachsene ..................................................................................................... 23 3.5 Sprache und Kommunikation in ihrer sozialen Funktion ............................... 24 3.6 Der Zusammenhang von Sprache und Interaktion auf die Identität eines Individuums .................................................................................................... 25 3.7 Resümee.......................................................................................................... 26 4 4 Theoretische Grundlagen aus der Identitätsforschung..................................... 28 4.1 Allgemeine Begriffsdefinition von „Identität“ ............................................... 28 4.2 Klassische psychologische und soziologische Identitätstheorien ................... 30 4.2.1 Kritische Reflexion der Entwicklungstheorie von E. Erikson................ 30 4.2.2 Kritische Reflexion der Entwicklung des Selbst bei G.H. Mead und seiner Fortführung durch L. Krappmann ......................................... 34 4.3 Das sozialpsychologische Modell der Identitätsarbeit.................................... 37 4.3.1 Grundlegendes Verständnis von Identität............................................... 37 4.3.2 Identitätsentwicklung als prozesshafte alltägliche Identitätsarbeit......... 38 4.3.2.1 Situationale Selbstthematisierungen ................................................... 39 4.3.2.2 Bildung von Teilidentitäten ................................................................ 40 4.3.2.3 Metaidentität ....................................................................................... 43 4.3.2.4 Subjektive Handlungsfähigkeit als Ergebnis der prozesshaften alltäglichen Identitätsarbeit................................................................. 45 4.3.3 Zusammenfassung .................................................................................. 45 4.3.4 Identitätsentwürfe und Identitätsprojekte ............................................... 47 4.3.5 Der Zusammenhang zwischen Identitätsarbeit und sozialen Netzwerken ............................................................................................. 47 4.3.6 5 Kulturelles Konzept von Gehörlosigkeit............................................................. 50 5.1 Definition von „Kultur“ .................................................................................. 50 5.2 Die Gebärdensprachgemeinschaft als kulturelle Minderheit.......................... 50 5.3 Die Gebärdensprache als eigenständiges visuelles Sprachsystem.................. 53 5.4 Weitere Formen der manuellen Kommunikation ........................................... 54 5.4.1 Lautsprachbegleitende Gebärden............................................................ 54 5.4.2 Das Fingeralphabet ................................................................................. 55 5.5 6 Kulturelle Identität.................................................................................. 48 Zusammenfassung .......................................................................................... 55 Darstellung von Handlungstheorien für die Soziale Arbeit mit spätertaubten Erwachsenen................................................................................. 56 6.1 Empowerment als Grundhaltung für die Soziale Arbeit................................. 56 6.2 Das Konzept „Lebensweltorientierte Soziale Arbeit“ .................................... 57 6.2.1 Traditionslinie der Theorie ..................................................................... 57 5 6.2.2 Der Lebensweltansatz ............................................................................. 58 6.2.3 Leitlinien und Ziele der „Lebensweltorientierten Sozialen Arbeit“ ....... 59 6.3 6.3.1 Das Zusammenspiel von Biographie und Lebenslauf ............................ 61 6.3.2 Grunddimensionen der biographischen Lebensbewältigung.................. 61 6.3.3 Arbeitsprinzipien einer biographisch orientierten Sozialen Arbeit ........ 64 6.4 7 Das „Biographiekonzept“ nach L. Böhnisch .................................................. 60 Zusammenfassung .......................................................................................... 64 Zusammenfassung des theoretischen Zugangs und Ableitung der empirischen Fragestellung ................................................................................... 65 8 Operationalisierung der allgemeinen Fragestellung ......................................... 67 8.1 Grundlegende Entscheidung bezüglich der benutzten Methoden................... 67 8.2 Kriterien für die Wahl einer spezifischen Interviewform............................... 67 8.3 Inhaltliche Struktur des Interviewleitfadens ................................................... 68 8.4 Kommunikative Kriterien für die Durchführung der Interviews.................... 70 8.5 Möglichkeiten und Grenzen von schriftlichen Befragungen.......................... 70 9 Durchführung der Untersuchung........................................................................ 71 Anwerbung der Interviewteilnehmer .............................................................. 71 9.2 Durchführung der Interviews.......................................................................... 72 9.3 Durchführung der Nachgespräche .................................................................. 72 10 9.1 Darstellung und Auswertung der Ergebnisse .................................................... 73 10.1 Auswertung der empirischen Methode ........................................................... 73 10.2 Vorstellung der Interviewpartner.................................................................... 74 10.2.1 Frau P...................................................................................................... 74 10.2.2 Herr A. .................................................................................................... 75 10.2.3 Herr C. .................................................................................................... 76 10.2.4 Herr M..................................................................................................... 76 10.3 Auswertung der Interviews............................................................................. 77 10.3.1 Die Auswirkungen der Ertaubung auf die berufliche Situation.............. 77 10.3.2 Die Auswirkungen der Ertaubung auf die Partnerschaft und Familie .... 83 10.3.3 Die Auswirkungen der Ertaubung auf die sozialen Netzwerke .............. 86 6 10.3.4 Die Auswirkungen der Ertaubung auf die kulturelle Zugehörigkeit ...... 91 10.3.5 Verknüpfung der Teilidentitäten zu einer Metaidentität......................... 95 10.4 11 Zusammenfassung ........................................................................................ 101 Diskussion von Handlungsanforderungen an die Soziale Arbeit ................... 102 Lebenswelt und Alltag als Rahmenkonzept und Handlungsmuster ............. 103 11.2 Biographie und Lebenslauf als Rahmenkonzept und Handlungsmuster ...... 107 12 11.1 Fazit und Ausblick .............................................................................................. 110 Abkürzungsverzeichnis .............................................................................................. 113 Literaturverzeichnis ................................................................................................... 114 7 1 Einleitung 1 Einleitung Die vorliegende Arbeit ist eine qualitative Studie über die Identitätsarbeit von im Erwachsenenalter ertaubten Personen im Kontext von Gehörlosenkultur und hörender Kultur. Spätertaubung stellt eine Hörbehinderung dar, in deren Folge der betreffende Mensch Sprache akustisch nicht mehr wahrnehmen kann und demnach seine bisherigen Kommunikationsmöglichkeiten mit der sozialen Umwelt beeinträchtigt werden. Infolgedessen wirkt sich eine Spätertaubung auf grundlegende menschliche Erlebnis- und Erfahrungsbereiche eines Individuums aus. Meine theoriegeleitete Analyse umfasst ausschließlich Menschen, die im erwerbsfähigen Alter ertaubten. Folglich kann die Problematik einer Ertaubung im Schul- und Jugendalter, wie auch diejenige im Rentenalter aus dem Blickfeld genommen werden. Ferner betrachte ich Spätertaubung in Abgrenzung zur Gehörlosigkeit, die vor dem Spracherwerb vorhanden war. Ich werde in dieser Arbeit aufzeigen, dass Individuen ihre Identität in der Interaktion mit der sozialen Umwelt entwickeln und darstellen. Dabei ist Sprache das zentrale Medium, mit dem sich Identität ausdrückt. Demzufolge ist Sprache das wichtigste Instrument von Individuen, um ihre Einstellungen und Erwartungen zu kommunizieren und sich damit in ihrem Selbstverständnis darzustellen. Die besondere Lebenssituation eines spätertaubten erwachsenen Menschen lässt mich vermuten, dass sich die kommunikativen Einschränkungen auf die Identität der betreffenden Person auswirken. Als theoretische Grundlage für meine qualitative Untersuchung dient das sozialpsychologische Modell zur Identitätsarbeit. In diesem Konzept wird die Identitätsentwicklung als offener, lebenslanger Prozess verstanden, in dem das Subjekt fortlaufend neue lebensweltliche Erfahrungen interpretiert. Ein zentraler Aspekt für die Identitätsarbeit eines Menschen bildet sein soziales Netzwerk, in dem u.a. kulturelle Werte und Orientierungen vermittelt werden, welche für die Ausbildung einer kulturellen Identität von Bedeutung sind. Ein kulturelles Netzwerk für gehörlose Menschen bildet die Gebärdensprachgemeinschaft. In der vorliegenden Arbeit werde ich die Gebärdensprachgemeinschaft als eine Subkultur der hörenden Dominanzkultur vorstellen. Im kulturellen Konzept von Gehörlosigkeit spielt der Begriff „Behinderung“ für die Selbstidentifizierung von gehörlosen Menschen keine wesentliche Rolle. In diesem Kontext ist zu erwähnen, dass die verminderte Hörleistung erst in der Kommunikation und Interaktion mit der hörenden Dominanzkultur zu einer sozialen Behinderung wird. In der Gebärdensprachgemeinschaft ist die Beherrschung der Gebär8 1 Einleitung densprache das verbindende und Kultur kennzeichnende Merkmal, welches uneingeschränkte Kommunikations- und Interaktionserfahrungen bietet und soziale Beziehungen herstellt. Spätertaubte Menschen sind physiologisch betrachtet gehörlos und erleben kommunikative Einschränkungen in der hörenden Gesellschaft. Jedoch bestimmt die physiologische Hörschädigung nicht automatisch die Zugehörigkeit zur Gebärdensprachgemeinschaft. Entscheidender als das medizinische Kriterium ist die Identifikation mit der Gruppe hörgeschädigter Menschen. Ausgehend von meinen bisherigen Überlegungen werde ich mich in der vorliegenden Arbeit mit der Frage auseinandersetzen, inwiefern sich ein plötzlicher Hörverlust im Erwachsenenalter auf die Identitätsarbeit einer betroffenen Person auswirkt; mit dem speziellen Blickwinkel auf die kulturelle Zugehörigkeit eines spätertaubten Menschen im Kontext der Gebärdensprachgemeinschaft und der hörenden Gesellschaft. In diesem Zusammenhang gebe ich zu bedenken, dass Identität die subjektive Konstruktion über die eigene Person ist. Folglich kann nur der betreffende Mensch selbst über seine Identität Auskunft geben. Diese Sichtweise hat mich dazu veranlasst, meine theoretische Abhandlung mit der Darstellung und Auswertung von biographischen Interviews zu ergänzen. Die retrospektiven Interviews beleuchten die individuelle Identitätsarbeit von einzelnen Biographien. Zum Abschluss der vorliegenden Arbeit werde ich mögliche Handlungsanforderungen an eine biographisch- und lebensweltorientierte Soziale Arbeit mit spätertaubten Menschen herausarbeiten. Das Ziel dieser Arbeit besteht nicht darin, einheitliche normative Vorstellungen über die Identitätsarbeit des betreffenden Personenkreises aufzuzeigen. Vielmehr möchte ich einen Denkrahmen für die Soziale Arbeit mit spätertaubten Menschen liefern, in dem die Vielfalt und Beweglichkeit von persönlichen Identitätsprozessen ihre Berücksichtigung finden. Abschließend weise ich darauf hin, dass ich in der vorliegenden Arbeit wegen der besseren Lesbarkeit darauf verzichtet habe, die männliche und die weibliche Form zu verwenden. Dies geschieht jedoch nicht, um Frauen zu diskriminieren oder zu benachteiligen. Ich hoffe, alle Leserinnen haben dafür Verständnis. 9 2 Allgemeine Grundlagen des Hörens und seine Schädigungen 2 Allgemeine Grundlagen des Hörens und seine Schädigungen Im Folgenden lege ich grundlegende Informationen zur Hörfähigkeit und zu verschiedenen Schädigungen des Gehörs dar. Damit möchte ich eine Basis an spezifischem Wissen schaffen, welches für den weiteren Verlauf der Arbeit bedeutsam ist. 2.1 Anatomie und Physiologie des menschlichen Hörorgans Geräusche sind akustische Zeichen, welche mittels Schall an das Hörorgan übertragen werden. Das Ohr empfängt die Schallwellen und wandelt diese mechanischen Schwingungen in elektrische Impulse um, die anschließend vom Gehirn als Geräusche oder Töne interpretiert werden können. Der Hörvorgang vollzieht sich in den drei Stufen: 1) Aufnahme der Schallschwingungen, 2) Verstärkung der Schallschwingungen und 3) Umwandlung der Schwingungen in elektrische Impulse (Ilenborg 2001, 63). Dementsprechend gliedert sich das menschliche Ohr in die Bereiche: Außenohr, Mittelohr und Innenohr. Die zwei Ohrmuscheln ermöglichen das stereophone Richtungshören. Beim Hörvorgang wandern die, durch die Ohrmuschel aufgenommenen, Schallwellen durch den Gehörgang und versetzen das Trommelfell in Schwingung. Die Gehörknöchelkette des Mittelohrs führt den Schall durch das ovale Fenster in das Innenohr weiter. Dieser Vorgang wird als Schallleitung bezeichnet. Das Innenohr besteht aus dem Gleichgewichtsorgan und der Hörschnecke (Cochlea). In der Schnecke werden die mechanischen Reize in elektrische Energie umgewandelt. Diese Energie wird anschließend vom Hörnerv als Impuls an das Gehirn übermittelt und es entsteht ein Höreindruck (vgl. Fink 1995, 58). Das Außenohr 1. Ohrmuschel 2. Gehörgang Das Mittelohr 3. Trommelfell 4. Hammer 5. Amboss 6. Steigbügel 7. Ohrtrompete Gehörknöchelkette Das Innenohr 8. Hörschnecke (vgl. Cochlea) 9. Bogengänge 10. Hörnerv und Gleichgewichtsnerv Abb. 1: Das menschliche Ohr (in Anlehnung an www.schwerhoerigen-netz.de, 2004) 10 2 Allgemeine Grundlagen des Hörens und seine Schädigungen 2.2 Klassifikationen von Hörschädigungen Störungen der physiologischen Hörfähigkeit werden zum einen nach Art und Ausmaß des Hörschadens eingestuft und zum anderen nach dem Zeitpunkt des Eintretens der Schädigung. Die Art der Hörstörung entscheidet über die verschiedenen medizinischen Rehabilitationsmöglichkeiten. Der zeitliche Aspekt bezieht sich auf die kindliche Sprachentwicklung. Einerseits verdeutlicht diese Definition den Zusammenhang von Hörfähigkeit und Lautspracherwerb, denn der Hörsinn bildet die Basis der lautsprachlichen Kommunikation, andererseits wird die Bedeutung von Sprache und Kommunikation als Bindeglied zwischen Individuen hervorgehoben. Demnach hat Sprache vor allem eine soziale Funktion. Mittels Sprache wird der Kontakt zu anderen Menschen hergestellt. Ergänzend füge ich hinzu, dass Lautsprache nicht die Prämisse für eine Verständigung mit der Umwelt sein muss. Die bisherigen Ausführungen gelten ebenfalls für die Benutzung der Gebärdensprache als visuelles Sprachsystem. Im Rahmen dieser Arbeit verwende ich für die Definition von Hörschädigungen die Begrifflichkeiten „Schwerhörigkeit“, „Gehörlosigkeit“ und „Spätertaubung“. Sie beinhalten eine hinreichende Klassifikation für meine weitere Analyse. 2.2.1 Art und Ausmaß des Hörschadens 2.2.1.1 Schallleitungsschwerhörigkeit Die Ursache der Hörstörung liegt in der unzureichenden Übertragung der Schalleindrücke vom Außenohr zur Cochlea. Ursache hierfür können krankhafte Veränderungen des Trommelfells bzw. der Gehörknöchelkette sein. Die Schallleitungsstörung führt zur Verringerung der Hörweite und damit zur Schwerhörigkeit. Die Hörminderung erstreckt sich gleichmäßig auf alle Frequenzen ohne störende Entstellung oder Verzerrung der Sprachlaute (vgl. Ilenborg 2001, 64). Die Schallleitungsschwerhörigkeit ist durch operative Eingriffe therapierbar und wird in der folgenden Analyse nicht weiter berücksichtigt. Die nachstehende Abbildung stellt einen optischen Vergleich zur Schallleitungsstörung dar. Abb. 2: Optische Parallele zur Schallleitungsstörung (Lienhard 1992, 47) 11 2 Allgemeine Grundlagen des Hörens und seine Schädigungen 2.2.1.2 Schallempfindungsschwerhörigkeit Bei der Schallempfindungsschwerhörigkeit liegt eine Funktionsstörung vor, die vom Innenohr ausgeht und die Cochlea betrifft. Krankhafte Veränderungen der Hörsinneszellen und der Hörnerven verhindern die Umwandlung der mechanischen Reize in elektrische Reize bzw. die Weiterleitung der Impulse zum Gehirn. Schallempfindungsstörungen reichen von Schwerhörigkeit bis zur vollständigen Taubheit und sind oftmals irreversibel. Zur Hörminderung treten zusätzlich akustische Wahrnehmungsverzerrungen auf. Der medizinischen Versorgung mit einem Hörgerät sind in diesem Fall Grenzen gesetzt. Krüger (1982, 6) postuliert, dass eine akustische Verstärkung erreicht werden kann, jedoch bleiben die qualitativen Veränderungen und Klangentstellungen der wahrgenommenen Sprache bestehen. Die Klassifikation von Schwerhörigkeit richtet sich in erster Linie auf das vorhandene Sprachverständnis als wichtigste Funktion des menschlichen Gehörs. Bei an Taubheit grenzender Schwerhörigkeit und bei vollständiger Taubheit ist kein Sprachverständnis über das Ohr möglich. Leven (2003, 15) stellt einschränkend fest, dass die Grenzbereiche von hochgradiger Schwerhörigkeit, an Taubheit grenzender Schwerhörigkeit und Gehörlosigkeit aufgrund verschiedener audiometrischer Verfahren und individueller Möglichkeiten der betroffenen Personen fließend sind und die bisherigen medizinischen Einteilungen nicht mehr aussagekräftig erscheinen. In den letzten Jahren wurden zunehmend mehr hörgeschädigte Menschen mit CochleaImplantaten (CI) versorgt. Dabei handelt es sich um ein elektronisches Hörgerät, welches in die Hörschnecke eingepflanzt wird. Für eine erfolgreiche Implantation sind intakte Hörnerven die Voraussetzung. Im Idealfall bewirkt das CI ein Verstehen von gesprochener Sprache (vgl. www.uni-heidelberg.de, 2005). Die folgende Abbildung stellt einen optischen Vergleich zur Schallempfindungsschwerhörigkeit dar. Abb. 3: Optische Parallele zur Schallempfindungsstörung (Lienhard 1992, 48) Die medizinische Versorgung sollte möglichst schnell nach Eintreten der Taubheit erfolgen, um an frühere auditive Wahrnehmungen anknüpfen zu können. Bucher (1991, 46) weist darauf hin, dass es um so schwieriger für die betroffenen Menschen ist, sich 12 2 Allgemeine Grundlagen des Hörens und seine Schädigungen der hörenden Welt wieder anzuschließen und Lauteindrücke eindeutig zu interpretieren, je mehr Zeit zwischen dem Zeitpunkt der vollständigen Taubheit und der medizinischen Rehabilitation liegt. 2.2.1.3 Schädigung des Hörnervs oder im Gehirn Diese Form der Hörschädigung betrifft den Hörnerv oder das zentrale Hörsystem im Gehirn, so dass kein Höreindruck entsteht. Der Übertragungsweg der Nervenimpulse vom Ohr zum Gehirn ist geschädigt (vgl. Ilenborg 2001, 64). Die Versorgung mit einem CI ist nicht möglich und die betroffenen Menschen sind unter medizinischen Gesichtspunkten gehörlos (vgl. Ilenborg 2001, 64). Gegenstand dieser Arbeit sind Menschen mit Schallempfindungsstörungen bzw. einer Schädigung des Hörnervs (vgl. Kapitel 2.2.1.2; vgl. Kapitel 2.2.1.3). Einschränkend stelle ich fest, dass die medizinische Sichtweise auf die Dysfunktion des menschlichen Hörorgans für meine weitere Analyse unzureichend ist. Eine Abgrenzung von Gehörlosigkeit unter Berücksichtigung des Eintrittszeitpunktes erscheint sinnvoll für eine interdisziplinäre Auseinandersetzung mit dem Personenkreis der ertaubten Menschen. 2.2.2 Zeitpunkt des Eintretens der Hörschädigung 2.2.2.1 Prälinguale Gehörlosigkeit Prälinguale Gehörlosigkeit beinhaltet die begrenzte Aufnahme auditiver Höreindrücke. Insbesondere die gesprochene Sprache wird nicht über das Ohr wahrgenommen. Diese restriktiven Bedingungen verhindern weitgehend den natürlichen Lautspracherwerb des Kindes (vgl. Krüger 1982, 21). Mehrere Autoren (Krüger 1982, 21; vgl. Leven 2003, 15; vgl. Rosen-Bernays 1992, 10) benennen den Zeitraum der Ertaubung vor Abschluss der primären Spracherwerbsphase, d.h. in den ersten vier Lebensjahren. Die Sozialisation von prälingual gehörlosen Kindern ist durch ein Leben ohne Gehör geprägt und weist demzufolge signifikante Unterschiede zur Entwicklung von Personen auf, die erst nach dem Lautspracherwerb ertaubten. Das genuine Kommunikationsmittel von Menschen, die vor der Spracherwerbsphase ertaubten, ist die Gebärdensprache. Als visuelle Sprache stellt sie analog zur Lautsprache ein signifikantes Zugehörigkeitsmerkmal zu einer kulturellen Sprachgemeinschaft dar, in diesem Fall zur Gebärdensprachgemeinschaft. Das Emanzipationsstreben prälingual hörgeschädigter Menschen bezieht sich auf eine soziokulturelle Perspektive von 13 2 Allgemeine Grundlagen des Hörens und seine Schädigungen Gehörlosigkeit und grenzt sich demnach von der pathologischen Sichtweise ab. Im kulturellen Konzept von Gehörlosigkeit begreifen sich hörgeschädigte Menschen als Angehörige einer Minderheitskultur, die ihnen personale und soziale Identität bietet (vgl. Leven 2003, 18). Aus diesem Blickwinkel heraus sehen gehörlose Personen das Cochlea Implantat häufig als eine Bedrohung ihrer Kultur an, da es dazu dient einen Anschluss an die hörende Gesellschaft zu erhalten, der einher geht mit der Abwertung ihrer eigenen Sprache und Kultur (vgl. Ilenborg 2001, 81). 2.2.2.2 Postlinguale Gehörlosigkeit Personen mit postlingualer Gehörlosigkeit werden auch als Ertaubte oder Spätertaubte bezeichnet. Die Hauptursachen für erworbene Hörschädigungen liegen in Unfällen und Krankheiten begründet. Der Verlust des Gehörs erfolgt in diesen Fällen nach dem natürlichen Lautspracherwerb in der kindlichen Entwicklung. Fengler (1990, 16) spricht von Spätertaubung, wenn der Hörverlust nach dem fünften Lebensjahr erfolgt. Zu diesem Zeitpunkt verfügt das Kind bereits über differenzierte Kenntnisse der Grammatik sowie über einen umfangreichen Wortschatz. Analog zu prälingual gehörlosen Personen können spätertaubte Menschen Sprache nicht über das Ohr aufnehmen, aber dennoch relativ verständlich sprechen. Im Rahmen dieser Arbeit geht es speziell um Personen, die erst im Erwachsenenalter einen Gehörverlust erfahren haben. Sie unterscheiden sich von allen bisher beschriebenen Gruppen aufgrund ihrer jahrzehntelangen Hörfähigkeit. Spätertaubte Erwachsene sind soziokulturell in der hörenden Kulturgemeinschaft aufgewachsen. Mit der eintretenden Gehörlosigkeit nehmen die Partizipationsmöglichkeiten in der hörenden Gesellschaft ab. Das Cochlea Implantat stellt für ertaubte Erwachsene, im Gegensatz zu prälingual gehörlosen Menschen, die Hoffnung dar, wieder einen Anschluss an ihre bisherige Alltagswelt zu finden (vgl. Ilenborg 2001, 81). Der Hörverlust verändert die psychosoziale Situation der Betroffenen nachhaltig. Die kommunikativen Einschränkungen können sowohl psychische Belastungen als auch Verunsicherung bezüglich der personalen und sozialen Identität hervorrufen (vgl. Leonhardt 1999, 70). Bedenkt man, dass soziale Interaktion in erster Linie auf verbaler Ebene erfolgt, so wird das Ausmaß der Verständigungsprobleme deutlich (vgl. Fink 1995, 123). Die ertaubte Autorin Hannah Merker postuliert in ihrem Buch „Listening“: „Da ich mein Gehör als Erwachsene fast vollständig und ganz plötzlich verlor, fand ich mich nach dem Verlust an einem merkwürdigen Nicht-Ort wieder. Die 14 2 Allgemeine Grundlagen des Hörens und seine Schädigungen Sinne sind wach, doch man ist abgeschnitten, allein in seiner unheimlichen Isolation. Die Welt eilt vorwärts, und man kann nicht Schritt halten.“ (Merker 1998, 72). Hannah Merker illustriert auf diese Weise die anthropologische Bedeutung des Hörens im Sinne einer gesellschaftlichen Teilhabe. Im Folgenden führe ich diesen Sachverhalt näher aus. 2.2.3 Anthropologische Bedeutung des Hörens Die Einteilung der Hörschädigungen unter Berücksichtigung der Lautsprachentwicklung beinhaltet die Feststellung, dass Hören eine Sinnesbrücke ist, durch die Individuen mit der physischen Umwelt in Verbindung stehen (vgl. Krüger 1982, 3). Vom anthropologischen Standpunkt aus gesehen erscheint der Mensch somit als subjektiv handelndes, auf seine Umwelt wirkendes und von ihr beeinflusstes Wesen. Fink (1995, 314) hebt in diesem Zusammenhang hervor, dass der Sinnesausfall keine ausschließlich medizinische, sondern eine soziale Behinderung zur Folge hat, die sich aus der kommunikativen Beeinträchtigung ergibt. Das Gehör bietet die Möglichkeit, kontinuierlich Schalleindrücke aus allen Raumrichtungen aufzunehmen. Selbst während der Schlafphase ist der Hörsinn selektiv aktiv. Die regelmäßige Wiederkehr der Schallerregung bietet einen fortwährenden Kontakt zur Umwelt und der menschliche Organismus wird permanent über Umweltveränderungen informiert (vgl. Barthes 1991, 56). Gemäß Krüger (1999, 55) lässt sich der Gesamthörprozess analytisch in folgende Funktionsebenen gliedern: - die Wahrnehmung der allgegenwärtigen Umwelt mit den kaum bewussten Hintergrundgeräuschen (z.B. Verkehrsgeräusche, Naturgeräusche oder die eigenen Atemgeräusche), - die Signalebene mit Geräuschen, die Individuen identifizieren, die Gefahr anzeigen oder denen sich Menschen wegen ihrer auffallenden Akustik zuwenden und - die Symbolebene mit der hörbar gesprochenen Sprache als wesentliches interaktives Kommunikationssystem in einer Sozial- und Sprachgemeinschaft. Das Wissen um den Verlust der Hörfähigkeit bei spätertaubten Menschen beinhaltet andere Voraussetzungen und Problemlagen als bei prälingual ertaubten Personen. Von Geburt an gehörlose Menschen sind auf das Wahrnehmen visueller Signale der akustischen Umwelt geschult. Indessen sind postlingual gehörlose Menschen mit dem plötzlichen Wegfall eines wichtigen menschlichen Fernsinnes konfrontiert. In Folge der Kom- 15 2 Allgemeine Grundlagen des Hörens und seine Schädigungen pensation des Hörverlustes durch den Sehsinn gehen der spätertaubten Person zwangsläufig Informationen aus der auditiven Umwelt verloren (vgl. Fink 1995, 68f.). Des Weiteren erlebt der Mensch auf der Signalebene einen plötzlichen Einschnitt in seine Orientierungssicherheit, die auf visuellem Wege wiedererlangt werden muss (vgl. Krüger 1999, 54). Die physiologische Hörfähigkeit bezieht die Möglichkeit der auditiven Sprachaufnahme ein und stellt damit eine Voraussetzung für die Zugehörigkeit und Partizipation zur hörenden Kulturgemeinschaft dar (vgl. Leven 2003, 50). In diesem Zusammenhang konstatiert Leven: „Sprache, […], ist als soziale und kulturelle Eigenschaft von Menschen unerlässlich für die Entwicklung des Individuums sowie der Gemeinschaft.“ (Leven 2003, 50). Hintermair und Voit (1990, 68) führen weiter aus, dass die menschliche Sprachfähigkeit eine eigene Lebensqualität begründet bzw. deren Ausdruck darstellt. Demzufolge wird die Komplexität des Hörverlustes im Erwachsenenalter besonders auf der Symbolebene deutlich. Die menschliche Sprache ist sozial tradiert und wird durch Anpassung und Erprobung erworben. Spätertaubte Menschen können sehr gut sprechen und scheinen zunächst nicht in ihrer Kommunikationsfähigkeit beeinträchtigt. Die sensorische Deprivation behindert allerdings die Wahrnehmung der Sprachlaute und die zwischenmenschliche Verständigung mit der sozialen Umwelt. Zusammenfassend halte ich fest, dass spätertaubte Personen zwar die Laut- und Schriftsprache beherrschen, jedoch nicht mehr uneingeschränkt am Leben der hörenden Sprach- und Kulturgemeinschaft teilhaben können. Lienhard (1992, 29) postuliert in diesem Kontext, dass Sprache und Kommunikation zentrale Elemente der Alltagswelt sind und ihr Verlust umfassend in die psychosoziale Lebenswelt eines Betroffenen eingreift. Die Auswirkungen der Ertaubung auf die Kommunikationsmöglichkeiten eines Menschen sind Gegenstand des nachfolgenden Kapitels. 16 3 Kommunikationstheoretische Aspekte unter Berücksichtigung der Ertaubung im Erwachsenenalter 3 Kommunikationstheoretische Aspekte unter Berücksichtigung der Ertaubung im Erwachsenenalter Nachdem ich die grundlegenden Merkmale von Hörschädigungen dargelegt habe, erörtere ich im Folgenden die Auswirkungen der akustischen Deprivation auf die zwischenmenschliche Kommunikation. Dazu schildere ich zunächst den Ablauf eines Kommunikationsprozesses. Anschließend rekurriere ich das Kommunikationsmodell von Schulz von Thun und wende es auf die kommunikativen Einschränkungen von spätertaubten Personen an. 3.1 Der Ablauf eines Kommunikationsprozesses Die verbale Kommunikation ist ein intentionaler Hörakt und das zentrale Verständigungsmittel in der heutigen Kommunikationsgesellschaft. Ein wesentlicher Bestandteil dabei ist die Lautsprache, die mittels der individuellen Stimme des Menschen übertragen wird. Jede verbale Nachricht wird durch nonverbale Anteile in der Mimik und Gestik begleitet und ergänzt (vgl. Schulz von Thun 2001, 33). Der Grundvorgang menschlicher Kommunikation setzt mindestens zwei Subjekte in Beziehung. Der Kommunikationspsychologe Schulz von Thun (2001, 25) spricht in diesem Kontext von einem Sender, „der etwas mitteilen möchte“, und einem Empfänger, „der dieses wahrnehmbare Gebilde zu entschlüsseln“ versucht. Hierzu kodiert der Sender seine zu übermittelnden Gedanken und Intentionen in abstrakte Zeichen. Die Aufgabe des Empfängers besteht anschließend in der Dekodierung der Nachricht. Die grundlegende Prämisse für Verständigung zwischen Sender und Empfänger besteht in der Verwendung einer homogenen Sprache. Dies gilt sowohl bei der Verwendung verbaler als auch bei visuellen Sprachen. In diesem Zusammenhang lasse ich die Schriftsprache mit ihren Eigenarten und Besonderheiten der menschlichen Kommunikation außer Acht und konzentriere mich auf die mündliche Interaktion als zentrales gesellschaftliches Verständigungsmittel. Zur Analyse und Beschreibung von Kommunikationsprozessen entwickelte Schulz von Thun 1981 sein kommunikationspsychologisches Modell. Schulz von Thun betrachtet Kommunikation nicht nur als ein Vermitteln von Sachinhalten durch Sprache, sondern auch als ein umfangreiches intra- und interpersonales Verhalten (vgl. Leven 2003, 23). Für meine theoriegeleitete Analyse bietet sich dieses Modell an, weil der Autor Kommunikation in den unterschiedlichen Funktionen beleuchtet und entsprechende Störungsmöglichkeiten auf verschiedenen Ebenen darlegt. 17 3 Kommunikationstheoretische Aspekte unter Berücksichtigung der Ertaubung im Erwachsenenalter 3.2 Das Kommunikationsmodell nach Schulz von Thun 3.2.1 Die Anatomie einer Nachricht aus der Sender-Perspektive Schulz von Thun (2001, 25ff.) arbeitet in seinem Kommunikationsmodell vier Teilaspekte menschlicher Kommunikation heraus, die als Botschaften in ein und derselben Nachricht enthalten sind. Daraus lässt sich ableiten, dass eine Nachricht mehrdeutig ist. Gemäß Schulz von Thun (2001, 13) gliedern sich die Aspekte in: - Sachaspekt, - Beziehungsaspekt, - Selbstoffenbarungsaspekt und - Appellaspekt. Der Sachaspekt umfasst die Übermittlung von Fakten, Daten und Informationen. Dieser Gesichtspunkt bezieht sich vor allem auf Sachfragen und Richtigstellungen. Emotionale Sachverhalte und Beziehungsfragen finden dabei keine Berücksichtigung (vgl. Leven 2003, 20). Aus dem Beziehungsaspekt der Nachricht geht hervor, wie der Sender zum Empfänger steht und wie der Sender die Beziehung zwischen sich und dem Empfänger deutet. Gemäß Schulz von Thun (2001, 28) werden auf diese Weise „Du-Botschaften“ und „WirBotschaften“ transportiert. Neben der verbalen Formulierung können sowohl nichtsprachliche Begleitsignale in der Mimik und Gestik des Senders als auch parasprachliche Signale bedeutsam sein. Nach Voit (zit. n. Ahrbeck 1997, 95) sind parasprachliche Phänomene durch Pausengliederung, Grundlautstärke, Grundtonhöhe sowie einen Veränderungsverlauf in der Sprachgeschwindigkeit gekennzeichnet. Schulz von Thun (2001, 27) und Leven (2003, 21) verweisen auf die eminente Signifikanz des Beziehungsaspektes in der zwischenmenschlichen Kommunikation. Hier fühlt sich eine Person in bestimmter Weise behandelt bzw. „misshandelt“. Beziehungsbotschaften wirken nicht nur für den Augenblick, sondern tragen auch längerfristig zum Selbstkonzept des Empfängers bei (vgl. Leven 2003, 21). Der Selbstoffenbarungsaspekt bezieht sich auf die Tatsache, dass in jeder Nachricht Informationen über den Sender enthalten sind. Die vermittelten Inhalte können die Person des Senders, seine Gefühle oder Wertvorstellungen betreffen. Die Selbstoffenbarung vollzieht sich gewollt in Form der Selbstdarstellung oder ungewollt in Form der Selbstenthüllung. Hierbei handelt es sich stets um „Ich-Botschaften“, die an den Empfänger gesendet werden. 18 3 Kommunikationstheoretische Aspekte unter Berücksichtigung der Ertaubung im Erwachsenenalter Sie bewegen sich vorwiegend auf der nonverbalen Kommunikationsebene und äußern sich in Tonfall, Mimik und Gestik (vgl. Schulz von Thun 2001, 33). Der letzte Teilaspekt einer gesendeten Nachricht richtet sich als Aufforderung an den Empfänger etwas „zu tun oder zu unterlassen“ (Schulz von Thun 2001, 29). Schulz von Thun bezeichnet diese Seite der Kommunikation als Appellaspekt. Der Sender möchte mit seiner Nachricht etwas bewirken und versucht, Einfluss auf den Empfänger zu nehmen. Grundsätzlich sind die einzelnen Sachverhalte einer Nachricht gleichrangig, auch wenn der Sender in jeder einzelnen Situation einen bestimmten Aspekt in den Vordergrund hebt. Auf allen vier Ebenen können explizite und implizite Botschaften transportiert werden. Für implizite Botschaften wird häufig der nonverbale Kommunikationskanal genutzt. Die Vermittlung dieser eigenständigen, qualifizierten Aussagen erfolgt über die Phonation, die Artikulation und über die begleitende Mimik und Gestik (vgl. Schulz von Thun 2001, 35). Die verbalen und nonverbalen Anteile einer Nachricht können sich einerseits ergänzen und unterstützen, andererseits aber auch widersprechen und Verwirrung auslösen. Die Mehrdeutigkeit von Nachrichten korreliert mit einem beträchtlichen Störungspotential für die interpersonale Kommunikation und enthält die Gefahr von Fehlinterpretationen (vgl. Leven 2003, 22). 3.2.2 Die Anatomie einer Nachricht aus der Empfänger-Perspektive Der Ambiguität bzw. Mehrdeutigkeit einer Nachricht ordnet Schulz von Thun (2001, 44ff.) den „vierohrigen Empfänger“ zu. Dabei betrachtet der Autor die vier Seiten der gesendeten Nachricht aus der Sicht des Empfängers. Auf der Sachebene konzentriert sich der Empfänger auf die Frage, wie der Sachinhalt der Nachricht zu verstehen ist, während er sich auf der Beziehungsebene überlegt: „Wie redet mein Gegenüber mit mir?“ und „Wie fühle ich mich behandelt?“. Die Selbstoffenbarung des Senders lässt den Empfänger vermuten, in welcher Stimmung sich dieser befindet oder was für ein Mensch er sein mag. Auf der Appellebene spekuliert der Empfänger über die Intentionen des Senders und stellt sich die Frage: „Was soll ich tun, denken, fühlen aufgrund seiner Mitteilung?“ (vgl. Schulz von Thun 2001, 45). Prinzipiell hat der Empfänger die freie Wahl, auf welche Botschaft er reagieren möchte. Gleichzeitig wird jede Kommunikation durch die intra- und interpersonale Beziehung der Interaktionspartner beeinflusst (vgl. Becker 2003, 31). Ferner ist zu berücksichtigen, dass die individuelle Wahrnehmung des Empfängers durch seine lebensweltlichen Er19 3 Kommunikationstheoretische Aspekte unter Berücksichtigung der Ertaubung im Erwachsenenalter fahrungen, die in seiner Biographie kumulieren, geprägt ist. Im Laufe der Sozialisation macht der Mensch verschiedene Kommunikationserfahrungen und entwickelt eine Vorstellung davon, ob er verstanden, akzeptiert und geschätzt oder missverstanden und missachtet wird (vgl. Leven 2003, 22). Auf diese Weise konstruiert sich „ein inneres Bild von dem, wie der Betreffende meint, von anderen wahrgenommen zu werden“ (Leven 2003, 22). Mit anderen Worten: Sprache kann als Vehikel der Sozialisation verstanden werden. Im Sinne einer Entwicklungspsychologie der Lebensspanne finden solche Lernerfahrungen zeitlebens statt (vgl. Haußer 1995, 71). Während des zwischenmenschlichen Interaktionsprozesses ergeben sich Kommunikationsstörungen, wenn der Empfänger auf eine Botschaft der Nachricht Bezug nimmt, die der Sender nicht herausstellen wollte oder wenn der Empfänger tendenziell immer nur eine bestimmte Seite der Nachricht perzipiert und die anderen Botschaften unberücksichtigt lässt (vgl. Schulz von Thun 2001, 46). 3.2.3 Zusammenfassung Aus psycholinguistischer Perspektive ist Kommunikation ein Transfer von Botschaften zwischen mindestens zwei Personen. Ein Informationsaustausch ist erst gegeben, wenn der Empfänger die kodierten Botschaften des Senders entschlüsselt hat. Der Empfänger hebt beim Zuhören die akustischen Reize aus ihrer kognitiven Indifferenz und verdichtet sie zu bedeutungstragenden Nachrichten (vgl. Richtberg 2001, 44). Voraussetzung dafür ist das Verwenden eines gemeinsamen Sprachsystems. Der Empfänger reagiert seinerseits auf die interpretierten Signale und sendet eine Nachricht zurück. Infolgedessen befinden sich die Gesprächspartner in einem zirkulären Interaktionsprozess. Die bisherigen Ausführungen gelten sowohl im Zusammenhang mit der Benutzung der Lautsprache als auch bei der Verwendung der Gebärdensprache, als visuelles Sprachsystem. Das psychologische Modell der zwischenmenschlichen Interaktion lässt sich grafisch folgendermaßen darstellen: Sachinhalt Sender Selbstoffenbarung Nachricht Appell Empfänger Beziehung Abb. 4: Modell der zwischenmenschlichen Kommunikation (in Anlehnung an Schulz von Thun 2001, 30) 20 3 Kommunikationstheoretische Aspekte unter Berücksichtigung der Ertaubung im Erwachsenenalter Notwendigerweise stellt das Modell eine Vereinfachung menschlicher Kommunikations- und Interaktionsprozesse dar. In den meisten Fällen befinden sich mehrere Personen gleichzeitig in Interaktionsprozessen und es bestehen komplexe Beziehungen zwischen den Beteiligten. 3.3 Auswirkungen des Hörverlustes auf die Mehrdimensionalität der Kommunikation Mit sinkendem Hörvermögen sind spezifische Erschwernisse der Kommunikation verbunden, die im Folgenden näher betrachtet werden. Zunächst ist zu bedenken, dass Ertaubung eine unsichtbare Sinnesbehinderung darstellt. Die Gehörlosigkeit verhindert die Möglichkeit der auditiven Sprachaufnahme. Unter linguistischen Gesichtspunkten können die betroffenen Menschen ihre Nachrichten in Bezug auf Artikulation, Stimmgabe und Lautstärke nicht kontrollieren. Die verbalen Anteile der Nachricht, z.B. eine laute oder schrille Modulation der eigenen Stimme, können den nonverbalen Anteilen widersprechen und beim Empfänger Verwirrung auslösen oder als situationsunangebracht interpretiert werden. Folglich sind spätertaubte Menschen in Interaktionsprozessen mit fremden Personen zuerst genötigt, auf der Sachebene über das Faktum ihrer Hörschädigung zu informieren, um den Dialog zu beginnen oder seinen Fortgang zu ermöglichen (vgl. Leven 2003, 23). Die Selbstoffenbarung des hörgeschädigten Senders dient der erleichterten Kommunikation. Gleichzeitig sind Auswirkungen auf der interpersonalen Beziehungsebene die Folge, da der hörgeschädigte Sender nicht den Erwartungen des hörenden Empfängers entspricht (vgl. Leven 2003, 23). Mit der gesendeten Sachinformation über die Hörschädigung richtet der Sender einen Appell an den Empfänger, langsam, deutlich und mit Blickkontakt zu sprechen. Leven (2003, 23) konstatiert weiter, dass der hörende Empfänger auf die Konfrontation mit seinen eigenen Unsicherheiten oder Ängsten nicht selten mit Kontaktabbruch reagiert. Demzufolge scheint für ertaubte Erwachsene die kommunikative Verbindung zur sozialen Umwelt zunächst unterbrochen. Innerhalb der Kommunikationsprozesse verhalten sich Gesprächsteilnehmer nach den geltenden Regeln einer Sprachgemeinschaft. Diese Fähigkeit wird als „kommunikative Kompetenz“ bezeichnet (Fink 1995, 47). Matthes (1996, 360) umschreibt kommunikative Kompetenz als Fähigkeit, „Redesituationen herbeizuführen und eigene Interessen zu artikulieren sowie soziale Beziehungen neu zu definieren.“. Spätertaubte Personen können in der Interaktion mit der sozialen Umwelt nicht auf gewohnte sprachliche Mus21 3 Kommunikationstheoretische Aspekte unter Berücksichtigung der Ertaubung im Erwachsenenalter ter zurückgreifen. Dazu zählen z.B. kulturelle Besonderheiten bei der Begrüßung und Verabschiedung sowie allgemein gültige Sprach- und Kommunikationsgewohnheiten. Infolgedessen ist ihre kommunikative Kompetenz unter den bisherigen Bedingungen eingeschränkt. Weiterhin sind sie auf das visuelle Wahrnehmen einer gesendeten Nachricht angewiesen, indem sie von den Lippen absehen. Becker (2003, 36) weist darauf hin, dass Menschen in einer akustisch orientierten Gesellschaft nicht geschult sind, optische Eindrücke ausreichend zu erfassen und zu interpretieren. Neben der erhöhten Konzentration kommt die kommunikative Unsicherheit hinzu, ob die Nachricht richtig verstanden wurde. Ein daraus resultierender, erlebter Verlust an Spontanität kann der hörende Empfänger auf dem Selbstoffenbarungsohr als ein zurückhaltendes oder ruhiges Verhalten auslegen (vgl. Seithe 1998). Ferner ist davon auszugehen, dass hörende Menschen nicht in der Kommunikation mit hörgeschädigten Personen geschult sind. Seitliches Wegdrehen des Kopfes, schnelles Sprechtempo oder ein abgedunkelter Raum verhindern jegliches Verstehen. Die Gefahr der Reduktion auf die unbedingt notwendigen Informationen ist gegeben. Becker (2003, 36) und Merker (1998, 155) zeigen auf, dass sich die Gewichtung der Kommunikation in Richtung Sachebene verschieben kann. Stellt ein Sender beim Empfänger wiederholt Nichtverstehen fest, kann sich seine Ungeduld oder Unerklärlichkeit in der Mimik widerspiegeln und vom Empfänger ablehnend auf seine Person hin bezogen interpretiert werden. Diese impliziten Botschaften wirken sich auf die Beziehung zwischen Sender und Empfänger aus. Watzlawick (zit. n. Berg 2000, 31) spricht in diesem Zusammenhang von Rückkoppelungskreisen, da jedes Individuum das Gegenüber beeinflusst und seinerseits gelenkt wird. Die Beziehungsbotschaften in einer Nachricht werden außerdem mittels parasprachlicher Äußerungen übermittelt. Aufgrund der Taubheit kann die betroffene Person weder sich selbst mit Hilfe parasprachlicher Mitteilungen verdeutlichen noch wird es ihr gelingen, die Äußerungen des Kommunikationspartners dahingehend zu entschlüsseln. Beispielsweise gehören dazu ironische Aussagen, welche mit der Grundtonhöhe und der Pausengliederung parasprachlich unterstützt werden (vgl. Kapitel 3.2.1). Darüber hinaus sind die Botschaften von Seiten der Umwelt für die Entstehung des subjektiven Selbstbildes von Bedeutung. Kommunikative Misserfolge wirken sich auf das Selbstwertgefühl des Empfängers aus und können in der Entwicklung eines negativen Selbstbildes kumulieren (vgl. Seithe 1998). 22 3 Kommunikationstheoretische Aspekte unter Berücksichtigung der Ertaubung im Erwachsenenalter Subsumierend stelle ich fest, dass eine plötzliche Ertaubung eine elementare Störung der zwischenmenschlichen Kommunikation auf allen vier Ebenen nach sich zieht. Spätertaubte Menschen sind aus der Sender- sowie aus der Empfängerperspektive nicht mehr in der Lage, ungehindert auf der Sachebene, der Beziehungsebene, der Selbstoffenbarungsebene sowie der Appellebene zu kommunizieren. Durch den Versuch, die Nachricht optisch von den Lippen abzusehen, entsteht möglicherweise eine Verschiebung zur Inhalts- und Sachebene der gesendeten Nachricht hin. Des Weiteren ist von lebensweltlichen Exklusionserfahrungen in der hörenden Sprach- und Kulturgemeinschaft auszugehen. Mehrmalige Misserfolge in der Kommunikation verdichten sich im Selbstkonzept des Individuums und wirken sich auf die Identität der Person aus (vgl. Leven 2003, 22). 3.4 Möglichkeiten und Grenzen des Lippenabsehens für postlingual ertaubte Erwachsene Spätertaubte Erwachsene haben die Lautsprache als „Normalhörende“ erlernt. Demzufolge können sie nach der Ertaubung über Wort und Schrift verfügen. In verbalen Kommunikationsprozessen sind sie auf die visuelle Wahrnehmung in Form des Lippenabsehens angewiesen. Hierbei sind die sprachlichen Erinnerungsvorstellungen für das Umstellen der veränderten Perzeptionsbedingungen von eminenter Wichtigkeit (vgl. Lienhard 1992, 36f.). Die Erinnerungen ermöglichen den betroffenen spätertaubten Personen, eine kognitive Vorstellung über den artikulierten Inhalt der gesendeten Nachricht des Gesprächspartners zu entwickeln. Das Absehen befähigt spätertaubte Menschen, alltägliche Kommunikationssituationen selbstständig zu bewältigen (vgl. Becker 2003, 60). Neben den genannten Möglichkeiten ist der Absehfähigkeit eine Anzahl von Grenzen gesetzt. Zunächst einmal bleibt diese Form der Verständigung immer auf den direkten Augenkontakt beschränkt (vgl. Ebbinghaus/Heßmann 1989, 237). In der Interaktion mit mehreren Personen können spätertaubte Menschen aufgrund des schnellen Sprecheroder Themenwechsels nicht mehr auf das visuelle Absehen zurückgreifen. Infolgedessen sind die betreffenden Personen in Gruppengesprächen oder Versammlungen keine gleichberechtigten Teilnehmer mehr (vgl. Ebbinghaus/Heßmann 1989, 237). Des Weiteren ähneln sich in der Lautsprache viele der gesprochenen Phoneme in ihrer Lippenstellung bzw. werden im Rachen gebildet und sind optisch nicht erkennbar (vgl. Leven 2001, 28). Darüber hinaus hat jeder Mensch seine individuell geprägte Aussprache. 23 3 Kommunikationstheoretische Aspekte unter Berücksichtigung der Ertaubung im Erwachsenenalter Dementsprechend unterscheiden sich die Mundbilder der sprechenden Personen. Leven (2001, 28) schlussfolgert, dass nur ein Drittel der gesprochenen Informationen von den Lippen absehbar ist. Folglich benötigen spätertaubte Personen eine ausgezeichnete Kombinationsgabe für die korrekte Perzeption und Interpretation. Diese muss sich der Betroffene im Rahmen audiotherapeutischer Intervention oder in Absehkursen aneignen. Die genannten Faktoren verdeutlichen, dass jede Kommunikation unter Einbeziehung des Lippenabsehens mit hoher Konzentration verbunden ist. Es kann davon ausgegangen werden, dass die betroffenen Menschen unter diesen Kommunikationsbedingungen schneller ermüden (vgl. Lienhard 1992, 37). 3.5 Sprache und Kommunikation in ihrer sozialen Funktion Sprache ist ein Konglomerat kultureller Symbole, die sich verbal, nonverbal und visuell äußern kann. Unter Bezugnahme auf Hintermair und Voit (vgl. 1990, 1) vertrete ich die Ansicht, dass Sprache ein fundamentales Wesensmerkmal der Menschen ist. Die grundlegende Bedeutung von Sprache liegt in ihrer kommunikativen Verwendung. In meinen bisherigen Ausführungen habe ich konstituiert, dass Sprache ein Bindeglied zwischen dem Individuum und der Gesellschaft darstellt. Der soziale, emotionale und intellektuelle Austausch zwischen Personen findet weitgehend mittels Sprache statt. Demnach werden zwischenmenschliche Beziehungen vorwiegend über Interaktionsprozesse aufgebaut und gestaltet. Voraussetzung für eine gelingende Interaktion ist eine funktionierende Kommunikation. Des Weiteren vertrete ich den Standpunkt, dass der Austausch von Gedanken mit anderen Menschen ein Grundbedürfnis von Individuen ist. Ausgehend von diesen Überlegungen stellt sich für mich die Frage, inwiefern sich eine plötzliche Ertaubung im Erwachsenenalter auf das Selbstverständnis und die subjektive Handlungsfähigkeit eines Betroffenen auswirkt. Im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitstudie zu einer Rehabilitationsmaßnahme für spätertaubte erwachsene Menschen in Rendsburg fanden Claußen und Schuck heraus, dass sich die Mehrheit der hörgeschädigten Seminarteilnehmer seit der postlingualen Taubheit sozial isoliert fühlt (vgl. Claußen 1991, 19). Hierbei wurden kommunikative Einschränkungen als Ursache für die subjektiv wahrgenommene Exklusion benannt. Ebbinghaus und Heßmann bekräftigen diesen Sachverhalt folgendermaßen: „Eine Kommunikationsbehinderung entfaltet […] ihre eigenen sozialen Konsequenzen, da Sozialität unmittelbar an Kommunikation gebunden ist.“ (Ebbinghaus/Heßmann 1989, 238). 24 3 Kommunikationstheoretische Aspekte unter Berücksichtigung der Ertaubung im Erwachsenenalter Tönnissen (1993, 27) offeriert ferner, dass die Zugehörigkeit zu einer Gesellschaft u.a. über die Verwendung einer homogenen Sprache erreicht werden kann. Für die Kommunikation zwischen hörenden und ertaubten Personen konstatiere ich eine Inkongruenz im Hinblick auf die Verwendung und das Verstehen eines gleichen Sprachcodes. Das gemeinsame Verständigungsmittel ist jedoch die Voraussetzung für die Herstellung und den Ausbau menschlicher Beziehungen. Unter Heranziehung der bisherigen Aussagen besteht meiner Ansicht nach die Gefahr der subjektiven Handlungsunfähigkeit und eine Bedrohung der sozialen Integration für postlingual ertaubte Erwachsene. Im Vergleich dazu sind prälingual gehörlose Menschen in der Gebärdensprachgemeinschaft sozial integriert. Als kulturelle Sprachgemeinschaft bietet sie ihren Mitgliedern mittels der Gebärdensprache uneingeschränkte Kommunikationsmöglichkeiten und soziale Identität. Folglich sind prälingual gehörlose Menschen erst in einem Gespräch mit einer hörenden und gebärdensprachunkundigen Person kommunikationsbehindert. Gemäß Miller (2001, 56) ist Kommunikation das basale Element des Sozialen. Dabei stellt die Verständigung die Grundlage für soziale Prozesse und Handeln dar. Demnach ist Sprache das wichtigste Medium, mit dem Menschen in Interaktion, also in das aufeinander bezogene Handeln zwischen zwei oder mehreren Personen, treten. Durch die Hörschädigung werden die bisherigen Kommunikationsformen beeinträchtigt und eine Neuorganisation der Interaktionsformen im betroffenen Person-Umwelt-System ist erforderlich (vgl. Claussen/Schuck 1991, 142). 3.6 Der Zusammenhang von Sprache und Interaktion auf die Identität eines Individuums Im vorigen Abschnitt habe ich herausgearbeitet, dass Sprache das basale Medium ist, mit dem Individuen in Interaktion treten. Gemäß der Theorie des symbolischen Interaktionismus entwickelt sich die Identität eines Subjekts in der Interaktion (vgl. Georgogiannis 1985, 3). Dabei ist Sprache das Mittel, mit dem sich Identität ausdrückt bzw. erworben wird (vgl. Matthes 1996, 358). Folglich ist Sprache das wichtigste Instrument des Individuums, um seine Einstellungen und Erwartungen zu kommunizieren und sich damit in seinem Selbstverständnis darzustellen. Wolfgang Kraus formuliert in seiner Studie „Das erzählte Selbst“: „Was das Subjekt an Identitätsprojekten formuliert, wie es mit sich und anderen verhandelt, all dies findet in Narrationen statt.“ (Kraus 2000, 168). 25 3 Kommunikationstheoretische Aspekte unter Berücksichtigung der Ertaubung im Erwachsenenalter Infolgedessen ist der Begriff der „Identität“ mit dem der Sprache verbunden. In der aktuellen Identitätsforschung werden die Narrationen nicht als individuelle Ausdrücke, sondern als Produkte des sozialen Austausches verstanden. Keupp (2002, 209) betont, dass Individuen sich in Interaktionen auf ein Sprachsystem zur Vermittlung und Verbindung von Ereignissen stützen und demzufolge in einem sozialen Akt involviert sind. Demnach sind Narrationen in soziales Handeln eingebettet. Ferner wird davon ausgegangen, dass Individuen ihre Identität in einem lebenslangen Prozess konstruieren und neue Interaktionserfahrungen das Selbstkonzept umformen (vgl. Keupp 2002, 189). 3.7 Resümee Für meine weitere Untersuchung fasse ich zusammen: Spätertaubung ist eine Störung der physiologischen Hörfähigkeit. Neben der fehlenden Möglichkeit der auditiven Perzeption ist der Mensch darüber hinaus von den bisherigen sprachlichen Kommunikationsmöglichkeiten mit der sozialen Umwelt abgeschnitten. Sprache und Kommunikation sind zentrale Elemente der Alltagswelt, und ihr Verlust greift umfassend in die psychosoziale Lebenswelt der Betroffenen ein. Unter kommunikationstheoretischen Gesichtspunkten sind postlingual ertaubte Erwachsene auf das visuelle Wahrnehmen einer gesendeten Nachricht angewiesen, indem sie von den Lippen absehen. In einer akustisch orientierten Gesellschaft sind Menschen jedoch nicht geschult, optische Eindrücke ausreichend zu erfassen und zu interpretieren. Gleichzeitig sind dem Lippenabsehen vielfältige Grenzen gesetzt. Demnach stellt die Spätertaubung eine Kommunikationsbehinderung dar, die sich zum einen auf die Zugehörigkeitsmöglichkeiten zur hörenden Gesellschaft auswirkt und zum anderen auf das Selbstkonzept der Person. Die Zugehörigkeit zu einer Gesellschaft wird über die Verwendung einer gemeinsamen Sprache gesteuert. Für die Kommunikation zwischen hörenden und postlingual ertaubten Menschen konstatiere ich eine Inkongruenz im Hinblick auf die Verwendung und das Verstehen einer gemeinsamen Sprache. Demzufolge ist davon auszugehen, dass für spätertaubte Personen die Partizipationsmöglichkeiten zur hörenden Gesellschaft abnehmen. Ferner ist der Austausch von Gedanken mit anderen Menschen ein Grundbedürfnis des Menschen. Sprache ist das Medium, mit dem Individuen in Interaktion treten. In der Identitätsforschung wird davon ausgegangen, dass sich die Identität eines Subjekts in der Interaktion entwickelt. Dabei ist Sprache das Mittel, mit dem sich Identität ausdrückt. Die Identität eines Subjekts besteht aus einem Netz von selbstbeschrei26 3 Kommunikationstheoretische Aspekte unter Berücksichtigung der Ertaubung im Erwachsenenalter benden Narrationen und kann folglich in der Kommunikation verbalisiert werden (vgl. Tesch-Römer 1990, 14). In Bezug auf die vorliegende Thematik stelle ich fest: Sind Individuen in ihren bisherigen sprachlichen Möglichkeiten eingeschränkt, sind Auswirkungen auf die Interaktion und demzufolge auch auf die Identität der betroffenen Person zu vermuten. Im folgenden Kapitel widme ich mich eingehender der theoretischen Betrachtung von Identität und dem Prozess der Identitätsbildung. 27 4 Theoretische Grundlagen aus der Identitätsforschung 4 Theoretische Grundlagen aus der Identitätsforschung Zentraler Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist der Begriff der „Identität“ eines Menschen. Der Terminus „Identitätsarbeit“ steht dabei im Gegensatz zu klassischen psychologischen und soziologischen Definitionen von Identität. In diesem Kapitel soll zunächst eine für diese Studie gültige Definition von „Identität“ erarbeitet werden. Anschließend erfolgt ein kurzer Abriss klassischer Modelle der Identitätsentwicklung. Darauf aufbauend werden die konzeptuellen Überlegungen zum prozessualen Modell der „Identitätsarbeit“ skizziert, die für ein erweitertes Verständnis von Identität notwendig sind und den theoretischen Rahmen für den empirischen Teil der Arbeit bilden. 4.1 Allgemeine Begriffsdefinition von „Identität“ Eine eindeutige Definition des Konstruktes „Identität“ ist in der Wissenschaft nicht vorhanden; zu unterschiedlich sind die Auffassungen darüber und entsprechend vielfältig sind die Begriffsbestimmungen. Im Hinblick auf die Lebenslage spätertaubter Menschen begrenze ich mich auf einzelne Aspekte, die mir in diesem Rahmen besonders relevant erscheinen und zum weiteren Verständnis der vorliegenden Arbeit elementare Aussagen enthalten. Der Begriff der „Ich-Identität“ geht auf den Psychoanalytiker Erik Erikson zurück. Ahrbeck (1997, 42) postuliert, dass der Begriff auch bei anderen Autoren genannt wurde, jedoch findet sich bei Erikson erstmals eine Begriffsentwicklung im Rahmen eines elaborierten psychologischen Modells. Erikson offeriert in seiner Betrachtung: „Das bewußte [sic] Gefühl, eine persönliche Identität zu besitzen, beruht auf zwei gleichzeitigen Beobachtungen: der unmittelbaren Wahrnehmung der eigenen Gleichheit und Kontinuität in der Zeit, und der damit verbundenen Wahrnehmung, daß [sic] auch andere diese Gleichheit und Kontinuität erkennen. Was wir hier Ich-Identität nennen wollen, meint also mehr als die bloße Tatsache des Existierens, vermittelt durch persönliche Identität; es ist die Ich-Qualität dieser Existenz.“ (Erikson 1973, 18). In Anlehnung an Erikson verstehe ich unter Identität den Entwurf eines Individuums von sich selbst, den sich die Person selbst und der Welt präsentiert. Meine anthropologische Grundannahme beruht dabei auf Luhmanns Verständnis eines selbstreferentiellen Menschen, der die Fähigkeit besitzt, zu sich selbst Bezug zu nehmen. Gemäß Niklas Luhmann (zit. n. Baum 2000, 163) ist ein Individuum in der Lage, über sich selbst, das bedeutet über sein Denken, Träumen, Planen und Wünschen nachzudenken. Ich schließe mich dieser Sichtweise an und werde im empirischen Teil der Arbeit spätertaubte 28 4 Theoretische Grundlagen aus der Identitätsforschung Menschen zu ihrem Selbstverständnis befragen. Die folgenden Subjekttheorien zur Identität sind ausgewählte Modelle, die für meinen theoretischen Zugang bedeutsam sind und für die Soziale Arbeit handlungsleitend wirken können. Es gibt hierzu vergleichbare Modelle, auf die ich an dieser Stelle kurz hinweise (vgl. Goffmann 1977; vgl. Siegert/Chapman 1987; vgl. Whitbourne/Weinstock 1982). Haußer (1983, 3) konstatiert in seiner Definition, dass Identität immer etwas vom Individuum selbst konstruiertes ist. Folglich stellen Personen ihre subjektive Identität in einem selbstreflexiven Prozess her, indem sie ihr Wissen und ihre Erfahrungen über sich selbst verarbeiten. Schlussfolgernd postuliert Haußer: „Die Instanz, die über die Identität eines Menschen Auskunft zu geben vermag, ist der betreffende Mensch, ist das Subjekt selbst.“ (Haußer 1983, 3). Schließt man sich seinen Ausführungen an, so existiert Identität ursprünglich im Bewusstsein der Menschen und ist dementsprechend zu erforschen (vgl. Haußer 1983, 3). Für die vorliegende Arbeit soll dieser Sachverhalt handlungsleitend sein, deswegen erweitere ich meine theoretische Abhandlung um die subjektive Befragung von ausgewählten Personen. Dieser Zugang impliziert die Vorstellung einer narrativen Identitätskonstruktion unter Zuhilfenahme sprachlicher Strukturen. Kraus (2000, 171) und Keupp (2002, 208) verweisen darauf, dass Subjekte ihr Erleben erzählend organisieren. Gemäß Kraus (2000, 171) wird darunter die Art und Weise verstanden, in der das Subjekt selbstrelevante Ereignisse auf der Lebenszeitachse aufeinander bezieht. Keupp (2002, 208) führt weiter aus, dass die narrativen Strukturen keine Eigenschöpfung des Individuums sind, „sondern im sozialen Kontext verankert und von ihm beeinflusst“. In diesem Zusammenhang verweise ich darauf, dass sich Individuen in sozialen Netzwerken bewegen. Der Begriff der „subjektiven Identität“ soll folglich um den Begriff der „sozialen Identität“ als Kennzeichnung von sozialen Systemen ergänzt werden (vgl. Haußer 1987, 4). In sozialen Netzwerken werden kulturelle Werte, Orientierungen und Einstellungen entwickelt und vermittelt. Keupp (2002, 170) verwendet zur Beschreibung des Zugehörigkeitsgefühls eines Subjekts zu einer bestimmten Gruppe den Begriff der „kulturellen Identität“. In den Sozialwissenschaften finden beide Begriffe ihre Anwendung und meines Erachtens können sie für die vorliegende Analyse eine ergänzende Funktion einnehmen. Abschließend betone ich, dass Identität immer ein Relationsbegriff ist (vgl. Haußer 1987, 3). Das bedeutet, Identität bestimmt sich durch den Vergleich zu etwas 29 4 Theoretische Grundlagen aus der Identitätsforschung anderem. Die Frage lautet also nicht „Wie sehe ich mich?“, sondern „Wie sehe ich mich im Vergleich zu anderen?“, „Wie sehe ich mich im Vergleich zu damals?“, „Wie hätte mich mein Partner gern und wie hätte ich mich gern?“ etc. (Hintermair 2001, 110). Durch diese Sichtweise wird deutlich, dass Identität dynamisch ist und sich ständig in Bewegung befindet. 4.2 Klassische psychologische und soziologische Identitätstheorien Für die Auseinandersetzung mit der Identitätsentwicklung sind vor allem zwei getrennte klassische Forschungstraditionen bestimmend: zum einen die psychoanalytische Theorie, die mit den Namen E. Erikson verbunden ist, und zum anderen die soziologische Sichtweise, die vor allem mit G.H. Mead und in seiner Fortführung L. Krappmann relevante Bezugsautoren darstellt. Während in der Psychologie Identität als Resultat der menschlichen Entwicklung bezeichnet wird, versteht man in der Soziologie Identität als Ergebnis einer gelungenen Interaktion (vgl. Kruse/Kiefer-Pahlke 1988, 37). 4.2.1 Kritische Reflexion der Entwicklungstheorie von E. Erikson Erikson beschäftigte sich in Anlehnung an Freud mit den psychosozialen Aspekten der einzelnen Entwicklungsphasen des Individuums von der Geburt bis zum hohen Erwachsenenalter. Im Gegensatz zu Mead nimmt er eine entwicklungspsychologische Perspektive auf die menschliche Identität ein und entwirft ein „Acht-Phasen-Modell der Identitätsbildung“ (vgl. Erikson 1973, 55ff.). Erikson unterstellt mit seinem Modell ein universelles menschliches Grundschema. Der epigenetische Phasenverlauf legt bestimmte Thematiken in ihrer Abfolge im Lebenslauf fest, wobei einzelne Inhalte in bestimmten Altersphasen dominieren und sich zu einer potentiellen Krise verdichten (vgl. Haußer 1998, 121). Beispielsweise postuliert Erikson die Jugendphase als Periode der Orientierung und Erprobung, in der das Individuum sein Identitätsprojekt formuliert und sich für die spätere Erwachsenenphase vorbereitet. Das Erwachsenenalter ist anschließend die Phase der Realisierung und Verteidigung der erarbeiteten Stabilität. Zur Vertiefung der hier angedeuteten Entwicklungsthematiken verweise ich auf die entsprechende Literatur (vgl. Ahrbeck 1997, 43ff.; vgl. Haußer 1995, 75ff.; vgl. Seidenstücker 1998, 47ff.). Die verschiedenen zu absolvierenden Entwicklungsstufen und zu bewältigenden Krisen sind für eine gelingende Identitätsentwicklung notwendig. Im Rahmen des Sozialisationsprozesses durchlaufen Individuen die einzelnen Entwicklungsphasen und entwerfen ihre Ich-Identität indem sie auf die Erwartungen der Umwelt antworten (vgl. Krapp30 4 Theoretische Grundlagen aus der Identitätsforschung mann 1998, 67). Die Umwelt muss den Identitätsentwurf akzeptieren, in dem die Bedürfnisse des Heranwachsenden mit dem Paradigma der gesellschaftlichen Lebensführung zusammengefügt werden (vgl. Krappmann 1998, 67). Eine bedeutende Rolle hierbei nehmen die engeren Bezugspersonen im Sinne der psychosexuellen Theorie nach Freud ein. Infolgedessen entsteht Identität an den Schnittstellen von persönlichen Entwürfen und sozialen Zuschreibungen. In diesem Zusammenhang konstatiert Georgogiannis: „Im […] Prozess der Identitätsbildung ist der Heranwachsende ständig versucht, mit Hilfe der Anerkennung durch die Umwelt, weitere Fähigkeiten seines Ichs herauszufinden und fügt die gesammelten Ich-Erfahrungen in der IchSynthese zu einem harmonischen Gesamtbild zusammen.“ (Georgogiannis 1985, 22). Krappmann (1998, 67) ergänzt, dass die Anerkennung von der sozialen Umwelt leichter zu erhalten ist, wenn die Ich-Synthese den akzeptierten Bildern von Persönlichkeit, den vorstellbaren Lebenswegen und den üblichen Rollen entspricht. Folglich ist die IchIdentität eine Variante der Gruppen-Identität und stellt die Integration in die Gesellschaft dar. Weiterhin wird die soziale Definition von Identität deutlich, indem Erikson unterstreicht, dass sich Heranwachsende für einen Platz in der Gesellschaft entscheiden müssen, denn eine Identitätsbedrohung und Segmentierung entsteht, „wenn Jugendliche nicht wagen, sich den sozialen Angeboten anzuvertrauen“, die ihnen einen Platz im sozialen Leben versprechen (Krappmann 1998, 76). Ich schlussfolgere daraus, dass Erikson von einer gelungenen Identitätsbildung ausgeht, sofern das Subjekt sich den gegebenen gesellschaftlichen Strukturen anpasst und sich in diese einfügt. Gemäß Erikson begleitet der Prozess der Identitätsbildung Individuen ein Leben lang. Dennoch insistiert er, dass die Identitätsfindung in der Phase der Adoleszenz Vorrang hat und nicht in das frühe Erwachsenenalter verlagert werden soll (vgl. Krappmann 1998, 74). Die zentrale Aufgabe des Jugendalters besteht daher in der Ausbildung einer stabilen Identität. Eine stabile Ich-Identität manifestiert sich in der Integration der neuen Erfahrungen mit den Erkenntnissen früherer Entwicklungsphasen, ohne das Gefühl von persönlicher Kontinuität und Konsistenz zu verlieren (vgl. Frey/Haußer 1987, 7). Kontinuität („Ich bleibe über die Zeit hinweg dieselbe Person.“) und Konsistenz („Ich bin in jeder Situation immer dieselbe Person.“) sind die zentralen Begrifflichkeiten der Identitätstheorie von Erikson (Göser 2001, 14). 31 4 Theoretische Grundlagen aus der Identitätsforschung Die Identitätsfindung in der Adoleszenz strahlt auf die folgenden Entwicklungsphasen aus. Infolgedessen ist die in der Jugend ausgebildete stabile Identität Voraussetzung, um in späteren Lebenskrisen Ressourcen zur Bewältigung nutzen zu können. Gelingt die Auseinandersetzung mit divergierenden Anforderungen und Erwartungen der sozialen Umwelt nicht, kommt es zur Identitätsdiffusion. Erikson versteht darunter: „eine Zersplitterung des Selbstbildes, […], einen Verlust der Mitte, ein Gefühl von Verwirrung und in schweren Fällen die Furcht vor völliger Auflösung“ (Erikson zit. n. Krappmann 1998, 76). Eriksons Modell unterscheidet sich von anderen Identitätsmodellen, indem es nicht nur aufzeigt, welche Kompetenz ein Individuum in jeder Phase erringt, sondern auch, welche Fehlhaltung sich entwickeln kann (vgl. Krappmann 1998, 70). Einmal erfolgte Krisenlösungen sind nach seiner Theorie irreversibel. In einer potentiellen Krise schwanken Individuen zwischen den zwei Polen der betreffenden Thematik (vgl. Haußer 1998, 121). Diese Entwicklung soll hier nur angedeutet werden, um zu verdeutlichen, dass die Identitätsbildung in normativen Krisen verläuft. Das Kriterium einer erfolgreichen Identitätsbildung ergibt sich nicht aus der „Heftigkeit der einzelnen Krise“, sondern durch „die intensive Auseinandersetzung mit der Entwicklungsaufgabe“ (Krappmann 1998, 75). Haußer (1998, 121) expliziert in seiner Analyse, dass sich der Mensch während der Krise mit beiden Polen der Thematik ambivalent identifiziert. Erst durch die eigene Verarbeitung und Lösung der Krise erfolgen eine Festlegung und der Abschluss der Entwicklungsphase. Die Bewältigung der einzelnen Entwicklungsaufgaben wird durch das bereits erworbene Wissen und Können der früheren Entwicklungsstufen erleichtert. Hintermair (2001, 111) postuliert zu Recht, dass Eriksons große Leistung in der Ausformulierung des entwicklungspsychologischen Gedankens bis ins hohe Erwachsenenalter zu sehen ist, der bei Mead zwar mitgedacht, aber nicht präzisiert wird. Die Kritik an Eriksons Entwicklungstheorie bezieht sich vor allem auf die Vorstellung eines kontinuierlichen Stufenmodells, dessen erfolgreiches Durchlaufen bis zur Adoleszenz eine stabile Identität für das spätere Erwachsenenleben sichert (vgl. Keupp 2002, 29). Erikson unterstellt, dass die ausgebildete „Kern-Identität" den Menschen eine erfolgreiche Lebensbewältigung ermöglichen würde ohne etwaige Rückfälle oder Neubestimmungen. Mit den heutigen empirisch gesicherten Erkenntnissen aus der Stressforschung sowie der Krisenbewältigungsforschung ist diese Irreversibilitätsannahme nicht mehr haltbar (vgl. Haußer 1998, 124). In diesem Zusammenhang wird die Grenze des Stufenmodells deutlich. Es werden keine expliziten Aussagen hinsichtlich des Selbst32 4 Theoretische Grundlagen aus der Identitätsforschung konzeptes im Erwachsenenalter getroffen. Stattdessen geht Erikson von einer weitgehend unbewusst ablaufenden Entwicklung aus (vgl. Ahrbeck 1997, 46). Eriksons Konstruktion der zeitlichen Kontinuität enthält keine Aussagen über die Beziehungen zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in Bezug auf die Selbstkonzeption von Individuen. Siegert und Chapman (1987, 144) setzen die Annahme dagegen, dass sich Individuen auch im Hinblick auf das, „was sie in der Vergangenheit waren und was sie in der Zukunft sein könnten“, definieren. Folgt man ihrer Argumentation, so ist für die Identität von spätertaubten Personen anzunehmen, dass ihre gegenwartsbezogene Identitätsdefinition mit der vergangenen Entwicklung als hörende Person interagiert und ihre zukünftige Identitätskonstruktion beeinflusst. Eriksons Entwicklungstheorie folgt dem linearen Lebenslaufmodell in sozialstaatlichen Arbeitsgesellschaften (vgl. Galuske 2002, 113). Der Wohlfahrtsstaat fördert und stabilisiert durch Bildung, Beratung und Betreuung Lebenswege innerhalb des biographischen Normalitätsmusters. Indem Erikson die Jugendphase als Periode der Orientierung und Erprobung für die spätere Erwachsenenphase betrachtet, folgt er den Eckpunkten des staatlichen Lebensentwurfs (vgl. Galuske 2002, 114). Ich schließe mich Galuske an, dass Eriksons Modell im Sinne des sozialstaatlich konstituierten Lebenslaufs immer noch gewisse Gültigkeit besitzt. Gleichzeitig ist anzumerken, dass Erikson von einer gesellschaftlichen Kontinuität ausgeht, die sich „in die […] subjektive Selbstfindung verlässlich einbinden kann.“ (Keupp 2002, 30). Im Zuge von Individualisierung, Pluralisierung und Globalisierung können Eriksons Postulate den heutigen gesellschaftlichen Bedingungen nicht mehr standhalten. Zeitgenössische Identitätstheorien zeigen auf, dass sich Kohärenz und Kontinuität für Subjekte unter individualisierungstheoretischen Gesichtspunkten als problematisch erweisen können (vgl. Ahbe 1998, 208). Die dargelegte gesellschaftsorientierte Kritik bedient sich vor allem den soziologischen Thesen zur Risikogesellschaft von Ulrich Beck, der von einem immer schnelleren gesellschaftlichen Wandel ausgeht, welcher verschiedenste Anforderungen an das Subjekt stellt. Zur Vertiefung seiner Analyse verweise ich auf die entsprechende Literatur (vgl. Beck, 1986; vgl. Keupp 2002). Einschränkend möchte ich bemerken, dass Erikson sein Modell unter völlig anderen gesellschaftlichen Voraussetzungen entwickelte. In der Psychoanalyse wird Identität als Syntheseleistung der Individuen verstanden, divergierende Erwartungen in ihr Selbstkonzept zu integrieren. Identität ist in Eriksons Konzeption das Ergebnis von Reflexionsprozessen des Subjekts. Dieser Sachverhalt ist in der Wissenschaft nach wie vor aktuell und für den empirischen Teil dieser Arbeit 33 4 Theoretische Grundlagen aus der Identitätsforschung relevant, indem ich spätertaubte Menschen retrospektiv zu ihrem Selbstverständnis befrage. Abschließend weise ich darauf hin, dass Erikson keine Aussagen über den Prozess der Identitätsbildung trifft (vgl. Hintermair 1999, 15). Für den biographischen Zugang der vorliegenden Arbeit ist dieser Sachverhalt entscheidend und muss mit anderen Theorien untermauert werden. 4.2.2 Kritische Reflexion der Entwicklung des Selbst bei G.H. Mead und seiner Fortführung durch L. Krappmann Mead gilt als der Begründer der Theorie des symbolischen Interaktionismus. Ohne hier näher auf diese Theorie eingehen zu können, beschränke ich mich nachfolgend auf die Ausführungen zur Entwicklung des Selbst, die für die vorliegende Arbeit bedeutend sind. Im symbolischen Interaktionismus wird davon ausgegangen, dass sich Identität innerhalb gesellschaftlicher Beziehungen entwickelt. Die Grundannahme besteht darin, dass Individuen untereinander in Interaktion stehen und durch die in der sozialen Interaktion ablaufenden Prozesse ihre Identität erwerben (vgl. Georgogiannis 1985, 3). Folglich entsteht Identität im Aushandlungsprozess des Einzelnen mit seiner gesellschaftlichen Umwelt. Kohärenz und Kontinuität sind aus diesem Blickwinkel, analog zur Psychoanalyse, Kernfragen der Identitätsentwicklung (vgl. Keupp 2002, 97). Mead vertritt die Ansicht, dass sich das Selbst eines Individuums formt, während es der Person gelingt, ein reflexives Verhältnis zu sich auszubilden (vgl. Ahrbeck 1997, 34). Mit anderen Worten: Indem es Individuen möglich ist, von sich selbst Abstand zu nehmen, sich aus dieser Distanz heraus zu betrachten und über sich nachzudenken, entwickelt der betreffende Mensch sein Selbst (vgl. Ahrbeck 1997, 34). Dabei handelt es sich um eine kognitive Entwicklungsleistung des Individuums. Mead führt weiter aus, dass sich ein Bewusstsein von sich selbst nur in der sozialen Interaktion entfalten kann, so dass der Mensch auf ein Gegenüber angewiesen ist. Mead offeriert in diesem Zusammenhang: „Der Einzelne erfährt sich […] nur indirekt – aus der besonderen Sicht anderer Mitglieder der gleichen gesellschaftlichen Gruppe oder aus der verallgemeinerten Sicht der gesellschaftlichen Gruppe als ganzer, zu der er gehört.“ (Mead zit. n. Ahrbeck 1997, 34). Meads Vorstellung von Identität besteht darin, dass sich Individuen nur in der Reaktion der sozialen Umwelt auf ihr Verhalten selbst erkennen. Heranwachsende Personen er- 34 4 Theoretische Grundlagen aus der Identitätsforschung langen Identität, wenn sie für ihre soziale Umwelt verständlich handeln können. Dies ist dem Individuum möglich, wenn es sein Handeln aus der Perspektive seines konkreten Gegenübers sowie des gesellschaftlichen Zusammenhangs einschätzen und kontrollieren kann (vgl. Krappmann 1998, 79). Entscheidend sind dabei zunächst die wichtigsten Bezugspersonen, anschließend die peer-group und letztlich die gesamte Gesellschaft im Rahmen des menschlichen Sozialisationsprozesses. Nach Mead ist das basale Instrument zur Herstellung von Identität die Sprache. Sprache als System signifikanter Symbole ist das wichtigste Medium, mit dem Subjekte in Interaktion treten. Gleichzeitig reflektieren Subjekte mit Hilfe von Sprache über ihre Erfahrungen und ihr Identitätsbewusstsein formt sich aus (vgl. Georgogiannis 1985, 6). Sprachliche Kompetenz ist eine notwendige Bedingung für Reflexion und damit für die Entstehung von Identität. Ahrbeck analysiert Meads Annahme unter entwicklungspsychologischen Gesichtspunkten und kommt zu dem Schluss, dass „[…] ein Kind erst dann ein Selbst ausbilden kann, wenn die Sprache bereits entwickelt ist. Und umgekehrt: eine sich entwickelnde Sprache kann als Ausdruck der Entwicklung des Selbst angesehen werden.“ (Ahrbeck 1997, 35). Insofern hat die menschliche Sprache in Meads Theorie eine unersetzbare Funktion für die Ausbildung des Selbst. Gleichzeitig besteht in dieser Vorstellung das eigentliche Problem in Meads Theorie: Einerseits stellen Subjekte mittels sprachlicher Reflexion Identität über sein Verhalten her, andererseits wird Sprache selbst erst über soziale Interaktion erworben (vgl. Georgogiannis 1985, 7). Mead versucht das Problem der Diskrepanz zwischen sozialer Determination und individueller Freiheit aufzulösen, indem er das Konstrukt Identität in „me“ und „I“ unterteilt (vgl. Georgogiannis 1985, 7). Das „me“ kennzeichnet die Vorstellung von der Wahrnehmung der eigenen Person durch die Umwelt. Das „I“ bezeichnet hingegen die aktive Reaktion des Subjekts auf eine, durch Erwartungen definierte, soziale Interaktion (vgl. Ahrbeck 1997, 36). Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Meads Begriff des „Selbst“ zum einen die Sozialisation im Sinne einer universellen Rollenübernahme thematisiert, und zum anderen die Individuation als eine aktive Stellungnahme zu sozialen Erwartungen berücksichtigt (vgl. Ahrbeck 1997, 36). Infolgedessen unterliegen Subjekte der Aufgabe, die Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe und die Abgrenzung von dieser miteinander in Einklang zu bringen. 35 4 Theoretische Grundlagen aus der Identitätsforschung Lothar Krappmann (1969, 134) kritisiert die Theorie des Selbst dahingehend, dass nach seiner Ansicht nicht geklärt wird, worauf die Fähigkeit des „I“ beruht, die Erwartungen der Umwelt so zu interpretieren, dass es seine Einzigartigkeit in ihnen ausdrücken kann. Krappmanns Theorie knüpft an diesem Punkt an und führt aus, dass Identität die Anerkennung der sozialen Umwelt braucht, jedoch die eigenen Bedürfnisse nicht aufgegeben werden dürfen. Hier unterscheidet sich die interaktionistische Sichtweise von der psychoanalytischen Theorie nach Erikson: Im interaktionistischen Sinn stellt Ich-Identität eine individuelle Leistung der Balance zwischen den Erwartungen der Umwelt und der Individualität des Individuums dar (vgl. Krappmann 1969, 72). Krappmann gebraucht hierfür die Begriffe „soziale Identität“ und „persönliche Identität“. Identität ist erlangt, wenn das Subjekt fähig ist, die divergierenden Pole im Gleichgewicht zu halten. Da Menschen im Laufe ihres Lebens neue Interaktionserfahrungen sammeln, müssen sie ihre Identität stets neu ausbalancieren. Folglich sind Individuen ständig bestrebt zusätzliche Erfahrungen, aber auch Verletzungen in ihr Selbstkonzept zu integrieren (vgl. Krappmann 1998, 81). Krappmann (1969, 12) erläutert, dass vor allem im Medium der verbalen Kommunikation die Situationsinterpretation und die Auseinandersetzung über gegenseitige Erwartungen zwischen den Interaktionspartnern stattfinden. Sprache ist dabei das Hauptelement, sich in seiner Identität zu vermitteln (vgl. Georgogiannis 1985, 28). Die dynamische Auffassung von Identität ist für den Rahmen dieser Arbeit relevant, weil zu fragen bleibt, wie sich plötzliche Interaktionseinschränkungen auf die Identität von Personen auswirken. Zusammenfassend halte ich fest, dass Identität ein Netz aus selbstbeschreibenden Propositionen ist und damit in der Kommunikation verbalisiert werden kann (vgl. Tesch Römer 1990, 14). Dieser Sachverhalt besitzt in der vorliegenden Arbeit den Status einer methodischen Prämisse: Indem ich den Überlegungen von Mead und Krappmann im Hinblick auf die sprachliche und damit kommunikative Organisation von Identität folge, kann ich Interviewverfahren, welche kommunikative Kompetenz voraussetzen, rechtfertigen. Einschränkend hebe ich hervor, dass bei aller Betonung der Prozesshaftigkeit in der psychoanalytischen Sichtweise durch Erikson sowie den interaktionistischen Ansätzen nach Mead und Krappmann die biographische Perspektive verloren geht. Es fehlt weitgehend ein Modell, in dem berücksichtigt wird, welche Spuren die Interaktionsprozesse in Individuen hinterlassen. Gerade dieser Sachverhalt ist bei Menschen mit spezifischen 36 4 Theoretische Grundlagen aus der Identitätsforschung Einschränkungen, wie z.B. spätertaubten Personen, von besonderer Bedeutung. Die Frage, wie Menschen mit ihren individuellen Wahrnehmungsbedingungen und Interaktionsmöglichkeiten ihre Erfahrungen reflektieren, kann mit den klassischen Identitätstheorien nur ungenügend geklärt werden. Hierzu bedarf es eines erweiterten Verständnisses von Identität, welches ich im folgenden Abschnitt erarbeiten werde. 4.3 Das sozialpsychologische Modell der Identitätsarbeit 4.3.1 Grundlegendes Verständnis von Identität Die basale Grundlage für ein erweitertes Verständnis von Identität und der Überarbeitung der klassischen Modelle liegt in den gesellschaftlichen Bedingungen der ausgehenden Moderne. Für Individuen gehört es heutzutage zu einer Schlüsselqualifikation, sich in einer individualistischen und pluralistischen Gesellschaft mit Unübersichtlichkeiten, Orientierungsverlusten und Handlungsunsicherheiten zu bewegen, die unterschiedlichen Erwartungen und Aufgaben zu bewältigen und dabei handlungsfähig zu bleiben (vgl. Hintermair 1999, 16). In Anlehnung an die klassischen Modelle der Identitätsentwicklung (vgl. Kapitel 4.2) beschäftigt sich die neuere Identitätsforschung mit der Frage nach der inneren Kohärenz des Subjekts. Mit der Theorie zur Identitätsarbeit wird aufgezeigt, in welcher Form Menschen für sich Kohärenz bilden (vgl. Keupp 2002, 12). Der Begriff „Identitätsarbeit“ umfasst den sozialpsychologischen Blickwinkel auf die Entwicklung von Identität als einen offenen lebenslangen Prozess, dessen Aufgabe darin besteht, fortlaufend neue Erfahrungen zu interpretieren und „eine stimmige Passung zwischen dem subjektiven «Innen» und dem gesellschaftlichen «Außen»“ zu schaffen (Keupp 2002, 28). In diesem Postulat äußert sich die Verbundenheit mit den interaktionistischen Ansätzen, indem herausgestellt wird, dass Identitätsentwicklung immer ein Aushandlungsprozess des Individuums mit seiner sozialen Umwelt ist (vgl. Kapitel 4.2.2). Keupp (zit. n. Hintermair 1999, 23) weist darauf hin, dass die eminenten Voraussetzungen für ein stimmiges Identitätsgefühl „soziale Anerkennung“ und „Zugehörigkeit“ sind. Die zentrale Prämisse für das Modell der Identitätsarbeit besteht in der Annahme, dass Identität die Verknüpfungsarbeit lebensweltlicher Erfahrungen der Individuen darstellt. Dabei ordnen Menschen ihre Erfahrungen nach der zeitlichen Perspektive, indem Vergangenes mit Gegenwärtigem und Zukünftigem verbunden wird. Des Weiteren werden die Selbsterfahrungen unter lebensweltlichen- und biographischen Gesichtspunkten verarbeitet. Dazu gehören z.B. Erfahrungen als Partner, als Berufstätiger oder ge37 4 Theoretische Grundlagen aus der Identitätsforschung schlechtsrollenbezogene Selbstthematisierungen. In dem Zusammenhang wird auch die Verbindung der Teilidentitäten in den jeweiligen Lebensfeldern von Arbeit, Partnerschaft, sozialen Netzwerken und Kultur betrachtet, die widersprüchliche Schwerpunkte enthalten können. Letztlich unterliegen Selbsterfahrungen auch inhaltlichen Ordnungen nach Ähnlichkeit und Differenz (vgl. Keupp 2002, 190). Keupp (2002, 190) versteht darunter eine Verknüpfung zwischen den Selbsterfahrungen, die bereits vorhandene Erfahrungen bestätigen, die den früheren widersprechen oder die neu sind. Diese Prozesse sind durch Ambivalenzen, Widersprüche und Spannungen geprägt und das Ziel einer Identitätsarbeit besteht nicht in der Auflösung der Differenzen, sondern in der Bewältigung der Spannungen, indem die Ambivalenzen und Widersprüche in ein subjektiv lebbares Beziehungsverhältnis gebracht werden (vgl. Göser 2001, 68). Die anthropologische Grundannahme der Theorie besteht in einem konstruktivistischen Menschenbild, welches davon ausgeht, dass Individuen im Kontext ihrer spezifischen Wahrnehmungs- und Lebensbedingungen ihr Leben auf der Basis ihrer alltäglichen Erfahrungen mit Sinn füllen und dabei zu einer persönlichen Konstruktion ihrer Selbst gelangen (vgl. Hintermair 1999, 21). Hintermair kommentiert, dass es in dieser Definition von Identität weniger um normative Vorgaben wie Kontinuität, Konsistenz oder Gelingen geht, sondern vielmehr um die handelnden Tätigkeiten eines reflexiven Subjekts, „das seine Einmaligkeit und Geschichtlichkeit durch ein fortlaufendes Vergleichen und konstruktives Anpassen persönlicher Erfahrungs- und Handlungsmuster im Kontext konkreter sozialer […] Bedingungen gestaltet und fortschreibt […]“ (Hintermair 1999, 21). Anhand dieser Begriffserklärung von Identität kann im empirischen Teil der theoriegeleiteten Analyse dem Forschungsinteresse nachgegangen werden, inwiefern sich eine plötzliche Ertaubung im Erwachsenenalter auf die Identitätsarbeit eines Betroffenen auswirkt. Ferner richtet sich mit dieser Definition der Blick auf eine einzigartig ausgerichtete Lebenssicht der einzelnen Menschen und ihrer ebenso individuell entfalteten Identität in der Vielfalt lebensweltlicher Erfahrungen. Folglich kann dieser Ansatz als theoretisches Bezugssystem für eine „Lebensweltorientierte Soziale Arbeit“ handlungsleitend sein. 4.3.2 Identitätsentwicklung als prozesshafte alltägliche Identitätsarbeit In den folgenden Abschnitten werden die einzelnen Bausteine der alltäglichen Identitätsarbeit beleuchtet, die sich an die Ausführungen von Straus und Höfer (1998), Hin38 4 Theoretische Grundlagen aus der Identitätsforschung termair (1999) und Keupp (2002) anlehnen. Ergänzt wird die Perspektive um das übergreifende Prozessmodell von Haußer (1995), welches für die vorliegende Analyse zur plötzlichen Ertaubung im Erwachsenenalter eminente Aussagen enthält. 4.3.2.1 Situationale Selbstthematisierungen Situationale Selbstthematisierungen stellen die Basis der alltäglichen Identitätsarbeit dar. Dahinter steht die Auffassung, dass Subjekte fortlaufend ihr Handeln und ihr Erleben im Hinblick auf dessen Bedeutungszusammenhang für sich selbst reflektieren und folglich an ihrer Identität arbeiten (vgl. Hintermair 1999, 28). Gemäß Keupp (2002, 195) erfolgt das Nachdenken über lebensweltliche Erfahrungen als eine Verknüpfung von retro- und prospektiver Zeitanalyse. Er konstatiert: „In der alltäglichen Identitätsarbeit sind retrospektiver Prozess und prospektiver Prozess […] immer miteinander verbunden, es gibt keine Erinnerung, die nicht auch in die Zukunft gerichtet wäre, und keinen Entwurf, der nicht vergangene Erfahrungen beinhalten würde.“ (Keupp 2002, 195). Im Zentrum des retrospektiv-reflexiven Prozesses als verarbeitendem und bewertendem Teil der Identitätsarbeit stehen situationale Selbstthematisierungen. Es wird davon ausgegangen, dass in jeder Interaktion die implizite Auseinandersetzung mit den Fragen „Wer bin ich?“ und „Wer war ich in dieser Situation?“ erfolgt (vgl. Hintermair 1999, 28). Meiner Meinung nach wird in dieser Sichtweise die Nähe zu den Ansätzen von Mead und Krappmann deutlich, die sich ebenfalls der Identitätsentwicklung in Interaktionen widmen. In Abgrenzung zu Mead gehen Straus und Höfer (1998, 273) jedoch von kognitiven und affektiven Anteilen in einer identitätsrelevanten Erfahrung aus. Sie unterscheiden folgende vier Arten der Selbstwahrnehmung: - kognitive Selbstwahrnehmung („Welches Bild hat eine Person von sich in der jeweiligen Situation?“) - emotionale Selbstwahrnehmung („Wie hat sich die Person in der jeweiligen Situation gefühlt?“) - soziale Selbstwahrnehmung („Welche verbalen und nonverbalen Rückmeldungen hat ein Mensch zu seinem eigenen Verhalten oder zu seiner Person wahrgenommen?“) - produktorientierte Selbstwahrnehmung („Welche Leistungen hat der Mensch erbracht?“) (Straus/Höfer 1998, 273). 39 4 Theoretische Grundlagen aus der Identitätsforschung Keupp (2002, 192) fügt in seiner Betrachtung noch eine fünfte Ebene hinzu u.z. die „körperliche Selbstwahrnehmung“. Die Ebene umfasst die Frage: „Wie hat sich die Person in der jeweiligen Situation körperlich gefühlt?“. Im Folgenden beziehe ich diese fünfte Perspektive in meine Analyse mit ein, da sie für die vorliegende Untersuchung unter dem Blickwinkel einer ganzheitlichen Betrachtungsweise eminent ist. Straus und Höfer (1998, 274) führen aus, dass die genannten Gesichtspunkte in jeder sozialen Interaktion enthalten sind und sich gegenseitig beeinflussen, ohne dass der Mensch dies explizit beobachtet. Hintermair (1999, 30f.) betont in diesem Zusammenhang, dass nicht alle Aspekte gleichrangig sind. Der emotionale Anteil nimmt eine weitaus größere Rolle im Vergleich zu den anderen Aspekten ein, als dies in der kognitiv orientierten Identitätsforschung angenommen wurde. Die Selbstwahrnehmungen kumulieren zu einem Gesamteindruck und werden in der Biographie des Subjekts abgespeichert, wobei ein Wechselverhältnis zwischen aktueller und früherer Selbstthematisierung besteht (Keupp 2002, 195). 4.3.2.2 Bildung von Teilidentitäten Gemäß Straus und Höfer (1998, 275) bleiben Individuen bei ihrer Selbstreflexion nicht auf der situationalen Ebene stehen, sondern bündeln die einzelnen Selbstwahrnehmungen zu Identitätsperspektiven. Die Bündelung erfolgt unter kulturellen und narrativen Gesichtspunkten. In Anlehnung an Straus und Höfer umschreibt Keupp (2002, 193) Identitätsperspektiven als Erzählrahmen, indem der Blick auf die eigene Person unter bestimmten Rollen, lebensphasischen Themen oder übergreifenden Sichtweisen fokussiert wird. Aktuelle subjektive Selbstthematisierungen vermischen sich mit früheren Erfahrungen (z.B. „Früher bin ich gern ins Kino gegangen; seit der Ertaubung habe ich daran keinen Spaß mehr.“) und die narrative Konstruktion ermöglicht die Sortierung und Ordnung der identitätsrelevanten Ereignisse. Sie sind im Kontext der Biographie der Individuen eingebunden und beschreiben die individuelle Erfahrungswelt der Menschen (vgl. Hintermair 1999, 39). Selbstthematisierungen können unter mehreren Identitätsperspektiven abgespeichert werden, beispielsweise unter der Perspektive „ich als spätertaubte Person“, „ich als berufstätige Person“ oder unter dem Aspekt „ich als Ehemann/Ehefrau“ (vgl. Hintermair 1999, 36). Es stellt sich nun die Frage, warum ein Subjekt bei der Ordnung der Selbstthematisierung diese und nicht eine andere Perspektive wählt. Hintermair (1999, 37) postuliert, dass es sich bei der Perspektivenbildung um einen stark soziokulturell ge40 4 Theoretische Grundlagen aus der Identitätsforschung formten Prozess handelt. Keupp (2002, 193) schließt sich in seiner Analyse diesem Postulat an, indem er von „kulturspezifisch geprägten Identitätsperspektiven“ spricht. Die Integration von individuumsspezifischen Erfahrungsmustern unter einem bestimmten Aspekt führt zur Ausbildung einer Teilidentität. Mit den Worten von Straus und Höfer (1998, 281) sind Teilidentitäten das „Ergebnis der Integration der selbstbezogenen situationalen Erfahrungen unter bestimmten Perspektiven […].“. Am Beispiel der „beruflichen Teilidentität“ soll ihre Entstehung verdeutlicht werden: Straus und Höfer erläutern, dass die Verdichtung der situativen Selbsterfahrungen in Bezug auf den Erwerb einer beruflichen Identität zu der Typisierung der eigenen Person als „Berufstätiger“ führt (Straus/Höfer 1998, 281). Ferner wird in der Identitätsforschung davon ausgegangen, dass Teilidentitäten die für eine bestimmte Lebensphase gültigen „Standards“ enthalten. Unter dem Begriff „Standard“ verstehen die Autoren ein Set von Bedeutungen, die Personen entwerfen und die definieren, wer man glaubt zu sein (vgl. Keupp 2002, 219). Am Beispiel der Teilidentität „ich als spätertaubte berufstätige Person“ sollen die einzelnen Standards kurz skizziert werden: - kognitive Standards („Wo sehe ich als spätertaubte Person meine beruflichen Stärken und Schwächen?“) - emotionale Standards („Wo fühle ich mich aufgrund meines Selbstwertgefühls sicher und habe Vertrauen in mein eigenes berufliches Handeln?“) - soziale Standards („Die von mir wahrgenommene Einschätzung der anderen zu meinen beruflichen Fähigkeiten und Kompetenzen.“) - produktive Standards („Was glaube ich durch meine berufliche Tätigkeit bewirken oder herstellen zu können?“) - körperorientierte Standards („Welche körperlichen Fähigkeiten besitze ich für meine beruflichen Anforderungen?“) (vgl. Keupp 2002, 219). Straus und Höfer (1998, 282) insistieren, dass es sich bei der Bildung der Teilidentitäten nicht um einen Vorgang handelt, der im Sinne der klassischen Definition des Identitätsbegriffs alle Wahrnehmungsmodalitäten zu einem kohärenten Gesamtbild zusammenfügt. Vielmehr sind Ambivalenzen und divergierende Bewertungen vorstellbar, z.B. wenn die Wahrnehmung des sozialen Standards viel besser ausfällt als die des emotionalen Standards (vgl. Keupp 2002, 219). Die einzelnen Selbsterfahrungen werden auf verschiedenen Ebenen in Beziehung gesetzt. Zum einen werden sie anhand der zeitli41 4 Theoretische Grundlagen aus der Identitätsforschung chen Dimensionen (Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft) sowie der biographischen Etappe, in denen sie gemacht wurden, analysiert. Zum anderen werden die Erfahrungen in Bezug auf ihre Konsistenz und Kohärenz in Beziehung gesetzt (vgl. Keupp 2002, 190). Infolgedessen besteht die Identitätsarbeit von Subjekten aus einer Kombination von retro- und prospektiven Anteilen und in ihrer Verknüpfung wird die individuelle Biographie in einer Mischung aus Kontinuität und Kohärenz sowie Flexibilität und Prozesshaftigkeit organisiert (vgl. Straus/Höfer 1998, 286). Aus den bisherigen Ausführungen ist ersichtlich, dass sich Straus und Höfer, Keupp sowie Hintermair in ihrem Verständnis von Kontinuität und Kohärenz in Abgrenzung zu den klassischen Modellen nicht auf die mathematische Formel A=A reduzieren lassen. Vielmehr werden Ambiguitäten mitgedacht, die sich als Ergebnis aus unterschiedlichen subjektiven Festlegungen ergeben können. Folglich wird Subjekten eine aktive Steuerungsleistung bezüglich ihrer Identitätsentwicklung zugestanden, die sich durch ihre gesamte Biographie zieht. Hintermair ergänzt, dass die Teilidentitäten dazu beitragen, dass Menschen ein aktuelles und fortlaufend aktualisierendes Bild von sich selbst formen, weil stets neue situative Selbsterfahrungen zu früheren Erfahrungen hinzukommen (vgl. Hintermair 1999, 38). In diesem Zusammenhang ist zu bedenken, dass ein kritisches Lebensereignis, wie z.B. ein Hörverlust im Erwachsenenalter, verändernd oder auflösend auf eine Teilidentität wirken kann oder entscheidend für den Aufbau einer neuen Teilidentität ist. Straus und Höfer (1998) sowie Hintermair (1999) rekurrieren in ihren Überlegungen Haußers „Kreismodell des Identitätsprozesses“ und verstehen Identität als „konfliktorientiertes Regulationsmodell“ (vgl. Haußer 1995, 63). Mit seinem übergreifenden Prozessmodell bietet Haußer elementare Aussagen in Bezug auf die Teilidentitäten bei einer plötzlichen Ertaubung im Erwachsenenalter und wird für die vorliegende Analyse herangezogen. Haußer geht davon aus, dass sich Identität durch die prozesshafte Verarbeitung von Lebenserfahrungen bestimmt (vgl. Hintermair 1999, 64). Er formuliert selbst: „Es geht um die laufende Wechselwirkung zwischen der bestehenden Identität eines Menschen und neuen, diese bestätigenden oder verunsichernden Erfahrungen.“ (Haußer 1998, 131). Seine zentralen Begrifflichkeiten sind „Assimilation“ und „Akkommodation“, welche sich an Piagets Grundbegriffe der Intelligenzentwicklung des Kindes anlehnen (vgl. www.arbeitsblaetter.stangltaller.at, 2004). Assimilationsprozesse umfassen die Integration neuer Erfahrungen in die bestehende subjektive Identität, ohne qualitative Verände42 4 Theoretische Grundlagen aus der Identitätsforschung rungen für die Struktur der Personen hervorzurufen. Haußer (1998, 132) definiert diesen Verlauf als Identitätsstabilisierung. Im Gegensatz zur Assimilation finden Akkommodationsprozesse statt, wenn neue Erfahrungen nicht ohne weiteres in die bestehende Identitätsstruktur des Subjekts integriert werden können, sondern zu signifikanten Veränderungen, Ausdifferenzierungen oder Neuentwürfen in der Selbstkonstruktion führen. Gemäß Haußer (1998, 132) handelt es sich dabei um eine Identitätsänderung. Eine identitätsrelevante Erfahrung, wie z.B. ein Hörverlust im Erwachsenenalter, erfordert von betroffenen Menschen einen kognitiven, einen emotionalen sowie einen motivationalen Anpassungsprozess (vgl. „Drei-Komponenten-Ansatz“ In: Haußer 1998, 133). Die kognitive Ebene spiegelt sich in der Identitätsstabilisierung oder Identitätsänderung wieder. Dagegen bezieht sich die emotionale Ebene des Identitätsprozesses auf das Selbstwertgefühl der Personen. Haußer (1998, 132) konstatiert an dieser Stelle, dass eine neue identitätsrelevante Erfahrung selbstwertdienlich oder selbstwertbedrohlich wirken kann. Die motivationale Ebene umfasst die Handlungsseite des Identitätsprozesses und äußert sich in bestätigendem Sinn durch neues informationssuchendes Verhalten oder in Abwehrmechanismen, die zu Distanz und vermeidendem Verhalten führen können. Gemäß Hintermair (1999, 68) besteht das Ziel einer adäquaten Identitätsarbeit in einem sich immer wieder ausbalancierenden Verhältnis, so dass ein inneres Gleichgewicht hergestellt wird. Keupp (2002, 197) setzt dagegen, dass es weder um eine Widerspruchsfreiheit noch um eine Kongruenz geht, sondern um ein subjektiv empfundenes Passungsverhältnis mit einem persönlich definierten Maß an Ambiguität. In diesem Zusammenhang sind die Ressourcen entscheidend, die Individuen für ihre alltägliche Identitätsarbeit mobilisieren und nutzen können und die ihnen bei kritischen Lebensereignissen als Bewältigungsressourcen zur Verfügung stehen. Keupp (2002, 203) führt als Beispiel die sozialen Netzwerke an, die in Orientierungskrisen Rückhalt und emotionalen Halt bieten können. In der vorliegenden Analyse über die Identitätsarbeit von postlingual ertaubten Erwachsenen soll nicht das ausbalancierte Gleichgewicht als Zielvorstellung betrachtet werden, sondern das subjektiv stimmige Passungsverhältnis einzelner Menschen. 4.3.2.3 Metaidentität Die Frage nach einer Metaidentität bzw. einem Identitätskern wird in der Identitätsforschung in zunehmendem Maße diskutiert. Straus und Höfer (1998, 297) entwickelten ihr Modell nur bis zur Ebene der Teilidentitäten, stellen jedoch in ihrer Analyse die für 43 4 Theoretische Grundlagen aus der Identitätsforschung sie bislang plausibelste Konstruktion von übergeordneten Identitätsbezügen vor. Keupp (2002, 217ff.) beschäftigt sich in Anlehnung an Straus und Höfer ebenfalls mit der Konzeption zu einer Metaidentität. Für Hintermair (1999, 49) ist eine Bündelung von Teilidentitäten zu einem umfassenden Identitätskern vorstellbar, „auch wenn die Empirie bislang keine gesicherten Aussagen darüber treffen kann“. Helga Bilden (1998, 227ff.) nimmt im Gegensatz zu den anderen Autoren die radikalste Position ein. Sie plädiert für die Anerkennung eines „dynamischen Systems vielfältiger Selbste“ (Bilden 1998, 227). Ohne hier näher auf ihren Ansatz eingehen zu können sei erwähnt, dass sie sich in ihrer Argumentation gegen Identitätszwang und Einheitssehnsucht ausspricht (vgl. Hintermair 1999, 49). Es ist davon auszugehen, dass kommende empirische Studien zur Identitätsentwicklung erschöpfendere Angaben hierzu enthalten. Ich schließe mich in meiner Analyse den Ausführungen von Keupp an und werde im Folgenden die einzelnen Bausteine einer Metaidentität erörtern. Als einen ersten Baustein für die Konstruktion einer Metaidentität ist die Dominanz einer Teilidentität vorstellbar (vgl. Keupp 2002, 217). Ein Beispiel hierfür wäre die Vorherrschaft der Aussage: „Ich bin gehörlos.“, gegenüber der Aussage „Ich bin ein Mann.“. Nach individuellem Erfahrungshintergrund des Individuums kann sich die Überlegenheit einer bestimmten Teilidentität im Laufe des Lebens auf andere Teilidentitäten verlagern. Der nächste Baustein einer Metaidentität besteht im Identitätsgefühl einer Person. Keupp (2002, 217) führt aus, dass die Verdichtung von biographischen Erfahrungen auf der Ebene zunehmender Generalisierung der Selbstthematisierung und der Teilidentitäten zur Entstehung des Selbstwertgefühls führen. An anderer Stelle hebt er hervor, dass situationale Selbsterfahrungen nicht nur im Rahmen einer Teilidentität geordnet werden, sondern zusätzlich in ihrem Kerngehalt im Identitätsgefühl abgespeichert werden (vgl. Keupp 2002, 225). Analytisch betrachtet umfasst das Identitätsgefühl sowohl Bewertungen über die Qualität und die Art der Beziehung zu sich selbst (Selbstgefühl) als auch Bewertungen bezüglich der eigenen Alltagsbewältigung (Kohärenzgefühl). Letztlich handelt es sich um ein aktives inneres Regulationsprinzip, welches übergeordnet ist und dem die einzelnen Selbstthematisierungen unterliegen (vgl. Keupp 2002, 225). Der subjektiv bewusste Teil des Identitätsgefühls wird narrativ zur Darstellung der eigenen Person gegenüber sich selbst und der sozialen Umwelt verdichtet. Keupp (2002, 229) wählt hierfür den Begriff der „biographischen Kernnarration“. Dies ist der letzte Baustein für die Konstruktion einer Metaidentität. Unter biographischen Kernnarratio44 4 Theoretische Grundlagen aus der Identitätsforschung nen ist die Ideologie von sich selbst zu verstehen, die in dem Versuch mündet, sich und seinem Leben einen Sinn zu geben und dies anderen mitzuteilen. Alle drei Bausteine der Metaidentität verdichten sich zu dem Gefühl der subjektiven Handlungsfähigkeit. Diese stellt gemäß Keupp (2002, 217) die Funktionalität der Identitätsarbeit für das Handeln einer Person dar. 4.3.2.4 Subjektive Handlungsfähigkeit als Ergebnis der prozesshaften alltäglichen Identitätsarbeit Die Auseinandersetzung des Subjekts mit den Fragen „Wer bin ich?“, „Wer war ich?“ und „Wer möchte ich sein?“ enthalten immer Vorstellungen über die eigene Gestaltbarkeit und Bewältigung des Alltagslebens (vgl. Keupp 2002, 235). Keupp bezeichnet die subjektive Handlungsfähigkeit des Individuums als ein persönliches Gefühl über die Verfügbarkeit und die Gestaltbarkeit des eigenen Lebens. Die Handlungsfähigkeit stellt die „allgemeinste Rahmenqualität eines menschlichen Daseins“ dar (Keupp 2002, 236). Sie steht immer in einem Wechselverhältnis mit der gesellschaftlichen Handlungsfähigkeit. Darunter versteht Keupp (2002, 240) den sozialen Spielraum, der durch Normen und Werte definiert ist und innerhalb dessen Grenzen das Verhalten von Individuen als erwartbar und normal gilt. Überträgt man diese Thesen auf das bisher entwickelte Modell der Identitätsarbeit, wird der eminente Stellenwert des subjektiven Kohärenzgefühls für das Erleben der Verfügbarkeit und Gestaltbarkeit der eigenen Lebensbedingungen deutlich. Für die Soziale Arbeit mit spätertaubten Menschen hat das subjektive Gefühl von Handlungsfähigkeit den Stellenwert eines Interventionskriteriums (vgl. Böhnisch 2001, 31f.). Für den empirischen Teil der vorliegenden Arbeit besteht das Forschungsinteresse darin, zu erfragen, welche subjektiven Vorstellungen über die eigene Gestaltbarkeit und Bewältigung des Alltagslebens in Folge der Ertaubung existieren. 4.3.3 Zusammenfassung Zusammenfassend halte ich fest, dass Identität das Rahmenkonzept von Individuen darstellt, innerhalb dessen die Personen ihre lebensweltlichen Erfahrungen interpretieren. Der Begriff „Identitätsarbeit“ umfasst die aktuelle sozialpsychologische Perspektive der individuellen Identitätsentwicklung im Sinne eines lebenslangen, offenen Prozesses, in dem „situativ stimmige Passungen zwischen inneren und äußeren Erfahrungen“ geschaffen werden (Keupp 2002, 60). Individuen reflektieren ihre lebensweltlichen Erfah45 4 Theoretische Grundlagen aus der Identitätsforschung rungen fortlaufend im Hinblick auf ihren Bedeutungszusammenhang für sich selbst und arbeiten folglich beständig an ihrer Identität. Die einzelnen Bausteine der alltäglichen Identitätsarbeit sind die situationalen Selbstthematisierungen, die Bildung von Teilidentitäten und die Metaidentität. Die situativen Selbstthematisierungen werden zu Identitätsperspektiven gebündelt. Die Integration von individuumsspezifischen Erfahrungsmustern unter einer bestimmten Identitätsperspektive führt zur Ausbildung einer Teilidentität. Teilidentitäten fügen sich zu übergeordneten Identitätsbezügen zusammen und stellen den Identitätskern einer Person dar. Das Beziehungsverhältnis von Teilidentitäten und Metaidentität ist durch Wechselseitigkeit bestimmt, da die Metaidentität ebenfalls die Bildung und Neustrukturierung von Teilidentitäten beeinflusst. Die Metaidentität wirkt sich auf das subjektive Handeln der Individuen aus und beeinflusst die situationalen Selbstthematisierungen. Alle Strukturen der Identitätsarbeit unterliegen einem fortlaufenden Veränderungsprozess und sind mehr oder minder stabil. Die folgende Abbildung verdeutlicht das Beziehungsverhältnis der Konstruktionen der alltäglichen Identitätsarbeit von Individuen. Abb. 5: Konstruktionen der Identitätsarbeit (Keupp 2002, 218) 46 4 Theoretische Grundlagen aus der Identitätsforschung 4.3.4 Identitätsentwürfe und Identitätsprojekte Die Begriffe „Identitätsentwurf“ und „Identitätsprojekt“ symbolisieren die zeitliche Strukturierung des Identitätskonstruktes und werden an dieser Stelle als die zwei letzten zentralen Begrifflichkeiten des Modells der Identitätsarbeit eingeführt. Keupp (2002, 195) postuliert, dass situationale Selbstthematisierungen auch immer einen prospektiv-reflexiven Charakter besitzen. Das bedeutet, Menschen entwerfen unter den Fragestellungen „Wer möchte ich sein?“ und „Wohin möchte ich mich entwickeln?“ optionale „Selbste“, die im Kontext der Identitätsarbeit als Identitätsentwürfe klassifiziert werden. Identitätsentwürfe sind individuelle Vorstellungen über mögliche Identitäten, die sich aus der biographischen Bearbeitung aktueller Selbstbeschreibungen ergeben (vgl. Drewes 1993, 83f.). Schlussfolgernd halte ich fest, dass es sich bei diesen Skizzen um imaginäre Vorstellungen des Individuums handelt. Gemäß Hintermair (1999, 47) können sich Entwürfe zu Identitätsprojekten verdichten. Keupp (2002, 194) schließt an, dass sich die konkreten Identitätsprojekte aus den Identitätsentwürfen, „die Subjekte in ihren jeweiligen Teilidentitäten «mit sich führen»“ ergeben. Die Divergenz zwischen den beiden Begriffen besteht im inneren Beschlusscharakter des Identitätsprojekts. Projekte setzen einen subjektiven Reflexionsprozess mit Blick auf vorhandene Ressourcen voraus, die für eine Realisierung erforderlich sind (vgl. Keupp 2002, 194). Ich schlussfolgere daraus, dass sich Identitätsprojekte an den existierenden Möglichkeiten orientieren. Sowohl die subjektiven Identitätsentwürfe als auch die konkreten Identitätsprojekte werden durch Erfahrungen aus der Vergangenheit beeinflusst. In diesem Zusammenhang erörtert Keupp: „[…] man kann jedes aktuelle Projekt und erst recht jeden Entwurf auf seine biographischen «Wurzeln» hin untersuchen und wird da auch immer plausible, scheinbar kausale Verbindungen finden.“ (Keupp 2002, 195). In Verbindung mit der vorliegenden Arbeit ergibt sich die Frage, wie sich ein Hörverlust im Erwachsenenalter auf die subjektiven Identitätsentwürfe und Identitätsprojekte von Betroffenen auswirken kann. Diese Überlegung greife ich im empirischen Teil meiner Analyse wieder auf. 4.3.5 Der Zusammenhang zwischen Identitätsarbeit und sozialen Netzwerken Individuen leben mit einer sozialen Umwelt, d.h. Personen stehen mit anderen Menschen im Kontakt, zu denen sie soziale Beziehungen aufbauen und die ihr soziales Netzwerk gestalten (vgl. Göser 2001, 53). Gemäß Keupp (2002, 169) braucht die Identi47 4 Theoretische Grundlagen aus der Identitätsforschung tätsarbeit von Personen soziale Netzwerke. Diese stellen dem Individuum materielle, emotionale und soziale Ressourcen zur Bewältigung von Belastungssituationen zur Verfügung und reduzieren die Komplexität der sozialen Welt durch die Vermittlung von Relevanzstrukturen (vgl. Keupp 2002, 153). Infolgedessen bieten soziale Netzwerke für Subjekte ein Fundament an Ressourcen und verschaffen die Möglichkeit, aus der Vielzahl von Informationen und Lebensformen die elementaren herauszufiltern und durch Ausschlusskriterien auf ein individuell verkraftbares Maß zu begrenzen (vgl. Keupp 2002, 154). Gleichzeitig gestaltet Identitätsarbeit soziale Netzwerke, indem Personen Netzwerkbeziehungen herstellen und sich in Beziehung zu anderen Individuen setzen. Daraus entwickeln sich soziale Identitäten. Sowohl die Relevanzstrukturen als auch die Netzwerkbeziehungen sind narrativ verankert. Keupp (2002, 103) führt aus, dass die Selbstnarration sich fortlaufend in einem sozialem Aushandlungsprozess befindet. In diesem Zusammenhang ist die Verwendung einer homogenen Sprache signifikante Voraussetzung für die soziale Interaktion. Aus den bisherigen Darlegungen entstehen folgende zentrale Fragen für die Identitätsarbeit von postlingual ertaubten Menschen: - Wie sind ihre sozialen Netzwerke und besonders ihre kommunikative Dimension beschaffen?, - Wie begegnen ihnen Menschen und wie vermitteln sich spätertaubte Personen ihrer Umwelt? und - Wie definieren sie sich in diesen sozialen Netzwerken bzw. wie können sie sich definieren? 4.3.6 Kulturelle Identität Keupp (2002, 180) konstatiert, dass in den sozialen Netzwerken kulturelle Werte, Orientierungen und Einstellungen vermittelt werden, die für die Identitätsarbeit von Bedeutung sind. Folglich bilden soziale Netzwerke nicht nur Interaktionsgemeinschaften, sondern bieten auch kulturelle Orientierung. Diese werden von Individuen in kulturelle Praktiken und Formen der alltäglichen Lebensführung umgesetzt. Es kann sich eine kulturelle (Teil-)Identität ausformen, die sich aus dem Zugehörigkeitsgefühl zu einer bestimmten Gruppe entwickelt. Die kulturelle (Teil-)Identität kann zeitweise dominieren, aber auch wieder in den Hintergrund treten (vgl. Göser 2001, 88). Keupp legt dar, 48 4 Theoretische Grundlagen aus der Identitätsforschung dass der Begriff der „kulturellen Identität“ vorwiegend von diskriminierenden Minderheiten aufgenommen wurde, welche „im Rahmen ihrer Emanzipationsprozesse die ihnen […] negativ zugeschriebenen diskriminierenden Identitäten aufgegriffen und als Ausgangsbasis positiver Identifikation genutzt haben.“ (Keupp 2002, 171). Unter Bezugnahme auf Keupp betone ich, dass die Emanzipationsprozesse nicht auf Abwehr von Diskriminierung oder auf Selbstaufwertung beruhen. Vielmehr geht es in den sozialen Netzwerken, die sich auf kulturelle Identität gründen, um die Beschreibung anderer, minoritärer Lebens- und Erfahrungszusammenhänge, die nicht nur als Abweichung von der Dominanzkultur, sondern auch als deren Bereicherung begriffen wird (vgl. Keupp 2002, 171). Ein Beispiel für eine kulturelle Minderheit ist die Gehörlosenbzw. Gebärdensprachgemeinschaft. Zu ihr fühlen sich gehörlose Menschen zugehörig, welche die Gebärdensprache als Interaktions- und Verständigungsmedium nutzen und in der hörenden Gesellschaft kommunikative Einschränkungen erleben. Folglich versteht sich die Gebärdensprachgemeinschaft als kulturelle Sprachgemeinschaft, die entscheidend für die Identitätsarbeit von gehörlosen Personen ist. Lane führt aus, dass sich die kulturelle Konzeption von gehörlosen Menschen auf folgende Fragenkomplexe stützt: „Wie sehen die jeweils miteinander verflochtenen Werte, Bräuche, Kunstformen, Überlieferungen, Organisationen und Sprachstrukturen aus, welche die fragliche Kultur charakterisieren? Welchen Einfluss übt die materielle und soziale Umgebung aus, in welche die Kultur eingebettet ist?“ (Lane 1994, 38). Solche Fragen sind im Prinzip wertneutral. Sie unterstellen den Mitgliedern eines sozialen Netzwerkes zunächst keine Defizite, sondern bestimmen kulturelle Vielfalt. Spätertaubte Menschen sind physiologisch betrachtet gehörlos und erleben kommunikative Einschränkungen in der hörenden Gesellschaft. Jedoch bestimmt die physiologische Hörschädigung einer ertaubten Person nicht automatisch die Mitgliedschaft zur Gebärdensprachgemeinschaft und formt eine kulturelle (Teil-)Identität aus. Entscheidender als das medizinische Kriterium ist die Identifikation mit der Gruppe hörgeschädigter Menschen. Meines Erachtens sind spätertaubte Menschen im Gegensatz zu prälingual gehörlosen Personen nicht eigens in Netzwerken organisiert. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird u.a. der Frage nachgegangen, inwiefern die Gebärdensprachgemeinschaft für spätertaubte Personen ein soziales Netzwerk darstellt, in der sich eine kulturelle (Teil-)Identität ausbildet. 49 5 Kulturelles Konzept von Gehörlosigkeit 5 Kulturelles Konzept von Gehörlosigkeit Im folgenden Kapitel stelle ich grundlegende Informationen zur Kultur gehörloser Menschen dar. In Anbetracht meines speziellen Blickwinkels auf eine Ertaubung im Erwachsenenalter möchte ich damit eine Basis an spezifischem Wissen schaffen, die für den empirischen Teil der Analyse und für mögliche Anforderungen an die Soziale Arbeit mit spätertaubten Menschen relevante Aussagen enthält. 5.1 Definition von „Kultur“ In diesem Rahmen erscheint es mir notwendig zunächst eine einleitende, allgemeine Begriffsdefinition für „Kultur“ zu skizzieren, die den besonderen Gesichtspunkt meiner Arbeit widerspiegelt. Der Kulturbegriff umfasst die Gesamtheit der Lebensformen und Wertvorstellungen einer Gruppe in einem historisch bzw. regional abgrenzbaren Raum. Dazu zählen die Methoden und Institutionen des gesamten Lebens, Wert- und Normensysteme sowie Verhaltensmuster und Fertigkeiten, die Individuen im Zuge des Hineinwachsens in eine Gesellschaft übernehmen und dementsprechend zu einer soziokulturellen Persönlichkeit heranreifen (vgl. Brockhaus 2001b, 612). Dieser Prozess wird als Enkulturation bezeichnet. Die Weitervermittlung und das Erlernen der Kultur erfolgt mittels Sprache, ebenso wird Sprache im Kontext der jeweiligen Kultur erlernt. Folglich sind Sprache und Kultur unlösbar miteinander verbunden (vgl. Matthes 1996, 361). Die Grenzen zwischen verschiedenen Kulturgemeinschaften sind nicht immer eindeutig bestimmbar. Ansatzpunkte zur Demarkation können die Verwendung eines homogenen Sprachsystems, gleiche Lebensgewohnheiten, weltanschauliche Orientierungen, Sitten und Bräuche sowie gleiche Verhaltensmuster sein (vgl. Brockhaus 2001a, 408). Innerhalb kultureller Milieus kann es Variationen geben, die wiederum als „Subkultur“ bezeichnet werden. Darunter wird eine Kultur verstanden, die Teile der Verhaltensweisen von der Dominanzkultur besitzt, sich jedoch in spezifischen Verhaltensweisen oder Normen von dieser unterscheidet bzw. abgrenzt (vgl. Brockhaus 2001c, 324). Ausgehend von dem dargestellten Kulturbegriff werde ich im Folgenden die Gebärdensprachgemeinschaft als Subkultur der hörenden Kulturgemeinschaft betrachten. 5.2 Die Gebärdensprachgemeinschaft als kulturelle Minderheit Die Gebärdensprachgemeinschaft verfolgt seit vielen Jahren die Ziele einer selbstbestimmten Lebensgestaltung und einer gleichberechtigten gesellschaftlichen Teilhabe. In Abgrenzung zur medizinisch defektorientierten Definition versteht sich die Gemein50 5 Kulturelles Konzept von Gehörlosigkeit schaft als „kulturelle Minderheit“ bzw. als „sprachliche Minderheit“ (vgl. Leven 2003, 14). Hierbei besteht eine Auffassung von Gehörlosigkeit als menschliche Differenz und Andersartigkeit, die nicht nur als Abweichung von der hörenden Dominanzkultur verstanden wird, sondern auch als deren Bereichung begriffen werden kann (vgl. Kapitel 4.3.6). Im Kontrast zum medizinischen Defizitmodell hat die soziokulturelle Sichtweise weitere Aspekte der Subkultur im Blick, z.B. Kunst, Theater, Sitten und Bräuche sowie Interaktionserfahrungen mittels einer gemeinsamen Sprache (vgl. Boys Braem 1995, 144). Boyes Braem (1995, 144) führt aus, dass es ein künstlerisches Leben mit eigener Folklore, eigenen Geschichten und Witzen in Gebärdensprache gibt. Darüber hinaus sind poetische und theatralische Formen der Gebärdensprache hoch entwickelt und werden auf nationaler und internationaler Ebene präsentiert. Die Zugehörigkeit zur Gebärdensprachgemeinschaft erfolgt primär durch die Identifikation der Mitglieder mit dem sozialen Netzwerk. In der amerikanischen Sprache gibt es hierfür die Unterscheidung der Begriffe „Deaf“ und „deaf“ (Padden/Humphries 1991, 10, vgl. Albertini 1991, 99). Der Begriff „Deaf“ impliziert Gehörlosigkeit als Ausdruck einer Minderheitskultur und der Begriff „deaf“ kennzeichnet den audiologischen Mangel an Hörfähigkeit. In der deutschen Sprache ist diese Unterteilung nicht gegeben. Die öffentlichen Aktivitäten der Gebärdensprachgemeinschaft äußern sich in Vereinen oder Verbänden, die Kristallisationspunkte für das soziale Netzwerk sind. Von zentraler Bedeutung für die Sozialstruktur sind z.B. Sportvereine, Gehörlosenclubs sowie das Netzwerk von Internaten, die als Interaktionsforen dienen und ein lebendiges Verbindungsglied bei der Weitergabe von Kultur und Sprache darstellen. Ebbinghaus und Heßmann betonen in diesem Zusammenhang: „Wenn Gehörlose davon sprechen, der Gehörlosenverein sei ihre Heimat, dann verweisen sie damit auf die zentrale Bedeutung dieses Ortes für ihr Sozialleben. […] Es ist aber gewiß [sic] verfehlt, soziale Gemeinschaften über ihre Probleme zu definieren und die Existenz von Gehörlosenvereinen auf den Wunsch zurückzuführen, Menschen mit vergleichbaren Problemen treffen zu wollen. Gehörlose finden einander nicht deshalb so attraktiv, weil sie behindert sind, sondern weil sie im Umgang miteinander nicht behindert sind!“ (Ebbinghaus/Heßmann 1989, 240). Das Gefühl von Verbundenheit und Solidarität ist nicht auf nationale Grenzen beschränkt. Internationale Vereinigungen und Organisationen strukturieren ebenso das Sozialleben. Aus meiner eigenen Erfahrung mit hörgeschädigten Menschen ist mir bekannt, dass internationale Kontakte auf einer Vielzahl von Kongressen, Tagungen und 51 5 Kulturelles Konzept von Gehörlosigkeit Gebärdensprachfestivals gepflegt werden. Ereignisse dieser Art bieten die Möglichkeit anderen gehörlosen Menschen zu begegnen und auf der Grundlage gemeinsamer Kommunikationsmittel soziale Beziehungen einzugehen, die durch Zugehörigkeit und soziale Anerkennung bestimmt sind. Unter Bezugnahme auf das Modell der Identitätsarbeit konstatiere ich, dass diese situationalen Selbstthematisierungen sich zu einer Teilidentität als kulturell gehörlose Person verdichten können und demnach kulturspezifisch geprägte Identitätsperspektiven ausgebildet werden. Dabei ist die Beherrschung der Gebärdensprache das verbindende und Kultur kennzeichnende Merkmal für die Gemeinschaft. Als genuine Sprache ermöglicht sie prälingual gehörlosen Menschen uneingeschränkte Kommunikations- und Interaktionserfahrungen. Ebbinghaus und Heßmann (1989, 242) erörtern, dass der kommunikative Gebrauch der Gebärdensprache notwendige Bedingung für das Fortbestehen der kulturellen Minderheit als gesellschaftliche Einheit ist. Des Weiteren schweißt die Gebärdensprache ihre Benutzer zu einer Kulturgemeinschaft zusammen, denn im Sinne des symbolischen Interaktionismus werden in interaktiven Kontexten mittels Sprache die Kultur und das Weltbild einer Sprachgemeinschaft vermittelt (vgl. Matthes 1996, 360). Damit ist die Gebärdensprache ein zentrales Merkmal für die Gruppenidentität hörgeschädigter Personen. Gleichzeitig ist anzumerken, dass der Großteil prälingual hörgeschädigter Menschen in hörenden Familien sozialisiert ist. Demzufolge erlernen sie die allgemein gültigen gesellschaftlichen Praktiken der hörenden Kultur, auch wenn sie ihnen fremd und undurchschaubar bleiben. Im Laufe ihres Lebens kann die Gebärdensprachgemeinschaft zu einem sozialen Netzwerk werden, zu dem sich hörgeschädigte Menschen zugehörig fühlen, so dass sie darin ihre kulturelle (Teil-)Identität ausformen. In diesem Zusammenhang wird auch die besondere Konstitutionsbedingung der Gebärdensprachgemeinschaft sichtbar. Ebbinghaus und Heßmann (1989, 241) erörtern, dass im Regelfall Individuen in ihre Sprachgemeinschaft hineingeboren werden und die entsprechenden kulturellen Praktiken erlernen. Das zentrale Instrument zur Aneignung des Kulturgutes der Gemeinschaft stellt die Sprache dar. Im Falle von gehörlosen Menschen ist diese Situation oftmals nicht gegeben. Ich schließe mich Ebbinghaus und Heßmann (1989, 244) an, die erläutern, dass die Gebärdensprachgemeinschaft für Hörgeschädigte die „soziale Heimat“ ausdrückt, bedeute weder ein Versagen noch dass sie „Welt und Gesellschaft den Rücken gekehrt haben“. 52 5 Kulturelles Konzept von Gehörlosigkeit Vielmehr stehen hörgeschädigte Menschen in einer ständigen Wechselbeziehung mit hörenden Menschen. Albertini offeriert in seiner Analyse der amerikanischen Gebärdensprachgemeinschaft: „Durch ihre Interpretation dieser Wechselbeziehungen entwickeln sie eine gemeinsame Ansicht darüber, was es bedeutet, in der amerikanischen Kultur hörgeschädigt zu sein.“ (Albertini 1991, 101). Die kommunikative Kompetenz von gehörlosen Menschen beruht auf kulturgenerienden Merkmalen ihrer Gemeinschaft. Beispielsweise zählt dazu die körperliche Berührung des Kommunikationspartners. Der Körperkontakt dient u.a. der Erlangung von Aufmerksamkeit oder als Einstieg in eine Kommunikationssituation und unterliegt speziellen Regeln. Der Gebrauch des Namens einer Person, wie es in der Lautsprache üblich ist, wird in der Interaktion zwischen gehörlosen Menschen selten verwendet (vgl. Kyle 1990, 205). Ein weiteres Beispiel für eine kulturspezifische kommunikative Verhaltensweise zeigt sich, wenn sich eine Person während eines Gesprächs abwenden möchte. Hierzu analysiert Kyle: „[…] wenn die Aufmerksamkeit abgelenkt wird, muß [sic] der Gebärdende bestimmte Konventionen anwenden, um den Gesprächspartner nicht zu verletzen. Dies geschieht oft durch das Gebärden von ‚WARTE’, oder der Arm des Zuschauers wird festgehalten, während man sich wegdreht. Wird dies versäumt, wird der andere Gehörlose das Abwenden als schwerwiegende Beleidigung empfinden […].“ (Kyle 1990, 206). Die bisherigen Ausführungen haben immer wieder die zentrale Bedeutung der Gebärdensprache für die Kultur der gehörlosen Menschen herausgestellt, so dass ich im folgenden Abschnitt noch näher auf das visuelle Sprachsystem eingehen möchte. 5.3 Die Gebärdensprache als eigenständiges visuelles Sprachsystem Sprache ist nicht abhängig von der Fähigkeit zu hören und zu reden. Vielmehr ist es eine abstraktere Fähigkeit des menschlichen Gehirns, die entweder auf verbalem oder auf visuellem Weg ihren Ausdruck findet (vgl. Lane 1994, 32). Gebärdensprachen als visuelle Sprachen sind national begründet. Es lassen sich z.B. die amerikanische, die schwedische oder die französische Gebärdensprache unterscheiden. Aufgrund des Behindertengleichstellungsgesetzes vom 27. April 2002 haben hör- und sprachbehinderte Menschen in Deutschland erstmalig das Recht mit Trägern der öffentlichen Gewalt in Deutscher Gebärdensprache (DGS) zu kommunizieren. Die Träger sind verpflichtet auf Wunsch den Betroffenen eine Übersetzung durch einen Gebärden53 5 Kulturelles Konzept von Gehörlosigkeit sprachdolmetscher sicher zu stellen und die notwendigen Aufwendungen zu tragen (vgl. www.behindertenbeauftragter.de, 2005). Es handelt sich hierbei um einen einklagbaren Rechtsanspruch für gehörlose Menschen. Seitdem ist die Deutsche Gebärdensprache gesetzlich als eine eigenständige Sprache anerkannt. Das impliziert die Tatsache, dass die DGS kein Abbild der Lautsprache darstellt, sondern sich durch eine eigene linguistische Struktur auszeichnet. Aufgrund ihrer räumlichen Anordnung kann die Gebärdensprache nur in der mündlichen Kommunikation Anwendung finden, da bisher keine adäquate Gebrauchsschrift existiert (vgl. Werth/Sieprath 2002, 361). Zentrales Klassifikationsmerkmal für die Gebärdensprachverwendung ist der Umgang mit dem dreidimensionalen Gebärdenraum, der sich vor dem Oberkörper und dem Kopf des Gebärdenden befindet (vgl. Leven 2003, 27). Gebärden bestehen aus einzelnen Elementen, u.z. aus Handform, Handstellung, dem Ausführungsort am Körper und der Bewegungsrichtung. Sie werden durch die menschliche Mimik, durch das Mundbild sowie die Mundgestik ergänzt. Die einzelnen Komponenten treten gleichzeitig auf und sind durch ihre eigenständige Grammatik und Lexik gekennzeichnet (vgl. Lane 1994, 32). Neben der DGS können schwerhörige, gehörlose und spätertaubte Menschen auf weitere manuelle Kommunikationssysteme zurückgreifen, die ich im Folgenden kurz vorstellen werde. 5.4 Weitere Formen der manuellen Kommunikation 5.4.1 Lautsprachbegleitende Gebärden Werden Sätze der gesprochenen Sprache Wort für Wort in Gebärden übersetzt, erhält man lautsprachbegleitende Gebärden (LBG). Es besteht die Möglichkeit einzelne Wörter der Lautsprache, Wortteile in zusammengesetzten Wörtern sowie einzelne Morpheme durch ein manuelles Zeichen zu ersetzen. LBG orientiert sich an der Lautsprache und stellt im Gegensatz zur DGS kein eigenständiges Sprachsystem dar. In Studien zur Verwendung von LBG fand man heraus, dass die Visualisierung des einzelnen Lautsprachmorphems doppelt so lang an Zeit benötigt wie die entsprechende gesprochene Sprache (vgl. Boyes Braem 1995, 158). Gemäß Boyes Braem (1995, 158) entsteht dadurch eine unnatürliche zwischenmenschliche Kommunikation. Meines Erachtens können lautsprachbegleitende Gebärden besonders hilfreich und unterstützend in der Kommunikation mit schwerhörigen und spätertaubten Personen sein, die vor allem auf das Lippenabsehen angewiesen sind und mit Hilfe visueller Gebärden eine zusätzliche Informationsquelle zur Entschlüsselung einer Nachricht erhalten. 54 5 Kulturelles Konzept von Gehörlosigkeit 5.4.2 Das Fingeralphabet Das Fingeralphabet ist eine Kommunikationsform, bei der einzelne Handformen die einzelnen Buchstaben des Alphabets repräsentieren. Fingeralphabete sind national verschieden. Im Gegensatz zum deutschen Fingeralphabet ist das britische System zweihändig. Mit Hilfe des Fingeralphabets können Wörter der Lautsprache im Gebärdenraum buchstabiert werden. Es können sowohl einzelne Wörter als auch ganze Sätze buchstabiert werden. Allerdings ist Kommunikation mittels des Fingeralphabets nicht nur in der Produktion sondern auch für den Zuschauer über längere Zeit ermüdend. Aus meiner eigenen Erfahrung ist mir bekannt, dass sich das Fingeralphabet besonders zur Buchstabierung von Begriffen eignet, für die es keine Gebärden gibt sowie zur Buchstabierung von Eigennamen, die zur Verständigung im Kommunikationsprozess notwendig sind. Für spätertaubte Menschen ist das Fingeralphabet eine leicht erlernbare Kommunikationshilfe, die ihnen dabei hilft Fremdwörter oder unbekannte Begriffe, die nicht von den Lippen absehbar sind, zu erfassen (vgl. Becker 2003, 66). Meinen Beobachtungen zufolge wird es häufig auch von Angehörigen, Freunden und Interessierten erlernt, die in ihrem sozialen Netzwerk mit hörgeschädigten Menschen interagieren. 5.5 Zusammenfassung Zum Abschluss des Kapitels dürfte deutlich geworden sein, dass die Gebärdensprachgemeinschaft eine kulturelle Subkultur im Sinne der Kulturdefinition darstellt (vgl. Kapitel 5.2). Sie bietet ihren Mitgliedern soziale Anerkennung und Zugehörigkeit für die Entwicklung einer kulturellen (Teil-)Identität. Ein wesentliches kulturkennzeichnendes Merkmal ist die Benutzung einer homogenen Sprache. Als Sprachgemeinschaft verwenden gehörlose Menschen die Gebärdensprache als Kommunikations- und Interaktionsmedium. Sie stellt ein eigenes Sprachsystem, analog zur Lautsprache, dar und bietet ihren Benutzern, innerhalb ihrer Gemeinschaft, uneingeschränkte lebensweltliche Kommunikations- und Interaktionserfahrungen. Darüber hinaus gibt es noch weitere manuelle Kommunikationssysteme für hörgeschädigte Menschen, wie lautsprachbegleitende Gebärden und das Fingeralphabet. Sie begründen sich auf die Lautsprache und setzen Kenntnisse der lautsprachlichen Lexik und Grammatik voraus. Im empirischen Teil der Arbeit werde ich der Frage nachgehen, inwiefern die Gebärdensprachgemeinschaft für das kulturelle Leben von postlingual ertaubten Personen ein soziales Netzwerk darstellt und welche manuellen Kommunikationssysteme die befragten Menschen verwenden. 55 6 Darstellung von Handlungstheorien für die Soziale Arbeit mit spätertaubten Erwachsenen 6 Darstellung von Handlungstheorien für die Soziale Arbeit mit spätertaubten Erwachsenen Das Thema dieser Analyse ist die Auseinandersetzung mit der Identitätsarbeit postlingual ertaubter Erwachsener in ihrer besonderen Lebenssituation. Damit wird ein zentraler Aspekt des Konstruktes „Identität“ markiert, indem betroffene Menschen zum Ausgangs- und Mittelpunkt der Untersuchung erhoben werden. Auf diesen Überlegungen aufbauend wähle ich einen biographisch- und lebensweltorientierten sozialpädagogischen Bezugsrahmen, der als theoretische Reflexionsfolie für mögliche Handlungsanforderungen an die Soziale Arbeit mit spätertaubten Menschen genutzt werden kann. Die metatheoretische Perspektive der nachfolgenden Handlungstheorien beruft sich auf den Empowermentansatz als Grundhaltung für die Soziale Arbeit. Infolgedessen werde ich einleitend diese übergeordnete Sichtweise skizzieren. Anschließend erläutere ich die zentralen Sachverhalte der „Lebenswelttheorie“ von Hans Thiersch. In seinem Konzept vom „gelingenderem Alltag“ folgt Thiersch der subjektiven Lebenswelt von Individuen und befasst sich mit den dort vorfindbaren Verstehens- und Handlungsmustern. Darüber hinaus bietet das „Biographiekonzept“ von Lothar Böhnisch relevante Thesen für eine subjektorientierte Betrachtungsweise, indem er die individuelle Biographie der Menschen in den Mittelpunkt seiner Darstellung hebt. Die genannten Handlungstheorien der Sozialen Arbeit scheinen mir besonders geeignet, um die Verhältnisse in den Lebenswelten von spätertaubten Menschen zu beleuchten und problematische Strukturen zu erkennen. Daraus ableitend können im Anschluss an die empirische Studie Handlungsanforderungen für die Soziale Arbeit mit spätertaubten Menschen herausgearbeitet und diskutiert werden. 6.1 Empowerment als Grundhaltung für die Soziale Arbeit Empowerment wird als professionelle Haltung von Sozialpädagogen verstanden, nach der sie lösungs- und ressourcenorientiert arbeiten und Vertrauen in die Stärken und Fähigkeiten des Individuums haben (vgl. Stark 1996, 117). Demnach bedeutet Empowerment, Ressourcen für ein gelingendes Lebensmanagement zur Verfügung zu stellen, auf die Menschen, bei Bedarf zurückgreifen können, um Lebensstärke und Kompetenz zur Selbstgestaltung der Lebenswelt zu gewinnen (vgl. Miller 2000, 23). Damit wendet sich der Empowermentansatz von einer traditionellen, defizitärorientierten Perspektive ab, die Adressaten vordergründig als Personen betrachtet, welche bestimmte Kompetenzen nicht entwickelt haben. Vielmehr wird der einzelne Mensch in eine ganzheitliche 56 6 Darstellung von Handlungstheorien für die Soziale Arbeit mit spätertaubten Erwachsenen Wahrnehmung gerückt und die Soziale Arbeit setzt an den vorhandenen Fähigkeiten und Stärken einer Person an, ohne Defizite oder mögliche Schwächen aus dem Blick zu verlieren. Pankofer (2000, 13) konstatiert, dass die Grundlage allen Empowermenthandelns in der Anerkennung der Gleichberechtigung von professionell Tätigem und Adressat liegt, in der Konstruktion einer symmetrischen Arbeitsbeziehung und dass ein Beziehungsmodus des partnerschaftlichen Aushandelns hergestellt wird. Die genannten Aspekte können unter drei verschiedenen Ebenen zusammengefasst werden: - Ziele, Normen und Werte: Dazu zählen u.a. Selbstbestimmung und Fähigkeitsorientierung. - Methoden, Techniken und Verfahren: Beispielhaft sei hier die Gemeinwesenarbeit oder Partizipationsprozesse hervorgehoben. - Eine Grundhaltung der therapeutischen, beratenden oder politischen Arbeit, indem kompensatorisch gearbeitet wird, um die Verantwortung für das Alltagshandeln an das Individuum zurückzugeben und eine professionelle Hilfe überflüssig zu machen (vgl. Pankofer 2000, 13). Sowohl Thiersch als auch Böhnisch verweisen in ihren Handlungstheorien der Sozialen Arbeit auf eine Ressourcenarbeit, die soziale und kulturelle Teilhabe ermöglicht und Partizipationsprobleme mindert. Damit folgen sie dem Empowermentgedanken und richten ihren Blick auf die Selbstgestaltungskräfte der einzelnen Individuen. Ausgehend von diesen Überlegungen entwerfen sie ihre Leitlinien und Arbeitsprinzipien für professionelles sozialpädagogisches Handeln. Im folgenden Abschnitt werde ich die einzelnen Handlungstheorien explizit vorstellen. 6.2 Das Konzept „Lebensweltorientierte Soziale Arbeit“ 6.2.1 Traditionslinie der Theorie Der Begriff „Lebenswelt“ entstammt ursprünglich aus den Bezugswissenschaften Philosophie und Soziologie. Hans Thiersch erhob den Begriff zum sozialpädagogischen Rahmenkonzept in seiner „Lebensweltorientierten Sozialen Arbeit“. Die „Lebensweltorientierung“ ist eine mögliche Handlungstheorie zur Analyse und Strukturierung heutiger Sozialer Arbeit und hat gesellschaftliche Umbrüche der Moderne sowie die Zunahme der Individualisierung und Pluralisierung von Lebenslagen im Blick. Analog zum Modell der Identitätsarbeit stützt sich Thiersch mit seinem Konzept 57 6 Darstellung von Handlungstheorien für die Soziale Arbeit mit spätertaubten Erwachsenen auf die Modernisierungstheorie von Ulrich Beck und rekonstruiert Lebenswirklichkeit und Handlungsmuster unter dem Gesichtspunkt der Alltäglichkeit. Aufgrund des hermeneutisch-pragmatischen Zugangs sowie des interaktionistischen Rahmenkonzepts wird eine kritische Distanz zur Alltagspraxis hergestellt, ohne die Perspektive des täglichen Lebens und des Handelns in der Alltagswelt abzuwerten (vgl. Grunwald/Thiersch 2004, 17). Im Sinne einer lebensweltlichen Definition des Empowermentansatzes steht für Thiersch die „gelingende Mikropolitik des Alltags“ im Zentrum seiner Betrachtung sowie die Fähigkeit des Subjekts, in den Strukturen und Beziehungen seines sozialen Netzwerkes eine individuelle Lebensform zu verfolgen (Herriger 1997, 13). Ich schließe mich in meinem theoretischen Blickwinkel auf die Identitätsarbeit von spätertaubten Menschen der Betrachtungsweise von Thiersch an und stelle, die bereits vorgefundene, vorinterpretierte, jedoch veränderbare Lebenswirklichkeit einzelner betroffener Menschen ins Zentrum meines theoretischen Zugangs. Ferner betrachte ich den Menschen nicht abstrakt als Individuum, sondern im Sinne von Thiersch als ein soziales Wesen, welches in gesellschaftliche Strukturen und soziale Netzwerke eingebettet ist. 6.2.2 Der Lebensweltansatz Ausgangspunkt des Lebensweltansatzes ist der Alltag von Individuen. Thiersch (1986, 12) analysiert, dass Subjekte einen Alltag besitzen, der durch eine Vielfalt von Problemlagen charakterisiert ist. Im Alltag sind Menschen zuständig für die Bewältigung der sich ihnen stellenden Aufgaben, wozu individuelle Kompetenzen und Ressourcen benötigt werden. Gemäß Thiersch (1986, 34) ist Alltag „ein Gemengelage aus Täuschung und Wirklichkeit“ sowie aus gelingender Alltagsbewältigung und Scheitern. Er verwendet zur Beschreibung dessen den Begriff „pseudokonkreter Alltag“. Der Alltag ist durch Alltäglichkeit strukturiert. Mit Alltäglichkeit beschreibt Thiersch die subjektive Auslegung der Wirklichkeit. Das bedeutet, Alltäglichkeit ist pragmatisch orientiert. Des Weiteren muss Alltäglichkeit immer als soziales Handeln verstanden werden, da Menschen in gesellschaftliche Strukturen eingebettet sind (vgl. Engelke 1999, 331). Einerseits bietet Alltäglichkeit Individuen Verlässlichkeit, Routine, Sicherheit und Identität, andererseits wird genau dies immer wieder verworfen, indem der einzelne Mensch neue Ereignisse bewältigen muss, bei denen er nicht auf gewohnte Handlungsmuster zurückgreifen kann. Ein Beispiel dafür ist ein plötzlicher Hörverlust im Erwachsenenalter. Demnach ist Alltäglichkeit auch eine dynamische und prozesshafte Gratwanderung, in 58 6 Darstellung von Handlungstheorien für die Soziale Arbeit mit spätertaubten Erwachsenen der es zur Weiter- und Neuentwicklung von Identität kommt (vgl. Thiersch 1986, 17). Alltäglichkeit offenbart sich in den verschiedenen Alltagswelten. Als Alltagswelten werden konkrete Lebensfelder bezeichnet, die nach Funktionen und Inhalten gegliedert sind, wie z.B. Familie, Schule oder Arbeit (vgl. Grunwald/Thiersch 2004, 20). In den einzelnen Lebensfeldern machen Individuen verschiedene Erfahrungen, die in ihrem Lebenslauf kumulieren. Infolgedessen beschäftigt sich das Konzept „Lebenswelt“ mit der Rekonstruktion der konkreten Lebensverhältnisse sowie der Spannungen und Konflikte zwischen den einzelnen Lebensfeldern (vgl. Grunwald/Thiersch 2004, 21). Die „Lebensweltorientierte Soziale Arbeit“ bezieht sich auf die Bewältigungs- und Verarbeitungsformen von Problemen in der Lebenswelt der Adressaten, die zu einem „gelingenderem Alltag“ beitragen sollen. Das bedeutet, Hoffnungen auf Veränderungen müssen an den Erfahrungen und Gegebenheiten des Möglichen gebunden sein (vgl. Thiersch 1986, 35). In seiner Analyse verwendet Thiersch die Begriffe „Lebensweltorientierung“ und „Alltagsorientierung“ synonym. Ferner werden in dem Konzept die Spannungen von Gesellschaftsstrukturen und Bewältigungsmustern, z.B. in den Formen der Exklusion lebensweltlicher Erfahrungen, verfolgt. Dieser Aspekt besitzt für mich besondere Relevanz, wenn es aufgrund einer Ertaubung im Erwachsenenalter um Einschränkungen von Interaktionsräumen geht, die bis zum subjektiven Gefühl der sozialen Isolation führen können. In dieser Spannung zwischen subjektiven Möglichkeiten und gesellschaftlichen Strukturen geht die „Lebensweltorientierte Soziale Arbeit“ von den subjektiven Möglichkeiten aus (vgl. Thiersch 2001, 470). 6.2.3 Leitlinien und Ziele der „Lebensweltorientierten Sozialen Arbeit“ Thiersch betont im Sinne des Empowermentansatzes die Selbstbestimmung und Selbstverantwortlichkeit der Menschen, ihre Umwelt aktiv mitzugestalten. In diesem Zusammenhang hebt Thiersch hervor, dass die Soziale Arbeit den Eigensinn subjektiver Deutungen und Lebenswege der Adressaten anerkennen und akzeptieren muss (vgl. Grunwald/Thiersch 2004, 24). Das impliziert eine sozialpädagogische Sichtweise auf den Menschen als Subjekt seiner Verhältnisse und betont den Respekt vor der Unterschiedlichkeit lebensweltlicher Erfahrungen. Die Aufgabe der Sozialen Arbeit besteht darin, kritisch Bezug auf den Alltag der Klienten zu nehmen, (vgl. Selbst-) Täuschungen aufzudecken und Scheitern zu verhindern, allerdings immer unter der Achtung vor der Autonomie der persönlichen Lebenspraxis (vgl. Engelke 1999, 334). Das Ziel der sozial59 6 Darstellung von Handlungstheorien für die Soziale Arbeit mit spätertaubten Erwachsenen pädagogischen Intervention liegt in der Unterstützung bei der Konstitution eines „gelingenderen Alltags“, in dem die gestellten Aufgaben vom Subjekt, in der Spannung von positiver Routine und der Integration von neuen Erfahrungen, bewältigt werden können. Thiersch (1986, 42) unterstreicht in seinen Ausführungen, dass sowohl Wege der Provokation, Unterstützung und Veränderung im Alltag wie auch in den gesellschaftlichen Bedingungen unverzichtbare Leitlinien der „Lebensweltorientierten Sozialen Arbeit“ sind. Die alltagsorientierte Soziale Arbeit folgt dem Prinzip der „Strukturierten Offenheit“ (Thiersch 1993, 11). Das bedeutet, lebensweltorientiertes Handeln verlangt situativ offenes agieren, in dem die Lösungen gemeinsam mit den Adressaten ausgehandelt werden. Dabei ist die Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung der miteinander verhandelnden Partner notwendige Bedingung des Interventionsprozesses. Demzufolge insistiert Thiersch auf eine symmetrische Arbeitsbeziehung zwischen dem Sozialpädagogen und dem Adressaten und folgt damit der Grundhaltung des Empowermentansatzes. Strukturiertes pädagogisches Handeln orientiert sich an den drei Grundannahmen Ganzheitlichkeit, Offenheit und Allzuständigkeit, die für die Soziale Arbeit konstitutiv sind. Folglich verlangt die „Lebensweltorientierung“ ein Handeln, welches am ganzheitlichen Zusammenhang von Problemverständnis und Lösungsressourcen sowie an den in der Lebenswelt verfügbaren Möglichkeiten orientiert ist (vgl. Thiersch 1993, 22). Zusammengefasst lässt sich festhalten, dass die „Lebensweltorientierte Soziale Arbeit“ die Ressourcen in der Lebenswelt stützen muss, vor allem dort, wo sie nicht hinreichend vorhanden sind und sie muss kompensatorisch und ergänzend neue Ressourcen aufbauen. Letztlich liegt das Ziel der Sozialen Arbeit darin, die Verantwortung für das Alltagshandeln an das Individuum zurückzugeben. Die Kompetenz der Lebensbewältigung zielt darauf, in den Widersprüchen und Offenheiten der gesellschaftlichen Verhältnisse zu innerer Kohärenz zu finden, also zu einer Sicherheit im Lebenskonzept (vgl. Grunwald/Thiersch 2004, 35). 6.3 Das „Biographiekonzept“ nach L. Böhnisch Unter Bezugnahme auf Ulrich Beck legt Lothar Böhnisch (2001, 30) dar, dass mit der Individualisierung und Pluralisierung der heutigen Lebensverhältnisse nicht mehr eine selbstverständliche Anpassung an gesellschaftliche Normen im Zentrum steht, sondern eine multiple Suche nach biographischer Handlungsfähigkeit den Mittelpunkt der Auseinandersetzung mit psychosozialen Problemen bildet. 60 6 Darstellung von Handlungstheorien für die Soziale Arbeit mit spätertaubten Erwachsenen Das „Biographiekonzept“ von Böhnisch bietet für die Soziale Arbeit eine theoretische Perspektive, in der sich die Dimension der individuellen Betroffenheit umsetzen lässt. Böhnisch (2001, 23) beschreibt, dass die biographische Perspektive nicht nur die Einzigartigkeit des jeweiligen Betroffenseins erfasst, sondern über die Anschlusskonzepte Lebenslauf und Lebensalter, auf die gesellschaftlichen Bedingungskonstellationen individueller Lebensprobleme bezogen werden kann. 6.3.1 Das Zusammenspiel von Biographie und Lebenslauf Das Konstrukt „Biographie“ weist auf ein biographisch handelndes und sich immer wieder veränderbares Subjekt im Lebenslauf hin. Lebenslauf ist dabei ein objektiver Tatbestand, der z.B. durch das Lebensalter oder die Herkunftsfamilie bestimmt ist. Böhnisch (2001, 36) erörtert, dass Biographie und Lebenslauf miteinander verschränkt sind. Die Individualisierung der Lebensverhältnisse hat eine zunehmende Biographisierung des Lebenslaufes mit sich gebracht. Trotzdem ist weiterhin eine Kernstruktur des Lebenslaufes durch Bildung und Arbeit erkennbar, die dem biographischen Normalitätsentwurf entspricht. Für die Soziale Arbeit ist der biographische Zugang deshalb bedeutsam, weil Sozialpädagogen auf Adressaten in ihrer aktuellen individuellen Befindlichkeit treffen, die nicht in Richtung ihres herkunftsgesteuerten Lebenslaufes denken und agieren (vgl. Böhnisch 2001, 36). Das Zusammenspiel von Lebenslauf und Biographie bietet ein erkenntnisleitendes Bezugssystem für sozialpädagogische Analysen, indem das individuelle Handeln mit den sozialen Bedingungsstrukturen verbunden werden kann. Eine weitere Perspektive in diesem Rahmenkonzept nehmen die verschiedenen Lebensalter ein. Böhnisch (2001, 39) schildert, dass der Lebenslauf von Individuen durch die Lebensalter gegliedert ist, hingegen die Biographie durch die selbstbezogene Erfahrung und Verknüpfung der Lebensalter. Diese Ausführungen sollen für die vorliegende Arbeit genügen, um das Verhältnis von Biographie und Lebenslauf deutlich zu machen. 6.3.2 Grunddimensionen der biographischen Lebensbewältigung Aus der Biographieperspektive steht in Lebensschwierigkeiten und bei kritischen Lebensereignissen immer der aktuelle Verlust der persönlichen Handlungsfähigkeit im Vordergrund. Der sozialpädagogische Blickwinkel auf die biographische Lebensbewältigung ermöglicht, dass die subjektiven Betroffenheiten und Befindlichkeiten der Ad61 6 Darstellung von Handlungstheorien für die Soziale Arbeit mit spätertaubten Erwachsenen ressaten erkannt und ihr darauf bezogenes Bewältigungshandeln verstanden werden (vgl. Böhnisch 2001, 31). Gemäß Böhnisch (2001, 35) ist das Paradigma der Lebensbewältigung mit dem Bedürfnis der Individuen nach sozialer Integration verbunden, in dem es letztlich um die Balance zwischen beiden Dimensionen geht. Die Soziale Arbeit erhält daraus ihren Handlungsansatz als „Hilfe zur Lebensbewältigung“. Lebensbewältigung meint in diesem Zusammenhang das Streben nach subjektiver Handlungsfähigkeit in Lebenssituationen, in denen das „psychosoziale Gleichgewicht“, gekennzeichnet durch Selbstwert und soziale Anerkennung, gefährdet ist (Böhnisch 2001, 31). Böhnisch (2001, 46) geht davon aus, dass Menschen folgende vier psychosoziale Dimensionen aktivieren, um eine biographische Krise zu bewältigen: - Suche nach Wiedergewinnung des Selbstwerts, - Suche nach sozialem Rückhalt, - Suche nach Orientierung und - Streben nach Normalisierung und Handlungsfähigkeit. Suche nach Wiedergewinnung des Selbstwerts Ein kritisches Lebensereignis, wie z.B. ein Hörverlust im Erwachsenenalter, kann zur Erfahrung des Selbstwertverlustes führen. Böhnisch (2001, 46) postuliert, dass einschneidende biographische Ereignisse nicht als selbstverständliches Schicksal begriffen werden, sondern ein Betroffensein auslösen. Die betroffenen Menschen beziehen den Zustand auf ihr Selbstsein verbunden mit Gefühlen der Hilflosigkeit und des Ausgesetztseins. Das Bewältigungsstreben der Individuen besteht in dieser Dimension, in der Suche nach Wiedergewinnung des Selbstwerts, verbunden mit den sozialen Bezügen der Anerkennung (vgl. Böhnisch 2001, 47). Suche nach sozialem Rückhalt Böhnisch (2001, 46) geht davon aus, dass in einer biographischen Krise die Erfahrung des fehlenden sozialen Rückhalts „angesichts personal nicht mehr überschaubarer biographischer Risikosituationen“ gemacht wird. Für ein stimmiges Identitätsgefühl benötigen Individuen jedoch soziale Anerkennung und Zugehörigkeit. In diesem Zusammenhang sind die soziale Einbindung und der soziale Rückhalt für jede Person notwendig (vgl. Kapitel 4.3.5). Dafür suchen sich Menschen Milieus, in denen sie sich geborgen und anerkannt fühlen. 62 6 Darstellung von Handlungstheorien für die Soziale Arbeit mit spätertaubten Erwachsenen Böhnisch definiert „Milieu“ als: „[…] ein sozialwissenschaftliches Konstrukt, in dem die besondere Bedeutung persönlich überschaubar, sozialräumlicher Gegenseitigkeits- und Bindungsstrukturen – als Rückhalte für soziale Orientierung und soziales Handeln – auf den Begriff gebracht ist.“ (Böhnisch 2001, 59). Die Beziehungen im Milieu beeinflussen nicht nur die Lebensbewältigung, sondern auch das Bewältigungsverhalten bei Belastungen und einschneidenden Lebensereignissen. In der vorliegenden Arbeit interessiert mich, welche Erfahrungen spätertaubte Personen in ihren Milieustrukturen erlebten und erleben. Suche nach Orientierung Anhand der Dimension des sozialen Rückhalts ist bereits die Verknüpfung von personaler Befindlichkeit und gesellschaftlichen Umständen herausgearbeitet worden. Die enge Verbindung der beiden Zustände wird in der Dimension der sozialen Orientierung ebenfalls deutlich. Böhnisch (2001, 63) postuliert, dass Menschen in einer hocharbeitsteiligen Gesellschaft nur als soziale Wesen existieren können. Das bedeutet, Individuen sind auf die Gesellschaft angewiesen. Infolgedessen hängt das Vermögen eines Individuums mit sich selbst zurechtzukommen davon ab, wie sich der betreffende Mensch in der Gesellschaft zurechtfindet. Gemäß Böhnisch lösen biographische Krisen soziale Orientierungslosigkeit aus. In diesem Zusammenhang stellt das subjektive Streben nach neuer Orientierung die Bewältigung lebensweltlich erfahrbarer Probleme der sozialen Integration dar. Streben nach Normalisierung und Handlungsfähigkeit Böhnisch (2001, 46) gibt als vierte Dimension der Lebensbewältigung das Streben nach Normalisierung an, welches Subjekte in einer biographischen Krise unternehmen. Damit versuchen Menschen aus ihrer Handlungsunfähigkeit herauszukommen. Das Streben nach Handlungsfähigkeit ist die fachliche Begründung für eine sozialpädagogische Intervention und dessen Legitimation. Böhnisch (2001, 31) nimmt den Versuch vor, das Bewältigungshandeln zu strukturieren und lehnt sich dabei an das aus der Stressforschung stammende Coping-Modell an. Er befasst sich vor allem mit der bestimmten Wiederherstellung der Handlungsfähigkeit aus der aktuellen biographischen Befindlichkeit heraus. Den psychosozialen Grunddimensionen ordnet Böhnisch im Anschluss 63 6 Darstellung von Handlungstheorien für die Soziale Arbeit mit spätertaubten Erwachsenen seiner Analyse entsprechende sozialpädagogische Arbeits- und Interventionsprinzipien zu, die ich im Folgenden in Auszügen vorstellen werde. 6.3.3 Arbeitsprinzipien einer biographisch orientierten Sozialen Arbeit Ein Grundprinzip der biographisch orientierten sozialpädagogischen Intervention zeigt sich darin, dass Sozialpädagogen über professionelle Beziehungen nicht nur Helfende, sondern auch Vermittelnde sind (vgl. Böhnisch 2001, 287). Im Sinne des Empowermentansatzes bieten sie nicht nur direkte soziale Hilfe, sondern auch Zugänge zu sozialen Ressourcen für die Aktivierung und Stärkung von Selbsthilfeaktivitäten. In ihrer personenbezogenen Tätigkeit agieren Sozialpädagogen immer mit bestimmten Menschenbildern und Definitionen von „Normalität“, die von den Adressaten gespürt bzw. erkannt werden. Folglich ist die „biographische Reflexivität“ ein weiteres Grundprinzip sozialpädagogischer Intervention (Böhnisch 2001, 288). An dieser Stelle lässt sich eine Nähe zur „Lebensweltorientierten Sozialen Arbeit“ feststellen, in der die Selbstreflexion von Sozialpädagogen als eine zentrale Schlüsselqualifikation und Handlungskompetenz ebenfalls hervorgehoben wird (vgl. Kapitel 6.2.3). In diesem Zusammenhang wird ein weiteres Arbeitsprinzip deutlich, welches Böhnisch mit dem Begriff des „Pädagogischen Bezugs“ umschreibt (Böhnisch 2001, 288). Aufgrund der interaktiven Dimension in der biographischen Intervention spielt die Persönlichkeit des Sozialpädagogen immer eine eingreifende Rolle, die über die berufliche Rollenfunktion hinausgeht. Böhnisch (2001, 288) insistiert, dass sich Sozialpädagogen ihres „Pädagogischen Bezugs“ in ihrem Handeln bewusst sein müssen. Letztlich beinhaltet das „Biographiekonzept“ noch das Prinzip der Aktivierung der Adressaten. Unter dem Stichwort „Empowerment“ fasst Böhnisch (2001, 289) die Befähigung des Adressaten einen eigenen Beitrag zur Problemlösung zu finden. Er bezieht sich damit auf die Bedeutung der Selbstwertkomponente in Bewältigungskonstellationen. Sozialpädagogische Interventionen versuchen den Selbstwert wieder zu aktivieren. Böhnisch markiert, dass der Empowermentansatz das beste Prinzip darstellt, um die biographische Interventionsperspektive zu entfalten. 6.4 Zusammenfassung Zusammenfassend für dieses Kapitel kann festgehalten werden, dass Subjekttheorien der Sozialen Arbeit die individuelle Lebensgeschichte von Subjekten als Determinante für das Belastungserleben betrachten. Der Zugang von Thiersch erfolgt über die einzel 64 7 Zusammenfassung des theoretischen Zugangs und Ableitung der empirischen Fragestellung nen Lebenswelten von Personen. Im Mittelpunkt seiner Betrachtung steht ein „gelingenderer Alltag“ für den betroffenen Menschen. Das „Biographiekonzept“ von Böhnisch kann die Einzigartigkeit des jeweiligen Betroffenseins erfassen und darauf aufbauend Personen in ihrem Streben nach psychosozialer Handlungsfähigkeit unterstützen. Mit Hilfe des Empowermentansatzes erhält die Soziale Arbeit eine theoretisch fundierte professionelle Grundhaltung für ihre Interventionen. Daraus ableitend können im Anschluss an die empirische Studie Handlungsanforderungen für die Soziale Arbeit mit spätertaubten Menschen herausgearbeitet und diskutiert werden. 7 Zusammenfassung des theoretischen Zugangs und Ableitung der empirischen Fragestellung In meiner bisherigen theoriegeleiteten Analyse habe ich dargelegt, dass eine Spätertaubung im Erwachsenenalter eine Hörbehinderung darstellt, die sich auch auf die zwischenmenschliche Kommunikation auswirkt und damit grundlegende menschliche Erlebnis- und Erfahrungsbereiche betrifft. Kommunikation ist ein Grundbedürfnis der Menschen und stellt das basale Element sozialen Handelns dar. In der Interaktion von Individuen mit der sozialen Umwelt konstituiert sich subjektive Identität. Dabei ist die Sprache das Medium, in dem sich Interaktion vollzieht. Gleichzeitig ist Sprache das Mittel, mit dem sich Identität ausdrückt bzw. erworben wird. Folglich wirken sich kommunikative Einschränkungen auf die lebensweltlichen Interaktionserfahrungen und damit auf die Zugehörigkeit zur Gesellschaft sowie auf das Selbstkonzept von Personen aus. Der Begriff „Identität“ ist der zentrale Gegenstand der vorliegenden Arbeit. Die klassischen Modelle der Identitätsforschung, das psychoanalytische Modell von Erikson und das soziologische Modell von Mead, bieten signifikante Zugänge für meine Untersuchung und fließen folglich in die Analyse ein. Ich übernehme für die empirische Studie die Definition der Ich-Identität von Erikson. Eriksons Betrachtung der Identitätsbildung in den verschiedenen Zeiträumen der Entwicklungsphasen von Menschen, ermöglicht, die Identität der Personen in der Erwachsenenphase zu beleuchten. Die interaktionistischen Sichtweisen von Mead und Krappmann hingegen stellen die sozialen Beziehungen in den Mittelpunkt ihres Modells und legen dar, dass Identität ein Netz aus selbstbeschreibenden Propositionen ist und damit in der Kommunikation verbalisiert werden kann. Einschränkend möchte ich hinzufügen, dass die klassischen Ansätze unter modernen gesellschaftlichen Bedingungen keine hinreichende Erklärung zum Konstrukt „I65 7 Zusammenfassung des theoretischen Zugangs und Ableitung der empirischen Fragestellung dentität“ bieten. Infolgedessen habe ich für meine Untersuchung das sozialpsychologische Konzept der Identitätsarbeit rekurriert. In diesem Modell wird davon ausgegangen, dass Identität eine Verknüpfungsarbeit lebensweltlicher Erfahrungen der Subjekte ist und einen lebenslangen, offenen Prozess darstellt. Ausgehend von den bisherigen Überlegungen werde ich im empirischen Teil der Analyse der Frage nachgehen: „Inwiefern wirkt sich eine plötzliche Ertaubung im Erwachsenenalter auf die Identitätsarbeit eines Betroffenen aus?“. Identitätsarbeit benötigt soziale Netzwerke, die Ressourcen zur Bewältigung von Belastungssituationen zur Verfügung stellen. Innerhalb der sozialen Netzwerke werden kulturelle Werte und Orientierungen vermittelt. Aufgrund des Zugehörigkeitsgefühls von Individuen zu ihrem sozialen Netzwerk bildet sich eine kulturelle (Teil-)Identität aus. Ein kulturelles Netzwerk stellt die Gebärdensprachgemeinschaft dar. Im kulturellen Konzept von Gehörlosigkeit grenzen sich hörgeschädigte Menschen bewusst von einer medizinisch defektorientierten Definition von Gehörlosigkeit ab. In diesem Zusammenhang besteht mein Forschungsinteresse darin, der Frage nachzugehen, inwiefern die Gebärdensprachgemeinschaft ein soziales Netzwerk und eine kulturelle (Teil-)Identität für spätertaubte Menschen darstellt. Meine Überlegungen beziehen sich darauf, dass spätertaubte Erwachsene mit prälingual gehörlosen Menschen die Tatsache des vollständigen Hörverlustes und folglich visuelle Perzeptionsbedingungen teilen. Darüber hinaus sind beiden Gruppen Kommunikationsbeeinträchtigungen mit der hörenden Gemeinschaft bekannt. Meine Vermutung liegt darin, dass spätertaubte Menschen in der Gebärdensprachgemeinschaft ein soziales Netzwerk finden können. Allerdings besteht ein entscheidendes Hindernis darin, dass gehörlose Menschen untereinander die Gebärdensprache verwenden, welche spätertaubte Menschen in der Regel nicht beherrschen. Im Anschluss an die empirische Studie werde ich auf der Grundlage der „Lebenswelttheorie“ von Thiersch und dem „Biographiekonzept“ von Böhnisch mögliche Handlungsanforderungen an die Soziale Arbeit mit spätertaubten Menschen ausarbeiten. 66 8 Operationalisierung der allgemeinen Fragestellung 8 Operationalisierung der allgemeinen Fragestellung 8.1 Grundlegende Entscheidung bezüglich der benutzten Methoden Der Ausgangspunkt meiner Überlegungen besteht in der Annahme, dass das Selbstkonzept von Subjekten in Form sprachlicher Äußerungen gekleidet ist. Folglich lässt es sich kommunizieren und ein empirischer Zugang zum Konstrukt „Identität“ erscheint möglich. Die Problematik besteht für mich darin, dass zwar jede Person eine Identität hat, aber die Kommunizierbarkeit dessen nicht ebenso selbstverständlich erscheint. Nach meiner Ansicht müssen die befragten Personen über ein hohes Maß an Selbstreflexivität verfügen, um Auskunft über ihr Selbstverständnis geben zu können. Die vorliegende Untersuchung stellt eine Studie im Rahmen der qualitativen Sozialforschung dar, in der die theoretische Beschäftigung mit dem Konstrukt „Identität“ um das subjektiv biographische Selbstverständnis ergänzt wird. Hintermair (2001, 109) hebt hervor, dass Identität die subjektive Konstruktion über die eigene Person ist. Folglich kann nur der betreffende Mensch selbst über seine Identität Auskunft geben. In Anlehnung an dieses Postulat werte ich in der nachfolgenden empirischen Studie biographische Interviews aus. Damit der befragte Mensch mit seiner Artikulationsfähigkeit im Zentrum steht, ist mein sozialwissenschaftliches Erhebungsinstrument weniger standardisiert (Atteslander 2000, 144; vgl. Diekmann 1999, 444; vgl. Schaffer 2002, 87). Im Sinne des Modells der Identitätsarbeit erhebe ich eine situationale Auseinandersetzung der Person mit sich selbst in einer Verknüpfung aus retro- und prospektiven Anteilen. Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass die Befragung einen punktuellen Eindruck von den Identitätskonstruktionen spätertaubter Menschen offenbart. Demzufolge stellen die ausgewählten Interviews eine qualitative Querschnittsuntersuchung zum momentanen Selbstverständnis der Untersuchungspersonen dar. 8.2 Kriterien für die Wahl einer spezifischen Interviewform Aus der Vielzahl der Möglichkeiten habe ich mich für das teilstandardisierte biographische Interview entschieden, welches auch als leitfadengestütztes Interview bezeichnet wird. Zu dieser Wahl haben folgende Gründe beigetragen: 1) Gemäß Schaffer (2002, 87) werden teilstandardisierte Interviews vor allem in der empirischen Forschung eingesetzt, wenn noch wenig über ein Forschungsfeld bekannt ist oder es um komplexe Themen, wie die individuelle Verarbeitung kritischer Lebensereignisse, geht. Beide Sachverhalte sind für mein Unter- 67 8 Operationalisierung der allgemeinen Fragestellung suchungsthema gegeben. Schaffer (2002, 89) postuliert weiter, dass teilstandardisierte Interviewformen immer dann eine unersetzliche Bedingung sind, wenn in einem Arbeitsfeld der Sozialen Arbeit keine oder nur wenige empirisch gesicherte Erkenntnisse vorliegen, um einen vollstandardisierten Fragebogens zu konstruieren. Infolgedessen ist die empirische Methode des Interviews für den Rahmen dieser Arbeit ein geeignetes sozialwissenschaftliches Instrument, um Erkenntnisse für die Soziale Arbeit zu gewinnen. 2) Mein Forschungsinteresse bezieht sich auf die subjektive Alltagswahrnehmung der betreffenden Person. Ein Leitfadeninterview bietet die Möglichkeit, die subjektiven Aussagen des Befragten in den Mittelpunkt zu stellen und auf individuelle Aspekte und Prioritäten einzugehen. Damit ist die Grundlage für eine „Lebensweltorientierte Soziale Arbeit“ gemäß Thiersch geschaffen. Des Weiteren bietet ein Leitfaden die Basis, um Identität anhand von Identitätsvariablen zu erheben und die Vergleichbarkeit der einzelnen Interviews zu gewährleisten. 3) Das letzte Kriterium der Entscheidung für ein biographisches Interview ist mit dem zweiten Punkt verwandt. Gemäß Böhnisch stellt die Biographie eines Subjekts die subjektive Deutung des Lebenslaufes dar (vgl. Kapitel 6.3.1). Im Rahmen der vorliegenden Analyse können aus der biographischen Perspektive mögliche Handlungsanforderungen für die Soziale Arbeit mit spätertaubten Erwachsenen diskutiert werden. 8.3 Inhaltliche Struktur des Interviewleitfadens Ausgehend von der Fragestellung: „Inwiefern wirkt sich eine plötzliche Ertaubung im Erwachsenenalter auf die Identitätsarbeit eines Betroffenen aus?“ wird in den Interviews die subjektive Identität der betreffenden Personen in Bezug auf ihre Position in der Gesellschaft und ihre zentralen Interaktionsfelder erhoben. Dabei stellt sich für mich die Frage, in welcher Form die theoretischen Erörterungen zum Konstrukt „Identität“ bei der Konkretisierung der allgemeinen Fragestellungen mit einbezogen werden können und eine Richtlinie für die inhaltliche Struktur des Leitfadens bieten. Um den genannten Überlegungen Rechnung zu tragen, wähle ich in Anlehnung an Keupp Identitätsvariablen, die gesellschaftliche Lebenswelten darstellen (vgl. Keupp 2002, 7). Sie verdeutlichen die inhaltliche Strukturierung der allgemeinen Fragestellungen. Damit lege ich einerseits ausgewählte Aspekte des Identitätsbegriffes dar, andererseits erhalte 68 8 Operationalisierung der allgemeinen Fragestellung ich eine Vergleichbarkeit der einzelnen Interviews unter Zuhilfenahme eines generalisierten Analyserasters. Hierzu messe ich Identität anhand der Lebensfelder Arbeit, Partnerschaft, soziale Netzwerke und Kultur. Ich vertrete die Ansicht, dass die genannten Lebensfelder ein strukturiertes Hilfsmittel für die Untersuchung darstellen und einen signifikanten Ausschnitt der Identitätsräume Erwachsener bilden. In Bezug auf die Sozialisation im Erwachsenenalter ist davon auszugehen, dass die berufliche Arbeit und die Partnerschaft einen zentralen Stellenwert im Leben von Menschen einnehmen. Ich schließe mich Leonhardt (1999, 167) an, die postuliert, dass über die berufliche Tätigkeit soziale Kontakte, Anerkennung, gesellschaftliche Partizipation und soziale Identität hergestellt wird. Insofern ist zu fragen, wie sich die Ertaubung auf die berufliche Situation von betroffenen Personen auswirkte. Ferner stellt sich die Frage: „Inwiefern hat sich die Ertaubung auf die Partnerschaft und die Familie der spätertaubten Person ausgewirkt?“. Ein weiteres Lebensfeld für Individuum bildet ihr soziales Netzwerk. Soziale Netzwerke sind notwendige Bedingungsfaktoren für die Identitätsarbeit und ich werde den Fragen nachgehen: „Inwiefern haben sich die sozialen Netzwerke von postlingual ertaubten Menschen verändert?“, „Wie begegnen ihnen Menschen und wie vermitteln sich Spätertaubte ihrer Umwelt?“, „Wie definieren sie sich in ihren sozialen Netzwerken bzw. wie können sie sich definieren?“ und „Inwiefern stellt die Gebärdensprachgemeinschaft ein soziales Netzwerk und eine kulturelle (Teil-) Identität für spätertaubte Menschen dar?“. Im Zusammenhang mit dem kulturellen Netzwerk von spätertaubten Menschen stellen sich für mich außerdem die Fragen: „Welche manuellen Kommunikationsmittel benutzen spätertaubte Menschen?“ und „Inwiefern besteht für spätertaubte Personen eine Motivation die Gebärdensprache zu lernen und sich der Gebärdensprachgemeinschaft anzuschließen?“. Die bisherigen Fragestellungen beziehen sich vorwiegend auf den retrospektiven Prozess der Identitätsarbeit. In meiner Analyse des Modells zur Identitätsarbeit habe ich dargelegt, dass situationale Selbstthematisierungen auch immer einen prospektiven Anteil haben. Folglich werde ich im empirischen Teil abschließend der Frage nachgehen, wohin sich die betreffenden Personen entwickeln möchten. Der Leitfaden (siehe Anhang) ist durch offene Fragen zum Forschungsthema strukturiert, so dass die Befragten ausführlich und in ihren eigenen Worten antworten können. Biographische Interviews beginnen mit einer erzählgenerierenden Eingangsfrage, welche sich auf ein bestimmtes Lebensereignis bzw. einen bestimmten Zeitpunkt der Bio69 8 Operationalisierung der allgemeinen Fragestellung graphie bezieht (vgl. Friebertshäuser/Prengel 2003, 387). Meine Eingangsfrage bezieht sich auf die Anfänge der Hörminderung der betreffenden Menschen. Ausgehend von diesem Lebensereignis sind die folgenden Fragen nach den genannten Lebensfeldern Arbeit, Partnerschaft, soziale Netzwerke und Kultur strukturiert. Die Abrundung des Leitfadens erfolgt durch allgemeine Fragen zur Nutzung von speziellen Kommunikationssystemen und durch die Erhebung von sozialdemographischen Daten. Im Sinne eines biographischen Interviews biete ich den befragten Personen damit die Möglichkeit, sich emotional zurückzuziehen. Gleichzeitig stellen die Abschlussfragen die Abrundung der Erzählsituation dar. Eine eminente Voraussetzung für leitfadengestützte biographische Interviews ist die sprachliche Kompetenz der Befragten. Im folgenden Abschnitt gehe ich näher auf die kommunikativen Kriterien für meine empirische Untersuchung ein. 8.4 Kommunikative Kriterien für die Durchführung der Interviews Gemäß Schaffer (2002, 107) ist das „Prinzip der Kommunikativität“ ein signifikantes methodologisches Prinzip qualitativer Interviews. Demnach muss sich der Interviewer an die sprachlichen Fähigkeiten der befragten Personen orientieren. An dieser Stelle möchte ich betonen, dass die empirische Sozialforschung immer von einer persönlichen Interviewsituation ausgeht. Für den Personenkreis von spätertaubten Menschen konstatiere ich, dass ihre kommunikative Kompetenz in verbalen Interaktionssituationen beeinträchtigt ist. Ein persönliches „Face-to-face“ Interview weist die Gefahr auf, dass Informationen auf der Sachebene missverständlich perzipiert werden. In Kapitel 3.4 habe ich ausführlich dargelegt, dass die visuell wahrnehmbaren Signale beim Lippenabsehen nicht so leistungsfähig sein können wie Sprachlaute oder dauerhafte Schriftzeichen (vgl. Leven 2003, 28). Infolge des beträchtlichen kommunikativen Störungspotentials wähle ich für die Durchführung meiner Interviews die Schriftform. Die schriftliche Umsetzung eines Interviews enthält Vor- und Nachteile, auf die im folgenden Abschnitt hingewiesen werden soll. 8.5 Möglichkeiten und Grenzen von schriftlichen Befragungen Das vorliegende Untersuchungsthema erfordert von der befragten Person Reflexionsvermögen hinsichtlich der eigenen Person. Ein schriftlicher Leitfaden gestattet Zeit zum Überlegen und zur reflexiven Beantwortung. Mit der schriftlichen Befragung fallen die Einflüsse äußerer Interviewermerkmale weg. Diese umfassen das Geschlecht, die Klei 70 9 Durchführung der Untersuchung dung und das Alter des Interviewers (vgl. Diekmann 1999, 399). Ein weiterer Vorteil der schriftlichen Befragung ist finanzieller Art. Innerhalb kurzer Zeit kann mit wenig Personalaufwand und geringen Kosten eine Vielzahl von Personen erreicht werden (vgl. Diekmann 1999, 439). Dieser Aspekt ist für mein Untersuchungsthema insofern relevant, als es eine hohe Bereitschaft voraussetzt, gegenüber einer nicht bekannten Interviewerin zum eigenen Fühlen und Handeln Auskunft zu geben. In meiner Vorbereitung vermutete ich, dass die Anwerbung von bereitwilligen Interviewpartnern einen hohen Zeitaufwand erfordert. Ferner ist zu bedenken, dass die schriftliche Kommunikation einer stärkeren Planung, Überarbeitung und Revision unterliegt. Ein schriftlicher Leitfaden erfordert vom Interviewer die Fähigkeit sich bei der Frageformulierung auf den Leser einzustellen. Demgegenüber verlangen offene Fragen nach Motiven und Begründungen erhebliche Formulierungsfähigkeiten von der Untersuchungsperson (vgl. Diekmann 1999, 439). Atteslander (2000, 147) weist darauf hin, dass eine schriftliche Interviewsituation zu Erkenntnisverfälschungen führen kann, indem andere Personen die Antwort des Befragten beeinflussen. Des Weiteren müssen die formulierten Fragen verständlich sein, weil der Interviewer persönlich nicht anwesend ist, um Rückfragen zu beantworten. Im Rahmen dieser Arbeit wurde das Internet als Kommunikationsmedium genutzt, um Rückfragen zu ermöglichen und die Grenzen einer schriftlichen Befragung einzuengen. 9 Durchführung der Untersuchung Aus meiner persönlichen Erfahrung ist mir bekannt, dass hörgeschädigte Menschen das Internet als Kommunikations- und Informationsmedium nutzen. Nach meiner Meinung ermöglicht es eine vorwiegend barrierefreie Kommunikation für spätertaubte Personen. Darüber hinaus bietet das Internet für die vorliegende Studie die Möglichkeit, in kurzer Zeit Rückfragen sowohl zum Verständnis des Interviewleitfadens zu stellen als auch bezüglich der Aussagen der befragten Person. Demnach ist die Offenheit eines biographischen Interviews im Sinne der qualitativen Sozialforschung gewährleistet. Aus diesen Gründen entschied ich mich dafür, die betreffenden Personen per E-Mail zu interviewen. 9.1 Anwerbung der Interviewteilnehmer Im Rahmen meiner Literaturrecherche zum Untersuchungsthema fand ich eine Webseite im Internet, die speziell für spätertaubte Menschen eingerichtet wurde (vgl. 71 9 Durchführung der Untersuchung www.spaetertaubt.de, 2005). Die Webseite enthält u.a. das Kontaktforum „Einstürzende Tonwelten“, welches die Möglichkeit bietet sich mit spätertaubten Menschen auszutauschen, Fragen zu verschiedenen Themengebieten zu stellen sowie Informationen weiterzuleiten. In diesem Forum stellte ich mein Anliegen und das Thema meiner Diplomarbeit vor und fragte nach interessierten Interviewpartnern. Meine Intention bestand darin, spätertaubte Personen zu finden, die Interesse an der vorliegenden Thematik besitzen und auf dieser Basis die Bereitschaft zu einem entsprechenden Interview haben. 9.2 Durchführung der Interviews Es nahmen mehrere Personen über E-Mail Kontakt zu mir auf, die sich durch meinen Beitrag im Internet-Forum angesprochen fühlten und bereit waren mir ein Interview zu geben. Nach einer kurzen Absprache bezüglich des Hörstatus und des Zeitpunktes der Ertaubung konnte ich vier Personen interviewen. Bei den befragten Personen handelt es sich um eine Frau und drei Männer im Alter von 34 bis 53 Jahren. Alle Interviewpartner sind regelmäßige und kompetente Internetbenutzer, so dass eine barrierefreie Kommunikation möglich erschien. Nach einer erneuten Rücksprache über den Verlauf der Untersuchung, versendete ich das Begleit- und Einführungsschreiben mit dem Leitfaden. Die Interviewpartner ergänzten diesen und schickten ihn per E-Mail an mich zurück. 9.3 Durchführung der Nachgespräche Das Interview ist eine Form intensiver Kommunikation zwischen dem Forscher und der befragten Person, in der Nachfragen und Erklärungen möglich sind und subjektive Bedeutungsebenen transparent werden (vgl. Drewes, 1993, 86). Im Anschluss an die Rücksendung des Leitfadens ergaben sich aus den Interviews einzelne Nachgespräche. Diese bezogen sich auf Rückfragen zum Verständnis einzelner Interviewaussagen und wurden von mir als Anhang zum einzelnen Interviewleitfaden aufbereitet. Des Weiteren kamen Rückfragen von Seiten der Teilnehmer, die sich sowohl auf die inhaltliche Strukturierung meines Leitfadens als auch auf meine persönliche Intention am Forschungsthema bezogen. Die Fragen wurden jeweils per E-Mail beantwortet und stellten den Abschluss der Interviewsituation dar. Im folgenden Kapitel präsentiere ich die Ergebnisse aus den einzelnen Interviews. 72 10 Darstellung und Auswertung der Ergebnisse 10 Darstellung und Auswertung der Ergebnisse Zunächst werde ich meine Erfahrungen mit der gewählten empirischen Methode auswerten. Dieser Zugang erscheint mir sinnvoll und notwendig, da in der qualitativen Sozialforschung üblicherweise keine schriftlichen Interviews durchgeführt werden. Anschließend stelle ich meine vier Interviewpartner in ihrer besonderen Lebenssituation vor. Abschließend werte ich die Ergebnisse aus den biographischen Interviews aus. Ich verzichte an dieser Stelle darauf, die ausführlichen Interviews in die fortlaufende Arbeit einzufügen, sondern weise darauf hin, dass sich die vollständigen Interviews in meinem Besitz befinden und bei mir einsehbar sind. 10.1 Auswertung der empirischen Methode Zunächst einmal ist festzuhalten, dass jeder Interviewteilnehmer über die sprachliche Kompetenz zur Erzählung verfügte und folglich die Voraussetzung für ein biographisches Interview gegeben war. Gemäß meiner Vermutung war die Anwerbung bereitwilliger Interviewteilnehmer zeitintensiv und die schriftliche Form stellte eine erhebliche Arbeitserleichterung für mich dar (vgl. Kapitel 8.5). Das schriftliche Interview erwies sich als sinnvoll, weil die befragten Personen für das abstrakte Forschungsthema Zeit zum Reflektieren benötigten und ein schriftlicher Leitfaden dieser Bedingung gerecht werden konnte. Ferner wurde unter Zuhilfenahme eines schriftlichen Leitfadens die spezielle Artikulationsfähigkeit der betreffenden Person berücksichtigt, da die Taubheit in der schriftlichen Kommunikation nicht relevant ist. Damit konnte ich dem methodischen „Prinzip der Kommunikativität“ Folge leisten, welches ein zentrales Kriterium in Interviewsituationen darstellt (vgl. Kapitel 8.4). Des Weiteren gehört in der qualitativen Sozialforschung das „Prinzip der Offenheit“ zum Methodeninstrumentarium. Gemäß Schaffer kann sich im Forschungsverlauf herausstellen, dass wichtige Fragestellungen fehlen oder differenziert werden müssen (vgl. Schaffer 2002, 107). Darüber hinaus verlangt die schriftliche Kommunikation eine stärkere Überarbeitung und Revision, in Bezug auf die Verständlichkeit der Fragen und auf mögliche Rückfragen zu Aussagen der Interviewteilnehmer. In der vorliegenden Studie konnten für diese Sachverhalte die Nachgespräche genutzt werden, in denen ich u.a. ein Feedback zu meinem Leitfaden erhielt, so dass ich strukturelle Veränderungen einzelner Fragestellungen vornahm, die verständlicher waren. Hierbei handelte es sich jeweils um Unklarheiten bezüglich des Zeitpunktes in der ersten und der fünften Frage. 73 10 Darstellung und Auswertung der Ergebnisse Aufgrund der Rückfragen von Seiten der Interviewteilnehmer zu meiner persönlichen Intention am Forschungsthema ergaben sich im Anschluss an das Leitfadeninterview fachlich anregende Nachgespräche, die weitere signifikante Aspekte zu meiner Thematik enthielten. Nach meiner Erfahrung stellte der Interviewleitfaden eine Vertrauensbasis her, auf dessen Grundlage spätere persönliche Äußerungen der befragten Person möglich waren. In dem Zusammenhang erschien es mir hilfreich, dass ich mein eigenes Interesse an dem Thema formulierte und meinen persönlichen Hintergrund offen legte. Ferner machte ich die Erfahrung, dass die individuellen Lebensgeschichten eine Reaktionsbildung bei mir auslösten, die meinen Fallzugang beeinflussten. In dem Zusammenhang habe ich mir vor der Auswertung der Interviews die Frage gestellt: „Welche Emotionen und Gedanken habe ich aufgrund der Aussagen meiner Interviewteilnehmer?“. Die Selbstreflexion ermöglichte mir emotional Abstand zu den individuellen Lebensgeschichten zu gewinnen und auf der Basis einer professionellen Empathie die Auswertung der Interviews durchzuführen. Einschränkend möchte ich festhalten, dass ein schriftliches Interview keine vergleichbare Erzählsituation, entsprechend einem persönlichen Interview, auslösen konnte. Meiner Meinung nach wurde der Leitfaden eher als empirischer Fragebogen verstanden, den es auszufüllen galt. Die Erzählsituation analog zu einem „Face-to-face“ Interview ergab sich erst in den Nachgesprächen aufgrund der geschaffenen Vertrauensbasis. Schlussfolgernd halte ich fest, dass ein schriftliches Leitfadeninterview die geeignete Form für den speziellen Personenkreis der postlingual ertaubten Menschen im Hinblick auf ihre individuellen Kommunikationsmöglichkeiten darstellte. Darüber hinaus erwies es sich als vorteilhaft, dass alle Interviewpartner kompetente Internetbenutzer sind und dieses elektronische Medium für private und öffentliche Zwecke nutzen. 10.2 Vorstellung der Interviewpartner Eine kurze Vorstellung der von mir interviewten Personen soll dazu dienen, die individuellen Lebensläufe verständlich werden zu lassen. Aus Datenschutzgründen habe ich die Namen der Interviewpartner geändert. 10.2.1 Frau P. Frau P. ist 52 Jahre, verheiratet und Mutter von zwei Kindern. Sie studierte Soziologie, Geschichte und Politikwissenschaften. Als sie Mitte 20 war, wurde von einem Betriebs- 74 10 Darstellung und Auswertung der Ergebnisse arzt bei einer Einstellungsuntersuchung eine geringe Hörminderung diagnostiziert. Diese betraf beide Ohren. Sie berichtet: „Dabei ging es um das Verstehen von Flüstern aus einer Entfernung von ca. 4 Metern. Ich habe diesen Zustand aber nicht als Hörminderung wahrgenommen.“ (P.). Ihre Hörfähigkeit nahm im Laufe der Jahre stetig ab und führte zu Einschränkungen in Kommunikationssituationen. Frau P. gibt an, dass sie Gesprächspartner, die sehr leise sprachen, nicht mehr verstehen konnte. Auch diesen Zustand empfand sie nicht als eine Hörminderung. Nach der Geburt ihres zweiten Kindes, im Jahr 1986, erlitt Frau P. einen kurzzeitigen Hörsturz. Anschließend begann eine sukzessive Innenohrschwerhörigkeit. Im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit, für die sie 1987 persönliche Interviews führen sollte, wurde ihr bewusst, dass ihre Hörfähigkeit spürbar reduziert war. Daraufhin erhielt sie im Alter von 35 Jahren zum ersten Mal zwei Hörgeräte, die sie nach eigener Angabe nur für ihre beruflichen Zwecke benutzte. Sieben Jahre später ertaubte Frau P. auf dem linken Ohr vollständig. Frau P. arbeitete zu diesem Zeitpunkt als Landesgeschäftsführerin eines gemeinnützigen Vereins der Kinder- und Jugendhilfe. Im März 1997 ertaubte Frau P. auch auf ihrem rechten Ohr und ist seitdem audiologisch betrachtet gehörlos. Nach ihrer Rehabilitationsmaßnahme im „Rehabilitationszentrum für hörgeschädigte Erwachsene“ in Rendsburg entschloss sich Frau P. 1998 für die medizinische Versorgung mit einem Cochlea Implantat (vgl. Kapitel 2.2.1.2). Anschließend bildete sie sich zur Audiotherapeutin für hörgeschädigte Menschen weiter und ist seitdem beruflich selbstständig tätig. 10.2.2 Herr A. Herr A. ist 44 Jahre und ledig. Er war Mitte 20, als Angehörige und Freunde zum ersten Mal den Verdacht ihm gegenüber äußerten, dass er schlecht höre. Er selbst sagt dazu: „Ich wurde […] darauf hingewiesen, daß [sic] ich die Stereoanlage und den Fernseher zu laut einstellen würde. Da war ich Mitte 20 und die Möglichkeit einer Hörminderung war mir zu dem Zeitpunkt nicht bewusst bzw. ich hätte nicht gedacht, daß [sic] das der Grund sein könnte.“ (A.). Am Ende seines Studiums musste Herr A. im Hörsaal einen vorderen Platz einnehmen, um den Aussagen des Dozenten folgen zu können. Es war ihm jedoch nicht möglich Fragen von Kommilitonen aus den hinteren Reihen zu verstehen, obwohl sie in Richtung des Dozenten und damit in seine Hörrichtung sprachen. Daraufhin sah sich Herr A. 75 10 Darstellung und Auswertung der Ergebnisse genötigt einen Hals-Nasen-Ohrenarzt aufzusuchen. Dieser diagnostizierte eine Schallempfindungsschwerhörigkeit und Herr A. erhielt zwei Hörgeräte. Mit 34 Jahren ertaubte er auf beiden Ohren. Die medizinische Versorgung mit einem CI ist bei ihm nicht möglich, weil die Hörnerven zerstört sind und demnach der Übertragungsweg der Nervenimpulse vom Ohr zum Gehirn geschädigt ist (vgl. Kapitel 2.2.1.3). Zusätzlich hat Herr A. von Geburt an eine starke Sehbehinderung. Er arbeitet als Referent im öffentlichen Dienst des Bundes. 10.2.3 Herr C. Herr C. ist 34 Jahre und verheiratet. Mit 19 Jahren war Herr C. wegen Tinnitus in ärztlicher Behandlung und in diesem Zusammenhang wurde eine einseitige Hörminderung diagnostiziert. Er selbst äußert, dass sich seine Hörprobleme zu dieser Zeit vor allem auf die z.T. starken Tinnitusgeräusche bezogen. Die Leistungsminderung des Ohrs war für ihn eher medizinisch messbar als persönlich erlebbar. Dieser Zustand blieb über Jahre stabil. Die Verschlechterung der Hörleistung setzte im Jahr 2000 plötzlich ein, so dass Herr C. auf einem Ohr ertaubte und auf dem anderen Ohr mit einem Hörgerät versorgt wurde. In dieser Zeit empfand er das Hören als sehr anstrengend. Herr C. berichtet: „Das Problem war, dass meine Situation nicht eindeutig war. Es gab Tage, an denen ich gut hörte und kaum Probleme mit der Kommunikation hatte. Dann wieder waren die Probleme so massiv, dass ich kaum etwas verstanden habe und entsprechend reagierte. Insofern stellt die Ertaubung eine ‚Klärung’ dieses merkwürdigen, unangenehmen Zustands dar […].“ (C.). Herr C. trägt kein Cochlea Implantat. Er ist beruflich als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand an einer deutschen Universität tätig. 10.2.4 Herr M. Herr M. ist 53 Jahre, verheiratet und hat zwei Kinder. Seinen ersten Hörverlust erlitt er im Alter von 47 Jahren. Herr M. und seine Frau besuchten ihren gemeinsamen Sohn. Während des Besuches erlitt Herr M. eine plötzliche Schwindelattacke und fiel zu Boden. Anschließend stellte er eine Veränderung beim Hören fest. Eine ärztliche Versorgung war notwendig und bei den Untersuchungen im Krankenhaus wurde ihm bewusst, dass er auf einem Ohr nicht mehr hörte. Audiologische Tests bestätigten den vollständigen Hörverlust des rechten Ohrs. Bis zu seinem zweiten Hörverlust arbeitete Herr M. als Pharmakant. 76 10 Darstellung und Auswertung der Ergebnisse Im Jahr 2003 wurde Herr M. während einer Autofahrt erneut schwindlig. Er beschreibt die Situation folgendermaßen: „Da ich während der Fahrt immer Radio anhatte wegen Staumeldung usw. fiel mir bei der Schwindelattacke sofort mein Hörverlust linkerseits auf. Deshalb verließ ich das Auto und machte eine andere Autofahrerin auf mich aufmerksam. Ich sagte ihr, daß [sic] ich einen Notarzt brauche. Sie antwortete, aber ich sah nur die Lippenbewegung. […] als ich sah, daß [sic] sie zum Handy griff, legte ich mich hin und wartete auf den Krankenwagen. Ich hörte nichts mehr.“ (M.). Seitdem ist Herr M. beidseitig ertaubt. Er trägt kein Cochlea Implantat. Aufgrund des beidseitigen Hörverlustes und der folgenden Arbeitsunfähigkeit wurde Herr M. im Alter von 51 Jahren berentet. 10.3 Auswertung der Interviews 10.3.1 Die Auswirkungen der Ertaubung auf die berufliche Situation In Kapitel 8.3 habe ich beschrieben, dass die Erwerbsarbeit ein zentrales Lebensfeld in der Sozialisation von erwachsenen Menschen darstellt. Die Erwerbsarbeit wird als ökonomisches, soziales und psychisches Fundament der Erwachsenenrolle betrachtet (vgl. Galuske 2002, 35). Thiersch führt aus, dass die Berufsarbeit ein zentrales Medium für soziale Integration, Anerkennung und Zugehörigkeit ist (vgl. Thiersch 2001, 783). Folglich ist die Erwerbsarbeit auch ein zentrales Merkmal für die Identitätsarbeit eines Individuums. Alle Interviewpartner waren bis zum Zeitpunkt der vollständigen Ertaubung beruflich tätig. Herr A. und Herr C. arbeiten weiterhin an ihren früheren Arbeitsstellen. Frau P. und Herr M. verloren nach der Ertaubung ihren Arbeitsplatz. Im retrospektiven Reflexionsprozess legen sie dar, dass sie sich unter ihren damaligen Bedingungen nicht für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze einsetzen konnten. Beispielsweise sagt Herr M.: „Anders machen würde ich vielleicht die Auseinandersetzungen mit der Arbeitswelt. Wahrscheinlich hätte ich doch irgendwo ein Plätzchen gefunden, wenn ich die entsprechenden Kenntnisse gehabt hätte, wie das zu bewerkstelligen ist.“ (M.). In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass sich die betreffenden Personen zum damaligen Zeitpunkt in einer akuten Verlustsituation befanden und die psychosozialen Auswirkungen der Ertaubung eine subjektive Betroffenheit auslösten und den Verlust ihrer Handlungsfähigkeit. Böhnisch erläutert, dass in biographischen Krisen die Erfahrung des Selbstwertverlustes gemacht wird, verknüpft mit dem Gefühl der Hilflo- 77 10 Darstellung und Auswertung der Ergebnisse sigkeit (vgl. Kapitel 6.3.2). Das subjektive Bewältigungsstreben des Individuums bezieht sich auf die Wiederherstellung des Selbstwerts verbunden mit dem Gefühl der Anerkennung. Das Bewältigungsstreben von Frau P. zeigt sich in ihrer beruflichen Weiterbildung zur Audiotherapeutin. Sie berichtet selbst: „Meine jetzige berufliche Tätigkeit spielt eine große Rolle, weil ich hier meine Kreativität entfalten kann, mich selbst entscheiden kann, ob ich etwas mache oder nicht. […] Ich fühle mich frei und anerkannt bei der Arbeit. Vor allem bin ich selbstbestimmt. Daher auch meine Entscheidung: lieber einen neuen Beruf anfangen und wenig […] Geld verdienen, als das Angebot zur Frühberentung annehmen.“ (P.). Obwohl die Erfahrungen im Berufsleben individuell verschieden sind, trat in den Interviews ein Aspekt immer wieder in den Vordergrund u.z. die kommunikative Situation am Arbeitsplatz. Grundsätzlich berichten die Interviewpartner von Erschwernissen in der Kommunikation. Unter Bezugnahme auf Schulz von Thun habe ich dargelegt, dass eine Spätertaubung eine elementare Beeinträchtigung in der zwischenmenschlichen Kommunikation auf allen vier Ebenen nach sich zieht (vgl. Kapitel 3.3). Herr A. und Herr C. schildern, dass ihre Kommunikation am Arbeitsplatz in Folge des Hörverlustes ausschließlich schriftlich mittels Papier oder E-Mail stattfindet. Dabei veränderte sich der Umgang mit Kollegen und Vorgesetzten qualitativ durch die kommunikativen Einschränkungen. Herr A. und Herr C. betonen, dass die zwanglosen Unterhaltungen ersatzlos wegfielen. Herr A. stellt dazu fest: „Sodann gibt es keine zwanglose Unterhaltung (small Talk, Büroschwätzchen) mehr. Belangloses wird nicht aufgeschrieben, weil es eben belanglos ist. […] Ohne diese soziale Kommunikation aber gehört man nicht wirklich dazu.“ (A.). Herr C. machte ähnliche Erfahrungen an seinem Arbeitsplatz und berichtet: „Schwieriger ist der ‚small Talk’ mit Kollegen über letztlich belanglose Dinge, die aber gerade so etwas wie ein Zugehörigkeitsgefühl entstehen lassen. Hier stehe ich schon ab und an außen vor […].“ (C.). In Kapitel 3.5 habe ich erläutert, dass der Austausch von Gedanken ein Grundbedürfnis des Menschen ist. Zwanglose Unterhaltungen strukturieren zwischenmenschliche Beziehungen und formen das Zugehörigkeitsgefühl einer Person. Fallen Kommunikationssituationen dieser Art ersatzlos weg, ist die soziale Integration einer Person gefährdet. Die Auswirkungen der kommunikativen Beeinträchtigung auf das Zugehörigkeitsgefühl zeigen sich an einem weiteren Interviewbeispiel. Herr A. berichtet, dass er an dienstlichen Großveranstaltungen nicht mehr teilnimmt, da er nur physisch anwesend wäre, 78 10 Darstellung und Auswertung der Ergebnisse ohne die Möglichkeit zu besitzen, am fachlichen Gespräch aktiv teilzuhaben. In diesem Zusammenhang verweise ich auf die Grenze des Lippenabsehens, die sich in Versammlungen aufgrund des schnellen Sprecher- oder Themenwechsels offenbart (vgl. Kapitel 3.4). Herr C. berichtet ebenfalls von den kommunikativen Einschränkungen bei sozialen Aktivitäten, wie Weihnachtsfeiern und Betriebsausflügen. Er versucht der Exklusion entgegenzuwirken und erzählt: „Ich versuche darauf zu achten, mich nicht selbst auszuschließen und wenn möglich, an entsprechenden, sozialen Aktivitäten […] teilzunehmen. Dort suche ich dann den Kontakt vor allem mit jenen, von denen ich weiß, dass sie sich auf meine Kommunikationsbedürfnisse einstellen. Ich hoffe dann, diesen Kreis zu erweitern. Das klappt nicht immer, aber doch recht regelmäßig.“ (C.). In der Aussage von Herrn C. zeigt sich noch ein zentraler Aspekt in der Kommunikation am Arbeitsplatz, u.z. dass das individuelle Bewältigungshandeln jeder Person durch die Bereitschaft der sozialen Umwelt, sich auf die veränderten Perzeptionsbedingungen der ertaubten Person einzustellen, beeinflusst wird. Hierzu berichtet Herr M. von der Zeit, als er auf einem Ohr ertaubt war: „[…] wenn ich gerufen wurde, wußte [sic] ich nie wo ich hin muß [sic]. Rücksichtslosigkeit der Normalhörenden, ansprechen auf der tauben Seite, Geräusche machen während des Gespräches usw. […] setzten mich natürlich immer unter Streß [sic]. Das Zugehörigkeitsgefühl nahm immer mehr ab, da immer mehr nur noch die notwendigsten Dinge mit mir besprochen wurden und alle außerbetrieblichen Aktivitäten der Kollegen ohne mich besprochen und durchgeführt wurden. Zum Teil wurden Infos nur noch ins Schichtbuch geschrieben.“ (M.). Anhand dieses Beispiels wird einerseits ersichtlich, dass sich die Verständigung zwischen Herrn M. und seinen Kollegen auf die unbedingt notwendigen Informationen reduzierte und sich die Gewichtung der Kommunikation in Richtung Sachebene verschoben hat (vgl. Kapitel 3.3). Andererseits wirkten sich die Unkenntnis der Kollegen über die Kommunikationsbedingungen sowie die fehlende Bereitschaft sich auf visuelle Signale umzustellen, auf das subjektive Zugehörigkeitsgefühl von Herrn M. aus und verstärkten ein Gefühl der sozialen Isolation. Einzig Herr C. machte als Wissenschaftler in der Zusammenarbeit mit Kollegen andere Erfahrungen. Er sagt: „Wissenschaftler sind es gewohnt, sich nicht unbedingt in ihrer Muttersprache auszudrücken, weil sie aus verschiedenen Ländern kommen. Insofern ist mein ‚visuelles Kommunikationsbedürfnis’ ‚nur’ eine weitere von vielen Sprachen.“ (C.). 79 10 Darstellung und Auswertung der Ergebnisse Im Beispiel von Frau P. zeigt sich ebenfalls, dass sich die Zusammenarbeit mit Kollegen auf das Zugehörigkeitsgefühl einer Person auswirkt. Frau P war Landesgeschäftsführerin eines gemeinnützigen Vereins der Kinder- und Jugendhilfe und erhielt nach der Ertaubung vom Vorstand das Verbot zu arbeiten. Damit wurde die gemeinsame Zusammenarbeit beendet und ein Zugehörigkeitsgefühl zu ihren Kollegen gab es nicht mehr, weil sie ausgeschlossen wurde. Keupp (2002, 129) legt in diesem Zusammenhang dar, dass Erwerbsarbeit nicht nur zentrale Erfahrungen von Anerkennung, sondern auch von Selbstverwirklichung bietet. Ich habe bereits an anderer Stelle erwähnt, dass sich Frau P. nach der Ertaubung beruflich neu orientierte. Die derzeitige Arbeit als Audiotherapeutin für hörgeschädigte Menschen gibt ihr Anerkennung. Sie berichtet selbst: Ich fühle mich frei und anerkannt bei der Arbeit. Vor allem bin ich selbstbestimmt. Daher auch meine Entscheidung: lieber einen neuen Beruf anfangen und wenig […] Geld verdienen, als das Angebot zur Frühberentung annehmen.“ (P.). In ihrer alltäglichen Identitätsarbeit gestaltet Frau P. ihr Arbeitsverhältnis in eine Richtung, die ihr Möglichkeiten der Selbstverwirklichung und Handlungsfähigkeit verschafft. Ferner wird im Modell der Identitätsarbeit davon ausgegangen, dass z.B. berufliche Teilidentitäten die für eine bestimmte Lebensphase gültigen „Standards“ enthalten (vgl. Kapitel 4.3.2.2). Unter dem Begriff „Standard“ verstehen die Autoren ein Set von Bedeutungen, die Personen entwerfen und die definieren, wer man glaubt zu sein. Frau P. trifft bezüglich des sozialen Standards ihrer beruflichen Teilidentität folgende Aussage: „Im beruflichen Bereich und in der politischen Arbeit werde ich sicher als stark und selbstbewusst und fachlich kompetent wahrgenommen.“ (P.). Die berufliche Teilidentität von Herrn C. drückt sich vor allem durch den emotionalen Standard aus. In seinem persönlichen Bewältigungsstreben beendete er trotz bzw. mit der Taubheit seine Promotion. Er selbst schildert, dass sich dieser Umstand positiv auf sein Selbstwertgefühl auswirkte. Die soziale Position eines Menschen in der Gesellschaft wird u.a. durch die Teilhabe an Erwerbsarbeit und dem damit verbundenem Einkommen bestimmt (vgl. Keupp 2002, 129). An dieser Stelle verweise ich erneut auf das Beispiel von Frau P., die äußerte, dass sie lieber eine neue berufliche Tätigkeit begann, anstatt das Angebot zur Frühberentung anzunehmen. Mit ihrer Aussage hebt Frau P. die Bedeutung der Erwerbsbiographie für das persönliche Selbstverständnis hervor. Keupp (2002, 129) postuliert, dass es die spezifische Form von sozialer Zugehörigkeit und 80 10 Darstellung und Auswertung der Ergebnisse Einbindung ist, die über die Arbeit vermittelt wird. In diesem Zusammenhang stellt sich Herr M. die Frage: „Ich habe verstanden, daß [sic] es schwierig ist in meinem Beruf weiterzuarbeiten […]. Da die Firma aber offensichtlich kein Interesse mehr an mir hatte, frage ich mich schon, was das soll. Denn ich bin doch ‚nur’ ertaubt (vgl. und nicht verblödet).“ (M.). Anhand dieser Aussage wird deutlich, dass die Abwesenheit von Erwerbsarbeit einen Verlust an persönlichem Sinn und sozialer Einbindung ausdrückt, die sich in psychosozialer Belastung äußert. Die berufliche Identität ist für Herrn M. aufgrund der Berentung weggefallen. Angesichts einer zunehmenden Verknappung von Arbeit ist es für Herrn M. ausgeschlossen, „noch einmal einen meiner Behinderung entsprechenden Arbeitsplatz zu finden“ (M.). Auch für Herrn A. ist eine berufliche Neuorientierung nicht möglich. Er berichtet selbst: „Eine berufliche Um- oder Neuorientierung kommt aus Alters- und Gesundheitsgründen nicht in Betracht. Berufliche Wünsche oder Ziele habe ich keine mehr, nach zweimaliger Beförderung ist für mich der Endpunkt der Karriere erreicht. Führungspositionen können von mir auf Grund der Ertaubung nicht ausgeübt werden. Ohne Telephon [sic], Besprechungen und Dienstreisen sind die nicht zu bewältigen. Es hat deshalb keinen Sinn, hier noch Ehrgeiz zu entwickeln. Ich bin beruflich zufrieden, aber die Erfüllung, die mir diese Arbeit einmal bereitet hat, ist nicht mehr gegeben.“ (A.). Herr A. verweist in diesem Zitat auf die Einschränkungen der kommunikativen Kompetenz und die daraus resultierende Relativierung seiner beruflichen Ziele. Für die Identitätsarbeit von Herrn C. ergaben sich ähnliche Auswirkungen auf seine Arbeitsorientierung. In Bezug auf seine beruflichen Ziele sagt er: „Meine beruflichen Ziele habe ich relativiert: Langfristige Planungen bringen nichts […]. Um nach ‚ganz oben’ zu kommen, benötigt man ‚Vitamin B’ (Beziehungen, Protegierung etc.). Als Spätertaubter ist es schwieriger, dies ‚anzusammeln’. Das heißt nicht, dass ich es nicht versuche.“ (C.). Herr C. weist mit seiner Aussage noch auf einen weiteren Sachverhalt des Berufslebens hin u.z. auf die „Destandardisierung der Erwerbsbiographie“ (Keupp 2002, 128). Die normale Berufsbiographie als Grundlage einer festen Berufsidentität ist in der heutigen Gesellschaft kaum noch gegeben. Identitätstheoretisch zeigen sich immer mehr nicht lineare Prozessverläufe, in denen die Arbeitsidentität durch mittelfristige Projekte umschrieben wird (vgl. 2002, 128). 81 10 Darstellung und Auswertung der Ergebnisse Herr C. erläutert in diesem Zusammenhang: „Bezogen auf Zukunftspläne hat sich eine gewisse Gelassenheit breit gemacht, da man die Erfahrung machen musste, dass die besten Pläne nur so lange etwas taugen, bis es zum nächsten drastischen Einschnitt kommt. Die Hoffnung auf eine Dauerstelle teile ich natürlich auch, sehe sie aber als eher gering an. Hier werden meiner Meinung nach die schon vorhandenen Probleme der ‚Wissenschaftslandschaft’ in Deutschland durch meine Ertaubung noch verschärft.“ (C.). Thiersch (2004, 33) insistiert in Bezug auf die gesamtgesellschaftlichen Verhältnisse, dass die Perspektivität in der heutigen Gesellschaft schwierig geworden ist, weil die Gegenwart angesichts der Offenheit von Zukunft ein eigenständiges Gewicht gewinnt. Ausgehend von den gesellschaftlichen Bedingungen der Moderne stellt sich die berufliche Identität von spätertaubten Menschen in nicht linearen Prozessverläufen dar. Zusammenfassend halte ich fest, dass für die Erwerbsarbeit einer spätertaubten Person oftmals nicht das Ausmaß des Hörverlustes, sondern die Intensität der mit einer bestimmten Tätigkeit verbundenen Kommunikation entscheidend ist. Die Erwerbsarbeit als zentrales Lebensfeld der Identitätsarbeit formt das Selbstverständnis eines Menschen. In den einzelnen Interviews zeigte sich, dass aufgrund der Ertaubung die Zusammenarbeit mit Kollegen und Vorgesetzten in fast allen Fällen beeinträchtigt wurde. Die Gründe hierfür sind individuell verschieden und heben letztlich doch einen zentralen Aspekt hervor u.z. dass die Erwerbsarbeit für die Identitätsarbeit eines Individuums die zentralen Erfahrungen von Anerkennung und Zugehörigkeit vermittelt. Infolgedessen stellt die Abwesenheit von Arbeit einen Verlust an persönlichem Sinn und sozialer Einbindung dar. Im Zuge der derzeitigen Arbeitsmarktsituation, die einhergeht mit der Verknappung von Arbeitsplätzen, bleibt die Erwerbsarbeit trotzdem zentrales Merkmal der Normalbiographie eines Individuums. Keupp (2002, 129) legt dar, dass gerade mit und wegen der Verknappung von Arbeit ihre Bedeutung für die Identitätsentwicklung einer Person wächst. Letztlich ist die Identitätsarbeit der Interviewpartner, sofern dies Umwelteinflüsse zuließen, durch die Gestaltung der Arbeitsverhältnisse geprägt, in denen die Möglichkeiten von Selbstverwirklichung und Handlungsfähigkeit erweitert werden können. Beispielsweise wurde Herr A. im Rahmen der beruflichen Rehabilitation mit einem Computer ausgestattet und im Umgang damit geschult. Folglich war es für ihn möglich auf elektronischem Weg mit Kollegen aus anderen Abteilungen und Mitarbeitern aus anderen Behörden per E-Mail zu kommunizieren und seine Handlungsfä- 82 10 Darstellung und Auswertung der Ergebnisse higkeit zu erweitern. Frau A. konnte sich durch ihre berufliche Neuorientierung zur Audiotherapeutin selbst verwirklichen. 10.3.2 Die Auswirkungen der Ertaubung auf die Partnerschaft und Familie Es ist davon auszugehen, dass eine Hörschädigung nicht nur das Individuum, sondern auch die Rahmenbedingungen des mikrosozialen Umfeldes betrifft. Partnerschaft und Familie gehören zu den zentralen Kategorien des Erwachsenenalters und stellen einen signifikanten Ausschnitt der Lebenswelt erwachsener Menschen dar. Die identitätsrelevante Erfahrung des Hörverlustes und die daraus resultierenden Kommunikationserfordernisse führen zu einer Veränderung der partnerschaftlichen Beziehung (vgl. Jones 1991, 187). Demnach ist eine Neuorganisation der Interaktionsformen im betroffenen Person-Umwelt-System erforderlich. Unter Bezugnahme des Modells von Haußer zur prozesshaften Verarbeitung von Lebenserfahrungen ist davon auszugehen, dass die interne Kongruenz einer Lebensgemeinschaft durch neuerliche wechselseitige Anpassungsprozesse wieder hergestellt werden muss, um ein subjektiv empfundenes Passungsverhältnis unter den veränderten Kommunikationsbedingungen zu erreichen (vgl. Kapitel 4.3.2.2). Herr C., Herr M. und Frau P. lebten bereits vor der Ertaubung in einer ehelichen Lebensgemeinschaft. Herr C. und seine Frau integrierten die kommunikativen Beeinträchtigungen der Ertaubung in ihre Partnerschaft folgendermaßen: „In der alltäglichen Situation wird versucht eine Arbeitsteilung zu etablieren. Jene Dinge, die unbedingt die Fähigkeit zu hören voraussetzen, werden vom hörenden Partner erledigt (Telefonate etc.). Was ohne Hören geht, versucht der ertaubte Partner zu erledigen (Briefe schreiben, Informationen sammeln soweit das über das Internet geht etc.).“ (C.). In ihrer gemeinsamen Kommunikation und Interaktion konnten sich Herr C. und seine Partnerin den veränderten Perzeptionsbedingungen anpassen und verwenden hauptsächlich lautsprachbegleitende Gebärden. Auch die Familie von Frau P. veränderte ihre Kommunikationstechniken. Die Kinder erlernten das Fingeralphabet und Frau P. berichtet, dass ihre Söhne sehr viel deutlicher als andere Menschen artikulieren. Herr M. schildert, dass sich seine Frau schnell an die veränderte Situation anpassen konnte. Ich schlussfolgere daraus, dass die interviewten Personen, gemäß dem dargestellten Regulationsmodell von Haußer, emotionale und soziale Ressourcen für ihre alltägliche Identitätsarbeit mobilisierten, um die identitätsrelevante Erfahrung des Hörverlustes zu bewältigen. 83 10 Darstellung und Auswertung der Ergebnisse Herr A. ist ledig und in seiner Auseinandersetzung mit dem Hörverlust zeigt sich besonders die emotionale Ebene des Identitätsprozesses. Die emotionale Ebene bezieht sich auf das Selbstwertgefühl der Person. In diesem Zusammenhang berichtet Herr A. von seinem Leben ohne Partnerschaft: „In einem Punkt hat mein Selbstwertgefühl […] gelitten, und hier mußte [sic] ich mein Lebensziel der Realität anpassen: Ich habe den Gedanken an eine Partnerschaft bzw. Familie aufgegeben. Ich habe niemanden kennengelernt, der sich ein Leben mit mir zugetraut hätte. Die Befürchtung, eines Tages mehr pflegende Angehörige als Partnerin zu sein, war wohl doch größer als die stärkste Zuneigung. Und Sätze wie ‚Ein Leben mit dir würde mich überfordern’ machen nicht dickfelliger, sondern dünnhäutiger. Es hat immer lange gedauert, bis ich so etwas überwunden habe und heute tue ich mir das nicht mehr an. Und das nagt schon am Selbstwertgefühl.“ (A.). Unter Bezugnahme des Modells der Identitätsarbeit lässt sich festhalten, dass das Selbstwertgefühl durch die Verdichtung von biographischen Erfahrungen auf der Ebene zunehmender Generalisierung der Selbstthematisierung entsteht (vgl. Kapitel 4.3.2.3). Die motivationale Ebene des Anpassungsprozesses einer identitätsrelevanten Erfahrung umfasst die Handlungsseite der Identitätsarbeit und äußert sich in bestätigendem Sinn durch neues informationssuchendes Verhalten oder in Abwehmechanismen, die zu Distanz und vermeidendem Verhalten führen können. Die motivationale Ebene wurde in den Interviews u.a. durch die gemeinsamen Aktivitäten in der Partnerschaft hervorgehoben. Beispielsweise erzählt Herr M.: „Freizeit verplane ich mehr oder weniger. Und weil ich nicht´s mehr mit der Akustik am Hut habe, möchte ich noch viel sehen. Jeder Urlaub ist in dieser Richtung angelegt. Wir haben einen kleinen Wohnwagen und sind dadurch natürlich für uns selbst unterwegs. Probleme am Flugzeugschalter usw. kenne ich daher nicht. Wenn ich mal mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs bin, ist das schon anstrengend genug.“ (M.). Folglich konnten Herr M. und seine Frau eine Bewältigungsstrategie für sich finden, in der die Taubheit für ihre Freizeitaktivitäten nicht relevant ist und Herr M. sich in seiner Handlungskompetenz nicht durch mögliche kommunikative Störungen eingeschränkt fühlt. Frau P. berichtet bezüglich ihrer Freizeitaktivitäten seit dem Hörverlust: „Inzwischen […] ist es so, dass ich […] bei kulturellen Dingen das eine oder andere ausprobiere, hin und wieder Frust und hin und wieder Freude erlebe.“ (P.). Aus dieser Aussage lese ich heraus, dass die motivationale Ebene der Identitätsarbeit von Frau P. durch neues, informationssuchendes Verhalten geprägt ist und sich den 84 10 Darstellung und Auswertung der Ergebnisse veränderten akustischen Wahrnehmungsbedingungen anpasst. Herr C. verhält sich ähnlich und berichtet, dass er seine Kinobesuche an die Hörminderung angepasst hat und seit der Ertaubung Filme mit Untertitel anschaut. Herr C. lebt in einer Großstadt und kann nach eigener Aussage zwischen dem reichhaltigen kulturellen Angebot an Originalfilmen mit Untertitel wählen. Werner Richtberg (1991, 83) hebt in seiner Analyse zu den Auswirkungen einer Spätertaubung auf das Familiensystem noch einen weiteren Aspekt hervor. Die Partner oder Familienangehörigen nehmen vor dem Hintergrund von konfliktbelasteten Differenzerlebnissen zur eigenen früheren Normalität in beruflichen und privaten Lebenswelten oftmals eine stützende und helfende Rolle ein, um die kommunikativen Defizite auszugleichen. Herr M. sagt dazu folgendes: „Telefonate mit Behörden erledigt meine Gattin. Bei Arztbesuchen ist auch meine Frau meistens dabei, aber da ist es so das [sic] mit meiner Frau über mich geredet wird, weil sich niemand die Zeit nimmt mit mir langsam zu sprechen.“ (M.). Aus dem Streben nach Normalisierung und Handlungsfähigkeit heraus, nutzt Herr M. seitdem ein Buch für Kommunikationssituationen, in dem Ärzte oder andere "öffentliche" Personen ihre Mitteilungen stichpunktartig für ihn notieren können. Damit stellt Herr M. einerseits seine subjektive Handlungskompetenz wiederher, andererseits versucht er durch die wiedererlangte Selbständigkeit seine Frau in ihrer „Dolmetscherrolle“ zu entlasten. Die Entlastung seiner Frau ist für Herrn M. in der Partnerschaft sehr wichtig und fördert die Konstruktion eines positiven Selbstwertgefühls. Hierzu berichtet er: „Ich sorge dafür, das [sic] sie sich auch Freiraum für sich läßt [sic] und sich nicht zu sehr in meine ‚Pflege’ vertieft. z.B. Bringe ich ihr aus der Bibliothek Bücher mit, die sie dann auch liest. Dazu hat sie sich früher nie die Zeit genommen. Es gibt mir ein gutes Selbstwertgefühl für meine Frau etwas Gutes zu tun. Auch kleine Dienste für die Familie bewirken Gutes in mir.“ (M.). Frau P. beschreibt in ihrem persönlichen Erleben ein ähnliches Bewältigungshandeln: „Ich habe von Anfang an darauf geachtet, so viel wie möglich selber zu machen (vgl. bin zum Arzt hingefahren zum Termin vereinbaren statt anrufen zu lassen). Alles was anfangs über meinen Kopf hinweg geschah, hat mich sehr wütend gemacht, ich war immer selbständig [sic], beruflich in leitender Position.“ (P.). Diese Bewältigungsstrategie zeigte Frau P. auch im Umgang mit ihren Kindern, die damals 10 und 12 Jahre alt waren. Sie erzählt, dass es ihr wichtig war, den Kontakt mit 85 10 Darstellung und Auswertung der Ergebnisse den Schulen zu halten und Gespräche mit den Lehrern zu führen, trotz der erschwerten Kommunikation und obwohl sie zunächst für schulische Belange, wie Vokabeln abhören und Elternabende, ausfiel. Inzwischen besitzt Frau P. ein CI und kann nahezu alle Aufgaben des Alltags selbstständig erledigen. Zusammenfassend halte ich fest, dass eine partnerschaftliche Beziehung nur positiv an die Veränderungen durch die Hörminderung angepasst werden kann, wenn beide Partner dies wünschen. Als Tutorin für hörgeschädigte Menschen betont Jesley Jones (1991, 187), dass die Bereitschaft visuelle Kommunikationstechniken zu erlernen und den Partner während der biographischen Krise zu unterstützen, voraussetzt, dass beide Partner schon vor der Ertaubung eine gute Kommunikation führten. Für die alltägliche Identitätsarbeit benötigen Menschen vor allem emotionale und soziale Ressourcen, um die biographische Krise des Hörverlustes zu bewältigen. In diesem Zusammenhang sind die soziale Einbindung und der soziale Rückhalt einer Person für ein stimmiges Identitätsgefühl entscheidend (vgl. Kapitel 6.3.2). Abschließend möchte ich dazu auf ein Zitat von Herrn M. verweisen: „Bewährt hat sich meine Familie, vor allem meine Frau. Ohne diese Erkenntnis wäre ich schon längst den Bach runtergegangen.“ (M.). 10.3.3 Die Auswirkungen der Ertaubung auf die sozialen Netzwerke Jedes Individuum lebt mit einer sozialen Umwelt, d.h. Personen stehen mit anderen Menschen im Kontakt, zu denen soziale Beziehungen aufgebaut werden und die das soziale Netzwerk der Person gestalten. Gemäß Keupp braucht die Identitätsarbeit einer Person soziale Netzwerke (vgl. Kapitel 4.3.5). In meiner sozialpsychologischen Betrachtung zur Identitätsarbeit habe ich dargelegt, dass die sozialen Netzwerke u.a. ein Fundament an Ressourcen zur Bewältigung von Belastungssituationen zur Verfügung stellen. Das Ziel der Identitätsarbeit besteht in einem Passungsverhältnis zwischen der Person und ihrer sozialen Umwelt. Die sozialen Netzwerke meiner Interviewpartner waren bis zur Ertaubung durch Kontakte mit hörenden Menschen strukturiert. Frau P. gibt an, dass sie bis zum Zeitpunkt der Ertaubung keine anderen spätertaubten Menschen kannte. Sie sagt: „Durch die Ertaubung habe ich natürlich mehr Nähe zu GL [Gehörlosen] und Ertaubten bekommen - das war früher für mich nicht denkbar - nicht aus irgendeiner Absicht, sondern weil es keinen Anlass gegeben hätte.“ (P.). 86 10 Darstellung und Auswertung der Ergebnisse Aus den Biographien der anderen Interviewteilnehmer lese ich ähnliche Erkenntnisse heraus. Im Gegensatz zu prälingual hörgeschädigten Menschen haben spätertaubte Menschen i.d.R. keinen Bekanntenkreis von anderen hörgeschädigten Personen, mit denen eine uneingeschränkte Kommunikation möglich wäre (vgl. Fengler 1990, 51). Die persönlichen Erfahrungen meiner Interviewteilnehmer unterstreichen diese Annahme. Für Herrn M. haben sich seit der Ertaubung signifikante Veränderungen in seinem sozialen Netzwerk ergeben. Er berichtet über die kommunikative Situation: „Zum Teil wird nur noch mit meiner Frau geredet, in der Annahme, das [sic] sie mir später alles erzählt. Dem ist aber nicht immer so. Ich werde eigentlich nie persönlich angesprochen. Und ich habe auch nicht mehr die Nerven dazu, ständig an alle in der Runde zu appellieren: sprecht bitte langsam usw..“ (M.). In diesem Zusammenhang habe ich in Kapitel 4.3.5 erörtert, dass die Verwendung eines homogenen Sprachsystems signifikante Voraussetzung für die soziale Interaktion ist. In Bezug auf eine Hörschädigung kann von einer Inkongruenz der Kommunikationsbedingungen ausgegangen werden, die eine spätertaubte Person in Gruppengesprächen mit dem Lippenabsehen nicht ausgleichen kann (vgl. Kapitel 3.4). Für eine gelingende Kommunikation sind die Interaktionspartner in den sozialen Netzwerken aufgefordert, ihre Kommunikationstechniken den visuellen Bedingungen der spätertaubten Person anzugleichen. Das setzt eine Bereitschaft von Seiten der Interaktionspartner voraus. Hierzu berichtet Herr C. aus seiner persönlichen Erfahrung: „Zum Thema Freundschaften und Zugehörigkeit kann ich sagen, dass die Quantität der Freundschaften abgenommen hat, weil einige nicht bereit waren, sich auf die veränderten Kommunikationsbedürfnisse einzustellen. Dafür hat sich die Intensität und Qualität der verbliebenen Freundschaften verstärkt.“ (C.). Frau P. hat ähnliche Erlebnisse in ihrem sozialen Netzwerk gesammelt und schildert: „Private Kontakte, die nicht per Fax, E-Mail, Besuche etc. realisiert werden konnten, weil diese Leute meine Situation nicht verstanden, habe ich abgebrochen. Allerdings haben auch viele liebe Menschen ein Fax oder E-Mail angeschafft um mit mir zu kommunizieren.“ (P.). Nachdem Herr A. seine Freunde über den Hörverlust informierte, veränderten sich seine sozialen Kontakte folgendermaßen: „Bei manchen endete der Kontakt sofort, weil sie schlicht nicht mit der neuen Situation umgehen konnten und auf meinen Brief geschwiegen haben. Andere bekundeten zwar, weiterhin mit mir in Kontakt bleiben zu wollen, brachten aber letztlich nicht die nötige Kraft dafür auf. Die Zeit zwischen den Treffen wurde 87 10 Darstellung und Auswertung der Ergebnisse üblicherweise per Telephon [sic] überbrückt, und das ging nun nicht mehr. Zum Briefschreiben fehlte andererseits der Antrieb, eine Briefkultur haben wir nicht mehr, und 1994/95 war das Internet noch nicht selbstverständlich. Der Kontakt war auch hier trotz anfänglich guten Willens schnell eingeschlafen.“ (A.). Im Sinne des Modells der Identitätsarbeit kumulieren die verschiedenen Selbstwahrnehmungen des Individuums zu einem situationalen Gesamteindruck und werden in der Biographie der Person abgespeichert. Dabei wirken sich die gemachten Erfahrungen auf die Zugehörigkeit und das Identitätsgefühl von sozialer Anerkennung aus (vgl. Kapitel 4.3.2.3). Im Zusammenhang mit seinen kognitiven und emotionalen Selbstwahrnehmungen berichtet Herr M.: „Ich meine, ich gehöre nicht dazu. Mein Freund (Musiker) ist sehr auf Akustik angewiesen, für ihn ist eine Welt zusammengebrochen, als er von meiner Ertaubung erfuhr. […] Unsere langjährige Freundin hat sich auch ziemlich zurückgezogen. Die Kontakte beschränken sich nur noch auf Geburtstagsbesuche und die werden freundlicherweise nach den eigentlichen Geburtstagsfeiern gelegt, das [sic] ich also auch mal was sagen kann und vor allem auch was verstehe. Ich denke, ich werde als ‚Krüppel’ (vor allem von meinem Musikerfreund) angesehen, den man meiden muß [sic], weil der ja sowieso nichts versteht. Nach der Devise: ‚Warum soll ich mich mit dem abgeben, wenn es schwierig ist mit ihm zu kommunizieren’." (M.). Die sozialen Selbstwahrnehmungen von Herrn C. beziehen sich auf folgende Erfahrungen in seinem sozialen Netzwerk: „Wichtig ist meiner Erfahrung nach, dass man Rücksicht aufeinander nimmt. Das beruht aber auf Gegenseitigkeit. Die Freunde stellen sich auf die geänderte Kommunikationstechnik ein. Diese ist aber durchaus auch anstrengend für sie, so dass im Laufe eines Abends auch mal ‚Pausen’ in der Kommunikation mit mir nötig sind. Meine Freunde versuchen mich so normal wie möglich zu behandeln. Da ist irgendwie kein ‚Mitleid’ spürbar im Sinne von ‚Der Arme!’, sondern eher ein gewisser Pragmatismus: ‚Der hört nix! Wie verständige ich mich mit ihm?’.“ (C.). Diese Erfahrungen beeinflussen sein persönliches Gefühl von sozialer Anerkennung und Zugehörigkeit, so dass Herr C. selbst sagt: „Ich habe nicht das Gefühl von meinen Freunden irgendwie ausgeschlossen zu werden oder nicht dazu zu gehören.“ (C.). In Kapitel 4.3.1 habe ich erörtert, dass Identitätsarbeit die Verknüpfung lebensweltlicher Erfahrungen eines Individuums beschreibt. Dabei werden die situationalen Selbstthematisierungen u.a. entlang biographischer Etappen geordnet. Folglich beeinflusst die Sozialisation des Erwachsenenalters ebenso die Identitätsarbeit eines Menschen wie ein 88 10 Darstellung und Auswertung der Ergebnisse identitätsrelevantes Lebensereignis und kann sich auf die Strukturierung von sozialen Beziehungen auswirken. In diesem Zusammenhang berichtet Herr A. aus seinem Freundeskreis: „Hinzu kommt, daß [sic] man sich wegen der unterschiedlichen Lebensentwürfe auseinanderlebte [sic]. Sie hatten geheiratet, die meisten von ihnen haben Kinder, etliche ein Haus gebaut. Das gibt es alles nicht in meinem Leben. Es fehlte letztlich an einer ausreichenden Zahl von Gemeinsamkeiten.“ (A.). Anhand dieser Aussage wird noch ein weiterer Aspekt von Identität deutlich, den ich in Kapitel 4.1 beschrieben habe, u.z. dass Identität immer ein Relationsbegriff ist. Haußer postuliert in seiner Analyse, dass sich Identität durch den Vergleich zu etwas anderem bestimmt. Indem sich Herr A. mit seinen Freunden vergleicht, geht er der Identitätsfrage nach: „Wie sehe ich mich im Vergleich zu den anderen?“. Aufgrund der Erlebnisse mit dem früheren sozialen Netzwerk haben sich in den Biographien meiner Interviewpartner nach der Ertaubung neue Kontakte und Freundschaften ergeben. Folglich gestaltet die Identitätsarbeit von Individuen auch soziale Netzwerke, indem Personen Netzwerkbeziehungen herstellen und sich in Beziehung zu anderen Individuen setzen (vgl. Kapitel 4.3.5). Frau P. berichtet von ihren neuen Kontakten seit der Ertaubung: „[…] es haben sich viele neue Beziehungen mit anderen Hörgeschädigten ergeben. Es gibt einen sehr kleinen Kreis intellektueller /akademischer bzw. künstlerischer Hörgeschädigter […], die ich als meinen Freundeskreis bezeichnen würde, dem ich mich zugehörig fühle.“ (P.). Herr A., der wegen einer zusätzlichen Sehbehinderung in seiner Kommunikation und Mobilität eingeschränkt ist, pflegt seine sozialen Kontakte vorwiegend über das Internet. Nachdem Herr A. in seiner beruflichen Tätigkeit mit einem Computer und Internetanschluss ausgestattet wurde, beschreibt er seine Erfahrungen folgendermaßen: „Hin und wieder surfte ich dann in der Mittagspause durch das Netz und sah, was es so alles an Seiten und Diskussionsforen für Behinderte gibt. Ich habe mich dann auch privat damit ausgestattet und merkte sehr schnell, dass [sic] dies für Behinderte ein nicht zu unterschätzendes Medium ist. […] Ich vermeide weitgehend Veranstaltungen, bei denen ich mir meine Ausgrenzung selbst vorführe, pflege meine […] Internet-Kontakte, bei denen sie [Taubheit] kaum eine Rolle spielt. Andere Betroffene und überhaupt Menschen mit gleichen Interessen findet man nur über das Internet, vor allem, wenn Kommunikation und Mobilität so eingeschränkt sind wie bei mir.“ (A.). 89 10 Darstellung und Auswertung der Ergebnisse In der heutigen Technologiegesellschaft ist das Internet ein zentrales Informations- und Kommunikationssystem. Die Bedeutung des Internets für das soziale Netzwerk hebt Herr C. hervor, indem er sagt: „[…] E-Mail, Chat- und Talkprogramme: Dies ist die wesentliche Kommunikationsform am Arbeitsplatz und die häufigste für die Kommunikation mit Freunden.“ (C.). Göser (2001, 78) stellt in ihrer empirischen Studie zu den Auswirkungen des Internets auf die Identitätsarbeit von hörgeschädigten Menschen fest, dass die Mehrzahl der aktiven Internetbenutzer neue Kontakte bei der Benutzung eines „Chat-rooms“ knüpfen und Beziehungen aufbauen. In diesem Rahmen spielt die Hörminderung für die zwischenmenschliche Kommunikation eine untergeordnete Rolle und es kann davon ausgegangen werden, dass spätertaubte Menschen bei der Nutzung des Internets in ihrer kommunikativen Kompetenz nicht beeinträchtigt sind. Ferner hebt Göser (2001, 83) hervor, dass sich die sozialen Netzwerke einer hörgeschädigten Person durch das Internet verändern. Die Homogenität der sozialen Netzwerke in Bezug auf Neigungs- und Interessenlage nimmt zu, weil gezielt Personen mit gleichem Fokus gesucht werden können, wie z.B. andere betroffene spätertaubte Personen (vgl. Göser 2001, 83). An dieser Stelle verweise ich nochmals auf die Aussage von Herrn A., der feststellt: „Für Spätertaubte gibt es nämlich im Unterschied zu Gehörlosen und Schwerhörigen keine Vereine. Andere Betroffene und überhaupt Menschen mit gleichen Interessen findet man dann nur über das Internet.“ (A.). Die Bedeutung des Internets für die sozialen Beziehungen und Netzwerke von spätertaubten Personen wurde in jedem Interview deutlich hervorgehoben. Gemäß Göser (2001, 84) kann davon ausgegangen werden, dass die Transformation der „Face-toface“ Kommunikationssituation zu neuen situationalen Selbstthematisierungen innerhalb der Identitätsarbeit führt, die auf Anerkennung und sozialer Zugehörigkeit beruhen. Infolgedessen wirkt sich die virtuelle Kommunikation auf die Selbstnarration eines Individuums aus und beeinflusst wiederum die Metaidentität der betreffenden Person. In allen Interviews wurde die signifikante Bedeutung des Internets für die Aufrechterhaltung und Neustrukturierung der sozialen Netzwerke der befragten Person hervorgehoben. Auf dieser Grundlage ergeben sich weitere Fragen im Zusammenhang mit der Identitätsarbeit von spätertaubten Menschen, die Anregungen für kommende Untersuchungen bilden können. 90 10 Darstellung und Auswertung der Ergebnisse 10.3.4 Die Auswirkungen der Ertaubung auf die kulturelle Zugehörigkeit Soziale Netzwerke stellen nicht nur Interaktionsgemeinschaften dar, sondern vermitteln auch kulturelle Werte, Orientierungen und Einstellungen. In Kapitel 4.3.6 habe ich erörtert, dass sich aus dem Zugehörigkeitsgefühl zu einer bestimmten Gruppe eine kulturelle (Teil-)Identität ausformt. Im Rahmen der vorliegenden empirischen Untersuchung bin ich der Frage nachgegangen, ob sich spätertaubte Menschen eher der hörenden Kultur oder der Gehörlosenkultur zugehörig fühlen. In diesem Zusammenhang interessierte es mich, inwiefern die Gebärdensprachgemeinschaft ein eminentes soziales Netzwerk für spätertaubte Menschen darstellt, in der sie ihre kulturelle (Teil-)Identität formen. Herr A. stellt fest, dass er sich eindeutig der hörenden Kultur zugehörig fühlt und benennt dabei die Sprache als signifikantes Kriterium für seine Identifikation. Er sagt selbst: „Das liegt vor allem daran, daß [sic] ich stark von meiner Sprache geprägt bin, als Spätertaubter bin ich hörend aufgewachsen und als Absolvent eines geisteswissenschaftlichen Studiums bin ich schriftkompetent. Die Laut- und Schriftsprache ist das Medium, in dem ich mich ausdrücke und in dem ich meinen Beruf ausübe.“ (A.). Unter Bezug auf Ebbinghaus und Heßmann habe ich in Kapitel 5.2 darauf hingewiesen, dass die Sprache das zentrale Instrument zur Aneignung des Kulturgutes der Gemeinschaft ist. Gleichzeitig wird Sprache im Kontext von Kultur erlernt. Für Herrn C., Herrn M. und Frau P. war die Frage nach der kulturellen Zugehörigkeit schwierig zu beantworten. Hierzu äußert sich Frau P. folgendermaßen: „Zugehörigkeitsgefühl ist für mich sehr schwierig. Genau genommen fühle ich mich fast nirgends zugehörig. Kulturell gehöre ich auf jeden Fall in die hörende Kultur, falls man das überhaupt so sagen kann, vielleicht genauer: in die Schwerhörigen-Kultur. Aber ich habe auch gute Kontakte zu GL [Gehörlosen].“ (P.). Trotz der kommunikativen Einschränkungen durch den Hörverlust und der möglichen Exklusion aus der hörenden Kulturgemeinschaft, besitzt die hörende Gesellschaft für jeden Interviewpartner einen zentralen Stellenwert. Hierzu berichtet Herr C.: „Der hörenden Kultur fühle ich mich eigentlich noch zugehörig, weil sie mich geprägt hat und ich die meiste Zeit Kontakte zu Hörenden habe. Auf der anderen Seite kann nicht geleugnet werden, dass sich manchmal ein Gefühl der Ausgeschlossenheit einstellt. Dies ist in meinen Augen aber oft eher ein praktisches Problem.“ (C.). 91 10 Darstellung und Auswertung der Ergebnisse Frau P. hebt ebenfalls die Bedeutung der Kontakte mit hörenden Menschen hervor und schildert: „Für mich ist der Kontakt mit Hörenden - sowohl privat als auch fachlich beruflich aus vielen Gründen wichtig. Hörende erzählen mir vieles oder weisen mich auf interessante Dinge (Filme, Ausstellungen...) hin.“ (P.). Im Rahmen der vorliegenden Arbeit bin ich davon ausgegangen, dass die Gebärdensprachgemeinschaft möglicherweise ein soziales Netzwerk für eine ertaubte Person darstellt und eine kulturelle Identität bietet. Diese Vermutung konnte in den Interviews nicht bestätigt werden. Herr C. beschreibt: „Der Gehörlosengemeinschaft fühle ich mich nicht zugehörig. Das liegt zum einen daran, dass die DGS für mich nicht die Muttersprache ist. Zum anderen habe ich den Eindruck gewonnen, dass in der GL-Gemeinschaft [GehörlosenGemeinschaft] Taubheit anders wahrgenommen wird. Für mich ist Taubheit eine Behinderung mit der ich so gut wie möglich zu leben versuche. Dies wird, wie ich erfahren musste, in der GL-Gemeinschaft zum Teil anders gesehen.“ (C.). In ihrem persönlichen Erleben berichtet Frau P. bezüglich ihres Zugehörigkeitsgefühls zur Gebärdensprachgemeinschaft: „Es ist […] nicht denkbar, mich in die GL-Kultur [Gehörlosenkultur] zu begeben (als Gast ja, aber nicht mit meiner Identität!), weil ich denke, dass ich dort mindestens ebenso Außenseiterin wäre wie in der hörenden Welt, wo ich immerhin steuernd Einfluss nehmen kann.“ (P.). Sowohl Herr C. als auch Frau P. verweisen darauf, dass es für prälingual gehörlose Menschen schwierig ist, die anthropologische Bedeutung des Hörens zu erfassen und die daraus entstehenden psychosozialen Auswirkungen der Verlustsituation sowie die kommunikativen Einschränkungen spätertaubter Menschen nachzuvollziehen (vgl. Kapitel 2.2.3). In diesem Zusammenhang sagt Frau P.: „Die Probleme Spätertaubter verstehen zu können, ist für GL [Gehörlose] genau so schwierig wie für Hörende.“ (P.). Herr C. berichtet aus seinen persönlichen Erfahrungen in der Gebärdensprachgemeinschaft folgendes: „Hinzu kommt, dass ich die Kontakte zu Gehörlosen als wenig hilfreich empfunden habe […]. Auf meine konkreten Probleme nach der Ertaubung konnte oder wollte man nicht eingehen. Ich will nicht sagen, dass dies für alle Gehörlosen gilt, es hat sich nur seit dem kein weiterer Kontakt mehr ergeben.“ (C.). 92 10 Darstellung und Auswertung der Ergebnisse In Kapitel 5.2 habe ich dargelegt, dass die Gebärdensprachgemeinschaft als kulturelle Sprachgemeinschaft die Deutsche Gebärdensprache als Kommunikations- und Interaktionsmedium verwendet. Die Beherrschung der Gebärdensprache stellt das verbindende und Kultur kennzeichnende Merkmal für die Gemeinschaft dar, über die sich die Mitglieder mit ihrer sozialen Gruppe identifizieren. In meiner Analyse interessierte mich, inwiefern für spätertaubte Menschen eine Motivation darin besteht, die Gebärdensprache zu erlernen. In diesem Zusammenhang stellt Frau P. fest: „Ich habe mich mit DGS beschäftigt, weil ich schon früher viel mit Sprachen zu tun hatte (Erstausbildung als Übersetzerin) und für mich ist DGS eine schöne und interessante Fremdsprache. Ich glaube, dass es relativ schwer für Ertaubte ist, DGS zu lernen, wenn sie die Erklärungen nicht akustisch verstehen können.“ (P.). Herr C. hat sich ebenfalls persönlich mit der Gebärdensprache beschäftigt und zählt grundsätzliche Hindernisse auf, die sich für ihn bei der Erlernung und Verwendung von DGS als Kommunikationsmittel ergeben: „1. Wenn man ertaubt, stellt sich das Problem, eine neue Kommunikationsform zu finden praktisch von gestern auf heute. Das Erlernen der DGS dauert jedoch eine gewisse Zeit. 2. Es fehlt an entsprechenden Kursen und Kurskonzepten. Die, die ich erlebt habe, verfehlten meine Bedürfnisse und die meines Partners, der die Kurse mit mir zusammen besucht hat. Außerdem dauert es seine Zeit, bis man ein Niveau erreicht hat, das man für die Kommunikation nutzen kann. Intensivkurse wären besser, sind jedoch schwierig mit den Erfordernissen des Arbeitslebens in Einklang zu bringen. Außerdem stellt sich die Frage der Kostenübernahme. 3. Es genügt für Spätertaubte ja nicht, dass sie selbst die DGS können. Auch das Umfeld (Familie, Freunde, Kollegen) muss gewillt und in der Lage sein, sich zumindest Grundkenntnisse beizubringen.“ (C.). Für Herrn A. besteht ein anderes praktisches Problem bei der Aneignung der DG Infolge seiner Sehbehinderung ist es ihm nicht möglich die visuelle Sprache zu erlernen, so dass die Gebärdensprachgemeinschaft nie ein soziales Netzwerk für ihn darstellen wird. Er selbst sagt: „Bei meinen Schnupperbesuchen im hiesigen Gehörlosenverein fiel mir jedoch auf, daß [sic] man ohne die Gebärdensprache dort nicht als zugehörig angesehen wird. Und da ich diese Sprache wegen der Sehbehinderung nicht lernen kann, bleibt mir diese Welt letztlich verschlossen.“ (A.). 93 10 Darstellung und Auswertung der Ergebnisse Herr M. weist in seiner Aussage, vergleichbar zu Herrn C., auf einen zentralen Sachverhalt bei der Erlernung der DGS hin: „Um mich herum sind keine gebärdenden Leute und ich kenne auch keine. Eine neue komplette Sprache zu erlernen, die zu dem viel Übung erfordert und auch eine gewisse Beweglichkeit […] voraus setzt, ist auch nicht leicht in unserem Alter und ungeeignet, weil es meine Familie ebenso erlernen müßte [sic]. Welcher Hörende macht das schon, wenn es noch anders geht.“ (M.). Das soziale Netzwerk der spätertaubten Interviewteilnehmer ist u.a. durch ihr hörendes Familiensystem strukturiert. Die Benutzung der DGS als Kommunikations- und Interaktionsmedium setzt voraus, dass die hörenden Personen im sozialen Umfeld ebenso die DGS als Kommunikationsmittel verwenden. Herr M. schildert in seiner Aussage, dass keine Motivation für ihn besteht die DGS zu erlernen, weil andere manuelle Kommunikationssysteme zur Verständigung genutzt werden können. In diesem Zusammenhang stellte mir Frau P. in unserem Nachgespräch folgende Frage: „Mich würde mal interessieren, warum Sie sich auf DGS ausschließlich beziehen und nicht nach LBG fragen. Die meisten Spätertaubten ohne CI, die ich kenne (und das sind schon einige) benutzen LBG.“ (P.). Lautsprachbegleitende Gebärden scheinen für die Kommunikation spätertaubter Menschen einen signifikant höheren Stellenwert zu besitzen, als die DG LBG bietet spätertaubten Personen, die vor allem auf das Lippenabsehen angewiesen sind, eine zusätzliche Informationsquelle zur Entschlüsselung einer gesendeten Nachricht (vgl. Kapitel 5.4.1). Vorteilhaft bei der Erlernung von lautsprachbegleitenden Gebärden sind Kenntnisse der deutschen Grammatik, welche postlingual ertaubte Menschen aufgrund ihrer Lautsprach- und Schriftkompetenz besitzen. Folglich sind lautsprachbegleitende Gebärden für eine spätertaubte Person und ihr hörendes Familiensystem leichter zu erlernen als die DGS. Zusammenfassend halte ich fest, dass die Tatsache der physiologischen Hörschädigung eine ertaubte Person nicht automatisch zum Mitglied der Gebärdensprachgemeinschaft macht. Entscheidender als das medizinische Kriterium sind die Identifikation mit der Gruppe und die gebärdensprachliche Kompetenz (vgl. Kapitel 5.2). In ihrem persönlichen Erleben beschreiben die Interviewpartner, dass sie sich eher der hörenden Gemeinschaft als der Gebärdensprachgemeinschaft zugehörig fühlen. Ein zentraler Aspekt stellt in diesem Zusammenhang ihre eigene Sozialisation in der hörenden Kultur und Laut- 94 10 Darstellung und Auswertung der Ergebnisse sprachgemeinschaft dar. Die Deutsche Gebärdensprache, als Kultur kennzeichnendes Merkmal der Gebärdensprachgemeinschaft, ist eine Fremdsprache, deren Erlernung für die Interviewpartner mit erheblichen Hindernissen verbunden ist. Infolgedessen konnte in den Interviews nicht nachgewiesen werden, dass die befragten Personen eine kulturelle (Teil-)Identität als hörgeschädigte Person im Sinne des kulturellen Konzepts von Gehörlosigkeit entwickelten. Letztlich haben die Interviews aufgezeigt, dass die Frage nach der kulturellen (Teil-)Identität aufgrund der individuellen Exklusionserfahrungen, sowohl in der hörenden Gesellschaft als auch in der Gebärdensprachgemeinschaft, nicht eindeutig zu bestimmen war. Die zentrale Prämisse für das Modell der Identitätsarbeit besteht in der Annahme, dass Identität die Verknüpfungsarbeit lebensweltlicher Erfahrungen des Individuums darstellt. In dem Zusammenhang wird auch die Verbindung der Teilidentitäten in den jeweiligen Lebensfeldern von Arbeit, Partnerschaft, sozialen Netzwerken und Kultur betrachtet (vgl. Kapitel 4.3.1). Die einzelnen Identitätsvariablen, die gesellschaftliche Lebenswelten darstellen, zeigten eine narrative Verdichtung von situationalen Selbstthematisierungen und Teilidentitäten der alltäglichen Identitätsarbeit auf. In diesem Kontext wurde immer wieder der Zusammenhang zwischen kommunikativer Kompetenz und subjektiver Handlungsfähigkeit hervorgehoben. Aufbauend auf diesen Überlegungen und den Ergebnissen aus den individuellen Interviews werde ich mich im abschließenden Kapitel meiner empirischen Auswertung mit der Verknüpfung der Teilidentitäten meiner Interviewpartner zu einer Metaidentität beschäftigen. Dabei beziehe ich den prospektiven Anteil der Identitätsarbeit meiner Interviewpartner in die Auswertung mit ein. 10.3.5 Verknüpfung der Teilidentitäten zu einer Metaidentität Einleitend möchte ich kurz an die drei Bausteine der Metaidentität erinnern, die für die Konstruktion eines übergeordneten Identitätsbezuges relevant sind. Es handelt sich dabei um die Dominanz einer Teilidentität, um das Identitätsgefühl und die biographische Kernnarration des Individuums (vgl. Kapitel 4.3.2.3). Im Modell der Identitätsarbeit wird davon ausgegangen, dass sich die Identität eines Subjekts in der Interaktion entwickelt. Gemäß Krappmann und Mead ist Sprache das basale Medium, mit dem Individuen in Interaktion treten (vgl. Kapitel 4.2.2). Anhand eines Alltagsbeispiels von Herrn M. möchte ich eine situationale Selbsterfahrung seiner Lebenswelt skizzieren, die seine 95 10 Darstellung und Auswertung der Ergebnisse biographische Kernnarration widerspiegelt. Herr M. berichtet von einer Einkaufsituation folgendes: „Einkaufen ist nicht nur ein akustisches, sondern auch ein nervliches Problem. Es ist schon schwierig, wenn man am Wurststand beispielsweise 100g Wurst bestellt, falls man überhaupt mitbekommt, das [sic] man dran ist. (vgl. denn mindestens 3 Verkäuferinnen reden ständig irgendetwas) und dann die Rückfragen der Verkäuferin nicht versteht. Schnell entsteht der Eindruck, man läuft ja nicht ganz rund. Normalhörende können nicht verstehen, das [sic] man zwar ‚richtig’ sprechen kann aber nicht verstehen. Man steht also in der Welt doch alleine da, weil die Vorstellungskraft nicht ausreicht sich in meine Probleme reinzuversetzen [sic].“ (M.). Die kommunikative Kompetenz von Herrn M. ist in dem Beispiel eingeschränkt und die Grenze des Lippenabsehens als visuelles Kommunikationsmedium wird hervorgehoben. In Kapitel 3.3 habe ich erörtert, dass die beim Sprechen entstehenden Mundbilder individuell geprägt sind und sich je nach Sprecher unterscheiden. Darüber hinaus verhindern seitliches Wegdrehen des Kopfes, schnelles Sprechtempo oder ein abgedunkelter Raum jegliches Verstehen. Neben der erhöhten Konzentration kommt die kommunikative Unsicherheit hinzu, ob die Nachricht richtig verstanden wurde. Ferner sind anhand dieser situationalen Selbsterfahrung die einzelnen Arten der Selbstwahrnehmung deutlich geworden. Beispielsweise lässt sich die soziale Selbstwahrnehmung von Herrn M. in seiner Aussage: „Schnell entsteht der Eindruck, man läuft ja nicht ganz rund.“ wieder finden. Aktuelle subjektive Selbstthematisierungen vermischen sich mit früheren Erfahrungen und die narrative Konstruktion ermöglicht die Sortierung und Ordnung der identitätsrelevanten Ereignisse. Sie sind im Kontext der Biographie eines Subjekts eingebunden und beschreiben die individuelle Erfahrungswelt der Person (vgl. Kapitel 4.3.2.2). Herr M. hat Situationen dieser Art schon mehrmals erlebt und meidet sie aus diesem Grund. Situationale Selbsterfahrungen werden in ihrem Kerngehalt im Identitätsgefühl abgespeichert und Herr M. äußert sich bezüglich des Stellenwertes der Taubheit in seinem Leben folgendermaßen: „Die Taubheit spielt die Hauptrolle, insofern ich weiß, das [sic] ich nie wieder besser hören werde. Ich versuche damit klar zu kommen, weil ich tagtäglich damit konfrontiert bin.“ (M.). Analytisch betrachtet umfasst das Identitätsgefühl auch Bewertungen bezüglich der eigenen Alltagsbewältigung, die in biographischen Kernnarrationen münden. 96 10 Darstellung und Auswertung der Ergebnisse In der narrativen Verdichtung seines Selbstverständnisses schreibt Herr M.: „Unzufriedenheit kommt immer dann, wenn man das Gefühl hat zu nichts mehr gut zu sein. Ich würde gerne mal Billard spielen oder mal ein Bier trinken gehen, aber alleine ‚traue’ ich mich nicht. Angst vor Mißverständnissen [sic] in der Öffentlichkeit bewegt mich häufig dazu nur bekannte Wege zu beschreiten (dies ist symbolisch gemeint).“ (M.). Anhand dieser Aussage zeigt sich, dass sich die früheren Selbstthematisierungen auf das Selbstverständnis von Herrn M. auswirken und seine individuellen Erfahrungsmuster beeinflussen. Für ein stimmiges Identitätsgefühl benötigen Individuen soziale Anerkennung und Zugehörigkeit. Herr M. findet in seiner Familie die Bewältigungsressource, welche ihm sozialen Rückhalt bietet. Er selbst berichtet: „Bewährt hat sich meine Familie, vor allem meine Frau. Ohne diese Erkenntnis wäre ich schon längst den Bach runtergegangen.“ (M.). Die Selbstreflexion von Herrn A. stützt sich auf folgende lebensweltliche Erfahrungen, die in seinem Selbstkonzept kumulieren: „Bei einem gelassenen und selbstsicheren Auftritt mit dem sofortigen Hinweis auf die Gehörlosigkeit und die Bitte, Fragen und Bemerkungen aufzuschreiben, verkrampft die Situation gar nicht erst. Es läuft dann wirklich reibungslos, egal wo: Bahnhof, Einkauf, Buchhandlung, Arzt... Wenn ich diese Brücke baue, gibt es so gut wie keine Probleme und gelegentliche Mißverständnisse [sic] oder Nachfragen (vgl. es ist nicht jede Handschrift gleich gut zu lesen) werden dann genauso behandelt wie das akustische Mißverständnis [sic] eines Hörenden. Allerdings muss ICH dafür sorgen, daß [sic] das so ist.“ (A.). Die Selbstkundgabe in Interaktionsprozessen erleichtert Herrn A. die Kommunikationssituation. Dennoch ist es für Herrn A. wichtig, dass die Taubheit Teil seiner Identität bleibt und nicht zur Konstruktion von übergeordneten Identitätsbezügen führt. Die Relevanz der Taubheit in seiner Lebenswelt beschreibt er folgendermaßen: „Sie ist eine Tatsache, der ich nicht entgehen kann. Verdrängen läßt [sic] sie sich nicht, nicht mal eine Minute. Egal ob ich aus dem Haus gehe, den Fernseher einschalte, ein Buch lese… ich werde ständig mit dieser Tatsache konfrontiert. Ich muß [sic] deshalb aufpassen, daß [sic] sie nicht zum dominierenden Faktor in meinem Leben wird, also nicht mehr Raum einnimmt, als unbedingt notwendig […]. Dadurch vermeide ich, daß [sic] die Taubheit trotz der psychischen Belastung, die sie unbestreitbar ist, zu Depressionen führt.“ (A.). Herr A. stellt in der Selbstnarration fest, dass er mit seiner Person durchaus zufrieden ist. In Folge des kritischen Lebensereignisses hat sich vor allem seine Religiosität als 97 10 Darstellung und Auswertung der Ergebnisse identitätsrelevante Instanz herauskristallisiert, die seine Identitätsarbeit steuert. In seinem persönlichen Erleben beschreibt er: „Was mir am meisten dabei geholfen hat, dieses Leben anzunehmen, ist der Glaube. Ich habe selbst die Erfahrung gemacht und sehe das auch bei anderen, daß [sic] der Glaube das Floß ist, das noch trägt, wenn alle anderen Rettungsboote längst leckgeschlagen sind und ich bin meinen Eltern auch sehr dankbar dafür, daß [sic] sie mich im Glauben erzogen haben.“ (A.). In diesem Zusammenhang verweise ich auf eine empirische Studie zu Lebenskrisen und Glaubensaneignung von Dirk Klute, in der er postuliert, dass ein kritisches Lebensereignis, die Relevanz des Glaubens für die Identität verändern kann (vgl. Klute 1999, 120). Gleichzeitig kann sich auch eine Änderung der Identitätsrelevanz des Glaubens auf die biographische Krise auswirken. Klute (1999, 120) führt weiter aus, dass eine Wechselwirkung zwischen Identitätsarbeit und Religiosität nur auftritt, wenn die Identitätsrelevanz des Glaubens schon gegeben ist, wie das Beispiel von Herrn A. zeigt. Unter Bezugnahme auf Keupp habe ich in dieser Arbeit geschildert, dass der retrospektive Anteil in den situationalen Selbstthematisierungen immer um einen prospektiven Anteil in der Identitätsarbeit ergänzt wird (vgl. Kapitel 4.3.2.1). Identitätsprojekte setzen einen subjektiven Reflexionsprozess mit Blick auf vorhandene Ressourcen voraus, die für eine Realisierung erforderlich sind (vgl. Kapitel 4.3.4). Das Identitätsprojekt von Herrn A. ist darauf ausgerichtet, seine Handlungsfähigkeit zu behalten. In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass die Sehbehinderung von Herrn A. auf eine fortschreitende Erkrankung seiner Netzhaut zurückzuführen ist, welche in den meisten Fällen zur Erblindung führt. Herr A. berichtet: „Da ich nicht weiß, was mich erwartet, sind meine Pläne für die Zukunft recht bescheiden. Ich wünsche mir, noch so lange wie möglich arbeiten zu können, weiß aber heute schon, daß [sic] das nicht bis zur Pensionsgrenze gehen wird. Bei der Kombination von Hör- und Sehbehinderung ist alles viel anstrengender, man muß [sic] sich dauernd konzentrieren; für ein ganzes Arbeitsleben reicht das nicht. Und dann hoffe ich, daß [sic] ich noch so lange wie möglich ein selbständiges [sic] Leben führen kann, auch nach dem Ausscheiden aus dem Arbeitsleben.“ (A.). Ich habe an anderer Stelle dargelegt, dass für Herrn A. die sozialen Kontakte im Internet einen wichtigen Stellenwert in seiner Lebenswelt einnehmen (vgl. Kapitel 10.3.3). Auf dieser Basis kann er uneingeschränkt kommunizieren. Des Weiteren arbeitet Herr A. bei der Webseite für Spätertaubte mit, in dessen Forum ich meine Interviewanfrage veröffentlichte. 98 10 Darstellung und Auswertung der Ergebnisse Herr A. erläutert: „Für die Seite habe ich mittlerweile zwei Beiträge verfaßt [sic], weitere sind in Arbeit. Dort würde ich mich gerne auf Dauer engagieren. Für Spätertaubte gibt es nämlich im Unterschied zu Gehörlosen und Schwerhörigen keine Vereine.“ (A.). Anhand dieses Beispiels wird ersichtlich, dass Herr A. unter der Fragestellung: „Wohin möchte ich mich entwickeln?“ ein optionales Selbst entwirft, welches im Kontext der Identitätsarbeit als Identitätsentwurf klassifiziert wird. Dieser Identitätsentwurf bezieht sich auf die zeitliche Strukturierung des Identitätskonstruktes von Herrn A. und formt sich aus der biographischen Bearbeitung seiner aktuellen Selbstbeschreibung (vgl. Kapitel 4.3.4). Für Herrn C. ist es ebenfalls wichtig, sich für spätertaubte Menschen zu engagieren. Herr C. hebt in seinen Aussagen hervor, dass er nach der Ertaubung keine Informationen über eventuelle Rehabilitationsmaßnahmen o.ä. erhielt und sich aus diesem Grund bei der Erstellung der Webseite für spätertaubte Menschen engagierte. Herr C. sagt selbst: „Das Problem war, dass es damals praktisch keine Informationen für Spätertaubte gab, was übrigens einer der Gründe ist, warum ich mich an der Erstellung der Website ‚Einstürzende Tonwelten’ [Internetforum der Webseite] beteiligt habe. Der behandelnde Ohrenarzt wusste z.B. nichts von den Rehabilitationsangeboten in […] Rendsburg. Ich vermute, dass mir vieles, was ich mir zusammen mit Freunden, Familie und Partner an Kommunikationstaktiken etc. erarbeitet habe, dort vermittelt worden wäre.“ (C.). An anderer Stelle hebt Herr C. hervor: „Ich habe durch die Beschäftigung mit dem Projekt ‚Einstürzende Tonwelten’ gemerkt, dass gerade auch in meiner ‚Verarbeitung’ der Ertaubung noch nicht alles ‚fertig’ ist - wird es das jemals? Momentan betrifft dies aber eher praktische Fragen, wie man das Leben als Spätertaubter noch besser organisieren kann.“ (C.). Im Sinne des Modells der Identitätsarbeit ist davon auszugehen, dass Herr C. seine lebensweltlichen Erfahrungen unter der Identitätsperspektive „ich als spätertaubte Person“ abgespeichert hat. Die Integration von individuumsspezifischen Erfahrungsmustern unter einer bestimmten Perspektive führt zur Ausbildung einer Teilidentität. Ich konstatiere, dass die Selbstaussage „Ich bin spätertaubt.“ eine ernstzunehmende Teilidentität mit dem Charakter einer Metaidentität darstellt, in der sowohl das Identitätsgefühl als auch die biographische Kernnarration eine zentrale Bedeutung haben. Inwiefern 99 10 Darstellung und Auswertung der Ergebnisse diese Teilidentität gegenüber anderen Teilidentitäten dominiert, konnte im Beispiel von Herrn C. nicht festgestellt werden. Die subjektive Handlungsfähigkeit als Ergebnis der alltäglichen Identitätsarbeit ist für Herrn C. durch einen pragmatischen Umgang mit seiner Taubheit gekennzeichnet. Er beschreibt sein Bewältigungsstreben folgendermaßen: „Taubheit ist Teil meiner Biographie […]. Ich versuche, die Trauer und/oder Wut über die Ertaubung nicht mein Leben bestimmen zu lassen. Stattdessen bemühe ich mich, möglichst offen und pragmatisch mit Taubheit und den daraus resultierenden Problemen umzugehen. Das gelingt nicht immer, aber immer öfter. Ich bin zu einem gewissen Maße auch stolz auf das was ich trotz oder mit meiner Taubheit erreicht habe.“ (C.). Anhand der Ausführungen von Herrn C. lassen sich seine subjektiven Vorstellungen über die eigene Gestaltbarkeit und Bewältigung seines Alltagslebens erkennen, die durch sein persönliches Kohärenzgefühl gestärkt werden. Die Identitätsentwürfe und Identitätsprojekte von Herrn C. beziehen sich vorwiegend auf seine berufliche Teilidentität. Unter den Bedingungen der Flexibilisierung des Arbeitsmarktes ist es Herrn C. wichtig, mittelfristig einen Vertrag als Wissenschaftler zu erhalten. In seinem persönlichen Erleben beschreibt er: „Ich habe ja geschrieben, dass ich momentan Postdoc bin. Da ist es üblich, das [sic] man sich von einer befristeten Stelle zur nächsten hangelt und hofft, irgendwann vielleicht doch mal eine Dauerstelle zu bekommen. Da geht es Hörenden nicht anders als Spätertaubten. Die Hoffnung auf eine Dauerstelle teile ich natürlich auch, sehe sie aber als eher gering an. Hier werden meiner Meinung nach die schon vorhandenen Probleme der ‚Wissenschaftslandschaft’ in Deutschland durch meine Ertaubung noch verschärft. […] Meine konkreten Pläne für die Zukunft? Die Frage der beruflichen Zukunft für die nächsten 2 oder 3 Jahre klären.“ (C.). Frau P. hat ihr konkretes berufliches Identitätsprojekt mittlerweile in die Praxis umsetzen können und arbeitet als Audiotherapeutin mit hörgeschädigten Menschen. Im Gegensatz zu Herrn C. bezeichnet sich Frau P. nicht als spätertaubt. Sie begründet ihr Selbstverständnis folgendermaßen: „[…] Mit CI bin ich ganz schön weit davon entfernt, taub zu sein. Diese Beurteilung maße ich mir an, weil ich weiß, wie es ist, ohne jedes Hilfsmittel taub zu sein.“ (P.). Im Sinne des Regulationsmodells nach Haußer konnte Frau P. die identitätsrelevante Erfahrung des Hörverlustes in ein subjektiv empfundenes Passungsverhältnis mit einem subjektiv definierten Maß an Ambiguität bringen. 100 10 Darstellung und Auswertung der Ergebnisse Hierzu berichtet sie ferner: „Ich habe einen Verlust bewältigt und gelernt, anderen Menschen bei der Bewältigung eines derartigen Verlustes zu helfen. Ich habe auch gelernt, Dinge bei anderen Menschen zu akzeptieren, die ich nicht verstehen oder nachvollziehen kann. In den meisten Fällen finde ich Mittel und Wege, die Barrieren, die mir die Taubheit auferlegen, zu umgehen.“ (P.). In diesem Zusammenhang verweist Frau P. auf eine identitätsrelevante Selbsterfahrung, die sie in Folge der Ertaubung sammelte: „Bewährt hat sich auf jeden Fall, mich auf mich selbst zu verlassen, auf meine Kraft zu vertrauen.“ (P.). 10.4 Zusammenfassung Das Modell der Identitätsarbeit bietet die Bausteine, um ein Bild davon zu entwerfen welche Erfahrungen spätertaubte Menschen in ihren Lebenswelten gemacht haben, welche Erlebnisse die Biographie sowie die aktuelle Situation kennzeichnen und welche Optionen und Hindernisse sich daraus für die Weiterentwicklung in der Zukunft ergeben. Die in den Interviews zum Ausdruck gebrachten Teilidentitäten der Personen sortieren sich entlang ihrer Hörminderung. Zusammenfassend stelle ich fest, dass für die Erwerbsarbeit einer spätertaubten Person oftmals nicht das Ausmaß des Hörverlustes, sondern die Intensität der mit einer bestimmten Tätigkeit verbundenen Kommunikation entscheidend ist. In den einzelnen Interviews zeigte sich, dass aufgrund der Ertaubung die Zusammenarbeit mit Kollegen und Vorgesetzten in fast allen Fällen beeinträchtigt wurde. Die Gründe hierfür waren individuell verschieden und hoben letztlich doch einen zentralen Aspekt hervor, u.z. dass die Erwerbsarbeit für die Identitätsarbeit eines Individuums die zentralen Erfahrungen von Anerkennung und Zugehörigkeit vermittelt. Des Weiteren wurden in den Partnerschaften und Familiensystemen der Interviewpartner Assimilationsprozesse deutlich, die sich aus den veränderten Kommunikationsbedingungen ergaben. Unter Zuhilfenahme des Modells der Identitätsarbeit konnte aufgezeigt werden, dass Menschen vor allem emotionale und soziale Ressourcen benötigen, um die biographische Krise eines Hörverlustes zu bewältigen. Dabei sind die soziale Einbindung und der soziale Rückhalt einer Person für ein stimmiges Identitätsgefühl entscheidend. In diesem Kontext wurde auch die Bedeutung der sozialen Netzwerke hervorgehoben, welche sich im Zuge der Ertaubung bewährten oder veränderten und entscheidend in der Identitätsarbeit der betreffenden Person waren. In allen Interviews 101 11 Diskussion von Handlungsanforderungen an die Soziale Arbeit kristallisierte sich die signifikante Bedeutung des Internets für die Aufrechterhaltung und Neustrukturierung der sozialen Netzwerke heraus. Meine anfängliche Vermutung, dass die Gebärdensprachgemeinschaft bei der Formung einer kulturellen (Teil-)Identität relevant ist, wurde von meinen Interviewpartnern nicht bestätigt. In ihrem persönlichen Erleben beschreiben die befragten Personen, dass sie sich eher der hörenden Gemeinschaft als der Gebärdensprachgemeinschaft zugehörig fühlen. Abschließend stelle ich fest, dass sich jeder Interviewpartner intensiv mit seiner Hörminderung auseinandergesetzt hat und sein Streben in der Wiederherstellung bzw. Erweiterung seiner Handlungskompetenz zu sehen ist. All diese Prozesse sind durch Ambivalenzen, Widersprüche und Spannungen geprägt und das Ziel der Identitätsarbeit besteht nicht in der Auflösung der Differenzen, sondern in der Bewältigung der Spannungen, indem sie in ein subjektiv lebbares Beziehungsverhältnis gebracht werden (vgl. Kapitel 4.3.1). Ich möchte die Auswertung der Interviews zur Identitätsarbeit spätertaubter erwachsener Menschen mit einem Zitat von Frau P. beenden, die retrospektiv auf ihre Ertaubung zurückblickt und postuliert: „Ich denke, alles was im Leben passiert, bedarf einer Re-aktion! [sic] Das Gehör zu verlieren ist wahrlich keine schöne Erfahrung und wenn man in der Verlustkrise steckt ist das eine schlimme Sache […], aber im Großen Ganzen - zumal wenn man in einem medizinisch und gesundheitspolitisch recht fortgeschrittenen Land lebt - durchaus zu bewältigen […]. Ich stelle damit den Schmerz nicht in Abrede, denke aber einfach, dass es hilfreicher ist, den Menschen Hinweise auf ihre eigenen Ressourcen zu geben, ihnen Wege aufzuzeigen […].“ (P.). 11 Diskussion von Handlungsanforderungen an die Soziale Arbeit Im folgenden Kapitel werde ich anhand der „Lebensweltorientierten Sozialen Arbeit“ von Thiersch und dem Biographiekonzept von Böhnisch mögliche Handlungsanforderungen herausarbeiten, die sich für die Soziale Arbeit mit postlingual ertaubten Menschen ergeben. Die Handlungstheorien orientieren sich an der Grundhaltung des Empowermentansatzes (vgl. Kapitel 6.1). Die genannten Rahmenkonzepte greifen ineinander über und nehmen in der vorliegenden Arbeit eine sich ergänzende Funktion ein. Ziel dieser Arbeit ist es, Denkanstöße für die Soziale Arbeit anzuregen, welche sich aus den einzelnen Biographien der Interviewpartner formen und die entlang der Prämisse eines „gelingenderen“ Alltags strukturiert sind. Zwischen der Auswertung der individuellen Biographien und der Formulierung globaler Handlungsanforderungen an die Soziale Arbeit mit spätertaubten Menschen entsteht ein Spannungsverhältnis, welches nicht aufgelöst werden kann und soll. Stattdessen besteht die Intention der vorliegenden Ar102 11 Diskussion von Handlungsanforderungen an die Soziale Arbeit beit darin, erste empirische Erkenntnisse für die Soziale Arbeit aufzubereiten, die Anregungen für einen methodisch strukturierten Reflexionsprozess bieten und eine lebensweltorientierte hermeneutische Sensibilität für spätertaubte Menschen fördern sollen. 11.1 Lebenswelt und Alltag als Rahmenkonzept und Handlungsmuster Das Konzept „Lebensweltorientierte Soziale Arbeit“ zielt auf eine theoretisch fundierte Bestimmung über die Rahmenbedingungen, die pädagogische Orientierung und den Ort der pädagogischen Intervention Sozialer Arbeit unter den gesellschaftlichen Bedingungen von Individualisierung und Pluralisierung der Lebenslagen (vgl. Kapitel 6.2.1). Der Blick auf den Alltag des Adressaten als Ort sozialpädagogischer Intervention ermöglicht den Fokus auf die individuellen Lebenswelten mit ihren Selbstverständlichkeiten, Selbstinterpretationen und Relevanzstrukturen zu setzen (vgl. Sickendiek 1999, 147). Thiersch insistiert, dass sich Sozialpädagogen in die Lebenswelt des Betroffenen begeben müssen, um Probleme dort aufzugreifen, wo sie sich zeigen (vgl. Kapitel 6.2.2). Dabei nutzt die „Lebensweltorientierte Soziale Arbeit“ jene Ressourcen, die in der Alltagswelt gegeben sind und baut ergänzend neue Ressourcen auf. Die individuelle Alltagswelt der spätertaubten Interviewpartner ist durch eine Gratwanderung zwischen Selbstständigkeit und Hilfestellung geprägt. Kommunikative Einschränkungen in verbalen Interaktionsprozessen erfordern Hilfestellungen von Seiten der hörenden Umwelt. Gleichzeitig muss die Selbstbestimmung und Selbstverantwortlichkeit der betreffenden Person gewahrt bleiben. Meiner Ansicht nach besteht die Anforderung der „Lebensweltorientierten Sozialen Arbeit“ darin, die Handlungskompetenz des ertaubten Menschen soweit zu stärken und zu fördern, dass ein selbstbestimmtes Leben möglich ist, in dem eine bedürfnisorientierte Kommunikation seine Berücksichtigung findet. Zur Verdeutlichung dessen verweise ich rückblickend auf die selbstreferentielle Aussage von Herrn A. zu seinem Selbstverständnis: „Ich habe nie versucht, meine Behinderungen zu kaschieren, sondern weise auf sie hin, wenn es notwendig ist. Ich kann auch im Bedarfsfalle andere um Hilfe bitten, […] oder für mich telephonieren lassen. Ich denke deshalb, daß [sic] ich von anderen durchaus ernst genommen werde und habe nicht das Gefühl, anders oder gar schlechter als Hörende behandelt zu werden.“ (A.). Letztlich sollte das Ziel alltagsorientierter Sozialer Arbeit darin liegen, eine authentische Lebensperspektive zu entwickeln, in welcher die spätertaubte Person ihre Hörschädigung in ihr Selbstkonzept integrieren kann. Das Rahmenkonzept der „Lebens- 103 11 Diskussion von Handlungsanforderungen an die Soziale Arbeit weltorientierung“ stützt sich auf die Erkenntnis, dass sozialpädagogische Interventionen nicht ohne Wert- und Zielvorstellungen auskommen (vgl. Kapitel 6.2.3). Demnach besteht die Anforderung an die Soziale Arbeit, ein reflexives Bewusstsein ihres eigenen normativen Handelns auf der Grundlage theoriegeleiteter Strukturierung zu entwickeln. Hierzu müssen Sozialpädagogen in der Arbeit mit spätertaubten Personen ihr persönliches Menschenbild, ihre Wert- und Normvorstellungen selbstreferentiell betrachten können, weil diese Grundsätze die berufliche Identität und das berufliche Selbstverständnis formen. Aus der lebensweltorientierten Perspektive ergibt sich meiner Meinung nach die anthropologische Grundhaltung, dass der Mensch ein soziales Wesen darstellt, welches in soziale Netzwerke eingebettet ist. Im Zusammenhang mit einer Ertaubung im Erwachsenenalter ist zu beachten, dass die kommunikativen Einschränkungen des Hörverlustes Auswirkungen auf das mikrosoziale Umfeld des betreffenden Menschen haben. Folglich muss die „Lebensweltorientierte Soziale Arbeit“ ihren Blickwinkel auf die sozialen Netzwerke der ertaubten Person richten. Beispielsweise kann in der „Netzwerkbezogenen Beratung“ erarbeitet werden, welche Unterstützungsressourcen im sozialem Umfeld zur Verfügung stehen, wo die Grenzen für partnerschaftliche Hilfestellungen liegen und das Familiensystem überlastet ist (vgl. Sickendiek 1999, 185). In diesem Zusammenhang verweise ich auf das Beispiel von Herrn M., der bezüglich seiner Partnerschaft folgendes sagte: „[…] Ich habe mir ein Buch zu gelegt, in dem die Ärzte oder andere ‚öffentliche’ Personen mir stichpunktartig einschreiben was sie mir zu sagen haben bzw. gesagt hatten […]. Das funktionierte schon einige mal [sic] gut und ich brauch dann auch meine Frau mit meinen Arztbesuchen nicht zu belasten.“ (M.). Die Wiederherstellung der Handlungskompetenz im Rahmen der Identitätsarbeit von Herrn M. entlastet auch seine Partnerschaft. Sofern diese Prozesse vom betroffenen Subjekt nicht selbst initiiert werden können, ist die „Lebensweltorientierte Soziale Arbeit“ aufgefordert, unterstützend zu intervenieren. Ferner braucht es für eine alltagsorientierte Soziale Arbeit die sozialpädagogische Fähigkeit, sich den gegebenen Verhältnissen der Lebenswelt des Adressaten auszusetzen und die gegebenen Verhältnisse zu verstehen (vgl. Kapitel 6.2.3). Für die Soziale Arbeit mit postlingual ertaubten Menschen sind u.a. Kenntnisse der Kommunikationstheorie notwendige Bedingung, um Problemlagen des Alltags einer spätertaubten Person zu erfassen und daraus gemeinsam mit dem betroffenen Menschen Bewältigungs- und Verarbeitungsformen zu entwickeln, die einen „gelingenderen Alltag“ ermöglichen. Die Interviewpartner haben hervorgeho- 104 11 Diskussion von Handlungsanforderungen an die Soziale Arbeit ben, dass sie in ihren Lebenswelten immer wieder die Erfahrung machen, dass hörende Menschen ihre kommunikativen Einschränkungen nicht nachvollziehen können. Die vorhandenen Kenntnisse der Laut- und Schriftsprache verschleiern für hörende Menschen die Kommunikationseinschränkungen der Interviewpartner in verbalen Interaktionsprozessen. Am Beispiel von Herrn M. wurde deutlich, dass die Unkenntnis seiner Arbeitskollegen im Umgang mit seiner einseitigen Ertaubung zu emotionalen Stresssituationen führte. Zur Verdeutlichung dessen verweise ich rückblickend auf das persönliche Erleben seiner beruflichen Situation: „[…] Rücksichtslosigkeit der Normalhörenden, ansprechen auf der tauben Seite, Geräusche machen während des Gespräches usw. […] setzten mich natürlich immer unter Streß [sic].“ (M.). Die „Lebensweltorientierte Soziale Arbeit“ kann im Rahmen der beruflichen Rehabilitation in Konfliktlagen dieser Art vermitteln und aufklärend intervenieren. Beispielsweise kann die Arbeitsplatzbegleitung in diesem Fall eine hilfreiche Interventionsmaßnahme darstellen. Dabei verzichtet das Konzept „Lebensweltorientierung“ auf eine Vorgabe von Interventionszielen und rekurriert stattdessen eine prozessuale Dimension, die sich an der Lebenslage der Adressaten orientiert und mit dem Begriff „strukturierte Offenheit“ umschrieben wird (vgl. Kapitel 6.2.3). Das erfordert die sozialpädagogische Fähigkeit, gemeinsame Aushandlungsprozesse mit dem Adressaten initiieren zu können, auf der Basis einer symmetrischen Arbeitsbeziehung zwischen gleichwertigen und gleichberechtigten miteinander agierenden Partnern. Ich vertrete die Ansicht, dass diese theoretische Handlungsanforderung mit dem beruflichen Alltagshandeln in einem paradoxen Verhältnis steht. Es ist davon auszugehen, dass die professionell Tätigen einen unaufhebbaren Wissensvorsprung haben, der die Gefahr beinhaltet, dass Adressaten zum „passiven Objekt der Anwendung theoretischen abstrakten Wissens“ gemacht werden, ohne dass eine Rückkoppelung an die konkrete Problemlage in der Lebenswelt des Adressaten erfolgt (Sickendiek 1999, 157). Aus diesem Spannungsverhältnis heraus sehe ich die notwendige Grundvoraussetzung für Professionalität in der Reflexion der eigenen sozialpädagogischen Tätigkeit. Des Weiteren hat die „Lebensweltorientierte Soziale Arbeit“ mit spätertaubten Menschen die Aufgabe, stellvertretende Lebensdeutungen zu entwickeln, die im Sinne des Empowermentansatzes einen „verständigungsorientierten biographischen Dialog“ inszenieren (Miller/Pankofer 2000, 16). Bezüglich der Identitätsarbeit spätertaubter Menschen kann davon ausgegangen werden, dass dieser Prozess retrospektiv auf die 105 11 Diskussion von Handlungsanforderungen an die Soziale Arbeit Aufarbeitung des bisherigen Lebensweges und die biographische Krise sowie prospektiv auf die persönlichen Identitätsentwürfe und Identitätsprojekte in Folge des Hörverlustes ausgerichtet ist. Dabei orientiert sich die Soziale Arbeit an der Erschließung von individuellen Ressourcen zur Unterstützung der Selbstorganisation der betreffenden Person. In den Interviews wurde sowohl von Herrn C. als auch von Herrn A. betont, dass sie nach der Ertaubung keine Informationen über Rehabilitationsmöglichkeiten erhielten, die für den Trauerprozess notwendig gewesen wären und die Wiederherstellung der Handlungskompetenz unterstützt hätten. Die Beispiele weisen darauf hin, dass hier Vernetzungsarbeit zwischen behandelnden Ärzten und der Sozialen Arbeit erfolgen muss, so dass ein Verbundsystem mit niedrigschwelligen Angeboten entsteht. Aus meiner persönlichen Erfahrung in der Arbeit mit hörgeschädigten Menschen ist mir bekannt, dass es eigene Sozialdienste für hörgeschädigte Personen gibt. Ausgehend von den allgemeinen Aufgaben und Zielen psychosozialer Beratung ist hier ein differenziertes Angebot gegeben, welches sich an den kommunikativen Möglichkeiten hörgeschädigter Menschen orientiert und die psychosozialen Folgen von Gehörlosigkeit berücksichtigt (vgl. Dommaschk-Rump 1995, 199). Die Beratung am Arbeitsplatz stellt einen Schwerpunkt des speziellen sozialpädagogischen Betätigungsfeldes dar. Die individuellen Biographien der befragten Personen haben die Spannweite der Auswirkungen eines Hörverlustes auf die berufliche Tätigkeit von postlingual ertaubten Menschen aufgezeigt. Dabei wurde in den Interviews die Erwerbsarbeit als ein zentrales Merkmal für die Identitätsarbeit hervorgehoben, weil über die berufliche Tätigkeit soziale Anerkennung und Integration erlangt werden. Folglich ist eine zentrale Anforderung an die „Lebensweltorientierte Soziale Arbeit“, mangelnde Informationen über Möglichkeiten und Grenzen in der Kommunikation mit spätertaubten Menschen auszugleichen und eine Schnittstelle zwischen der hörenden Arbeitswelt und der hörgeschädigten Person zu bilden. Dabei erscheint es mir hilfreich, den hörenden Arbeitgeber und die Kollegen über manuelle Kommunikationstechniken zu informieren und beratend zur Seite zu stehen. In diesem Zusammenhang stellt sich eine weitere Anforderung an die „Lebensweltorientierte Soziale Arbeit“ mit spätertaubten Menschen, denn die Grundprämisse des Rahmenkonzeptes besteht in dem Postulat der „sozialen Gerechtigkeit“. Thiersch (2004, 22) insistiert, dass eine Ausgrenzung besonderer Zielgruppen unter dieser Prämisse nicht erfolgen darf. Teilhabeprobleme durch Exklusionserfahrungen können sich für spätertaubte Menschen sowohl in der beruflichen Lebenswelt als auch in der kulturellen 106 11 Diskussion von Handlungsanforderungen an die Soziale Arbeit Alltagswelt im Kontext von hörender Kultur und Gehörlosenkultur ergeben. Ich erinnere an dieser Stelle an das Beispiel von Herrn A., der von seinen Exklusionserfahrungen in der Gebärdensprachgemeinschaft berichtete: „Bei meinen Schnupperbesuchen im hiesigen Gehörlosenverein fiel mir jedoch auf, da [sic] man ohne die Gebärdensprache dort nicht als zugehörig angesehen wird. Und da ich diese Sprache wegen der Sehbehinderung nicht lernen kann, bleibt mir diese Welt letztlich verschlossen.“ (A.). Im Gegensatz zu Herrn A. sammelte Frau P. folgende Erfahrungen: „Was die Gl-Gemeinschaft [Gehörlosen-Gemeinschaft] betrifft, ich glaube, da gibt es sehr unterschiedliche Erfahrungen. Jeder Versuch von mir, mich mit Gebärden (egal ob DGS oder LBG) zu verständigen, jede ‚Handreichung’ wurde stets von GL [Gehörlosen] mit Interesse aufgenommen.“ (P.). Darüber hinaus berichteten die Interviewpartner von Exklusionserfahrungen in der hörenden Kultur, die sich aufgrund der eingeschränkten Kommunikationsmöglichkeiten ergeben. Letztlich spiegeln diese unterschiedlichen lebensweltlichen Erfahrungen wieder, dass Inklusion und Exklusion keine gegebenen Phänomene sind. Sie unterliegen subjektiven und sozialen Deutungen, welche durch die Interviewaussagen narrativ verdichtet wurden (vgl. Miller 2001, 103). In Anlehnung an Miller vertrete ich die Ansicht, dass die „Lebensweltorientierte Soziale Arbeit“ die Aufgabe hat dort zu unterstützen, wo Teilhabe gewollt ist und sich die Exklusion für die Person als subjektive Belastung darstellt, egal ob es sich um die hörende oder die Gehörlosenkultur handelt. Weiterhin bin ich der Meinung, dass die „Lebensweltorientierte Soziale Arbeit“ Aufklärungsarbeit leisten muss, um spätertaubten Menschen nach dem Hörverlust die verschiedenen Möglichkeiten aufzuzeigen, die von den unterschiedlichsten Kommunikationstechniken bis hin zum kulturellen Konzept von Gehörlosigkeit reichen. In diesem Kontext ist die Soziale Arbeit aufgefordert, ihr Selbstverständnis hinsichtlich einer interdisziplinären Auseinandersetzung zu reflektieren, denn die medizinische Sichtweise auf die Dysfunktion des menschlichen Hörorgans erscheint für den Personenkreis der ertaubten Menschen unzureichend. 11.2 Biographie und Lebenslauf als Rahmenkonzept und Handlungsmuster Das „Biographiekonzept“ von Böhnisch bietet einen ergänzenden Blickwinkel zur „Lebensweltorientierten Sozialen Arbeit“ gemäß Thiersch. Aus diesem Grund werden im 107 11 Diskussion von Handlungsanforderungen an die Soziale Arbeit Folgenden die Aspekte des Konzeptes aufgegriffen, die eine erweiterte Perspektive auf die Soziale Arbeit mit postlingual ertaubten Menschen enthalten. Das „Biographiekonzept“ bietet die Möglichkeit, die Dimension der individuellen Betroffenheit von postlingual ertaubten Menschen zu thematisieren. Mit dem Modell der Identitätsarbeit als Bezugssystem können alle denkbaren Lebensmuster und Bewältigungsstrategien der betreffenden Person abgebildet werden. Über die Anschlusskonzepte Lebenslauf und Lebensalter werden die gesellschaftlichen Bedingungskonstellationen individueller Lebensprobleme berücksichtigt (vgl. Kapitel 6.3). In der vorliegenden Arbeit wurden spätertaubte Menschen befragt, die im Erwachsenenalter ihr Gehör verloren haben. Demnach muss die Soziale Arbeit die Dimension des Erwachsenenalters als metatheoretische Perspektive in ihrer Analyse und ihrem pädagogischen Handeln berücksichtigen. Im Zusammenspiel von Biographie und Lebensalter sind besonders die Entwicklungsprozesse des Erwachsenenalters einzubeziehen. Beispielsweise sagte Frau P. im Interview folgendes: „Die Frage nach dem Lebenssinn stellt sich für mich jetzt häufiger als früher, ob dies Folge der Ertaubung oder des Lebensalters ist, weiß ich nicht. Ich vermute mal beides.“ (P.). An diesem biographischen Beispiel werden das Zusammenspiel von Lebensalter, der Bewältigung von Entwicklungsaufgaben und das Erreichen eines bestimmten Grades an psychischer Reife deutlich, welche das Erwachsenenalter umfassen (vgl. Whitbourne 1982, 26). In der zeitlichen Perspektive des Erwachsenenalters nimmt die potentielle Zukunft ab und wird in Vergangenheit „übersetzt“ (vgl. Siegert/Chapman 1987, 145). Die zeitliche Dimension der Identitätsentwicklung ist durch die Interaktion von vergangenen Identitätsdefinitionen und gegenwartsbezogenen Identitätsprojekten gekennzeichnet. Folglich muss das Rahmenkonzept für die Soziale Arbeit unter biographischen und lebenslaufbezogenen Gesichtspunkten das individuelle Handeln einer spätertaubten Person mit den sozialen Bedingungsstrukturen verknüpfen. Zu den Bedingungsfaktoren der Moderne gehört, dass die Gegenwart angesichts der Offenheit von Zukunft ein eigenständiges Gewicht erlangt. Beispielsweise schilderte Herr C. die Offenheit in seiner beruflichen Lebenswelt folgendermaßen: „Ich habe ja geschrieben, dass ich momentan Postdoc bin. Da ist es üblich, das [sic] man sich von einer befristeten Stelle zur nächsten hangelt und hofft, irgendwann vielleicht doch mal eine Dauerstelle zu bekommen. Die Hoffnung auf eine Dauerstelle […] sehe ich eher als gering an. Hier werden meiner Meinung nach die schon vorhandenen Probleme der ‚Wissenschaftslandschaft’ in 108 11 Diskussion von Handlungsanforderungen an die Soziale Arbeit Deutschland durch meine Ertaubung noch verschärft. Konkret läuft mein aktueller Vertrag Ende dieses Jahres aus und momentan bemühe ich mich schon darum, wie es danach weiter gehen könnte.“ (C.). In diesem Zusammenhang verweise ich auf die grundlegende Bedeutung von Arbeit als eine zentrale Kategorie des Lebenslaufes, die von den Interviewpartnern immer wieder thematisiert wurde. In der Auswertung der biographischen Interviews wurde aufgezeigt, dass die Erwerbsarbeit zentrale Erfahrungen von Anerkennung und sozialer Integration sowie Selbstverwirklichung bietet (vgl. Kapitel 10.3.1). Der Verlust eines Arbeitsplatzes oder die strukturelle Veränderung der Bedingungen am Arbeitsplatz müssen von der Sozialen Arbeit unter der Dimension der individuellen Betroffenheit betrachtet werden, so dass die biographische Lebensbewältigung verstanden werden kann. Böhnisch legt in seinem Konzept dar, dass die Soziale Arbeit ihren Handlungsansatz als „Hilfe zur Lebensbewältigung“ aus dem Streben des Subjekts nach sozialer Integration erhält (vgl. Kapitel 6.3.2). Die Soziale Arbeit mit spätertaubten Menschen ist aufgefordert nach den Ressourcen zu suchen, die dem betreffenden Menschen für ein gelingendes Lebensmanagement zur Verfügung stehen. Beispielsweise ist die Familie eine zentrale Ressource im Leben von Herrn M., die ihm sozialen Rückhalt bietet. In diesem Zusammenhang ist die Aktivierung des Selbstwerts eine signifikante Komponente der biographischen Interventionsperspektive, denn in Folge der Ertaubung kann es zu einem Selbstwertverlust kommen (vgl. Kapitel 6.3.2). Das zentrale Medium der Sozialen Arbeit ist die Kommunikation mit dem Adressaten mittels Sprache. Infolgedessen besteht für die sozialpädagogische Intervention die Notwendigkeit, eine Bandbreite an verschiedenen Kommunikationstechniken zu beherrschen, die den kommunikativen Möglichkeiten der spätertaubten Person entsprechen. Dazu gehört auch, dass die räumlichen Lichtverhältnisse der Kommunikationssituation angepasst werden. Die Biographien der Interviewteilnehmer haben gezeigt, dass die Kommunikationsstile individuell verschieden sind und der Bedarf jeder einzelnen Person unterschiedlich ausfallen kann. Beispielsweise verwendet Herr A. aufgrund seiner Sehbehinderung keine lautsprachbegleitenden Gebärden, sondern äußert sich vorwiegend in schriftlicher Form. Frau P. hingegen kann sehr gut von den Lippen absehen und die Verwendung des Cochlea Implantats unterstützt ihre akustische Wahrnehmung. Dem gegenüber stellt das Absehen für Herrn C. keine adäquate Kommunikationsmöglichkeit dar, so dass er vorwiegend lautsprachbegleitende Gebärden verwendet bzw. in schriftlicher Form kommuniziert. 109 12 Fazit und Ausblick Die Soziale Arbeit ist aufgefordert, den individuellen Bedürfnissen im Sinne einer gelingenden Kommunikation gerecht zu werden. Dazu zählt unter kommunikationspsychologischen Gesichtspunkten auch die Fähigkeit des „aktiven Zuhörens“, d.h. Sozialpädagogen müssen sich in die Gefühls- und Gedankenwelt der postlingual ertaubten Person empathisch einfühlen können (vgl. Schulz von Thun 2001, 57). Letztlich geht es darum sensibel zu werden, wie sich der betroffene Mensch im Spannungsfeld mehr oder minder kommunikativ erlebter Einschränkungen sein Leben einrichten kann. Nur unter diesen Voraussetzungen kann Hilfe zur Lebensbewältigung in biographischen Kontexten geleistet werden. 12 Fazit und Ausblick In der vorliegenden Arbeit habe ich die Identitätsarbeit von spätertaubten Erwachsenen mit dem speziellen Blickwinkel auf ihre kulturelle Zugehörigkeit im Kontext der Gebärdensprachgemeinschaft und der hörenden Gesellschaft untersucht. Zu Beginn definierte ich den Begriff „Spätertaubung“ unter medizinischen Gesichtspunkten, um darauf aufbauend die kommunikativen Einschränkungen des Hörverlustes im Erwachsenenalter zu analysieren. Anschließend erläuterte ich, dass Individuen in der Interaktion ihre Identität mittels Sprache konstituieren und narrativ darstellen. Folglich wirken sich Kommunikationseinschränkungen auf die Interaktionsmöglichkeiten und damit auf die Identität einer Person aus. Hieran angeschlossen erörterte ich die theoretischen Grundlagen der Identitätsforschung mit den klassischen Modellen aus der Psychoanalyse und der Soziologie. Es wurde aufgezeigt, dass die Ansätze zentrale Aspekte des Konstruktes „Identität“ umfassen und signifikante Zugänge für meine empirische Untersuchung bieten. Für die biographische Perspektive auf die Identität einer Person rekurrierte ich das sozialpsychologische Modell der Identitätsarbeit, welches die Grundlage für die qualitativen Interviews darstellte. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass in diesem Modell Identitätsentwicklung als offener, lebenslanger Prozess verstanden wird, in dem fortlaufend neue lebensweltliche Erfahrungen interpretiert werden und identitätsrelevante Erfahrungen zu Assimilationsoder Akkommodationsprozessen führen. Im Anschluss habe ich die Bedeutung der sozialen Netzwerke für die Identitätsarbeit einer Person geschildert. Dabei wurde sichtbar, dass in den sozialen Netzwerken kulturelle Werte und Orientierungen vermittelt werden, die zur Ausformung einer kulturellen (Teil-)Identität beitragen können. Ein kulturelles Netzwerk für gehörlose Menschen 110 12 Fazit und Ausblick stellt die Gebärdensprachgemeinschaft dar. In diesem Kontext stellte ich das kulturelle Konzept von Gehörlosigkeit vor. Meine Überlegungen bezogen sich darauf, dass spätertaubte Erwachsene mit prälingual gehörlosen Menschen die Tatsache des vollständigen Hörverlustes und daher visuelle Perzeptionsbedingungen teilen. Darüber hinaus sind beiden Gruppen Kommunikationsbeeinträchtigungen mit der hörenden Gemeinschaft bekannt. In diesem Zusammenhang bestand mein empirisches Forschungsinteresse in der Frage, zu welchen kulturellen Netzwerken sich spätertaubte Menschen im Zuge ihrer Identitätsarbeit zugehörig fühlen und inwiefern die Gebärdensprachgemeinschaft ein soziales Netzwerk für postlingual ertaubte Erwachsene darstellt. Für die biographischen Interviews mit spätertaubten Erwachsenen wählte ich lebensweltliche Identitätsvariablen, die meine inhaltliche Strukturierung der allgemeinen Fragestellung verdeutlichen sollten. Hierzu habe ich Identität anhand der Lebensfelder Arbeit, Partnerschaft und Familie, soziale Netzwerke sowie Kultur gemessen. In den Interviews kristallisierte sich heraus, dass sich die zum Ausdruck gebrachten Teilidentitäten der Interviewpartner entlang ihrer Hörminderung sortieren. In diesem Kontext wurde die Bedeutung der sozialen Netzwerke hervorgehoben, welche sich im Zuge der Ertaubung bewährten oder veränderten und entscheidend für die Identitätsarbeit der betreffenden Personen waren. Meine anfängliche Vermutung, dass die Gebärdensprachgemeinschaft bei der Formung einer kulturellen (Teil-)Identität relevant sei, wurde von meinen Interviewpartnern nicht bestätigt. In ihrem subjektiven Erleben beschrieben die befragten Personen, dass sie sich eher der hörenden Gemeinschaft als der Gebärdensprachgemeinschaft zugehörig fühlen. Die persönlichen Entwicklungswege der Interviewteilnehmer haben aufgezeigt, dass sie von ihrem Lebensalter, ihrem sozialen Kontext, ihrer kulturellen Interessenslage und ihrer beruflichen Situation Einzelschicksale darstellen. Dabei konstruieren die subjektiven lebensweltlichen Erfahrungen ihre Identität, so dass die befragten Personen mit dem Hörverlust ihr Leben bewältigen können. Mit den einzelnen Elementen des Modells der Identitätsarbeit bestand grundsätzlich die Möglichkeit, alle denkbaren Lebensmuster abzubilden. Zum Abschluss der Arbeit wurden auf der Grundlage eines biographisch- und lebensweltorientierten sozialpädagogischen Bezugsrahmens, welcher als theoretische Reflexionsfolie diente, mögliche Handlungsanforderungen an die Soziale Arbeit mit spätertaubten Menschen ausgearbeitet und diskutiert. Die biographischen Interviews sollten 111 12 Fazit und Ausblick einen Denkrahmen für die Soziale Arbeit liefern, wie man sich die Beweglichkeit von Identitätsprozessen vorstellen kann und auf welche Aspekte die Soziale Arbeit als ein professionelles, ressourcenorientiertes Unterstützungssystem zu achten hat. In den Interviews kam immer wieder der Wunsch der befragten Personen zum Ausdruck, die Öffentlichkeit über die besonderen Lebensbedingungen spätertaubter Erwachsener zu informieren. Ich hoffe, dass ich mit dieser Arbeit einen kleinen Beitrag dazu leisten konnte, die vielfältigen Zusammenhänge eines Hörverlustes im Erwachsenenalter aufzuzeigen, welche die persönliche Identität des betroffenen Menschen verändern. Abschließend möchte ich ein Gedicht von Sibylle Gurtner zitieren (zit. n. Hintermair 2001, 113), welche sich literarisch mit ihrer Identität als hörgeschädigte Person auseinandersetzt: nie bin ich dieselbe, endgültig fest gefügt. ich fühle mich wachsen offen für die Schönheit um mich und mir. schon morgen bin ich eine andere: ich hat keinen ort. ich ist unterwegs ein leben lang. 112 Abkürzungsverzeichnis Abb. Abbildung Bd.Band bzw. beziehungsweise ca. cirka CI Cochlea Implantat DGS Deutsche Gebärdensprache d.h. das heißt ebd. ebenda etc.et cetera f.ff. folgende (Seiten) Hg. Herausgeber LBG lautsprachbegleitende Gebärden i.d.R. in der Regel o.ä. oder ähnliches u.a. unter anderem u.z. und zwar usw. und so weiter vgl. vergleiche z.B. zum Beispiel zit. n. zitiert nach z.T. zum Teil 113 Literaturverzeichnis Ahbe, Thomas 1998: Ressourcen – Transformation – Identität. In: Keupp, Heiner/Höfer, Renate (Hg.): Identitätsarbeit heute. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 207-224 Ahrbeck, Bernd 1997: Gehörlosigkeit und Identität. Probleme der Identitätsbildung Gehörloser aus der Sicht soziologischer und psychoanalytischer Theorien. Hamburg: Signum Albertini, John A. 1991: Die Hörgeschädigten in der amerikanischen Gesellschaft. Identität im Wandel. In: Jussen, Heribert/Claußen, W. Hartwig. (Hg.): Chancen für Hörgeschädigte. Hilfen aus internationaler Perspektive. München: Reinhardt, 98-104 Atteslander, Peter 2000: Methoden der empirischen Sozialforschung. Berlin: de Gruyter Barthes, Roland 1991: Zuhören. In: Kuhn, Robert/Kreutz, Bernd (Hg.): Das Buch vom Hören. Freiburg im Breisgau: Herder, 55-71 Baum, Hermann 2000: Anthropologie für soziale Berufe. Opladen: Leske + Budrich Beck, Ulrich 1986: Risikogesellschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp Becker, Maryanne 2003: Hörverlust und Identitätskrise. verstehen, bewältigen, akzeptieren. Dortmund: Literaturwerkstatt Berg, Reni 2000: Rollenspezifische Hörweisen und Missverständnisse. In: Lotzmann, Geert (Hg.): Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung bei Sprach-, Sprech-, Stimm- und Hörstörungen. Würzburg: Bentheim, 30-62 Bilden, Helga 1998: Das Individuum – ein dynamisches System vielfältiger TeilSelbste. In: Keupp, Heiner/Höfer, Renate (Hg.): Identitätsarbeit heute. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 227-249 Böhnisch. Lothar 2001: Sozialpädagogik der Lebensalter. Weinheim: Juventa Boyes Braem, Penny 1995: Einführung in die Gebärdensprache und ihre Erforschung. Hamburg: Signum Brockhaus 2001a: Brockhaus. Die Enzyklopädie in 24 Bänden. Bd. 6. Leipzig: Brockhaus Brockhaus 2001b: Brockhaus. Die Enzyklopädie in 24 Bänden. Bd. 12. Leipzig: Brockhaus 114 Brockhaus 2001c: Brockhaus. Die Enzyklopädie in 24 Bänden. Bd. 21. Leipzig: Brockhaus Bucher, Peter (u.a.) 1991: Rehabilitation von Cochlea-Implantat-Trägern. In: Jussen, Heribert/Claußen, W.Hartwig (Hg.): Chancen für Hörgeschädigte. Hilfen aus internationaler Perspektive. München: Reinhardt, 45-51 Claußen, W. Hartwig 1991: Zur Polarität von Selbstentfaltung und sozialer Eingliederung. In: Jussen, Heribert/Claußen, W.Hartwig (Hg.): Chancen für Hörgeschädigte. Hilfen aus internationaler Perspektive. München: Reinhardt, 17-24 Diekmann, Andreas 1999: Empirische Sozialforschung. Grundlagen, Methoden, Anwendungen. Reinbek: Rowohlt Dommaschk-Rump, Cornelia 1995: Beratungsstellen für Gehörlose im Arbeitsleben – ein weiterer Beitrag zur Inflation psychosozialer Dienstleistungen? In: Bungard, Walter/Kupke, Sylvia (Hg.): Gehörlose Menschen in der Arbeitswelt. Weinheim: Beltz, 215-227 Ebbinghaus, Horst/Heßmann, Jens 1989: Gehörlose – Gebärdensprache – Dolmetschen. Chancen der Integration einer sprachlichen Minderheit. Hamburg: Signum Engelke, Ernst 1999: Theorien der Sozialen Arbeit. Eine Einführung. Freiburg im Breisgau: Lambertus Erikson, Erik H. 1973: Identität und Lebenszyklus. Frankfurt am Main: Suhrkamp Fengler, Jörg 1990: Hörgeschädigte Menschen. Beratung, Therapie und Selbsthilfe. Stuttgart: Kohlhammer Fink, Verena 1995: Schwerhörigkeit und Spätertaubung. Eine Untersuchung über Kommunikation und Alltag hörgeschädigter Menschen. Deutsche Hochschuledition. Bd. 34. Neuried: ars una Friebertshäuser, Barbara/Prengel, Annedore 2003: Handbuch qualitativer Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft. Weinheim: Juventa Frey, Hans-Peter/Haußer, Karl 1987: Entwicklungslinien sozialwissenschaftlicher Identitätsforschung. In: Frey, Hans-Peter/Haußer, Karl (Hg.): Identität. Entwicklungen psychologischer und soziologischer Forschung. Stuttgart: Enke, 1-23 Galuske, Michael 2002: Flexible Sozialpädagogik. Elemente einer Theorie sozialer Arbeit in der modernen Arbeitsgesellschaft. Weinheim: Juventa Georgogiannis, Pantelis 1985: Identität und Zweisprachigkeit. Sozialwissenschaftliche Studien. Bd. 28. Bochum: Studienverlag Brockmeyer 115 Goffmann, Erving 1977: Stigma. Über Techniken der Bewältigung beschädigter Identität. Frankfurt am Main: Suhrkamp Grunwald, Klaus/Thiersch, Hans 2004: Das Konzept Lebensweltorientierte Soziale Arbeit – einleitende Bemerkungen. In: Grunwald, Klaus/Thiersch, Hans (Hg.): Praxis Lebensweltorientierter Sozialer Arbeit. Weinheim: Juventa, 13-37 Haußer, Karl 1995: Identitätspsychologie. Berlin: Springer Haußer, Karl 1998: Identitätsentwicklung – vom Phasenuniversalismus zur Erfahrungsverarbeitung. In: Keupp, Heiner/Höfer, Renate (Hg.): Identitätsarbeit heute. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 120-134 Herriger, Norbert 1997: Empowerment in der Sozialen Arbeit – Eine Einführung. Stuttgart: W. Kohlhammer Hintermair, Manfred/Voit, Helga 1990: Bedeutung, Identität und Gehörlosigkeit. Argumente für eine veränderte Entwicklungs- und Förderperspektive in der Erziehung gehörloser Kinder. Hörgeschädigtenpädagogik: Beiheft 26. Heidelberg: Julius Groos Hintermair, Manfred 1999: Identität im Kontext von Hörschädigung. Hörgeschädigtenpädagogik: Beiheft: 43. Heidelberg: Median Hintermair, Manfred 2001: Zur Identitätsarbeit von gehörlosen Menschen oder der Versuch, „die zu sein, die ich bin und die zu werden, die ich sein kann“. In: Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Evangelische Gehörlosenseelsorge (Hg.): Gehörlos – nur eine Ohrensache? Aspekte der Gehörlosigkeit. Hamburg: Signum, 107-118 Ilenborg, Ronald 2001: Das Ohr. In: Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Evangelische Gehörlosenseelsorge (Hg.): Gehörlos – nur eine Ohrensache? Aspekte der Gehörlosigkeit. Hamburg: Signum, 63-65 Ilenborg, Ronald 2001: Chancen und Grenzen des Cochlea-Implantats. In: Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Evangelische Gehörlosenseelsorge (Hg.): Gehörlos – nur eine Ohrensache? Aspekte der Gehörlosigkeit. Hamburg: Signum, 81-87 Jones, Lesley 1991: Veränderung der sozialen Rolle – Beziehungen und Hörverlust. In: Jussen, Heribert/Claußen W. Hartwig (Hg.): Chancen für Hörgeschädigte. Hilfen aus internationaler Perspektive. München: Rheinhardt, 187-191 Keupp, Heiner (u.a.) 2002: Identitätskonstruktionen. Das Patchwork der Identitäten in der Spätmoderne. Reinbek: Rowohlt 116 Klute, Dirk 1999: Glaubensübernahme, Glaubensaneignung, Lebenskrise. In: Breuer, Franz (Hg.): Abseits!? marginale Personen - prekäre Identitäten. REIHE: Psychologische Erkundungen; Bd. 1. Münster: Lit Verlag, 116-134 Krappmann, Lothar 1969: Soziologische Dimensionen der Identität. Strukturelle Bedingungen für die Teilnahme an Interaktionsprozessen. Stuttgart: Klett-Cotta Krappmann, Lothar 1998: Die Identitätsproblematik nach Erikson aus einer interaktionistischen Sicht. In: Keupp, Heiner/Höfer, Renate (Hg.): Identitätsarbeit heute. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 66-91 Kraus, Wolfgang 2000: Das erzählte Selbst. Die narrative Konstruktion von Identität in der Spätmoderne. Herbolzheim: Centaurus Krüger, Michael 1982: Der Personenkreis. In: Jussen, Heribert/Kröhnert, Otto (Hg.): Handbuch der Sonderpädagogik. Bd. 3: Pädagogik der Gehörlosen und Schwerhörigen. Berlin: Carl Marhold Verlagsbuchhandlung, 3-25 Krüger, Michael 1999: Gehörlose und schwerhörige Menschen. In: Fengler, Jörg/Jansen, Gerd (Hg.): Handbuch der Heilpädagogischen Psychologie. Stuttgart: Kohlhammer, 51-83 Kruse, Maren/Kiefer-Paehlke, Heike 1988: Schwerhörigkeit. Probleme der Identität. In: Hörgeschädigtenpädagogik: Beiheft 23. Heidelberg: Julius Groos Kyle, Jim 1990: Die Gehörlosengemeinschaft: Kultur, Gebräuche und Tradition. In: Prillwitz, Siegmund/Vollhaber, Thomas (Hg.): Gebärdensprache in Forschung und Praxis. Vorträge vom internationalen Kongreß der Gebärdensprache in Forschung und Praxis in Hamburg vom 23.-25.03.1990. Hamburg: Signum, 201-213 Lane, Harlan 1994: Die Maske der Barmherzigkeit. Unterdrückung von Sprache und Kultur der Gehörlosengemeinschaft. Hamburg: Signum Leonhardt, Annette 1999: Einführung in die Hörgeschädigtenpädagogik. München: Reinhardt Leven, Regina 2003: Gehörlose und Schwerhörige Menschen mit psychischen Störungen. Hamburg: Verlag hörgeschädigter kinder Lienhard, Peter 1992: Ertaubung als Lebenskrise. Bewältigung des Gehörverlustes im Erwachsenenalter. Dissertation: Luzern Matthes, Claudia 1996: Identität und Sprache. Gehörlose zwischen Laut- und Gebärdensprache, zwischen gehörloser und hörender Welt. Teil 1. In: Das Zeichen 37/96, 358-365 117 Merker, Hannah 1998: Listening - Eine Frau erkundet ihre verstummende Welt. Hamburg: Klein Miller, Tilly 2000: Kompetenzen – Fähigkeiten – Ressourcen: Eine Begriffsbestimmung. In: Miller, Tilly/Pankofer, Sabine (Hg.): Empowerment konkret. Stuttgart: Lucius und Lucius, 23-32 Miller, Tilly 2001: Systemtheorie und Soziale Arbeit. Entwurf einer Handlungstheorie. Stuttgart: Lucius und Lucius Padden, Carol/Humphries, Tom 1991: Gehörlose. Eine Kultur bringt sich zur Sprache. Hamburg: Signum Pankofer, Sabine 2000: Empowerment – eine Einführung. In: Miller, Tilly/Pankofer, Sabine (Hg.): Empowerment konkret. Handlungsentwürfe und Reflexionen aus der psychosozialen Praxis. Stuttgart: Lucius und Lucius, 7-22 Richtberg, Werner 1991: Hilfen für Angehörige von Hörschädigungen – „Familientherapeutische Seminare“. In: Jussen, Heribert/Claußen W. Hartwig (Hg.): Chancen für Hörgeschädigte. Hilfen aus internationaler Perspektive. München: Rheinhardt, 82-88 Richtberg, Werner 2001: (Zu-)Hören als Element menschlicher Begegnung. In: Bürgstein, Johann (Hg.): Qualitäten des Hörens. entwickeln und erleben; erfassen, verbessern, fördern; sich bewähren und verändern. Heidelberg: Median, 44-50 Rosen-Bernays, Esther 1992: Die Frage nach psychischer Norm und Psychopathologie bei gehörlosen Menschen – Eine kritische Auseinandersetzung mit bestehender Literatur und Resultaten einer eigenen Untersuchung. Dissertation. Zürich Schaffer, Hanne 2002: Empirische Sozialforschung für die Soziale Arbeit. Freiburg im Breisgau: Lambertus Schulz von Thun, Friedemann 2001: Miteinander Reden. Störungen und Klärungen. Bd.1. Reinbek: Rowohlt Seidenstücker, Gerhard/Jöckel, Beate 1998: Identität und Psychotherapie: Inwieweit lassen sich Phasen und Status der psychosozialen Entwicklung im Kontext von Psychotherapien nutzen? Eine Auseinandersetzung mit Konzepten von Marcia und Erikson. Bd. 25, Heft 6. Trier: Trierer Psychologische Berichte Sickendiek, Ursel (u.a.) 1999: Beratung. Eine Einführung in sozialpädagogische und psychosoziale Beratungsansätze. Weinheim: Juventa 118 Siegert, Michael T./Chapman, Michael 1987: Identitätstransformationen im Erwachsenenalter. In: Frey, Hans-Peter/Haußer, Karl (Hg.): Identität. Entwicklungen psychologischer und soziologischer Forschung. Stuttgart: Enke, 139-149 Stark, Wolfgang 1996: Empowerment. Neue Handlungsperspektiven in der psychosozialen Praxis. Freiburg im Breisgau: Lambertus Straus, Florian/Höfer, Renate 1998: Entwicklungslinien alltäglicher Identitätsarbeit. In: Keupp, Heiner/Höfer, Renate (Hg.) 1998: Identitätsarbeit heute. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 270-307 Tesch-Römer, Clemens 1990: Identitätsprojekte und Identitätstransformationen im mittleren Erwachsenenalter. Berlin: Max-Planck-Institut für Bildungsforschung Thiersch, Hans 1986: Die Erfahrung der Wirklichkeit. Perspektiven einer alltagsorientierten Sozialpädagogik. Weinheim: Juventa Thiersch, Hans 1993: Strukturierte Offenheit. Zur Methodenfrage einer lebensweltorientierten Sozialen Arbeit. In: Rauschenbach, Thomas (u.a.) (Hg.): Der sozialpädagogische Blick. Lebensweltorientierte Methoden in der Sozialen Arbeit. Weinheim: Juventa, 11-28 Thiersch, Hans 2001: Sozialpädagogik/Sozialarbeit. In: Keupp, Heiner/Weber, Klaus (Hg.) 2001: Psychologie. Ein Grundkurs. Reinbek: Rowohlt, 466-474 Thiersch, Hans 2001: Lebensweltorientierte Jugendsozialarbeit. In: Fülbier, Paul/Münchmeier, Michael (Hg.): Handbuch Jugendsozialarbeit. Bd 2. Münster: Votum, 777-789 Tönnissen, Susanne 1993: Gehörlose – Theoretische Aspekte. In: Landschaftsverband Rheinland (Hg.): Gehörlose im Arbeitsleben. Interdisziplinäres Forschungsprojekt des Landschaftsverbandes Rheinland, Hauptfürsorgestelle. Bd. 1. Köln: Rheinland Verlag, 20-41 Werth, I./ Sieprath, H. 2002: Interkulturelle Kommunikation zwischen Hörenden und Gehörlosen. In: Das Zeichen 61/02, 360-364 Whitbourne Krauss, Susan/Weinstock, Comilda 1982: Die mittlere Lebensspanne. Entwicklungspsychologie des Erwachsenenalters. München: Urban und Schwarzenberg 119 Internetquellen: Göser, Monika-Maria 2001: Die Auswirkungen des Internets auf die Identitätsarbeit hörgeschädigter Menschen. In: http://www.taubenschlag.de/lernen/wissenschaft/goeser/identitaet.pdf (24.06.2004) Seithe, Werner 1998: Psychische und soziale Auswirkungen von Schwerhörigkeit und Spätertaubung. In: http://www.schwerhoerigennetz.de/RATGEBER/MEDIZIN/RFERATE/psychische_auswirkung.htm – 17k (12.12.2004) http://www.arbeitsblaetter.stangltaller.at/KOGNITIVEENTWICKLUNG/Piagetmodell. shtml (17.09.2004) http://www.behindertenbeauftragter.de/files/1027946170.39/gleichstellungsgesetz.pdf (18.03.2005) http://www.schwerhoerigen-netz.de/RATGEBER/INFO/SCHWERHOERIGKEIT/ (10.12.2004) http://www.spaetertaubt.de/ (21.02.2005) http://www.uni-heidelberg.de/uni/presse/rc4/5.html (05.04.2005) 120