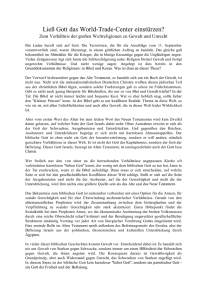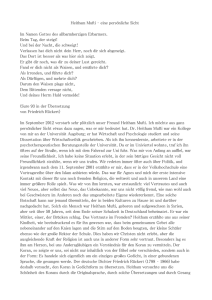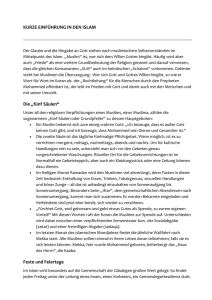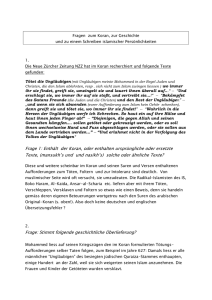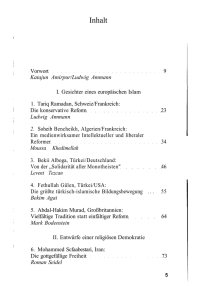bücher - Christ in der Gegenwart
Werbung

BÜCHER DER GEGENWART FRÜHJAHR 2016 Von Ludger Schwienhorst-Schönberger A braham begegnet uns sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Auch der Koran weiß viele Geschichten von Abraham zu erzählen. Ist es möglich, dass sich Judentum, Christentum und Islam mit Bezugnahme auf Abraham über grundlegende Fragen ihres Glaubens verständigen? Gibt es eine „abrahamische Ökumene“? Dieser Frage geht der Neutestamentler Hubert Frankemölle nach. Der Autor bringt reiche Erfahrungen aus seinem langjährigen Engagement im christlich-jüdischen Dialog mit. Er ist kein Islamwissenschaftler, hat sich aber intensiv mit dem Islam und dem Koran und seiner Auslegung befasst. Eine christlich geprägte theologisch-exegetische Sicht auf den Koran hat durchaus ihren Reiz und kann gegenüber einer rein religionswissenschaftlichen Perspektive einen Mehrwert bringen. Es steht die Frage im Raum, ob sich der Islam mit einer historisch-kritischen Sicht auf den Koran anfreunden kann. Als kundiger Exeget weiß der Autor um die Probleme und Herausforderungen, die sich mit der Anwendung dieser Methode auch innerhalb von Kirche und Theologie gestellt haben und stellen. Er kommt zu der Erkenntnis, dass die im interreligiösen Dialog oft geforderte „abrahamische Ökumene“ nicht möglich sei. Wie gelangt er zu diesem Ergebnis? Die andere Geschichte im Koran Zunächst erläutert Frankemölle, dass Abraham nur als eine literarisch gedeutete Figur existiert. In der Bibel und im Koran werden unterschiedliche Geschichten von Abraham erzählt. Die Frage, welche von ihnen nun die „wahre“ Geschichte sei, erübrigt sich, da uns außerhalb dieser Geschichten Abraham gar nicht zugänglich ist. Eine Geschichte Abrahams außerhalb der überlieferten Geschichten gibt es nicht. Es mag durchaus sein, dass Abraham gelebt hat. Für das Selbstverständnis von Judentum, Christentum und Islam ist aber nur der in je unterschiedlicher Weise erzählte und gedeutete Abraham von Bedeutung. Die Erzählungen und Deutungen hängen historisch miteinander zusammen, lassen sich aber nicht auf eine Erzählung zurückführen. Dabei sind die Verbindungen zwischen Judentum und Christentum von qualitativ anderer Art als die zwischen Christentum und Islam. Das Neue Testament bezieht sich auf den Abraham des Alten Testaments und schreibt ihn fort. Er ist für jüdische wie nichtjüdische Christusanhänger eine Identifikationsfigur. Der Koran dagegen erzählt eine andere Geschichte. Dabei schöpft er aus mündlicher Tradition. Für Mohammed wird Abraham (Ibrahim) zu einer Figur der Abgrenzung. Nach Sure 3,68 war Abraham weder Jude noch Christ, sondern Anhänger des unverfälschten monotheistischen Glaubens. Er ist der erste Muslim, der alle muslimischen Pflichten erfüllte. Demnach stehen Juden und Christen nicht in der Tradition der Religion Abrahams. Frankemölle stellt sämtliche Erzählungen über Abraham aus der Bibel und dem Koran vor und legt sie im Rahmen der in akademischen Kreisen anerkannten literaturwissenschaftlichen Methoden aus. Seine Ausle- Abraham in Geschichten Inwieweit eignet sich eine literarische Figur in Bibel und Koran für die Verständigung von Judentum, Christentum und Islam? gungen sind auch für Laien sehr verständlich geschrieben. Immer wieder erklärt er die zugrunde liegenden Methoden. Mit der historisch-kritischen Koranexegese unterscheidet er ältere und jüngere Texte im Koran. Er weiß aber auch, dass diese sogenannte diachrone Perspektive, also die zeitliche Betrachtung der Entwicklungsgeschichte, für die Aufnahme und Wirkung der Texte in der Glaubensgemeinschaft wenig austrägt. So gesehen hat auch im Koran die kanonische Exegese, die sich verbindlich am Gesamtzusammenhang des Schlusstextes orientiert und diesen auslegt, das letzte Wort. Aufgrund des textorientierten Zugangs ist das von Frankemölle erzielte Ergebnis gut nachvollziehbar: „Für Mohammed ist ‚Abraham‘ nicht der jüdisch-christlich geglaubte Abraham, sondern der muslimische ‚Ibrahim‘.“ Der Autor sieht damit die These des Islamwissenschaftlers Friedmann Eißler bestätigt: „Die Bezugnahme der drei großen religiösen Traditionen auf Abraham ist offensichtlich so unterschiedlich, dass die Behauptung einer grundlegenden Gemeinsamkeit entweder nur Hülle ohne Inhalt ist oder aber im Namen einer gemeinsamen Symbolfigur einer eigenen, neuen Konstruktion jenseits dessen bedarf, was in der jeweiligen Glaubensgemeinschaft in Geltung steht“. Mit dem von Frankemölle gewählten Zugang zum Thema steht die grundlegende Frage nach dem Verhältnis von Text und Offenbarung im Raum. Auch in christlichen Kreisen ist oft die Ansicht anzutreffen, die Bibel sei das Wort Gottes. Theologisch korrekt muss es jedoch heißen, dass die Bibel das Wort Gottes bezeugt. In diesem Sinne ist das Christentum keine Buchreligion. Gott offenbart sich selbst, und diese Selbstmitteilung Gottes wird in der Bibel bezeugt. Das Zeugnis der Bibel bedarf der Interpretation. Deshalb gehört die Auslegung der Bibel zum Selbstverständnis des Christentums, und zwar von seinen geschichtlichen Anfängen an und nicht erst seit der Aufklärung, wie immer wieder behauptet wird. In diesem Zusammenhang finden sich auch bei Frankemölle leider einige unklare Aussagen. Es war keineswegs so, dass die katholische Kirche erst mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil „jegliches wortwörtliche Verständnis der biblischen Texte ab(lehnte)“, wie Frankemölle behauptet. In der gesamten Geschichte der christlichen Theologie war man sich darüber im Klaren, dass nicht alles, was in der Bibel steht, in einem wörtlichen Sinn zu verstehen ist. Als ein Beispiel von vielen sei eine Aussage des Theologen Hugo von Sankt Viktor aus dem 12. Jahrhundert zitiert: „Es ist notwendig, dass wir einerseits in gewisser Weise dem Buchstaben folgen, … andererseits aber auch ihm in gewisser Weise nicht folgen, damit wir nicht zu der Ansicht gelangen, das Urteil über die Wahrheit hänge gänzlich vom Buchstaben ab. Nicht der Schriftkundige, ‚sondern der Geistige urteilt über alles‘ (1 Kor 2,15).“ EDITORIAL Abendland – christlich I st Religion Kultur? Wenn nicht – was denn sonst? Wenn es nicht eine Religion ist, ist es die Glaubenslosigkeit, die wesentlich über das kulturelle Leben einer Zivilisation bestimmt. Ohne Kultur gibt es keine Gemeinschaft, keine Gesellschaft, keinen Staat. Insofern sind sämtliche Debatten darüber, ob sich Religion aus der öffentlichen Sache, der res publica, also der Republik, herauszuhalten habe, absurd. Es gibt keine religionsfreie Zone, nirgendwo. Wo es nicht die Religion ist, bestimmt der Atheismus – ob ausdrücklich oder insgeheim – das Geschehen. Auch er ist nicht Privatsache, sondern öffentlich wirksam. Wo das eine verdunstet, verschwindet, dringt ein anderes hinein. So war es mit den Religionen der Antike, die sich zusehends als unglaubwürdig und unplausibel erwiesen und der aufgeklärteren Religion Christentum Platz machen mussten, die größere Überzeugungskraft hatte. Das Abendland wurde von da an kulturell-geistig eben nicht mehr durch hellenistische, römische, germanische, keltische oder sonstige Kulte bestimmt, sondern durch eine christliche Dynamik. Das Christentum hat das Heidentum kulturell abgelöst. Wird sich der christliche Glaube aber so weiterentwickeln, dass er auch in Zukunft die abendländische Kultur prägt? Oder werden andere Geisteskräfte mehr Plausibilität verbuchen? Der Islam? Thront am Ende über allem der Säkularismus? Es ist eine offene Frage. Das Geistesleben, die Literatur jedenfalls, belegt (noch), dass man am Christentum so leicht dann doch nicht vorbeikommt, selbst wenn wider alle Realität – ebenfalls absurd – behauptet wird, das christliche Abendland gebe es überhaupt nicht und habe es nie gegeben. rö. Leider hat sich auch in der Theologie das Klischee eingenistet, dass erst mit der Aufklärung oder in der katholischen Kirche sogar erst mit dem jüngsten Konzil ein fundamentalistisches Verständnis der Bibel überwunden worden sei. Diese häufig anzutreffende Ansicht ist schlichtweg falsch. Beim christlich-islamischen Dialog geht es nicht nur um das Thema „Religion vor oder nach der Aufklärung“, sondern es geht um das Offenbarungsverständnis selbst. Wie steht es um das Verhältnis von Text und Offenbarung im Islam? Gewöhnlich wird von einem grundlegenden Unterschied zwischen dem christlichen und dem islamischen Offenbarungsverständnis gesprochen: Die Bibel bezeugt die Offenbarung Gottes, der Koran ist die Offenbarung Gottes. Wenn das wirklich so ist, dann liegt hier eine bedeutende Differenz vor. „Abrahamische Ökumene“? Da nach Frankemölle die unterschiedlichen literarischen Bezeugungen Abrahams letztlich nicht aufeinander rückführbar sind, kann es für ihn keine „abrahamische Ökumene“ geben. In der Argumentation von Frankemölle ist diese Position logisch. Eine solche Ökumene könnte es nur dann geben, wenn die textlichen Bezeugungen Abrahams in den jeweiligen Religionen radikal relativiert würden. Wäre das für den Islam möglich? Gäbe es (noch) ein Judentum und ein Christentum, wenn sie die literarischen Ausdrucksgestalten ihrer Glaubenstraditionen radikal relativieren würden? Wäre das nicht der Abraham, der weder Bibel noch Koran besaß, sondern Gott glaubte und sich auf den Weg fortschreitender Erkenntnis machte, wie die Kirchenväter betonen? Gegen Ende des Buches deutet der Autor diesen Gedanken an: „Meine These, dass historisch-literarisch der in Bibel und Koran vorgestellte Abraham nicht als Urgestalt der Ökumene zwischen Juden, Christen und Muslimen genannt werden kann, besagt nicht, dass mittels der Metapher oder des Symbols ‚Abraham‘ aufgrund der interreligiösen Entwicklung vor allem der letzten ca. siebzig Jahre ‚Abraham‘ in transformierter und abstrahierter Gestalt nicht einen gemeinsamen Weg von Juden, Christen und Muslimen zu einem friedlichen Miteinander und zum Frieden in der Welt andeuten und eröffnen kann.“ Das Buch behandelt viele Fragen, die uns im Dialog der Religionen auf den Nägeln brennen: die Frage der Gewalt, die Bedeutung der Aufklärung, die historisch-kritische Exegese, das Offenbarungsverständnis. Es eignet sich hervorragend als Grundlage für den Dialog in Gemeinden und jüdischchristlich-islamischen Gesprächskreisen, weil es ganz konkret von Texten in Bibel und Koran ausgeht, diese miteinander vergleicht und über den Vergleich nachdenkt, die Texte also verstehenswissenschaftlich – hermeneutisch – reflektiert auslegt und miteinander ins Gespräch bringt. Ein wichtiges Buch zur rechten Zeit! Hubert Frankemölle Vater im Glauben? Abraham / Ibrahim in Tora, Neuem Testament und Koran (Verlag Herder, Freiburg 2016, 520 S., 34,99 €) 226 Gesellschaft Nr. 21 / 2016 BÜCHER CIG Was ist das „Abendland“? Wahrheit in Freiheit T oleranz. Angesichts der Flüchtlingsströme ein aktuelles Schlagwort. Intuitiv meint man, genau zu wissen, was damit gemeint ist. Doch soll man seine Bedeutung erklären, wird es schwierig, eine passende Umschreibung zu finden. Kardinal Karl Lehmann nähert sich dem Begriff zunächst in historischer Betrachtung. Blitzlichtartig erhellt er Sichtweisen verschiedener Personen sowie Phasen in der Entwicklung des Toleranzverständnisses. Dabei wird deutlich, dass es keineswegs immer mit positiven Vorstellungen verbunden und ohne Widersprüche war. Augustinus etwa bewertete tolerantia zwar einerseits als fundamentale Grundtugend, die ein friedfertiges Leben der Gemeinde garantieren soll, sah andererseits aber Zwangsbekehrung als gerechtfertigt an. Thomas von Aquin ging mit Ketzern ähnlich hart ins Gericht, brachte jedoch neu den Gedanken des irrenden Gewissens ein, das zu respektieren ist. Wer voller Überzeugung ist, etwas Gutes zu tun, kann nicht sündigen. Nikolaus von Kues schließlich sah in den vielen verschiedenen religiösen Ausdrucksformen Entfaltungen der einen wirklichen Wahrheit. Eine andere kritische Dimension zeigt sich beispielsweise bei Nietzsche, der Toleranz als ein Zeichen der Schwäche des Geistes und des Charakters beurteilte, eine Unfähigkeit, sich für ein klares Ja oder Nein zu entscheiden. Das Ringen um die Religionsfreiheit war ein sehr langer Weg. Die Problematik liegt im Wahrheits- und Absolutheitsanspruch des Christentums – und auch der anderen monotheistischen Religionen. Wenn der eigene Glaube wahr ist, wie verhält man sich dann gegenüber einem anderen, „falschen“ Glauben? Weder indifferente Gleichgültigkeit ist die Lösung noch die Verneinung der Freiheit und Würde des anderen. Denn dies bedeutete für Christen einen Widerspruch zu den Evangelien. Als im Zweiten Vatikanischen Konzil anderen Religionen ein Licht der Wahrheit zuerkannt wurde, ging man auf dem Weg der Toleranz einen großen Schritt nach vorne. Der Toleranzdiskurs entzündete sich zwar an der Frage der Religionsfreiheit, mittlerweile aber hat er sich auch in den gesellschaftlichen und politischen Raum ausgeweitet. Toleranz steht auch hier im Spannungsfeld von Wahrheit und (Gewissens-)Freiheit. Außerdem gibt es eine falsche „Toleranz, die zum Selbstmord führt“, und zwar wenn sie Leuten entgegengebracht wird, „die ihrerseits von Toleranz nichts halten“. Angesichts heutiger Bedrohung durch fundamentalistische Strömungen, ist das eine sehr wichtige Einschränkung. Das Buch bietet keine konkreten Handlungsanweisungen für aktuelle gesellschaftspolitische Fragen. Dem Autor geht es um eine „Grundsatz-Besinnung“, die dazu befähigen soll, sich ein eigenes Urteil zu bilden. Lehmanns Ausführungen sind knapp und dicht, mit vielen Hinweisen auf Literatur zur Vertiefung. Die Texte gehen auf drei Gast-Vorlesungen und eine Seminarsitzung an der Universität Düsseldorf zurück. Daher verlangt das Buch einen sehr aufmerksamen Leser. Dorothea Röser Karl Lehmann Toleranz und Religionsfreiheit Geschichte und Gegenwart in Europa (Verlag Herder, Freiburg 2015, 144 S., 19,99 €) Entzaubert – verzaubert D er Mensch glaubt an Gott, weil es absurd, unvernünftig ist? Nein. Eher: weil es plausibel, vernünftig ist. Und das mit den Befunden der Naturwissenschaften. Solche aus Kosmologie und Evolutionsbiologie zählt der Heidelberger Theologe Norbert Scholl auf, was über die Hälfte seines Buches ausmacht. Er beschreibt, warum die Deutungen von Sein und Zeit trotzdem nicht die letzten jener Fragen, die unserem Verstand möglich sind, beantworten. Etwa: welcher Anfang „vor“ dem Anfang lag und welchen Raum und welche Zeit es in der physikalischen Singularität des „Nullpunkts“ ohne Raum und ohne Zeit „gab“. Das sprengt jedwede Anschauung, ebenso wie die Theorie, dass es niemals einen Anfang gab, weil alles „ewig“ schon „da“ war und „da“ sein wird, wenn auch nicht als Materie, nicht einmal als Energie, sondern als …? Mit jeder Entzauberung beginnt die nächste Verzauberung des grundlegend Mysteriösen. Das schließt die Gottesahnung nicht aus, sondern nährt sie, wie der Autor nahelegt. Bleibt uns schlussendlich doch nur übrig, in allem eine Art „geistiges Prinzip“ anzunehmen? Woher aber kommt dieses, was begründet „Gott“? Schließlich: Was bedeutet das alles für den christlichen Glauben? Darauf geht Scholl im letzten Drittel ein, eher kursorisch und selektiv, indem er auf die Begrenztheit des hellenistisch inkulturierten und entspre- chend philosophisch in Dogmen gefassten Glaubens- und Gottes„wissens“ verweist. Die Lehre von der Dreifaltigkeit / Dreieinigkeit könnte als kommunikative Dynamik des Göttlichen transparent gemacht werden, schlägt Scholl vor, wobei er jenseits der spekulativen Begrifflichkeit vom Gott(essohn) Christus den Menschen(sohn) Jesus, die Bedeutung der Inkarnation, betont. Da liegen allerdings auch Grenzen. Die Sicht auf den vorbildlichen Menschen und Propheten Jesus produziert selber die Gefahr, ihn auf eine sozial-moralische Gestalt zu verengen, ihn zu einem „Werte“-Protagonisten zu stilisieren. Die Frage nach dem Ersten und Letzten, dem Ewigen und dem Nichts, also nach dem Göttlichen, geht als Glaubensfrage darin jedoch nicht auf. Das wird in den Bemerkungen übers Beten deutlich, das über die Plausibilitäten und Bedrängnisse des Diesseits hinaus ausgreift. Das Jenseitige, Transzendente lässt den denkenden, ahnenden Menschen nicht los. Das zeichnet das Buch – trotz mancher „Schnelldurchgänge“ – anregend nach. Johannes Röser Norbert Scholl Glauben im Zweifel Der moderne Mensch und Gott (Lambert Schneider Verlag in der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft, Darmstadt 2016, 224 S., 19,95 €) A nlässlich der Verleihung des KarlJaspers-Preises 2015 bekannte Hans Maier: „Ich hätte meine Wissenschafts- und Lebensthemen wohl nicht in friedlichen und ruhigen Zeiten gefunden.“ Tatsächlich war der Weg des einstigen bayerischen Kultusministers und Präsidenten des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, der aus einfachen Verhältnissen stammt, keineswegs vorgezeichnet. Vielmehr musste die Mutter den Stipendiaten in der Freiburger Verwandtschaft sogar gegen den Verdacht verteidigen, eine gescheiterte Existenz zu sein. Dass es vor allem das „Katholische“ war, das den Historiker und Politologen zeitlebens bewegte, sich mit einem durch den NSTotalitarismus geschärften Wertebewusstsein dem Spannungsverhältnis von Religion und Gesellschaft zu widmen, davon gibt der Band „Christentum und Gegenwart“, der anlässlich Maiers 85. Geburtstags zusammengestellt wurde, auf beeindruckende Weise Auskunft. Ein Schwerpunkt des Buches gilt den christlichen Wurzeln europäischer Identität – der Frage nach dem, was das Abendland konstituiert. Wurde dem führenden katholischen Intellektuellen für diesen Ansatz früher nicht selten Kritik und Ab- lehnung entgegengebracht, inspirieren seine Forschungen heute junge Muslime, Möglichkeiten für einen europäischen Islam auszuloten. „Braucht Rom eine Regierung?“ Auch das fragt der einstige GuardiniLehrstuhlinhaber. Dem ältesten „Global Player“ der Welt, der katholischen Kirche und ihrer Zentrale im Vatikan, bescheinigt Maier dabei ein Zurückbleiben hinter den eigenen Möglichkeiten. „Man stelle sich ein profanes Kabinett vor, in dem Abstimmung und Koordination der freien Initiative der einzelnen Ressorts unterliegen.“ Schließlich kommt auch der Künstler, der den Gesang der Gemeinde jeden Sonntag als Organist begleitet, zu Wort: „Von der Schönheit des Christentums“ lautet ein Aufsatz. Darin zitiert der Autor ein Gedicht von Gerald Manley Hopkins (1844–1889): „Ehre sei Gott für gesprenkelte Dinge“. In der Kunst, der gesprenkelten Schönheit des Glaubens auf die Spur zu kommen, hat Hans Maier es weit gebracht. Thomas Brose Hans Maier Christentum und Gegenwart Gesammelte Abhandlungen. Hg. von Ulrich Ruh (Verlag Herder, Freiburg 2016, 488 S., 39,99 €) Die Vernunft der Bibel W elchen Beitrag haben das Alte und das Neue Testament geleistet, um Menschen aufzuklären? Mit dieser spannenden Frage, deren Tragweite weit über das Biblische hinausgeht, befasst sich der Neutestamentler Gerhard Lohfink. Sein umfangreicher Band versammelt zwanzig Vorträge, die er bei der Münchner Integrierten Gemeinde gehalten hat. Der Verfasser will zeigen, dass und wie der Glaube der christlich-jüdischen Tradition die Vernunft sucht und braucht. So geschieht etwa in den Schöpfungsgeschichten des Alten Testaments Entmythologisierung – und damit Aufklärung –, wenn die Gestirne, die im Umfeld Israels als Götter angesehen wurden, bloß funktionalistisch als „Lampen“, als große Leuchte für die Sonne und kleine Leuchte für den Mond, bezeichnet werden. Andere Beiträge befassen sich mit der Kraft des Christusglaubens der ersten Christen, den sie als „Erleuchtung“ (Cyprian von Karthago) beschrieben haben, ein Begriff, den die europäische Aufklärung übernommen hat. Der Autor argumentiert historisch orientiert. Er erinnert an die Erkenntnisse von Bibelwissenschaft und Theologie, die angesichts der Glaubenserosion im gesellschaftlichen Bewusstsein verschwinden. Eine notwendige wie klug aufbereitete Anregung – nicht nur für christliche Leser. Jürgen Springer Gerhard Lohfink Im Ringen um die Vernunft Reden über Israel, die Kirche und die Europäische Aufklärung (Verlag Herder, Freiburg 2016, 560 S., 29,99 €) Keine Vergeltung V erzeihen und Vergeben sind konstituierende, bisweilen auch moralisch überhöhte Begriffe im Christentum. Die Philosophin Svenja Flaßpöhler beleuchtet das Thema im Kontext von Schuld angenehm sachlich. Verzeihen sei zunächst nichts anderes als der Verzicht auf Vergeltung. In ihren Augen ist das dennoch eine Art menschliches Wunder. Es sei nicht logisch, nicht gerecht und nicht ökonomisch im Sinne eines Schuldausgleichs. Unter welchen Bedingungen kann Verzeihen geschehen? Heißt Verzeihen automatisch auch Verstehen, Lieben, Vergessen? Bei der differenzierten Beschäftigung streift Flaßpöhler große Philosophen und Schriftsteller wie Derrida, Nietzsche, Arendt oder Dostojewski. Themen wie Schuld, freier Wille oder das Böse werden behandelt. Die Autorin driftet jedoch niemals in eine Fach- diskussion ab. Dies liegt auch daran, dass sie nicht nur vier Betroffene (ein Opfer, einen Täter, zwei Holocaust-Überlebende) zu Wort kommen lässt, sondern auch Einblicke in ihren persönlichen Umgang mit Verzeihen gewährt – Svenja Flaßpöhler wurde als Vierzehnjährige von ihrer Mutter verlassen. Das Buch geht in feinen Nuancen einen eigenen Weg – jenseits einer theologischen oder psychologischen Betrachtung. Eine wohltuendrationale, gleichzeitig menschlich-warme Inspiration für einen individuellen Umgang mit dem Verzeihen. Elena Griepentrog Svenja Flaßpöhler Verzeihen Vom Umgang mit Schuld (Deutsche Verlags-Anstalt, München 2016, 223 S., 17,99 €) CIG BÜCHER Nr. 21 / 2016 Jesusgeschichte 227 Der Ermittler und seine Bilder Mit dem Schriftsteller Emanuelle Carrère und seinem Lukas auf Spurensuche nach dem Jesus aus Fleisch und Blut. Von Christian Heidrich W ir feiern Ostern, Christi Himmelfahrt und Pfingsten, weil wir einer Nachricht vertrauen, die vor 2000 Jahren in einem eher obskuren Winkel des römischen Imperiums ihren Ausgang nahm. Ist das nicht verrückt, nicht staunenswert? Auch Emmanuel Carrère, 1957 in Paris geboren, erfolgreicher Schriftsteller, Drehbuchautor und Filmproduzent, staunt – und ist entsetzt. Darüber hat er ein Buch geschrieben, das ursprünglich „Lukas’ Ermittlung“ heißen sollte und schließlich den frommen Titel „Das Reich Gottes“ erhielt. Beides passt, auch wenn man sich von Carrères Frömmigkeit nicht allzu viel versprechen sollte. Anfang der neunziger Jahre hatte er, wie er freimütig und vielleicht etwas zu ausführlich beschreibt, eine „christliche Phase“. In dieser Zeit kommentierte er penibel alle Verse des Johannesevangeliums, achtzehn dicke Hefte habe er so vollgeschrieben. Doch das ist aufgehobene Vergangenheit, fast nicht mehr wahr. Seine heutige Selbstbeschreibung: „ein Ungläubiger. Ein Agnostiker – nicht mal gläubig genug, um Atheist zu sein … Es geht mir ziemlich gut damit.“ Emmanuel Carrère ist ein mit allen Wassern der (post)modernen Schreibstrategien gewaschener Intellektueller. Wer in seine früheren Veröffentlichungen hineinschaut, merkt schnell, dass seine Auseinandersetzungen mit fremden Schicksalen, mit Mehrfachmördern, Tsunami-Opfern oder russischen Skandalautoren letztlich immer in eine Selbstbefragung münden. Welches Ich spricht hier eigentlich?, fragt sich dann der Leser. Was ist wahr, was erdacht? Hält man ein Sachbuch oder einen Roman in den Händen? Wer diesen Autor liest, muss aufpassen, kann seine discretio, seinen Unterscheidungssinn, gut gebrauchen. Der Lohn der Lektüren freilich ist ein außerordentlicher. Jetzt widmet der „gelassene Agnostiker“ Hunderte von Seiten einer verblüffenden Spurensuche, bei der Jesus und noch mehr Paulus und der Evangelist Lukas die Haupt- rolle spielen. Das weist darauf hin, dass etwas von der christlichen Weltsicht, von ihrer Energie, lebendig geblieben ist. Carrère ist das natürlich bewusst, auch wenn er nicht sicher ist, wie seine Motive genau zu bestimmen wären. Er möchte die Texte des Neuen Testaments noch einmal genauer anschauen, möchte den „zentralen, mysteriösen Fragen“ nachgehen. Etiketten à la „Romanautor“ oder „Historiker“ scheinen ihm zweitrangig, am ehesten sagt ihm „Ermittler“ zu. Und ja, es ist eine Ermittlung, die sich der ersten nachchristlichen Jahrzehnte annimmt, der Jahre 50 bis 90, als noch niemand ahnen konnte, dass sie später nach einem jüdischen Wanderprediger benannt werden würden. Die Eingangstür, die Carrère wählt, ist Lukas, der Evangelist, der auch der Verfasser der Apostelgeschichte ist. Diese Wahl ist erstaunlich, denn über den Menschen Lukas wissen wir faktisch nichts. Davon ist zumindest die kritische Bibelwissenschaft überzeugt. Sie ist auch sehr skeptisch gegenüber der kirchlichen Tradition, die den Evangelisten mit dem „Arzt Lukas“ (Kol 4,4) identifiziert, der bei Paulus als Einziger in dessen römischer Haft ausharrt (2 Tim 4,11). Der Schriftsteller Lukas lebte „in einer anderen“ Zeit, so lautet das exegetische Argument. Zudem scheint er die Paulusbriefe nicht zu kennen. Wie eine Gemäldegalerie Carrère, der „Ermittler“, hält dagegen und beruft sich vor allem auf den mehrfachen Perspektivenwechsel in der Apostelgeschichte, auf die dort vorkommenden „Wir“-Berichte. „Ich war dabei“, flüstert Lukas seinen Lesern zu. Davon ist zumindest Carrère überzeugt, auch wenn er im Laufe seiner Ausführungen immer wieder darauf hinweist, dass es ihm nicht um Historisches im strengen Sinne des Wortes geht, um Nachvollziehbares vielmehr, um Plausibles. Und so ist sein Werk auch eine lang gesponnene Erzählung, in der tatsächlich Nachvollziehbares geboten wird. Ein so „fiktiver“ wie „möglicher“ Bericht, der auf den Leser wie eine kostbare Gemäldegalerie wirkt, deren Bilder von all dem träumen, was die Bibelwissenschaftler aussparen müssen, weil ihnen die Quellen fehlen. Carrère muss sich um Belegbares nicht kümmern. Er vertieft sich in die Schriften des Lukas und in die Paulusbriefe, punktet gleichzeitig mit schriftstellerischer Phantasie und Eleganz. Lukas, der Evangelist mit dem besten Griechisch, könnte Paulus, so der Ermittlungsansatz, im Hafen von Troas begegnet sein. Er ist einer jener „gottesfürchtigen Heiden“, die von dem jüdischen Glauben und seiner Ethik angezogen waren, für die ein Synagogenbesuch nichts Ungewöhnliches darstellte. In der Synagoge hört er die Predigt des durchreisenden Paulus von dem gekreuzigten Messias, von dem Erlöser am Kreuz. Für die meisten Juden ist das ein schrecklicher, ein blasphemischer Gedanke, nicht aber für den frommen Heiden Lukas, der sich mit der Botschaft des Mannes aus Tarsus anzufreunden vermag, zugleich mit dem Mann selbst. Vielleicht kommt ihm zupass – und das ist eines der zahllosen „Vielleicht“ in diesem Buch –, dass er Arzt ist und sich um einen „fiebergeschüttelten und schmerzgepeinigten“ Paulus zu kümmern hat? Wie auch immer: Lukas, so Carrère, folgt von nun an Paulus’ Spuren, wird zu seinem zeitweiligen Begleiter und ist schließlich auch in Jerusalem dabei, als der Völkerapostel eine Kollekte seiner Gemeinden an die „Mutterkirche“ abliefert und sich zugleich bemüht, von Jakobus, dem „Herrenbruder“, und anderen Urgesteinen ein Einverständnis für seine „gesetzesfreie“ Heidenmission zu erlangen. Für Paulus endet die Geschichte in einem Desaster. Er wird aus zwielichtigen Gründen verhaftet, schließlich nach Rom überstellt, wo sich seine Spur verliert. Für Lukas aber beginnt, so Carrères grandioser Einfall, eine „Ermittlung“ ganz eigener Art. Hatte er bisher nur den „paulinischen Christus“ kennengelernt, einen Christus, der als himmlischer Erlöser verkündigt wird, aber als ein Mensch aus Fleisch und Blut kaum greifbar ist, so macht er sich jetzt auf die Suche nach dem historischen Jesus. Er befragt die noch lebenden Zeitzeugen, ist begierig, von Worten und Taten des Nazareners zu hören, die ersten Quellen zu sichten. Das letzte Abendmahl zum Beispiel. Wo hat es überhaupt stattgefunden? Bisher, so phantasiert Carrère, habe sich Lukas den Ort als eine Art Olymp zwischen Himmel und Erde vorgestellt. Hier, in Jerusalem, wird ihm plötzlich bewusst, dass es „fünfundzwanzig Jahre zuvor in einem wirklichen Raum eines wirklichen Hauses und im Beisein von wirklichen Menschen“ stattgefunden hatte. Das klingt banal, ist auch banal, und doch könnten solche Gedanken der Antrieb gewesen sein nachzuschauen, wie es „wirklich“ gewesen ist. Wer das auffällige „Vorwort“ des Lukasevangeliums liest, wird genau darauf verwiesen. Nun ist Carrère alles andere als naiv. Er hat sich in die exegetische Literatur eingearbeitet, fragt beispielsweise nach dem Ursprung des lukanischen „Sonderguts“, nach den Stücken also, die nur im Lukasevangelium zu finden sind. Das „Magnificat“ gehört dazu, das Gleichnis vom verlorenen Sohn, die Zachäus-Erzählung und andere ausgesprochen liebenswürdige Verse. Aus dem „Gewirr von Hypothesen“ scheint Carrère die Aussage, Lukas „hat es frei erfunden“, am wahrscheinlichsten. Das mag sich, so der Autor, wie ein „Sakrileg“ anhören, aber als Schriftsteller schaue er genau auf das Handwerk eines Schreibenden, und dass Lukas „viel erfunden hat, scheint mir auf der Hand zu liegen“. Kleine Wunder Nein, nach vielen Seiten einer unterhaltsamen und geistreichen Erzählung aus dem urchristlichen Milieu, nach kapitalen Seitenblicken auf Nero oder Seneca, entlässt uns Emmanuel Carrère nicht mit seinen nüchternen Erkenntnissen zur „Quellenkritik“. Er ist zwar „nicht länger Christ“, das heißt aber nicht, dass ihn die christliche „Umwertung aller Werte“ in Ruhe lässt, dass sie ihm gleichgültig ist. Da wäre zum Beispiel diese Fußwaschung, von der nur im Johannesevangelium die Rede ist. Liegt hier nicht ein „Sakrament“ vor, eine „Glückseligkeit“? Und so endet das Buch mit einer Einkehrzeit in einer der von Jean Vanier begründeten Arche-Gemeinschaften. Mit etwa vierzig Personen, zu denen auch Schwerbehinderte gehören, nimmt Carrère an einer Zeremonie der Fußwaschung teil. „Das ist das Christentum, sage ich mir.“ Es ist eines der kleinen Wunder dieses so reichen Buches, dass auch diese Szene den Leser nachdenklich macht. Emmanuel Carrère Das Reich Gottes Aus dem Französischen von Claudia Hamm (Matthes & Seitz, Berlin 2016, 524 S., 24,90 €) Zum »Jahr der Barmherzigkeit« Habt Mut! Jetzt die Welt und die Kirche verändern geb. m. SU, ISBN 978-3-7022-3508-6 144 Seiten, € 14.95 N EU Soeben erschienen – und gleich »Religiöses Buch des Monats« Erwin Kräutler / Josef Bruckmoser Raniero Cantalamessa DAS ANTLITZ DER BARMHERZIGKEIT Erwin Kräutler benennt sieben Kategorien für ein Leben, das vor dem eigenen Gewissen und vor der Mitwelt bestehen kann. In seinem Plädoyer stützt er sich auf die Bibel, auf seine Erfahrung als Seelsorger in Amazonien und auf Papst Franziskus. P. Cantalamessa, offizieller Prediger des Päpstlichen Hauses, lotet in diesem ebenso berührenden wie qualifizierten, biblisch fundierten Buch aus, was Barmherzigkeit bedeutet – für den Einzelnen und die Kirche. 192 S., geb., ISBN 978-3-7346-1079-0, EUR (D) 19,95 In jeder guten Buchhandlung oder direkt bei: www.tyrolia-verlag.at VERLAG NEUE STADT Münchener Str. 2, D-85667 Oberpframmern, Tel. 08093 2091 E-Mail: [email protected] www.neuestadt.com 228 Kirchengeschichte Nr. 21 / 2016 BÜCHER CIG Da der „Ketzer“, dort der „Antichrist“ Annäherungen an Luthers Reformation: wie beiderseitige Ängste und Feindbilder eine Verständigung blockierten. D er Unterschied zwischen einem Heiligen und einem Ketzer ist nur ein gradueller, vor allem aber ist er eine Frage der Perspektive. So banal diese Einsicht klingt, so sehr setzt sie doch den notwendigen Abstand zu der im Zentrum des Interesses stehenden Person voraus. Die sogenannte Luther-Dekade, die sich ihrem Höhe- und Endpunkt im Herbst 2017 nähert, macht einen objektiven Abstand zum Reformator aus Wittenberg sicherlich nicht leichter. Um so erfreulicher ist es, dass Volker Reinhardts Buch „Luther, der Ketzer“ sich als „gleichberechtigte Simultanerzählung“ versteht, in der Wahrnehmungen und Argumente gegenübergestellt und nicht gegeneinander aufgerechnet werden. Dieser Versuch, ein und dasselbe Ereignis – die Reformation – von beiden Standpunkten aus zu betrachten, ist geglückt. Das Ergebnis ernüchtert indes: Denn nach über 300 Seiten eines spannend erzählten Lebens in unruhigen Zeiten hat sich die Erkenntnis Bahn gebrochen, dass es seit dem ominösen Thesenanschlag im Herbst 1517 niemals wirklich eine Chance auf Versöhnung zwischen zwei Positionen gab, die sich gegenseitig verteufelten. Der Teufel ist allgegenwärtig in Luthers Erwiderungen auf alles, was aus Rom kam und in Wittenberger Per- spektive als Werk des „Antichrist“ galt. Aber auch die Kurie und manche ihrer Legaten bemühten den Fürsten der Finsternis, um ihr Luther-Bild zu illustrieren. Interessant dabei, dass gelegentlich von „den Lutheranern und ihrem Mahommed“ die Rede war und die sich neu formierende Glaubensgemeinschaft als „Synagoge“ bezeichnet wurde. Reinhardt zeigt überzeugend, wie die Entfremdung zwischen „Rom“ und den Anhängern der neuen Lehre auf der Unfähigkeit beruhte, mit dem Fremden umzugehen, das eben schlechterdings nur „vom Teufel“ kommen konnte. In der Wahrnehmung des jeweils Fremden überlagerten sich indes vom Anbeginn des Konflikts an zwei völlig verschiedene Ebenen. Ja sie vermischten sich: hier die theologische Auseinandersetzung um die Willensfreiheit, die Luther aus einem tiefen anthropologischen Pessimismus heraus bestritt – dort die „nationalen“ Stereotypen vom geschliffenen italienischen Humanisten einerseits und dem schlichten Mönch aus dem unzivilisierten Germanien andererseits, der kaum des Lateinischen mächtig war. Dabei wird aus Volker Reinhardts Darstellung deutlich, wie die lutherische Seite ganz bewusst das Bild des einfachen, aber authentischen Mannes gegenüber der triumphierenden und mit allen Wassern gewaschenen römischen Kirche bediente und die Klaviatur der „Öffentlichkeitsarbeit“ bestens beherrschte. Vor diesem Hintergrund erscheint ein Mann wie Gasparo Contarini wie eine tra- Das Lesebuch zum Katholikentag gische Gestalt: Der Gesandte, den Papst Paul III. für die Regensburger Religionsgespräche ausgewählt hatte, stand den spirituali nahe, einer italienischen Reformbewegung, die mit Luthers Theologie viel gemeinsam hatte – außer der Verneinung des freien Willens, auf der Luther allerdings ebenso starr beharrte, wie Rom auf dem Primat des Papstes bestand. So musste Contarinis Mission scheitern, weil beide Positionen plötzlich zum Kernbestand der jeweiligen Theologie erklärt wurden, was sie keinesfalls waren und sind. Nicht nur an diesem Beispiel zeigt sich, wie erhellend Reinhardts Bestreben ist, „zu beobachten, wie auf beiden Seiten Ängste und Heilserwartungen, Loyalitäten und Feindbilder, politische und gesellschaftliche Ordnungsvorstellungen, Denkstile und Glaubensweisen zu der subjektiven Überzeugung führen, objektiv auf der richtigen Seite zu stehen.“ Anders nähert sich Ulrich Köpf dem Reformator und seiner Zeit. Der Verfasser orientiert sich vornehmlich an den theologischen Positionen und bringt grundsätzliche Fragen der Forschung zur Sprache, etwa diejenige, ob Luther eher als Mensch des Mittelalters oder der anbrechenden Neuzeit zu bewerten sei. Köpfs Studie ist eng an der Biografie Luthers ausgerichtet, aber trotz seines Bestrebens, den Reformator „vor dem Hintergrund seiner Zeit“ zu betrachten, kommen gegenüber den theologischen und theologiegeschichtlichen Aspekten die politischen und kulturgeschichtlichen Parameter der frühen Neuzeit zu kurz. Mit besonderem Gewinn liest man indes die beiden Kapitel über Luthers Verhältnis zu den Juden, das als eine Geschichte der enttäuschten Hoffnungen erzählt wird. Wenn Köpf allerdings manche holzschnittartige Äußerung des Wittenbergers mit dem „grobianischen Stil seiner Zeit“ erklärt, möchte man die ironisch-geschliffene Rede eines Erasmus von Rotterdam ebenso dagegenhalten wie die feinsinnigen Differenzierungen eines Contarini. Dass Köpf gelegentlich von „Martin“ spricht und all die, welche dessen Überzeugungen nicht teilen, als die „Altgläubigen“ bezeichnet, lässt bisweilen die notwendige Distanz vermissen. Diese ist indes umso notwendiger, als hinter dem theologischen Streit um Sakramente, päpstlichen Primat und freien Willen eben ein kultureller und national aufgeladener Konflikt steht, der Luther durchaus bekannt war. In einer seiner späten Tischreden äußerte er selbstbewusst: „Ich bin der neue Arminius, der Deutschland von der neuen Tyrannei Roms befreit und Rom verwüstet.“ Clemens Klünemann Volker Reinhardt Luther, der Ketzer Rom und die Reformation (Verlag C. H. Beck, München 2016, 352 S. mit 24 Abb., 24,95 €) Ulrich Köpf Martin Luther Der Reformator und sein Werk (Reclam Verlag, Ditzingen 2015, 254 S., 22,95 €) Ein angesehener Islamexperte erzählt Paul Hinder ist bekannt als der »Bischof von Arabien«. In Abu Dhabi, seinem Bischofssitz, hat er Erfahrungen gemacht, die Antworten geben auf die Frage, wie der Dialog mit dem Islam gelingen kann. Hinder schildert die Situation der Christen am Golf und beschönigt nicht, sondern liefert ehrliche Einblicke in eine Welt, die für Christen nicht immer einfach ist. AuthentischAnzeige Herder erzählt und spannend geschrieben. In Magazinform und in attraktiver Gestaltung, leichtfüßig, luftig, journalistisch, mit verschiedenen Blickwinkeln, bietet das Buch Wünsche von Prominenten, Geschichten rund um die Katholikentage, Interviews, Bilder. Zum Zwischendurchlesen, zum Querlesen, zum Reinlesen in der Straßenbahn, der Warteschlange oder daheim auf dem Sofa. Ein Mitbring-, Geschenk-, und Erinnerungsbuch. Ein ansprechendes, ein schönes Buch. 208 Seiten | Gebunden mit Schutzumschlag € 19,99 / SFr 26.90 / € [A] 20,60 ISBN 978-3-451-34883-9 112 Seiten | Klappenbroschur € 12,99 / SFr 16,90 / € [A] 13,40 ISBN 978-3-451-31130-7 Neu in allen Buchhandlungen oder unter www.herder.de Neu in allen Buchhandlungen oder unter www.herder.de Bibel / Philosophie 229 CIG BÜCHER Nr. 21 / 2016 Der erste Paulusbrief D er erste Thessalonicherbrief wird heute gewöhnlich als die älteste Schrift des Neuen Testaments angesehen. Da er bald nach der Gründung der Gemeinde von Thessaloniki entstand, lässt sich an ihm besonders gut ablesen, welche Fragen und Probleme eine junge Christengemeinde in einer hellenistischen Großstadt umtreiben konnten. Außerdem sind Rückschlüsse auf die Erstverkündigung des Paulus möglich. Rudolf Hoppes Kommentar, Frucht einer mehr als zwanzig Jahre währenden Beschäftigung mit dieser Schrift, legt besonderes Augenmerk auf diese beiden Fragerichtungen. Vor dem erklärenden Durchgang durch den Text werden, der Gattung eines exegetischen Kommentars entsprechend, die historischen Entstehungsbedingungen sowie die literarischen und theologischen Merkmale besprochen. Im Hinblick auf Abfassungsort und Abfassungszeit folgt der Autor mit gutem Grund der verbreiteten Einschätzung, Paulus habe den Brief im Jahr 50 in Korinth geschrieben. Diese geschichtliche Verortung wird erhellend eingebettet in übergreifende Zusammenhänge: in den Weg der Christusbotschaft in die hellenistische Welt; in die Besonderheiten des antiken Thessaloniki (Geschichte, soziale Struktur, überaus vielfältiges religiöses Leben); in die Gegebenheiten des missionarischen Wirkens des Paulus, zu deren Rekonstruktion mit der Apostelgeschichte eine zweite, kritisch auszuwertende Quelle vorliegt. In Absetzung von deren Darstellung (Apg 17,1–10) sieht Hoppe die Adressatenschaft des paulinischen Wirkens vor Ort wie auch des Briefes nicht jüdisch geprägt. Die neue Existenz in Christus führte für die Glaubenden in Thessaloniki zur Erfahrung der Ausgrenzung, und zwar im Hinblick auf ihre heidnische Mitwelt. So muss Paulus „die Frage nach dem ,Gewinn‘ des Evangeliums gegenüber ihren bisherigen Lebenskonzepten“ im Brief bearbeiten. Als thematische Schwerpunkte erkennt Hoppe die Danksagung für den Glaubensweg der Adressaten, die Beziehung zwischen Paulus und Gemeinde sowie die Darlegung einer neuen Ethik – nachdrücklich eingeschärft durch die Betonung der baldigen Wiederkunft Christi. Die Kommentierung folgt nach der Übersetzung einem bewährten Dreischritt. Die Analyse ordnet den jeweiligen Abschnitt in den Zusammenhang ein, erfasst die sprachliche Struktur und kann – je nach gegebenem Text – weitere Fragen verfolgen wie die nach der Verwendung von geprägten Gattungen oder vorgegebenen Überlieferungen. Die Einzelauslegung – also die Erklärung des Textes an dessen einzelnen Aussagen entlang – wird eingehend und gründlich durchgeführt. Hoppe hat dabei, wie für einen exegetischen Kommentar nicht anders möglich, den griechischen Text im Blick, bietet aber in den meisten Fällen selbst zu einzelnen Begriffen die deutsche Übersetzung. Leser ohne Griechischkenntnisse werden das Werk nicht unbedingt mühelos, aber ebenso wie die Fachleute mit Gewinn lesen. Dazu trägt auch der dritte Schritt der Kommentierung bei, der als Zusammenfassung die wesentlichen Aspekte eines Abschnitts bündelt und gegebenenfalls dessen bleibende Aktualität oder Problematik diskutiert. Hoppe scheut sich nicht, auch Grenzen eines Textes zu benennen (etwa zu der schwierigen Passage 2,14–16). Sein Kommentar ist ein zuverlässiger Wegführer in den ersten Thessalonicherbrief und damit zugleich in die Frühphase der selbstständigen Mission des Paulus. Wer Freude hat an klarer Sprache, an sorgfältiger Argumentation und an einem soliden exegetischen Urteil, wird Freude an diesem Kommentar haben. Gerd Häfner Rudolf Hoppe Der erste Thessalonikerbrief Kommentar (Verlag Herder, Freiburg 2016, 365 S., 39,99 €) Mosebilder D er Judaist Günter Stemberger hat sich in seinen Werken seit langem mit der rabbinischen Literatur befasst. Der vorliegende Band beschreibt Mose, die bedeutendste Gestalt des Alten Testaments, in der Diskussion der Rabbinen (70–1000 n. Chr.) über eine lange Entwicklungsgeschichte. Dass die jüdischen Lehrer nicht historischkritisch fragen, ist selbstverständlich, ebenso, dass manche ihrer Aussagen eher nur den Spezialisten interessieren. Aber ihre Beobachtungen und Überlegungen sind für ein lebendiges Mosebild aufschlussreich. Gleichzeitig sind sie eine gute Einführung in die Art, wie die Rabbinen Texte verstehen und auslegen. Zum Beispiel entdecken die Rabbinen an Mose Seiten, die von ihrer geschichtlichen Situation, von ihren Nöten und Hoffnungen, oft auch vom individuellen Temperament und von den religiösen Problemen der jeweiligen Zeit bestimmt sind – wie übrigens auch die Bücher des Alten Testaments schon unterschiedliche Mosebilder kennen. Bei den Rabbinen erscheint Mose als Retterkind, Priester, Gottes Gesandter, Prophet, Autor der Tora, Führer des Volkes Israel, Schüler Gottes, Mittler zu Gott oder Lehrer. Besonders geglückt ist die Gliederung des Buches. Da stellt Stemberger in sechs Abschnitten die unterschiedlichen, manchmal widersprüchlichen Überlegungen der Rabbinen vor, analysiert und interpretiert sie: (1) Geburt, Kindheit und Jugend, (2) Der Auszug / Exodus aus Ägypten, (3) Die Offenbarung der Tora, (4) Der Führer seines Volkes, (5) Tod, Himmelfahrt und Grab des Mose, (6) Moshe Rabbenu, das heißt Mose der Lehrer und seine Nachfolge. Für christliche Leser ist der ergiebige Vergleich zwischen Mose und Jesus wichtig. Er zeigt von Neuem, wie tief die Jesusüberlieferung in der jüdischen Tradition verankert ist. Werner Trutwin Günter Stemberger Mose in der rabbinischen Tradition (Verlag Herder, Freiburg 2016, 250 S., 29,99 €) Keine Landnahme, wohl aber David? G eschichte ist Konstruktion. Das gilt auch für die Geschichte Israels. Der Bochumer Alttestamentler Christian Frevel zitiert den Orientalisten Julius Wellhausen, der bereits im 19. Jahrhundert die deutende Perspektive als Differenz zwischen „Wirklichkeit“ und „Geschichte“ ausgemacht hat. Gleichwohl muss um diese Einsicht mitunter bis heute gerungen werden. Abgesehen von fundamentalistischen Kreisen entzünden sich auch innerhalb der akademischen Disziplin „Geschichte Israels“ immer wieder Konflikte. Gegenwärtig, so der Autor, trete diese Disziplin in eine neue Phase ein, die dadurch gekennzeichnet sei, dass die übliche Skepsis gegenüber einer Rekonstruktion der Geschichte Israels einem größeren Vertrauen in das historische Quellenmaterial weicht. Während der italienische Historiker des Alten Orients Mario Liverani noch unterscheidet zwischen der „normalen“ und der „erfundenen“ Geschichte Israels, bietet Frevel eine die Fülle jüngster Untersuchungen berücksichtigende Zusammenschau und diskutiert die biblische Darstellung auf der Grundlage literarischer, ikonografischer und vor allem archäologischer Daten. Zu Beginn eines jeden Kapitels wird die einschlägige Literatur angeführt; im Anhang findet man neben illustrierendem Kartenmaterial unter anderem ein Glossar ausgewählter Fachbegriffe. Dennoch verlangt die Lektüre dem Lesenden einiges ab. Mit den erwähnten Disziplinen und deren jeweiligem Gegenstand sollte man einigermaßen vertraut sein, um die Studie mit Gewinn zu lesen. Am Anfang stellt sich die Frage, wann man, historisch gesehen, den Beginn der Geschichte Israels ansetzen darf. Die Kontroverse ist ausgespannt zwischen der Position von „Maximalisten“, die noch die Auskünfte über die biblischen Erzeltern auf vermutete mündliche Überlieferungen aus der erzählten Zeit zurückführen wollen, und „Minimalisten“, die biblische Texte nur dann in die Geschichtsrekonstruktion einbeziehen, wenn sie mit außerbiblischen Befunden in Deckung gebracht werden können. Einigkeit, so Frevel, bestehe darin, dass eine kritische Rekonstruktion des antiken Israel nicht im Nacherzählen der biblischen Geschichte bestehen kann, weil „Heilsgeschichte“ ihrerseits nicht in historischen Daten aufgeht. Die Darstellung folgt der biblischen Erzählung und stellt diese in den Rahmen der archäologischen Chronologie, beginnend mit der Kupfersteinzeit, bis hin zur späten Eisenzeit und der sich daran anschließenden altorientalischen und antiken Geschichtsschreibung von der Perser- bis zur Römerzeit. Während im Kontext von Exodus und Landnahme kaum ein kritischer Bibelwissenschaftler noch von Historizität ausgeht, sondern die Geschichten in einen Zusammenhang mit der spätbronzezeitlichen Stadtkultur und der damit verbundenen Reorganisation der Bevölkerungsstruktur stellt, präsentiert sich die Sicht vom Beginn der Staatlichkeit und dem frühen Königtum Israels kontroverser. Auch wenn die 1993 entdeckte aramäische Inschrift auf der sogenannten Dan-Stele die von manchen in Zweifel gezogene historische Existenz König Davids stützt, muss man die Größe des davidischen Reiches ebenso infrage stellen wie den Glanz der salomonischen Herrschaft. Überraschend dürfte für manche der Befund der Forschung sein, dass es eine Teilung des Reiches nach Salomo, also einen Abfall des Nordreiches Israel vom Südreich Juda, nicht gegeben haben dürfte. Beide sind wahrscheinlich unabhängig voneinander entstanden und sollten über die Erzählung von der „Reichsteilung“ mit den Überlieferungen von David und Salomo verknüpft werden. Frevels Gang durch die Geschichte Israels bleibt spannend und erhellend bis zur Zeitenwende und zur Neuformierung des Judentums nach der Zerstörung Jerusalems und des Tempels durch Titus im Gefolge der jüdischen Aufstände gegen die römische Besatzung. Es ist, um es mit Liverani zu sagen, die „normale“ Geschichte der südlichen Levante, aus deren Material die Verfasser der biblischen Texte eine neue Geschichte gewoben haben, mit der sie ihre Identität, den Sinn und das Ziel ihrer historischen Existenz festzuschreiben suchten. Es liegt am Leser und vor allem am glaubenden Menschen, leben, denken und glauben zu lernen im Spannungsfeld zwischen der Welt und ihren Deutungen. Andrea Pichlmeier Christian Frevel Geschichte Israels Reihe: Kohlhammer Studienbücher Theologie (W. Kohlhammer, Stuttgart 2016, 445 S., 35 €) Homo mathematicus? W as unterscheidet das Gottesvolk vom Rest der Menschheit?“ Dieser Frage geht der Publizist Adam Deutsch philosophisch-anthropologisch nach. Im technischen Fortschritt der Moderne sieht der Autor das Ziel menschlicher Selbstverwirklichung in völliger Autonomie erreicht. Zur neuen Sprache der Menschen ist die Mathematik geworden. Über alle Religionen, über alle Differenzen hinweg „spinnt die mathematische Sprache das kommunikative, ‚digitale‘ Netz der Globalisierung“. Dieser Homo mathematicus kann mithilfe der Mathematik auch Dinge erkennen, die er mit seinen Sinnen nicht wahrnehmen kann. Es gelingt ihm sogar, seine Wirklichkeit selbst zu konstruieren. Diesem Wissen steht der Glaube der Angehörigen des Gottesvolks entgegen. In der Gegenwart Gottes zu leben, begrenzt ihr Recht zum Selbstsein. Sie sind auf „das Andere“ angewiesen. In diesem „Gottesgehorsam“ liegt für die Menschen aber auch Freiheit: Das Gottesvolk ist unabhängig von jeder weltlichen Macht. Ungewöhnlich ist die Gliederung mit fünfhundert Paragraphen, die – was das Nachvollziehen der Argumente erschwert – stellenweise leider sehr ruppig aufeinanderfolgen. Amelie Tautor Adam Deutsch Das Gottesvolk Eine philosophische Anthropologie (Matthes & Seitz, Berlin 2016, 260 S., 29,90 €) 230 Kirche / Spiritualität Nr. 21 / 2016 BÜCHER CIG Wegweisungen Banaler Glaube? Weltgebet Vaterunser es wirklich noch Bücher darüs gibt viele Interpretationen des Va- dungen her zwischen den christlichen Kondes Frère Roger B raucht ber, dass die Kirchen nach wie vor mit E terunser aus den verschiedensten fessionen – und zieht Linien bis zu den Welter erste Band einer auf vermutlich zehn der Moderne fremdeln? Erinnert sei zum Traditionen, Epochen und Perspektiven, religionen und dem säkularen Denken, ohne D Bände angelegten Reihe mit Texten von Frère Roger, dem Gründer der ökumenischen Gemeinschaft von Taizé, versammelt Schriften von 1941 bis 2001, die sich mit dem Leben der Brüder als einem „Gleichnis der Gemeinschaft“ befassen. Als Erstes begegnet dabei dem Leser die letzte, 2001 redigierte Fassung der „Quellen von Taizé“, wie Frère Roger bezeichnend die Wegweisungen, herkömmlicherweise Ordensregel genannt, betitelte. Im weiteren Verlauf erfährt man durch die erstmalige Zusammenstellung von Texten unterschiedlichen Charakters (dokumentiert sind früheste Überlegungen von 1941, die Gelübdeablegung, die „Regel“ in den fünfziger Jahren, weitere geistliche und theologische Reflexionen aus den sechziger und siebziger Jahren), wie Frère Roger im Lauf seines Lebens immer wieder neu darum gerungen hat, das Wesentliche für ein gemeinsames Leben zum Ausdruck zu bringen. Dabei wird auf faszinierende Weise deutlich, wie der Prior einerseits von Anfang an eine klare Grundintuition hatte, der er bis zuletzt treu blieb, und wie er andererseits zugleich seine Brüder davor bewahren wollte, in einem „geregelten Leben“ zu erstarren. Deshalb unternahm er immer wieder neue Anläufe und suchte stets neue Formulierungen, um unter veränderten Zeitumständen verständlich zu bleiben. Frisch und originell liest sich Frère Rogers Sprache, die auf unnachahmliche Weise biblisches Fundament, nüchterne Lebensweisheit und geistliche Poesie miteinander verbindet. Wohltuend und hilfreich empfindet man dabei die neue Übersetzung. Jakob Paula Frère Roger Die Grundlagen der Communauté von Taizé Gesammelte Schriften von Frère Roger, Bd. 1 (Verlag Herder, Freiburg 2016, 174 S., 15 €) Beispiel an den Konflikt von Hans Küng mit der Kirchenleitung über sein Buch „Credo“ Mitte der siebziger Jahre. Wer heute noch in diese Kerbe hauen willen, muss dem Thema etwas grundlegend Neues abgewinnen. Martin Urban versucht dies. Der Physiker und frühere Redakteur der „Süddeutschen Zeitung“ hat zwar Sympathien für das Christentum, stammt er doch aus einer evangelischen Theologenfamilie. Aber gerade seiner Konfession in ihrer aktuellen Verfassung kann der Autor nichts Positives abgewinnen. Aus der Kirche der Freiheit habe man eine „Kirche der Feiglinge“ gemacht. Sie sei eine „dahinsiechende Organisation“. Fundamentalistische Strömungen seien auf dem Vormarsch. Der Hauptkritikpunkt lautet: Die Kirchen nehmen zu wenig die Erkenntnisse der Naturwissenschaften wahr. Stattdessen werde der Glaube banalisiert. Bei allem Richtigen, was Urban aufzählt: Die Lektüre lässt den Leser doch einigermaßen ratlos zurück. Das Ganze ist eine wortgewaltige – und deshalb auf weite Strecken auch gut zu lesende – Abrechnung. Doch neu ist das alles nicht. Auch Lösungsansätze bietet das Buch keine. Er wolle mit dem Buch ein großes „So nicht“ formulieren, sagt der Autor: „So kann man das heute nicht mehr sagen. Das Wie dann? zu klären, wäre Sache der Kirche. Aber dazu müsste sie wieder disputfähig werden.“ Das ist ein bisschen dünn. Hinzu kommt der undifferenzierte Blick des Naturwissenschaftlers auf seine eigene Disziplin. Auf die Zeitbedingtheit hinzuweisen, aus der auch diese Sicht auf die Welt lebt, wäre 500 Jahre nach der Reformation das Mindeste gewesen. Stephan Langer Martin Urban Ach Gott, die Kirche! Protestantischer Fundamentalismus und 500 Jahre Reformation (dtv Verlagsgesellschaft, München 2016, 270 S., 14,90 €) von Kirchenvätern wie Reformatoren, von Mystikern, Religionsphilosophen, Psychologen, Historikern und vielen anderen. Den Versuch, diese „Kurzformel“ christlichen Glaubens vor dem Horizont nichtchristlicher Religionen und säkularen Denkens zu interpretieren, gab es laut Hans-Martin Barth bisher noch nicht. Der Autor unternimmt dieses „Wagnis“ nicht ohne Bedenken. Entlang der acht Vaterunser-Bitten geht er deren je eigener Problematik nach, sucht nach entsprechenden wie auch gegenläufigen Vorstellungen in anderen Religionen und säkularen Auffassungen, versucht, Anschlussmöglichkeiten aufzuzeigen. Das gelingt Barth, in persönlicher, existenzieller wie auch wissenschaftlicher, theologischer Auseinandersetzung mit dem Gebet. Ausgehend von der eigenen religiösen Heimat stellt er über das Vaterunser Verbin- den je eigenen Standpunkt aufzugeben. So betrachtet er zum Beispiel die erste Sure des Koran, manches jüdische Gebet oder hinduistische und buddhistische Texte konsequent aus der Perspektive des Christen. Umgekehrt ist es ihm ein Anliegen, das Vaterunser als Inspirationsquelle ebenso für Angehörige anderer Religionen wie für Nichtreligiöse zu deuten und als Einladung an alle zu richten. Wenn dies in der gegenseitigen Achtung des je Fremden geschieht, kann das Vaterunser tatsächlich ein nicht nur die Weltchristenheit, sondern sogar die Menschheit weltumspannendes Gebet sein. Christina Herzog Hans-Martin Barth Das Vaterunser Inspiration zwischen Religionen und säkularer Welt (Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 2016, 222 S., 19,99 €) Das ungekämmte Leben W ie lässt sich das Vertrauen auf Gott angesichts einer heillosen Welt begründen und als Lebensgrundlage für Einzelne und die Gemeinschaft durchhalten? Zu dieser Grundfrage des Glaubens legt der Schriftsteller und Theologe Ulrich Knellwolf eine Fülle theologisch begründeter und origineller Reflexionen in einer lebendigen und zupackenden Sprache vor. Sie sind in vierzig Jahren gewachsen und geordnet vom Leitgedanken der Rechtfertigung her: der Rechtfertigung Gottes (angesichts des Leids), der Rechtfertigung des Menschen und der christlichen Gemeindeversammlung, der Kirche. Ihren Ausgang nehmen die Überlegungen vornehmlich bei der biblischen Theologie und der Literatur: Hamann, Hebel, Gotthelf, Swift – um nur einige Gewährsleute zu nennen. Der Autor bevorzugt dabei das ungekämmte Leben gegen die reine Lehre, das „Stückwerk“ des Erzählens gegen das geschlossene System, das Abenteuer gegen die Beamtenmentalität, Markus und Petrus gegen Paulus, den Protest Jesu am Kreuz gegen den präexistenten Gottessohn, die offene Zukunft gegen den geschlossenen Kosmos. Die Ernte eines langen theologischen Lebens lässt sich nicht in wenigen Sätzen würdigen. Man kann aber in Aussicht stellen, dass theologisch interessierte Leser das Buch mit Gewinn lesen werden. Josef Epping Ulrich Knellwolf Wir sind’s noch nicht, wir werden’s aber Stückwerk zu Gott und der Welt (Theologischer Verlag Zürich, Zürich 2016, 350 S., 29,90 €) 800 Jahre Dominikaner NEU NEU NEU ADAM KOZŁOWIECKI SJ LIBORIUS OLAF LUMMA HANSJÜRGEN VERWEYEN Not und Bedrängnis Feiern im Rhythmus des Jahres Mensch sein neu buchstabieren Eine kurze Einführung in christliche Zeitrechnung und Feste Vom Nutzen der philosophischen und historischen Kritik für den Glauben Als Jesuit in Auschwitz und Dachau. Lagertagebuch Ein bewegendes Dokument gegen Hass und Verzweiflung! 688 Seiten, Hardcover ISBN 978-3-7917-2730-1 € (D) 29,95 Die christlichen Feste – fundiert und leicht lesbar! 248 Seiten, kartoniert ISBN 978-3-7917-2771-4 €(D) 16,95 / auch als eBook Verweyens Ansatz präzisiert! 176 Seiten, kartoniert ISBN 978-3-7917-2772-1 € (D) 24,95 / auch als eBook NEU 4400 Seitten 400 4 Farb rrbbsei sseeite eeiiten eenn Halbble Hal Halble le l ine in nen mitt Leseb Les seb eebä bändchen e en IISB SSBN 978-3-7 788-33-779917-27 3-7 17-27 2777700-7 € (D) 24 24,95 955 JOHANN JO JOH O ANN AN NNES S BUNNEN U NEN UN NBER RG / A ELI AUR LIA A SPENDEL L (H ( G.)) Auf der anderen Seite des Schweigens Dominikanisches Jahreslesebuch Dieses spirituelle Lesebuch liefert geistliche Impulse für jeden Tag des Jahres. www.verlag-pustet.de Telefon 0941 / 92022-0 Telefax 0941 / 92022-330 [email protected] Islam / Theologie 231 CIG BÜCHER Nr. 21 / 2016 Muslimas, traut euch! W arum haben bislang eigentlich nur Männer den Koran und andere islamische Quellen gedeutet?, fragt Sineb el Masrar. Warum keine einzige islamgelehrte Muslima? Traut man(n) Frauen nichts Vernünftiges zu? Dabei sei doch, provoziert die Autorin, von Männern „alles Hirnrissige … schon gesagt worden“, Frauen könnten dem nichts Schlimmes mehr hinzufügen. So und ähnlich scharfzüngig, humorvoll und schlagkräftig schreibt die Wahlberlinerin mit marokkanischen Wurzeln über den Islam, über sein Potenzial und seine Rolle in Europa. Höchste Zeit sei es, dass die Frauen damit anfingen, den Islam auf den neuesten Stand zu bringen, und zwar so, dass Frauen, Jugendliche, Homosexuelle und andere sich mit ihm identifizieren könnten. Auf die männlichen Islamgelehrten zu vertrauen, sei vertane Zeit: Traut euch also, Muslimas, macht den Mund auf! Den zahlreichen islamischen Verbänden in Deutschland steht sie skeptisch gegenüber und warnt vor allzu schneller Akzeptanz derselben. Dass sich ein Großteil der Verbände zum Beispiel nicht mit salafistischen Inhalten oder extremistischen Anteilen auseinanderzusetzen bereit ist, sei für Frauen nicht zu akzeptieren. Schließlich sind sie die Hauptleidtragenden des islamischen Extremismus. Ähnlich wie vor einigen Jahrzehnten feministische Theologinnen anfingen, das Christentum frauentauglich zu erneuern, so soll auch der Islam durch weibliche Tat- kraft modern und frauenfreundlich werden, wünscht sich die Autorin. Sie bedauert, dass die Unterweisung von Imamen aus der alten Heimat, die seit den achtziger Jahren gastweise in muslimischen Gemeinden den Islam lehrten, an deutschen Gegebenheiten total vorbeiging und ohnehin nicht einheitlich war, ja sogar oft nicht durchschaubare salafistische Inhalte hatte. Altes Islamwissen aus der Türkei, Syrien und Tunesien ging dabei für die junge Generation deutscher Muslime weitgehend verloren. Eindringlich weist Sineb El Masrar darauf hin, dass Islam und Judentum aufgrund der gemeinsamen Geschichte etliche Gemeinsamkeiten hätten. Es sei an der Zeit, dies herauszuarbeiten. Die Tochter malikitischer Sunniten hat nicht nur mit großer Quellen- und Geschichtskenntnis eine Streitschrift für einen modernen Islam geschrieben, sondern dank eines ausführlichen Glossars und erläuternder Fußnoten auch für alle Islamunkundigen einen Religionsunterricht der besonderen Art geschaffen. Absolut lesenswert! Aufgrund einer gerichtlichen einstweiligen Verfügung, beantragt von einer islamischen Gemeinschaft, musste ein Textabschnitt des Buches allerdings geschwärzt werden. Daniela M. Ziegler Sineb El Masrar Emanzipation im Islam Eine Abrechnung mit ihren Feinden (Verlag Herder, Freiburg 2016, 315 S., 24,99 €) Athanasius der Große – und Unruhestifter A ufregender und irritierender kann Kirchengeschichte kaum sein: Was wir heute Christentum nennen, entwickelte sich einst erst in heftigsten Auseinandersetzungen und Kämpfen. Die Jahrhundertfigur des Alexandriner Bischofs und Kirchenlehrers Athanasius (um 300–373) führt mitten hinein in die kaiserlichen und kirchlichen Machtspiele beziehungsweise Interessenlagen zwischen Ost und West, nicht zuletzt in die Konfessionskämpfe um die Identität und Einheit des Christlichen selbst. „Es seufzte der Erdkreis und wunderte sich, dass er arianisch geworden war“, meinte zum Beispiel Hieronymus. Mitten in dieser Konstantinischen Wende zum staatlich anerkannten Christentum und im entstehenden Mönchtum als jesuanischer Alternativbewegung steht Athanasius, mit gerade dreißig Jahren – und vielen Tricks – Bischof in der Kulturmetropole Alexandria geworden und trotz fünfmaligem Exil geblieben. „Das Machtbewusstsein des Patriarchen, seine Kompromisslosigkeit und die damit einhergehende Gewaltbereitschaft“ prägten die fast fünfzig Jahre, die seit dem ersten Konzil in Nizäa vergangen waren. Sein Gegner Kaiser Julian nannte Athanasius „diesen unverwüstlichen Intriganten, diesen Unruhestifter“. In der bis heute aktuellen Jahrhundertfrage, ob in Jesus Christus wirklich Gott selbst begegnet, blieb Athanasius unbeirrt auf der Linie des ersten Konzils, der Wesenseinheit von Jesus und Gott. Das brachte ihm – durchaus mit Gründen – den Ehrentitel „der Große“ ein. Auch dass er das spirituelle Bestseller-Buch des Jahrhunderts, das Leben des Mönchvaters Antonius, schrieb, gehört zu den großen Verdiensten Athanasius’. Wie sehr trotzdem die Treue zum Evangelium verquickt sein kann mit eklatanten menschlichen Schwächen, schier unglaublichem Intrigantentum und unbekümmerter Gewaltbereitschaft, ist zwar auch dem Zeitgeist damals geschuldet, gibt aber doch nachdrücklich zu denken – in der heutigen Zeit erst recht, in der dem Christentum seine imperialen Anwandlungen und konstantinischen Verhaltensweisen genommen werden. So zeichnet der Frankfurter Althistoriker und Theologe Manfred Clauss kompetent, anschaulich und sehr gut lesbar nicht nur das Porträt eines imponierenden, befremdlichen, schwierigen Kirchenvaters, sondern das Bild eines ganzen Jahrhunderts. Gotthard Fuchs Manfred Clauss Athanasius der Große Der unbeugsame Heilige (Philipp von Zabern Verlag, Darmstadt 2016, 256 S. mit 20 s/w-Abb. und Karten, 29,95 €) Scheitern der islamischen Eliten D er Islam gründet auf den Offenbarungen des Korans. Wie der Koran allerdings auch für arabischkundige Leser zu mindestens einem Drittel unverständlich und rätselhaft bleibt, scheinen auch die Politik und das Tagesgeschehen in der islamischen Welt zu mindestens einem genauso hohen Prozentsatz rätselhaft. Anders verhält es sich jedoch mit der Geschichte der islamischen Welt, die im Rückblick Analysen und Erklärungsmuster zulässt, die das Verständnis dieser komplexen Religion und ihrer unauflöslichen Verquickung mit der Politik zumindest etwas enträtseln. Dies ist das große Verdienst des neuen Standardwerks von Reinhard Schulze zur islamischen Geschichte. Es handelt sich um die dritte Auflage einer bereits 1994 erschienenen Erstausgabe. Seit der letzten Publikation 2002 hat sich auch als Folge des 11. September 2001 die asymmetrische Konfrontation zwischen den Verfechtern radikalislamischer Ideologien und dem Westen drastisch verschärft, und diese Front wurde in Form von Bürgerkriegen auch in die islamischen Länder selbst hineingetragen. Die „Arabellion“ – der arabische Frühling – und die Kriege in Syrien und im Irak, die zur Schreckensherrschaft des „Islamischen Staates“ geführt haben, sieht Schulze auch als eine Folge des totalen Scheiterns der islamischen Eliten. Ultraislamische Gruppierungen wie Boko Haram, IS, Al Qaida oder Al Shabaab profitieren von dem von den Eliten zu verantwortenden Scheitern der Modernisierung und dem Zerfall staatlicher wie gesellschaftlicher Ordnungen und der sie tragenden Normen. Dieses Scheitern hat mit dem schwierigen Prozess der Modernisierung zu tun, der vom Westen angeregt und geformt, aber auch gleichzeitig behindert wurde. Auf die Globalisierung, einhergehend mit Ent- wurzelung und Radikalisierung, war und ist erst noch eine „islamische“ Antwort zu suchen. Der Dschihadismus und der Salafismus wollen diese Antwort geben. Dabei war dem islamischen Orient schon das ihm fremde Konzept des Nationalstaats nach 1918 aufgedrängt worden, als Versuch zur Modernität. Heute fördert vor allem das Internet einen ganz neuen Diskurs über die Moderne in einer geschulten islamischen Öffentlichkeit. Das führt zu Veränderungen auch mancher religiösen Auffassung. Aus einer islamischen Öffentlichkeit wurde zusätzlich eine virtuelle Weltöffentlichkeit. In einer Zeit, da bedingt durch wachsenden Terror zahlreiche Publikationen sich verkürzt und einseitig mit den radikalsten „islamischen“ Ideologien befassen, liegt rechtzeitig ein tiefgründiges Werk vor, das auch die wachsende Abhängigkeit der Kulturen voneinander aufzeigt. Der Berner Islamwissenschaftler glänzt mit vielen Fakten und Szenenwechseln von Marokko bis Indonesien. Einige der „blinden Flecken“ in der neueren Islamgeschichte kann er aufklären. Doch insgesamt hat auch die beschwerliche Fülle des fast 800-seitigen Werkes zu mancher Selektivität geführt. So kommt die säkulare Türkei, wichtigster Partner und Brücke zum Westen, in dem Werk viel zu kurz. Alle Widersprüche und Rätsel der islamischen Geschichte konnte Reinhard Schulze dann doch nicht lösen. Bodo Bost Reinhard Schulze Geschichte der islamischen Welt Von 1900 bis zur Gegenwart. Grundlegend neu bearbeitete, aktualisierte und erweiterte Fassung des Buches „Geschichte der islamischen Welt im 20. Jahrhundert“ von 1994 (Verlag C. H. Beck, München 2016, 767 S. mit 7 Karten, 34,95 €) Universum des Staunens D ie Verteidiger Gottes waren jahrzehntelang in einem Rückzugsgefecht. Mit jeder neuen Erkenntnis vor allem naturwissenschaftlicher Art war die Arbeitshypothese Gott einmal mehr überflüssig geworden. Und als man mit Raketen in den Himmel flog, fand man ihn nicht. Bestenfalls führte er noch ein Nischendasein in der kleinen Welt abnormer Phänomene. Harald Lesch, Professor für Astrophysik in München, und der Jesuit Christian Kummer, Biologe, Theologe und ehemaliger Leiter des Instituts für naturwissenschaftliche Grenzfragen zur Philosophie und Theologie, holen Gott – ohne dies groß in ihrem lesenswerten Buch zu thematisieren – zurück in die Mitte. Und zwar, indem sie erst einmal ihre ganze naturwissenschaftliche Leidenschaft – manchmal etwas detailverliebt – ausleben, Lesch auf dem Gebiet der Entstehung des Universums, Kummer auf dem der Evolution. Doch anstatt mit zunehmender Erkenntnis Gott zu widerlegen oder überflüssig zu machen, ziehen sie in ihrem gemeinsamen Band den umgekehrten Schluss. Nicht: Erkenntnis entmystifiziert die Welt. Sondern: Jeder Erkenntnisschritt führt zu einem noch größeren Staunen. „Das Wunderbare, worüber wir staunen, ist nicht das unverstan- den Geheimnisvolle, sondern gerade das Erkannte und Verstandene.“ Rationaler Erkenntnisgewinn vertieft die Frage nach dem Sinn und stellt damit auch die Gottesfrage. Die Naturwissenschaften ersetzen nicht den Glauben an Gott, sondern führen – je weiter sie in ihre Materie eindringen, desto drängender – zur Frage aller Philosophen: Warum ist überhaupt Seiendes und nicht vielmehr nichts? Und, das wäre die anschließende Frage, wie entsteht es überhaupt, das Leben? Wie sind die qualitativen Sprünge in der Entwicklung der Welt letztlich zu erklären? Diesen Fragen sind die Naturwissenschaften bisher keinen Deut näher gekommen. Was man allerdings schon sagen kann: Naturwissenschaftliche Ergebnisse zwingen dazu, von primitiven Gottesbildern und naiv-frömmlerischer Sprache Abschied zu nehmen. Angesichts der Komplexität des Lebens liegt es nahe, dass auch Gott ziemlich komplex und alles andere als letzterklärbar ist. Alexander Schwabe Harald Lesch, Christian Kummer Wie das Staunen ins Universum kam Ein Physiker und ein Biologe über kleine Blumen und große Sterne (Patmos Verlag, Ostfildern 2016, 176 S., 17,99 €) 232 Philosophie / Kunst Nr. 21 / 2016 BÜCHER CIG Weltinnigkeit – ja, Achtsamkeitsgeplapper – nein Vor dem Kreuz E I s ist der Untertitel, der aufmerken lässt: „Eine stille Subversion“. Eine Subversion, ein Umsturz, wenn die Welt als Schöpfung betrachtet wird? Für wen? Auf den ersten Blick nicht für den religiösen, den gläubigen Menschen, für den das Bekenntnis zum Schöpfergott fundamental ist. Doch auch dieser wird der Darlegung Peter Strassers mit Gewinn folgen – auch oder gerade, wenn er sich durch dessen Thesen provoziert fühlen könnte. Denn der Grazer Philosoph setzt sich nicht nur mit einem mängelbehafteten Naturalismus auseinander, „der als Realität nur gelten lässt, was empirisch – mit den Methoden der Naturwissenschaft – beweisbar scheint“. Auch den Glauben an einen Gott, dessen Schöpfung das Leiden mit sich bringt, stellt Strasser auf den Prüfstand und sieht „fundamentale Konsequenzen für jede aufgeklärte, humane Religiosität: Gott ist kein Du, und der Holocaust ist für uns nicht entschlüsselbar als Ausdruck eines göttlichen Wollens“. Wenn Strasser dennoch die Welt als Schöpfung betrachten will, dann als „Schöpfung an sich“, als das „große Unbegreifliche“. Er sieht dies als die allen Menschen gemeinsame, auch den Religionen noch vorausgehende Erfahrung einer „Weltinnigkeit“, eines unmittelbar gegebenen Weltbezugs, der die Welt als Schöpfung erschließt. Dabei will er bewusst einen „sehr kindlichen oder sehr philosophischen Standpunkt“ einnehmen. Den Kreationismus, also ein unmittelbares Eingreifen Gottes in jeden Schöpfungsakt, sieht er ebenso kritisch wie die Ansicht, die das menschliche Gehirn „mit quasi göttlichen Attributen“ versieht und an die Stelle des „alten, ausrangierten Schöpfergottes“ erhebt. Ebenso kritisch beurteilt der Autor unser „Zeitalter des Präsentismus“, also eine extreme Gegenwartsfixierung. Diese führe zu einer „Reduzierung der Erlebnistiefe“, wodurch „die Welt als Schöpfung unbegreiflich und unfassbar“ geworden sei. Die Erfahrung der Weltinnigkeit hingegen, die „unserem Geist eingeboren“ sei, begründe „unseren unabweisbaren, fortdauernden Hang und Drang, die Welt als Schöpfung anzuschauen und aufzufassen“. Innigkeit, nicht Objektivität, sei das Prinzip, unter dem sich das philosophische Fragen entfaltet. In der Liebe zur Weisheit wiederum sieht Strasser „die Liebe zur ‚Welt als Schöpfung betrachtet‘“. Anregend sind auch seine Ausführungen zum Ursprung der Gottesliebe: „Wir lieben Gott, indem wir an den Dingen der Welt des Wunderbaren gewärtig werden, das sie ins geistdurchwirkte Dasein hebt, während wir sie, dem Mythos nachlauschend, begriffslos als Teile eines Ganzen begreifen, für welches im Abendland der Begriff ‚Schöpfung‘ steht.“ Mit Peter Strasser die Welt als Schöpfung betrachten – das ist fordernd und in jedem Fall der Mühe wert. Die Subversion ergibt sich aus dem Standort des Betrachters. Wer nach der hellsichtigen Schöpfungsbetrachtung Strassers sein Buch zur Achtsamkeit zur Hand nimmt, mag zunächst erstaunt, vielleicht enttäuscht, in jedem Fall wohl irritiert sein. Denn anstelle einer einfachen Ermutigung zu einem – naheliegend! – acht- samen Blick auf die Schöpfung etwa formuliert der Philosoph „zeitgeistwiderständige“ Kommentare gegen die achtsamkeitsbeflissene neue Quasireligion. Er karikiert und übertreibt – um das Anliegen dahinter zu retten. Anhand der ironisch-unsinnig formulierten „Zehn Gebote der Achtsamkeit“ („der ultimative Achtsamkeitspartydekalog“), allesamt durch ein warnendes „Bloß nicht …!“ eingeleitet, wird das Buch zu einem in mitunter derb formulierten Episoden verfassten Aufruf zur Wachsamkeit gegen „jenes Achtsamkeitsgetue und Achtsamkeitsgeplapper, das heutzutage auf das Podium der Jahrhunderttugend erhoben wird“. Das ist nicht unsympathisch. Zur Anregung und zum Gewinn wird das Bändchen durch das Aufblitzen der eingestreuten philosophischen Erkenntnisse, wenn Strasser etwa das Wesen der Achtsamkeit wie folgt formuliert: „Gib, soweit es in deinen schwachen Kräften steht, den armen, dir tagtäglich begegnenden Kreaturen rund um dich herum das Gefühl, bei sich selbst zu sein und dabei irgendwie zu Hause; gib ihnen das Gefühl, dass sie dort sind, wo sie hingehören.“ Norbert Schwab Peter Strasser Die Welt als Schöpfung betrachtet Eine stille Subversion (Wilhelm Fink, Paderborn 2015, 118 S., 16,90 €) Peter Strasser Achtsamkeit (Braumüller, Wien 2016, 93 S., 14,90 €) m Symbol des Kreuzes eine angemessene Sprache angesichts des Leids auch für unsere Zeit zu finden, versucht der evangelische Neutestamentler Reiner Knieling, der das Gemeindekolleg der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands leitet. Er skizziert die Entwicklung von Kreuzesdarstellungen in der Kunst und macht deutlich, wie darin Unverständliches ausgedrückt werden kann. Bis zum 4. Jahrhundert von Nichtchristen als Zeichen der Ohnmacht und Schwäche angesehen und mit einem Eselskopf verhöhnt, setzt sich das Kreuz immer mehr durch und wird zum Zeichen nicht nur für das Mitleiden Christi mitten in Leiden und Ohnmacht der Menschen, sondern auch für die Überwindung des Todes und somit für die Gegenwart Gottes. Kreuzesdarstellungen spiegeln ihre jeweilige Zeit wider. So sieht Luther das Kreuz als lebensschaffende Kraft und Fundament des Glaubens. Das Liebeswerben Gottes ist die Botschaft, in die der Autor das Kreuz einordnet. Knieling verzichtet dennoch nicht darauf, Kritisches und bisweilen Sperriges wie „Opfertod“ und „Sühne“ zu erörtern. Besonders der dritte Teil enthält zahlreiche Impulse für eine heute angemessene Sprache und die Auseinandersetzung mit dem Kreuz. Martina Ahmann Reiner Knieling Das Kreuz mit dem Kreuz Sprache finden für das Unverständliche (Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 2016, 224 S., 19,99 €) Warum Bibel und Aufklärung kein Gegensatz sind Dieses Buch möchte zeigen, in welchem Ausmaß bereits das Alte Testament Aufklärung leistet, und wie durch Jesus und die Kirche diese Aufklärungsarbeit fortgeführt und vertieft wurde. Auf der Grundlage dieser jüdisch-christlichen Aufklärungsgeschichte geht es um die Vernunft des Glaubens, die in diesen Tagen immer wieder zur Debatte steht. Dabei möchte die Darstellung nichts vom Geheimnis des Glaubens wegnehmen, sondern seine Vernünftigkeit aufleuchten lassen. 560 Seiten | Gebunden mit Schutzumschlag € 29,99 / SFr 39.90 / € [A] 30,80 ISBN 978-3-451-31239-7 Neu in allen Buchhandlungen oder unter www.herder.de 234 Kultur Nr. 21 / 2016 Bücher CIG Der Tag des Zorns E ine Geschichte des Weltuntergangs kann kein klassisches Geschichtsbuch sein. Der Weltuntergang, obwohl schon öfter mit einem Fuß in der Tür, hat bisher nicht stattgefunden. Der Historiker Johannes Fried bleibt dennoch seinem Handwerk treu und durchsucht detailgenau Geschichte, Kunst und Wissenschaft nach den vielen Spielarten der Endzeiterwartungen. Er fördert dabei eine Fülle von Katastrophenvisionen mit ihren Protagonisten zutage und verlässt doch notgedrungen nur kurz den jüdisch-christlichen Kulturkreis. Denn hier, so stellt er fest, ist die Furcht vor dem Weltenende zu Hause. „Dieses immerwährende Jüngste Gericht und dieser stets erwartete Untergang verfestigten sich zu einem sozialen Habitus des christlichen Westens“, fasst der Professor für Mittelalterliche Geschichte zusammen. Endzeitvokabeln wie Jüngstes Gericht, Armageddon oder Apokalypse haben es nicht zuletzt dank Hollywood bis in die moderne Sprache geschafft und erinnern daran, dass etwas alle bisherigen Katastrophen in den Schatten stellen könnte. Was die Auseinandersetzung lohnenswert macht, erwartet den Leser manchmal eher zwischen den Zeilen. Die dargestellten Ereignisse und Entwürfe zum unausweichlichen Tag des Herrn kratzen an der Fassade einer Kultur, für die die Zukunft immer besser werden soll, und legen Ängste frei, die tief in der kollektiven Seele schlummern. Ängste vor der totalen Zerstörung und die damit verbundenen unbeantworteten Fragen nach Ursprung und Sinn allen Seins. Dass dies tatsächlich ein abendländisches Phänomen ist, zeigt ein kurzer Exkurs in die östlichen Religionen. Zwar wird im Hinduismus und Buddhismus auch das individuelle und kollektive Ende mitgedacht, jedoch stets auch ein Neuanfang. Zyklisches Denken, das im Osten ebenso tief verwurzelt ist wie im Westen das lineare, entzieht einer totalen Auslöschung den Boden. Auch die Vorstellung von Vernichtung als Strafe ist eine eher westliche Denkfigur. Auch die Aufklärung und die Wissenschaften bringen nach Johannes Frieds Darstellung kaum frischen Wind in die Vorstellung vom Untergang. Wo das eine erleichternd hätte wirken können – der strafende Gott verliert seine Bedrohlichkeit – und das andere eher ernüchternd – das Erlöschen von Sonne und Leben ist eine Gewissheit –, lebt die westliche Menschheit lieber weiter mit ihrer namenlosen Sorge vor dem katastrophalen Ende. Zu tief hat sich die Angst vor dem Unaussprechlichen über Jahrtausende im kulturellen Gedächtnis festgesetzt und tritt besonders dann an die Oberfläche, wenn sich individuell oder kollektiv Bedrohung anzukündigen scheint, sei es durch Krieg, Terror, Viren oder Migrationswellen. So bedrohlich der Weltuntergang auch sein mag, lähmen lässt sich das Leben nicht. Angst vor dem Ende, fasst Fried zusammen, hat auch eine „stimulierende, gesellschafts- und weltverändernde Kraft“. Barbara Münzer Johannes Fried Dies irae Eine Geschichte des Weltuntergangs (Verlag C. H. Beck, München 2016, 352 S. mit 26 s/wAbb. und 19 farb. Abb. im Tafelteil, 26,95 €) Ein Gott ohne Körper? H at Gott einen Körper? Ist die Vorstellung von Gottes Körperlichkeit nur Kinderglaube? Oder gibt es Gründe, Gott auch körperlich zu denken? In der Antike war es offenbar nicht nur für schlichte Gemüter selbstverständlich, dass die Götter über einen Körper verfügen. Selbst der jüdischchristliche Gott konnte zu dieser Zeit bis in die gebildetsten Kreise so gedacht werden. Christoph Markschies zeigt, wie man sich den Körper Gottes konkret vorgestellt hat. Dazu verfolgt er die theologischen und philosophischen Debatten zu dieser Frage, wirft einen Blick hinter den Vorhang des Olymps heidnischer Gottheiten und vermisst die Abstände zwischen ihnen und dem jüdischchristlichen Gott. Das Ergebnis ist eine gelehrte Studie, die alle relevanten Entwicklungen nachzeichnet, in deren Verlauf einstmals breiter vertretene Ideen an den Rand gedrängt wurden. So wird erklärt, warum ausgerechnet das Mittelalter den Gedanken an Gottes Leiblichkeit verabschiedete und sich stattdessen die bis heute geläufige Vorstellung von Gott als einem körperlosen Wesen durchsetzen konnte. Dass es so zu einem Substanzverlust biblisch begründeten Gottglaubens kam, ermöglicht dem Verfasser, einen vorsichtigen theologischen Impuls zugunsten einer Rede vom Körper Gottes zu formulieren. Sofern diese nicht eine um Details der Körperlichkeit gekappte Rede sei, verfüge sie über das Potenzial, die Wahrheit des Mythos und auch die Notwendigkeit der Entmythologisierung zu begründen. Das Buch ist eine Fundgrube mit fast zweitausend Anmerkungen und gut hundert Seiten Literatur. Es liest sich wie ein spannender Rechenschaftsbericht über ein Forschungsprojekt, der den Lesern Einblicke in die jüdische Mystik und die christliche Theologie der Spätantike gewährt. Der hochkarätige Aufweis christologischer Debatten um das Mensch- und Gottsein Jesu rundet diese Studie ab, die historische und theologische Fragestellungen auf elegante Weise verbindet. Auch in den Auslassungen (zum Beispiel islamischer Textzeugnisse) werden die Untersuchungen Markschies’ zum Ideengeber zukünftiger Forschung. Leider kommt die Bibel selbst als Urkunde jüdischer und christlicher Gottesrede fast nur am Rande zur Sprache, wobei gleichwohl festgehalten wird, dass „Aussagen über die Körperlichkeit Gottes die jüdisch-christliche Bibel nahezu auf jeder Seite“ prägen. Insgesamt handelt es sich bei diesem Werk jedenfalls um eine gelungene Überraschung, die vielfach Antwort gibt und immer neue Fragen aufwirft. Robert Vorholt Christoph Markschies Gottes Körper Jüdische, christliche und pagane Gottesvorstellungen in der Antike (C. H. Beck Verlag, München 2016, 900 S. mit 15 Abb., 48 €) Was begrenzt den Herrscher? D ie Herrscher des Mittelalters setzten die von der Antike übernommene Beratungskultur fort. Vor wichtigen Entscheidungen ließen sie sich in der Regel Ratgeber kommen, die um einen allgemeinen Konsens im Sinne der Herrschenden bemüht waren. Denn die Könige konnten die Beratung lenken. Zudem waren sie an den Rat nicht gebunden, sie behielten sich die Entscheidung vor. Dennoch kann die mit dem Ratgeben eröffnete Teilhabe an der Herrschaft als ein Weg zur Begrenzung von Willkür verstanden werden. Dies ist die zentrale These der gründlichen Studie von Gerd Althoff, die Möglichkeiten und Grenzen von politischer Teilhabe durch Beratung aufzeigt. Durch die Analyse besonders aussagekräftiger – vorrangig politischer – Fälle intensiver Verhandlungen aus der Zeit der Karolinger, der Ottonen, der Salier und der Staufer versucht der Autor, das Wissen um die Formen und Inhalte von Beratung im Früh- und Hochmittelalter zu verbessern und vor allem auch ihre politischen Ausmaße zu verstehen: die Regelhaftigkeit des Vorgehens und Verhaltens sowie die Handlungsspielräume der Akteure. Die Quellenlage ist besser, als man denkt, auch wenn es weiterhin schwierig ist, die Art der Verhandlung und Beschlussfassung näher zu bestimmen. Im untersuchten Zeitraum kommt dem religiös begründeten Rat ein besonderes Gewicht zu. Ebenso wird die Intensität der Bemühung der Mächtigen aufgezeigt, dafür zu sorgen, dass sie nur den von ihnen erwarteten Rat bekamen. Ein nicht unwichtiges Ergebnis ist auch, dass die Herrscherberatung immer wieder auch versuchte, zur Gewaltvermeidung, zum Gewaltverzicht beizutragen – was eine gute Regierung auf dem Boden der Christenheit kennzeichnete. Mariano Delgado Gerd Althoff Kontrolle der Macht Formen und Regeln politischer Beratung im Mittelalter (Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2016, 360 S., 49,95 €) Der Mystiker Martin Luther Z u welchen Ergebnissen ist das Nachdenken der letzten Jahrzehnte über den Platz Martin Luthers in der Geschichte gekommen? Ein Fazit liegt im lesenswerten Buch des Tübinger Historikers Volker Leppin über „Luthers mystische Wurzeln“ vor. Wenn man das Spätmittelalter nicht mehr unter dem Gesichtspunkt betrachtet, was an ihm durch Martin Luther überwunden wurde, sondern untersucht, wie der Horizont des Spätmittelalters auch in den protestantischen Kirchen weiterwirkte, ist die Grenze zwischen der – katholischen – Welt des Mittelalters und der – protestantischen – Neuzeit weniger abweisend. Der Autor glaubt, dass die Mystik, wie Luther sie bei Johannes Tauler und der Schrift „Theologia deutsch“ des 14. Jahrhunderts vorgefunden und durch seinen Beichtvater Johann von Staupitz gelernt hatte, für den Reformator zeitlebens von Bedeutung war. Sie ist daher eine jener Größen, welche die „katholische“ und die „protestantische“ Welt verknüpfen. Konsequenterweise stellt Volker Leppin die ersten Jahre der Reformation nicht chronologisch, sondern unter dem Gesichtspunkt dar, wie sich Luthers Theologie weiterentwickelte und sich dadurch das mystische Erbe veränderte. Barbara Henze Volker Leppin Die fremde Reformation Luthers mystische Wurzeln (Verlag C. H. Beck, München 2016, 247 S., 21,95 €) Evangelisch mystisch D urch ‚Leben und Sterben, nicht durch Erkennen und Spekulieren‘ wird nach Luther der Christ geboren.“ Dem werden Mystikfreunde nicht widersprechen. Doch die Autorin und C.-G.-Jung-Kennerin Brigitte Romankiewicz grenzt Martin Luthers Zugang zu Frömmigkeit und Theologie mit diesen Worten ab von dem, was dann „im Schatten Luthers“ auf protestantischem Boden als Mystik entstanden ist. Luthers Umgang mit den sogenannten „Schwärmern“ wie Thomas Müntzer und Sebastian Franck war fraglos abgründig, und die lutherische Orthodoxie hat unselige Abgrenzungen vorgenommen und „wortlastige“ Einseitigkeiten ausgebildet. Dennoch ist das Thema Protestantismus und Mystik zu komplex, um es in schroffer Gegensätzlichkeit zu fassen. Zu differenzieren gelingt der Autorin nur bedingt. Maria ist für Brigitte Romankiewicz das Symbol mystischer Existenz. Sie gilt als Gefäß der göttlichen Sophia und bringt in ihrem „Es geschehe …“ die Bereitschaft zum Ausdruck, sich von der Weisheit führen zu lassen. Unter dem Motto „Sophia kehrt zurück“ wird eine marianisch-weisheitliche Mystik an den Rändern des Protestantismus nachgezeichnet. Die einzelnen Kapitel etwa über Jakob Böhme oder die christlich-kabbalistische Lehrtafel der Prinzessin Antonia von Württemberg in Bad Teinach, über Friedrich Christoph Oetinger oder Friedrich Daniel Schleiermacher sind anregend. Im „Sprung in die Gegenwart“ plädiert die Verfasserin für eine sophianisch inspirierte Mystik heute, die im Wortsinn „radikal“ ist und aus dieser Verwurzelung über sich hinauswächst in eine nichtduale kosmische Ganzheit hinein. Die Identifikation des Weisheitlichen mit dem Weiblichen hingegen ist ideologieanfällig. Die Autorin scheint darin kein Problem zu sehen. Irene Leicht Brigitte Romankiewicz Sophia kehrt zurück Evangelische Mystik im Schatten Luthers (Verlag Herder, Freiburg 2016, 347 S., 28,99 €)