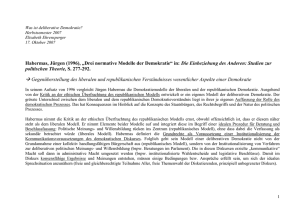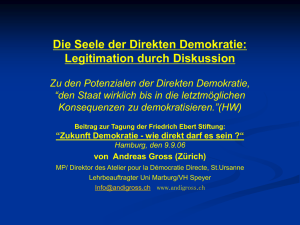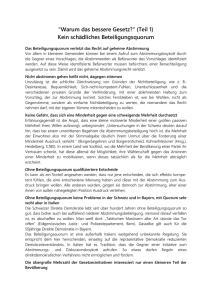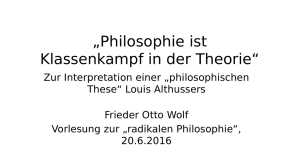Warum die Schweiz mehr Deliberation gut
Werbung
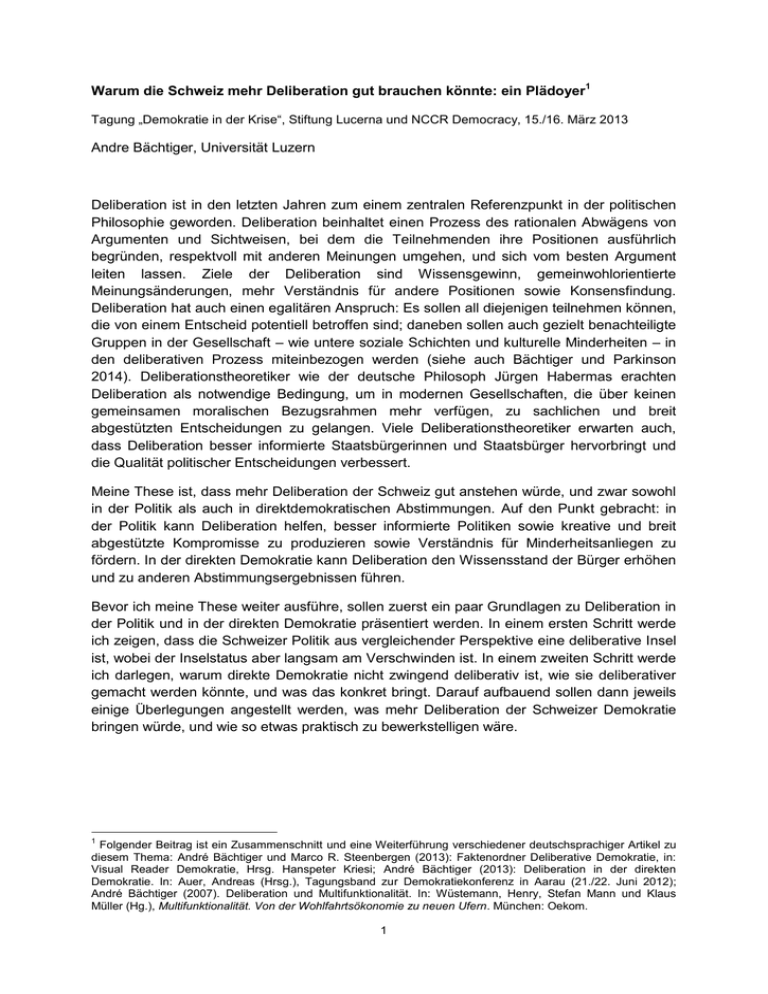
Warum die Schweiz mehr Deliberation gut brauchen könnte: ein Plädoyer1 Tagung „Demokratie in der Krise“, Stiftung Lucerna und NCCR Democracy, 15./16. März 2013 Andre Bächtiger, Universität Luzern Deliberation ist in den letzten Jahren zum einem zentralen Referenzpunkt in der politischen Philosophie geworden. Deliberation beinhaltet einen Prozess des rationalen Abwägens von Argumenten und Sichtweisen, bei dem die Teilnehmenden ihre Positionen ausführlich begründen, respektvoll mit anderen Meinungen umgehen, und sich vom besten Argument leiten lassen. Ziele der Deliberation sind Wissensgewinn, gemeinwohlorientierte Meinungsänderungen, mehr Verständnis für andere Positionen sowie Konsensfindung. Deliberation hat auch einen egalitären Anspruch: Es sollen all diejenigen teilnehmen können, die von einem Entscheid potentiell betroffen sind; daneben sollen auch gezielt benachteiligte Gruppen in der Gesellschaft – wie untere soziale Schichten und kulturelle Minderheiten – in den deliberativen Prozess miteinbezogen werden (siehe auch Bächtiger und Parkinson 2014). Deliberationstheoretiker wie der deutsche Philosoph Jürgen Habermas erachten Deliberation als notwendige Bedingung, um in modernen Gesellschaften, die über keinen gemeinsamen moralischen Bezugsrahmen mehr verfügen, zu sachlichen und breit abgestützten Entscheidungen zu gelangen. Viele Deliberationstheoretiker erwarten auch, dass Deliberation besser informierte Staatsbürgerinnen und Staatsbürger hervorbringt und die Qualität politischer Entscheidungen verbessert. Meine These ist, dass mehr Deliberation der Schweiz gut anstehen würde, und zwar sowohl in der Politik als auch in direktdemokratischen Abstimmungen. Auf den Punkt gebracht: in der Politik kann Deliberation helfen, besser informierte Politiken sowie kreative und breit abgestützte Kompromisse zu produzieren sowie Verständnis für Minderheitsanliegen zu fördern. In der direkten Demokratie kann Deliberation den Wissensstand der Bürger erhöhen und zu anderen Abstimmungsergebnissen führen. Bevor ich meine These weiter ausführe, sollen zuerst ein paar Grundlagen zu Deliberation in der Politik und in der direkten Demokratie präsentiert werden. In einem ersten Schritt werde ich zeigen, dass die Schweizer Politik aus vergleichender Perspektive eine deliberative Insel ist, wobei der Inselstatus aber langsam am Verschwinden ist. In einem zweiten Schritt werde ich darlegen, warum direkte Demokratie nicht zwingend deliberativ ist, wie sie deliberativer gemacht werden könnte, und was das konkret bringt. Darauf aufbauend sollen dann jeweils einige Überlegungen angestellt werden, was mehr Deliberation der Schweizer Demokratie bringen würde, und wie so etwas praktisch zu bewerkstelligen wäre. 1 Folgender Beitrag ist ein Zusammenschnitt und eine Weiterführung verschiedener deutschsprachiger Artikel zu diesem Thema: André Bächtiger und Marco R. Steenbergen (2013): Faktenordner Deliberative Demokratie, in: Visual Reader Demokratie, Hrsg. Hanspeter Kriesi; André Bächtiger (2013): Deliberation in der direkten Demokratie. In: Auer, Andreas (Hrsg.), Tagungsband zur Demokratiekonferenz in Aarau (21./22. Juni 2012); André Bächtiger (2007). Deliberation und Multifunktionalität. In: Wüstemann, Henry, Stefan Mann und Klaus Müller (Hg.), Multifunktionalität. Von der Wohlfahrtsökonomie zu neuen Ufern. München: Oekom. 1 Deliberation in der Politik – die Schweiz als deliberative Insel? Es gibt eine lange Tradition in der politischen Philosophie, welche die Wichtigkeit von Deliberation in der Politik betont. Der englische Philosoph John Stuart Mill beispielsweise betonte, dass sich gewählte Volksvertreter bei ihren Entscheidungen vom besseren Argument leiten lassen sollten. Doch viele Politikwissenschaftler betonen, dass in Politik nicht Deliberation, sondern Macht, Strategie und Interessendurchsetzung im Vordergrund stehen. Auch wird argumentiert, dass Politiker aus politischem Kalkül heraus emotionale anstatt rationale Argumente benutzen, weil diese den Bürgerinnen und Bürgern einfacher zugänglich sind und besser haften bleiben. Doch heisst dies nun, dass in der Politik Deliberation gar nicht vorkommt? Die Antwort lautet klar nein: das politische System und der politische Kontext spielen eine entscheidende Rolle für die Deliberationsqualität politischer Debatten. Das Schweizerische Konkordanzsystem ist dabei ein deliberationsförderlicher Kontext. Zum einen sind alle wichtigen politischen Kräfte in die Regierungsarbeit eingebunden, wodurch die Bedeutung des Wahlwettbewerbs abnimmt. Zum andern gibt es oft einen Verhandlungszwang, d.h. die Positionen der beteiligten Akteure können nicht ohne hohe Kosten übergangen werden. In der Schweiz wird dieser Verhandlungszwang durch die direkte Demokratie befördert. Die Erfahrung zeigt, dass durch die Einbindung aller wichtigen politischen Kräfte ein Referendum verhindert, oder - wenn es doch zustande kommt -, relativ leicht gewonnen werden kann. In der Tat enthält Konkordanz deliberative Elemente. Laut AltBundesrat Samuel Schmid ist das „Schmiermittel“ der Konkordanz das „das gütliche Einvernehmen und der konstruktive Dialog“2, beides zentrale deliberative Prinzipien. In Wettbewerbssystemen wie Grossbritannien dagegen stehen sich Regierung und Opposition als erbitterte Gegner gegenüber, und in der Regel hat die Opposition auch keine Möglichkeit, die Politik der Regierung zu beeinflussen. Somit kann die Regierung die Argumente der Opposition nicht nur ignorieren, die ständige Konkurrenz zwischen Regierung und Opposition verunmöglicht respektvolle und konstruktive Diskussionen. Da sehr viele politische Systeme auf der Welt wettbewerbsorientiert sind, hat die Schweiz den Charakter einer deliberativen Insel. Das lässt sich mit einigen Zahlen aus den 1990er Jahren verdeutlichen: im Schweizer Nationalrat liegt expliziter Respekt und Zustimmung zu Gegenpositionen bei rund 16%, im deutschen Bundestag – ein Regierungs-OppositionsSetting - bei 7%. Ähnlich sind die Unterschiede bei abwertenden Äusserungen: im Schweizer Nationalrat ist die Quote 20%, im deutschen Bundestag 30% (siehe Bächtiger 2013; Steiner et al. 2004). Selbstverständlich gibt es neben Konkordanz noch weitere Faktoren, welche die Deliberationsqualität in der Politik beeinflussen: - - - 2 Nicht-Öffentlichkeit (wie Schweizerische Parlamentskommissionen): hinter verschlossenen Türen, wo der Druck der Öffentlichkeit kleiner ist, können Politiker viel einfacher Respekt und konstruktive Haltungen für andere Positionen aufbringen oder sogar ihre Meinung ändern; Zweitkammern: seit der Antike werden Zweitkammern – wie der schweizerische Ständerat oder der amerikanische Senat - als Arenen gesehen, die Reflexion und Deliberation im politischen Prozess stärken. Zweitkammern sind überdies kleiner als Erstkammern und ihre Mitglieder verfügen in der Regel auch über mehr politische Erfahrung, was zusätzlich deliberationsförderlich wirkt; Tiefe Parteidisziplin: wenn Politiker stets mit ihrer Partei stimmen müssen, dann werden Deliberation und Meinungsänderungen schwierig. Hohe Parteidisziplin ist ein Kennzeichen parlamentarischer Systeme wie etwa Deutschland, wo http://www.uniaktuell.unibe.ch/content/geistgesellschaft/2011/konkordanz/index_ger.html 2 - - Regierung und Parlament in einem Vertrauensverhältnis stehen. Wenn in parlamentarischen Systemen Parlamentarier ihre Meinungen ändern und gegen ihre eigene Regierung stimmen, dann ist die Stabilität der Regierung gefährdet. In präsidentiellen Systeme wie den USA dagegen, wo Präsident und Parlament in keinem Vertrauensverhältnis stehen, sind Parlamentarier unabhängiger und können eher miteinander deliberieren. Regierungs- und Mitteparteien: Da Regierungs- und Mitteparteien vom erfolgreichen Zustandekommen von Politiken wahlmässig profitieren können, haben sie ein gewisses Interesse, sachbezogen und kompromissorientiert zu politisieren. Oppositionelle und populistische Parteien dagegen haben ein grosses Interesse, politische Erfolge anderer Parteien zu verhindern, da dies ihnen wahlstrategisch Vorteile bringt. Folglich ist ihr Interesse an Deliberation gering; Themenpolarisierung: Bei politisch stark polarisierten Themen, wo auch die ideologischen Unterschiede zwischen Parteien gross sind, wird Deliberation schwierig. Bei weniger polarisierten Themen dagegen, wie etwa den Bedürfnissen von behinderten Menschen, stehen sich Politiker ideologisch näher, was konstruktivere Debatten möglich macht. Schliesslich kann man sich auch fragen, was denn mehr Deliberation in der Politik konkret bringt. Mein Kollege Markus Spörndli ist dieser Frage am Beispiel des deutschen Vermittlungsausschusses nachgegangen (Spörndli 2004). Der deutsche Vermittlungsausschuss ist ein Gremium, dessen Aufgabe darin liegt, einen Kompromiss zwischen Bundestag und Bundesrat zu finden. Von seinem Deliberationspotential her ist der Vermittlungsausschuss durchaus mit Schweizer Kommissionen zu vergleichen. Spörndli konnte zeigen, dass auf Debatten mit hoher Deliberationsqualität mehr einstimmige Entscheidungen folgen. Ein konkretes Beispiel für hochstehende Deliberation in der Politik mit Wirkung auf das konkrete Ergebnis ist die Beratung zur Revision des Sprachenartikels in den 1990er-Jahren (siehe auch Pedrini et al. 2013). Diese Revision ging auf die Motion des Rätoromanen Martin Bundi aus dem Jahre 1986 zurück, welche die Stellung des Rätoromanischen stärken sollte. Der Bundesrat arbeitete daraufhin einen Verfassungsartikel aus, der zwei Prinzipien explizit in die Verfassung aufnehmen wollte: die Sprachenfreiheit – das Recht, seine Muttersprache überall sprechen zu dürfen – sowie das Territorialitätsprinzip, das genau regelt, welche Sprache in einem Kanton gesprochen wird. Mit der expliziten Erwähnung der Sprachenfreiheit in der Verfassung sollte den Rätoromanen mehr Flexibilität bei der Ausübung ihrer Sprache gewährleistet werden. Doch der bundesrätliche Entwurf stiess bei französisch- und italienischsprachigen Politikern auf gehörigen Widerstand. Sie befürchteten eine Germanisierungsgefahr: Deutschschweizer könnten dann in französischsprachigen Kantonen und im italienischsprachigen Tessin deutschsprachige Schulen einfordern, ja diese auf dem Rechtsweg gar erzwingen. In der parlamentarischen Beratung zum Sprachenartikel waren viele Vertreter der Deutschschweizer Mehrheit sehr respektvoll im Umgang mit Argumenten der sprachlichen Minderheiten. Zudem gab es bei diesem Thema eine grosse Bereitschaft, eine optimale Lösung für alle Sprachminderheiten – Rätoromanen, Tessiner und Romands – zu finden. Nicht nur haben einige Parlamentarier ihre Meinung geändert, auch hatte die Debatte oft akademisches Niveau. Dies kann auch anhand einiger Zahlen belegt werden: 54 Prozent aller Reden beinhalteten elaborierte Begründungen, 26 Prozent waren gemeinwohlorientiert und 70 Prozent waren explizit respektvoll. Diese Werte liegen deutlich über den Werten in gewöhnlichen Parlamentsdebatten. 3 Nach mehrjähriger Debatte und intensiver Suche nach kreativen Lösungen - wie z.B. ein hierarchisches Verhältnis von Territorialitätsprinzip und Sprachenfreiheit - kamen die Parlamentarier zu dem Schluss, dass die explizite Erwähnung der beiden Prinzipien in der Verfassung kein gangbarer Weg ist. Daraufhin schlugen zwei französischsprachige Ständeräte vor, die Verfassungsdebatte beiseite zu schieben und sich ganz auf die Problematik der Rätoromanen zu konzentrieren. Der neue Sprachenartikel solle nur Regelungen beinhalten, mit denen man bedrohten sprachlichen Minderheiten finanziell unter die Arme greifen kann. Dieser Kompromissvorschlag fand sehr breite Zustimmung in National- und Ständerat und ging auch problemlos in der Volksabstimmung durch. Auch wenn er in den Medien gerne als «Fleisch ohne Knochen» bezeichnet wurde, war er doch das Produkt hochstehender Deliberation, deren Resultat vom Respekt gegenüber den unterschiedlichen Anliegen der Sprachminderheiten und der Einsicht in die Komplexität der Materie geprägt war. Klar, die Deliberationsqualität politischer Debatten im schweizerischen Konkordanzsystem ist nicht automatisch hoch. Wie bereits erwähnt, hängt viel vom Thema ab, das zur Debatte steht. Sprachdebatten in der Schweiz berühren einen zentralen Punkt schweizerischer Nationalität, wobei es starke historische Mythen von gegenseitigem Verständnis und Respekt zwischen den Sprachgruppen gibt. Dadurch besteht in der Schweiz bei Sprachdebatten ein grosser Wille zur politischen Zusammenarbeit. Bei wirtschafts- und sozialpolitischen Vorlagen ist dieser Wille zur Zusammenarbeit klar weniger ausgeprägt, und die Deliberationsqualität sinkt entsprechend (obwohl es in der alten Konkordanz auch hier punktuell deliberative Momente gab). Zudem, und das ist für diese Tagung besonders wichtig, hat sich im letzten Jahrzehnt der politische Stil im Schweizerischen Konkordanzsystem spürbar verändert: der Wahlerfolg der Schweizerischen Volkspartei (SVP) hat die anderen Parteien gezwungen, auf den populistischen und aggressiven Diskussionsstil der SVP zu reagieren und deliberatives Verhalten, wie wir es bei der Beratung des Sprachenartikels gesehen haben, vielfach aufzugeben. Der Verlust deliberativen Handelns geht auch einher mit einer stärkeren Mediatisierung der Politik. Einzig in der zweiten Kammer, im Ständerat, finden sich aktuell noch Ansätze zu differenzierter und respektvoller Argumentation. Aus meiner Sicht ist der Rückgang der Deliberationsqualität und der damit verbundene Verlust an Sachlichkeit der demokratischen Auseinandersetzung in der Tat ein Problem. Komplexe politische Systeme wie die Schweiz sind auf Deliberation angewiesen. Deliberation kann dabei helfen, dass Akteure in einem komplexen Umfeld Unsicherheit und Unwissen überwinden, dass sie mittels Diskussion neue Alternativen generieren, und dass sie Verständnis gegenüber Interessen von Minderheiten und weniger privilegierten Gruppen entwickeln. Die Debatte zum Sprachenartikel zeigt deutlich auf, dass Politiker in qualitativ hochstehenden Diskussionen nicht nur etwas lernen können, sondern dass Deliberation auch die Suche nach kreativen Politiken auslösen kann, die – auch wenn sie nicht immer umgesetzt werden können – letztlich doch minderheitsfördernde Massnahmen und breit abgestützte Kompromisse begünstigen. Die aktuell stark polarisierte Politik in den USA zeigt deutlich auf, was passiert, wenn Politiker ihre Bereitschaft zu Deliberation und Kompromiss verlieren. Wie beim „fiscal cliff“ resultieren dann politische Blockaden oder Kompromisse auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner, die weder minderheitsschützend sind noch win-winSituationen für die Gesamtgesellschaft darstellen. Kommt hinzu, dass stark polarisierte Politik auch das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Politik untergräbt. Ein spannendes Experiment von Diana Mutz (2007) zeigt, dass, wenn ein Thema sehr 4 kontrovers aufgezogen ist, Bürger sehr viel weniger Vertrauen in die Politik haben als wenn ein Thema konsensualer abgehandelt wird. Deliberation in der direkten Demokratie Das Verhältnis von Deliberation und direkter Demokratie ist grösstenteils unerforscht, gleichzeitig aber auch umstritten. Einige Autoren (z.B. Hanspeter Kriesi) weisen darauf hin, dass direktdemokratische Abstimmungen Bürgerinnen und Bürgern mit unterschiedlichen Argumenten und Sichtweisen konfrontieren und intensive Diskussionen auslösen können. Die Mehrheit der Autoren ist aber klar der Meinung, dass direkte Demokratie und Deliberation nicht so einfach miteinander kombinierbar sind. Dies aus zwei Gründen. Erstens, können Diskussionen über ein Abstimmungsthema nicht automatisch mit Deliberation gleichgesetzt werden. Wie der amerikanische Rechtswissenschaftler Cass Sunstein wiederholt betont hat, diskutiert man oft nur mit Leuten, die ähnliche Meinungen vertreten; oder man hört wohl Gegenargumente, wertet diese aber sogleich als untauglich ab. Das Ergebnis ist dann lediglich Verstärkung der bestehenden Meinung (oder Meinungspolarisierung). Deliberation dagegen heisst, dass wir uns gezielt und respektvoll mit anderen Meinungen und Sichtweisen auseinandersetzen, diese gegeneinander abwägen und gegebenenfalls unsere Meinungen anpassen. Deshalb muss Deliberation unter Bürgerinnen und Bürgern gewissermassen „künstlich“ hergestellt werden (wie das genau bewerkstelligt werden kann, wird weiter unten erläutert). Zweitens haben direktdemokratische Abstimmungskämpfe Kampagnencharakter, bei dem es nicht um das beste Argument, Respekt gegenüber anderen Sichtweisen oder Problemlösung geht, sondern um das Mobilisieren für die jeweils eigene Position auf rhetorisch geschickte Art und Weise. Stephen Tierney beschreibt dies in einem neuen Buch über direkte Demokratie wie folgt: “referendums by their nature facilitate or indeed encourage the mere aggregation of individual wills and in doing so fail to foster either acquisition of information by, or the active deliberation of, citizens. By this argument people enter the referendum process with pre-formed views and the referendum, as a simple act of voting Yes or No, becomes a conduit through which these views can be expressed, often hastily, without discussion or reflection and, therefore, without any possibility that minds might be changed and preferences transformed.” (Tierney 2012:27-28) Es stellt sich nun die Frage, was passieren würde, wenn Deliberation gezielt in direktdemokratische Kampagnen eingebaut würde und normale Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit hätten, im direkten Gespräch miteinander über den anstehenden direktdemokratischen Entscheid zu deliberieren. Würden deliberierende BürgerInnen anders entscheiden als solche, die nur der Kampagne ausgesetzt waren? Und würde Bürgerdeliberation in direktdemokratischen Abstimmungen das Wissen zum Thema erhöhen? Bis anhin fehlt systematische Forschung zu diesem Thema weitgehend. Im Rahmen des NCCR Democracy („Challenges to Democracy in the 21st Century“) hat unser Projektteam3 in enger Zusammenarbeit mit dem Umfrageinstitut LINK erstmalig im direktdemokratischen Kontext der Schweiz ein deliberatives Feldexperiment durchgeführt, 3 André Bächtiger (Universität Luzern), Thomas Gautschi (Universität Mannheim), Seraina Pedrini und Marco Steenbergen (beide Universität Zürich). 5 und zwar zur Ausschaffungsinitiative der SVP und dem Gegenvorschlag (Oktober-Dezember 2010). Unser Feldexperiment folgt der Grundidee von James Fishkin’s “deliberative polls” (DPs), beinhaltet aber einige Innovationen. Fishkin geht vom Problem aus, dass alle potentiell Betroffenen eines Entscheids zur Deliberation zugelassen werden sollten, dass Deliberation in sehr grossen Gruppen aber nicht funktionieren kann. DPs lösen dieses Problem, indem eine repräsentative Stichprobe der Bevölkerung gezogen wird, wodurch alle theoretisch die gleiche Chance haben, an der Deliberation teilzunehmen. Eine Stichprobe der Bevölkerung ist gleichzeitig klein genug, dass die ausgewählten Teilnehmenden effektiv miteinander deliberieren können. Unser experimentelles Design nahm diese Idee als Ausgangspunkt: in einem ersten Schritt wurden Interviews mit 1670 zufällig ausgewählten stimmberechtigten Schweizer Bürgerinnen und Bürgern durchgeführt (aus dem Internet Panel des LINK Instituts mit 110’000 registrierten Teilnehmern). Dabei wurden neben Einstellungsfragen zur Ausschaffungsinitiative und dem Gegenvorschlag auch generelle Einstellungsfragen zur Politik und zur Immigrationstematik gestellt (Fragebogen 1). Am Ende wurden alle Befragten eingeladen, an der Online-Diskussion teilzunehmen. Entgegen bisheriger Erfahrungen mit DPs wollten nur rund 15% mitmachen (anstatt der 30% prognostizierten Teilnehmenden). In einem zweiten Schritt haben wir die Teilnahmewilligen zufällig in drei Gruppen eingeteilt: eine erste Gruppe, die sowohl Informationsmaterial (basierend auf eingeholten Argumenten von Parteien und Abstimmungskomitees) erhielt und in Kleingruppen diskutierte; eine zweite Gruppe, die nur das ausgewogene Informationsmaterial erhielt, aber nicht diskutierte; und eine dritte Gruppe, die nur Fragebögen ausfüllte. Diese drei Gruppen wurden in der Experimentwoche (Fragebogen 2) sowie unmittelbar nach der Abstimmung am 28. November 2010 nochmals befragt (Fragebogen 4). Unser Feldexperiment zur Ausschaffungsinitiative und dem Gegenvorschlag zeigt, dass der gezielte Einbau von Deliberation in direktdemokratischen Kampagnen Wirkungen auf die Positionen und das Wissen der Bürgerinnen und Bürger haben kann. Meinungen zu Gegenvorschlag und Initiative zu Beginn der Kampagne und nach der Abstimmung Online-Diskussionsgruppe Kontrollgruppe mit Information Kontrollgruppe ohne Information Zustimmung zum Gegenvorschlag zu Beginn der Kampagne (Fragebogen 1) 48.8% 50.8% 63.9% Zustimmung zum Gegenvorschlag nach Abstimmung (Fragebogen 4) 71.7% 46.3% 47.7% Online-Diskussionsgruppe Kontrollgruppe mit Information Kontrollgruppe ohne Information Zustimmung zur Initiative zu Beginn der Kampagne (Fragebogen 1) 50.7% 57.1% 53.7% Zustimmung zur Initiative nach Abstimmung (Fragebogen 4) 41.0% 46.8% 41.9% Fokussiert man auf Meinungsänderungen zum Gegenvorschlag, zeigt sich, dass die OnlineDiskussionsgruppe eine höhere Zustimmung für den Gegenvorschlag entwickelte (von 49% auf 72%), im Vergleich zu den beiden Kontrollgruppen, deren Zustimmungsrate zum Gegenvorschlag konstant blieb oder sogar abnahm (von 64% auf 48% in der Kontrollgruppe, 6 die nur der Kampagne ausgesetzt war). Die Unterschiede zwischen der OnlineDiskussionsgruppe und den beiden Kontrollgruppen (mit und ohne Information) sind nach der Abstimmung auch statistisch signifikant (zum Beginn der Kampagne waren sie es nicht). Bei der Initiative finden sich dagegen keine Unterschiede bei den drei Gruppen. Dies mag auf den ersten Blick paradox erscheinen, erklärt sich jedoch mit der Möglichkeit der Stimmbürger, sowohl für Gegenvorschlag und Initiative ein „Ja“ einlegen zu können. Bezüglich Wissensgewinn finden wir ein interessantes Muster: nachdem die OnlineDiskussionsgruppe und die Kontrollgruppe mit Information das Informationsmaterial gelesen hatten, nahm der Anteil korrekter Antworten im Vergleich mit der Kontrollgruppe ohne Informationsmaterial deutlich zu. Jedoch konnte nur die Online-Diskussionsgruppe diesen Wissensgewinn bis nach der Abstimmung behalten, während die Kontrollgruppe mit Informationsmaterial dieses Wissen wieder verlor. Somit hatte die Online-Diskussion einen Konsolidierungseffekt auf den Wissensgewinn. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die deliberierenden Bürgerinnen und Bürger nicht nur mehr zum Abstimmungsthema wussten, sie entschieden sich auch deutlich für den moderateren Gegenvorschlag, der das Verlangen der Bürger nach Ausschaffung krimineller Ausländer mit den Prinzipien des Völker- und Grundrechts in Einklang bringen wollte. Mit Blick auf die Ausschaffungsinitiative, die von vielen politischen Kommentatoren als „populistisch“ eingestuft wurde, sind diese Resultate von besonderer Bedeutung. Deliberation könnte demnach als Korrektiv gegen den zunehmenden Populismus in der schweizerischen direkten Demokratie fungieren, indem deliberierende Bürgerinnen und Bürger der Gefahren populistischer Initiativen bewusst werden und ihre Meinungen entsprechend anpassen. Klar: Deliberation, die eine grössere Anzahl von Bürgerinnen und Bürgern miteinschliesst, scheint utopisch – gerade wenn man auch die doch geringe Teilnahmewilligkeit an unserem Feldexperiment denkt (nur 15% der Angefragten wollten mitmachen) Doch kanadische Erfahrungen (siehe Warren und Pearse 2008) mit Bürgerdeliberation zeigen, dass Bürger, die nicht deliberiert haben, deliberierenden Bürgern durchaus Vertrauen schenken können, gerade weil sie wissen, dass diese nicht einer Parteilogik folgen müssen und eher das Gesamtinteresse im Auge behalten können. Anders gesagt: ausgewählte Bürgerinnen und Bürger, die nach intensiver Deliberation eine gemeinsame Abstimmungsempfehlung machen würden (die zum Beispiel im offiziellen Abstimmungsbüchlein erwähnt würde), könnten in der direkten Demokratie durchaus einflussreich sein, indem sie andere Bürger in ihrem Abstimmungsverhalten beeinflussen. Dafür muss aber sichergestellt sein, dass sowohl die Rekrutierung als auch der deliberative Prozess unter normalen Bürgerinnen und Bürgern optimal ablaufen: nur wenn die Teilnehmenden repräsentativ für die Gesamtbevölkerung sind und sie sich gleichzeitig im deliberativen Prozess intensiv und ausgeglichen mit den pro- und contra-Argumenten auseinandergesetzt haben, kann Bürgerdeliberation politischen Einfluss in der direkten Demokratie beanspruchen. Unser Feldexperiment mag solchen Anforderungen nicht vollauf genügen: während die Diskussionen durchaus ausgewogen abliefen, war insbesondere die Teilnehmerzahl in der Online-Diskussion viel zu klein (N=49), um Repräsentativität zu beanspruchen. Dennoch bildet unser Feldexperiment einen ersten Versuch, die gerade im Schweizer Kontext oft propagierte „Rationalität“ direktdemokratischer Verfahren („das Volk hat immer recht“) kritisch zu hinterfragen und gleichzeitig über institutionelle Weiterentwicklungen der direkten Demokratie konkret nachzudenken. 7 Deliberative Reformen in der Schweiz? Wir haben gesehen, dass es Spuren von Deliberation in der Politik gibt und dass Deliberation Kompromisslösungen begünstigen und Verständnis für Minderheitsanliegen schaffen mag; und wir haben gesehen, dass mehr Deliberation in der direkten Demokratie zu besserem Wissen und anderen Entscheidungen führen kann. Doch lässt sich Deliberation als Handlungslogik verbreitern – oder bleibt Deliberation eine Utopie ohne reale Bedeutung für die aktuelle Politik? Im letzten Teil will ich die Möglichkeiten und Grenzen von Deliberation für demokratische Reformen genauer ausleuchten und insbesondere auch nach problematischen Aspekten von Deliberation fragen. Zunächst ist festzuhalten, dass es in allen Demokratien ein wahrgenommenes Malaise etablierter Politik gibt. Nicht nur ist die Beteiligung bei Wahlen in den letzten Jahrzehnten stetig gesunken, auch sind die Bürgerinnen und Bürger gegenüber politischen Parteien, Regierungen und Parlamenten zunehmend kritisch eingestellt. Gewiss, der Trend ist in der Schweiz nicht so ausgeprägt, doch er ist vorhanden (wie auch der Fragebogen im Vorgang zu dieser Tagung dokumentiert). Eine Möglichkeit dem Malaise etablierter Politik entgegenzuwirken, liegt aus Sicht vieler Politikbeobachter in einer Stärkung von Bürgerpartizipation und insbesondere Bürgerdeliberation. Die grün-rote Regierung in Baden-Württemberg zum Beispiel hat dies zum politischen Programm erhoben und fördert explizit deliberative Experimente. Konkrete Ergebnisse stehen noch aus, doch die mittlerweile vielfachen Erfahrungen mit Bürgerdeliberation weltweit zeigen, dass Deliberation in der Tat ein probates Mittel gegen das Malaise sein kann: erstens werden Leute einbezogen, die sich vorher noch nie gross mit Politik beschäftigt haben; zweitens entwickeln deliberierende Bürgerinnen und Bürger ein höheres Vertrauen in die institutionelle Politik, insbesondere weil sie lernen, wie komplex politische Materien sein können und wie schwierig es oft ist, Kompromisse zu finden; und drittens weist eine Studie in den USA auch nach, dass regelmässige Teilnahme an deliberativen Prozessen das Interesse an Politik und die Teilnahmehäufigkeit an Wahlen und anderen politischen Aktivitäten deutlich erhöht (Jacobs et al. 2009). Obwohl Bürgerdeliberation gewiss einen wichtigen Teil in einem demokratischen Reformprogramm spielen sollte, bin ich skeptisch gegenüber Reformen einzig auf Basis von Bürgerdeliberation. Ein grosses Problem von Bürgerdeliberation ist die direkte Wirkung auf politische Prozesse. Zwar gibt es einzelne Fälle wie bei dänischen Konsenskonferenzen, bei denen Inputs aus Bürgerdeliberationen von der etablierten Politik aufgenommen wurden; doch die Mehrzahl der Bürgerdeliberationen bleibt ohne jegliche politische Wirkung. Gründe dafür sind meistens fehlende politische und parteiliche Unterstützung sowie mangelnde Medienöffentlichkeit. Ein weiteres Problem ist die kontinuierliche Motivation von Bürgerinnen und Bürgern, sich an deliberativen Verfahren zu beteiligen. Mein Kollege Michael Neblo hat zwar eindrücklich nachgewiesen, dass normale Bürgerinnen und Bürger an Deliberation interessiert sind, und dass dies insbesondere diejenigen sind, die sich von der normalen Politik abgewendet haben (Neblo et al. 2010). Dennoch darf man sich fragen, ob es bei einer starken Institutionalisierung deliberativer Bürgerverfahren letztlich nicht doch zu einer sehr selektiven Teilnahme kommt – anders gesagt, dass es letztlich immer die gleichen sind, die deliberieren wollen, was die Repräsentativität und damit auch die Legitimität deliberativer Verfahren stark einschränken würde. Und schliesslich darf man auch Fragezeichen setzen, wie gut Bürgerdeliberation funktioniert, wenn komplexe Kompromisse zwischen widerstreitenden Positionen und Interessen ausgearbeitet werden müssen. Dies ist bislang 8 noch kaum ausprobiert worden. Die meisten Forscher und Praktiker sind sich jedoch einig, dass Bürgerdeliberation zwar bei generellen Empfehlungen und bei Agenda-Setting gut funktionieren kann, dass bei der komplexen und kreativen Kompromissfindung das repräsentative System aber wohl das geeignetere ist. Wenn wir ein Malaise aktueller Politik diagnostizieren, dann sollte auch über deliberative Reformen im repräsentativen System nachgedacht werden. Der Grundgedanke wäre, dass ein stärker deliberatives repräsentatives System sachlichere, kreativere, stärker am Gemeinwohl orientierte, minderheitsschützende (und –fördernde) sowie konsensorientiertere Politiken hervorbringen würde. Denken wir aber zuerst einmal extrem: was würde passieren, wenn das ganze politische System auf Deliberation umgestellt würde? Eine (realistische) Möglichkeit wäre, dass dies massive Probleme von Verantwortlichkeit und Legitimität hervorrufen würde. Wären Bürgerinnen und Bürger bereit zu akzeptieren, dass ihre politischen Vertreter ihre Meinungen im Lichte deliberativer Prozesse regelmässig ändern? Oder würden sie dann dem politischen System das Vertrauen entziehen, was den perversen Effekt erzeugte, dass mehr Deliberation die Legitimität politischer Systeme untergraben würde (zu deren Erhöhung Deliberation ja eigentlich gedacht ist)? In der Tat zeigen amerikanische Umfragen, dass das „trustee“-Modell mit loser Kupplung zwischen Wählerschaft und Repräsentanten von vielen Bürgerinnen und Bürger nicht akzeptiert wird. Stattdessen ziehen letztere ein Modell mit starker Verantwortlichkeit und Responsivität vor (Jacobs und Shapiro 2000). Gleichzeitig sollten wir nicht vergessen, dass es gerade in der Schweiz einen substantiellen Anteil von Bürgerinnen und Bürgern gibt, denen Sachlichkeit in der Politik – und damit auch Deliberation – wichtig ist. Damit stellt sich aber die Frage nach dem Grad der „optimalen“ Deliberation, konkret: wieviel Deliberation braucht und verträgt ein politisches System wie die Schweiz? Ferner stellt sich die Frage, ob sich deliberative und weitere demokratische Standards - wie Transparenz oder Responsivität - gleichzeitig maximieren lassen, oder ob es normative „trade-offs“ geben kann. Empirisch scheint die gleichzeitige Maximierung verschiedener Standards schwierig. Nehmen wir die beiden Faktor Öffentlichkeit und Transparenz, die von vielen Demokratieforschern als zentrale Kriterien einer guten Demokratie erachtet werden (siehe auch Umfrage zu dieser Tagung). Die empirische Forschung zeigt aber, dass ein zentrales Element von Deliberation – Respekt und konstruktive Problemlösung – in der Nichtöffentlichkeit deutlich mehr vorkommt als in der Öffentlichkeit. Demokratietheoretisch ist diese Erkenntnis aber sehr problematisch: wenn Deliberation in der Politik vor allem in nichtöffentlichen Arenen (wie in einer Ständeratskommission) oder in wenig transparenten Politiknetzwerken möglich ist, dann ist das deliberative Ideal elitistisch und letztlich undemokratisch. Gleichwohl hat Deliberation - wie gezeigt - gewichtige Vorteile, welche für die Erneuerung von Demokratien genutzt werden sollten. Wie können wir also die Stärken von Deliberation maximieren und die Schwächen sowie „trade-offs“ zwischen deliberativen und anderen demokratischen Standards minimieren? Ich plädiere für eine „systemische“ und „sequentielle“ Perspektive“ auf Deliberation (siehe Parkinson und Mansbridge 2012; Goodin 2005), bei der verschiedene Arenen deliberative und demokratische Ansprüche so einlösen, dass potentielle „perverse“ Effekte möglichst minimiert werden und ein optimaler Grad an Deliberation im gesamten politischen System erreicht werden kann. Eine systemische und sequentielle Perspektive postuliert, dass weder ein ganzes System auf Deliberation umgestellt werden sollte noch eine einzige Arena alle normativen Kriterien gleichzeitig maximieren kann. Die Hoffnung besteht aber darin, dass der gesamte Entscheidungsprozess 9 trotzdem deliberativen und weiteren demokratischen Standards gerecht wird, weil unterschiedliche Arenen arbeitsteilig unterschiedliche normative Kriterien erfüllen. Um das ein wenig plastischer zu machen, möchte ich nochmals auf das Schweizer Parlament zu sprechen kommen. Hier begünstigen nicht-öffentliche Kommissionen oder der Ständerat Deliberation, doch wissen die beteiligten Akteure, dass sie die entsprechenden Ergebnisse in der öffentlichen Parlamentsdebatte vertreten und zudem in Nationalrat durchbringen müssen, welche stärker parteipolitischen Logiken folgen. Eine solche Arbeitsteilung kann gleichzeitig unterschiedliche Ansprüche von Bürgerinnen und Bürgern an die Politik befriedigen: solche, die starke Responsivität der Politik wollen, werden beispielsweise von der stärker parteipolitisch ausgerichteten Erstkammer befriedigt, wo politische Repräsentanten klar als Interessens-Advokaten agieren; solche, die Moderation und Deliberation bevorzugen, werden von der Zweitkammer bedient, wo politische Repräsentanten neben Interessensvertretung auch Deliberation und Reflexion hoch gewichten. Wenn die Arenen der repräsentativen Politik zusätzlich mit Bürgerpartizipation und Bürgerdeliberation verknüpft werden, dann lässt sich möglicherweise ein optimaler Grad an Deliberation erreichen. Ein Beispiel dafür ist das schottische Parlament, wo die Verfassung vorschreibt, dass Parlamentskommissionen normale Bürgerinnen und Bürger sowie zivilgesellschaftliche Akteure bei der Beratung von Gesetzen in die Sitzungen einladen und konsultieren müssen. Im parlamentarischen System von Schottland sind entsprechende Wirkungen auf das Politikergebnis gering, da Parteidisziplin herrscht und Abgeordnete der Regierungskoalitionen nicht so einfach Regierungsvorlagen aufgrund von Bürgerwünschen und -ideen abändern können. Würde man dagegen Bürgerkonsultation im nichtparlamentarischen System der Schweiz einführen, könnten die Wirkungen auf das Politikergebnis sehr viel grösser sein, da Parlamentarier keiner strikten Parteidisziplin unterworfen sind und Vorlagen des Bundesrats ohne politische Kosten verändern können. Lassen sie mich nochmals den Bogen zur Schweiz schlagen. Aus meiner Sicht hat das komplexe schweizerische politische System ein grosses institutionelles Potential, um deliberative und andere demokratische Ideale in die Realität umzusetzen. Die parteipolitische Polarisierung im letzten Jahrzehnt hat das systemrelevante deliberative Potential aber erheblich beschnitten. Doch es gibt auch gegenläufige Tendenzen, wie etwa die Bildung neuer Parteien in der Mitte (Grünliberale und BDP), die klassische Konkordanzprinzipien wie Dialog, Mässigung und Respekt (und damit indirekt auch deliberative Ideale) wieder hochhalten. Bezüglich Bürgerdeliberation ist die Schweiz allerdings noch Entwicklungsland. Zwar gibt es in den letzten Jahren eine Reihe von deliberativen Mitwirkungsverfahren auf Gemeindeebene, doch nicht ist die Verbreitung nicht nur auf wenige Kantone beschränkt, auch blieben die Wirkungen auf die Politik schwach. Andere Länder, insbesondere in Lateinamerika, sind der Schweiz in diesem Bereich weit voraus. Auch wenn Bürgerdeliberation demokratischem Malaise entgegenwirken kann, ist trotzdem kritisch zu fragen, wie viel Bürgerdeliberation das System Schweiz wirklich braucht. Ich denke, bei sehr kontroversen oder auch sachpolitisch sehr komplexen Vorlagen und Abstimmungen mag Bürgerdeliberation ein nützliches Gefäss sein, um zusätzliche Stimmen – nämlich diejenige einer bislang ungehörten repräsentativen Bürgerschaft – besser in die demokratische Öffentlichkeit einzubinden. Ansonsten sollte ein punktuell deliberatives repräsentatives System in Kombination mit einer lebendigen direkten Demokratie aus demokratietheoretischer Sicht vollauf genügen. Zum Schluss sei festgehalten, dass Deliberation kein Allheilmittel für die Erneuerung von Demokratien ist. Mehr Deliberation in der Politik kann externe Zwänge und Einflüsse nicht 10 mindern. Auch wird mehr Deliberation kaum das Problem der wachsenden Einkommensund Vermögensschere lösen können. Dennoch: Deliberation ist das Schmiermittel einer lösungsorientierten politischen Kultur, die in komplexen Gesellschaften kreative Kompromisse generieren kann, die win-win-Situationen für die Gesamtgesellschaft schafft und gleichzeitig Minderheiten fördert und schützt. Bibliographie Bächtiger, André (2013). Deliberation, Discourse, and the Study of Legislatures”. In: Strøm, Kaare, Saalfeld, Thomas, and Shane Martin (eds.), Oxford Handbook of Legislative Studies, Oxford: Oxford University Press. Bächtiger, André and John Parkinson (2014). Mapping and Measuring Deliberation. Micro and Macro Strategies. Book forthcoming with Oxford University Press. Goodin, Robert E. (2005). Sequencing deliberative moments. Acta Politica 40, 182–196. Jacobs L. R. and Shapiro R.Y (2000). Politicians Don’t’ Pander: Political Manipulation and the Loss of Democratic Responsiveness. Chicago: University of Chicago Press.. Jacobs, L., F. L. Cook, and M. X Delli Carpini (2009). Talking Together: Public Deliberation and Political Participation in America. Chicago: University of Chicago Press. Mutz, Diana C. (2007) Effects of "in-your-face" television discourse on perceptions of a legitimate opposition. American Political Science Review 101: 621-635. Neblo, Michael A., Kevin M. Esterling, Ryan P. Kennedy, David M.J. Lazer, and Anand E. Sokhey (2010). Who Wants to Deliberate - and Why? American Political Science Review 104: 566-83. Parkinson, John R., and Jane J. Mansbridge. 2012. Deliberative Systems. Deliberative Democracy at the Large Scale. Cambridge: Cambridge University Press. Pedrini, Seraina, André Bächtiger, and Marco R. Steenbergen (2013). Deliberative Inclusion of Minorities: Patterns of Reciprocity among Linguistic Groups in Switzerland. European Political Science Review (forthcoming). Warren, Mark, and Hilary Pearse. Designing Deliberative Democracy: The British Columbia Citizens' Assembly. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. Steiner, Jürg, André Bächtiger, Markus Spörndli, and Marco R Steenbergen. 2004. Deliberative Politics in Action. Analysing Parliamentary Discourse. Cambridge, UK: Cambridge University Press. Sunstein, Cass R. (2007). Republic.Com 2.0. Princeton: Princeton University Press. Tierney, Stephen (2012). Constitutional Referendums. The Theory and Practice of Republican Deliberation. Oxford: Oxford University Press. 11