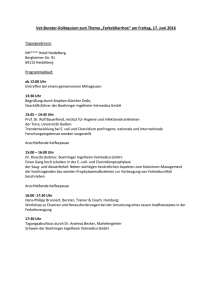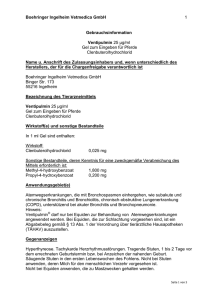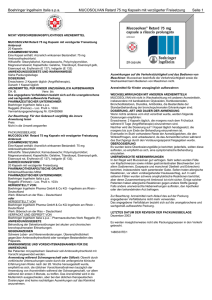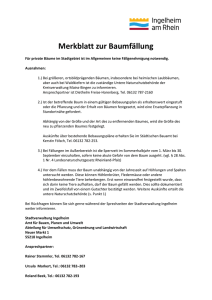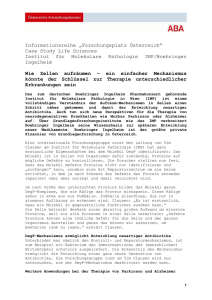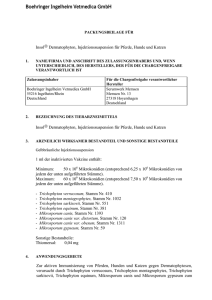Zum des Heftes
Werbung

wissenschaft.de plus Aufbruch zu neuen Horizonten Wie Pharmaforscher Medikamente entwickeln Eine Sonderpublikation in Zusammenarbeit mit der Boehringer Ingelheim GmbH Editorial | Inhalt Vom Elfenbeinturm zum Forschungsbiotop Text & Grafik: Daniela Leitner Kooperation Pharmafirmen F ör AK AD EM ISC HE NE TZ WE RK E • bilden aus • betreiben Grundlagenforschung • erforschen molekulare Krankheitsprozesse • entwickeln neue Methoden und identifizieren Ansätze zur Beeinflussung von Krankheiten INVE STO REN ung Fonds • bringen die besten Partner zu einem Thema zusammen • investieren und forschen • erforschen molekulare Krankheitsprozesse • entwickeln Wirkstoffe zu Medikamenten weiter • haben Erfahrung in klinischer Forschung und Zulassung sowie Produktion und Vertrieb • führen erste klinische Studien durch Kooperation ner geb S tudie finanzierung B IO TE C H S TA R TU P S För der ung und Studien Förderung Be teiligung Kauf nis s e Ausgründungen Kooperation Universit äten Forschungsinstitute der Forschungsbiotop Pharmaforschung in einem interdisziplinären Biotop Niemals zuvor in der Geschichte wurden Menschen so alt. Und: Die Lebenserwartung steigt weiter. Ein heute in Deutschland geborener Junge hat eine statistische Lebenserwartung von fast 78 Jahren, ein neugeborenes Mädchen von fast 83 Jahren. Für diese Entwicklung gibt es eine Reihe von Ursachen: Hoher Lebensstandard, ausgewogene Ernährung, Arbeitsschutz, Sport – und der medizinische Fortschritt. Ärzte erhalten und retten Menschenleben. Und Pharmazeutika helfen ihnen dabei und sorgen nicht selten dafür, das Leben auch bei chronischen Krankheiten wieder lebenswert zu gestalten. Trotz dieser positiven Entwicklung stehen Pharmaunternehmen immer wieder in der Kritik, nichts anderes zu wollen, als rasch möglichst viel Geld zu verdienen. Klar ist, ohne finanzielle Erträge gäbe es keine neuen Medikamente. Denn nur ein Unternehmen, das wirtschaftlich erfolgreich ist, hat die Kraft, die oft mehr als ein Jahrzehnt dauernde Entwicklung für ein Medikament durchzustehen. In dieser Sonderausgabe dokumentiert bild der wissenschaft beispielhaft die Herausforderungen, die bei der Medikamentenentwicklung zu meistern sind. Wie verwoben das ist, offenbart die große Infografik auf der gegenüberliegenden Seite. Wir präsentieren Ihnen den „Aufbruch zu neuen Horizonten“ in Kooperation mit Boehringer Ingelheim: einem Global Player der Pharma-Branche; einem Unternehmen, das am 1. August 2015 bereits 130 Jahre alt wurde; einer sich ausschließlich in Familienbesitz befindlichen Firma, die sich dezidiert zu ethischen Prinzipien bekennt. Ich bin mir bewusst, dass viele unserer Leserinnen und Leser dieses bild der wissenschaft plus kritisch in die Hand nehmen. Doch Sie werden das nicht bereuen. Denn vieles von dem, was Sie hier lesen, vermittelt Einblicke, die Sie sonst kaum bekommen. INDU STR IE AK ADE MIS CHE INST ITUT IONE N 02 _ Vom Elfenbeinturm zum Ein tiefer Einblick in moderne Pharmaforschung Früher konnte es sehr lange dauern, bis neue wissenschaftliche Erkenntnisse in die Pharmaforschung einflossen. Der Grund dafür waren starke Berührungsängste zwischen Universitäten und Industrie – Kooperationen waren selten. Der Weg von der Grundlagenforschung bis zur Entwicklung neuer Therapien kam deshalb so nur sehr mühsam voran. Heute ist dies zum Glück anders: Pharmaindustrie und Universitäten arbeiten mittlerweile Hand in Hand zusammen, um gemeinsam ein therapeutisches Problem zu lösen, mit dem Wohl des Patienten im Mittelpunkt. In dieses interdisziplinäre Biotop gesellen sich außerdem fünf weitere Gruppen: Junge Biotechunternehmen, akademische Netzwerke, medizinische Forschungseinrichtungen, staatliche Institutionen und die Patienten selbst. Sie alle sind beteiligt, wenn es um die Entwicklung neuer Medikamente geht. Jede Gruppe – unten als Heilpflanze dargestellt – bringt dabei ihre Stärken und Erfahrungen ein, damit Erkrankten am Ende besser und schneller geholfen werden kann. P A T IE N T E N P A T IE N T E N VER TRE TU NGEN • artikulieren und vertreten die Wünsche der Patienten 04 _ Schatzsuche im Reich der Moleküle Nintedanib ist ein Medikament, das bei zwei Krankheiten hilft 13 _ Lichtschalter für Nervenzellen Mit Optogenetik lassen sich erstmals einzelne Nervenzellen untersuchen 14 _ „Die menschliche Komponente ist wichtig für den Erfolg“ Andreas Barner über ethische Verantwortung und Perspektiven in der Pharmaindustrie 18 _ Neue Wege im Kampf gegen Krebs Immuntherapeutische Ansätze sind die größten Hoffnungsträger der Pharmaindustrie 21 _ Impressum 22 _ Der Mann für Sicherheit Christopher Corsico ist verantwortlich für die Medikamentensicherheit 26 _ Kraftakt für einen Lebensretter Zwischen Entwicklung und Vermarktung eines Arzneimittels steht die Zulassung 32 _ Im Zeichen des Wandels Wie Wissenschaftler den Boden für Innovationen bereiten er un g 36 _ Meilensteine bei Boehringer Ingelheim STA ATL ICH E INS TIT UTI ONE N Ko op ti er a on Zentren / Kliniken, die klinische For schung betreiben Klinische For schungsdienstleis ter Zulassungsbehörden Institute zur Nut zenbewertung Forschungs förderung Wolfgang Hess Chefredakteur • wägen Sicherheit, Effektivität, Kosten und Nutzen ab • entscheiden über Zulassung und Erstattung • tauschen sich mit Unternehmen und Patientenvertretungen aus, um den besten Weg zur Zulassung zu finden 2 bild der wissenschaft plus • führen klinische Studien und Zulassungsstudien durch • führen Anwendungsstudien durch Nachwuchsforscher im Porträt Welche Perspektiven die Pharmaforschung ihnen bietet. 07 _ Ulrike Groß 09 _ David Wyatt 11 _ Andre Broermann 25 _ David Keays 31 _ Alessandra Bartolozzi Grafik: Daniela Leitner • forschen und entwickeln • liefern neue Konzepte und Wirkstoffe, die anschließend von Pharmapartnern weiterentwickelt werden Foto: W. Scheible, Cover: A. Brookes/Corbis F ör d ME DI ZIN ISC HE FO RS CH UN G bild der wissenschaft plus 3 Wirkstoffsuche Schatzsuche im Reich der Moleküle Früher war oft Zufall im Spiel, wenn Wissenschaftler Medikamente entdeckten. Doch moderne Arzneimittelforschung erlaubt es, Wirkstoffe auf einer rationalen Basis zu entwickeln – und manchmal lassen sich damit sogar zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. von Claudia Eberhard-Metzger Alle Fotos: W. Scheible E s gibt Krankheiten, gegen die kein Kraut gewachsen ist. Und das sind noch immer erstaunlich viele: Ein Drittel der mehr als 30 000 Leiden, von denen die Menschheit geplagt wird, lässt sich überhaupt nicht oder nur unzureichend behandeln. Die idiopathische Lungenfibrose zählte noch bis vor Kurzem dazu. Was die Erkrankung verursacht, ist unbekannt; wer sie erleidet, stirbt meist drei bis vier Jahre nach der Diagnose. Damit hat die Lungenfibrose eine schlechtere Prognose als viele Krebserkrankungen. Doch seit jüngster Zeit gibt es zwei Medikamente, mit denen sich das Fortschreiten des schweren Leidens erstmals hinauszögern lässt. Eines davon ist Nintedanib, ein Wirkstoff von Boehringer Ingelheim. An seiner Entwicklung lässt sich exemplarisch aufzeigen, wie Arzneimittelforscher heute vorgehen, um im Reich der Moleküle nach neuen Behandlungsweisen gegen schwere Leiden des Menschen zu fahnden. „In der Vergangenheit war es oft der Zufall, der die Geschicke leitete“, sagt Frank Hilberg t Lutz Wollin war maßgeblich an der Entwicklung von Nintedanib als Arznei gegen idiopathische Lungenfibrose beteiligt. Im Hintergrund Fibroblasten, Zellen des Bindegewebes, die eine zentrale Rolle bei der Entstehung der Erkrankung spielen. 4 bild der wissenschaft plus Die meisten Wirkstoff-Kandidaten scheitern und erlangen nie den Ehrentitel „Medikament“. Nintedanib ist diese Ehre gleich zweifach zuteil geworden: Es eignet sich als Arznei für Patienten mit einem Adenokarzinom und bei idiopathischer Lungenfibrose. Im Bild: Weichkapseln auf dem Sicherheitsdatenblatt. bild der wissenschaft plus 5 Wirkstoffsuche die Wachstumsbotschaft im Innern der Zelle von zahlreichen Molekülen wie der Stab bei einem Staffellauf weitergereicht und dabei verstärkt. Die molekulare Signalkette endet im Zellkern. Dort werden Gene angeschaltet, die Zellen dazu veranlassen, sich zu teilen; andere Gene bestimmen, wie die neu gebildeten Zellen mit anderen Zellen Kontakt aufnehmen und auf welche Weise sie sich zu einem funktionstüchtigen Blutgefäß zusammenschließen sollen. Foto: M. Appelt Zur Vermehrung animiert Zu den einflussreichsten Mitspielern bei der Angiogenese zählt der Vascular Endothelial Growth Factor, kurz VEGF. Der Wachstumsfaktor animiert Zellspezialisten – die Endothelzellen der Blutgefäße – dazu, sich zu vermehren. Endothelzellen sind für Blutgefäße unverzichtbar. Sie kleiden die Gefäße von innen wie eine dünne Tapete aus und sind für nichts weniger verantwortlich als den lebenswichtigen Gas-, Flüssigkeits- und Stoffaustausch zwischen Blut und umliegendem Gewebe. Das Ziel von Frank Hilberg und Gerald Roth war es Mitte der 1990er-Jahre, die Wirkung des Proteins VEGF auszuschalten, die Angiogenese anzuhalten und so zu verhindern, dass Blutgefäße entstehen, die Tumore am Leben halten. Doch wie findet man Substanzen, die VEGF ausbremsen können? „Wir stellten zunächst eine Bibliothek mit rund 100 000 Molekülen zusammen, die uns biologisch interessant erschienen“, erläutert Frank Hilberg. „Anschließend prüften wir, ob eines der Moleküle die Funktion des Zielproteins verändern kann.“ Die so identifizierten Moleküle wurden systematisch modifiziert, um die erwünschte hemmende Wirkung zu verbessern. Bereits die tausendste Prüfsubstanz zeigte einen Effekt und erklomm nach weiteren Analysen zügig die nächste wichtige Untersuchungsstufe auf der langen Treppe zum Medikament, die präklinische Toxikologie. Dort ermitteln die Arzneimittelforscher – weit vor jeder denkbaren Anwendung am Menschen –, wie sich der Wirkstoff verhält, wenn er sich nicht mehr im Reagenzglas, sondern in einem lebenden Organismus befindet. „In der Toxikologie ist unser erstes vielversprechendes Molekül mit Pauken und Trompeten durchgefallen“, erinnert sich Frank Hilberg. Es zeigten sich schwere Auf Kosten gesunder Zellen Die Geschichte des neuen Medikaments beginnt Mitte der 1990er-Jahre. Der Biologe Frank Hilberg vom Boehringer Ingelheim Research Center in Wien sucht zusammen mit seinem Kollegen, dem Chemiker Gerald Roth von der Chemischen Forschung am Standort von Boehringer Ingelheim in Biberach, nach Substanzen, die in einen verhängnisvollen Prozess einzugreifen vermögen, der sich Tumor-Angioneogenese nennt. So bezeichnen Wissenschaftler die tückische Eigenschaft von Tumoren, Blutgefäße an6 bild der wissenschaft plus zulocken, um ihre Versorgung mit Nährstoffen und Sauerstoff sicherzustellen. Ohne Anschluss an das Blutgefäßsystem des Körpers kommen Tumore über die Größe eines Senfkorns kaum hinaus. Gelingt es ihnen aber, Blutgefäße zu akquirieren, verwandeln sie sich in das, was Ärzte als „bösartig“ bezeichnen: Entartete Zellen wachsen ungehemmt auf Kosten gesunder Zellen, Gewebe und Organe heran, verlassen den Ort ihres Entstehens und siedeln in anderen Regionen des Körpers als Tochtergeschwülste. Die Idee, Tumore daran zu hindern, die Neubildung von Blutgefäßen zu veranlassen und Krebsgeschwülste auf diese Weise gleichsam den Hungertod sterben zu lassen, geht zurück auf Arbeiten des amerikanischen Forschers Judah Folkman. Der Zellbiologe und Mediziner untersuchte in den 1960er-Jahren, wie Blutgefäße zu Tumoren hinwachsen und stellte Anfang der 1970er-Jahre die Hypothese auf, dass alle Krebsarten von der Angiogenese abhängig seien. Folkman gab der Krebsforschung damit eine neue Richtung und der Suche nach Wirkstoffen, die in das folgenschwere Geschehen eingreifen, weltweiten Auftrieb. Die Neubildung von Blutgefäßen ist komplex und viele zelluläre und molekulare Mitspieler sind daran beteiligt. Unterschiedliche Zellspezialisten, etwa Muskel- und Bindegewebszellen, müssen sich dazu kontrolliert vermehren, in geordneter Weise zusammenfinden und zielgerichtet wachsen. Animiert – und überwacht – werden die Zellen von bestimmten Proteinen, sogenannten Wachstumsfaktoren. Sie entfalten ihre Wirkung, indem sie an Rezeptoren andocken, spezielle Aufnahmestationen auf der Oberfläche der Zielzellen. Sobald ein Wachstumsfaktor an seinen Rezeptor gebunden hat, wird Ulrike Groß _ geboren 1982 in Lauffen am Neckar, ist Chemikerin und Laborleiterin in der Medizinischen Chemie. „Ich war schon lange begeistert von der Idee, mein chemisches Wissen für die Entwicklung von neuen Medikamenten einzusetzen. An der Universität Cambridge hatte ich Gelegenheit, mit zwei MedizinalChemikern von Boehringer Ingelheim zusammenzuarbeiten, die mir viel von ihrer Arbeit erzählt haben. Daraufhin habe ich mich als Laborleiterin bei BI beworben. Derzeit arbeite ich dort an zwei Projekten. Beide haben zum Ziel, neue Wirkstoffe gegen psychiatrische Erkrankungen wie Depression und Schizophrenie zu finden. Meine Aufgabe ist es, neue chemische Moleküle zu entwerfen, die verbesserte biologische Eigenschaften zeigen. Diese Moleküle werden dann von meinem Laborteam zum ersten Mal synthetisiert und durchlaufen anschließend viele biologische Tests. Als Medizinische Chemikerin fasziniert es mich, die biologischen Eigenschaften von Molekülen zu beeinflussen, indem ich gezielt ihre chemische Struktur verändere. Foto: T. Klink von Boehringer Ingelheim. Die moderne Pharmaforschung könne aufgrund eines besseren molekularen Verständnisses der Krankheitsentstehung jedoch auf eine rationale Strategie setzen und „intelligent und zielgerichtet“ vorgehen. NACHWUCHSFORSCHERIN IM PORTRÄT Frank Hilberg erklärt, wie Nintedanib die Teilung von verschiedenen Zelltypen hemmt, die an der Blutgefäßbildung beteiligt sind. Es begeistert mich, Teil eines interdisziplinären Teams von Forschern zu sein, die mit großem Engagement und viel Kreativität an einem gemeinsamen Ziel arbeiten. Diese Art der Teamarbeit bedeutet für mich, dass ich nicht nur für den medizinal-chemischen Fortschritt des Projekts verantwortlich bin, sondern auch die Strategie des gesamten Projekts mitgestalten kann.“ bild der wissenschaft plus 7 Nebenwirkungen, „damit war die Substanz für uns erledigt“. Weitere chemische Veränderungen führten bereits 120 Substanzen später zu einem Molekül mit dem Boehringer Ingelheim internen Code BIBF 1120. Anders als seine Vorgänger meisterte es alle nachfolgenden Hürden und erwies sich zudem als dreifach wirkstark: BIBF 1120 – das heutige Nintedanib – hemmt nicht nur VEGF, sondern zudem zwei weitere Wachstumsfaktoren der Angiogenese, die die Kürzel PDGF (Platelet Derived Growth Factor) und FGF (Fibroblast Growth Factor) tragen. Nintedanib verhindert, dass Wachstumsfaktoren ihre biologische Wirkung entfalten, indem es ihnen gleichsam ihren Platz am jeweiligen Rezeptor streitig macht und die Informationsübermittlung vereitelt. Frank Hilberg fasst den Wirkmechanismus in präzise wissenschaftliche Worte: „Nintedanib bindet an die sogenannte Kinasedomäne der jeweiligen Rezeptoren im Innern der Zellen und verhindert so die energieabhängige Aktivierung der Rezeptoren und damit die Signalweitergabe.“ Seit November 2014 ist Nintedanib, der erste dreifache Angiogenese-Hemmstoff, in Deutschland zugelassen, um eine bestimmte Form von fortgeschrittenem Lungenkrebs zu behandeln. Das neue Medikament kommt für Patienten mit einem sogenannten Adenokarzinom infrage. Der Tumor wird von den Ärzten in der Regel mit einer herkömmlichen Chemotherapie behandelt, also mit Zellgiften, die sich gegen alle sich rasch teilenden Zellen im Körper richten. Schreitet der Krebs trotz Therapie fort, ist mit dem Angiogenese-Hemmer Nintedanib nun ein weiteres Medikament verfügbar. Eine wunderbare Erfahrung Von den ersten Laboruntersuchungen im Reagenzglas, über weitere Tests mit Zellkulturen und Geweben, den Untersuchungen mit Tieren bis hin zu ersten Anwendungen beim Menschen und den Studien zur Zulassung des Wirkstoffs als Medikament gegen Lungenkrebs vergingen 14 Jahre – eine für die Entwicklung von Arzneimitteln übliche Zeit. Den Werdegang eines interessant erscheinenden Moleküls bis zu seiner Markteinführung von Anfang an in all seinen Schritten miterleben zu dürfen, sei in einem Forscherleben eine „seltene und wunderbare Erfahrung“, meint Frank Hilberg. Es sei ein bisschen so, „als würde man sein Kind über die Jahre hinweg bis zur Selbstständigkeit begleiten“. Die meisten Wirkstoff-Kandidaten scheitern auf dem langen und hürdenreichen Weg zum Ziel und erlangen nie den Ehrentitel Medikament. Nintedanib ist diese Ehre gleich zweifach zuteil geworden: Im Januar 2015 wurde es europaweit auch zur Behandlung der Lungenfibrose zugelassen. Doch wie kann ein Medikament zwei derart unterschiedliche Krankheiten beeinflussen? Der Doppelerfolg begründe sich mit der molekularen Wirkweise von Nintedanib, erklärt der Pharmakologe Lutz Wollin von der Boehringer Ingelheim-Forschungsdependance in Biberach. Denn auf molekularer Ebene sind Krebs und Fibrose weit weniger verschieden als es auf den ersten Blick den Anschein haben mag. David Wyatt _ geboren 1978 in Exeter, Vereinigtes Königreich, ist Laborleiter in der Abteilung für Immunologie und Atemwegserkrankungen. Ich habe das Glück, zusammen mit einem interdisziplinären Team von Wissenschaftlern aus der ganzen Welt in einem gemeinsamen Projekt von Boehringer Ingelheim und BioMedX mitzuwirken. Dabei geht es um epigenetische Einflüsse bei chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD), einer fortschreitenden Erkrankung der Atemwege, die häufig durchs Rauchen verursacht wird. Ich bin schon ganz gespannt und hoffe, dass wir zusammen einen Weg finden, der zu neuen Therapien führt.“ Foto: T. Klink „Als Kind habe ich alte Maschinen und Spielzeug auseinandergenommen, um zu sehen, wie sie funktionieren, oder um defekte Gegenstände zu reparieren. Heute mache ich im Prinzip nichts anderes: Ich versuche, die Komponenten einer Erkrankung zu erfassen, um anschließend Medikamente zu entwickeln. Ich arbeite explorativ an Ideen, die zu Therapien gegen Lungenfunktionsstörungen führen können. Es geht vor allem darum, Moleküle zu identifizieren, die mit bestimmten Krankheitsprozessen in Verbindung stehen. Mein Team und ich versuchen, diese Moleküle so zu verändern, dass sich das Krankheitsbild des Patienten verbessert. Kooperationen mit anderen wissenschaftlichen Institutionen spielen dabei eine ganz wesentliche Rolle – man sollte nicht nur innerhalb der eigenen Mauern denken! NACHWUCHSFORSCHER IM PORTRÄT Foto: W. Scheible Wirkstoffsuche Eine Verdünnungsreihe mit Nintedanib wird mit einer Multikanalpipette in eine Mikrotiterplatte vorgelegt. In diesen Platten werden anschließend enzymatische Tests oder Zellkulturexperimente durchgeführt. 8 bild der wissenschaft plus bild der wissenschaft plus 9 Wirkstoffsuche Lutz Wollin und seine Biologielaborantin Jennifer Schütz in seinem Labor am Standort Biberach. Auf dem Computerbildschirm zeigt ein Spektralphotometer die Ergebnisse eines enzymatischen Assays an, der in einer Mikrotiterplatte durchgeführt wurde. „Die Entstehung der Lungenfibrose“, sagt Lutz Wollin, „zeigt auffällige Ähnlichkeiten zum Entstehen von Krebs.“ Aus dieser Analogie wurde 2005 von den Wissenschaftlern Birgit Jung und John Park, beide aus der Atemwegsforschung von Boehringer Ingelheim in Biberach, die Hypothese aufgestellt, dass Nintedanib zur Behandlung von idiopathischer Lungenfibrose anwendbar sein sollte. Zu einer Fibrose kommt es, wenn sich Bindegewebszellen, Fibroblasten genannt, übermäßig vermehren und ausbreiten. Grundsätzlich können al10 bild der wissenschaft plus le Organe von einer Fibrose betroffen sein. Ein Beispiel ist die alkoholbedingte Leberzirrhose, bei der gesunde, schadstoffabbauende Leberzellen unter dem ständigen Einfluss des Zellgiftes Alkohol nach und nach durch „wertlose“ Bindegewebszellen ersetzt werden. Warum die Bindegewebszellen der Lunge beginnen, sich unkontrolliert zu teilen und zu verbreiten, ist nicht bekannt. Lange Zeit gingen Wissenschaftler von einem entzündlichen Geschehen aus. Heute nehmen sie an, dass überschießende Reparatur- und Wundheilungsprozesse am Anfang des Leidens stehen. Danach schädigen äußere Einflüsse – etwa Zigarettenrauch, Schadstoffe in der Luft, aber auch Viren, Bakterien oder eingeatmete Magensäure – das Lungenepithel, eine zarte einschichtige Lage von Zellen, die die Lungenbläschen auskleidet. Wird das Epithel verletzt, setzen sofort Reparaturmaßnahmen ein: Jene Wachstumsfaktoren, die auch bei der Angiogenese eine Rolle spielen, werden ausgeschüttet und regen Bindegewebszellen dazu an, sich zu vermehren, auszubreiten und extrazelluläre Matrix zu produzieren. Dabei handelt es sich um eine proteinreiche, von Fasern durchzo- Bei Menschen, die an einer Lungenfibrose leiden, laufen die natürlichen Prozesse der Wundheilung unkontrolliert ab. Bei ihnen werden Zellen des Lungenepithels wahrscheinlich durch sogenannte Myofibroblasten ersetzt – sehr produktive Zellen, die weit mehr Matrixmaterial erzeugen als erforderlich ist. Die Funktion der umgebenden gesunden Epithelzellen wird dadurch erheblich beeinträchtigt. Mehr und mehr überwuchert zähes Narbengewebe die dünne, gut durchblutete Epithelschicht der Lungenbläschen und lässt eine grobe bienenwabenartige Struktur entstehen. Die krankhaften Veränderungen machen die Lunge starr und unelastisch. Ihre lebenswichtige Aufgabe, Sauerstoff aufzunehmen und Kohlendioxid abzugeben, kann sie immer weniger erfüllen. „An diesem fortschreitenden Prozess sind NACHWUCHSFORSCHER IM PORTRÄT Foto: W. Scheible Unkontrollierte Abläufe die Wachstumsfaktoren PDGF, FGF und VEGF maßgeblich beteiligt“, erklärt Lutz Wollin. Und hier kommt Nintedanib ins Spiel. Es hemmt die übermäßig aktiven Wachstumsfaktoren und kann das allmähliche Vernarben der Lunge hinauszögern. „Mit Nintedanib gibt es jetzt für schwer an Lungenfibrose erkrankte Patienten erstmals eine wirksame Therapie, die die jährliche Verschlechterung der Lungenfunktion halbieren kann“, sagt Wollin. Die Entwicklung von Nintedanib zur Arznei gegen Lungenfibrose begann in den späten 1980er-Jahren. Parallel zu den Arbeiten von Frank Hilberg in der onkologischen Forschung in Wien arbeiteten Birgit Jung und John Park an neuen Konzepten, um Lungenerkrankungen zu behandeln, unter anderem auch an Ansätzen zur Therapie von Lungenfibrosen – einem für Boehringer Ingelheim damals neuen Krankheitsbild. Dazu entwickelten die Wissenschaftler eigene Lungenfibrose-Modelle und testeten an ihnen den in der Onkologie in Wien entdeckten Wirkstoff BIBF 1120. „Die Kollegen sahen damals eine herausragende Wirksamkeit“, sagt Wollin. Zahlreiche wissenschaftliche Begutachtungen folgten. Mitte der 2000erJahre wurde die Entscheidung getroffen, BIBF 1120 nicht allein als Medikament gegen Lungenkrebs, sondern auch zur Behandlung der idiopathischen Lungenfibrose weiterzuentwickeln. „Mit fünf bis höchstens 24 Fällen unter 100 000 Menschen ist die idiopathische Lungenfibrose eine sehr selten auftretende Erkrankung“, erläutert Wollin. Eine mutige Entscheidung Es sei eine „mutige Entscheidung“ gewesen, sich auf dem Feld einer Orphan Disease – einer seltenen Erkrankung – zu engagieren. So wurde Nintedanib zur ersten Substanz von Boehringer Ingelheim mit Orphan Drug-Status und außerdem wegen der Innovation für die Therapie der Lungenfibrose „FDA breakthrough therapy designation“ mit beschleunigter Zulassung. Zwischenzeitlich ist es aufs Molekül genau zu erklären, wie Nintedanib Zellen daran hindert, sich zu vermehren. Das Wirkstoffmolekül – chemisch betrachtet Andre Broermann _ geboren 1980 in Erwitte, ist Biotechnologe und Laborleiter in der Abteilung für Kardiometabolische Forschung bei Boehringer Ingelheim. „Während meiner Promotionszeit habe ich primär Grundlagenforschung betrieben. Anschließend wollte ich in einem Bereich arbeiten, in dem mein Wissen in die Entwicklung von Produkten fließt, die dem Patienten zugutekommen. Dafür bietet Boehringer Ingelheim optimale Rahmenbedingungen. Unsere Abteilung beschäftigt sich mit Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes. Meine Aufgabe ist es, neue Mechanismen und Zielproteine zu identifizieren und zu prüfen, ob wir diese mittels Wirkstoffen so beeinflussen können, dass sie das Krankheitsbild verbessern. In Experimenten testen mein Team und ich verschiedene Wirkstoffe, um deren Eigenschaften zu verstehen und zu optimieren. Aktuell arbeiten wir an Wirkstoffen, die hoffentlich schon bald Patienten mit Nicht-alkoholischer Fettlebererkrankung helfen werden. Da es sich um ein sehr komplexes Krankheitsbild handelt, entwickeln wir ständig neue experimentelle Modelle, um die unterschiedlichen Aspekte der Erkrankung abzubilden. Mithilfe dieser Modelle können wir Daten erheben, die es uns ermöglichen, die Substanzen mit der besten Wirksamkeit zu identifizieren. Ich finde es extrem spannend, die Entwicklung eines Wirkstoffs von der Idee bis hin zu den ersten Tests im Menschen zu begleiten und lerne praktisch jeden Tag etwas Neues!“ Foto: T. Klink gene Substanz, die der Körper benutzt, um Strukturen zu verstärken, Lücken zwischen den Zellen und Wunden zu schließen. Wirkstoffsuche Lichtschalter für Nervenzellen Wenn verschiedene Disziplinen miteinander im Austausch stehen, kann dies zu herausragenden Ergebnissen führen. Die Optogenetik ist genau solch ein Kandidat. Angefangen hat alles mit zwei Mikroorganismen: Biologen entdeckten bei der Grünalge Chlamydomonas Proteine, die auf Licht reagieren. Sobald blaues Licht auf sie trifft, verändern die sogenannten Kanalrhodopsine ihre Durchlässigkeit. Positiv geladene Ionen strömen ins Zellinnere, die Zelle wird aktiviert. Auch ein Bakterium namens Natronomonas pharaonis besitzt solch lichtempfindliche ProteinKanäle. Allerdings bewirken diese das Gegenteil: Trifft gelbes Licht auf die Zellmembran, strömen negativ geladene Ionen ins Zellinnere. Die Zelle wird deaktiviert. Dank Gentechnik ist es gelungen, die DNA-Abschnitte für diese beiden Protein-Kanäle in Nervenzellen einzubauen. Diese lassen sich daraufhin gezielt über ein Glasfaserkabel mit blauem Licht an- und mit gelbem Licht abschalten. Diese Vorgehensweise ist revolutionär und birgt großes Potenzial für die Medizin: Denn anders als bei der Elektrostimulation, die wahllos alle Neuronen in der Umgebung anregt, lassen sich dank Optogenetik erstmals einzelne Nervenzellen und der Einfluss auf Verhalten untersuchen. Komplexe neuronale Netzwerke können so präzise erforscht und bestimmte Erkrankungen wirksamer bekämpft werden. Text & Grafik: Daniela Leitner 1 Die Grünalge Chlamydomonas besitzt lichtempfindliche Protein-Kanäle: Trifft blaues Licht auf sie, öffnen sie sich und lassen positiv geladene Natrium- und Kaliumionen ins Zellinnere strömen. Dadurch wird die Zelle aktiviert. Auch das Archaebakterium Natronomonas pharaonis besitzt lichtempfindliche Protein-Kanäle: Trifft gelbes Licht auf sie, pumpen sie negativ geladene Chloridionen ins Zellinnere. Die Zelle wird deaktiviert. Foto: M. Appelt Protein-Kanal Kanalrhodopsin Zellen verändern ihr Verhalten Von solchen energieübertragenden Enzymen – die Biochemiker sprechen von Rezeptortyrosinkinasen – gibt es im 12 bild der wissenschaft plus Körper rund 200 verschiedene Typen. Sie arbeiten alle nach dem gleichen Prinzip: Wo immer Rezeptortyrosinkinasen im Spiel sind, werden Signale weitergeleitet, verstärkt und Signalkaskaden bis hin zum Zellkern in Gang gesetzt, worauf sich das Verhalten der Zelle verändert. Rezeptortyrosinkinasen, die aufgrund molekularer Veränderungen aus ihrem fein ausbalancierten Arbeitstakt geraten, können Zellen dazu veranlassen, sich übermäßig zu teilen, ihren Platz zu verlassen, im Körper zu wandern und „Todesbefehle“, die der Zelle aufgrund schwerer genetischer Fehler erteilt werden, zu ignorieren – oder Botenstoffe auszuschütten, die Blutgefäße anlocken und natürliche Wundheilungsprozesse aus dem Ruder laufen zu lassen. Nintedanib, das kleine Molekül, ist von den Chemikern von Boehringer Ingelheim so optimiert worden, dass es exakt in die ATP-Bindungstasche der Tyrosinkinase passt, sodass ATP darin keinen Platz mehr findet. Doch das allein reicht noch nicht aus. „Die Kunst besteht darin“, erläutert Wollin, „dass der Wirkstoff genau die wenigen Kinasen hemmt, die für die Erkrankung relevant sind – genau das ist uns gelungen.“ Ohne die gültige Energiewährung können die Tyrosinkinasen ihrer Arbeit nicht mehr nachgehen. Aufgrund dieses Wirkmechanismus, so hoffen die Forscher, lässt sich Nintedanib vielleicht noch breiter einsetzen, etwa gegen weitere Krebserkrankungen wie Darm-, Nieren-, Eierstock- oder Leberkrebs und andere, häufigere Formen der Fibrose. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran“, sagt Lutz Wollin. ● Die Gene, die die beiden Kanäle formen, werden aus den Mikroorganismen isoliert. Es wird ihnen eine DNA-Sonde angehängt, damit sie später nur spezielle Nervenzellen ansprechen. Gen für Halorhodopsin mit DNA-Sonde Archaebakterium Natronomonas pharaonis harmloses Virus OPTOGENETIK 4 GENETIK Mit einem Glasfaserkabel wird Licht ins Mäusehirn gesendet. Die beiden Protein-Kanäle reagieren danach, je nach Wellenlänge des Lichts, unterschiedlich: lichtempfindliche Nervenzelle mit Kanalrhodopsin-Kanal Bei blauem Licht öffnen sich die KanalrhodopsinKanäle. Die Nervenzelle sendet nun vermehrt Nervenimpulse aus. lichtempfindliche Nervenzelle mit Halorhodopsin-Kanal 3 Die veränderten Gene werden in ein harmloses Virus eingebaut und in ein Mäusegehirn injiziert. Die angesprochenen Nervenzellen entwickeln daraufhin die lichtempfindlichen Protein-Kanäle auf ihrer Oberfläche. OPTOGENETIK Grafik: Daniela Leitner ein Salz der Ethansulfonsäure – besetzt die Rezeptoren für Wachstumsfaktoren stets an einem bestimmten, entscheidend wichtigen Ort im Innern der Zellen: Nintedanib gelangt durch die Membran in das Innere der Zelle und trifft dort an der Innenseite der Wachstumsfaktoren, die die Membran durchspannen, auf ein Protein, das als Enzym arbeitet und die wichtige Aufgabe hat, Phosphatgruppen an andere Proteine weiterzureichen. Die Phosphatgruppen entstammen Adenosintriphosphat (ATP), der allgegenwärtigen Energiewährung der Zellen. Gen für Kanalrhodopsin mit DNA-Sonde GENETIK Protein-Kanal Halorhodopsin Grünalge Chlamydomonas reinhardtii Frank Hilberg bewertet die Ergebnisse eines molekularbiologischen Verfahrens (Western Blot) zur Untersuchung der Hemmwirkung von Nintedanib. 2 BIOLOGIE Gelbes Licht aktiviert die Halorhodopsin-Kanäle. Die Nervenzelle sendet nun keine Nervenimpulse mehr aus. 5 Nervenzelle für Nervenzelle lässt sich dadurch gezielt an- oder ausschalten. Die Forscher beobachten dabei das Verhalten der Mäuse und können so Neuronen identifizieren, die eine Rolle bei bestimmten Krankheiten spielen, beispielsweise Parkinson oder Epilepsie. Zukünftig könnten dadurch wirksamere und schonendere Therapien und Medikamente entwickelt bild der wissenschaft pluswerden. 13 Interview „Die menschliche Komponente ist wichtig für den Erfolg“ Welche Perspektiven Boehringer Ingelheim hat, erläutert Andreas Barner, der Sprecher der Unternehmensleitung. Das Gespräch führten Wolfgang Hess und Claudia Christine Wolf Was sind aktuelle Ansprüche an die Pharmaindustrie, Herr Barner? ist Vorsitzender der Unternehmensleitung von Boehringer Ingelheim. Barner (*1953) studierte Medizin an der Universität Freiburg und Mathematik an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich und schloss beide Studiengänge mit Promotion ab. Seine Karriere in der Pharmaindustrie begann bei der Ciba-Geigy AG in Basel. 1992 wechselte er zu Boehringer Ingelheim, wo er die Leitung des Bereichs Medizin übernahm. Seit 1999 ist er Mitglied der Unternehmensleitung und für die Bereiche Pharmaforschung, Entwicklung und Medizin zuständig. 2009 übernahm er darüber hinaus die Rolle des Sprechers der Unternehmensleitung. Barner ist Präsident des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft, Mitglied des Senats der Max-Planck-Gesellschaft und der Helmholtz-Gemeinschaft sowie Präsidiumsmitglied des Bundesverbandes der Deutschen Industrie und der Chemischen Industrie. Außerdem ist er Mitglied im Präsidium des Deutschen Evangelischen Kirchentags und seit Anfang 2015 Mitvorsitzender des High-Tech Forums, des innovationspolitischen Beratungsgremiums für die deutsche High-Tech Strategie 2020. 14 bild der wissenschaft plus Alle Fotos: T. Wegner Andreas Barner Ganz wichtig ist es, Medikamente zu finden, die sich an den medizinischen Notwendigkeiten orientieren. Beispiel Aids: Die pharmazeutische Industrie konnte die HIV-Problematik so entschärfen, dass diese zunächst meist rasch tödlich verlaufende Infektion inzwischen mehr zu einer häufig chronischen, wenn auch nach wie vor sehr ernsten Erkrankung umgewandelt werden konnte. Oder denken Sie daran, wie sich die Herz-KreislaufSterblichkeit dank der Cholesterinsenker verringert hat. Gegenwärtig erleben wir eine ähnliche Situation in der Onkologie, der Krebsforschung. Dort nähern wir uns in vielen kleinen Schritten den Herausforderungen. Beispielsweise wird mit unserem Wirkstoff Nintedanib die Blutversorgung von Krebsgeschwülsten unterdrückt. Gerade wurde Nintedanib auch als Wirkstoff gegen die idiopathische Lungenfibrose zugelassen. Hier haben wir bisher eine Sterblichkeitsrate von 50 Prozent innerhalb der ersten drei Jahre nach Diagnose-Stellung. Oder denken Sie an Diabetes und insbesondere an den SGLT2-Hemmer Empagliflozin, die erste antidiabetische Substanz, die sowohl die Gesamtsterblichkeit wie auch die kardiovaskuläre Sterblichkeit bei Patienten mit Diabetes und kardialen Vorerkrankungen senken konnte. An der idiopathischen Lungenfibrose leiden nur wenige Menschen. Der Pharmamarkt und die damit verbundene Einnahmequelle sind überschaubar. Warum wurde Ihr Unternehmen aktiv? Zwei Mitarbeiter machten uns darauf aufmerksam, dass Nintedanib in einem präklinischen Modell der Lungenfibrose gute Wirksamkeit zeigt. Es gehört zu unserer Verantwortung, Krankheiten zu lindern, auch wenn wir dabei nicht viel verdienen. Ein gutes Beispiel dafür ist auch die Substanz Nevirapine gegen HIV/Aids. Wir entschieden uns für die Weiterentwicklung – obwohl wir ursprünglich vermutet hatten, so wenig Umsatz zu machen, dass wir nicht einmal unsere Registrierungs-, geschweige denn Entwicklungskosten decken würden. Das hat sich letztlich dann doch anders entwickelt. Der Punkt zeigt, dass wir aus prinzipiellen Überlegungen auch Entscheidungen treffen, bei denen die wirtschaftlichen Interessen von sekundärer Bedeutung sind. Wie oft treffen Sie solche Entscheidungen im Jahr? Ob und wie wir ein Medikament aufgrund der Datenlage weiterentwickeln wollen, prüfen wir ständig. Ob wir in eine Indikation gehen, die sich kaum rechnen wird, darüber entscheiden wir vielleicht drei, vier Mal pro Jahr. Was fordert den Unternehmens-Chef Andreas Barner am stärksten? Das sind immer wieder Situationen, bei denen man spät in der Medikamentenentwicklung auf Schwierigkeiten stößt, die man nicht erwartet hatte – etwa bei der Stabilität eines Wirkstoffs. Für mich am wichtigsten zu lernen war es aber, dass man trotz vieler Daten immer wieder intuitiv entscheiden muss. Da denke ich beispielsweise an das Medikament Pradaxa zur Vermeidung von Schlaganfällen bei Patienten mit Vorhofflimmern. Wir haben uns für eine Studie an 16 000 Patienten entschieden – wohl wissend, dass das Risiko zu scheitern da war. Eine solche Entscheidung zu treffen, ist eine gewaltige Herausforderung. Bei Pradaxa gab es aufgrund unerwünschter Nebenwirkungen in den USA an die 4000 Klagen gegen Boehringer Ingelheim. Das Medikament hatte von Anfang an substanzielle Vorteile gegenüber herkömmlichen Vitamin-K-Antagonisten. Natürlich trifft es einen, wenn jemand ganz unabhängig von der wissenschaftlichen Datenlage über einen Schadensersatzprozess nach amerikanischem Recht versucht, finanzielle Vorteile zu erstreiten. Und natürlich haben wir uns mit den vorgebrachten Argumenten in dem Gerichtsverfahren auseinandergesetzt. Im bild der wissenschaft plus 15 Interview Ergebnis hat sich keines dieser Argumente als stichhaltig erwiesen, weshalb wir den Klagen in der Sache sehr zuversichtlich gegenüberstanden. Mittlerweile hat erfreulicherweise eine Studie der US-Gesundheitsbehörde FDA, an der 130 000 Patienten beteiligt waren, unsere Ergebnisse bestätigt: Die Zahl der Schlaganfälle und das Todesfallrisiko kann durch Pradaxa im Vergleich zu den herkömmlichen Wirkstoffen wirklich substanziell reduziert werden. Im Übrigen sind inzwischen praktisch alle Klagen durch einen umfassenden Vergleich vom Tisch. Die Alternative dazu wäre gewesen, jede einzelne der Klagen juristisch bis zum Ende durchzufechten. Das hätte unser Unternehmen auf Jahre hinaus stark beschäftigt. Was in der Pharmaforschung ist heute anders als vor zwei Jahrzehnten? Einmal sind die einfacheren Forschungsfragen gelöst. Zweitens ist insbesondere die Zahl der Patienten, die in das Registrierungsprogramm einzuschließen sind, substanziell gestiegen. Drittens konnte die pharmazeutische Industrie damals vier, fünf, sechs Medikamente einer Klasse erfolgreich auf den Markt bringen. Inzwischen sind die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung sowie der Preisdruck auf das Medikament so gestiegen, dass höchstens noch drei Medikamente einer Klasse wirtschaftlich erfolgreich sind. Welche Forschungsansätze sind es, durch die Sie sich neue Durchbrüche erhoffen? Bei Boehringer Ingelheim haben wir traditionell enge Kooperationen mit externer Forschung: Obwohl bei uns mehr als 8000 Menschen in Forschung und Entwicklung arbeiten – und dies sehr erfolgreich tun –, sind wir auf Ideen von außen angewiesen und wollen mit Externen, die gute Ideen und Ansätze haben, ins Gespräch kommen. Das war vor 20, 30 Jahren im aktuellen Umfang nicht der Fall. Wie finden Sie die externen Wissenschaftler, die Ihrem Unternehmen weiterhelfen können? Ganz wichtig ist das wissenschaftliche Interesse der Boehringer Ingelheim-Forscher, mit bestimmten externen Wissenschaftlern zusammenarbeiten zu wollen. Neben Themenfeld und Kompetenz ist auch die menschliche Komponente für den Erfolg einer solchen Zusammenarbeit sehr wichtig. Wenn wir eine Vereinbarung unterzeichnen, dann im Bewusstsein, die Kooperation längerfristig aufrechtzuerhalten. Überdies unterstützen wir gut 150 Doktoranden durch den Boehringer Ingelheim Fonds – eine Stiftung. Auch dadurch ergeben sich weltweit viele Anknüpfungspunkte für neue Zusammenarbeit. Und diese frisch gebackenen Doktoren stellen Sie dann bevorzugt ein? Nein, Boehringer Ingelheim unterstützt traditionell stark die Grundlagenforschung, und es ist wichtig, diesen guten Ruf in der akademischen Welt zu erhalten. Man weiß dort, auf Boehringer Ingelheim kann man sich verlassen! Wie erklären Sie es sich dann, dass es um das öffentliche Image der Pharmaindustrie nicht gut bestellt ist? Ich bin der festen Meinung, dass der Ruf der pharmazeutischen Industrie schlechter ist als sie es verdient. Ich bekomme so viele Briefe von Patientinnen und Patienten, die sich bei uns bedanken. Das ist ausgesprochen befriedigend und freut mich sehr. Dass wir mit unseren Wirkstoffen Geld verdienen möchten, liegt auf der Hand. Ich habe noch kein Pharmasystem gesehen, das besser funktioniert als privat finanzierte Initiativen und die damit verbundene Risikobereitschaft. Nur zur Erinnerung: Im gesamten ehemaligen Ostblock wurde kein einziges neues Medikament entwickelt. Was das Image angeht, muss man im Übrigen differenzieren. Für Deutschland trifft Ihre Aussage wohl zu – für England, die USA und viele weitere Länder aber nicht. Dort hat die Bevölkerung erkannt, welchen enormen Anteil moderne Medikamente und die dahinter stehende Industrie an der Gesundheit haben. In Deutschland erlauben wir uns den Luxus zu sagen: Ein Medikament, das mir hilft, ist gut, aber die pharmazeutische Industrie, die das herstellt, ist schlecht. Hierzulande möchte man die besten Arzneimittel zu den tiefsten Preisen in Europa. Aber anders als in den USA sind viele Politiker hier nicht bereit, die Pharmaforschung zu unterstützen. Wird die Pharmaindustrie also mittelfristig aus Deutschland abwandern? „Ich habe noch kein Pharmasystem gesehen, das besser funktioniert als privat finanzierte Initiativen.“ Andreas Barner im Gespräch mit bdwRedakteur Wolfgang Hess. 16 bild der wissenschaft plus Die Gefahr ist immer, dass die Industrie dort verschwindet, wo der Markt nicht mehr funktioniert. Doch das sind sehr langfristige Prozesse. Erfreulich ist, wie viele Biotech-Unternehmen es inzwischen in Deutschland gibt und dass einige sehr erfolgreich sind. Ich bin immer noch optimistisch, dass sich die Antihaltung vieler Deutscher zur Pharmaindustrie verändert. Welche Sichtweise haben Sie beim Thema Tierversuche? „Ganz wichtig ist es, mit externen Wissenschaftlern zusammenzuarbeiten“ Wir versuchen, mit möglichst wenigen Tieren auszukommen. Ich würde es aber nicht verantworten können, eine medikamentöse Krebsbehandlung oder ein Atemwegspräparat direkt am Menschen zu erproben. Gleichzeitig ergreifen wir viele Maßnahmen, um Versuchstiere möglichst artgerecht zu halten. Die Perspektive, auf Tierversuche völlig zu verzichten, sehen Sie nicht? Wir machen inzwischen viel auf der Basis von Zellen. Doch der lebende Gesamtorganismus ist durch nichts ersetzbar. Auch die behördlichen Auflagen zu Verträglichkeitsuntersuchungen erfordern die Untersuchung am Gesamtorganismus. Welchen Vorteil zieht Boehringer Ingelheim aus der Struktur eines Familienunternehmens? Die klare Zielsetzung, über Forschung erfolgreich zu sein, ist für mich ganz wesentlich – verbunden mit der Zielsetzung, aus eigener Kraft zu wachsen. Das haben wir in den vergangenen Jahren gut geschafft. Als ich 1992 bei Boehringer Ingelheim angefangen habe, entsprach unser Umsatz etwa zwei Dritteln vom Mitbewerber Schering und etwa der Hälfte von Bayer. Heute sind wir so groß wie Bayer und Schering zusammen. Dass wir das geschafft haben, liegt zu einem guten Teil auch daran, dass wir als Familienunternehmen konsequent an der Entwicklung des Unternehmens arbeiten können und in der Lage waren, für Patienten wichtige Medikamente bereitzustellen … … vorausgesetzt, die Familien wollen das Tafelsilber nicht verscherbeln. Da herrscht bei Boehringer natürlich ein ideales Umfeld. Die Eigentümerfamilien haben ein klares Interesse, das Unternehmen zu erhalten – und das schon in der vierten Generation. Und es ist ihnen wichtig, das Unternehmen – möglichst noch gestärkt – in die Hände der fünften Generation zu übergeben. Boehringer ist als Arbeitgeber sehr attraktiv. Ihre Begründung? Ich glaube, dass die Leute bei uns gerne arbeiten, weil ihre Tätigkeit eine unglaubliche Wirkung erzielt. In ganz wenigen Unternehmen können Sie so viel Positives für Menschen tun. Wie sieht die Pharmabranche in zehn Jahren aus? Wir alle hoffen, dass die individualisierte Medizin dann einen Schritt weitergekommen ist. In der Onkologie ist der Blick auf individuell ausgeprägte Tumore schon Gegenstand der Forschung. Was ich mir zudem erhoffe, dass wir auch bei Erkrankungen, bei denen wir bisher nur symptomatisch vorgehen können, wie etwa Bluthochdruck, kausale Therapie- ansätze entwickeln können, die es zum Beispiel ermöglichen, den Herzmuskel nach einem Infarkt zu regenerieren. In den zurückliegenden Jahren stieg unsere Lebenserwartung deutlich. Kennen Sie Untersuchungen, wie viel davon auf den erfolgreichen Einsatz von Pharmawirkstoffen zurückzuführen ist? Nach Schätzungen gewinnen wir derzeit pro Jahr zwei bis drei Monate an Lebenserwartung hinzu. Es gibt Experten, die sagen, dass die Hälfte bis zwei Drittel davon auf die Ergebnisse der pharmazeutischen Industrie zurückgehen. Mit anderen Worten: Wenn bei uns die Lebenserwartung seit 1950 grob gerechnet um 15 Jahre gestiegen ist, wäre die pharmazeutische Industrie daran mit siebeneinhalb Jahren oder sogar noch mehr beteiligt. Dennoch dürfte die Lebenserwartung künftig bei uns nicht mehr so zunehmen, wie in den vergangenen Jahren. Warten wir dies einmal ab! Ich baue darauf, dass Patienten künftig noch länger leben, weil sie gute Medikamente haben und gezielter auf Prävention geachtet wird. Weiterhin arbeitet die Forschung an Gewebs-Regenerationen mit dem Ziel, die Lebensqualität bei schwer erkrankten Patienten deutlich zu steigern. Dafür lohnt es sich zu auch, viel zu arbeiten. ● bild der wissenschaft plus 17 Immuntherapie Neue Wege A im Kampf gegen Krebs Neue immuntherapeutische Ansätze zählen derzeit zu den größten Hoffnungsträgern der Krebsmedizin. Das Pipettieren an der Sterilbank erfordert Geduld und Präzision. 18 bild der wissenschaft plus Foto: A. Körner/CureVac von Claudia Eberhard-Metzger ller Anfang ist schwer. Ein Jahr lang kochte Friedrich Miescher in der ehemaligen Küche des Tübinger Schlosses eitrige Wundverbände aus und experimentierte mit Laugen und Säuren, bis es ihm gelang, aus den Kernen der Eiterzellen ein weißliches Material zu isolieren. Er nannte es „Nuklein“ – nach seiner Herkunft, dem Zellkern, der im Fachjargon Nukleus heißt. Das war im Jahr 1869, und was der junge Mediziner damals unwissentlich entdeckt hatte, war die Nukleinsäure, der Stoff, aus dem die Gene sind. Nahezu 150 Jahre später arbeiten andere junge Wissenschaftler in den Laborräumen des biopharmazeutischen Unternehmens „CureVac“ im Technologiepark vor den Toren Tübingens an einer neuen Therapie gegen Krebs. Sie nutzen dazu das Lebensmolekül, das Friedrich Miescher einst in der Schlossküche fand – einem der weltweit ersten biochemischen Laboratorien. „Unser Ziel ist es, ein Medikament zu entwickeln, das dem Immunsystem dabei hilft, Krebszellen zu erkennen und zu zerstören“, erklärt Ingmar Hoerr, Biologe und Geschäftsführer von CureVac. Die Tübinger Forscher nutzen für ihre neuartige Therapie eine besondere Nukleinsäure, die Boten-Ribonukleinsäure, kurz mRNA (englisch: messenger RNA), ein Schwestermolekül des berühmten Erbmoleküls DNA. Sie dient der Zelle als Bote, der Abschriften der Gene zu den Ribosomen bringt, Proteinfertigungsstätten im Zellsaft. In den Ribosomen werden die lebenswichtigen Proteine nach den Konstruktionsplänen der Gene aus kleineren Bausteinen, den Aminosäuren, zusammengesetzt. Weil die Boten-Ribonukleinsäuren von der Zelle rasch abgebaut werden, nachdem sie ihre Dienste als Übermittler erfüllt haben, galten sie lange Zeit als wenig geeignet für therapeutische Anwendungen. Den Wissenschaftlern von CureVac ist es jedoch gelungen, die Lebenszeit der Boten-Moleküle zu verlängern und sie so zu präparieren, dass sie für eine zukunftsweisende, gegen Krebs gerichtete Behandlungsform eingesetzt werden können: die Immuntherapie. bild der wissenschaft plus 19 Foto: M. Storz/Graffiti „Immuntherapie“ meint den Versuch, die körpereigene Abwehr, das Immunsystem, so zu aktivieren, dass es Krebszellen anhand subtiler Zeichen erkennt, seine Zurückhaltung ihnen gegenüber aufgibt und sie ebenso kompromisslos angreift wie körperfremde Eindringlinge. Mit dem Immunsystem, glauben viele Forscher, kann dem Krebs der wohl einzige Gegner gegenübergestellt werden, der der komplexen Erkrankung an Plastizität und Flexibilität ebenbürtig ist. Anstrengungen, das Immunsystem in den Kampf gegen Krebs einzubeziehen, gibt es schon lange. Doch die Erfahrungen waren ernüchternd. Mittlerweile hat sich das Blatt gewendet: Immuntherapien gelten als die größten Hoffnungsträger der Krebsmedizin. Die Zeitschrift „Science“ feierte sie als „Breakthrough of the Year“ – als Durchbruch des Jahres –, und Nobelpreisträger wie Harald zur Hausen, vormals Chef des Deutschen Krebsforschungszentrums in Heidelberg, bewerten die Immuntherapie als „Ansatz, der uns in die Zukunft führt“. Auch Boehringer Ingelheim setzt auf die Immuntherapie gegen Krebs. Ein Beispiel für das Engagement der Pharmafirma auf dem Forschungsfeld ist die Kooperation mit dem Tübinger Unternehmen CureVac. Das Einzige, was das Immunsystem braucht, um aktiv zu werden, ist ein „Antigen“ – ein Molekül aus der Klasse der Proteine, das unmissverständlich anzeigt: Hier ist etwas im Körper, das ihm gefährlich werden kann. Die Eindeu- Unter UV-Licht wird menschliche Erbinformation sichtbar gemacht. 20 bild der wissenschaft plus tigkeit dieses Zeichens ist unerlässlich – genau daran aber lassen es Tumorzellen missen. Aufgrund ihres unkontrollierten Teilungsverhaltens sind sie für den Organismus eine lebensbedrohliche Gefahr – nichtsdestotrotz handelt es sich um körpereigene Zellen. Und das oberste Gebot, das Immunzellen zwingend einhalten müssen, lautet, Körpereigenes niemals anzugreifen. Eine Immunzelle, die sich nicht daran hält, wird gnadenlos aussortiert. Geschieht das nicht, kommt es zu schweren Erkrankungen, den sogenannten Autoimmunkrankheiten. Dennoch verraten sich Tumorzellen – allerdings mit subtilen Zeichen. Wie die Krebsforscher heute wissen, erfährt eine gesunde Zelle auf dem Weg zu einer sich krankhaft teilenden Krebszelle viele genetische Veränderungen (Mutationen). Infolgedessen produziert sie veränderte Proteine, die auf der Oberfläche der mutierten Zellen auftauchen. Die Wissenschaftler sprechen von Tumorantigenen oder Tumormarkern. Hunderte solcher verdächtigen molekularen Flaggen sind den Wissenschaftlern mittlerweile bekannt. Lungenkrebszellen etwa verraten sich häufig mit Tumorantigenen, die „MAGE“, „NY“, „ESO“, „5T4“ oder „Survivin“ heißen. Dem Lungenkrebs, einer der weltweit häufigsten Krebsarten, gilt die besondere Aufmerksamkeit der CureVac-Forscher. Gemeinsam mit Boehringer Ingelheim entwickeln die Tübinger Wissenschaftler in einem klinischen Entwicklungsprojekt seit dem Jahr 2014 ihren Lungenkrebswirkstoff „BI1361849“ zu einem therapeutischen Impfstoff, einer Vakzine, gegen das nicht-kleinzellige Lungenkarzinom weiter. „Mit diesem innovativen Ansatz wollen wir unser Portfolio im Bereich Lungenkrebs stärken, welches aus zwei zugelassenen Substanzen (Giotrif und Vargatef) besteht, die beide für bestimmte Patientengruppen in Studien lebensverlängernde Daten gezeigt haben. BI1361849 ist eine von mehreren neuen Substanzen in klinischer Forschung im Bereich Lungenkrebs von Boehringer Ingelheim“, erklärt Jörg Barth, der bei Boehringer Ingelheim den Bereich Onkologie leitet. Die Innovation der Wissenschaftler aus Tübingen ist, die von Natur aus kurzlebige Boten-Ribonukleinsäure haltbarer und so für therapeutische Anwendungen nutzbar zu machen. Dazu bestücken die CureVac-Forscher das Botenmolekül mit Informationen für Tumorantigene. „Auf der mRNA werden – ähnlich wie bei einer Software – bestimmte Informationen gespeichert“, veranschaulicht Ingmar Hoerr. „Der Körper – also die Hardware – liest diese Informationen ab, und das körpereigene Immunsystem reagiert darauf mit den ihm zur Verfügung stehenden Abwehrstrategien.“ Das mit dem Bauplan für Tumorantigene aufgerüstete Boten-Molekül wird den Patienten in die Haut injiziert und von Körperzellen aufgenommen. Die zelleigene Proteinfabrikation beginnt daraufhin, die Konstruktionspläne abzulesen und Tumorantigene herzustellen. Anschließend stellt die Zelle ihre Produkte auf ihrer Oberfläche, der Zellmembran, zur Schau und macht Zellen der körpereigenen Abwehr auf die Tumorantigene aufmerksam. Der Körper produziert den Impfstoff, auf den seine Abwehrtruppen reagieren sollen, also selbst. Gefährlich für Tumorzellen Fast alle Körperzellen sind imstande, Antigene zu präsentieren – die Profis aber sind die Antigen präsentierenden Zellen (APC) des Immunsystems. Dazu zählen die dendritischen Zellen, die Monozyten, Makrophagen und die B-Lymphozyten. Was die Profis gegenüber den Laien auszeichnet, sind ihre Beziehungen zu weiteren einflussreichen Immunzellen, den T-Lymphozyten. Zu ihnen zählen die T-Killerzellen – sie können Tumorzellen unmittelbar am gefährlichsten werden. Zudem sind nur die Antigen präsentierenden Zellen des Immunsystems in der Lage, T-Zellen zu weiteren Aktionen zu motivieren. Dazu wandern die Antigen präsentierenden Zellen in den nächstgelegenen Lymphknoten und zeigen den dort anwesenden T-Zellen ihr „Ausstellungsstück“. Sobald eine T-Zelle das präsentierte Antigen wahrgenommen hat, kommt es zu einem vielfältigen Signalaustausch. Infolgedessen wird die gesamte Streitmacht des Immunsystems alarmiert und rückt aus, um überall im Körper nach Zellen zu suchen, die das verräterische Antigen tragen und sie zu Bei CureVac arbeiten Wissenschaftler daran, die optimale mRNA für den gewünschten medizinischen Zweck zu erhalten. Die Arbeit am Mikroskop ist bis heute einer der Arbeitsschritte, die maßgeblich für den Erfolg der Forschung und Entwicklung sind. eliminieren. Soweit die Idealvorstellung dessen, was die mRNA-basierte Immuntherapie leisten soll. Ob das gelingt, muss die Zukunft zeigen. Zurzeit absolviert das neue Verfahren erste Prüfungen in der Klinik. „Bislang wissen wir, dass unser Impfstoff gut verträglich ist und dass wir mit seiner Hilfe bei den meisten Patienten eine ausgeglichene Immunantwort auslösen können, an der sowohl T-Killerzellen als auch T-Helfer- und Gedächtniszellen sowie B-Lymphoyzten beteiligt sind“, erklärt Ingmar Hoerr von CureVac. Die Zusammenarbeit mit CureVac wurde durch den „Boehringer Ingelheim Venture Fund“ gestartet und ist inzwischen ein fortgeschrittenes Entwicklungsprojekt, das in der Klinik angekommen und von Boehringer Ingelheim bislang mit 150 Millionen Euro unterstützt worden ist. Das ist ein typisches Beispiel für die Arbeit von Frank Kalkbrenner. Der Mediziner leitet den „Boehringer Ingelheim Venture Fund“, kurz BIVF. Gemeinsam mit seinen Mitarbeitern sucht er überall auf der Welt nach völlig neuen Forschungsansätzen, die es lohnt zu unterstützen, weil Foto: A. Körner/CureVac Immuntherapie sie versprechen, eines Tages therapeutisch nutzbar und zu neuen Medikamenten zu werden. Dazu geht das Pharmaunternehmen außerhalb seiner bereits bestehenden Therapiegebiete Kooperationen mit externen Forschergruppen ein. „Wir investieren mit diesen Kooperationen in die Zukunft“, sagt Frank Kalkbrenner. Aus 200 Projekten werden 3 Derzeit sind es 15 Projekte, die Boehringer Ingelheim gemeinsam mit externen Partnern verfolgt – sieben davon gelten dem Themenfeld Immuntherapie gegen Krebs. Dass selbst auf den ersten Blick noch so vielversprechende Forschungsansätze auf dem langen und hürdenreichen Weg zum Medikament scheitern, sei eher die Regel als die Ausnahme, betont Kalkbrenner. „Das ist unser Risiko – aber anders geht es nicht.“ Von rund 200 Projekten, die Kalkbrenner und sein Team alljährlich aus der wissenschaftlichen Welt der Publikationen, Meetings und Kongresse herausfiltern, kommen 50 bis 60 in die nähere Wahl, 20 von ihnen werden vertieft angegangen – drei Pro- jekte pro Jahr werden von Boehringer Ingelheim längerfristig finanziell gefördert. „Von insgesamt zehn Unternehmungen, die wir fördern, sollten ein bis zwei schlussendlich ein großer Erfolg werden“, erläutert Kalkbrenner. Die Übrigen – das zeige die Erfahrung – verliefen erfolglos im Sand. Von der Immuntherapie erwartet Kalkbrenner einen großen Erfolg: „Das ist ein sehr spannendes Feld in der onkologischen Forschung – da tut sich etwas!“ Ein großes Potenzial sieht er vor allem in der Kombination herkömmlicher mit neuen Behandlungsansätzen gegen Krebs. Immuntherapeutische Ansätze wie die Impfung mittels Boten-Ribonukleinsäure oder der Einsatz der zurzeit vielversprechenden „Checkpoint Inhibitoren“, die imstande sind, Bremsen des Immunsystems zu lösen, könnten zusammen mit bereits verfügbaren zielgerichtet ansetzenden Medikamenten und verbesserten konventionellen Verfahren Krebs womöglich schon bald von einer lebensbedrohlichen zu einer chronischen Erkrankung werden lassen. Die Patienten werden es den Forschern danken. ● _ Impressum Aufbruch zu neuen Horizonten Eine Sonderpublikation von bild der wissenschaft in Zusammenarbeit mit Boehringer Ingelheim ERSCHEINUNGSTERMIN: 12 . 2015 HERAUSGEBERIN: Katja Kohlhammer VERLAG: Konradin Medien GmbH Ernst-Mey-Straße 8, 70771 Leinfelden-Echterdingen CHEFREDAKTEUR: Wolfgang Hess PROJEKTLEITUNG: Claudia Christine Wolf REDAKTIONELLE MITARBEIT: Claudia Eberhard-Metzger, Stefanie Reinberger, Michael Simm GRAFISCHE GESTALTUNG: commbox8.de BILDREDAKTION: Susanne Söhling-Lohnert REDAKTION BOEHRINGER INGELHEIM: Dr. Reinhard Malin VERTRIEB: Kosta Poulios DRUCK: Konradin Druck GmbH Kohlhammerstr. 1–15, 70771 Leinfelden-Echterdingen Weitere Exemplare können Sie kostenlos anfordern bei: Leserservice bild der wissenschaft Tel. 01805-260155 [email protected] bild der wissenschaft plus 21 Porträt I Der Mann für Sicherheit Christopher Corsico ist verantwortlich für die Medikamentensicherheit bei Boehringer Ingelheim. Ein Job, dem er eine zentrale Bedeutung in der Pharmabranche zumisst – im Hinblick auf die Produktentwicklung, aber vor allem auf das Wohl jedes einzelnen Anwenders. Alle Fotos: T. Wegner von Stefanie Reinberger m Büro von Christopher Corsico steht eine Streichholzschachtel. Darin befindet sich ein ganz besonderes Krankenzimmer, ein Tierarzt behandelt einen Elefanten. Der US-Amerikaner sieht in Veterinär und Dickhäuter vor allem eins: Einen Mediziner, der sich mit aller Hingabe und Sorgfalt einem Kranken und dessen Genesung widmet. Genauso sah Corsico als junger Mann seine eigene Zukunft. Er studierte Medizin und praktizierte einige Jahre als Arzt. Doch bald stellte er fest, dass ihm das nicht reichte. „Ich wollte mehr Einfluss nehmen auf die Gesundheit der Menschen“, sagt Corsico. „Einzelnen Patienten zu helfen ist wichtig, aber meine Vision war, das Wohl und die Gesundheit vieler zu verbessern.“ Der Arzt ging zurück an die Uni und absolvierte einen Master-Studiengang in Epidemiologie chronischer Krankheiten. „Ich wollte die großen Zusammenhänge verstehen. Was braucht es, damit Menschen insgesamt gesünder und besser leben?“ Für Corsico lautet eine zentrale Antwort auf diese Frage: bessere Medikamente. Daher entschied er sich mit 34 Jahren, den Arztkittel gegen einen Job in der Pharmaindustrie einzutauschen. Seit 19 Jahren arbeitet er nun schon im Bereich der Arzneimittelsicherheit, 17 davon bei Boehringer Ingelheim. Heute ist der 52-Jährige weltweiter medizinischer Leiter und damit verantwortlich für klinische Entwicklung, Medizin und Zulassung. „Meine Arbeit wirkt sich auf so viele Menschen aus“, sagt er. „Das empfinde ich als ungeheuer befriedigend.“ Heute fühlt sich Corsico für beide Akteure seiner Streichholzschachtelszenerie verantwortlich: den Arzt und den Patienten. Ein Stück weit wurde dieser Weg wohl vorgezeichnet. Der Großvater war Pharmazeut mit eigener Apotheke. Später überwachte er im Auftrag des USBundesstaats New York die Abgabe von Substanzen, die unter das Betäubungsmittelgesetz fallen – auch das eine Aufgabe im Dienste der Arzneimittelsicherheit. Der Großvater war es auch, der in Corsico das Interesse für die Medizin weckte. „Ich erinnere mich, wie er einmal ein Stethoskop nach Hause brachte, mit dem ich mein eigenes Herz hören konnte. Das hat mich unglaublich fasziniert.“ Die Folgen von Contergan Arzneimittelsicherheit klingt nicht nach dem aufregendsten Aspekt der Pharmaforschung. Aber es ist möglicherweise der wichtigste: „Ich habe als Arzt den Hippokratischen Eid geleistet“, sagt Corsico. „Keinem Patienten Schaden zuzufügen, das ist für mich nach wie vor verbindlich.“ Das gelinge aber nur, wenn die Wirkungsweise einer Substanz rundum verstanden ist – mit all ihren Risiken, Nebenwirkungen und Gegenanzeigen. „Wir brauchen möglichst viel Wissen, um die richtige Balance zu finden zwischen Wirkung und möglichen Gefahren.“ Ein Fall, in dem die Waagschalen von Nutzen und Risiko in dramatischer Weise aus dem Gleichgewicht geraten sind, war Ende der 1950er-Jahre bis Anfang der 1960er-Jahre der Arzneimittelskandal um das Beruhigungsmittel Thalidomid, besser bekannt unter dem Markennamen Contergan. Das Medikament galt als besonders sicher. Es wurde als Schlaf- und Beruhigungsmittel für Schwangere empfohlen und sollte auch gegen die typische Morgenübelkeit helfen. Die Folgen waren dramatisch: Weltweit wurden aufgrund der Einnahme mehr als 10 000 Kinder mit massiven Fehlbildungen geboren. Rund 40 Prozent der Kinder verstarben im Säuglingsalter. Dazu kam eine ungeklärte Zahl von Totgeburten. „Das ist vielleicht das Schlimmste, was in der Geschichte der Pharmaindustrie passiert ist“, sagt Corsico. „So etwas darf sich niemals wiederholen.“ Doch er verrät auch, dass dieser Fall die Medikamentensicherheit revolutioniert habe. „Die Food and Drug Administration, also die Arzneimittelzulassungsbehörde in den USA, hat daraufhin scharfe Richtlinien für die Sicherheit vor der Zulassung von Medikamenten formuliert.“ Andere Behörden weltweit reagierten ebenfalls. In Deutschland etwa trat 1975 ein neues Arzneimittelgesetz in Kraft – mit einem Zulassungssystem, das strenge Anforderungen an den Nachweis von Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit von Arzneimitteln stellt. Außerdem gab der Contergan-Skandal den entscheidenden Anschub für das Fachgebiet der Pharmakovigilanz, die Arzneimittelsicherheit an erster Stelle: Christopher Corsico ist weltweiter Leiter des Bereichs klinische Entwicklung, Medizin und Zulassung bei Boehringer Ingelheim. 22 bild der wissenschaft plus bild der wissenschaft plus 23 Porträt Wissenschaft, die sich der Überwachung bereits zugelassener Medikamente widmet. Meldesysteme wurden eingeführt, bei denen Ärzte und Apotheker ebenso wie Patienten Bericht erstatten über unerwartete und unerwünschte Reaktionen auf Medikamente. Rund 5000 Meldungen über Nebenwirkungen gehen jeden Monat bei Boehringer Ingelheim ein. „Das sind extrem wertvolle Informationen für uns, denn dadurch lernen wir, unsere Produkte besser zu verstehen“, sagt Corsico. Zulassungsverfahren und die zugehörigen Tierversuche und klinischen Studien sind eben nur ein Teil der Geschichte. Der kniffligste Teil der Arzneimittelsicherheit beginne eigentlich erst danach, wenn das Produkt auf dem Markt sei und sich im „echten Leben“ bewähren muss, so Corsico. Der Grund: Selbst in ausgeklügelten klinischen Studien sind die Patientengruppen meist zu klein, um sehr seltene Nebenwirkungen zuverlässig zu erfassen. „Wenn eine bestimmte Reaktion nur bei einem von 10 000 Patienten auftritt, 24 bild der wissenschaft plus oder sogar noch seltener, ist nicht sehr wahrscheinlich, dass wir sie in den Studien bemerken“, erklärt Corsico. Sehr seltene Nebenwirkungen kommen daher oft erst ans Tageslicht, wenn Ärzte das Medikament verschreiben und die Zahl der Anwender steigt. Die Wissenschaft der Feinjustierung „Außerdem müssen die Probanden in den klinischen Studien strenge Kriterien erfüllen. Sie dürfen zum Beispiel kein Herzleiden haben, wenn wir im Rahmen eines Zulassungsverfahrens ein Diabetes-Medikament prüfen“, argumentiert Corsico weiter. Die klinischen Studien klopfen die Wirkung des Arzneimittels im Zusammenhang mit Diabetes ab – da müssen weitere Faktoren so weit wie möglich ausgeschlossen werden. Erkrankungen des Herzkreislaufsystems sind jedoch häufig bei Diabetikern, so dass sich Diabetes-Medikamente im realen Einsatz auch vor diesem medizinischen Hintergrund bewähren müssen. Pharmakovigilanz dient also der Feinjustierung der Waage, könnte man sagen. Es ist ein Prozess, bei dem zunehmend deutlich wird, für welche Anwendung und Patientengruppen ein Medikament geeignet ist – und für welche nicht. Das hilft, die Anwendung, aber auch die Gegenanzeigen, immer präziser zu definieren und so die Sicherheit zu erhöhen. „Wussten Sie, dass Thalidomid heute wieder auf dem Markt ist?“, sagt Corsico. Das einstige Skandal-Medikament dient heute der Behandlung von Menschen mit Lepra und mit Multiplen Myelomen, eine Krebserkrankung des Knochenmarks. Das ist für den Amerikaner ein Beispiel für erfolgreiche Pharmakovigilanz. „Thalidomid darf niemals wieder bei Schwangeren angewendet werden, aber bei einer streng definierten Patientengruppe überwiegt der Nutzen über mögliche Risiken, und diese Menschen profitieren von dem Wirkstoff.“ Arzneimittelsicherheit geht aber noch weiter: Da gilt es Beipackzettel zu formulieren, mit denen Ärzte und Patienten etwas anfangen können. Packungsgrößen müssen so gewählt werden, dass das trifft, nachhaltige Konsequenzen hat – für die pharmazeutischen Produkte, die sein Arbeitgeber entwickelt und vertreibt, aber auch für die Patienten, die das Medikament einnehmen. Dass die meisten Menschen nicht erkennen, wie viel Zeit, Geld und Arbeit in die Sicherheit von Medikamenten investiert wird, bedauert er. „Viele sehen nur, was Medikamente kosten und den Profit, den die Konzerne mit ihren Produkten natürlich machen wollen.“ Spaß am Rätselknacken Nein, ein Sicherheitsfreak sei er nicht, sagt Corsico. Er ist keiner, der dreimal nachschaut, ob der Herd wirklich aus ist, bevor er das Haus verlässt. Ihm geht es darum, Informationen zusammenzutragen und gegeneinander abzuwägen, um dann die bestmögliche Entscheidung zu treffen. „Aber das ist doch im Leben immer so“, findet er. „Wenn es etwa um die Familie geht, wenn man ein Haus kaufen will oder Freizeitaktivitäten plant. Da sammelt man doch auch alle möglichen Informationen, um dann das Beste auszuwählen.“ Und dann fällt ihm doch noch etwas ein, was man unbedingt mitbringen muss, um im Bereich der Medikamentensicherheit zu arbeiten. „Um diesen Job zu machen, muss man Spaß daran haben, Rätsel zu knacken“, sagt er. „Wir müssen tagtäglich Unmengen von Daten interpretieren und wie winzige Puzzlesteine zu Gesamtbildern zusammenfügen – wer das nicht mag, wird in diesem Arbeitsfeld nicht glücklich.“ Knobeln liebte Corsico schon als Kind, und auch heute noch verbringt er seine Feierabende gerne mit Kreuzworträtseln und Anagrammen. Davon abgesehen verlangt der 52-Jährige von seinen Mitarbeitern vor allem eines: „Jeder, der in der Pharmaindustrie arbeitet, muss sich seiner großen Verantwortung bewusst sein, denn alles, was wir machen, hat Konsequenzen für jeden einzelnen Anwender.“ ● David Keays _ geboren 1976 in Johannesburg und australischer Staatsbürger, ist Neurobiologe und Arbeitsgruppenleiter am Forschungsinstitut für Molekulare Pathologie (IMP) in Wien, an dem biomedizinische Grundlagenforschung betrieben wird. Hauptsponsor des IMP ist Boehringer Ingelheim. „Nach meiner Promotion an der Universität Oxford hatte ich einen ehrgeizigen Plan: zu verstehen, welche Zellen und Moleküle die Wahrnehmung des Erdmagnetfelds bei Tauben vermitteln. Daher nahm ich eine Stelle am IMP an, dem Boehringer Ingelheim Grundlagenforschungsinstitut. Das war eine der besten Entscheidungen, die ich je getroffen habe. Zusammen mit meinem Team untersuche ich, welche Rolle das Innenohr bei der Wahrnehmung des Erdmagnetfelds spielt. 2013 entdeckte mein Doktorand Mattias Lauwers eine eisenhaltige Struktur in den Sinneszellen des Innenohrs von Tauben. Wir wollen nun herausfinden, ob es sich dabei um den mysteriösen Magnetrezeptor handelt. In einem anderen Projekt, das gerade angelaufen ist, versuchen wir, einen künstlichen Magnetrezeptor zu entwickeln. Dabei verwenden wir Moleküle aus ganz unterschiedlichen Tierarten und entwickeln eine neue Methode für die Neurowissenschaften. Mit der Technik werden wir Nervenzellen mithilfe eines Magnetfelds gezielt und mit hoher zeitlicher Präzision aktivieren können. Es wird nicht einfach werden – aber unglaublich spannend! Es ist wahnsinnig aufregend, wenn wir etwas wirklich Neues entdecken. Das Gefühl, dass noch niemand das jemals zuvor gesehen oder verstanden hat, ist elektrisierend. Das ist ein ganz besonderer Augenblick.“ Foto: T. Klink „Wir brauchen möglichst viel Wissen, um die richtige Balance zu finden zwischen Wirkung und möglichen Gefahren“ NACHWUCHSFORSCHER IM PORTRÄT Risiko für gefährliche Überdosierungen und Medikamentenmissbrauch auf ein Minimum reduziert wird. Verpackungen müssen kindersicher sein und gleichzeitig der Zielgruppe die korrekte Einnahme so einfach wie möglich machen. „Stellen Sie sich vor, sie haben ein Arthrose-Medikament in einer kindersicheren Dose und der Patient kann diese dann nicht öffnen.“ Was muss man für Fähigkeiten mitbringen, um bei all diesen verschiedenen Aspekten den Überblick zu behalten und die richtigen Entscheidungen zu treffen? „Das mach ich ja nicht alles alleine, wir haben weltweit mehr als 300 Mitarbeiter, die sich mit diesen Fragen beschäftigen“, lacht Corsico. Der Mediziner klingt sehr bescheiden, wenn er das so sagt. Überhaupt tritt Corsico eher zurückhaltend auf. Er spricht ruhig und mit Bedacht, aber mit einer einnehmenden Präsenz. Und man hat den Eindruck, dass er nichts Unüberlegtes von sich gibt. Das mag damit zu tun haben, dass jede seiner Entscheidungen, die er tagtäglich Zulassung E Kraftakt für einen Lebensretter Zwischen der Entwicklung eines Arzneimittels und dessen Vermarktung steht die Zulassung. Die Geschichte des Antikörpers Idarucizumab illustriert die Herausforderungen des Verfahrens. Joanne van Ryn mit dem Präparat Pradaxa zur Vorbeugung von Schlaganfällen bei Patienten mit Vorhofflimmern und dem dazu entwickelten Gegenmittel Idarucizumab. 26 bild der wissenschaft plus Alle Fotos: T. Klink von Michael Simm s war eine Sternstunde für Boehringer Ingelheim: Hunderte von Mitarbeitern hatten daran gearbeitet, und nun, am 19. Oktober 2010, war sie da: die Zulassung für den Gerinnungshemmer Dabigatran (Handelsname: Pradaxa®), das erste Präparat zur Vorbeugung von Schlaganfällen bei Patienten mit Vorhofflimmern, mit dem die Wirkung der bisherigen Standards übertroffen werden konnte. Vorausgegangen waren jahrelange Forschung und Studien mit mehr als 18 000 Patienten. Wohl niemals zuvor hatte das 1885 gegründete Familienunternehmen solch einen Aufwand für ein einziges Produkt betrieben. „Das war ein Grund zum Feiern“, erinnert sich Joanne van Ryn, wissenschaftliche Expertin für Gerinnungshemmung und eine der Geburtshelferinnen von Idarucizumab. „Und nun wollten wir noch das Tüpfelchen auf dem i.“ Zusätzlich zu dem Gerinnungshemmer sollte neben den bestehenden Verfahren ein spezifisches Gegenmittel bereitstehen. Denn wer Präparate wie Dabigatran oder auch das ältere Marcumar einnimmt, erhöht damit das Risiko, eine Blutung zu erleiden. Diese Nebenwirkung ist mit allen Medikamenten aus dieser Klasse ebenso untrennbar verbunden wie die Vorder- und die Rückseite einer Medaille. Blutungen etwa im Gehirn oder auch im Magen können in sehr seltenen Fällen auch beim vorschriftsmäßigen Gebrauch eintreten. Auch wenn Patienten unter einem Blutgerinnungshemmer einen schweren Unfall haben, oder plötzlich operiert werden müssen, sind die Ärzte besonders gefordert. Zwar verliert Dabigatran nach dem Absetzen seine Wirkung sogar schneller, als dies bei den Vitamin-K-Antagonisten durch die Verabreichung von Vitamin-K möglich ist, dennoch hatten sich viele Ärzte ein maßgeschneidertes und noch schnelleres Gegenmittel gewünscht. Hans-Christoph Diener, Direktor der Klinik für Neurologie am Universitätsklinikum Essen und einer der weltweit führenden Experten zur Vorbeugung des Schlaganfalls, berichtet: „Bei jedem Vortrag über Dabigatran werde ich nach einem Gegenmittel gefragt.“ Kaum jemand schien besser vorbereitet, diesen Wunsch zu erfüllen, als Joanne van Ryn. Vor rund 20 Jahren war sie aus ihrer Heimat Kanada nach Biberach gezogen, wollte nach ihrer Doktorarbeit über Blutgerinnsel weiter auf diesem Gebiet forschen – und fand hier das ideale Umfeld. Gerade war man dabei, mit Hilfe der Gentechnik ein besonderes Medikament herzustellen, den gewebespezifischen Plasminogenaktivator Alteplase. Er kann Gerinnsel auflösen und hat als Actilyse® ungezählten Patienten mit Herzinfarkten, Schlaganfällen und Lungenembolien das Leben gerettet. Gleichzeitig wurden neue Wege zur Blutgerinnungshemmung erforscht. Zwei Jahre wollte die Biologin zunächst nur bleiben, doch dann traf sie nicht nur ihren heutigen Ehemann, sondern bekam auch noch ein Jobangebot, das sie nicht ablehnen konnte: Nun wollte man als nächstes eine ganz neue Art von Blutgerinnungshemmern entwickeln und man holte dafür van Ryn mit ins Boot. Bis heute hat die Wissenschaftlerin 78 Fachpublikationen vorzuweisen; die meisten davon auf diesem Gebiet. Seit dem Jahr 2006 ist sie mit dabei im „Product and Pipeline Scientific Support“ für Dabigatran, schrieb unter anderem den Pharmakologie-Teil für dessen Zulassungsanträge bei den beiden größten Behörden FDA und EMA. Parallel dazu – und noch vor der Zulassung von Dabigatran in den USA – begann van Ryn sich Gedanken zu machen, wie ein mögliches Gegenmittel aussehen könnte. Zusammen mit dem Chemiker, der Dabigatran synthetisiert hatte, und den Antikörper-Experten, beschloss sie schließlich, dieses Molekül direkt ins Visier zu nehmen – und zwar mit einem maßgeschneiderten Antikörper. Auf Erfahrungen zurückgreifen Die gesamte Infrastruktur für die anfänglichen Untersuchungen war am Standort Biberach bereits vorhanden. Ein „Riesenvorteil“ war es außerdem, auf die Dabigatran-Erfahrungen zurückgreifen zu können. Im ersten Schritt verabreichte man Dabigatran an Mäuse, und zwar in einer Form, die eine Immunreaktion auf das Mittel besonders stimuliert. Tatsächlich bildeten sich zahlreiche verschiedene Antikörper, unter denen man die aussichtsreichsten Kandidaten isolierte und bild der wissenschaft plus 27 Zulassung nach Ridgefield in den USA schickte. Dort „vermenschlichten“ eine Handvoll Spezialisten den Maus-Antikörper. Bei dieser Methode werden Teile des Antikörpers, die von der Maus stammen, durch Fragmente ersetzt, wie sie für menschliche Antikörper typisch sind. So kann man verhindern, dass die Antikörper später vom Immunsystem des Patienten als fremd erkannt und angegriffen werden. Schließlich haben van Ryns Kollegen auch noch gezielte Veränderungen an der Bindungsstelle ihres Antikörpers vorgenommen, und damit die Haftung an Dabigatran auf das 20-fache gesteigert. Der Name des neuen Moleküls: Idarucizumab. Die Biologin schwärmt von Bindungskonstanten, von schneller On- und langsamer Off-Rate. Dies bedeutet, dass der neue Antikörper sein Ziel sehr schnell erfasst und dann nicht mehr loslässt „wie ein Superkleber“. Ein wenig Glück sei auch Claudia Niestroj lagert Plasmaproben in einem Eisbad. Die Proben stammen aus Studien an Schweinen, die mit Pradaxa und Idarucizumab behandelt wurden. 28 bild der wissenschaft plus dabei gewesen, und so war es gelungen, diesen Entwicklungsschritt in rund einem Jahr zu bewältigen. Ein Kernteam von gerade einmal zehn Mitarbeitern hatte die Grundlage gelegt, und nun besaß man mit Idarucizumab einen maßgeschneiderten Wirkstoff, mit dem sich die blutverdünnende Wirkung von Dabigatran wieder aufheben ließ. Im Reagenzglas. Zwar würde ein Teil des Kernteams die weitere Entwicklung begleiten, jetzt aber waren andere Spezialisten gefragt: Sicherheits-Pharmakologen, Präklinische Pharmakokinetiker, Mediziner, Biotechnologen – und Experten für den Zulassungsprozess. Teil der Aufgabe war es, das neue Biomolekül in ausreichender Menge bereitzustellen. Reichten für die Forschungsphase noch kleine Fermenter von 800 Liter Volumen, galt es nun, bei konstant hoher Qualität wesentlich größere Mengen für die anstehenden klinischen Studien zu liefern. Schließlich musste dieser Prozess des „Upscaling“ auch sicherstellen, dass im Falle einer Zulassung der weltweite Bedarf an Idarucizumab ohne Lieferengpässe gestillt werden könnte. „Glücklicherweise verfügt Boehringer Ingelheim als einer der weltweit führenden Hersteller von Biopharmazeutika über langjährige Erfahrungen und große Entwicklerteams an mehreren Standorten, sodass wir auch diese Herausforderung bestanden haben“, so van Ryn. Eine weitere Herausforderung, die es zu bestehen galt, war der Umstand, dass Idarucizumab zu einer Klasse von Wirkstoffen gehört, mit denen selbst die Zulassungsbehörden bislang kaum Erfahrung hatten. Auf einer eigens einberufenen Konferenz trafen sich deshalb im April 2014 Fachleute des „Cardiac Safety Research Consortiums“ und Experten der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA. In einem „White Paper“, das die wichtigsten Ergebnisse zusammenfasst, bekräftigen sie die Wichtigkeit von Idarucizumab, weil es spezifisch die Blutverdünnung nach Dabigatrangabe normalisieren kann. „Spezifische Gegenmittel sind wichtig, weil die Blutgerinnungshemmung immer noch zu wenig genutzt wird, um Schlaganfälle bei Patienten mit Vorhofflimmern zu verhindern.“ Die Vorteile der neuen Produktion von Idarucizumab in Fermentern. Hermann Hutzel (vorn) arbeitet an der Prozessdokumentation, im Hintergrund bedienen Andreas Angele, Sarah Lotter und Franz Gerstenlauer das Steuerungssystem der Fermentationsanlage. Der obere Bildschirm zeigt den Prozessablauf, am unteren Bildschirm verfolgen die Mitarbeiter die einzelnen Arbeitsschritte und Anweisungen. oralen Antikoagulantien (NOACs), zu denen Dabigatran gehört, würden nicht ausreichend genutzt, solange es keine Gegenmittel gebe, so das White Paper. Um diese Gegenmittel zu testen, müssten jedoch besondere Regeln gelten. Abgesehen von dem 20 Jahre alten Präparat Digibind® gegen eine Überdosis mit dem Herzmittel Digitalis und ein paar Antiseren gegen Schlangengifte kennt die Medizin fast keine spezifischen Gegenmittel. Schließlich sind diese Arzneien für seltene Notfälle gedacht. Eine der üblichen großen Vergleichsstudien, bei denen die eine Gruppe das Antidot erhält und die andere nicht, wäre schon aus ethischen Gründen sehr problematisch. Wegen ihrer Bedeutung neige man dazu, die NOAC-Gegenmittel für den Gebrauch in lebensbedrohlichen Situationen zuzulassen, wenn diese Moleküle in präklinischen Untersuchungen gut charakterisiert würden, etwa auf Wirkstärke und Dauer, schreiben die Experten in ihrem White Paper. Und schließlich dürften sie in den ersten Tests beim Menschen keine schädlichen Nebenwirkungen zeigen. Zusätzlich wollte man die Auflage machen, dass nach der Zulassung die verfügbaren Informationen aus der Anwendung ständig ergänzt würden, bis es genug Daten gebe, um die Ergebnisse unter Praxisbedingungen zuverlässig zu bewerten. Die Untersuchung war eine enorme Herausforderung, auf die man jedoch vorbereitet war. „Bei allem, was wir hier erforschen, haben wir natürlich auch das Ziel einer späteren Zulassung im Blick“, erklärt van Ryn. Alle Daten werden dokumentiert, alle Erkenntnisse strukturiert und archiviert. Vorgeschrieben sind auch Tierversuche, um nicht nur die Wirksamkeit, sondern auch die Sicherheit neuer Präparate besser abschätzen zu können. Ein Beitrag bild der wissenschaft plus 29 zulassung 30 bild der wissenschaft plus Rund um die Uhr – und den Globus 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche standen darum „Aufpasser“ bereit. 300 Patienten wollte man in die Studie einschließen und spannte dazu ein Netz von mehr als 400 Zentren in 38 Ländern – von Neuseeland über Hongkong und Europa bis Kanada und den USA. Jeder teilnehmende Studienarzt, jedes Zentrum musste informiert und geschult werden, um die geeigneten Patienten zu erkennen, sie in die Studie einzuschließen und Idarucizumab zu verabreichen. „Es war eine fantastische Leistung“, lobt van Ryn ihren Kollegen Paul A. Reilly, der zusammen mit seinem Team die Studie koordiniert hat. Ein unverzichtbarer Bestandteil war es, dass die Ärzte sich dazu verpflichteten, in engen zeitlichen Abständen Blutproben abzunehmen: unmittelbar vor und nach der ersten Infusion, nach 10 bis 30 Minuten, sowie nach 1, 2, 4, 12 und 24 Stunden nach der zweiten Infusion. Nun konnte man anhand der Gerinnungsfaktoren im Blut und der Konzentrationen von Dabigatran und Idarucizumab die Wirkung des Gegenmittels exakt nachverfolgen. Stolz zeigt van Ryn die Grafiken für die ersten 90 Patienten, die die Veröffentlichung der Ergebnisse in der renommierten Fachzeitschrift „New England Journal of Medicine“ begleiteten. Sie dokumentieren den Erfolg unter realen Bedingungen: Innerhalb von Minuten konnte Idarucizumab die Wirkung von Dabigatran bei nahezu allen Patienten aufheben. Dies war das Ergebnis, auf das sie alle gehofft hatten. Noch dazu hatte man diesen Erfolg unter besonders schwierigen Bedingungen erzielt: 76,5 Jahre war das Durchschnittsalter der Studienteilnehmer, und viele unter ihnen hatten eine gestörte Nierenfunktion. Bei 36 Patienten, die wegen einer Notfalloperation behandelt wurden, verzeichneten die Ärzte in 33 Fällen eine ganz normale intraoperative Blutgerinnung, lediglich bei zwei Probanden war die Blutgerinnung leicht und bei einem mäßig gestört. Dies sei „ein extrem wichtiger Schritt“, lobte Schlaganfall-Experte Professor Hans-Christoph Diener. Er hofft, dass Idarucizumab bald schon in jeder Notfallaufnahme verfügbar sein wird. Die Chancen dafür stehen gut, denn gerade erst haben die Experten der EMA die Zulassung empfohlen. „Ist die Arbeit jetzt erledigt, Dr. van Ryn?“ Wohl kaum, schmunzelt die Forscherin. Auch nach der Zulassung werden weiter Daten gesammelt, um zu untersuchen, wie das Antidot in der Praxis eingesetzt wird. Diese Ergebnisse werden Ärzten bei ihren alltäglichen Therapieentscheidungen helfen, die Patienten optimal zu versorgen. ● Alessandra Bartolozzi, _ geboren 1973 in Prato, Italien, ist Chemikerin und Teamleiterin in der Medizinal-Chemie bei Boehringer-Ingelheim in Ridgefield, USA. „Es gibt viele Aspekte, die meinen Job einzigartig machen. Aber zwei Dinge ragen besonders heraus: die Patienten und die Herausforderung. Wir stehen in einer Art „Bündnis“ mit den Patienten – den Menschen, die an einer Krankheit leiden und deshalb auf den nächsten Durchbruch in der medizinischen Forschung warten. Jedes neue Experiment oder Projekt hat zum Ziel, den Menschen dort draußen zu helfen. Dem zweiten Aspekt – der Herausforderung – begegnen wir jeden Tag. Es gibt immer ungelöste Fragen und Probleme, die mit immensen technischen Herausforderungen verbunden sind. Wir arbeiten im festen Glauben daran, dass es für alles eine Lösung gibt. Doch die Arzneimittelentwicklung ist mühsam. Es gibt viele Misserfolge und nur gelegentliche Durchbrüche. Doch eben diese Durchbrüche sind es, die uns unserem Ziel näher bringen: einen Unterschied im Leben der Patienten zu machen. Gerade hat eine Serie neuer Projekte begonnen, in denen es um Autoimmunerkrankungen geht. Meine Arbeitsgruppe und ich werden an einigen dieser Projekte arbeiten. Momentan befinden wir uns noch in der „Entdeckungsphase“: Wir müssen herausfinden, wie wir die Zielstrukturen –sogenannte „targets“ – modulieren können, um den gewünschten pharmakologischen Effekt zu erzielen. Ich freue mich sehr auf die Herausforderungen, die vor mir liegen.“ NACHWUCHSFORSCHERIN IM PORTRÄT tran erhielten und wegen eines Notfalls eine schnelle Aufhebung der Wirkung des Blutverdünners benötigten. Es war eine enorme Herausforderung. Per Definition geschehen Notfälle unerwartet, auch mitten in der Nacht oder am Wochenende, man kann sie nicht einplanen, und sie sind sehr selten, erklärt van Ryn. Auch musste sichergestellt werden, dass die Patienten überhaupt Dabigatran eingenommen hatten. Foto: Boehringer Ingelheim Das Zulassungsverfahren für Idarucizumab startete Mitte 2014. Am 25. September 2015 haben die Experten der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) die Zulassung empfohlen. dazu waren Versuche mit Ratten, denen man eine hohe Dosis Dabigatran verabreicht hatte, und deren Blutung mit Idarucizumab schnell und sicher gestoppt werden konnte. Genauere und zuverlässigere Aussagen erhoffte man sich von einem Tiermodell, das dem Menschen sehr viel ähnlicher ist als die Ratte: das Schwein. Tatsächlich gelang es in Zusammenarbeit mit einer Forschergruppe an der RWTH Aachen, Blutungen bei Schweinen mit Idarucizumab binnen 15 Minuten zu stillen. Noch immer waren die Daten nicht ausreichend, um einen Zulassungsantrag zu stellen. Gleich drei Studien mit Freiwilligen sollten folgen. Zunächst wurde der Antikörper alleine verabreicht, um zu messen, wie schnell er abgebaut wird und ob er gut verträglich ist. Dann wurde den Freiwilligen zunächst Dabigatran und anschließend der Antikörper verabreicht, um zu prüfen, ob er auch beim Menschen die gerinnungshemmende Wirkung von Dabigatran aufheben kann. „Diese Studien haben bestätigt, dass Idarucizumab wirkt wie erwartet und dass es keine überraschenden Nebenwirkungen gibt“, so van Ryn. Inzwischen war Idarucizumab bereits geadelt mit dem sogenannten Breakthrough-Status bei der US-Behörde FDA. Dieser Status wird für besondere therapeutische Innovationen verliehen und ist eine Art Überholspur, mit der die oft jahrelangen Verfahren abgekürzt werden sollen für jene Arzneien, die auf ernsthafte und lebensbedrohliche Erkrankungen zielen. Voraussetzung ist aber, dass der Antragsteller zumindest vorläufige Belege erbringt, wonach das Arzneimittel eine erhebliche Verbesserung darstellt. Sind alle Voraussetzungen gegeben, so wird die Durchsicht der Dokumente beschleunigt, für Besprechungen mit der Behörde gibt es schneller Termine oder man setzt besonders erfahrene Prüfer ein, was die Marktzulassung ebenfalls beschleunigt. Parallel zum Zulassungsverfahren startete Mitte 2014 dann der alles entscheidende Praxistest, der die „erhebliche Verbesserung“ beweisen sollte. In RE-VERSE AD™ – so der Name dieser weltweiten Patientenstudie – wurde das Gegenmittel erstmals in der klinischen Praxis bei Patienten getestet, die Dabiga- bild der wissenschaft plus 31 Perspektiven I Im Zeichen des Wandels Mit Teamwork, Kreativität und Offenheit bereiten Boehringer-Forscher den Boden für Innovationen in einem schwierigen Markt. Ein internationales Team ist der Regelfall bei Boehringer Ingelheim. 32 bild der wissenschaft plus Foto: T. Wegner von Michael Simm st das der Mann, der für Boehringer Ingelheim in die Zukunft schaut? Michel Pairet lächelt bescheiden. Nur einer von vielen sei er hier, sagt der globale Leiter der nicht-klinischen Forschung und Entwicklung beim zweitgrößten deutschen Pharmakonzern. 1992 ist der Franzose zur Firma gekommen. In fließendem Deutsch erklärt er, wie die Branche damals funktioniert hat: „Wenn man eine wirksame Substanz hatte, brachte man sie auf den Markt.“ Es war also etwas einfacher als heute, denn für häufige Leiden gab es oft nur unzureichende Behandlungsmöglichkeiten. Gleichzeitig war dies auch eine Chance, denn man kannte bereits für viele Krankheiten den zugrunde liegenden Mechanismus. Was fehlte, waren „nur noch“ Wirkstoffe, die an diesen Stellen ansetzen würden. Natürlich war das auch schon früher leichter gesagt als getan – dennoch war das die Basis für die Entdeckungen neuer Moleküle und neuer Produkte. „Es gab noch nicht diesen Kampf um den Zugang zu den Märkten“, so Pairet. 30 Jahre später steht die Pharmaindustrie vor einer großen Herausforderung, diagnostiziert Professor Florian Gantner, Globaler Leiter der Translationalen Medizin & Klinischen Pharmakologie. „Zwar haben wir die Leiden unzähliger Patienten gelindert, und darauf können wir stolz sein. Damit haben wir aber zugleich die Messlatte für weitere Erfolge höher gelegt.“ Leider gibt es aber noch immer Patienten und Krankheiten ohne zufriedenstellende Behandlungsmöglichkeiten. Hier bestehe die Herausforderung darin, vollständig neue und klinisch relevante Mechanismen zu identifizieren, sagt Pairet. Die müssten dann mit Arzneien angegangen werden, deren Wirksamkeit und Sicherheit außer Frage steht. Dass man sich dabei an dem jeweiligen Goldstandard messen muss, und die Qualitätsansprüche somit immer weiter steigen, sieht Pairet positiv: „Dem stellen wir uns mit aller Leidenschaft.“ „Heute ist eine zusätzliche Hürde die Wirtschaftlichkeit“, sagt Gantner. Das bedeutet: Neben Neuheit, Wirksamkeit, Sicherheit und Qualität muss nachgewiesen werden, ob eine neue Arznei gegenüber der Konkurrenz einen Zusatznutzen bietet. Und darüber gibt es oft Streit. „Es werden teilweise Medikamente nicht mehr angemessen honoriert, deren Nutzen für die Gesellschaft und die Patienten wir für erwiesen halten“, beklagt Gantner. Das Problem der Kosten Der Vorreiter dieser Bewegung war eine britische Behörde, das National Institute for Health and Clinical Excellence, kurz NICE. Sie errechnet, wie viel ein gewonnenes Lebensjahr bei guter Lebensqualität kostet. Liegt der Preis unter 30 000 Pfund (etwa 42 000 Euro), wird das Medikament erstattet. Mehr Geld stellt der aus Steuern finanzierte britische Gesundheitsdienst nicht zur Verfügung. Schon mit einer der ersten Entscheidungen machte NICE sich unbeliebt, weil sie eine Reihe von Alzheimer-Arzneien als Geldverschwendung einstufte. Zwar musste NICE ihr Urteil später teilweise revidieren. Das Beispiel der Kostenrechnung aber machte weltweit Schule. Seit 2007 empfiehlt etwa in Deutschland das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) den gesetzlichen Krankenkassen, welche Medikamente erstattet werden sollten. Den Rest müssen die Versicherten entweder aus eigener Tasche bezahlen, oder schlimmer noch, die Medikamente kommen erst gar nicht in den Verkehr, weil die Hersteller befürchten müssen, damit ein Verlustgeschäft zu machen. Trotz dieser schwierigen Umstände erwirtschaftete Boehringer Ingelheim mit seinen rund 48 000 Mitarbeitern zuletzt einen Umsatz von 13,3 Milliarden Euro und liegt damit auf Platz 17 weltweit. Besonders stolz ist man auf Dabigatran, einen Blutgerinnungshemmer, der 50 Jahre nach der Einführung von Warfarin als erstes neues orales Antikoagulans weltweit zugelassen wurde. Mit dem ebenfalls als Tablette verabreichten Antidiabetikum Empaglifozin verfügt man über den einzigen Wirkstoff zur Senkung des Blutzuckerspiegels, der eine Reduktion des Herzkreislauf-Risikos in einer dafür ausgelegten Studie demonstrieren konnte. Neu auf den Markt kommen Afatinib zur Behandlung von fortgeschrittenem Lungenadenokarzinom, Nintedanib zur Behandlung der idiopathischen Lungenfibrose, und Olodaterol in einer neuen Kombinationstherapie mit Tiotropium gegen die chronisch-obstruktive Lungenerkrankung (COPD). Dass der Erfolg so bleibt, ist auch die Aufgabe Pairets. Der Forschungsleiter bewertet die neuen Trends, er schmiedet Kooperationen und trifft strategische Entscheidungen. Vor allem aber kultiviert er ein Klima der Kreativität und lockt kluge Köpfe nach Ingelheim und nach Biberach, Wien und Ridgefield, USA. Am Anfang steht die Strategie der Therapiegebiete. Wo besteht medizinischer Bedarf, den man mit der Entwicklung spezifischer Medikamente und Therapien befriedigen könnte? Auf einer „Krankheitskarte 2025“ stehen die Indikationen mit dem größten unbefriedigten Bedarf. Es sind gleichzeitig die lohnendsten Ziele: Klar spezifizierte Erkrankungen in den Therapiegebieten Atemwege, Herz-Kreislauf und Krebs, Stoffwechsel, Immunologie und Neurologie. Der zweite Filter fragt danach, ob es wissenschaftliche Ansätze gibt, diesen Bedarf zu adressieren. Gibt es beispielsweise genetische Veränderungen, bestimmte Proteine oder Bestandteile von Signalketten, die als Angriffspunkte dienen könnten? „Schließlich fragen wir uns, ob wir mit unseren Möglichkeiten auf diesem Gebiet im Wettbewerb bestehen können, ob wir also die entsprechenden Kapazitäten für Forschung und Entwicklung in einem bestimmten Bereich haben und das notwendige Know-how“, erklärt Pairet. Heute gelingt es den Chemikern bei Boehringer Ingelheim, kleine Moleküle mit beeindruckenden Eigenschaften zu synthetisieren, die die genannten Ziele ins Visier nehmen. Dazu kommen biologische Ansätze. Biotechnologisch hergestellte Proteine, die Gentherapie oder zellbasierte Behandlungen haben enorm an Bedeutung gewonnen. „Manchmal verfolgt man bei Boehringer auch zwei oder drei Ansätze parallel“, so Chefstratege Pairet. An die 100 Forschungsprojekte verfolgt der Konzern gleichzeitig und investierte dafür im letzten Berichtsjahr knapp 2,7 Milliarden Euro in Forschung, nichtklinische und klinische Entwicklung. Als Brückentechnik dient zunehmend die Bioinformatik. Sie hilft, die Daten aus den verschiedenen Bereichen des Unbild der wissenschaft plus 33 Perspektiven Foto: Boehringer Ingelheim den dabei beschritten, auf denen man im Bereich der Forschung schon lange dabei ist, die aber nicht zum aktuellen Portfolio gehören. Noch nicht. Das nötige Know-how holen sich die Forscher nicht nur auf traditionelle Art über die Fachliteratur und den Besuch von Kongressen. Boehringer Ingelheim leistet sich auch spezielle Pfadfinder, die „Innovation Seekers“. Sie sind unterwegs in den wissenschaftlichen Zentren der Welt und helfen, Kontakte anzubahnen. Mit Research Beyond Borders wagt Boehringer Ingelheim sich jenseits der Firmengrenzen. So ist längst ein breites Netzwerk entstanden, mit führenden universitären und außeruniversitären Forschungszentren, aber auch mit offenen Allianzen zur Entwicklung neuer Wirkstoffe unter Beteiligung anderer Pharma- oder Biotechunternehmen. Schließlich gibt es einen Strauß von Kooperationen mit derzeit 15 jungen und kreativen Start-Ups, die von dem firmeneigenen Venture Fund unterstützt wurden, der mit einem Kapital von 100 Millionen Euro ausgestattet ist. Die Förderung – darauf legt Pairet Wert – verzichtet auf unnötige Einschränkungen der Partner und ist viel mehr als nur eine Finanzspritze: „Transferiert wird nicht nur Geld, sondern auch die Expertise unserer Experten“, berichtet Pairet. „Im Gegenzug lernen wir eine Menge von der Kreativität und der Agilität dieser Wissenschafts-Unternehmer.“ ternehmens zugänglich zu machen und zu interpretieren. Und Daten gibt es jede Menge: Insbesondere die Bildgebung und die Sequenzierung des Erbguts von Patienten können schon mal die Hochgeschwindigkeitsleitungen überfordern, sodass man sich teilweise mit dem Versand von Festplatten behelfen muss. „Wir sitzen auf einem Berg von Daten, aus dem wir noch nicht genug Kapital schlagen“, sagt Gantner selbstkritisch. Mehr als 8000 Menschen waren im Jahr 2014 bei Boehringer in der Forschung und Entwicklung tätig. Natürlich kennt Pairet diese Zahl. Er weiß aber auch, dass Man-Power und Milliardeninvestitionen alleine nicht ausreichen, um im internationalen Wettbewerb zu bestehen. Pairets Beitrag zum Erfolg ist subtiler. „Kreativität und Innovation kommen von Laborwissenschaftlern, nicht vom Management. Alles dreht sich um Menschen, die voller Neugier, mit harter Arbeit und Experimentierfreude sich mit anderen Kreativen austauschen“, so Pairet. 34 bild der wissenschaft plus Bestseller wie das Atemwegspräparat Tiotropium (Handelsname: Spiriva®), der Blutgerinnungshemmer Dabigatran (Pradaxa®) und Linagliptin (Trajenta®) zur Behandlung von Diabetes finanzieren auch ein Programm, das Pairet besonders am Herzen liegt. Forschung ohne Grenzen „Research Beyond Borders“ heißt es, also Forschung ohne Grenzen. „Wir dürfen nicht zu Sklaven unseres eigenen Erfolges werden und uns mit den bisherigen Errungenschaften zufrieden geben“, erklärt Pairet. „Die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse müssen ja nicht unbedingt aus einem unserer angestammten Indikationsgebiete kommen. Daher müssen wir sehr wachsam sein und versuchen, jene Erkenntnisse zu identifizieren, die neue therapeutische Durchbrüche ermöglichen könnten.“ Um Biotech-Experten aus aller Welt anzulocken, bietet man Forschern die Möglichkeit, quer zu denken und neue Wege einzuschlagen. „Wir geben unseren kreativen Köpfen die Freiheit, ihre Ideen zu überprüfen und zu entwickeln. Das ist Teil der Firmenstrategie.“ „Die wahre Entdeckungsreise in der Arzneimittelentwicklung besteht nicht darin, neue Landschaften zu sehen, sondern darin, neue Augen zu haben“, zitiert Pairet den französischen Schriftsteller Marcel Proust frei. So gelang es auch den „Querdenkern“ am Rhein, die Kehrseite des Krebsmittels Nintedanib zu entdecken und erfolgreich gegen die idiopathische Lungenfibrose einzusetzen. „Viele unserer Wissenschaftler machen Vorschläge. Es sind mehr Ideen da, als wir verfolgen können“, sagt Pairet. „Es herrscht also ein Wettbewerb, und die Gewinner bekommen die Möglichkeiten, ihre Ideen zu verfolgen – in einem eigenen Labor und durch Kooperationen mit akademischen Zentren oder mit Wissenschaftlern bei Biotech-Firmen oder Start-Ups.“ Dabei geht man eine ganze Reihe kleiner Wetten ein. Auch Gebiete wie die Gentherapie und die Regenerative Medizin wer- Foto: T. Wegner Wenn Moleküle gesucht werden, die auf neu entwickelte therapeutische Angriffspunkte wirken, kann Boehringer Ingelheim auf eine riesige Bibliothek von Substanzen zurückgreifen. Auch das Crowd-Sourcing hat man für Boehringer Ingelheim entdeckt: Probleme werden dabei in regelrechten Ausschreibungen dargestellt, sei es in Fachzeitschriften oder auf einer Webseite. Die Kandidaten mit den besten Lösungsvorschlägen erhalten die Chance, die eigene Idee in einem gut ausgestatteten Labor zu prüfen und zu entwickeln. So vielfältig die verschiedenen Kooperationen auch sein mögen, es überwiegen doch die Gemeinsamkeiten bei der Suche nach neuen Wirkstoffen und bei deren Entwicklung. Schon bei der Zielvorgabe steht der Patient im Mittelpunkt. Im Labor geht es dann mit Zellkulturen und in Tierversuchen darum, ein Abbild der Krankheit dieses imaginären Patienten zu schaffen. Möglichst nah dran am Original soll es sein, dieses Krankheitsmodell, sodass die Ergebnisse auch übertragbar sind und nicht nur Wirkungen, sondern auch mögliche Nebenwirkungen abschätzbar werden. Biomarker sind ein Schlüssel Eine Schlüsselrolle spielen dabei die Biomarker – messbare Werte im Blut oder Gewebe, die biologische Prozesse widerspiegeln, und an denen sich die Wirksamkeit einer Substanz abschätzen lässt. Biomarker gibt es auch für die Sicherheit. Und in jüngster Zeit kommt ein weiterer Faktor hinzu: Biomarker, die erkennen helfen, welche Patienten am ehesten von einem Wirkstoff profitieren – und welche eher nicht. Hier könnte auch einer der Schlüssel zur Lösung der Kostenfrage liegen, sagt Gantner. Eine der jüngsten Entwicklungen, Afatinib (Giotrif®), wirkt gegen den metastasierenden nicht-kleinzelligen Lungenkrebs unterschiedlich gut, je nachdem, ob das Zielmolekül auf den Zellen der Patienten eine bestimmte Mutation aufweist oder nicht. Die Zulassung der Arznei ist deshalb auf genau jene Patienten beschränkt. In ähnlicher Weise werden Patienten künftig immer häufiger „stratifiziert“, glaubt Gantner. Ob Diabetes oder die Lungenerkrankung COPD: Viele Krankheitsbilder, die heute noch aufgrund ähnlicher Symptome zusammengefasst werden, könnten als eigenständige Leiden anhand genetischer und anderer Biomarker klassifiziert werden. Je mehr es gelingt, solche Subpopulationen von Patienten zu identifizieren, umso präziser würde die Behandlung, erwartet Gantner. Natürlich würden auch weniger Menschen Arzneien bekommen, von denen sie keinen Nutzen haben. Damit würde sein Unternehmen gleichzeitig die Versorgung verbessern und zur Kostensenkung im Gesundheitswesen beitragen. „Und das ist eine Bilanz, auf die wir alle stolz sein können“, so Gantner. ● Der Franzose Michel Pairet ist seit 1992 bei Boehringer Ingelheim. bild der wissenschaft plus 35 Meilensteine bei Boehringer Ingelheim 1885 Albert Boehringer erwirbt eine kleine 1986 Das Biotechnikum in Biberach nimmt 2015 Einführung von Glyxambi® auf dem Weinsteinfabrik in Ingelheim. Anfangs sind dort 28 Mitarbeiter beschäftigt, die Salze der Weinsäure für Apotheken und Färbereien herstellen. Die Nachfrage nach diesem Produkt steigt in den ersten Jahren rasant an. den Betrieb auf. Es ist nach einer Investition von rund 77 Millionen Euro die größte Produktionsanlage für Biopharmazeutika aus Zellkulturen in Europa. US-amerikanischen Markt zur Behandlung von Typ-2-Diabetes. Abasaglar®, eine Gemeinschaftsentwicklung von Boehringer Ingelheim und Eli Lilly & Co., ist das weltweit erste zugelassene Insulin Biosimilar, das den Wirkstoff Insulin glargin enthält. Einführung des Kombinationspräparats Synjardy® zur Behandlung von Typ-2-Diabetes. Einführung von Spiolto® Respimat® (in USA Stiolto™ Respimat™) zur langwirksamen Dauertherapie für Patienten mit COPD (chronisch-obstruktiver Lungenerkrankung). 1895 Die Firma meldet ihr erstes Patent 1987 Actilyse®, das erste bei Thomae/ für ein neues Verfahren zur Herstellung von Backpulver auf Milchsäurebasis an. Boehringer Ingelheim biotechnisch hergestellte Präparat zur Therapie des akuten Herzinfarkts, erhält die Zulassung. 1917 Gründung der Wissenschaftlichen 1995 Erstmals in der Geschichte des Abteilung auf Anregung des Chemikers und späteren Nobelpreisträgers für Chemie Prof. Dr. Heinrich Wieland (1877 – 1957), einem Vetter von Albert Boehringer. Unternehmens werden für Forschung und Entwicklung weltweit mehr als eine Milliarde Mark aufgewendet. 1920 Einführung des Herz-Kreislauf-Präparats Cadechol®, das am Anfang der Reihe erfolgreicher Herz-Kreislauf-Präparate von Boehringer Ingelheim steht. 1927 Heinrich Wieland erhält den Nobelpreis für Chemie für seine „Untersuchungen über die Zusammensetzung der Gallensäure und verwandter Verbindungen“. 1941 Einführung des Atemwegspräparats Aludrin®. Dieses erste Asthmamittel eröffnete später auch den Weg zu den sogenannten Betablockern. 1951 Einführung von Buscopan®, einem schmerz- und krampflösenden Mittel auf pflanzlicher Basis zur Behandlung von Magen- und Darmerkrankungen.Einführung des ersten Präparates aus der Thomae-Forschung: Finalgon®-Salbe zur perkutanen Wärme-ReizTherapie. 1975 Einführung von Atrovent® zur Be- 2002 Das COPD-Präparat Spiriva® wird eingeführt. 2010 Pradaxa® wird zur Vorbeugung von Schlaganfällen bei Patienten mit Vorhofflimmern zugelassen. 2011 Boehringer Ingelheim erhält die Zulassung für Trajenta® zur Behandlung von Erwachsenen mit Typ-2-Diabetes. Im weltweit agierenden Unternehmensverband Boehringer Ingelheim sind aktuell 47 700 Menschen beschäftigt (Umsatz 2014: 13,317 Milliarden Euro). Allein 8100 Mitarbeiter arbeiten in Forschung und Entwicklung, für die das Unternehmen 2,7 Milliarden Euro jährlich bereitstellt. ®Registered Trademark: englischer Fachbegriff für registrierte Warenmarke 2013 Zulassung von Giotrif® für die Behandlung einer bestimmten Form des Lungenkarzinoms und Pradaxa® für die Behandlung und Vorbeugung von tiefer Venenthrombose und massiver Lungenembolie. Marktzulassung des COPD-Produkts Striverdi®. 2014 Zulassung von Ofev® zur Behandlung von idiopathischer pulmonaler Fibrose, Jardiance® bei Typ-2-Diabetes, Spiriva® Respimat® bei Bronchialasthma und Vargatef®zur Behandlung einer bestimmten Form von fortgeschrittenem Lungenkrebs. handlung von COPD (chronisch-obstruktive Atemwegserkrankung). 1985 Das Institut für Molekulare Pathologie (IMP) in Wien wird gegründet. 36 bild der wissenschaft plus Foto: Boehringer Ingelheim Eines der drei großen Forschungszentren von Boehringer Ingelheim befindet sich im oberschwäbischen Biberach an der Riß.