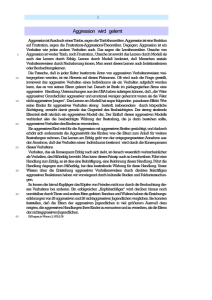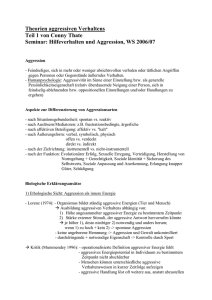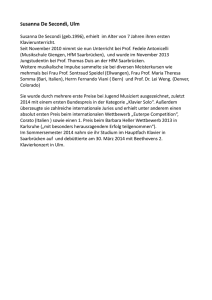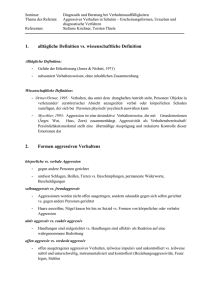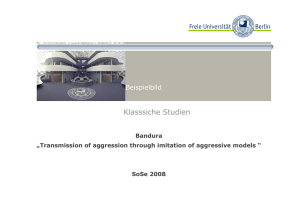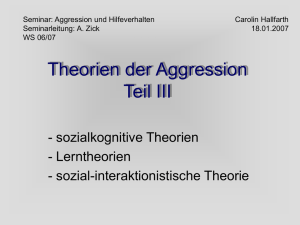ZF Sozialpsychologie I 03407
Werbung

Sozialpsychologie I 03407 1 Einführung Definition: Die Sozialpsychologie ist eine grundlagenwissenschaftliche Teildisziplin der empirischen Psychologie. Sie untersucht das Erleben und Verhalten von Menschen in sozialen Situationen, d.h. Situationen, in denen Kognitionen, Emotionen, Motive und Handlungen einer Person durch die tatsächliche, vermutete (oder mitunter lediglich vorgestellte) Anwesenheit anderer Menschen beeinflusst werden (Allport, 1954). Hauptziel: Ein Hauptziel sozialpsychologischer Forschung besteht darin, empirisch überprüfbare Theorien und Modelle zu entwickeln, um zu beschreiben, zu prognostizieren und zu erklären, wie Menschen sich in sozialen Situationen verhalten – wie sie einander wahrnehmen, wie sie Einfluss aufeinander ausüben und wie sie ihre Beziehungen zueinander gestalten. Entwicklung der Sozialpsychologie bis in die 1960er Jahre in den USA Ab Mitte der 1979er Jahre in Deutschland Übungsaufgabe 1) Erläutern Sie zwei grundlegende Prämissen sozialpsychologischer Forschung! Eine Prämisse ist, dass der Mensch seine soziale Umwelt aktiv konstruiert. Er nimmt seine soziale Umwelt nicht „objektiv“ wahr, sondern es ist seine höchst persönliche Wahnnehmung der sozialen Realität und dem entsprechend reagiert er auf die von ihm selbst subjektiv wahrgenomme Situation. Die Zweite beruht auf die Annahme von K. Levin (1951): menschliches Verhalten (V)ist eine Funktion von Personenfaktoren (P) und Umweltfaktoren (U) V= f(P,U) Definition: eine Interaktion zwischen zwei Einflussfaktoren liegt vor, wenn die Stärke des Effekts, den ein bestimmter Faktor (z.B. ein Situationsmerkmal) auf eine Variable (z.B. ein bestimmtes Verhalten) ausübt, systematisch mit der Ausprägung eines anderen Faktors (z.B. einem Personenmerkmal) variiert. Übungsaufgabe 2) Was versteht man unter der Interaktion zweier Faktoren (oder Variablen)? Beispiel: Vorstellungsgespräch = Stress (Situation) → Person hat wenig Selbstvertrauen (Personenmerkmal) → Fingernägel kauen (Verhalten) Es heißt, dass das Verhalten „Fingernägel kauen“ systematisch mit Stresssituation auftritt und umso stressiger es wird (Belastung durch Situation) um so eher oder heftiger wird dies getan. Forschungsbereiche: 1) Intra- und Interpersonale Prozesse 2) Intra- und Intergruppale Prozesse Intrapersonal: Einstellung deren Beeinflussung des Verhaltens Interpersonal: soziale Beziehung und deren Entwicklung Intragruppal: Kooperation und Leistung von Gruppen Intergruppal: Erforschung von Vorurteilen und Diskriminierung Interdisziplinäre Verbindung: Makroeben soziastruktrellen, ökonomische Wirtschaftswissenschaften) oder politische Prozesse (Politikwissenschaften, Mesobene soziale Prozesse, Interaktion zwischen Individuen, innerhalb von Gruppen und zwischen Gruppen ( Sozialpsychologie, Soziologie, Kommunikationswissenschaften, Ethnologie) Mikroebene psychologische oder biologische Kognitionspsychologie, Neurowissenschaften) Ebene (Allgemeine-, Persönlichkeits-, Die sozialpsychologische Analyse stellt eine wichtige Verbindung zwischen Analysen auf der Mikro- und der Makroebene her. Susanna Lopez Seite 1 29.02.2012 Methoden der Sozialpsychologie: Zahlreiche Phänomene sind nicht direkt mess- oder beobachtbar (z.B. Einstellungen). Ihre Existenz und Ausprägung kann nur über Indikatoren erschlossen werden. Mann bezeichnet diese als hypothetische Konstrukte. Definition: Hypothetische Konstrukte sind abstrakte theoretische Begriffe, die sich nicht direkt beobachten lassen, sondern nur mit Hilfe von Indikatoren beobachtet oder erschlossen werden können. Eine Variable bezieht sich auf die messbaren Indikatoren eines hypothetischen Konstruktes. Definition: unter Operationalisierung wird die Art und Weise verstanden, wie ein hypothetisches Konstrukt in eine beobachtbare Variable überführt wird. Sie hat Auswirkungen auf die Validität (Gültigkeit) der wissenschaftlichen Schlussfolgerungen. Definition: der Begriff Konstruktvalidität bezieht sich darauf, inwieweit eine beobachtete Variable das zugrunde liegende theoretische Konstrukt angemessen repräsentiert. Die Hypothesen einer Theorie spezifizieren die Beziehung zwischen den hypothe-tischen Konstrukten. Gütekriterien wissentschaftlicher Theorien: Innere Widerspruchsfreiheit – man sollte nicht eine Aussage und deren Gegenteil (Verneinung) aus einer Theorie ableiten können. Äußere Widerspruchsfreiheit – eine Theorie sollte nicht im Widerspruch zu als gesichert geltenden Theorien stehen, ohne genau zu spezifizieren, wo bisherige Annahmen zu korrigieren sind. Eine Theorie ist umso besser je präziser ihre Vorhersagen und Erklärungsleistungen sind. Eine Theorie ist umso besser je mehr Phänomene sie erklären und vorhersagen kann. Eine Theorie ist umso besser je sparsamer ihre Annahmen sind. Forschungsmethoden: Labor: Vorteil ist die Kontrollierbarkeit und Standardisierung von Einflussgrößen und Rahmenbedingungen. Nachteil: Generalisierbarkeit auf Populationen außerhalb des Labors. Durch ungewöhnliche Settings im Labor können Artekfakte auftreten. Dieser Kritikpunkt beruht auf eine falsche Prämisse. Entscheidet ist nicht das im Labor das reale Leben nachgestellt wird, sondern es kommt vielmehr auf den psychologischen Realismus an. D.h. Susanna Lopez Seite 2 29.02.2012 das die angestoßenen psychologischen Prozesse denjenigen unter entsprechenden Bedingungen im „reale Leben“ weitgehend ähneln. Feldforschung: wenig Kontrolle und Standardisierung, dafür mehr natürliche Umgebung für die Probanden, dadurch auch eher Generalisierbarkeit der Ergebnisse. Ist das Ziel der Forschung die Beschreibung sozialer Phänomene so ist die Methode hier die Beobachtung (systematische Beobachtung und Protokollierung) Geht es Primär um die Vorhersage so verwenden Forscher häufig die Korrelationsmethode (zwei oder mehrere Variablen werden gemessen und die Beziehung zwischen ihnen ermittelt). Ist das Ziel die Erklärung von sozialen Phänomen so werden experimentelle Methoden gewählt (kausale Beziehungen können mit größerer Sicherheit überprüft werden. Das sozialpsychologische Experiment: Schlüsselmerkmale sind Manipulation und Kontrolle 1) es wird die Ausprägung einer Variablen (unabhängigen Variable = UV) manipuliert/ variiert von der angenommen wird sie ist die Ursache einer anderen Variablen 2) es wird die resultierende Veränderung der anderen Variablen beobachtet (abhängige Variable = AV) 3) Kontrollgruppen dienen zur Überprüfung der Ergebnisse Randomisierung: zufällige Zuteilung der Personen in die verschiedenen Versuchsgruppen ein Experiment ein echtes Experiment! nur dann ist Gütekriterien von Experimenten: Interne Validität hängt von der Sicherheit, mit der man aus den Ergebnissen des Experiments auf UrsacheWirkungsbeziehungen schließen kann. Die interne Validität eines Experiments ist hoch, wenn die beobachtete Veränderung der AV mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die experimentelle Manipulation der UV zurückzuführen ist. Die externe Validität bezieht sich darauf, inwieweit die Befunde auf andere Situationen oder Populationen übertragbar (generalisierbar) sind. Ein wichtiges Kriterium zur Beurteilung der externen Validität eines Experiments ist die Replizierbarkeit bei unabhängigen Wiederholungen mit Vpn aus anderen Populationen, in unterschiedlichen Kontexten oder unter Verwendung unterschiedlicher Varianten der Manipulation. Susanna Lopez Seite 3 29.02.2012 Ethische Aspekte: Demand characteristics: die interne Validität kann dadurch bedroht werden, das Hinweisreize in der Untersuchungssituation dazu führen das die Vpn Überlegungen zum Experiment anstellt und sich entsprechen Verhält (um den Forscher zu „gefallen“, soziale Erwünschtheit). Soziale Erwünschtheit (das Bemühen in einem „guten Licht“ dazustehen) stört besonders bei der Untersuchung von negativen Verhaltensweisen wie Aggression. Cover Story: um derartige Prozesse zu reduzieren wird die Vpn durch zurück halten von Informationen oder absichtliche Irreführung getäuscht. Vorsätzliche Täuschung der Vpn kann aus wissenschaftlicher Sicht gerechtfertigt sein – ist aber aus ethische Sicht nichtsdestotrotz problematisch! In Hinblick auf die Täuschung von Vpn schreiben die Ethikrichtlinien eine vollständige postexperimentelle Aufklärung vor: Postexperimentelle Aufklärung: Die Vpn werden nach dem Experiment vollständig über die Täuschung und das eigentliche Ziel der Untersuchung aufgeklärt; die wissenschaftliche Notwendigkeit der Täuschung wird begründet. Im Idealfall vermittelt diese Aufklärung den Vpn ein Verständnis für die Relevanz der Forschungsergebnisse und den Beitrag, den sie dazu geleistet haben. 2) Geschichte der Sozialpsychologie o o o Frühste Begriffsverwendung von „psicololgia social“ 1863/1864 bei Carlo Cattaneo (1801-1869) Im deutschsprachigem Raum war es vermutlich G.A. Lindner (1828-1887) der 1871 den Begriff „Sozialpsychologie“ verwendete Lindner, Schäffle, Herbart und Spencer vertraten einen organizistischen Gesellschaftsbegriff Organizistische Gesellschaft nach Spencer: Völkerpsychologie (Vorläufer der Sozialpsychologie) o Geht auf Wilhelm von Humboldt zurück (1767-1835), hat aber wohl nicht geprägt Denken wird durch die Sprache bestimmt. Verschiedene Völker würden durch verschiednen Sprachen verschiedene Weltansichten haben Whorf-Sapir-Hypothese o Völker-und Kulturvergleichende Wissenschaft ist M. Lazarus (1824-1903), H. Steintnal (1823-1899) zu verdanken o Wilhelm Wundt (1832-1929) sah die Völkerpsychologie nur als Beobachtende, beschreibende und vergleichende Wissenschaft (Sprache, Religion, Mythos, Recht, Kultur und Geschichte) Susanna Lopez Seite 4 29.02.2012 Massenpsychologie (Vorläufer der Sozialpsychologie) o Ursprung liegt in Italien: Scipio Sighele (1868-1913), Kriminologe stellte die Frage nach der Zurechnungsfähigkeit des Individuums in der „entgleisten“ Menge o Ebenso ind Frankreich ging es G. Tarde (1843-1949) um juristische, kriminologische Fragen o G. LeBon (1841-1931) stellte dem kritischen und vernünftigem Denken des Einzelnen die Masse gegenüber o Alle Ausführungen zur Massenpsychologie hatten wenig Wirkung auf die Entwicklung der empirischen Sozialpsychologie Frühe empirische Sozialpsychologie o Sie geht auf amerikanische und französische Psychologen zurück, die die Bedeutung der sozial Umgebung für das Individuum beschrieben und der empirischen Forschung zugänglich machten o C.H. Cooley (1864-1929) führte den Begriff der Primärgruppen ein o N.D. Triplett (1861-1900) veröffentlichte 1898 das Experiment zum Schrittmacherphänomen (Einfluss von der Anwesendheit anderen auf die Leistung des Individuums) o W. Moede (1888-1958, Wundtschüler) untersuchte Kinder um den Einfluss der Anwesenheit anderer auf die Leistung festzustellen o F.H. Allport gelang theoretische Durchdringung solcher Gruppenwirkung unter dem Eindruck des Behaviorismus versuchte er größere Kontrolle der Störvariablen zu erreichen Erste Untersuchungen von Gruppenprozessen o In den dreißiger Jahre war die Kleingruppenforschung Kerngebiet der Sozialpsycholgie o J. Moreno (1898-1974) Technik der soziometrischen Befragung o M. Sherif (1906-1988), die Entstehung gesellschaftlicher Normen o K. Levin (1890-1947), Einfluss autokratischer und demokratischer Führung Gruppenatmosphäre in Jugendgruppen, Gruppendynamik o W.F. Whyte (1914-2000), teilnehmende Beobachtung in Jugendbanden auf die Anfänge der Einstellungsforschung o Weiteres Kerngebiet war die Einstellungs- oder Attitüdenforschung o L.L. Thurstone (1887-1955), Fragenbögen und standardisierte Einstellungsskalen o A. Adorno, 1950: autokratische Persönlichkeiten; ebenso Horkheimer, 1936 aus diesen Studien ging de „F“-Skala (F von fascism) hervor o H. Hyman prägte 1942 den Begriff der Bezugsgruppe Sozialpsychologie in der ersten Jahren nach dem 2. Weltkrieg o In den 50ziger neue Phasen der Kleingruppenforschung o R.F. Bales (geb. 1919), Interaktionsprozesse o S.E. Asch (1907-1996), Einfluss einer Majorität auf das Urteil eines Einzelnen o S. Schachter (1922-1997), Kontaktbedürfnis in bedrohlichen Situationen o Kogan & Wallach, Risikobereitschaft von Gruppen vs Einzelnen o Bevelas & Leavitt, Kommunikationsstruktur und Gruppenleistung o M. Sherif und Mitarbeiter, Konfliktsituation zw. Gruppen und Re-Integrationsmaßnahmen o L. Festinger, 1957 kognitive Dissonanztheorie → Vorhersagen von Einstellungsänderungen Sozialpsychologie in Westdeutschland o Erstes und einigstes Sozialpsychologisches Institut in Deutschland zwischen den Weltkriegen gründete W. Hellpach 1921 in Karlsruhe o Bezeichnend für die Nachkriegszeit war, dass die angewandten sozialpsychologischen Arbeiten von Levin eher übersetzt wurden als die grundlegenderen, theoretischen Ansätze und Bücher o Kultur des gemeinsamen Schweigens über die „dunkle“ Nazi-Zeit Willy Hellpach (1877-1955): Sozialpsychologie in historischen Bezügen o Wundtschüler o Gesellschaft als Sozialorganismus Susanna Lopez Seite 5 29.02.2012 o o o Einfluss des Klimas auf menschliches Handeln Er bezog keine Klassiker mit ein wie Moreno, Levin, Sherif, Bales – dadurch auch keine moderne Sozialpsychologie in den Hörsälen 1962 erstes Institut für Sozialpsychologie in Köln durch Hans Anger (1920-1998) Kriphal S. Sodhi: Rezeption der amerikanischen Sozialpsychologie gegen den Strom der Zeit o Gebürtiger Inder, kam 1937 nach Berlin um bei W. Köhler Gestaltpsychologie zu studieren o Forschungsbereich: Konformitätsforschung, soziale Wahrnehmung und der Stereotypenforschung o Hatte einen schwierigen Stand die moderne Sozialpsychologie in Deutschland zu etablieren Peter R. Hofstätter (1913-1994): Popularisierung sozialpsychologischer Themen o Gruppendynamik o Er war Heerespsychologe mit rechtkonservativer Tendenz Martin Irle und der Sonderforschungsbereich 24 o 1964 Professur in Mannheim o SFB 24 „Sozialwissenschaftliche Entscheidungsforschung“ o Durch SFB wurde wissenschaftliche Forschung und Qualifikation verbessert o Erweiterung der Dissonanztheorie Sozialpsychologie in der DDR o 1954 sozialpsychologischen Schwerpunkt durch K. Gottschaldt (1902-191), Gestaltpsychologe o Ost-Berlin: Wir-Gruppen-Konzept und Führungsstile nach Levin o H. Hiebsch (1922-1990), Leipzig, Arbeiten im pädagogisch-psychologischen Kontext o In der Vergangenheit des Ostblock war Ideologisch nur die Reflexologie von Pawlow akzeptiert, die Ablösung von diesem psychologisch-mechanistischen Denken war ein langwieriger Prozess Eine Europäische Entwicklung: Die EASP o European Association of Experimental Social Psychology (EAESP) o Heute: European Association of Social Psychology EASP, 1966 o Verdienst: Aufrechterhaltung und Herstellung von Arbeitsbeziehungen zwischen west- und osteuropäischen, sowie zwischen west- und ostdeutschen Sozialpsychologen o Gründung einer europäischen Gesellschaft wurde maßgeblich durch das Social Science Research Council (S.S.R.C.) gefördert o Bis heute hat sich de EASP vom amerikanischen Vorbild verselbstständigt o 3) Soziale Kognition und Attribution Wie andere Studien zeigen, neigen Menschen auch dazu, eigene unerwünschte Emotionen oder Wünsche auf andere Personen zu projizieren Umfassend empirisch dokumentiert ist auch der Einfluss von sozialen Stereotypen auf die Wahrnehmung von Personen oder sozialen Ereignissen Stereotyp: Sozial geteilte Überzeugung bezüglich der Attribute, Eigenschaften, Verhaltensweisen etc. hinsichtlich derer die Mitglieder einer Gruppe einander ähneln Definition Soziale Kognition: Der Prozess des Erwerbs, der Organisation und Anwendung von Wissen über sich selbst und die soziale Welt. Konkret beinhaltet dieser Prozess a) mentale Repräsentationen über sich selbst, über andere und über soziale Beziehungen zu erstellen und im Gedächtnis zu speichern, und b) diese mentalen Repräsentationen flexibel anzuwenden, um Urteile zu bilden und Entscheidungen zu treffen Definition Mentale Repräsentation: Wissensstrukturen, die Menschen konstruieren, im Gedächtnis speichern, aus dem Gedächtnis abrufen und in unterschiedlicher Weise verwenden können Susanna Lopez Seite 6 29.02.2012 Schritte der soziale Informationsverarbeitung: Initiale Wahrnehmung: kritischer Stimuli muss wahrgenommen Aufmerksamkeit bestimmte Aspekte und Ausschluss anderer Aspekte werden, dafür nötig Definition Salienz: Ein Stimulus, der die Fähigkeit besitzt, im Zusammenspiel mit Merkmalen des Wahrnehmenden (z.B. seinen Bedürfnissen, Zielen) die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, wird in der sozialen Kognitionsforschung als „salient“ bezeichnet Stimuli werden i.d.R. salienter, wenn sie a) sozial bedeutsam sind und b) im Vergleich zu anderen Stimuli im sozialen Kontext relativ selten auftreten (z. B. ein einzelner Angehöriger einer sozialen Minorität unter Mitgliedern der Majorität) Die Salienz eines Stimulus hat somit wichtige Konsequenzen für die weitere Informationsverarbeitung Im zweiten Schritt muss die Person den Stimuli enkodieren und interpretieren Definition Enkodierung: Der Prozess, der einen äußeren Stimulus in eine kognitive Repräsentation überführt, die dann im Gedächtnis gespeichert wird. Der Prozess der Enkodierung beinhaltet, dass der externe Stimulus mit bereits vorhandenem Wissen in Beziehung gesetzt wird, wodurch er informationshaltig wird und einen Sinn erhält Es setzt voraus dass das gespeichert Wissen für die Interpretation im Gedächtnis zugänglich ist Im Hinblick auf die Enkodierung ist der Prozess der Kategorisierung des Stimulus von grundlegender Bedeutung Susanna Lopez Seite 7 29.02.2012 Definition Zugänglichkeit: Der Begriff der Zugänglichkeit bezieht sich darauf, wie leicht ein bestimmter Inhalt aus dem Gedächtnis abgerufen werden kann. Schnell abrufbare Inhalte werden als leicht zugänglich bezeichnet. Ein Reiz, der die Zugänglichkeit eines Gedächtnisinhalts erhöht bzw. zur Aktivierung eines bestimmten Inhalts führt, wird als „Prime“ bezeichnet Definition Kategorisierung: Der Prozess, durch den ein Stimulus einer Klasse ähnlicher Objekte (Personen, Ereignisse etc.) zugeordnet wird Kategorisierung hat zwei wichtige Implikationen: Systematisierung und Inferenz (Schlussfolgerung) Eine Hauptfunktion der Kategorisierung besteht in der Systematisierung der wahrgenommenen Stimuli im Hinblick auf zielorientiertes Handeln (z.B. Tajfel, 1969) Diese Systematisierung wird dadurch erzielt, dass bestehende Unterschiede zwischen Stimuli, die einer gemeinsamen Kategorie zugeordnet werden, zugunsten bestehender Ähnlichkeiten vernachlässigt werden Die Kategorisierung eines Stimulus erlaubt es, aus dem bereits gespeicherten Wissen über Mitglieder der Kategorie auf Eigenschaften oder Merkmale des Stimulus zu schließen, die nicht unmittelbar beobachtet wurden (oder werden können) In einem weiteren Schritt der Informationsverarbeitung wird die enkodierte Wahrnehmung schließlich im Gedächtnis gespeichert Dieser neue Gedächtnisinhalt liefert dann in Zusammenspiel mit dem im Gedächtnis bereits gespeicherten Wissen die Grundlage für Urteile und Entscheidungen, welche dann die Verhaltensreaktionen gegenüber dem Stimulusobjekt bestimmen (z.B. Annäherung, Vermeidung oder Ignoranz) Modus der Informationsverarbeitung: Wie die Interpretationen der sozialen Realität vorgenommen wird hängt maßgeblich von der Art und Weise ab, wie diese sozialen Informationen verarbeitet werden Drei Aspekte der Informationsverarbeitung sind von besonderer Bedeutung: Das Zusammenspiel von Stimulus und Vorwissen, die Menge der verarbeiteten Informationen und das relative Verhältnis von automatischen und kontrollierten Verarbeitungsprozessen (siehe Bless et al., 2004) Zusammenspiel von Stimulusinformation und Vorwissen: In manchen sozialen Situationen wird die Verarbeitung der sozialen Informationen überwiegend durch Vorwissen oder Erwartungen des Wahrnehmenden geleitet – in diesem Fall spricht man von top-down oder konzeptgesteuerter Informationsverarbeitung In anderen Situationen wird die Informationsverarbeitung überwiegend durch die Merkmale des Stimulus oder der Situation determiniert – man spricht dann von bottom-up oder datengesteuerter Informationsverarbeitung Susanna Lopez Seite 8 29.02.2012 Menge der verarbeiteten Informationen: Systematische Verarbeitung: sammeln und Prüfen vieler Informationen vor der Interpretation Heuristischer Informationsverarbeitung: stützen auf wenige Hinweisreize und bewährte Entscheidungshilfen Definition Kognitive Heuristik: Eine kognitive Entscheidungshilfe im Sinne einer Faustregel, die es Menschen ermöglicht, mit geringem kognitivem Aufwand auf der Grundlage weniger Informationen Entscheidungen oder Urteile zu treffen Verfügbarkeitsheuristik: Als Grundlage dient der Grad der Zugänglichkeit von Informationen im Gedächtnis z.B. Ereignisse die häufig auftreten fallen einem schneller ein – das kann bei emotions-auslösenden oder ungewöhnlichen Ereignissen zu Fehleinschätzungen führen Ob die Urteilsbildung eher auf systematischer oder auf heuristischer Informationsverarbeitung beruht, hängt insbesondere von zwei Faktoren ab: Verarbeitungskapazität und Verarbeitungsmotivation. Ist die Verarbeitungskapazität eingeschränkt (z.B. durch Ablenkung) und/ oder die Motivation gering (Salienz des Ereignisses) steigt die Wahrscheinlichkeit zu heuristischer Verarbeitung Eine weitere wichtige Unterscheidung im Hinblick auf die Informationsverarbeitung bezieht sich darauf, ob der relevante kognitive Prozess weitgehend automatisch abläuft oder ob es sich um einen kontrollierten Prozess handelt. Kontrollierte Prozesse brauchen mehr kog. Ressourcen und sie erfordern mehr aktive Regulation (teilweise bewusst gesteuert) als automatisch ablaufende Prozesse Duale-Prozess Modelle: das Kontinuum-Modell von Fiske und Neuberg (1990) Zwei distinkte Modi der sozialen Informationsverarbeitung werden unterscheiden: automatische vs. kontrollierte Verarbeitung Die Eindrucksbildung beginnt stets mit einer automatischen Kategorisierung der fremden Person Ohne Beabsichtigung wird die Person im Sinne der Kategoriezugehörigkeit mit den damit assoziierten stereotypischen Eigenschaften wahrgenommen Nur bei ausreichender Motivation wird diese automatischer Verarbeitung zu Gunsten einer kontrollierteren Form der auf eigenschaftsbasierten oder individualisierten Informationsverarbeitung aufgegeben In der kontrollierten Informationsverarbeitung stellen kategoriale Informationen nur noch einen Aspekt der vielen Charakteristika dar Zugrundeliegende Bedürfnisse Die Soziale Informationsverarbeitung ist funktional – sie dient grundlegenden Bedürfnissen. Menschen haben ein Bedürfnis nach akkuraten Informationen, positiven Informationen über sich selbst, und Informationen, die ihre Erwartungen, Einstellungen und Überzeugungen bestätigen. Diese Bedürfnisse steuern 1) die Selektion von Informationen und 2) die Art und Weise, wie Informationen verarbeitet werden Bedürfnis, akkurat zu sein: ein akkurates Bild von der sozialen Realität zu entwickeln ist lebenswichtig für den Menschen; es stellt die Grundlage für effektive Umweltkontrolle dar. Allerdings ist dies nicht immer gegeben, vor allem nicht wenn sie mit anderen Bedürfnissen konfligiert ⇒ Attributionstheorien. Bedürfnis nach Konsistenz: Menschen haben ein Bedürfnis danach, bereits bestehende Erwartungen, Überzeugungen, Einstellung etc. zu bestätigen. Verletzt die Wahrnehmung subjektiv-logischer Unvereinbarkeiten zwischen zwei oder mehreren thematisch relevanten Kognitionen das Bedürfnis nach kognitiver Konsistenz, so schlägt sich das mit innerer Anspannung nieder (kognitive Dissonanz) ⇒ Theorie der kognitiven Dissonanz nach L. Festinger. Bedürfnis nach positiver Selbstbewertung: Zahlreiche Untersuchungen dokumentieren, dass Menschen bestrebt sind, das eigene Selbstwertgefühl zu schützen und/oder zu steigern. Dieses Bestreben beeinflusst zum einen, welche selbstbezogenen Informationen Menschen aktiv suchen (Steigerung des Selbstwertgefühls) und welche sie vermeiden (Bedrohung des Selbstwertgefühls). Doch nicht nur das, Menschen ziehen einen Teil ihres Selbstwertgefühls aus ihrer Zugehörigkeit zu sozialen Gruppen. Susanna Lopez Seite 9 29.02.2012 Der relative Einfluss dieser drei Bedürfnisse ist personen- und situationsabhängig Es gibt aber Hinweise dass das Bedürfnis nach positiver Selbstbewertung den stärksten Einfluss ausübt, gefolgt von dem Bedürfnis nach Konsistenz (Baumeister 1998) Rationale Entscheidungen Kann menschliche Informationsverarbeitung als rational eingeschätzt werden? Prospect Theorie oder auch „Heuristiken und Verzerrungen) Keren & Teigen, 2005; Tversky & Kahneman, 1974 Für diese beiden Autoren handelt ein normativ rationales Individuum nach dem Prinzip der Nutzenmaximierung (Tversky & Kahneman, 1986). D.h. es bedient sich in seinen Entscheidungen mathematischer bzw. statistische Rationalität, da diese Art der Entscheidungsfindung den optimalen Nutzen einer Entscheidung ermitteln kann Diese Abweichungen im Entscheidungsverhalten bezeichneten sie als „Verzerrung“ (bias) Eine solche Verzerrung wiesen Kahneman und Tversky z.B. nach, indem es ihnen gelang, Entscheidungsverhalten allein durch die Variation des Rahmens, in dem eine Entscheidung zu treffen war, zu beeinflussen Verstoß gegen das Invarianzprinzip (die mathematisch/statistische Grundlage der Entscheidung ändert sich durch den Rahmen nicht) Das heißt Entscheidungen waren in einem positiven Rahmen anders getroffen als in einem negativem Rahmen, auch wenn die Konsequenzen gleich sind! Der deutsche Soziologe Hartmut Esser spricht davon, dass sich die Zielstruktur der Situation mit dem jeweiligen Rahmen verändert (z.B. Verlust vermeiden oder Gewinn behalten) Kahneman und Tversky nennen 3 Punkte in denen menschliches Entscheidungsverhalten von einem komplett rationalen Entscheidungsverhalten abweichen: Wahrscheinlichkeitseinschätzung: Die Wahrscheinlichkeit des Eintreffens eines Ereignisses wird von Menschen häufig subjektiv falsch eingeschätzt. Kleine Wahrscheinlichkeiten werden überschätzt, große Wahrscheinlichkeiten eher unterschätzt. Nur bei den Extremen der absoluten Sicherheit oder unmöglichen Ereignissen stimmt die subjektive Bewertung von Wahrscheinlichkeiten mit der objektiven Realität überein (vgl. Kahneman & Tversky, 1979). Referenzpunkt: Menschen bewerten das Ergebnis von Entscheidungen immer in Relation zu einem Ausgangspunkt. Gewinn und Verlust und die damit einhergehenden Gefühle sind aber nicht linear miteinander verknüpft. Gewinne und Verluste unterscheiden sich nicht nur in dem damit assoziierten Gefühl, sondern auch in ihrem Anstiegsverhalten. Rahmung der Entscheidung: Wie Entscheidungsalternativen bewertet werden, hängt nicht zuletzt davon ab, in welchem Rahmen sie gesehen werden. Wie Menschen Entscheidungen rahmen, hängt mit Gewohnheiten, der Kultur und weiteren Einflüssen zusammen, die sich relativ schwer zu einem Begriff vereinheitlichen lassen Kahneman und Tversky weisen auf drei zentrale Heuristiken hin die Menschen stattdessen anwenden: Verfügbarkeitsheuristik: Als Grundlage dient der Grad der Zugänglichkeit von Informationen im Gedächtnis, z.B. Ereignisse die häufig auftreten fallen einem schneller ein – das kann bei emotionsauslösenden oder ungewöhnlichen Ereignissen zu Fehleinschätzungen führen Repräsentativitätsheuristik: Wenn Menschen Wahrscheinlichkeitsaussagen treffen, so werden sie diese häufig anhand von Repräsentativitätsheuristiken generieren. Dabei betrachten sie Merkmale eines zu klassifizierenden Gegenstandes und schätzen ab, für welchen Bereich dieser typisch ist. Die Anker- und Anpassungsheuristik wird von Menschen angewendet, wenn diese eine Quantität abschätzen sollen. Dabei orientiert sich die Schätzung an einem relativ willkürlich festgelegten Wert und wird von diesem ausgehend adjustiert. In vielen ist das Anwenden dieser Heuristiken nützlich oder zumindest harmlos, aber es kann auch zur Gefährdung bei Unterlassung kommen! Diese Tendenz, eine Handlung zu vermeiden, die potentiell Schaden zufügen könnte aber viel wahrscheinlicher größeren Schaden abwendet, wird als Auslassungsverzerrung (omission bias) bezeichnet Das Wissen um solche Verzerrungen und Heuristiken kann helfen, sinnvolle Programme und Entscheidungshilfen zu entwickeln. Davon könnte nicht nur in der Medizin oder Wirtschaft profitiert werden, sondern in fast allen Lebensbreichen Susanna Lopez Seite 10 29.02.2012 Begrenzte Rationalität Ansatz von G. Gigerenzer & Selten, 2001 Gigerenzer und seine Kollegen kritisieren den Rationalitätsbegriff der im oben skizzierten „Heuristiken und Verzerrungen“ Paradigma verwendet wird. Dieser erscheint ihnen als zu eng gefasst und würde nicht die Komplexität der alltäglichen Lebensumwelt berücksichtigen 2 Punkte die kritisiert werden: Enge Normen: Rational sei hier nur Verhalten, dass in Einklang mit statistisch/mathematischem Denken steht. Dies sei aber nicht sinnvoll, da Entscheidungen meistens a) lediglich einen Einzelfall betreffen und damit per Definition nicht durch statistische Methoden „richtig“ erfasst werden könnten und b) Entscheidungen immer in einem gewissen Kontext stehen, welcher selbst definiert, welches Verhalten in ihm als rational zu bezeichnen ist. Zugrundeliegende Prozesse: Oft würden nur vage Heuristiken als Erklärung von Entscheidungsphänomenen angegeben, die oft auch noch doppeldeutig im Sinne ihrer Interpretierbarkeit seien Ausgangslage der Theorie der Begrenzten Rationalität ist die Beschränktheit der menschlichen Verarbeitungskapazität (Zeitdruck, Aufmerksamkeit, Konzentrationsfähigkeit etc.) Alternativen: Menschliches Entscheidungsverhalten kann beispielsweise gut mit der Anspruch-AnpassungsTheorie (aspiration-adaptation theory) erklärt werden (Selten, 2001) Dieser Theorie zufolge ist das Entscheidungsverhalten stark davon beeinflusst welchem Anspruchslevel (aspiration level) eine Entscheidung überhaupt gerecht werden muss Je nach Anspruch oder Wichtigkeit der Entscheidung werden mehr oder weniger Ressourcen benötigt Das Anspruchslevel ist dabei aber keine Konstante, die nur einmal festgelegt wird, sondern ist je nach Situation flexibel anpassbar Zusammenfassend lässt sich also sagen: Wie die Rationalität der menschlichen Entscheidungsfähigkeit eingeschätzt wird, ist a) abhängig davon, welche Bedeutung der Umwelt für den Entscheidungsprozess zugesprochen wird und b) was in dieser Umwelt als Optimum erreicht werden soll. Der Einfluss von Emotionen und Stimmungen Frühere Rationalitätsdebatten wurden oft unter der Prämisse geführt, dass Rationalität nur dann möglich ist, wenn die Gefühle aus dem Entscheidungsprozess herausgehalten werden (z.B. Descartes 1649/1996) Als Arbeitsdefinition kann für die folgende Darstellung die These von William James (1884) über die Beschaffenheit von Emotionen dienen: Emotion: Das Fühlen einer körperlichen Veränderung, welche auf die Wahrnehmung eines erregenden Ereignisses erfolgt Im Gegensatz zum schwer zu bestimmenden Begriff der Emotion lässt sich nach Bless (1997) der Begriff der Stimmung relativ gut definieren, dies aber auch nur in Abgrenzung zur Emotion Stimmung in Abgrenzung zur Emotion: a) Stimmungen sind Gefühlszustände von geringerer Intensität als Emotionen; b) Stimmungen sind nicht auf ein Objekt gerichtet; c) Die Ursache der Stimmung liegt nicht im Aufmerksamkeitsfokus; d) Stimmungen ziehen keine bestimmten Reaktionen in Verhalten, Emotionen und Kognitionen nach sich; e) Stimmungen sind informativ für die allgemeine Qualität des eigenen Zustandes Stimmungen beeinflussen kog. Entscheidungsprozesse, nur die Vorhersage ist auf Grund hoher Varianzen im beobachtbaren Verhalten ist schwierig In der Sozialpsychologie hat es sich bewährt stattdessen eher allgemeine Denkstile zu identifizieren die unter verschiedenen Stimmungen wahrscheinlicher angewendet werden Da Menschen ihre eigene Stimmung als Information für ihr Befinden verwenden können, kann sie ihnen auch als Anhaltspunkt für die Angemessenheit von aufwendigen oder weniger aufwendigen kognitiven Verarbeitungsstilen in einer gegeben Situation dienen (Schwarz & Bless, 1991) Bless (1997) geht davon aus, dass Stimmungen vermitteln, ob eine Situation als problematisch (negative Stimmung) oder unproblematisch (positive Stimmung) gesehen wird Susanna Lopez Seite 11 29.02.2012 Unproblematische Situation ⇒ das positiv gestimmte Individuum verlässt sich vermehrt auf seine bestehenden allgemeinen Wissensstrukturen, um zu handeln, zu planen oder zu entscheiden Problematische Situation ⇒ jetzt ist es meist sinnvoll, sich von den eigenen ausgetretenen Pfaden zu lösen. Es werden spezifischere Repräsentationen und genauere Problemanalysen notwendig. Diese Feststellung könnte zu einem verfrühten Schluss führen, dass gut gestimmte Personen weniger kognitive Leistungen erbringen als schlecht gestimmte Und Bless, Mackie und Schwarz (1992) konnten in der Tat zeigen, dass die Qualität von Argumenten vor allem von Menschen in einer traurigen Stimmung berücksichtigt wird, während auf freudig Gestimmte die Qualität von Argumenten kaum Einfluss bezüglich deren Einstellungsänderung hatte. Bei freudig Gestimmten wirkten schwache Argumente fast ebenso gut wie starke Argumente. Weiter konnte gezeigt werden, dass gut gestimmte Menschen eher als schlecht gestimmte auf Stereotype zurückgreifen, somit eher Stimuli ganzheitlich verarbeiteten, anstatt sie auf ihre Komponenten hin zu analysieren (Bless, Schwarz, & Wieland, 1996) Sollten wir deshalb besser in schlechter Stimmung lernen? Dies scheint nicht sinnvoll, da gerade gut gestimmte Menschen zu allgemein befriedigenden Problemlösungen und vor allem zu kreativeren Leistungen fähig sind. Gerade das Verwenden von allgemeinen Wissensstrukturen erlaubt es erst, neue Zusammenhänge zu entziffern (Bless, 1997) Auch Höchstleistungen von Menschen, wie sie unter dem Konzept des „flow“: Flow: Freudiges reflexionsfreies Aufgehen in glatt laufender Tätigkeit, die trotz hoher Beanspruchung ständig unter Kontrolle ist Stimmungen als Motivationsregulativ: Menschen streben eine angemessen positive, optimistische Affektbalance im Alltag an. Die eigene Stimmung dient als ein Regulativ für die Bearbeitung von Aufgaben. Sinkt die Stimmung während der Bearbeitung einer Aufgabe ab, z.B. durch Ermüdung, so sinkt auch die Motivation weiter zu arbeiten Deswegen ist es auch eher ratsam Lernen so zu gestalten, dass dies zu einer guten Stimmung führt, damit die Motivation zu lernen über eine längere Zeit ohne besondere Anstrengung aufrecht erhalten werden kann AIM, J. Forgas (2002) AIM = Affect Infusion Modell“ AIM unterscheidet 4 Prozessstrategien: a) der direkte Abruf eines bereits existierenden Verhaltens b) Motivierte Verarbeitung für ein bereits gesetztes Ziel c) Anwendung einer Heuristik d)substantielle generative Verarbeitung um Verhalten zu planen Welche Strategie angewendet wird, hängt maßgeblich von der jeweiligen Person, deren Aufgabe und der Situation ab Die Strategien werden nach Anfälligkeit für den Einfluss von Affekten unterschieden: Während die ersten beiden Prozessstrategien eher dann verwendet werden, wenn keine eigene Planung mehr vorgenommen werden muss und die Abfolge der nächsten Handlungsschritte relativ festgelegt ist, werden die letzten beiden Prozessstrategien vor allem dann eingesetzt, wenn das zukünftige Verhalten noch nicht festgelegt ist. Dem entsprechend sind es vor allem die beiden letzten Prozessstrategien, die durch Affekte beeinflussbar sind Interessantweise ist es also so, dass gerade wenn der meiste kognitive Aufwand nötig ist, also die substantielle generative Verarbeitungsstrategie gewählt wird, Affekte am wirksamsten das Handeln beeinflussen, während sie bei der bloßen Ausführung einer Handlung, um ein Ziel zu erreichen, relativ wenig Einfluss haben (Forgas, 1995) Das AIM sagt also vorher, wann Affekte besonders viele Auswirkungen auf unser Denken und Handeln in sozialen Situationen haben Relativ analog zu Bless (1997) argumentieren Forgas und Laham (2006), dass positive Stimmung eher zur Verwendung von assimilativen schemabasierten Denkprozessen führt, während negative Stimmung eher akkomodative, auf die Umwelt gerichtete, Denkprozesse hervorruft. Stimmung legt damit zwar die Qualität aber nach dem AIM nicht die Quantität dieser Denkprozesse fest Susanna Lopez Seite 12 29.02.2012 Tatsächlich ließen sich diese unterschiedlichen Wirkungen von freudiger und negativer Stimmung belegen, wie Abbildung 3.3 zeigt. Traurige Versuchsteilnehmer waren in der Tat eher höflich, als fröhliche. Interessanterweise war dieser Effekt aber umso größer, je schwieriger die Situation war. Dies kann als ein Hinweis zur Gültigkeit der Annahmen aus dem AIM gedeutet werden. Die Stimmung war vor allem dann Einflussreich, wenn die Studenten ihr Verhalten aktiv planen und durchdenken mussten. Attribution Wie sich ein Beobachter das Verhalten eines Handelnden gegenüber einem anderen Menschen (oder einem Objekt) erklärt, steht im Mittelpunkt der Attributionsforschung Als Attribution werden die subjektiven Schlussfolgerungen des Beobachters bezüglich der Ursachen des beobachteten Verhaltens (oder eines Ereignisses) bezeichnet. Manchmal machen Menschen ihr eigenes Verhalten zum Gegenstand ihrer subjektiven Erklärungen sie nehmen dann selbstbezogene Attributionen vor Entsteht aus dem Bedürfnis heraus Ereignisse vorherzusagen und dadurch unter umständen zu kontrollieren So beschäftigen sie sich beispielsweise eher mit der Erklärung der Verhaltensweisen von Menschen, von denen sie persönlich abhängig sind, als von Personen, deren Verhalten für sie keine Bedeutung hat (z.B. Berscheid, Graziano, Monson, & Dermer, 1976) Die Vielzahl möglicher Attributionen, die Menschen zur Erklärung des Verhaltens anderer Menschen bzw. des Eintretens von Ereignissen vornehmen können, lassen sich anhand einer Reihe unabhängiger Attributionsdimensionen systematisieren (z.B. Weiner, 1985b) • Lokation: Liegen die subjektiv wahrgenommenen Ursachen für das beobachtete Verhalten oder Ereignis in der Person (personale oder interne Faktoren) oder liegen sie in der Situation und den Umständen (situationale oder externe Faktoren)? • Stabilität: Sind die Ursachen stabil (nicht veränderlich oder fix) oder instabil (variabel)? • Kontrollierbarkeit: Sind die Ursachen für den Handelnden kontrollierbar oder unkontrollierbar? Wie die Forschungsarbeiten von Bernard Weiner und Kollegen (1982) demonstrieren, ist die Unterscheidung zwischen diesen Attributionsdimensionen insbesondere deshalb relevant, weil in Abhängigkeit der spezifischen Ausprägungen einer Ursachenzuschreibung auf diesen Dimensionen ganz unterschiedliche Meinungen, Bewertungen und emotionale Konsequenzen beim Beobachter resultieren Die Art der Erklärung eigenen Erfolgs bzw. Misserfolgs spielt auch eine wichtige Rolle für das Selbstwertgefühl. So konnte gezeigt werden, dass die Attribution eigenen Erfolgs auf interne und stabile Faktoren (z.B. die eigenen Fähigkeiten) Stolz und Selbstvertrauen auslöst. Die Attribution eigenen Misserfolgs auf interne und stabile Faktoren hat hingegen negative Affekte, wie Niedergeschlagenheit und Enttäuschung zur Folge (Weiner, 1985b) Susanna Lopez Seite 13 29.02.2012 Als Attributionsstil wird die relativ zeitstabile Tendenz einer Person verstanden, über verschiedene Situationen hinweg bestimmte Erklärungsmuster zu verwenden. Depressive Menschen weisen beispielsweise häufig einen pessimistischen Attributionsstil auf, der darin besteht, dass sie eigene Misserfolge unabhängig davon, ob sie dafür verantwortlich sind oder nicht, auf stabile, interne und kontrollierbare Faktoren zurückführen (z.B. ihre Charaktereigenschaften, siehe Abramson, Seligman, & Teasdale, 1978). Attributsprozess Korrespondierende Schlussfolgerungen Im Zentrum der Theorie der korrespondierenden Schlussfolgerungen von Jones und Davis (1965) steht die Frage, wie Menschen von einer beobachteten Handlung auf die Dispositionen (Persönlichkeitsmerkmale, Einstellungen, Motive etc.) des Handelnden schließen, die ihn zu dem Verhalten veranlasst haben (bzw. die in diesem Sinne mit dem Verhalten korrespondierten) Zwei wesentliche Schritte spielen dabei eine Rolle: 1. In einem ersten Schritt muss der Beobachter entscheiden, ob der Handelnde die Handlung mit Absicht ausgeführt hat (Kannte er die Konsequenzen seiner Handlung? Hatte er die Fähigkeit, die Handlung auszuführen?) – zufällig ausgeführte Verhaltensweisen haben in der Regel keinen Informationsgehalt für zugrundeliegende Dispositionen 2. In einem zweiten Schritt muss der Beobachter dann entscheiden, welche Disposition(en) den Handelnden zu der konkreten Handlung veranlasst haben das Befolgen eines Befehls unter Zwang lässt beispielsweise keine Rückschlüsse auf zugrundeliegende Dispositionen zu Um die für eine Handlung verantwortliche Disposition zu ermitteln, vergleicht der Beobachter der Theorie zufolge sämtliche Verhaltensmöglichkeiten, die der Handelnde zur Auswahl hatte, im Hinblick auf ihre spezifischen Konsequenzen miteinander Spezifische Konsequenzen sind solche, die ausschließlich mit einer bestimmten Handlungsalternative, nicht jedoch mit anderen möglichen Handlungen einhergehen (Prinzip der nicht-gemeinsamen Effekte) Allerdings sind nicht alle spezifischen Konsequenzen einer Handlung gleichermaßen informativ. Aufschlussreich sind insbesondere solche, deren Wert im Allgemeinen als gering oder sogar negativ eingeschätzt wird Kovariation und kausale Schemata: Die Theorie von Harold Kelley (zum Überblick siehe Kelley, 1973) ist die allgemeinste und einflussreichste aller Attributionstheorien. Kelley unterscheidet drei Arten von Attributionen: 1. Personenattributionen (die Ursachen liegen in der beobachteten Person) 2. Stimulusattributionen (die Ursachen liegen in Eigenschaften eines Reizes bzw. der Umgebung) 3. Umständeattributionen (die Ursachen liegen in spezifischen Umständen zu bestimmten Zeitpunkten) Verfügt eine Person aufgrund wiederholter Verhaltensbeobachtungen über Informationen aus mehreren Informationsquellen, dann wird die entsprechende Ursache Kelley zufolge nach dem Kovariationsprinzip ermittelt Das Kovarationsprinzip besagt, dass ein beobachteter Effekt derjenigen Ursache zugeschrieben wird (der Person, dem Stimulus oder den Umstände), mit der er über die Zeit hinweg kovariiert Zur Analyse potentieller Ursache-Wirkungsbeziehungen nach dem Kovariationsprinzip ziehen Menschen Informationen aus drei unterschiedlichen Quellen heran Das genaue Vorgehen lässt sich am besten an einem Beispiel verdeutlichen. Stellen Sie sich vor, ein Lehrer beobachtet, dass Tim seinen Mitschüler Lars auf dem Pausenhof androht, ihn zu verprügeln • Konsensusinformationen resultieren aus Beobachtungen der Reaktionen anderer Personen auf den Stimulus. Im Beispielfall wäre der Konsensus hoch, wenn andere Schüler sich ähnlich wie Tim gegenüber Lars verhalten (z.B. ihm ebenfalls drohen oder ihn drangsalieren) • Distinktheitsinformationen resultieren aus Beobachtungen des Verhaltens der Person in anderen Situationen (gegenüber anderen Stimuli). Im Beispielfall wäre die Distinktheit hoch, wenn Tim außer Lars keinen seiner Mitschüler je bedroht oder drangsaliert hat Susanna Lopez Seite 14 29.02.2012 • Konsistenzinformationen resultieren aus Beobachtungen des relevanten Verhaltens über die Zeit. Im Beispielsfall wäre die Konsistenz hoch, wenn Tim Lars zu verschiedenen Zeitpunkten wiederholt bedroht und drangsaliert hat Zu einer Personenattribution kommt es dann, wenn geringer Konsensus, geringe Distinktheit und hohe Konsistenz besteht – d.h., das Ereignis oder Verhalten mit der Person kovariiert (niemand außer Tim drangsaliert Lars; Tim drangsaliert auch andere Klassenkameraden; Tim hat Lars auch schon früher drangsaliert; die Schlussfolgerung des Lehrers ist daher: Tim ist ein aggressiver Rabauke). Bei hohem Konsensus, hoher Distinktheit und hoher Konsistenz attribuieren Personen hingegen eher auf den Stimulus (Lars Drangsalierung, liegt daran, dass er ein sozialer Außenseiter ist). Bei niedrigem Konsensus, hoher Distinktheit und niedriger Konsistenz attribuieren Personen eher auf die Umstände (Tim und Lars haben offenbar Streit). Das Kovariationsprinzip beruht allerdings auf einem kognitiv äußerst anspruchsvollen Prozess der Datenanalyse – tatsächlich gleicht er einer naiven Version der statistischen Varianzanalyse. Zudem setzt die Anwendung dieses Prinzips voraus, dass Personen über eine Vielzahl von Informationen verfügen – eine Voraussetzung, die in vielen Situationen, in denen Menschen kausale Schlussfolgerungen anstellen, nicht gegeben ist. Kelley (1973, S. 113) räumt daher ein, dass das Kovariationsprinzip „Idealcharakter“ habe Bei geringer Motivation oder Zeit greifen Menschen auf kausale Schemata zurück Kausale Schemata: Wissensstrukturen, in denen durch Erfahrung gewonnene abstrakte Annahmen darüber repräsentiert sind, welche Ursachenfaktoren für bestimmte Arten von Ereignissen verantwortlich sind, bzw. wie diese Ursachenfaktoren zusammenspielen Kelley unterscheidet zwischen zwei Arten von kausalen Schemata: a) solche die zur Ergänzung unvollständiger Information dienen b) solche, die explizite Annahmen über die möglichen und wahrscheinlichen Ursachen machen Eines der einfachsten kausalen Schemata der Klasse b) ist das Schema der multiplen hinreichenden Ursachen Kausales Schemata der multiplen hinreichenden Ursachen: Dieses Schema repräsentiert die Annahme, dass für das Auftreten ein und desselben Effekts (z.B. Prüfungsversagen) unterschiedliche Ursachen hinreichend sein können (entweder mangelnde Begabung oder ein zu hoher Schwierigkeitsgrad der Prüfungsaufgaben oder private Probleme des Prüflings) Abwertungsprinzip: auf Grundlage von Vorwissen neigen Menschen dazu, eine plausible Ursache für das Auftreten eines bestimmten Effektes weniger Gewicht bei zu messen, wenn gleichzeitig andere plausible Ursachen ebenfalls gegeben sind: Bsp. Ein Prüfer würde dementsprechend das Prüfungsversagen eines Prüflings, weniger auf dessen mangelnde Begabung zurückführen, wenn er weiß, dass dieser sich gerade von seiner Freundin getrennt hat, als wenn ihm diese alternative Ursachenerklärung nicht bekannt ist. Aufwertungsprinzip: Faktoren, die gegen das Auftreten eines Effekts wirken, verleiten Menschen hingegen dazu, einer plausiblen förderlichen Ursache für eine Handlung eine stärkere Wirkung zuzuschreiben, als wenn diese Ursache alleine vorliegt: Bsp. Wenn der Prüfer um die privaten Probleme des Prüflings weiß, würde er dementsprechend vermutlich im Fall einer erfolgreichen Prüfungsleistung eher dazu tendieren, auf eine besondere Begabung des Prüflings zu schließen, als er dies ohne das Wissen um diesen hemmender Faktor getan hätte. Neuere, moderne Modelle sind Duale-Prozess-Modelle Sie gehen davon aus das Menschen nur in den seltensten Fällen derartig datengeleitet, systematisch und kontrolliert vorgehen, sondern stattdessen in Fällen ihre Attributionen mehr oder weniger automatisch bilden Daniel Gilbert und Kollegen (z.B. Gilbert, Pelham, & Krull, 1988) gehen in ihrem Modell von einem zweistufigen Attributionsprozess aus 1. Menschen beurteilen das Verhalten einer Person im ersten Schritt relativ automatisch und bilden eine Personenattribution. Sie vernachlässigen externe situative Faktoren und schließen auf interne Dispositionen (diese hängen von der Erwartung des Beobachters ab, Stereotypen) 2. Zu einem weiteren Schritt kommt es nur, wenn der Beobachter über ausreichende kognitive Ressourcen verfügt und entsprechend motiviert ist, sie zu nutzen. Hier werden dann auch situative Einflusse mit einbezogen, und die ursprüngliche Zuschreibung ggf modifiziert oder ganz ersetzt. Susanna Lopez Seite 15 29.02.2012 Attributionsverzerrung Menschen tendieren dazu, bestimmte Ursachenerklärungen gegenüber anderen den Vorzug zugeben, obwohl dies sachlich nicht gerechtfertig ist Korrespondenzverzerrung: Beobachter neigen generell dazu, das Verhalten eines Handelnden eher auf interne als auf externe Faktoren zurückzuführen. Ursachen für ein Verhalten werden somit eher der handelnden Person (ihren Dispositionen, Motiven etc.) als der Situation oder den Umständen (z.B. äußeren Zwängen) zugeschrieben Kulturvergleichende Studien haben gezeigt das dies eher in individualistischen Kulturen wie USA oder Europa geschieht. Kollektivistische Kulturen wie Japan oder Indien berücksichtigen mehr die Situation (Konzeption der Persönlichkeit ist kontextbezogener) Akteur-Beobachter-Divergenz: Obwohl Menschen (insbesondere Menschen in westlichen Gesellschaften) das Verhalten anderer Personen oft automatisch auf Dispositionen des Handelnden zurückführen, gibt es eine spezifische Divergenz zwischen Akteuren und Beobachtern, wenn es um die Zuschreibung von Ursachen geht. Interessanterweise neigen Menschen nämlich dazu, ihr eigenes Handeln (d.h., wenn sie selbst der Akteur sind) stärker auf externe oder situationale als auf interne oder dispositionale Faktoren zurückzuführen Ein Grund für diese Verzerrung liegt in der unterschiedlichen Ausrichtung der Aufmerksamkeit bei der Verhaltensbeobachtung. Wenn Menschen das Verhalten einer anderer Person beobachten, wird diese (und deren Verhalten) als „Figur“ vor dem „Hintergrund“ der Situation wahrgenommen. Beim eigenen Handeln ist aufgrund der eigenen Perspektive die Aufmerksamkeit hingegen auf Merkmale der Situation gerichtet, situative Faktoren sind daher auffälliger als das Verhalten selbst. Selbstwertdienliche Attributionsverzerrung: Diese Art der Verzerrung spielt insbesondere in Leistungssituationen eine Rolle; sie dient der Steigerung oder dem Schutz des Selbstwertgefühls. Um ihr Selbstwertgefühl zu steigern, führen Menschen die eigenen Erfolge typischerweise in höherem Maße auf (stabile) interne Faktoren zurück (Fähigkeiten, Begabung) als vergleichbare Erfolge anderer Personen. Um ihr Selbstwertgefühl zu schützen, werden die eigenen Misserfolge im Unterschied zu den Misserfolgen anderer Personen hingegen eher auf externe Faktoren zurückgeführt Kapitelzusammenfassung Die soziale Informationsverarbeitung lässt sich in drei Schritte unterteilen: Wahrnehmung, Enkodierung und Urteilen. Zu welcher Interpretation der sozialen Realität eine Person gelangt, hängt maßgeblich davon ab, wie sie die Informationen verarbeitet: Eher konzept- oder eher datengeleitet, eher systematisch oder eher heuristisch, eher automatisch oder eher kontrolliert. Die Selektion und Verarbeitung von Informationen wird auch durch grundlegende Bedürfnisse beeinflusst: Menschen haben zwar ein starkes Bedürfnis danach, ein akkurates Bild von der sozialen Realität zu entwickeln, sie streben allerdings auch danach, dass dieses Bild mit ihren eigenen Erwartungen übereinstimmt und ihr Bedürfnis nach positiver Selbstbewertung nicht verletzt. In vielen sozialen Situationen versuchen Menschen, die Ursachen des Verhaltens anderer Menschen zu ergründen. Das Kovariationsprinzip beschreibt einen hoch systematischen Prozess der Ursachenanalyse, bei dem ein Beobachter Informationen aus mehreren Informationsquellen berücksichtigt. In Situation, in denen nur unvollständige Informationen vorliegen (oder die Zeit oder Motivation zur systematischen Verarbeitung fehlen), greifen Menschen häufig auf einfachere Strategien zurück. Sie verwenden einfache kausale Schemata oder verlassen sich auf eine Erklärung, die sie automatisch auf der Grundlage weniger Informationen ableiten. Die kausalen Schlussfolgerungen, die Menschen bezüglich des eigenen Verhaltens und des Verhaltens anderer Menschen ziehen, können durch bestimmte kognitive und/oder motivationale Prozesse verzerrt sein. Susanna Lopez Seite 16 29.02.2012 4) Eindrucksbildung und Personenwahrnehmung Eigenschaftsbasierte Eindrucksbildung Grundstein bildete die Experimentalserie von Salomon Asch (1946) Wie die Abbildung zeigt, wurde die Qualität der Eigenschaften, die der Zielperson zugeschrieben wurden, signifikant dadurch beeinflusst, ob diese Person zuvor als „warm“ oder als „kalt“ charakterisiert worden war. Ob sie zuvor als „höflich“ oder „grob“ gekennzeichnet worden war, spielte hingegen keine Rolle Harold Kelley (1950) gab vor dem Vortrag eines Gastdozenten an die Studenten kurze schriftliche Notizen ob dieser „warm“ oder eher „kalt“ beschrieben wurde Die Studierenden, denen er als „kalt“ beschrieben worden war, beurteilten den Dozenten in einer Befragung im Anschluss an seine Vorlesung nicht nur als weniger sympathisch, sondern sie waren während der Vorlesung selbst auch zurückhaltender damit, Fragen zu stellen und mit dem Dozenten zu interagier Asch vertrat die Auffassung, dass die einzelnen Merkmale im Kontext ihrer Beziehung zu anderen Merkmalen gewichtet und interpretiert und anschließend zu einem subjektiv sinnvollen Gesamteindruck integriert werden. Wobei einige Personenmerkmale einen großen und andere einen geringeren Einfluss hatten Zentrale und periphere Persönlichkeitsmerkmale: Als zentrale Persönlichkeitsmerkmale werden Charakteristika einer Zielperson bezeichnet, die einen überproportional großen Einfluss auf den resultierenden Gesamteindruck eines Beobachters ausüben. Periphere Persönlichkeitsmerkmale haben hingegen nur einen geringen Einfluss auf die Eindrucksbildung. Norman H. Anderson (1974,1981) kritisierte die Einteilung Asch in zentrale und periphere Persönlichkeitsmerkmale Anderson ging im Gegensatz zu Asch von der Unabhängigkeit einzelner Eigenschaftsmerkmale aus. In seiner Informationsintegrationstheorie (IIT) formulierte er, dass alle Informationen bestimmten mathematischen Regeln folgend zu einem Gesamteindruck integriert werden. Jede Information hat demnach einen Wert im Sinne von positivem, neutralem oder negativem Einfluss auf den Eindruck, und ein bestimmtes Gewicht, also eine Stärke, mit dem sich diese Bewertung auf die Susanna Lopez Seite 17 29.02.2012 Eindrucksbildung auswirkt. Diese mathematischen Gesetzmäßigkeiten werden auch als „kognitive Algebra“ bezeichnet Das Experiment von Anderson zeigt, dass der Effekt von HH im Gegensatz zu der Non Gruppe nicht so stark ansteigt wie der der LH Gruppe. Dieser Effekt spricht gegen die Addition der Einzelinformationen zu einer Gesamtbewertung und unterstützt die Annahme, dass vorhandene Informationen zu einem Gesamtbild gemittelt werden. Weitere Studien unterstützen Andersons These in ähnliche Weise Die Tatsache, dass die durchgezogenen Linien nicht perfekt parallel verlaufen, lässt sich laut Lampel und Anderson durch das Weight Average Modell erklären, das besagt, dass einzelne Attribute je nach ihrer Gewichtung unterschiedlich stark in die Bildung des Gesamteindrucks eingehen, der sich dann aus den gemittelten Werten der Attribute zusammensetzt pos/pos pos/neutral neg/pos neg/neutral nur opt. Attaktivirätt Samuel Himmelfarb (1973) legte zum Weight Average Modell den Probanden Eigenschaftssets vor, anhand derer sie beurteilen sollten, wie sehr sie eine Person mit diesen Eigenschaften mögen würden. Dabei wurden Anzahl und Valenz der Adjektive variiert Die Tatsache, dass die Zugabe neutraler Eigenschaften, je nach Kombination, den Gesamteindruck sowohl verbessern, als auch verschlechtern kann, spricht ebenfalls dafür, dass der Gesamteindruck aus den erhaltenen Informationen gemittelt wird Ein Mehr an positiven Eigenschaften führt so insgesamt zu einer besseren Gesamtbewertung. Im Weight Average Modell sind additive und mittelnde Zusammenhänge ohne Widerspruch vereinbar Die IIT hatte später auch Einfluss auf Forschung zu Einstellung und Überzeugung Man kann an dieser Stelle nun fragen in welcher Beziehung die Modellvorstellungen von Asch und Anderson stehen: Während Asch laienpsychologische Theorien als maßgeblich für die Gewichtung von Merkmalen ansah, unterstützte Anderson den Ansatz einer unabhängigen und objektiven Analyse der Merkmale, losgelöst von laientheoretischen Vorerwartungen. Letztlich lässt sich keiner der Ansätze als dem anderen überlegen bezeichnen. Sie stellen zwei völlig unterschiedliche Herangehensweisen und Erklärungsversuche für den komplizierten Prozess der Eindrucksbildung dar, die sich kaum falsifizieren lassen. Beiden Modellen fehlt allerdings die Einbeziehung von Motiven, Bedürfnissen und Zielen des Wahrnehmenden Wie die vorangehenden Ausführungen dokumentieren besteht in der Forschung Konsens darüber, dass der Gesamteindruck einer Person durch eine Integration und Gewichtung einzelner Informationen gebildet wird. Forschungsarbeiten zu impliziten Persönlichkeitstheorien beschäftigen sich damit wie die Bildung dieses Gesamteindrucks durch implizite Persönlichkeitstheorien des Wahrnehmenden gesteuert wird (z.B. Bruner & Tagiuri, 1954). Susanna Lopez Seite 18 29.02.2012 Implizite Persönlichkeitstheorien beinhalten Vorstellungen darüber, welche Persönlichkeitsmerkmale i.d.R. gemeinsam auftreten, zusammenpassen oder zusammengehören („Wenn Person A, die Eigenschaft X hat, dann hat sie vermutlich auch die Eigenschaft Y). Sie werden als „implizit“ bezeichnet, weil sie dem Wahrnehmenden typischerweise nicht bewusst sind. Ferner handelt es sich nicht um formale Theorien im wissenschaftlichen Sinne, sondern um laienpsychologische Theorien. Implizite Persönlichkeitstheorien reflektieren zum einen die innerhalb einer Gruppe oder Kultur vorherrschenden Vorstellungen darüber, welche Persönlichkeitsmerkmale gemeinsam auftreten und welche Merkmale einander ausschließen Diese Vorstellungen werden über Sozialisationsprozesse erworben. Andererseits können implizite Theorien auch hochgradig idiosynkratische Elemente aufweisen, die aus spezifischen biographischen Erfahrungen resultieren Rosenberg, Nelson und Vivekananthan (1968) nehmen an, dass implizite Theorien Annahmen über Merkmalszusammenhänge auf zwei inhaltlichen Dimensionen beinhalten: 1. Soziabilität: Merkmale wie „warmherzig“, „kontaktfreudig“, „hilfsbereit“ sind subjektiv indikativ für hohe Soziabilität; Eigenschaften wie „kalt“, „ungesellig“ oder „humorlos“ sind subjektiv indikativ für niedrige Soziabilität. 2. Intelligenz (bzw. Kompetenz): Merkmale wie „intelligent“, „fleißig“, „zielstrebig“ sind subjektiv indikativ für hohe Intelligenz (bzw. Kompetenz), Eigenschaften wie „dumm“, „leichtsinnig“ oder „naiv“ subjektiv indikativ für niedrige Intelligenz (bzw. Kompetenz). Wie die empirischen Befunde der Autoren zeigen, sind die beiden Bewertungsdimensionen nicht vollständig unabhängig voneinander. Es besteht also eine leichte Tendenz dazu, Personen, die man in sozialer Hinsicht positiv einschätzt, auch intellektuelle Fähigkeiten zuzuschreiben Warum aber spielen Hinweise auf Soziabilität und Intelligenz bei der Eindrucksbildung eine wichtige Rolle? Fiske, Cuddy, Glick und Xu (2002) argumentieren folgendermaßen: Wenn Menschen andere Menschen kennen lernen, sind sie zunächst primär an zwei Informationen interessiert: Erstens wollen sie wissen, welche Absichten der Interaktionspartner gegenüber der eigenen Person hegt (Sind die Absichten positiv oder negativ – ist er Freund oder Feind?). Zweitens wollen sie wissen, wie hoch die Kompetenz des Interaktionspartners ist, seine Absichten umzusetzen. Informationen über Soziabilität und Intelligenz werden also deshalb besondere Beachtung geschenkt, weil sie für die Beantwortung dieser Fragen hoch diagnostisch sind Andere Dimensionen sind u.a. moralische Integrität, Kraft oder Selbstvertrauen – verschiedene Autoren argumentieren allerdings, dass diese Dimensionen eher spezifische Aspekte der beiden oben genannten Dimensionen repräsentieren (z.B. Moonja Park & Rosenberg, 1980, S. 387) Duales Prozessmodell der Eindrucksbildung (Brewer,1988) Eindrucksbildung beginnt nach diesem Modell mit der initialen Identifizierung der anderen Person. Dabei werden bestimmte Merkmale automatisch wahrgenommen (z.B. Geschlecht, äußere Erscheinung, Hautfarbe etc.) Nur wenn die beobachtete Person eine Relevanz für den Betrachter hat, geht der Prozess in einen kontrollierten zweiten Teil über Ist der Wahrnehmende selbst involviert, d.h. fühlt er eine persönliche Bedeutung der Person für sich selbst oder gibt es ein Ziel, dessen Erreichen von der Person abhängt, wird die Person personalisiert wahrgenommen Ist dies nicht der Fall beginnt der Prozess der kategorisierten Personenwahrnehmung: ⇒ Visuelle Zuordnung zu einem repräsentierten Prototypen ⇒ Bei fehlender Passung Subtypisierung Diesen Prozess nennt Brewer Individualisierung, die Kategorie bleibt die Hauptreferenz Die Personlaisierung tritt bei hoher Selbstrelevanz des sozialen Stimulus ein Susanna Lopez Seite 19 29.02.2012 Individualisierung Lisa ist Krankenschwester Lisa wird in die Kategorie „Krankenschwester“ geschoben: Zuschreibung von Hilfsbereitschaft, Fürsorglichkeit (Berufsrollenstereotypisch) Personalisierung Lisa ist Krankenschwester Krankenschwester ist nur eine Attribut von vielen wie Überschwänglichkeit, Unpünktlichkeit Sie müssen nicht in die Kategorie „Krankenschwester“ passen Brewers Modell ähnelt in einigen Punkten dem Kontinuum-Modell von Fiske und Neuberg. Vergleich der beiden Modelle: Brewer: Duale-Prozess Modell 1. Schritt 2. Schritt Unterschiede Gemeinsamkeiten Susanna Lopez Automatische Kategorisierung Individualisierung wenn nötig durch übergeordneten Zielen, Selbstrelevanz, Bedürfnis nach Akkuratheit oder anderen sozialen Motiven Kategorisierter Wahrnehmung bekommt Vorzug auf Grund hoher kognitiver Prozesse Fiske Neuberg: KontinuumModell Automatische Kategorisierung Individualisierung nur wenn Ziele und Selbstbezug es nötig machen Früher Stopp des Prozesses um ökonomische Haushalten mit den kognitiven Kapazitäten zu gewährleisten Distinkte Verzweigungen der kontrollierten Verarbeitungsprozesse je nach Stärke der eigenen Involviertheit Unterschiedliche kog. Repräsentationen der Verarbeitungsstufen Typisierung = visuelle Speicherung Personalisierung = verbale Speicherung Beide Modelle verbinden aber kategorienbasierte und attributorientierte Personenwahrnehmung und bieten eine fundierte theoretische Ausgangslage für die Forschung zur Eindrucksbildung und Personenwahrnehmung, wobei das Modell von Fiske und Neuberg bislang die stärkeren empirischen Belege aufweisen kann Seite 20 29.02.2012 Konnektionistische Modelle der Eindruckbildung Parallel Constraint Satisfaction Theory von Kunda und Thagard (1996) Grundlage ist hier ein konnektionistisches Verständnis der menschlichen Wahrnehmung und Repräsentation sozialer Informationen Konnektionismus ist ein aus der Kognitionsforschung stammender Ansatz, das menschliche Denken durch Netzwerke nachzubilden. Diese Netzwerke bestehen aus zahlreichen simplen, aber eng miteinander verbundenen Einheiten. Durch Aktivierung und Hemmung einzelner Schaltpunkte und die Weiterleitung dieser Aktivierung zu verbundenen Einheiten, entstehen Aktivierungsmuster, die dann z. B. Gedanken entsprechen. Die zusätzliche Information über die Hautfarbe aktiviert bei dem schwarzen Akteur die Eigenschaft „aggressiv“. Diese wiederum aktiviert zusätzlich die gewalttätige Interpretation und hemmt gleichzeitig die Alternativerklärung So entsteht je nachdem, ob ein weißer oder schwarzer Akteur beobachtet wurde, ein unterschiedliches Aktivierungsmuster im Netzwerk, dass zu unterschiedlichen Interpretationen von Situationen und Zuschreibungen zu Personen führt Eine weitere wichtige Aussage des Modells ist, dass die Aktivierung nicht sequentiell sondern parallel verläuft. Alle Informationen werden im Netzwerk quasi gleichzeitig aufgerufen und bilden gemeinsam den Eindruck. Dieser beruht der Theorie zufolge auf existierenden Verknüpfungen, die aus Vorerfahrungen entstanden sind In Kunda und Thagards Modell kommen Stereotypen und Kategorien keine andere Rolle zu als Eigenschaften oder Verhalten. Auch hierin unterscheidet sich das Modell von den Modellen von Brewer und Fiske und Neuberg Einige Phänomene der Eindrucksbildung und Personenwahrnehmung wurden mit auf konnektionistischen Modellen beruhenden Berechnungen simuliert (z.B. van Overwalle & Labiouse, 2004) Dass sich eine deutliche Passung von Simulationsdaten und tatsächlichen Befunden finden ließ, interpretieren die Autoren als Beleg für die Richtigkeit und Nützlichkeit des Modells Kritiker des konnektionistischen Ansatzes bemängeln, der Darstellung von kognitiven Prozessen als neuronale Netzwerke fehlen die Systematik und Produktivität, die in höheren Denkprozessen auftreten (Fodor & Pylyshyn, 1988) Mechanismen und Prozesse, die in der Lage sind die Aktivierung und Hemmung in den konnektionistische Netzwerken zu steuern und zu überwachen (sog. Monitoring-Prozesse), bleiben unklar Die Macht des ersten Eindrucks Ein erster Eindruck entsteht schnell und beeinflusst unsere folgenden Wahrnehmungen und Interpretationen Diese ersten Eindrücke sind unabhängig von ihrer Richtigkeit oft ziemlich beständig, aber nicht unveränderbar Susanna Lopez Seite 21 29.02.2012 Besonderheiten der Eindrucksbildung Positivität und Negativität: Im Allgemeinen bilden Menschen eher positive als negative Ersteindrücke von anderen Personen (es sei denn, es liegen explizite negative Informationen vor) Wird der Wahrnehmende allerdings in der Phase der Eindrucksbildung mit einer negativen Information über die Zielperson konfrontiert, dann zieht diese Information überproportional viel Aufmerksamkeit auf sich und fällt deshalb bei der Eindrucksbildung stark ins Gewicht (Fiske, 1980) Hat sich ein negativer Eindruck erst einmal manifestiert, ist es auch schwieriger, ihn durch die Präsentation positiver Informationen zu verändern. Umgekehrt wird ein positiver Eindruck im Lichte nachfolgender negativer Informationen hingegen wesentlich schneller revidiert (z.B. Hamilton & Zanna, 1972) Mit anderen Worten: Menschen sind anderen Menschen beim ersten Kennenlernen prinzipiell offenbar eher positiv gegenüber eingestellt Es gibt’s zwei Gründe für die Sensibilität für negative Informationen: Negative Informationen sind eher unerwartet und ungewöhnlich und ziehen deshalb besonders viel Aufmerksamkeit auf sich. Dies wiederum führt zu einer intensiveren Verarbeitung. Negative Informationen signalisieren potentielle Gefahr, es ist daher adaptiv auf sie zu reagieren Reihenfolgeeffekte: Ein angelsächsischer Aphorismus lautet: „You never get a second chance to make a first impression” Primacy Effekt: Ein Reihenfolgeeffekt, bei dem die zuerst dargebotenen Informationen einen überproportional großen Einfluss auf die Wahrnehmung und die Eindrucksbildung haben Studie von Asch (1946): die Ergebnisse waren eindeutig: Die Eigenschaften, die zuerst präsentiert wurden, übten einen überproportional großen Einfluss auf die Eindrucksbildung aus – im konkreten Fall bedeutete dies, dass die VPn die Zielperson positiver bewerteten, wenn die positiven Eigenschaften zuerst präsentiert wurden, als wenn sie zuletzt präsentiert wurden Wenn eine Person abgelenkt oder nur gering motiviert ist, personenbezogene Informationen zu verarbeiten, kann es auch zu einem Recency-Effekt bei der Eindrucksbildung kommen: Der Eindruck wird dann auf der Grundlage der Informationen gebildet, die zeitlich am kürzesten zurück liegen und daher im Gedächtnis am schnellsten zugänglich sind Recency Effekt: Ein Reihenfolgeeffekt, bei dem die zuletzt dargebotenen Informationen einen überproportional großen Einfluss auf die Wahrnehmung und die Eindrucksbildung haben Der primacy Effekt ist allerdings wahrscheinlicher und hat so die größere Bedeutung beim ersten Eindruck Der Halo-Effekt: wurde erstmals von Edward Thorndike (1920) beschrieben Halo-Effekt: Er bezeichnet das Phänomen, dass das Wissen über eine bestimmte Eigenschaft einer Person den Gesamteindruck dominiert. Andere Eigenschaften werden vernachlässigt oder ignoriert. Gleichzeitig führt das Wissen über diese bestimmte Eigenschaft dazu, Schlussfolgerungen auf weitere Eigenschaften zu begünstigen Eigenschaften, die einen Halo Effekt haben können sind z.B. Intelligenz, physische Attraktivität, aber auch Behinderungen oder Stigmata Aktive vs passive Informationssuche: Werden Informationen aktive gesucht oder passiv erhalten? Im Großteil der wissenschaftlichen Untersuchungen zur Eindrucksbildung fungieren Teilnehmer als passiv Wahrnehmende, indem genau festgelegt ist, wann ihnen welche Informationen präsentiert werden Das wirft die Frage auf, ob Ergebnisse dieser Studien sich auch auf Situationen übertragen lassen, in denen Personen selbst wählen, aus welchen Informationen sich ihr Eindruck zusammen setzen soll Susanna Lopez Seite 22 29.02.2012 In einer Untersuchung dazu konnten Waggoner, Smith, & Collins (2009) zeigen, dass es durchaus Unterschiede zwischen der Beurteilung von Personen gibt, je nachdem ob die vorherigen Informationen aktiv gesucht oder passiv präsentiert wurden Die Ergebnisse zeigten zwar keine unterschiedliche Qualität der Bewertungen, dennoch unterscheiden sich die Vergleichsgruppen: passiv Wahrnehmenden fiel die Beurteilung von Persönlichkeitseigenschaften fremder Personen leichter und sie waren sich insgesamt sicherer mit ihrem Urteil, Außerdem gaben sie im Vergleich zu den aktiven Informationssuchern eine positivere Sympathieeinschätzung über die zu bewertenden Personen ab Andersherum gesprochen scheint es bei aktiver Informationssuche mehr Unsicherheit bei der Eindrucksbildung zu geben. Ein mögliches Mehr an Informationen geht nicht zwingend mit höherer Sicherheit einher Alter und Länge der Bekanntschaft: In einer Studie fragten sich Hess und Pillen (1994), ob ältere Menschen sich schwerer damit tun, erste Eindrücke zu revidieren Ergebnis: ältere Vpn gewichteten negative Informationen zwar stärker, insgesamt war das Alter aber kein Prädiktor für die Änderung von Eindrücken Bekanntschaftslänge: durch mehr Interaktionen und Situation mit länger bekannten Personen werden diese auch differenzierter und individueller war genommen, die Übereinstimmung der Einschätzung von Persönlichkeitseigenschaften wird mit steigender Dauer der Bekanntschaft nicht signifikant besser (s.a. Kenny, 2004). Aufrechterhalten von Eindrücken Tendenz zur Beharrung (Perseverance bias): Der erste Eindruck hat häufig sogar dann noch Einfluss auf die Beurteilung einer Zielperson, wenn er sich nachfolgend als falsch herausgestellt hat Studie Lee Ross und seine Kollegen (Ross et al., 1975, Exp. 2): Zielpersonen bekamen falsche Eindrücke vermittelt, die später dann wieder korrigiert wurden. Wie die Auswertungen nachfolgender Einschätzungen der Zielperson ergaben, wurden diese Einschätzungen dennoch von dem ersten fehlerhaften Eindruck beeinflusst Wie dieses und andere Experimente zeigen, ist es aufgrund dieser Tendenz zur Beharrung oft schwierig, die Effekte eines ersten Eindrucks vollständig zu eliminieren, selbst wenn er – wie im Fall eines Gerüchts oder eines falschen Verdachts – auf offensichtlichen Fehlinformationen beruht Konfirmatorische (Befestigung, Bekräftigung) Informationssuche: Wie schon erwähnt, neigen Menschen dazu, gezielt nach Informationen zu suchen, die ihre Eindrücke oder sozialen Hypothesen über andere Personen bestätigen, während Informationen, die diese widerlegen könnten, vernachlässigt werde In einem Experimente legten Mark Snyder und William Swann (1978) VPn Hypothesen über eine zukünftige Interaktionspartnerin nahe (eine den VPn nicht bekannte Person) Die Untersuchung wurde zwar aus einer Reihe von methodischen Gründen kritisiert. Allerdings erwies sich die Tendenz zur konfirmatorischen Suche auch in nachfolgenden Untersuchungen mit einer verbesserten Methodik als ein außerordentlich robustes Phänomen (s. z.B. Bless et al., 2004) Dies bedeutet: Hat sich ein erster Eindruck erst einmal manifestiert, dann steuert er die nachfolgende Informationssuche (und -verarbeitung) oft im Sinne seiner Bestätigung Sich selbsterfüllende Prophezeiung: Folgende Prozessschritte - meine Erwartung über die Zielperson und ihrem Verhalten - dadurch behandele ich die ZP in einer bestimmten Art und Weise - dies bringt wiederum die ZP dazu sich tatsächlich erwartungskonform zu verhalten - mein ursprünglicher erster Eindruck wird bestätigt Susanna Lopez Seite 23 29.02.2012 Experimentelle Beispiele: Eine Untersuchung von Robert Rosenthal und Lenore Jacobson ist als sogenannter „Pygmalioneffekt“ bekannt geworden (Rosenthal & Jacobson, 1968): Schüler legten einen Intelligenz Test ab – die Lehrer bekamen dann die Information es sei in der Experimentalgruppe ein Entwicklungssprung zu erwarten – Eltern und Schüler bekamen diese Information nicht – nach 8 Monaten wurde der Intelligenztest wiederholt Insgesamt zeigte sich ein signifikanter Unterschied in den IQ-Werten beider Gruppen Die Schüler, bei denen ein Entwicklungssprung vorhergesagt wurde, schnitten im Durchschnitt tatsächlich besser ab als ihre Mitschüler Besonders deutlich war dieser Unterschied in den ersten beiden Klassen. Hier zeigten in der Kontrollgruppe 19% (n = 18) der Kinder einen Zuwachs von mehr als 20 IQ-Punkten, in der Experimentalgruppe waren es 47% (n = 9) Dies könnte daran liegen, dass jüngere Schüler noch kein gefestigtes Selbstbild haben, die eigene Leistungsfähigkeit nicht im gleichen Maße einschätzen können wie ältere Kinder und möglicherweise empfänglicher für die Beeinflussung durch Erwartungen von außen sind Eine weitere experimentelle Untersuchung, die das Phänomen der selbsterfüllenden Prophezeiung belegt, stammt von Snyder, Tanke und Berscheid (1977). 1. Schritt: Erwartung der Zielperson Männlichen VPn wurde ein Foto einer Frau, mit der sie angeblich anschließend ein Telefongespräch führen würden. Je nach experimenteller Bedingung wurde den VPn entweder das Foto einer sehr attraktiven oder das Foto einer weniger attraktiven Frau gezeigt 2. Schritt: Behandlung der Zielperson entsprechend der eigenen Erwartung Folgendes zeigte sich: Zum einen waren die Männer, die dachten mit einer attraktiven Frau zu telefonieren, kontaktfreudiger, interessierter und warmherziger als diejenigen, die dachten, die Gesprächspartnerin sei unattraktiv 3. Schritt: Erwartungskonformes Verhalten der Zielperson Zum zweiten zeigte sich, dass die Frauen auf dieses unterschiedliche Konversationsverhalten entsprechend regierten 4. Schritt: Bestätigung des ursprünglichenEindrucks Frauen, deren Partner annahmen, sie sprächen mit einer attraktiven Frau, verhielten sich aufgeschlossener, fröhlicher und selbstsicherer und wirkten damit de facto attraktiver als Frauen, deren Partner annahmen, sie telefonierten mit einer unattraktiven Frau Es hängt von primär 3 Faktoren ab, wie leicht man sich von den Erwartungen anderer dazu verleiten lasse, ihre Eindrücke zu bestätigen: Der Stärke des eigenen Selbstbilds: Wenn eine Person ein festes Bild von sich selbst in einem bestimmten Bereich hat, dann wird sie sich weniger durch gegenteilige Erwartungen einer anderen Person in ihrem Verhalten beeinflussen lassen (z.B. Swann & Ely, 1984). Dem Bewusstsein, dass der Interaktionspartner bestimmte Vorstellungen über einen hat: Wenn sich Personen negativer Erwartungen ihrer Interaktionspartner bewusst sind, versuchen sie typischerweise diese durch erwartungsinkonsistentes Verhalten zu entkräften (Hilton & Darley, 1985). Den Motiven der Personen in der sozialen Interaktion: Wenn Menschen bestrebt sind, dass die Interaktion mit der anderen Person unkompliziert verläuft, sind sie eher bereit, sich in ihrem Verhalten den Erwartungen des Interaktionspartners anzupassen (Snyder & Haugen, 1995). Änderung von Eindrücken Lassen sich erste Eindrücke verändern oder korrigieren – und wenn durch welche Umstände? Verarbeitung inkonsistenter Information: Inkonsistente Informationen gefährden die anfängliche Sicherheit in der Einschätzung des Gegenübers, denn dadurch kann auch die Basis für eine soziale Interaktion oder Beziehung betroffen sein Demnach werden inkonsistente Informationen in vielen Fällen ignoriert, oberflächlich verarbeitet oder wegerklärt, ebenso gibt es aber auch empirische Belege dafür, dass unerwartete oder inkongruente Verhaltensweisen und Eigenschaften besser erinnert werden als neutrale oder erwartbare Das Erinnerungsvermögen ist insbesondere dann besser, wenn es weniger inkongruente als kongruente Informationen gibt (Hastie & Kumar, 1979; Srull,1981) Susanna Lopez Seite 24 29.02.2012 Gründe: unerwartete Ereignisse brauchen durch Erklärungsversuche mehr kog. Kapazität und eine tiefere Verarbeitung ⇒ werden somit besser gespeichert Kammrath, Ames und Scholer (2007) untersuchten die Einschätzungen von Persönlichkeitsvariablen im Sinne der „Big Five“ darauf, ob sich durch zusätzliche Informationen anfängliche Einschätzungen auf diesen Dimensionen korrigieren ließen Stabil Extraversion und Offenheit Variabel Gewissenhaftigkeit, emotionale Stabilität und Verträglichkeit Gründe: Eigenschaften liegen unterschiedliche metakognitive Konzepte zugrunde, die z.B. Informationen über Veränderbarkeit und Stabilität der Eigenschaften beinhalten. Motive zur Integration zusätzlicher Informationen: Steven Neuberg (1989) untersuchte den Einfluss des Bedürfnisses akkurat zu urteilen auf negative Vorerwartungen über eine Person. Ein Teil der Probanden erhielt zusätzlich die Anweisung sich einen möglichst akkuraten Eindruck vom Gegenüber zu bilden Die Ergebnisse zeigen, dass die negativen Erwartungen dann zu negativeren Bewertungen und auch zu tatsächlichem negativerem Interaktionsverhalten führten, wenn die Teilnehmer keine Instruktion zur Akkuratheit erhielten Bei den Teilnehmern mit dem manipulierten Bedürfnis nach Akkuratheit gab es dieses Gefälle nicht. Hier zeigte sich sogar die Tendenz zu einem gegenteiligen Effekt. Die Bewerber mit negativer Vorbewertung wurden positiver behandelt und schnitten auch objektiv besser ab als die Bewerber ohne negative Vorinformation Diese Ergebnisse lassen sich ganz im Sinne einer selbsterfüllenden Prophezeiung interpretieren Es gibt also durchaus Möglichkeiten dem Einfluss erster Eindrücke und damit eventuell verbundener Fehlannahmen entgegenzuwirken. Es scheint aber auch so zu sein, dass trotz neu entstehender Eindrücke alte nie vollständig erlöschen Kapitelzusammenfassung Der erste Eindruck, den eine Person von einer anderen Person entwickelt, resultiert nicht einfach aus der Addition der wahrgenommenen Merkmale der Zielperson. Vielmehr werden einzelne Merkmale im Kontext ihrer Beziehung zu anderen Merkmalen gewichtet und interpretiert, und anschließend zu einem subjektiv sinnvollen Gesamteindruck integriert. Neben den ursprünglichen eigenschaftsbasierten Theorien versuchen kategoriebasierte und konnektionistische Modelle den Prozess der Eindrucksbildung theoretisch zu erklären. Die Integration und Gewichtung von einzelnen Informationen zu einem Gesamteindruck wird durch implizite Persönlichkeitstheorien des Wahrnehmenden gesteuert. Implizite Persönlichkeitstheorien beinhalten Vorstellungen darüber, welche Persönlichkeitsmerkmale typischerweise gemeinsam auftreten, zusammenpassen oder zusammengehören. Der Ersteindruck kann durch Primacy Effekte beeinflusst werden. Bei geringer Verarbeitungsmotivation oder Kapazität können auch Recency Effekte auftreten. Die Tendenz zur Beharrung, die konfirmatorische Informationssuche und die Prozesse der sich selbst erfüllenden Prophezeiung tragen zur Aufrechterhaltung des Ersteindrucks bei. Inkonsistente Informationen werden unter bestimmten Umständen sogar besser verarbeitet und können unter bestimmten Umständen zu einer Änderung des ersten Eindrucks führen. Bei expliziter Motivation akkurat zu urteilen, bzw. auf Veränderungen zu achten, fördert eine gründlichere und systematischere Verarbeitung und Integration zusätzlicher Informationen. Susanna Lopez Seite 25 29.02.2012 5 ) Interpersonale Beziehungen In der Beziehungsforschung bezieht sich der Beziehungsbegriff typischerweise auf Dyaden (d.h. zwei Personen) Von einer sozialen Beziehung spricht man dann, wenn zwei Menschen miteinander interagieren und sich durch diese Interaktion in ihrem Erleben und Verhalten gegenseitig beeinflussen Ob es sich um eine oberflächliche oder eine enge Beziehung handelt, hängt von den spezifischen Merkmalen der Interaktion ab Enge Beziehungen sind u.a. dadurch gekennzeichnet, dass a) ein hohes Maße wechselseitiger Abhängigkeit besteht, b) die Partner auf unterschiedlichen Ebenen (kognitiv, affektiv und verhaltensbezogen) Einfluss aufeinander ausüben, c) dieser Einfluss intensiv ist, i.d.R. als positiv erlebt wird und in unterschiedlichen (und nicht nur wenigen) sozialen Situationen besteht, d) alle diese Eigenschaften die Beziehung über eine gewisse Dauer kennzeichnen Interpersonale Attraktion: ein entscheidender Faktor dafür, dass sich aus einem sozialen Kontakt eine enge Beziehung entwickelt (z.B. eine Freundschaft), ist die Gegenseitigkeit der interpersonalen Attraktion Definition: Interpersonalen Attraktion bezieht sich auf positive Gefühle gegenüber einer anderen Person, die mit dem Bedürfnis einhergehen, die Gegenwart des anderen zu suchen. Interpersonale Attraktion ist eine wichtige sozialpsychologische Grundlage für die Aufnahme enger Beziehungen Definition: Sympathie wird eine wenig differenzierte Form der interpersonalen Attraktion bezeichnet, die bereits aufgrund einer flüchtigen Begegnung und weniger personaler Informationen entstehen kann Die Faktoren, die das Auftreten von interpersonaler Attraktion fördern, lassen sich folgenden Kategorien zuordnen I. Merkmale des Kontexts: Einer der basalsten kontextuellen Faktoren, der Attraktion fördert, ist die Häufigkeit, mit der eine Person mit einer anderen Person Kontakt hat – Menschen tendieren dazu, andere Menschen umso mehr zu mögen, je vertrauter sie ihnen sind (MereExposure-Effekt) II. Merkmale der Zielperson: Eine wichtige Quelle von Attraktion ist die positive Bewertung der individuellen Charakteristika der Zielperson (ihres Aussehens, ihrer Eigenschaften, Präferenzen etc). Personen schreiben physisch attraktiven Personen häufig automatisch auch viele andere positive Eigenschaften zu III. Merkmale der Beziehung zwischen Beobachter und Zielperson: Einer der wirkungsvollsten interpersonalen Faktoren für die Entstehung von Attraktion ist die Wahrnehmung von Ähnlichkeiten im Hinblick auf persönlich relevante Einstellungen (Byrne, 1971) Drei Gründe tragen zu diesem Zusammenhang bei: ähnliche Einstellungen bereiten die Grundlage für gemeinsame Aktivitäten, die wiederum zu einer Intensivierung der Beziehung führen; Menschen gehen häufig Sympathie davon aus, dass Personen, die ihnen ähnlich sind, sie selbst auch mögen (z.B. Condon & Crano, 1988); Menschen fühlen sich durch die wahrgenommenen Ähnlichkeiten in ihren Einstellungen bestätigt, was positive Affekte erzeugt IV. Merkmale des Beobachters: Ein personenseitiger Faktor, der die Beurteilung der Attraktivität einer Zielperson beeinflusst, ist seine Stimmung – Stimuli werden häufig kongruent zur eigenen Stimmung beurteilt (z.B. Fedorikhin & Cole, 2004) Studie: Wright und Contrada (1986: Sind Personen die „schwer zu kriegen“ sind, besonders begehrt? Wright und Contrada (1986) konnten diese Vermutung in ihrer Untersuchung nicht bestätigen Es zeigte sich, dass Zielpersonen, die als extrem selektiv bei ihrer Partnerwahl beschrieben wurden („schwer zu kriegen“), von den Untersuchungsteilnehmern als weniger interessante potentielle Datingpartner eingeschätzt wurde Es liegt nahe, in diesem Zusammenhang Unterschiede im Attributionsprozess für Unterschiede in den Erfolgsaussichten der Strategie, „schwer zu kriegen“ zu sein, verantwortlich zu machen Wird das Verhalten eher auf stabile interne Dispositionen oder Attribute zurückgeführt (z.B. mangelndes Interesse der Zielperson, extreme Selektivität usw.), dann sollte das persönliche Interesse an dieser Susanna Lopez Seite 26 29.02.2012 Person eher sinken. Anders sieht die Sache aus, wenn externe Ursachen als Grund für die „Hürden“ beim Kennenlernen ausgemacht werde Der Effekt ist dabei nicht allein auf die behaviorale Ebene beschränkt sondern beeinflusst auch die kognitive und emotionale Ebene. Die sprichwörtliche verbotene Frucht wird noch begehrenswerter als zuvor Beziehungstypen: Einer der einflussreichsten theoretischen Ansätze zur Analyse von interpersonalen Beziehungen inklusive enger Beziehungen ist der Austausch oder Interdependenzansatz (z.B. Thibaut & Kelly, 1959; Blau, 1964) Austausch- und Interdependenztheorien gehen davon aus, dass Menschen soziale Beziehungen aufbauen, weil sie im Hinblick auf ihre Bedürfnisbefriedigung wechselseitig von einander abhängig sind Ob Personen eine Beziehung aufnehmen, aufrechterhalten oder abbrechen, hängt vom Verhältnis der wahrgenommenen Nutzen und Kosten ab, die aus der Beziehung (bzw. dem Austauschprozess) für die Beteiligten resultieren Wie Margaret Clark und Kollegen herausgearbeitet haben, unterscheiden sich interpersonale Beziehungen bezüglich der Normen oder Prinzipien, nach denen das wechselseitige Geben und Nehmen von Ressourcen erfolgt (z.B. Clark & Mills, 1993) Es ergaben sich zwei Beziehungstypen: Austauschbeziehungen („exchange relationships“) und Gemeinschafts- (oder auch sozial motivierte) Beziehungen („communal relationships) In Austauschbeziehungen erwarten die Beziehungspartner, dass die Ressourcen, die sie dem Partner bereitstellen, vom Rezipienten durch die Bereitstellung vergleichbarer Ressourcen „bezahlt“ werden – das Geben und Nehmen orientiert sich am Gleichheitsprinzip Mit einer zunehmenden Intensivierung der emotionalen Bindung zwischen den Partnern verändern sich allerdings häufig die Regeln für den sozialen Austausch – die Beziehung nimmt den Charakter einer Gemeinschaftsbeziehung an Gemeinschaftsbeziehung: in Beziehungen dieses Typs gehen die Partner davon aus, jeder habe ein Interesse am Wohlergehen des anderen. Die Partner achten daher weniger darauf, was sie vom Beziehungspartner erhalten (oder was sie ihm schulden), sondern darauf, welche Bedürfnisse der andere hat – das Geben und Nehmen von Ressourcen orientiert sich am Bedürfnisprinzip Idealtypische Beispiele für Austauschbeziehungen sind Beziehungen zwischen Fremden, Arbeitskollegen, Nachbarn oder Bekannten; idealtypische Beispiele für Gemeinschaftsbeziehungen sind enge Familienbeziehungen, Liebesbeziehungen oder eben auch enge Freundschaften Die meisten Beziehungen lassen sich allerdings als Mischformen der beiden Beziehungstypen charakterisieren, wobei eher der eine oder der andere Typ überwiegt Wichtig: Der Wechsel von einer Austauschbeziehung zu einer Gemeinschaftsbeziehung markiert einen bedeutenden Wendepunkt in der Entwicklung interpersonaler Beziehungen. Mit zunehmender emotionaler Intensität der Beziehung wird im Hinblick auf den sozialen Austausch vom Gleichheitsprinzip zum Bedürfnisprinzip übergegangen; aus einer Bekanntschaft entwickelt sich eine Freundschaft. Ein wichtiger kommunikativer Faktor, der die emotionale Intensivierung interpersonaler Beziehungen fördert, ist der Grad an Selbstenthüllungen Unter eine Selbstenthüllung versteht man die bewusste Bereitstellung von Informationen über die eigene Person, die dem Kommunikationspartner ansonsten nicht zugänglich sind. Selbstenthüllungen beinhalten Fakten über das eigene Leben, Denken und Fühlen Die Wirkung von Selbstenthüllungen hängt mit dem Gefühl der Verpflichtung gegenüber dem Gleichheitsprinzip zusammen. Der Empfänger der Botschaft fühlt sich verpflichtet, die Selbstenthüllung eines Kommunikationspartners mit einer ungefähr gleichwertigen persönlichen Information zu erwidern Die genaue „Dosierung“ von Selbstenthüllungen ist allerdings ein sensibler Vorgang Susanna Lopez Seite 27 29.02.2012 Der Einfluss sozialer Beziehungen auf kognitive, emotionale und somatische Prozesse: Beziehung und Gesundheit: Menschen, die stärker sozial eingebunden sind, sind auch glücklicher (für einen Überblick z.B. Argyle, 1987; Myers & Diener, 1995) So fand eine Metaanalyse von Wood, Rhodes und Whelan (1989), dass verheiratete Personen durchschnittlich zufriedener als unverheiratete Menschen sind Nicht auszuschließen ist die Wirkung von dritten Variablen, die sowohl Einfluss auf das psychische Wohlergehen nehmen, als auch auf Merkmale von Beziehungen (Prädispositionen, Persönlichkeitseigenschaften) Menschen berichten, dass sie in Gesellschaft unabhängig von ihrer genetischen Disposition eine positivere Stimmung haben als Menschen, die allein sind Eine Veränderung der Stimmung ist für die Zeit nach Verlassen oder Aufsuchen anderer Personen feststellbar („experience sampling“ Methode, Larson & Csikszentmihalyi, 1983) Experience sampling method: Bei dieser Untersuchungsmethode werden Probanden gebeten, ihre Alltagsempfindungen in Echtzeit festzuhalten. In unregelmäßigen Abständen erhalten sie dann über den Tag oder einen längeren Zeitraum hin weg Signale (über eine programmierte Uhr o.ä.), die sie zum Verwenden des Notizbuches auffordern. Einsamkeit: Einsamkeit lässt sich als eine sowohl emotionale als auch kognitive Reaktion auf eine Diskrepanz zwischen der tatsächlichen Anzahl sozialer Beziehungen und ihrer Qualität auf der einen Seite und der gewünschten Anzahl und Qualität auf der anderen Seite definieren. Menschen, die es vorziehen, allein zu sein und die Zurückgezogenheit suchen fühlen sich nicht einsam (Burger, 1995). Ursachen für Einsamkeit können u. a. mangelnde soziale Fähigkeiten sein, oder aber der individuelle Bindungsstil (siehe nächster Abschnitt) Studien kamen übereinstimmend zu dem Schluss, dass eine stärkere Einbindung in soziale Netzwerke mit besserer Gesundheit und einer geringeren Sterblichkeitsrate assoziiert ist (für einen Überblick: Berkman, 1995 Dabei rückten strukturelle und funktionelle Merkmale sozialer Unterstützung in den Vordergrund Während die Untersuchung struktureller Merkmale z.B. den Einfluss der Größe des sozialen Netzwerks auf die Gesundheit prüfte oder auch die Häufigkeit sozialer Kontakte, befasste sich die funktionale Analyse mit den Bedürfnissen und Zielen, die mit sozialen Beziehungen verknüpft sind In diesem Zusammenhang konnten drei grundlegende Funktionen sozialer Unterstützung ausgemacht werden: 1. emotionale Unterstützung (Zuneigung, Intimität, Bindung, Wertschätzung usw.) 2. Unterstützung bei Bewertung und Entscheidungsfindung (Anleitung und Beratung, Informationen, Feedback usw.) 3. instrumentelle Unterstützung (materieller oder finanzieller Beistand) Die negativen Folgen unzureichender Bedürfnisbefriedigung auf diesen Dimensionen für z.B. das Immunsystem wurden bereits dokumentiert (z.B. Uchino, Cacioppo & Kiecolt-Glaser, 1996 Mentale Repräsentation von Beziehungen: Bereits in Kapitel 3 haben wir darauf hingewiesen, dass die individuelle Wahrnehmung der sozialen Wirklichkeit von den Wissensstrukturen beeinflusst wird, die wir erworben haben, sowie von grundlegenden Bedürfnissen wie dem nach Konsistenz oder positiver Selbstbewertung Auch Beziehungen sind Gegenstand der kognitiven Reflexion und Bewertung Eindrücke über und Erfahrungen mit der anderen Person bilden den Kern für sogenannte Beziehungsschemata, die nach Baldwin (1992) drei Komponenten beinhalten: ein Selbst-Schema, das das Selbst in der betreffenden Interaktion oder Beziehung betrifft (wie man sich selbst wahrnimmt oder in der Situation erlebt) ein Partner-Schema, das die Eigenschaften des Beziehungspartners beschreibt ein Skript, das die erwartete Abfolge von Interaktionssequenzen enthält, die auf Grundlage von Interaktionen mit dieser Person in der Vergangenheit angelegt wurde (äußerliche beobachtbare, aber auch Annahmen über den inneren Zustand von Selbst und Partner) Beziehungsschemata helfen dabei, das eigene Verhalten auf den Interaktionspartner abzustimmen und Vorhersagen über den wahrscheinlichen Ausgang einer Interaktion zu machen Susanna Lopez Seite 28 29.02.2012 Ein Ausgangspunkt neuerer Forschungsansätze ist die Unterscheidung unterschiedlicher Bindungsstile, wie sie von Ainsworth (1978) zur Beschreibung der Bindung von Kleinkindern an ihre primären Bezugspersonen beschrieben wurde 1. sicherer Bindungsstil 2. vermeidender Bindungsstil. 3. ängstlich/ambivalenter Bindungsstil Hazan und Shaver (1987) vertraten die Auffassung, dass romantische Beziehungen viele derselben Funktionen erfüllen, die in der Kindheit von der Beziehung des Kindes zur Bezugsperson erfüllt wurden die drei Bindungsstile nach Ainsworth (1978) auch für die Beschreibung von Beziehungen zwischen Erwachsenen herangezogen werden könnten Dieses konnte bestätigt werden und wurde später noch einmal gefunden (Mickelson et al., 1997) Bindungsstile sind über die Zeit veränderbar. Sie unterliegen dem Einfluss von Erfahrungen und Erlebnissen, die Menschen in ihren aktuellen oder vergangenen Beziehungen gemacht haben So konnte z.B. eine Untersuchung von Kirkpatrick und Hazan (1994) zeigen, dass 30% der Teilnehmer einer früheren Studie nach vier Jahren einen anderen Beziehungsstil pflegten Liebesbeziehungen: Partnerwahl Gegenseitige Attraktion führt nicht automatisch zu einer Liebesbeziehung. Gibt es also zusätzliche Hinweisreize oder Merkmale, die wir bei der Wahl eines potentiellen Sexualpartners beachten? Forscher, die sich mit dieser Frage beschäftigten, stellten fest, dass Frauen und Männer gleichermaßen solche Partner in Liebesbeziehungen bevorzugen, die ihnen selbst sehr ähnlich sind (der aus der Biologie entlehnte Begriff der „positiven assortativen Paarung“ wird mitunter in der Literatur verwendet, um diesen Umstand zu beschreiben) So berichtet Buss (1985) eine Reihe von Merkmalsdimensionen für die der Zusammenhang zwischen romantischen Partnern besonders hoch war: Alter, Bildung, Religion und ethnischer Hintergrund Man muss hier aber einschränkend anmerken, dass das soziale Umfeld einer Person von dieser aktiv mit gestaltet wird Geschlechtsspezifische Asymmetrien Ein Mann kann im Prinzip viel mehr Kinder zeugen, als eine Frau gebären kann. Frauen können nur eine begrenzte Zeit Kinder gebären, Männer bis ins hohe Alter Kinder zeugen. Frauen sind sich ihrer Elternschaft sicher, Männer nicht. Aus diesen Asymmetrien lassen sich folgende Annahmen über geschlechtsspezifische Unterschiede bei der Partnerwahl ableiten: Männer haben mehr Interesse an unverbindlichen sexuellen Kontakten. Männer haben mehr Interesse an einer großen Zahl von Geschlechtspartnern. Männer sind bei unverbindlichen sexuellen Kontakten weniger wählerisch. Männer bewerten bei Frauen Zeichen von Jugend und Fruchtbarkeit hoch Frauen bei Männern eher die Ressourcen, die sie für Kinder bereitstellen können. Männer reagieren eifersüchtiger auf sexuelle Seitensprünge der Frau, Frauen eher auf enge emotionale Beziehungen des Mannes. Untersuchung von Buss (1989) an 37 kulturell unterschiedlichen Stichproben aus 27 Ländern mit insgesamt mehr als 10.000 Personen: Männer bevorzuge im Durchschnitt (- 2,66J) jüngere Partnerinnen Frauen dagegen ältere (+3,42J.) Männer legen auf das Aussehen der Partnerin mehr Wert als Frauen auf das Aussehen der Männer. Die Diskussion um diese neue Sicht auf das Phänomen der Partnerwahl wurde kontrovers und heftig geführt. Gegner dieser Perspektive versuchten mittels alternativer Erklärungen die Befunde von Buss und anderen Anhängern soziobiologischer Ideen zu entkräften. Alice Eagly (1987) verwies auf die Bedeutung sozialer Strukturen für Geschlechtsunterschiede im Verhalten hin Sie legte dar, dass die sozialen Positionen, die Frauen und Männer in einer Gesellschaft einnehmen können, zu unterschiedlichen Rollenerwartungen geführt haben, die an Frauen und Männer herangetragen werden Das Verhalten wird dabei von Geschlechtsrollenbildern beeinflusst, sozialen geteilten Vorstellungen darüber, über welche erwünschten Eigenschaften und Fähigkeiten Frauen oder Männer verfügen Susanna Lopez Seite 29 29.02.2012 sollten. Diese Bilder wirken im Sinne von Geschlechtsstereotypen und damit verbundenen Verhaltenserwartungen von außen auf uns ein Eagly schlussfolgerte, dass Geschlechtsunterschiede im Verhalten vor dem Hintergrund dieser Theorie eher die jeweiligen gesellschaftlichen Zustände widerspiegeln, als dass sie Schlüsse auf biologische Prädispositionen zuließen. Bei der Partnerwahl seien Frauen und Männer daran interessiert, einen Partner zu finden, dessen Kompetenzen ihre eigenen ergänzen, insbesondere in Bereichen, die aufgrund der gesellschaftlichen Rollenerwartungen für das eigene Geschlecht nur eingeschränkt zugänglich sind Dieser Überlegung gingen Eagly und Wood (1999) nach, indem sie die Daten von Buss (1989, siehe oben) noch einmal analysierten. Wie sich zeigte, verringerten sich die Unterschiede zwischen den Präferenzen von Männern und Frauen mit zunehmender Gleichstellung der Geschlechter Die Diskussion über die Stärke des Einflusses biologischer und gesellschaftlicher Determinanten bei der Partnerwahl hält an. Die Schwierigkeit besteht letztlich darin, kulturelle Einflüsse und volutionäre Einflüsse zu trennen, um so ein klareres Bild von der tatsächlichen Bedeutung evolutionärer Faktoren zu erhalten Liebe Jemanden sehr zu mögen bedeutet nicht gleichsam, sie oder ihn zu lieben. Dies bedeutet aber auch, dass Liebe und gegenseitige Zuneigung nicht dieselben Ursachen haben müssen Fehr und Russel (1991) baten die Teilnehmer an ihrer Studie darum, alle Varianten der Liebe zu notieren, die ihnen einfielen. Beachtliche 93 Arten der Liebe wurden so zusammengetragen, von denen die „mütterliche Liebe“ von den Teilnehmern als die für den Begriff „Liebe“ typischste bewertet wurde, dicht gefolgt von der Liebe von Eltern zu ihrem Kind, romantischer Liebe usw. Die Autoren stellten damals fest, dass die Definition von Liebe in unserer Alltagssprache komplex sei und obendrein unscharf in der Abgrenzung zu anderen, ähnlichen Erfahrungen Ein verbreitetes Klassifikationssystem der Liebe wurde von John Alan Lee vorgeschlagen (1973) • Nach Lee: drei primäre und drei sekundäre Liebesstile. Die sekundären Liebesstile ergeben sich aus der Mischung der primären Liebesstile. Primäre Liebesstile: Romantische Liebe (Eros) unmittelbare Anziehung durch die geliebte Person, Liebe auf den ersten Blick, Aussehen des Partners und sexuelle Leidenschaft sind wichtig. Spielerische Liebe (Ludus) interpersonelle Orientierung richtet sich auf sexuelle Freiheit und Verführung, kurzfristige Beziehungen, wenn Partner nicht dabei ist - wird geflirtet Freundschaftliche Liebe (Storge) entsteht aus Freundschaft, wird durch gemeinsame Interessen und Aktivitäten bestimmt, Befriedigung bei Ausführung dieser Aktivitäten Sekundäre Liebesstile Besitzergreifende Liebe (Mania) Variante der romantischen Liebe, Idealisierung und Verbundenheit der Besitzansprüche mit starken Gefühlen, Kennzeichnung sowohl durch positive Gefühle (Verschmelzung mit dem Partner) als auch negative Gefühle (Eifersucht) Pragmatische Liebe (Pragma) steht in der Gefühlsintensität im Gegensatz zu der besitzergreifenden Liebe, rationale Begründung, dient der Herstellung von wünschenswerten Lebensbedingungen Altruistische Liebe (Agape) beinhaltet die Opferbereitschaft für den Partner, Personen sind bereit die eigenen Wünsche zurück zustellen und damit das Wohlergehen des Partners zu fördern. Sternberg (1986; 1987) unternahm den Versuch, die Dimensionen zu identifizieren, die den mit Liebe assoziierten Gefühlen und Kognitionen zugrunde liegen Trianguläre Theorie der Liebe: Jede Art von Liebe setzt sich aus einer jeweils unterschiedlichen Gewichtung der 3 Komponenten zusammen: o Leidenschaft → romantische Beziehung, physische Anziehung und sexuelle Befriedigung o Intimität → Gefühle der Nähe, Vertrautheit und der Zusammengehörigkeit o Entscheidung für den Partner / Verpflichtung zur Erhaltung durch Bindung, Fürsorge und Treue ⇒ Kombinationsmöglichkeiten lassen die Beschreibung unterschiedlicher Arten von Liebe zu: romantischer Liebe → Kombination von Intimität und Leidenschaft (bei Abwesenheit von Bindung) o Susanna Lopez Seite 30 29.02.2012 o o partnerschaftliche Liebe → Kombination von Intimität und Bindung (bei Abwesenheit von Leidenschaft) vollständige Liebe → gleichzeitige Vorhandensein aller drei Komponenten Für die Zufriedenheit der Partner ist die Übereinstimmung in der Beziehungswahrnehmung wichtig. Voraussetzung ist Empathie → möglichst Übereinstimmung der Partner in ihrer Gewichtung von Intimität, Leidenschaft und Commitment, um eine möglichst hohe Zufriedenheit zu erlangen o o Es ist zu beachten, dass es sich bei diesen Varianten um Idealtypen handelt. In der Realität basieren Liebesbeziehungen nicht selten auf Mischformen, da die Komponenten dieses Modells unterschiedlich stark ausgeprägt sein können Zu Beginn haben wir darauf hingewiesen, dass Liebe und Zuneigung offenbar verschiedene Reaktionen auf eine soziale Beziehung darstellen Elaine Hatfield (1988) macht daher eine ganz grundlegende Unterscheidung zwischen zwei Formen der Liebe; der leidenschaftlichen Liebe einerseits und der kameradschaftlichen Liebe andererseits Leidenschaftliche Liebe ist demzufolge ein intensiver emotionaler und oft auch erotischer Zustand, geprägt durch erhöhte physiologische Erregung und die Überzeugung, dass diese Erregung durch die Person verursacht wurde, der die Liebe gilt. Aber wie sicher können wir sein, dass eine Partnerin oder ein geheimnisvoller Unbekannter in der Disco tatsächlich für diese Erregung verantwortlich sind? Definition: Missattribution: Hier ein Erregungstransfer, bei dem die durch einen ersten Stimulus hervorgerufene Erregung auf einen zweiten Stimulus transferiert wird (z.B. eine attraktive Person), so dass dieser zweite Stimulus fälschlicherweise als Ursache wahrgenommen wird Feldstudie (Dutton & Aron, 1974): Brückenversuch mit Männer und attraktiven Frauen Männer, die die Hängebrücke überquert hatten, wählten diese Nummer im Laufe der nächsten Tage häufiger als Männer, die die sichere Brücke genommen hatten, allerdings nur dann, wenn sie die Nummer von einer attraktiven jungen Frau erhalten hatten Auch andere Studien konnten zeigen, dass körperliche Erregung oder Anstrengung emotionale Reaktionen intensivierte (z.B. White at al., 1981). Diese Ergebnisse scheinen auch die Alltagsbeobachtung zu bestätigen, dass sich Menschen scheinbar mit Vorliebe in schwierigen, turbulenten Zeiten verlieben Viele Menschen würden wohl zustimmen, dass Sexualität dieser Liebesform doch überhaupt erst das Leidenschaftliche verleiht Leidenschaftliche Liebe ohne Sex also undenkbar? Und was ist mit Heirat? „Stellen Sie sich vor, ein Mann oder eine Frau hätte alle anderen Eigenschaften, die Sie sich wünschen, würden Sie diese Person heiraten, obwohl Sie nicht in sie verliebt sind?“ Diese Frage beantworteten 1967 35% der befragten Männer und 76% der Frauen mit ja. 20 Jahre später bejahten dies noch 14% der Männer und 20% der Frauen (Simpson et al., 1986). Susanna Lopez Seite 31 29.02.2012 Was ist nun andererseits kameradschaftliche Liebe? Hatfield et al. Beschreiben sie als eine partnerschaftliche Beziehung, die durch Sicherheit, Vertrauen und Stabilität geprägt ist Im Vergleich zur leidenschaftlichen Liebe ist kameradschaftliche Liebe weniger intensiv, dafür aber anhaltender (Sprecher & Regan, 1998). Prägend für kameradschaftliche Liebe ist ein hohes Maß an Selbstenthüllung Zumindest in westlichen Kulturen ist die Tendenz zur Selbstenthüllung bei Frauen stärker ausgeprägt als bei Männern (Dindia & Allen, 1992) Folglich bewerteten Frauen aus diesem Kulturkreis Freundschaften zu anderen Frauen auch höher als Männer ihre gleichgeschlechtlichen Freundschaften. Dieser Geschlechtsunterschied konnte in einer chinesischen Stichprobe nicht gefunden werden (Wheeler et al., 1989) Erhalt und Auflösung von Beziehungen: Stabilität von Beziehungen Im Mittelpunkt der Forschung zur Stabilität von Beziehungen standen sehr häufig Liebesbeziehungen oder Ehen. Anders als bei z.B. freundschaftlichen Beziehungen lässt sich bei diesen Beziehungsformen ein Auflösungszeitpunkt relativ klar definieren, ab dem die Beziehung nicht länger aufrechterhalten wird Investitionsmodell von Caryl Rusbult (z.B. Rusbult, Olsen, Davis, & Hannon, 2001). Das Modell beruht auf einer Erweiterung klassischer austauschtheoretischer Überlegungen. Im Mittelpunkt des Modells steht das Konzept des „Commitment“ gegenüber einer bestehenden Beziehung Definition: Commitment: Die innere Festlegung auf eine Beziehung. Commitment beinhaltet die Absicht, die Beziehung aufrechtzuerhalten (Verhaltenskomponente), ein Gefühl der affektiven Bindung an die Beziehung (emotionale Komponente) und die Orientierung, sich und den Beziehungspartner auch zukünftig als Paar zu sehen (kognitive Komponente). Rusbult zufolge hängt die Stärke des Commitment von drei unabhängigen Faktoren ab: Zufriedenheit: Das Commitment gegenüber einer Beziehung ist umso stärker, je zufriedener die Person mit der Beziehung ist. Diese Prozesse und die zugrunde liegenden Variablen sind nicht stabil in ihrer Wirksamkeit. Alternativen: Das Commitment gegenüber einer Beziehung sinkt, wenn die Person attraktive Alternativen zur bestehenden Beziehung wahrnimmt. Diese können beispielsweise darin bestehen alleine oder in einer anderen Partnerschaft zu leben (Buunk ,1987) Investitionen: Unter Investitionen werden Faktoren verstanden, die unmittelbar mit der Beziehung verknüpft sind und dadurch die Beendigung einer Beziehung kostspielig machen. Hohe Investitionen und eine Vielzahl an geschätzten gemeinsamen Ressourcen erhöhen das Commitment gegenüber der Beziehung unabhängig von der Höhe der Zufriedenheit oder der Qualität der Ressourcen, da sie die Kosten des Beendens der Beziehung steigern. Die Bedeutung dieser drei Faktoren – Zufriedenheit, Alternativen und Investitionen für die Stärke des Commitment – und darüber vermittelt, die Stabilität oder Instabilität von Beziehungen, wird durch eine Vielzahl von empirischen Untersuchungen unterstützt (z.B. Rusbult & Buunk, 1993) Beziehungskonflikte Kommunikationsprobleme sind dabei nicht nur häufige Ursache für Konflikte, sondern können auch der Lösung des Problems im Wege stehen Zwei Kommunikationsmuster scheinen besonders häufig in gestörten Beziehungen Aufzutreten: Reziprozität negativer Affektivität (negative affect reciprocity): Dieses Muster folgt einem titfor-tat Prinzip (Gleiches mit Gleichem). Diese Form emotionaler Reziprozität ist nicht auf Paare in Konfliktsituationen beschränkt, allerdings ist sie bei solchen Paaren besonders stark ausgeprägt o Mitteilungsbedürfnis / Rückzugs Interaktionsmuster (demand / withdraw interaction pattern). Diesem Muster liegen geschlechtsspezifische Unterschiede bei der Reaktion auf Konflikte zugrunde: Frauen expressiver, berichten auch intensivere Emotionen (Grossman & Wood, 1993) Männer eher Rückzug, Problem wird rationalisiert ⇒ Wunsch der Partnerin nach Kommunikation wird so oft nicht erfüllt o Susanna Lopez Seite 32 29.02.2012 Per se sind beide Strategien weder besser noch schlechter geeignet, um mit einer Konfliktsituation umzugehen, das Problem entsteht hier aus der Diskrepanz zwischen den Strategien Abhängig davon, ob sie eher zufrieden oder unzufrieden mit ihrer Beziehung sind, neigen Menschen zu verschiedenen Attributionsmustern (Bradbury & Fincham, 1992) Partner in einer glücklichen Beziehung tendieren zu beziehungsdienlichen Attributionen Durch beziehungsdienliche Attributionen kann somit das Schlechte minimiert und das Gute maximiert werden. Für unglückliche Paare stellt sich das Muster genau andersherum dar, man spricht hier von distress-maintaining attributions, also Attributionen, die die Spannungen zwischen den Partnern erhalten, statt sie abzubauen. Trennung Wir haben auch schon betont, dass Beziehungen die menschliche Gesundheit sowohl positiv als auch äußerst negativ beeinflussen können. Unter diesem Gesichtspunkt und vor dem Hintergrund des gesellschaftlichen Wandels, der sich z.B. auch durch stark erhöhte Scheidungsraten im Vergleich zu vergangenen Jahrzehnten ausdrückt, hat die Forschung zur Auflösung von Beziehungen neuen Aufschwung erhalten Es lässt sich festhalten, dass sich Scheidung stark negativ auf das Wohlergehen der Kinder (Amato & Keith, 1991) auswirkt und auch für die Geschiedenen selbst eine verminderte Gesundheit (körperlich wie psychisch) festgestellt werden konnte Unklarheit: Scheidung = Stressor für die negativen Effekte oder eher die Abwesenheit von ehelichen Nutzenfaktoren Interessant ist der Befund, dass Geschiedene auch nachdem sie erneut geheiratet haben eine höhere Sterblichkeitsrate haben als Personen, die sich in einer stabilen Ehe befinden. Allerdings geht es ihnen besser als den Menschen, die nach der Scheidung Single bleiben (Hemstrom, 1996) Neuere Untersuchungen differenzieren und relativieren den Befund von Hemstrom, indem sie weitere Faktoren bei der Trennung mit berücksichtigen Linda Waite und ihre Kolleginnen (2009) gingen z.B. der Frage nach, ob sich das Wohlbefinden unglücklich Verheirateter nach einer Trennung nicht eher verbessert Die soziale Kognitionsforschung hat sich auch mit der mentalen Repräsentation der Scheidung bei den Betroffenen auseinandergesetzt Personen, die retrospektiv zu ihrer Trennung befragt wurden, sahen sich selbst mehrheitlich in der aktiven Rolle. Sie gaben also an, die Trennung im Vergleich zu ihrem Partner gewollt zu haben, Gray und Silver (1990). Zudem nahmen sich jeweils beide ExPartner eher in der Rolle des Opfers wahr Die individuelle Wahrnehmung, selbst aktiv die Scheidung herbeigeführt zu haben, wird mit dem Bedürfnis nach Kontrolle assoziiert. In der genannten Untersuchung war diese Kontrollüberzeugung mit weniger Bedauern, weniger psychologischem Distress und einer besseren Bewältigung der Situation korreliert Während einige Beziehungen absichtlich und willentlich aufgelöst werden können, stellt auf der anderen Seite der Tod eines Partners die häufigste Ursache für ein unfreiwilliges Beziehungsende da Die weitverbreitete Annahme, dass ein Trauerfall tiefgreifende und womöglich andauernde psychologische Belastungen und Gesundheitsschädigungen mit sich bringt, wurde besonders gründlich erforscht Stroebe und Stroebe schlagen in einem Überblicksartikel zu diesem Thema (1993) die folgende Verlaufsbeschreibung emotionaler und physischer Reaktionen im Anschluss an einen Todesfall vor: • Die Zeit unmittelbar nach dem Todesfall ist in der Regel durch große Trauer, Depression, Verlustgefühle und eine umfassende Störung der kognitiven und behavioralen Aktivitäten geprägt. • Auch nach sechs Monaten ist die psychologische Belastung noch beträchtlich; der Zustand verbessert sich im Verlauf der folgenden 12 bis 18 Monate jedoch merklich und ist nach 2 – 3 Jahren überwunden – gleiches gilt für körperliche Beschwerden • Die Sterblichkeitsrate bei den hinterbliebenen Partnern erreicht einen Höhepunkt in den Monaten im Anschluss an den Todesfall und langt nach etwa 2 – 3 Jahren wieder auf Normalniveau an Die Allgemeingültigkeit dieser Beobachtungen kann jedoch infrage gestellt werden Camille Wortman und ihre Kollegen (z.B. Wortman, Silver & Kessler, 1993) haben teils widersprüchliche Daten gefunden, die nahelegen, dass die Folgen des Verlustes auch stark von den individuellen Überzeugungen und Einstellungen der Betroffenen abhängig sind und keinesfalls bei allen Menschen die gleichen Reaktionen zu beobachten sind Decken sich mit Beobachtungen aus der Stressforschung (Copingstrategien) Susanna Lopez Seite 33 29.02.2012 Kapitelzusammenfassung Wechselseitige Attraktion ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass Menschen enge Beziehungen zueinander aufbauen. Soziale Beziehungen haben Einfluss auf das physische und psychische Wohlbefinden. Allgemein lassen sich interpersonale Beziehungen anhand der Normen oder Prinzipien, nach denen das wechselseitige Geben und Nehmen von Ressourcen erfolgt, unterscheiden. Während sich in Austauschbeziehungen der Ressourcenaustausch am Prinzip der Gleichheit orientiert, orientieren sich Menschen in Gemeinschaftsbeziehungen an den Bedürfnissen ihrer Interaktionspartner. Enge Freundschaften haben in der Regel den Charakter von Gemeinschaftsbeziehungen. Beziehungsschemata sind kognitive Repräsentationen spezifischer Beziehungen, deren Nutzen in der Antizipation von Verhalten des Beziehungspartners und der Regulation des eigenen Handelns liegt. Diese Schemata können teils bereits in der Kindheit angelegt werden, sind aber durch Lebenserfahrungen formbar. Die Stabilität einer Beziehung hängt von der Stärke der inneren Festlegung der Partner auf die Beziehung ab. Liebe ist ein besonders komplexes Phänomen interpersonaler Beziehungen, das sich in Bezug auf die große Variation an beobachtbaren Liebesstilen und -formen näherungsweise durch eine Reihe von Taxonomien beschreiben lässt. Eine sehr grundlegende Unterscheidung trennt kameradschaftliche und leidenschaftliche Liebe. Beziehungskonflikte sind oft durch dysfunktionale Kommunikationsmuster geprägt. Trennungen haben sowohl negative emotionale als auch physische Konsequenzen, denen Menschen zum Teil mit kognitiven Bewältigungsstrategien begegnen können. 6) Selbst und Identität Selbsterkenntnis: Defintion: Selbst und Selbstwertgefühl: In einem basalen sozialpsychologischen Sinn bezieht sich der Begriff des Selbst auf die Gesamtheit des Wissens, über das eine Person bezüglich ihrer selbst und ihres Platzes in der sozialen Welt verfügt. Selbstwertgefühl bezeichnet die Bewertung des Selbst auf der Dimension negativ – positiv. Der Begriff „Selbst“ wird in der sozialpsychologischen Literatur häufig synonym zum Begriff der „Identität“ verwendet Dieser Sprachgebrauch reflektiert die Tatsache, dass die sozialpsychologische Forschung zum Selbst v.a. durch zwei unterschiedliche Forschungstraditionen geprägt wurde: 1) soziale Kognitionsforschung verankerte Selbstkonzeptforschung nordamerikanischer Prägung 2) Ansatz zur sozialen Identität, der sich in der europäischen Sozialpsychologie aus der Forschung zu Intergruppenprozessen entwickelt Quellen selbstbezogenen Wissens: Wichtig Die sozialpsychologische Forschung nimmt an, dass die Selbstwahrnehmung einen Spezialfall der Personenwahrnehmung darstellt. Menschen ziehen zur Konstruktion ihres Selbst Informationen aus unterschiedlichen Quellen heran; die Integration dieser Informationen wird durch Informationsverarbeitungsprozesse und motivationale Prozesse beeinflusst. Eine zunächst intuitiv plausible Antwort auf die Eingangsfrage könnte lauten, dass Selbsterkenntnis aus der sorgfältigen Analyse eigener Gedanken, Motive, Gefühle, Einstellungen etc. resultiert Eine solche Introspektion unterliegt allerdings einer Reihe von Einschränkungen Menschen sind motiviert, einen positiven und konsistenten Eindruck von sich selbst aufzubauen oder aufrechtzuerhalten Daher tendieren sie dazu, selektiv Eigenschaften, Merkmale etc. zu erinnern oder zu betrachten, die diese Funktionen erfüllen Zudem sind nicht alle Informationen bezüglich der eigenen Person zu jedem Zeitpunkt zugänglich oder abrufbar (z.B. sind negative oder widersprüchliche selbstbezogene Informationen oft weniger zugänglich) – außerdem: implizierte Einstellung = unbewusst Sozialpsychologen gehen daher davon aus, dass Introspektion nur in eingeschränktem Maße geeignet ist, zutreffendes Wissen über die eigene Person zu generieren Stattdessen wird angenommen, dass dieser Prozess Individuen v.a. dazu dient, ein subjektiv stimmiges und positives Selbstbild zu entwerfen Die Selbstwahrnehmungstheorie von Daryl Bem (1972) postuliert, dass Menschen nicht nur in sich „hineinsehen“, um Wissen über sich selbst zu erwerben, sondern dass sie unter bestimmten Umständen auch ihr eigenes Verhalten als Informationsquellen für ihre Eigenschaften, Einstellungen Susanna Lopez Seite 34 29.02.2012 etc. heranziehen - wie ein externer Beobachter, der auf der Grundlage des beobachtbaren Verhaltens auf seine eigenen individuellen Merkmale und inneren Zustände schließt Freiwilliges Verhalten interne Zustände Situative Zwänge externale Faktoren Eine sozial bedingten Selbstkonzeption wurde von dem Soziologen Charles Cooley formuliert (Cooley, 1902) Menschen bilden ihre Vorstellungen über sich selbst, indem sie sich in ihre sozialen Interaktionspartner hineinversetzen und ihre eigene Person aus deren Sicht definieren und bewerten „looking-glass self“ (d.h. das Spiegel-Selbst) Das Selbst bzw. die Identität einer Person entsteht dieser Auffassung gemäß also nicht aus der bloßen Reflektion einer Person über sich selbst, sondern es bedarf der sozialen Interaktion und eines sozialen Gegenübers Für den Soziologe George H. Mead (1934) bedarf es nicht unbedingt eines tatsächlichen Interaktionspartners, der als Spiegel für die eigene Person fungiert, sondern es ist ausreichend für die Selbsterkenntnis , sich selbst aus den Augen eines „generalisierten Anderen“ zu betrachten – einer abstrakten Instanz, die die Vorstellungen und Normen der Gesellschaft repräsentiert („symbolischer Interaktionismus“) Wichtig Eine Kernannahme der sozialpsychologischen Forschung zum Selbst besteht darin, dass das Wissen über die eigene Person genuin sozialer (soziale Wurzeln) Natur ist Die empirische Forschung weist allerdings darauf hin, dass Menschen sich selbst typischerweise weniger so sehen, wie sie tatsächlich von anderen Menschen gesehen werden Stattdessen tendieren sie dazu, sich zu sehen, wie sie glauben, dass andere Personen sie sehen (z.B. Shrauger & Schoeneman, 1979) Während soziale Zuschreibungen im Kindesalter besonders relevant für die Ausbildung des eigenen Selbst sind, ist im Erwachsenenalter v.a. eine weitere Quelle selbstbezogener Information von Bedeutung – der soziale Vergleich mit anderen Personen Theorie der sozialen Vergleichsprozesse (Festinger, 1954): Die Theorie basiert auf der Prämisse, dass Menschen ein Bedürfnis danach haben, die Gültigkeit und Akkuratheit ihrer Wahrnehmungen, Einstellungen, Gefühle etc. zu überprüfen Der Theorie zufolge sollten sich Menschen v.a. dann mit anderen bezüglich ihrer individuellen Eigenschaften oder Fähigkeiten vergleichen, wenn keine objektiven (z.B. physikalischen) Maßstäbe existieren, an denen sie sich orientieren können, und sie selbst unsicher sind, wie hoch (oder gering) die individuellen Eigenschaften und Fähigkeiten auf dem jeweiligen Gebiet ausgeprägt sind Forschungsrelevant: mit wem sich Menschen vergleichen, um die Ausprägung ihrer Fähigkeiten (oder die Gültigkeit eigener Einstellungen) zu bestimmen (zum Überblick s. Suls & Wheeler, 2000) Die Forschung verweist hier zum einen auf die Rolle der wahrgenommenen Ähnlichkeit mit der Vergleichsperson hinsichtlich bestimmter kritischer Attribute Wenn das Ziel darin besteht, eigene Fertigkeiten oder Fähigkeiten zu verbessern, nehmen Menschen verstärkt aufwärtsgerichtete Vergleiche vor Wenn das Ziel hingegen darin besteht, das eigene Selbstwertgefühl zu stützen oder auszubauen, tendieren Menschen verstärkt dazu, sich bezüglich ihrer Leistung oder ihrer Eigenschaften mit Personen zu vergleichen, die schlechter sind als sie selbst, d.h., sie nehmen abwärtsgerichtete Vergleiche vor (z.B. Wood, Giordano-Beech, & Ducharme, 1999) Repräsentation, Struktur und Variabilität des Selbst Selbstschemata: Hazel Markus (1977) legte mit ihren paradigmatischen Forschungsarbeiten einen Grundstein für die (sozial)kognitionspsychologische Ausrichtung der Selbstkonzeptforschung Markus schlug vor, dass Informationen bezüglich der eigenen Person ebenso wie Informationen bezüglich anderer Personen in Form kognitiver Schemata gespeichert werden Definition. Selbstschemata: Aus vergangenen Erfahrungen abgeleitete kognitive Verallgemeinerungen über das Selbst, welche die Verarbeitung und Erinnerungen der durch Erfahrungen gewonnenen selbstbezogenen Informationen organisieren und steuern. Zwischen Fremdschemata (Wissen über andere) und Selbstschema Informationen) bestehen eine Reihe systematischer Unterschiede Susanna Lopez Seite 35 (selbstbezogenen 29.02.2012 o o o o Erstens sind Selbstschemata wesentlich detaillierter als Fremdschemata, da Personen mehr über sich selber als über andere Personen wissen. Menschen typischerweise bilden eine Vielzahl bereichspezifischer Teil- oder Subschemata aus – ein Körperselbstschema, Selbstschemata zu relevanten sozialen Rollen (Partner, Arbeitskollege, Mutter/Vater) Zweitens sind Selbstschemata auch funktional einflussreicher als Fremdschemata, da sie regulieren, welchen Informationen sich Menschen zuwenden, wie sie sie bewerten, wie sie sie speichern und weiterverarbeiten. Zusätzlich zu diesen Reaktionszeitunterschieden weisen Ergebnisse weiterer Studien darauf hin, dass Selbstschemata die Enkodierung und den Abruf schemakongruenter Informationen erleichtern Inkongruente selbstbezogene Informationen werden hingegen mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit enkodiert, lassen sich häufig schwerer aus dem Gedächtnis abrufen und erinnern, und diesbezügliche Urteile sind mit größerer subjektiver Unsicherheit behaftet Markus, Smith und Moreland (1985) zeigten beispielsweise, dass Männer mit einem ausgeprägten maskulinen Selbstschema, Maskulinität (und damit verbundene Attribute) stärker als Erklärungskonzept für das Verhalten anderer Männer heranziehen als Männer, für die Maskulinität im Hinblick auf das eigene Selbstbild von geringerer Bedeutung ist. Diese Ergebnisse sind repräsentativ für eine Vielzahl von Befunden, die demonstrieren, dass das Selbstschema Menschen einen interpretativen Bezugsrahmen zur Erklärung des Verhaltens anderer Personen liefert Selbstkomplexität: Patricia Linville (1985) ⇒ Menschen unterscheiden sich im Hinblick auf die Komplexität der Repräsentation ihres Selbst Diese Komplexität resultiert aus der Anzahl distinkter und voneinander unabhängiger Selbstaspekte, durch die das Selbst einer Person charakterisiert ist Während in Selbstschemata relativ zeitstabile und zentrale Informationen bezüglich der eigenen Person organisiert sind, beziehen sich Selbstaspekte auch auf weniger relevante oder zeitlich fluktuierende Merkmale einer Person Definition Selbstaspekte: Jede Rolle, Beziehung, Aktivität, Eigenschaft, Gruppenzugehörigkeit etc. einer Person, die Bestandteil ihrer Selbstrepräsentation ist, sowie die jeweils dazugehörigen kognitiven Informationen und affektiven Bewertungen. Manche dieser Aspekte stehen in einem engen kognitiven Zusammenhang (z.B. Sozialpsychologe und Wissenschaftler), während andere relativ unabhängig von einander sind (z.B. Wissenschaftler und Fußballfan). Der Grad der Selbstkomplexität resultiert aus der Anzahl von relativ von einander unabhängigen Selbstaspekten - bei niedriger Selbstkomplexität weist das Selbst einer Person nur relativ wenige und zudem stark miteinander verbundene Aspekte auf Wie Linville (1985) zeigen konnte, spielt die Selbstkomplexität im Zusammenhang mit der Emotionsregulation eine wichtige Rolle: Studie: Teilnehmer mit einer geringen Selbstkomplexität reagierten mit intensiveren Emotionen. Negative Rückmeldungen zu einem Aspekt betreffen dann auch einen anderen, da diese eng miteinander verwoben sind. Hohe Selbstkomplexität kann daher als psychologischer Puffer gegen die selbstwertbedrohlichen Folgen negativer Ereignisse fungieren, da bei Misserfolg oder einer negativen Bewertung eines Selbstaspekts nicht die Bewertung des gesamten Selbst in Mitleidenschaft gezogen wird Variabilität des Selbst: Die Selbstkonzeptforschung legt nahe, dass Menschen über einen ganzen Fundus an unterschiedlichen Selbstvarianten verfügen, die ihre Ursprünge in unterschiedlichen sozialen Beziehungen, Rollen etc. haben Allerdings sind nicht alle dieser Selbstvarianten gleichzeitig aktiviert. Welche dieser Selbstvarianten gerade aktiviert sind, hängt von ihrer chronischen und kontextspezifischen Zugänglichkeit ab Markus und Kunda (1987) vertreten die Auffassung, dass im Arbeitsgedächtnis jeweils nur die Teile des Selbstkonzepts aktiviert sind, die für die Verhaltenssteuerung und Informationsverarbeitung in einem bestimmten Kontext notwendig sind – dieser Teil wird von ihnen als Arbeitsselbstkonzept (working self-concept) bezeichnet In der Sozialpsychologie herrscht weitgehend Einverständnis darüber, dass die Selbstdefinition einer Person keine statische Größe ist, sondern mit dem sozialen Kontext variiert. Susanna Lopez Seite 36 29.02.2012 Inklusivitätsgrad des Selbst: Eine weitere wichtige sozialpsychologische Erkenntnis zum Selbst ist, dass sich Selbstdefinitionen nicht nur auf die eigene Person erstrecken, sondern, dass andere Personen in Abhängigkeit vom sozialen Kontext in die Definition des Selbst aufgenommen werden Der soziale Identitätsansatz, der auf der Theorie der sozialen Identität (Tajfel & Turner, 1986) bzw. ihrer Weiterentwicklung in Form der Selbstkategorisierungstheorie (Turner et al., 1987) beruht ist einer der einflussreichsten Forschungsperspektiven Personale vs. soziale Identität: Der Begriff personale Identität bezeichnet eine Selbstdefinition als einzigartiges und unverwechselbares Individuum, die auf einer interpersonalen (oder intragruppalen) Differenzierung auf der Basis individueller Merkmale beruht („ich“ vs. „du“ oder „ihr“). Der Begriff der sozialen Identität bezieht sich demgegenüber auf eine Selbstdefinition als austauschbares Gruppenmitglied, die aus einer intergruppalen Differenzierung zwischen Eigen- und Fremdgruppe auf der Basis gruppentypischer Merkmale resultiert („wir“ vs. „die“). Vertreter des sozialen Identitätsansatzes nehmen an, dass in dem Maße, in dem sich Menschen im Sinne ihrer sozialen Identität definieren, das Erleben und Verhalten dieser Person durch die in der entsprechenden Gruppe vorherrschenden Werte, Normen, Einstellungen etc. beeinflusst wird Wann und welche soziale Identität erlebens- und verhaltensrelevant wird, hängt a) von der sozial-kontextuellen Passung und b) der Bereitschaft der betreffenden Personen ab, eine entsprechende Identität zu übernehmen Aufgrund ihrer individuellen Erfahrungen können Menschen in unterschiedlicher Weise dazu prädisponiert sein, sich als Gruppenmitglied zu definieren Konstruktion eines konsistenten Selbstbilds: Die Annahme, dass die Selbstdefinition von Menschen situationsspezifisch und kontextabhängig ist, wird durch eine Fülle von Forschungsergebnissen gestützt. Dies wirft die Frage auf, warum Menschen dennoch den Eindruck haben, ihr Selbst sei relativ zeitstabil und in sich konsistent Tatsächlich haben Menschen ein starkes Bedürfnis nach einer Integration ihrer subjektiven Erfahrungen in ein stabiles und in sich stimmiges Selbstbild (Baumeister, 1998) Eine Reihe psychologischer Prozesse haben die Funktion, Stabilität und Konsistenz zu erzeugen: Eingeschränkte Zugänglichkeit Wenn eine bestimmte Variante des Selbst phänomenologisch in den Vordergrund rückt, sind andere Aspekte des Selbst weniger zugänglich, was die Wahrscheinlichkeit des Erlebens von Inkonsistenzen reduziert. Selektives Erinnern Eine Strategie, um eine stimmige und sinnvolle Lebensgeschichte wahrzunehmen, ist das selektive Erinnern von Erfahrungen (Verhaltensweisen, Merkmalen), die in dieses subjektive Narrativ passen bzw. das selektive Vergessen von widersprüchlichen und inkonsistenten Informationen (Greenwald, 1980). „Wegattribuieren“ das eigene Verhalten eher auf situative Faktoren, statt auf stabile Persönlichkeitseigenschaften zurückzuführen (Akteur-Beobachter-Divergenz). Die Attribution eigenen Verhaltens auf situative Faktoren ermöglicht es Personen, inkonsistente Verhaltensweisen, Einstellungen etc. als Resultat von Umwelteinflüssen zu interpretieren, statt es als Beleg für innere Widersprüchlichkeiten anzusehen. Konzentration auf Schlüsseleigenschaften wenn Menschen über sich selbst nachdenken, begrenzen sie das häufig auf Schlüsseleigenschaften, die sie von anderen unterscheiden und ihre Individualität ausmachen Susanna Lopez Seite 37 29.02.2012 Das Selbst in Aktion: exekutive Funktion ⇒ das Selbst steuert die Beziehung zwischen Mensch und Umwelt aktiv Selbstaufmerksamkeit und Selbstüberwachung: Das Phänomen, dass die menschliche Aufmerksamkeit einer Person entweder nach außen (die Umwelt) oder nach innen (das Selbst) gerichtet sein kann und die daraus resultierenden Konsequenzen für das Erleben und Verhalten sind zentraler Gegenstand der Theorie der objektiven Selbstaufmerksamkeit (z.B. Duval & Wicklund, 1972) Definition Objektive Selbstaufmerksamkeit: Der Zustand, in dem die eigene Person das Objekt der eigenen Aufmerksamkeit ist Eine zentrale Hypothese der Selbstaufmerksamkeitstheorie von Duval und Wicklund besagt, dass der Zustand der Selbstaufmerksamkeit die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Menschen negative Diskrepanzen zwischen ihrem Selbst und bestimmten Idealen und Standards entdecken ( z.B. Aufmerksamkeit auf die eigene Person lenken durch Spiegel, Kamera, Aufzeichnung der eigenen Stimme etc.) Es gibt zwei Strategien, um den durch negative Diskrepanzen ausgelösten, unangenehmen emotionalen Zustand zu regulieren: 1. Verminderung der Selbstaufmerksamkeit durch Aufmerksamkeitslenkung (z.B. gezielte Ablenkung oder Vermeidung entsprechender Auslösereize); 2. Verminderung der negativen Diskrepanz durch den Versuch, durch das eigene Verhalten die entsprechenden Standards oder Ideale zu erreichen Liegt eine positive Diskrepanz vor, entstehen positive Emotionen und gesteigertes Selbstwertgefühl Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass hinsichtlich des Ausmaßes in dem Menschen üblicherweise über sich nachdenken erhebliche interindividuelle Unterschiede bestehen – eine Persönlichkeitsvariable, die als dispositionelle Selbstaufmerksamkeit bezeichnet wird Eine mit der Disposition zur Selbstaufmerksamkeit eng zusammenhängende Persönlichkeitsvariable ist die Tendenz zur Selbstüberwachung (Snyder, 1974) ⇒ hohe Tendenz zur Selbstüberwachung = Orientierung an soziale Situationen im Hinblick auf die Regulation des eigenen Verhaltens (äußeren Hinweisreizen) ⇒ Geringe Selbstüberwachungstendenz = Orientierung an inneren Reizen bzw. den Eigenschaften, Persönlichkeitsmerkmalen, Einstellungen, die sie selbst in der gegebenen sozialen Situation als relevant erachten Selbstregulation: Definition Selbstregulation: Der Prozess der Kontrolle und Lenkung des eigenen Verhaltens, welcher der Erreichung angestrebter Ziele dient Eine der einflussreichsten Selbstregulationstheorien, die Selbstdiskrepanztheorie von Tory Higgins (1987), befasst sich mit der Rolle wahrgenommener Diskrepanzen zwischen dem tatsächlichen Selbst und bestimmten Standards für die Verhaltensregulation Ein wichtiger Ausgangspunkt der Theorie ist die Unterscheidung zwischen drei Selbstbildvarianten: 1. das aktuelle Selbst (wie man gegenwärtig ist), 2. das ideale Selbst (wie man gemäß eigener Wünsche und Ideale gerne sein möchte) und 3. das geforderte Selbst (wie man gemäß sozialer Erwartungen und Normen sein sollte) Das ideale und das geforderte Selbst dienen als Vergleichsstandards für das aktuelle Selbst Menschen sind bestrebt, das aktuelle Selbst sowohl mit dem idealen als auch dem geforderten Selbst in Einklang zu bringen Diskrepanzen zwischen aktuellem und gefordertem Selbst signalisieren das Eintreten negativer Konsequenzen (z.B. Strafe, Kritik), was Gefühle wie Angst, Nervosität oder Unruhe bewirken sollte. Diese Hypothesen wurden von Higgins und Mitarbeitern in einer Reihe von Untersuchungen bestätigt (s. Higgins, 1987) Higgins hat die Perspektive der Selbstdiskrepanztheorie im Rahmen der Theorie des regulatorischen Fokus weiterentwickelt (Higgins, 1999) Die Unterscheidung zwischen zwei motivationalen Orientierungen ist zentral: dem Promotionsfokus und dem Präventionsfokus Susanna Lopez Seite 38 29.02.2012 ⇒ Promotion („Vorankommen“) ⇒ Wünsche und Ideale sind das angestrebte Ziel ⇒ Prävention („Vermeidung“) ⇒ Ziele werden durch wahrgenommene Verpflichtungen definiert Die Theorie des regulatorischen Fokus hat einen weiteren Gültigkeitsbereich als die Selbstdiskrepanztheorie, da Selbstdiskrepanzen zwar als wichtige, aber nicht als einzige Determinanten für die beiden unterschiedlichen motivationalen Orientierungen angesehen werden (weitere Determinanten sind z.B. situative Anforderungen, Vorerfahrungen oder Gelegenheiten) Shah, Brazy und Higgins (2004) demonstrierten beispielsweise, dass die Ausrichtung des motivationalen Fokus auf Prävention zu einer erhöhten Nervosität im Intergruppenkontakt und Kontaktvermeidung führt Selbstregulation, Selbstkontrolle und verantwortungsvolles Entscheiden verbraucht innere Ressourcen – die exekutive Funktion des Selbst unterliegt also bestimmten Restriktionen und kann zur Selbst-Erschöpfung führen (Baumeister, 2002) Definition Selbsterschöpfung: Selbstregulation scheint (wie körperliche Aktivität) innere Ressourcen aufzubrauchen (vergleichbar mit Energie). Als Selbsterschöpfung wird eine vorübergehende Verringerung der Regulationsfähigkeit des Selbst verstanden Die für die Selbstregulation notwendigen Ressourcen erneuern sich offenbar – Erholung und positiver Affekt spielen hierbei eine wichtige Rolle. Allerdings sind die genauen psychologischen Prozesse, die die Regeneration der Fähigkeit zur Selbstregulation beschleunigen oder beeinträchtigen, bislang noch weitgehend ungeklärt Selbstwerterhöhung und Selbstwertschutz: Shelley Taylor und Jonathon Brown (1988) Menschen konstruieren sich systematisch unrealistisch positive Bilder über ihr Selbst o häufig schlechtere Erinnerungsleistungen bezüglich von Misserfolgen o attribuieren von Misserfolge auf äußere Umstände o Abwerten negative Aspekte Den Autoren zufolge handelt es sich bei dieser Selbstsicht um eine positive Illusion, d.h. eine Einschätzung, die zwar unrealistisch ist, aber eine wichtige Rolle für die seelische Gesundheit spielt Abraham Tesser (1988) unterstreicht in seinem Modell der Selbstwerterhaltung v.a. die Rolle von sozialen Vergleichsprozessen für die Regulation des Selbstwertgefühls. Wenn man sich bezüglich einer Leistung mit anderen vergleicht, kann dies sowohl zur Selbstwertsteigerung als auch zur minderung führen. Welche dieser Konsequenzen eintritt, ist Tesser zufolge u.a. von der persönlichen Relevanz der Vergleichsdimension so- wie der sozialen Nähe zur Vergleichsperson abhängig Person folgende Strategien verwenden: 1. versuchen, ihre eigene Leistung zu verbessern 2. sich von dem Freund zu distanzieren 3. die subjektive Bedeutung der Vergleichsdimension abwerten Ist die Vergleichsdimension, auf welcher der Freund besser abschneidet, hingegen für die Selbstdefinition nicht relevant, dann führt die Nähe zu dieser Person nicht zur Selbstbedrohung Eine weitere Strategie, durch die Menschen ihr Selbstwertgefühl regulieren, schützen oder auch ausbauen ist: Definition Selbstbehinderung: Unter „Selbstbehinderung“ wird die Strategie verstanden, bei Antizipation eines selbstwertbedrohlichen Misserfolgs selbst externale Gründe zu schaffen, auf die sich der Misserfolg bei seinem Eintreten attribuieren lässt. Wie schon oben angedeutet, können Strategien der Aufrechterhaltung bzw. des Schutzes des Selbstwertes dem Lernen aus Fehlern und Misserfolgen und damit dem Ausbau eigener Fähig- und Fertigkeiten im Wege stehen Kapitelzusammenfassung Das Selbst einer Person ist eine komplexe kognitive Struktur, das eine Vielzahl von bereichs- und kontextspezifischen Selbstschemata und unterschiedliche Selbstaspekte umfasst. Das in einem bestimmten Kontext aktivierte Arbeitsselbstkonzept reguliert, welchen Informationen sich Menschen zuwenden, wie sie sie bewerten, speichern und weiterverarbeiten. Susanna Lopez Seite 39 29.02.2012 Eine Reihe psychologischer Prozesse dienen der Funktion, einen subjektiven Eindruck von Stabilität und Selbstkonsistenz zu erzeugen. Aus sozialpsychologischer Sicht sind zwei (idealtypische) Varianten der Selbstdefinition besonders relevant: Selbstdefinition im Sinne personaler Identität und Selbstdefinition im Sinne sozialer Identität. Sozialpsychologen sehen im Wechsel der Selbstdefinition von personaler zu sozialer Identität einen entscheidenden psychologischen Prozess für die Erklärung von Gruppenphänomenen. Im Rahmen der Selbstregulation wird das aktuelle Selbst mit Formen der Selbstrepräsentation verglichen, die Ideale oder wahrgenommene Verpflichtungen repräsentieren, bei negativen Diskrepanzen resultieren negative Emotionen. Um ihr Selbstwertgefühl aufrechtzuerhalten oder zu steigern, verwenden Menschen unterschiedliche Strategien (z.B. abwärtsgerichtete soziale Vergleiche, Selbstbehinderung). 7 Einstellungen Seit ihrer Etablierung als akademische Disziplin ist die Erforschung von Einstellungen ein Kernthema der Sozialpsychologie. Ein Grund für dieses anhaltende Interesse besteht in der Annahme, dass Einstellungen menschliche Handlungen und Verhaltensentscheidungen leiten Einstellungen: Komponenten, Stärke, Funktionen: Definition Einstellung: Die Einstellung einer Person zu einem Objekt ist die subjektive Bewertung dieses Objekts. Einstellungsobjekte sind nichtsoziale oder soziale Stimuli (Produkte, Personen etc.), Verhaltensweisen (Rauchen, soziales Engagement etc.), Symbole (Flaggen, Embleme etc.) oder Begriffssysteme (Islam, Kommunismus etc.). Einstellungen lassen sich anhand zweier Dimensionen charakterisieren: 1. Ihrer Valenz (im Sinne von positiv oder negativ) 2. Ihrer Stärke (beobachtbar z.B. daran, wie schnell ein Einstellungsobjekt eine wertende Reaktion auslöst). Definition Überzeugung: bezieht sich in Abgrenzung zum Einstellungsbegriff auf die Informationen, das Wissen oder die Kognitionen, die eine Person mit einem Einstellungsobjekt verbindet. Über jedes Einstellungsobjekt kann man eine Reihe von Überzeugungen haben, die ihrerseits zu einer positiven oder negativen Einstellung gegenüber dem Objekt beitragen können. Einstellungskomponenten und –struktur: Sozialpsychologen gehen davon aus, dass Einstellungen eine kognitive, eine affektive und eine verhaltensbezogene Komponente aufweisen, die auf entsprechenden Erfahrungen im Umgang mit dem Einstellungsobjekt beruhen (Rosenberg & Hovland, 1960) Diesem Modell zufolge lässt sich die Einstellung gegenüber einem Einstellungsobjekt mathematisch als eine Summe von Erwartungs-X-Wert-Produkten modellieren: Wobei A0 die Einstellung (engl. attitude) gegenüber einem Objekt O ist und die Produkte bi ei die einzelnen Überzeugungen über O beschreiben. bi steht für die subjektive Wahrscheinlichkeit oder Meinungsstärke (belief strenght), e i steht dabei für die Bewertungen (evaluations) der i Eigenschaften oder Attribute von O Defintion Affektive Einstellungskomponente: Als affektive Komponente werden die Gefühle oder Emotionen bezeichnet, die eine Person mit einem Einstellungsobjekt assoziiert Sie spielen für die Herausbildung einer Einstellung eine wichtige Rolle: Treten positive Affekte auf, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine positive Einstellung manifestiert (und vice versa bei negativen Affekten) Klassische Konditionierung ist ein Lernprinzip, durch das Affekte oder Emotionen mit Einstellungsobjekten verbunden werden können Susanna Lopez Seite 40 29.02.2012 Untersuchungen zeigen, dass das Prinzip der klassischen Konditionierung die Einstellung gegenüber einem Objekt sogar dann beeinflussen kann, wenn der UCS unterhalb der Wahrnehmungsschwelle (d.h. unbemerkt vom Betrachter) in Verbindung mit dem CS präsentiert wird (z.B. Krosnick, Betz, Jussim, & Lynn 1992) Interessanterweise kann allerdings auch die bloße Häufigkeit der Konfrontation mit einem ursprünglich neutral bewerteten Einstellungsobjekt dazu führen, dass Menschen eine positive Einstellung gegenüber dem Objekt entwickeln. Dieses Phänomen wird auch als Mere-ExposureEffekt bezeichnet (Zajonc, 1968) Definition Mere-Exposure-Effekt: Das Phänomen, dass allein durch die mehrfache Darbietung eines neutralen Reizes eine positive Einstellung gegenüber diesem Reiz erzeugt werden kann. Eine Erklärung für den Mere-Exposure-Effekt besteht darin, dass das aus dem wiederholten Kontakt resultierende Gefühl der Vertrautheit Menschen offenbar als ein Hinweisreiz dafür dient, dass sie dem Objekt positiv (oder zumindest nicht negativ) gegenüberstehen, da sie es andernfalls – so die implizite Schlussfolgerung – schon längst gemieden hätten Defintion Konative Einstellungskomponente: Die konative oder verhaltensbezogene Komponente von Einstellungen bezieht sich auf Informationen bezüglich des Einstellungsobjekts, die aus dem eigenen Verhalten im Umgang mit diesem Objekt abgeleitet werden Menschen ziehen, wenn sie noch über keine feste Einstellung gegenüber einem Objekt verfügen, ihr eigenes Verhalten als eine Informationsquelle für ihre Einstellung heran – eine zentrale Annahme der Selbstwahrnehmungstheorie (Bem, 1972) In der Forschung bestehen unterschiedliche Auffassungen darüber, wie die positiven oder negativen Bewertungen, die auf kognitiven, affektiven oder konativen Informationen beruhen, repräsentiert sind Eindimensionale Konzeptionen gehen davon aus, dass positive und negative Informationen auf einer einzelnen Dimension (sehr positiv bis sehr negativ) abgespeichert werden Sportauto +++ +/- --- Bei der zweidimensionalen Konzeption wird hingegen davon ausgegangen, dass positive und negative Elemente auf getrennten Dimensionen (positiv vs. negativ) abgespeichert werden. Die zweidimensionale Konzeption ist der eindimensionalen insofern überlegen, als sie auch Einstellungsambivalenz erklären kann: Auf der positiven Dimension sind viele positive, auf der negativen Dimension viele negative Informationen abgespeichert, was dazu führt, dass die Person dem Objekt sowohl positiv als auch negativ (d.h. insgesamt ambivalent) gegenübersteht Sportautos negativ Verbrauchen viel Sprit Geschwindikeitsbeschränkungen, man sowieso nicht so schnell fahren wie man will Man fühlt sich als Held auf der Autobahn Sind unpraktisch: wenig Platz Positiv Sind schnell Sehen sehr schnittig aus Einstellungsambivalenz ist ein wichtiges Konstrukt, um scheinbar in sich widersprüchliche Verhaltensweisen von Menschen erklären zu können (z.B. MacDonald & Zanna, 1998). Einstellungsstärke: Einstellungen unterscheiden sich nicht nur darin, inwieweit sie auf kognitiven, effektiven oder konativen Erfahrungen beruhen, sondern sie variieren auch hinsichtlich ihrer Stärke Definition Einstellungsstärke wird von verschiedenen Autoren unterschiedlich verwendet, u.a. im Sinne von Wichtigkeit, Stabilität oder innerer Konsistenz einer Einstellung Susanna Lopez Seite 41 29.02.2012 Trotzdem herrscht Einigkeit in folgende vier Aspekte a) Starke Einstellungen sind im Allgemeinen zeitlich stabiler b) sie sind schwerer zu verändern, und sie wirken sich eher auf c) die Informationsverarbeitung und d) das Verhalten aus, als schwache Einstellungen (Krosnick & Petty, 1995) Wichtig Einstellungsstärke: Die Stärke einer Einstellung hat einen Einfluss darauf, wie schnell ein Mensch seine Einstellung ändert. In der Regel gilt: Je stärker die Einstellung, desto schwieriger lässt sie sich durch Überzeugungsversuche seitens anderer Personen verändern Definition Einstellungszugänglichkeit: Der Begriff der Einstellungszugänglichkeit bezieht sich darauf, wie leicht eine Einstellung aus dem Gedächtnis abgerufen werden kann: schnell abrufbare Einstellungen werden als leicht zugänglich bezeichnet Ein Indikator für die Zugänglichkeit einer Einstellung ist die Geschwindigkeit, mit der eine Person ihre Bewertung eines Einstellungsobjekts artikulieren kann Je kürzer die Reaktionszeit desto besser zugänglich ist die (in diesem Fall vermutlich negative) Einstellung Einstellungsfunktionen: In seinem einflussreichen Ansatz schlägt Katz (1967) vier basale psychologische Funktionen von Einstellungen vor: Instrumentelle, Anpassungs- oder utilitaristische Funktion: Menschen entwickeln positive Einstellungen gegenüber Objekten, die persönliche Bedürfnisse befriedigen und zu positiven Konsequenzen führen, während sie negative Einstellungen gegenüber Objekten entwickeln, die mit Frustration oder negativen Konsequenzen einhergehen. Die Valenz der Einstellung dient dann zukünftig als Hinweisreiz für die Verhaltensanpassung: Eine positive Einstellung fördert Annäherung, eine negative Einstellung Vermeidung des Einstellungsobjekts Ich-Verteidigungsfunktion: Unter Rückgriff auf psychodynamische Theorien postuliert Katz (1967), dass Einstellungen auch dazu dienen, Angst und Unsicherheit, die aus inneren unerwünschten Impulsen bzw. äußeren Gefahren resultieren, zu reduzieren. Dies erfolgt u.a. dadurch, dass negative Attribute, die man an sich selbst wahrnimmt, auf andere Personen (oder Gruppen) projiziert werden, was sich wiederum in einer negativen Einstellung gegenüber diesen Personen oder Gruppen niederschlägt. Wertausdrucksfunktion: Menschen ziehen Befriedigung daraus, zentrale Werte oder Aspekte des eigenen Selbst auszudrücken, da sie dadurch ihr eigenes Selbst und ihren Platz in der sozialen Welt „verifizieren“ (zu diesem Bedürfnis nach Selbstverifikation, siehe auch Swann, 1990). Wissensfunktion: Einstellungen vereinfachen die Organisation, Strukturierung und Verarbeitung von Informationen und die Handlungsplanung, indem sie es erlauben, neue Ereignisse und Erfahrungen anhand bereits bestehender evaluativer Dimensionen zu interpretieren. Einstellungsmessung: Einstellungen sind hypothetische Konstrukte und damit nicht direkt beobachtbar Verfahren zur Erfassung: explizite Maße: Personen werden gebeten, ihre Einstellung anzugeben (sog. Selbstberichtsverfahren) Verfahren für Implizite Maße: Verfahren mittels derer die Einstellungen erfasst werden, ohne die Personen direkt um eine verbale Angabe zu ihren Einstellungen zu bitten Explizite Maße: Likert-Einstellungsskala: Sie besteht aus einer Anzahl von Aussagen (Items), die positive oder negative Überzeugungen oder Gefühle in Bezug auf das Einstellungsobjekt ausdrücken in Beispiel für ein Item einer etablierten Likert-Skala, mit der die Einstellungen von heterosexuellen Personen gegenüber Lesben und Schwulen gemessen wird (Herek, 1988): Susanna Lopez Seite 42 29.02.2012 ⇒ Der Gesamtwert kann zwischen 20 (extrem positive Einstellung) und 180 extrem negative Einstellung variieren ⇒ Diese Form der Einstellungsmessung ist repräsentativ für eine Vielzahl von Messinstrumenten zur Messung individueller Einstellungen in unterschiedlichen (sozial-) psychologischen Forschungs- und Anwendungsbereich Implizite Maße: Eine potenzielle Einschränkung der Messung wie durch die Likert-Skala besteht darin, dass die Angaben der Befragten durch die Motivation beeinflusst sein können, die Items in einer sozial erwünschten Weise zu beantworten und/oder sich in einem positiven Licht zu präsentieren Möglicherweise besitzen die Befragten vor der Messung auch gar keine klare Einstellung gegenüber dem Objekt, und werden erst durch den Vorgang der Befragung darauf gestoßen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen („Reaktivität der Messung“) Definition Reaktivität: wird verstanden, dass der Messvorgang selbst die Ausprägung dessen was gemessen wird, beeinflusst. Eines der gebräuchlichsten Verfahren ist der Implicit Association Test (IAT) (z.B. Greenwald, McGhee, & Schwartz, 1998) Der IAT ist eine Methode zur Messung individueller Unterschiede in der Stärke der mentalen Assoziationen zwischen Einstellungsobjekten und ihren Bewertungen. In diesem IAT müssen die Vpn Bilder oder Namen Objekt-Stimuli durch Druck zweier Tasten so schnell wie möglich den zwei Kategorien zuordnen. Im Wechsel mit dieser Objekt-Diskriminationsaufgabe muss eine evaluative Entscheidungsaufgabe ausgeführt werden, in der normativ positive und negative Worte („Attribut-Stimuli“) so schnell wie möglich den Kategorien „positiv“ und „negativ“ zugeordnet werden. Für die Auswertung ist der Vergleich der Reaktionszeiten der Teilnehmer im Hinblick auf zwei Varianten dieser Diskriminationsaufgaben entscheidend Der Unterschied in den mittleren Reaktionszeiten zwischen assoziationskongruenter und assoziationsinkongruenter Zuordnung wird üblicherweise als Indikator für die Stärke der relativen Präferenz der Einstellungsobjekte (oder vice versa) interpretiert. Der IAT wird in vielen Bereichen der Psychologie, wie z.B. der Persönlichkeitspsychologie, der Gesundheitspsychologie und der Werbepsychologie verwendet Die Validität des IAT wird allerdings nach wie vor kontrovers diskutiert: ⇒ Die dem IAT zugrunde liegenden psychologischen Prozesse nach wie vor nicht hinreichend geklärt sind (Gawronski & Conrey, 2004) ⇒ Zudem bestehen (bisweilen) lediglich geringe Korrelationen zwischen expliziten und impliziten Einstellungsmaßen, was den Schluss nahe legt, dass beide Verfahren unterschiedliche psychologische Konstrukte messen: ⇒ Einerseits explizite (und bewusst zugängliche) Einstellungen und anderseits implizite (und unbewusste Einstellungen) Diese Schlussfolgerung wird auch dadurch unterstützt, dass explizite und implizite Einstellungen offenbar in unterschiedlichen Situationen verhaltenswirksam sind – explizite Einstellungen in Situationen, in denen die Person Zeit hat, systematisch zu überlegen, implizite Einstellungen hingegen in Situationen unter Zeitdruck Einstellung und Verhalten: Erste systematische Sichtungen von Studien zum Zusammenhang zwischen Einstellungen und Verhalten gegen Ende der 1960er-Jahre (Wicker, 1969) kamen zu einer ernüchternden Schlussfolgerung: Die Korrelation zwischen Einstellungen und Verhalten war häufig nur gering Susanna Lopez Seite 43 29.02.2012 Methodische Aspekte: In ihrem einflussreichen Artikel weisen Ajzen und Fishbein (1977) darauf hin, dass sich die Maße für Einstellungen und Verhalten im Hinblick auf vier Elemente entsprechen müssen, um eine zuverlässige Verhaltensvorhersage zu gewährleisten („TACT“ bzw. Korrespondenzprinzip): Target = Zielelement: Auf welches Objekt bzw. Ziel ist das Verhalten gerichtet? Action = Handlungselement: Welches Verhalten soll untersucht werden? Context = Kontextelement: In welchem Kontext wird das Verhalten ausgeführt? Time = Zeitelement: Zu welchem Zeitpunkt soll das Verhalten ausgeführt werden? Ajzen und Fishbein (1977) argumentieren, dass bei hoher Korrespondenz von Einstellungs- und Verhaltensmaßen bzgl. der oben genannten Aspekte eine zuverlässige Verhaltensvorhersage möglich ist – eine Schlussfolgerung, die in der nachfolgenden Forschung breite Unterstützung fand Wenn man also vorhersagen möchte, ob sich eine Person an einer Protestaktion der Antiglobalisierungsbewegung beteiligt, sollte man nicht ihre Einstellung zu globaler Gerechtigkeit messen (geringe Korrespondenz zwischen Einstellungs- und Verhaltensmaß). Stattdessen sollte man ihre Einstellung gegenüber dem konkreten Verhalten (Teilnahme an einer Demonstration der Bewegung – Handlungs- und Zielelement) unter Berücksichtigung der Kontextbedingungen (hohe Polizeipräsenz – Kontextelement) und dem Zeitpunkt (beim nächsten G-8 Gipfel – Zeitelement) erfassen Interindividuelle Unterschiede: Es beeinflussen auch bestimmte Persönlichkeitsfaktoren die Stärke des Zusammenhangs zwischen (expliziten) Einstellungen und Verhalten Personen mit einer geringen Tendenz zur Selbstüberwachung dadurch aus, dass sie ihr Verhalten in sozialen Situationen stark an ihren eigenen Gefühlen, Dispositionen oder Einstellungen orientieren Personen mit einer starken Tendenz zur Selbstüberwachung orientieren sich hingegen in ihren Verhaltensentscheidungen stark an Anforderungen der Situation und den antizipierten Reaktionen ihrer Interaktionspartner In einer Reihe von Studien konnte gezeigt werden, dass der Zusammenhang zwischen Einstellung und Verhalten bei schwachen Selbstüberwachern stärker ist als bei starken Selbstüberwachern, Snyder und Kendzierski (1982) Ein weiterer wichtiger Persönlichkeitsfaktor ist das Selbstschema. Wenn die Einstellung gegenüber einem bestimmten Verhalten (z.B. Sport zu treiben) integraler Bestandteil des Selbstschemas einer Person ist („Ich bin ein aktiver, sportlicher Typ“), dann ist es wahrscheinlicher, dass sie ein einstellungs- bzw. schemakonsistentes Verhalten zeigt, als wenn die entsprechende Einstellung für ihr Selbstschema von eher peripherer Bedeutung ist (z.B. Sheeran & Orbell, 2000) Modelle zum Einstellungs-Verhaltens-Zusammenhang: Menschliches Verhalten wird nicht nur durch individuelle Einstellungen, sondern auch durch soziale Faktoren beeinflusst Eine wichtige soziale Einflussgröße sind die wahrgenommenen oder antizipierten Erwartungen und Reaktionen anderer Personen bezüglich des Verhaltens bzw. vorherrschende soziale Normen Theorie des überlegten Handelns und die Theorie des geplanten Verhaltens: o Die Theorie des überlegten Handelns (z.B. Ajzen & Fishbein, 1980) und ihre Weiterentwicklung in Form der Theorie des geplanten Verhaltens (z.B. Ajzen & Madden, 1986) stellen zwei der am besten empirisch untersuchten Einstellungs-Verhaltens-Modelle dar gehen o Die beide Modelle gehen davon aus, dass die unmittelbare psychologische Determinante des Verhaltens die Verhaltensabsicht (oder -intention) ist In der Theorie des überlegten Handelns wird die Verhaltensintention von zwei psychologischen Faktoren beeinflusst: 1) die Einstellung gegenüber dem Verhalten: sie resultiert – im Einklang mit dem weiter oben erläuterten Erwartungs-X-Wert-Modell – aus der eingeschätzten Auftretenswahrscheinlichkeit bestimmter Verhaltenskonsequenzen und der Bewertung dieser Verhaltenskonsequenz. Für jede Konsequenz wird das Produkt aus Erwartung und Wert gebildet, diese Produkte werden dann zu einem Wert aufsummiert, der die Einstellung der Person modelliert 2) die subjektive Norm: Susanna Lopez Seite 44 29.02.2012 a) durch die wahrgenommenen normativen Erwartungen signifikanter Anderer (Partner, Familie, Freunde etc.) bezüglich des Verhaltens b) durch die Motivation der Person, diesen Erwartungen zu entsprechen Zur Modellierung der subjektiven Normen werden die subjektiven Einschätzungen bezüglich dieser beiden Komponenten wiederum multiplikativ miteinander verknüpft und dann aufsummiert Obwohl sich eine Reihe von Verhaltensweisen mit Hilfe der Theorie des überlegten Handelns gut vorhersagen lässt, hat das Modell seine Grenzen Eine weitere wichtige Variable zur Verhaltensvorhersage ist die Erwartung, das gewünschte Verhalten tatsächlich ausüben zu können, bzw. über entsprechende Verhaltenskontrolle zu verfügen Definition Wahrgenommene Verhaltenskontrolle: Die Wahrnehmung einer Person, dass sie über die erforderlichen Fähigkeiten und Ressourcen verfügt, um ein bestimmtes Verhalten ausführen zu können, wird als wahrgenommene Verhaltenskontrolle bezeichnet Die Integration der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle in das Modell stellt die entscheidende theoretische Erweiterung der Theorie des geplanten Verhaltens da Die Verhaltenskontrolle das Verhalten auf zwei Arten beeinflussen: a) kann die Absicht, ein Verhalten auszuführen, durch die Erwartung gestärkt werden, dass man das Verhalten tatsächlich ausüben kann b) kann die wahrgenommene Verhaltenskontrolle sich auch direkt auf die Ausführung bzw. Nicht-Ausführung des Verhaltens auswirken Wenn eine Person ein bestimmtes Verhalten de facto nicht ausführen kann (z.B. weil eine unüberwindbare Barriere sie daran hindert), bleibt die Wahrscheinlichkeit, dass sie es trotzdem versucht, mangels wahrgenommener Verhaltenskontrolle gering, selbst wenn ihre Verhaltensabsicht (aufgrund der Einstellung) stark ist. Ergänzungen und alternative Modelle: ⇒ Wiederholtes Verhalten: Viele Verhaltensweisen werden nicht nur einmal, sondern wiederholt ausgeführt, wodurch sie zunehmend zur Routine werden Dieses Routineverhalten wird dann durch automatische Prozesse reguliert, d.h., es wird ausgeführt, ohne dass ihm ein systematischer Entscheidungsprozess im Sinne der oben dargestellten Theorien vorausgeht Verschiedene Autoren haben daher vorgeschlagen, zusätzlich zu Einstellungen und subjektiven Normen Indikatoren von Gewohnheiten zur Verhaltensvorhersage heranzuziehen (z.B. die Häufigkeit, mit der Verhalten in der Vergangenheit ausgeführtwurde; s. Bentler und Speckart, 1979) Susanna Lopez Seite 45 29.02.2012 Die Ergebnisse einer Meta-Analyse einschlägiger Studien bestätigen (Ouellette und Wood, 1997), dass Verhaltensgewohnheiten insbesondere bei der Vorhersage von Alltagsroutinen (z.B. sich im Auto anzuschnallen) oft eine größere Rolle als Einstellungen oder subjektive Normen spielen ⇒ Spontanes Verhalten: Oftmals entscheiden sich Menschen relativ spontan für eine Verhaltensalternative, ohne systematisch über die Verhaltenskonsequenzen nachzudenken Die oben dargestellten Theorien erscheinen für die Vorhersage dieses Verhaltens wenig geeignet. Dies bedeutet allerdings nicht, dass nicht auch spontanes Verhalten durch Einstellungen beeinflusst würde Das MODE-Modell (Motivation and Opportunity as Determinants of Behavior) von Fazio (1990) (Duales-Prozess Modell) postuliert, dass sich Menschen, wenn ihnen die Motivation oder Gelegenheit zur systematischen Handlungsplanung fehlt, und sie daher eher spontane Verhaltensentscheidungen treffen, in ihren Entscheidungen entweder durch situative Reize oder durch leicht zugängliche (oder starke) Einstellungen leiten lassen Im Einklang mit dem MODE-Modell zeigt eine Serie von Untersuchungen, dass leicht zugängliche Einstellungen Verhaltensentscheidungen unter Zeitdruck oder bei geringer Motivation zur Verarbeitung weitgehend automatisch regulieren, indem sie die Wahrnehmung und die Beurteilung der Situation beeinflussen und die Aktivierung einstellungskonsistenter Verhaltensmuster fördern Einstellungsänderung durch Persuasion: Die Forschungsliteratur verweist insbesondere auf drei Möglichkeiten, die Einstellungen von Menschen zu verändern: 1. Förderung direkten Kontakts mit dem Einstellungsobjekt. Durch den Kontakt können neue Erfahrungen erworben werden, die im günstigen Fall eine Einstellungsänderung bewirken 2. Veränderung einstellungsrelevanter Verhaltensweisen durch positive und negative Verhaltensanreize. Infolge der Anreize kommt es zur Verhaltensänderung, was im günstigen Fall dazu führt, dass die Person ihre Einstellung an das Verhalten anpasst (Stichworte: Selbstwahrnehmung; Dissonanzreduktion) 3. Kommunikative Persuasion. Man kann versuchen, die Einstellung einer Person durch Kommunikation zu verändern. Letzter Prozess wird in den folgenden Abschnitten ausführlicher erläutert. Die beiden vielleicht einflussreichsten Modelle zu dieser Thematik sind das Modell der Elaborationswahrscheinlichkeit (Elaboration Likelihood Modell) von Petty und Cacioppo (1986) und das heuristisch-systematische Modell der Persuasion von Chaiken (z.B. Chaiken, 1987) (duale Prozessmodelle) Da sich beide Modelle in ihren Kernannahmen überschneiden, konzentrieren wir uns im Folgenden auf das Modell der Elaborationswahrscheinlichkeit Modus der Verarbeitung persuasiver Argumente: Eine grundlegende Annahme des Modells ist, dass Einstellungsänderung über zwei unterschiedliche Wege oder Routen erfolgen kann: a) Wird die zentrale Route beschritten, erfolgt die Einstellungsänderung aufgrund einer relativ intensiven kognitiven Auseinandersetzung des Empfängers mit der an ihn gerichteten Botschaft ⇒ z. B. systematisches Nachdenken. Durch das sorgfältige Abwägen von Pro- und KontraArgumenten überzeugt sich die Person quasi selbst b) Wird die periphere Route beschritten, erfolgt die Einstellungsänderung (oder -bildung) hingegen ohne allzu großen kognitiven Aufwand bzw. auf der Basis von Prozessen, die relativ unabhängig von der Qualität der dargebotenen Argumente wirken Dazu gehören z.B. Prozesse der klassischen Konditionierung oder die Verwendung einfacher Heuristiken, die sich auf oberflächliche „periphere“ Hinweisreize stützen Susanna Lopez Seite 46 29.02.2012 Heuristiken, die in diesem Kontext eine Rolle spielen, sind z.B.: Expertenheuristik: Menschen achten häufig eher darauf, wer etwas sagt, als was jemand sagt. Als heuristische Hinweisreize für einen (vermeintlichen) Expertenstatus fungieren z.B. ein akademischer Titel, das Alter oder das Geschlecht Attraktivitätsheuristik: Menschen lassen sich auch häufig eher von Personen überzeugen, die sie attraktiv finden. Ein Grund besteht darin, dass Menschen attraktiven Personen spontan mehr Zuneigung und Vertrauen entgegenbringen Länge der Nachricht als Heuristik: Bis zu einem gewissen Grad wirken längere Botschaften überzeugender als kürzere – und dies selbst dann, wenn es sich bei den präsentierten Argumenten gar nicht um unterschiedliche Argumente, sondern nur um unterschiedliche Formulierungen oder Varianten ein und desselben Arguments handelt Beide Routen führen zu unterschiedlichen Konsequenzen: Einstellungsänderung, die über die zentrale Route (d.h. durch intensives Nachdenken) erreicht wird, führt zu lang anhaltender und relativ änderungsresistenter Einstellungsänderung Einstellungsänderungen, die über die periphere Route erreicht wurden, sind hingegen fragiler und anfällig für neue Überzeugungsversuche Determinanten des Verarbeitungsmodus: Ob die zentrale oder die periphere Route der Informationsverarbeitung beschritten wird, hängt laut Petty und Cacioppo (1986) v.a. von der Motivation und der Kapazität des Zuhörers ab Die zentrale Route ist mit erheblichem kognitivem Aufwand verbunden, daher sollte sie nur dann beschritten werden, wenn sowohl die Kapazität als auch die Motivation zur genauen Informationsverarbeitung vorhanden sind Ein Faktor, der die Verarbeitungskapazität beeinträchtigt, ist Ablenkung Die einflussreichste Determinante der Verarbeitungsmotivation ist die persönliche Relevanz der kommunikativen Botschaft Andere Faktoren, die im Hinblick auf die Motivation eine Rolle spielen, sind: a) die Stimmung – wer in positiver Stimmung ist, ist typischerweise weniger motiviert, sich diese durch anstrengende systematische Verarbeitung zu verderben b) das individuelle Kognitionsbedürfnis – wer gerne nachdenkt (d.h. ein hohes Kognitionsbedürfnis hat), ist i.d.R. auch motivierter, über die Argumente einer Botschaft nachzudenken Studie von Petty, Cacioppo und Goldmann (1981) Zentrale Ergebnisse des Experiments von Petty et al. (1981): a) Bei hoher persönlicher Relevanz wurde die Einstellung primär durch die Qualität der Argumente beeinflusst (zentrale Route). b) Bei niedriger persönlicher Relevanz hing die Einstellung stärker vom Status der Einflussquelle ab. Susanna Lopez Seite 47 29.02.2012 Wichtig: Wenn Sie also jemanden inhaltlich überzeugen wollen, sollten Sie sich nicht allein auf die Kraft Ihrer Argumente verlassen. Bevor Sie argumentieren, stellen Sie erst sicher, dass die Person die Relevanz des Themas für sich selbst erkennt! Kapitelzusammenfassung Einstellungen beruhen auf der Integration von Informationen aus unterschiedlichen Quellen: Kognitionen, Affekten und Informationen bzgl. des eigenen Umgangs mit dem Objekt. Sie dienen wichtigen psychologischen Funktionen, wie der Vereinfachung der Informationsverarbeitung und der sozialen Orientierung; ihr Ausdruck schützt vor starken negativen Emotionen und dient der Verifikation des eigenen Selbst. Likert-Skalen sind weitverbreitete explizite Verfahren der Einstellungsmessung. Eines der bekanntesten impliziten Verfahren ist der „Implicit Association Test“, der individuelle Unterschiede in der Stärke der mentalen Assoziationen zwischen Einstellungsobjekten und ihren Bewertungen erfasst. Einstellungen stellen eine Grundlage für die Ausbildung von Intentionen dar, die dem Verhalten vorangehen. Duale-Prozess-Modelle der Persuasion spezifizieren zwei unterschiedliche Wege zur Einstellungsänderung. Einer basiert auf der systematischen Verarbeitung und Abwägung relevanter Argumente. Ein anderer beruht auf Prozessen, die relativ unabhängig von der Qualität dargebotener Argumente wirken (z.B. Verwendung von Heuristiken). 8 Prosoziales Verhalten, Helfen und Altruismus Begriffsbestimmung: Definition Prosoziales Verhalten: Mit dem Begriff prosoziales Verhalten werden in der sozialpsychologischen Literatur üblicherweise Verhaltensweisen bezeichnet, die von einer Gesellschaft allgemein als vorteilhaft oder gewinnbringend für andere Menschen und/oder das bestehende politische System definiert werden. Ob ein Verhaltensakt als prosozial angesehen wird, hängt unmittelbar vom spezifischen sozialen, historischen und politischen Kontext ab Helfen: Die für dieses Kapitel zentrale Verhaltenskategorie „Helfen“ umfasst eine Subkategorie prosozialen Verhaltens Definition Helfen: Verhaltensweisen, die eine Person (der Helfer) in der Absicht ausführt, das Wohlergehen einer anderen Person (des Hilfeempfängers) zu verbessern (oder zu schützen). Eine entscheidende Voraussetzung dafür, dass ein Akt als Helfen klassifiziert wird, ist die Verhaltensabsicht oder Intention des Helfers. ⇒ Planungsgrad: Handelt es sich bei der konkreten Tätigkeit eher um ein relativ spontanes und informelles Verhalten (z.B. jemandem die Tür aufhalten) oder um ein geplantes und in formale Strukturen eingebettetes Verhalten (langfristiges ehrenamtliches Engagement in einer karitativen Organisation)? ⇒ Schweregrad: Geht es darum, bei der Lösung eines kleineren Problems behilflich zu sein (z.B. einer Person Wechselgeld geben) oder um Hilfeverhalten in einer gravierenden Notsituation (z.B. Erste-Hilfe-Leistung im Falle eines Unfalls)? Susanna Lopez Seite 48 29.02.2012 ⇒ Art des Kontakts: Gibt der Helfer seine Unterstützung in direktem Kontakt (z.B. indem er selbst einem lernschwachen Schüler Nachhilfeunterricht gibt) oder erfolgt die Hilfeleistung indirekt oder vermittelt (z.B. indem er eine Fördereinrichtung für lernschwache Schüler finanziell unterstützt)? Wichtig Entscheidende Voraussetzung dafür, dass ein Akt als Helfen klassifiziert wird, ist die Verhaltsabsicht oder Intention des Helfers. ⇒ Hilfe zu bekommen, ist aus Sicht des Empfängers nicht notwendigerweise eine positive Erfahrung, auch wenn das Verhalten so intendiert sein mag ⇒ Hilfe angeboten zu bekommen, kann beim Adressaten das Gefühl erzeugen, von anderen als unselbstständig und abhängig wahrgenommen zu werden, was negative Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl haben kann Altruismus: Während in der Definition des Begriffs „Helfen“ die Motive, die der Intention zu Helfen zugrunde liegen, keine Rolle spielen, sind diese Motive für die sozialpsychologische Definition des Altruismuskonzepts entscheidend Defintion Altruismus: Formen des Hilfeverhaltens, deren primäres Ziel es ist, das Wohlergehen einer anderen Person zu verbessern oder zu schützen. Ein möglicher persönlicher Nutzen, der dabei für den Helfer entsteht (z.B. soziale Anerkennung durch andere Personen) stellt lediglich ein „Nebenprodukt“ des Hilfeverhaltens dar und ist nicht intendiert. Altruistisch motiviertes Helfen wird in der Literatur dem egoistisch motivierten Helfen gegenübergestellt (z.B. Batson, 1998; Dovidio et al., 2006) Egoistisch motivierten Helfens: das Ziel des Helfers liegt darin, sein eigenes Wohlergehen zu verbessern, zu schützen oder weiter auszubauen Die Verbesserung des Wohlergehens der anderen Person dient dem Helfer also lediglich als Mittel zum Zweck, um eigene Bedürfnisse zu befriedigen (z.B. um finanzielle oder soziale Anerkennung zu bekommen) Warum helfen Menschen einander? Unter Sozialpsychologen besteht weitgehend Einigkeit darüber, dass Helfen und Altruismus biologische Wurzeln haben und genetisch im Verhaltensrepertoire der Spezies Mensch verankert sind (z.B. Dovidio et al., 2006). Evolutionäre Grundlagen: Der Evolutionstheorie zufolge wird durch den Prozess der natürlichen Selektion die Evolution von Verhaltensweisen gefördert, die dazu beitragen, die Weitergabe eigener Gene in die nächste Generation sicherzustellen Warum sollte sich der Prozess der natürlichen Selektion zugunsten von Genen ausgewirkt haben, die Menschen dazu dispositionieren, anderen eigene Ressourcen bereitzustellen oder gar das eigene Leben für sie aufs Spiel zu setzen? Die Theorie der Verwandtenselektion (Hamilton, 1964; Meyer, 1999) liefert einen Ansatz zur Auflösung dieses vermeintlichen Paradoxons: o Im Zentrum der theoretischen Überlegungen steht die Annahme, dass die natürliche Selektion insbesondere die Evolution von prosozialem Verhalten gegenüber genetisch Verwandten gefördert hat, und zwar deshalb, weil dieses Verhalten den indirekten Reproduktionserfolg eines Individuums erhöht Gesamtfitness („inclusive fitness“): Der Fortpflanzungserfolg eines Individuums, der sich aus der Addition zweier Maße ergibt: a) der direkten Fitness, d.h., der Anzahl der Gene, die durch eigene Reproduktion (direkte eigene Nachkommen) in die nächste Generation weitergegeben werden, und b) der indirekten Fitness, der Anzahl der eigenen Gene, die über Verwandte an die nächste Generation weitergegeben werden. Hilfeverhalten und Altruismus gegenüber Verwandten steigert die Gesamtfitness eines Individuums. Susanna Lopez Seite 49 29.02.2012 Studie: Die Ergebnisse einer Serie von einfallsreichen Szenarioexperimenten von Burnstein, Crandall und Kitayama (1994) im Einklang mit dieser Theorie, dass die Bereitschaft, anderen Personen zu helfen, mit dem Grad der genetischen Verwandtschaft zwischen Helfer und Hilfeempfänger linear ansteigt. Interessanterweise war dieser Linearzusammenhang allerdings nur dann zu beobachten, wenn es sich bei den präsentierten Notfallszenarien, um lebensbedrohliche Situationen handelte (ein Brand in einem Wohnhaus). Wenn in der dargestellten Notsituation keine Lebensgefahr für die andere Person bestand, spielte die genetische Verwandtschaft für das Ausmaß der Hilfsbereitschaft keine Rolle. Dieses Befundmuster ist insofern interessant, da gerade lebensbedrohliche Situationen besonders diagnostisch für die Wirkung des Prinzips der Verwandtenselektion sind. Denn nur unter Bedingungen, die das Überleben eines genetisch Verwandten bedrohen, ist auch der eigene (indirekte) Reproduktionserfolg unmittelbar gefährdet Reziproker Altruismus: Menschen helfen aber auch Personen, mit denen sie nicht genetisch verwandt sind, Freunden, Kollegen, Zufallsbekanntschaften. Die von dem Biologen Trivers (1971) entwickelte und mittlerweile vielfältig weiter ausgearbeitete Theorie des reziproken Altruismus liefert eine eindeutige Antwort auf diese Frage Altruismus wird im Rahmen dieser Theorie im biologischen Sinne verstanden wird d.h., als ein Verhalten, das mit Fitnesskosten für den Helfer und Fitnessvorteilen für den Rezipienten verbunden ist. Theorie ist folgender: Die Unterstützung von Nichtverwandten bringt zunächst Fitnesskosten mit sich. Wenn allerdings garantiert ist, dass diese Unterstützung vom Rezipienten zu einem späteren Zeitpunkt durch eine Verhaltensweise erwidert wird, deren Wert die eigenen Investitionskosten übersteigt, dann resultiert aus der ursprünglichen Investition ein Fitnessvorteil für das Individuum Die Theorie des reziproken Altruismus postuliert daher, dass die natürliche Selektion die Evolution von Hilfeverhalten begünstigt hat, das auf dem Prinzip der Wechselseitigkeit beruht Interessanterweise findet sich in nahezu allen bekannten Kulturen eine Norm, die das Prinzip der Wechselseitigkeit in Hilfebeziehungen unterstützt: die sog. Reziprozitätsnorm (Gouldner, 1960) Im Kern beinhaltet diese Norm zwei Vorschriften: 1. Menschen sollen denen helfen, die ihnen geholfen haben, 2. Sie sollten die nicht verletzen, die ihnen geholfen haben. Während Sozialwissenschaftler diese Regeln als Bestandteil einer universell gültigen Norm ansehen, die ihre Verbreitung dem universellen Nutzen für das menschliche Zusammenleben verdankt, werten Evolutionspsychologen die kulturenübergreifende Verbreitung des Reziprozitätsprinzips als einen Beleg für seine genetische Verankerung (z.B. Cosmides & Tooby, 1992) Die Annahme einer genetischen Basis dieses Prinzips wird mittlerweile auch durch eine Reihe neuerer neuropsychologischer Untersuchungen unterstützt Das Verständnis des Reziprozitätsprinzips hängt offenbar mit hochspezialisierten neuronalen Einheiten im limbischen System zusammenhängt (z.B. Stone, Cosmides, Tooby, Kroll, & Knight, 2002) Auch Verhaltenstendenzen, die unmittelbar für die evolutionäre Effizienz des Reziprozitätsprinzips von Bedeutung sind, sind neuronal verankert ⇒ z.B. die Tendenz, Individuen aufzuspüren und zu bestrafen, die die Unterstützungsbereitschaft von anderen ausnutzen, ohne später etwas dafür zurückzugeben (sog. „Betrüger“). Kosten-Nutzen-Analysen: Definition sozialer Austausch: Hilfeverhalten lässt sich diesen Ansätzen zufolge also als eine Form des sozialen Austauschs verstehen, bei der eine Person eigene Ressourcen investiert, um einen Gegenwert dafür zu bekommen. Schematische Analyse der Hilfesituation: 1. Vergleich potenziellen Kosten und Nutzen 2. Vergleich der Konsequenzen von potenziellen Kosten und alternativen Handlungen 3. Auswählen der Verhaltensvariante mit den größtmöglichen Verhaltensnutzen geringstmöglichen Verhaltenskosten Susanna Lopez Seite 50 und 29.02.2012 den Anzumerken ist, dass es sich jeweils um subjektiv wahrgenommene Kosten und Nutzen handelt, deren jeweiliger Wert auf der persönlichen Einschätzung des Akteurs beruht Das übergeordnete Ziel des Hilfeverhaltens besteht austauschtheoretischen Überlegungen zufolge damit in der Wahrung oder dem Ausbau des eigenen Wohlergehens nach dem Prinzip der Nutzenmaximierung (egoistische Motivation) Die Kosten- und Nutzenfaktoren, die Menschen im Rahmen der Entscheidung zu helfen (oder nicht zu helfen) berücksichtigen, können prinzipiell in die folgenden Klassen fallen: Materielle Konsequenzen: auf Kostenseite z.B. der finanzielle Aufwand, der mit dem Hilfeverhalten verbunden ist; auf Nutzenseite ggf. eine finanzielle Belohnung, die einem aufgrund des Verhaltens zuteil wird. Körperliche Konsequenzen: auf Kostenseite z.B. körperliche Anstrengung, Schmerz, Verletzungen; auf Nutzenseite ggf. eine Stärkung der körperlichen Fitness und Gesundheit (z.B. durch langfristiges ehrenamtliches Engagement). Soziale Konsequenzen: auf Kostenseite z.B. negative soziale Reaktionen wie Verspottung oder sogar Ausgrenzung, weil man jemandem hilft, der dies vermeintlich nicht verdient; auf Nutzenseite ggf. soziale Anerkennung und Ruhm für eine heldenhafte Tat. Psychische Konsequenzen: auf Kostenseite z.B. Gefühle von Aversion und Ekel durch die Konfrontation mit Blut, Wunden oder Sekreten, auf Nutzenseite ggf. eine Steigerung des Selbstwertgefühls, das Gefühl im Einklang mit eigenen Idealen zu handeln. Je nach Hilfesituation (Planungsgrad, Schweregrad, Art des Kontakts) können diese Kosten und Nutzen für den Helfer erheblich variieren Konsequenzen des Nichthelfens In vielen Gesellschaften herrscht die Erwartung vor, dass man denjenigen helfen soll, die auf einen angewiesen sind – eine soziale Erwartung, die auch als Norm der sozialen Verantwortung bezeichnet wird (Berkowitz & Daniels, 1964) Einem Menschen in Not nicht zu helfen, kann daher soziale Sanktionierungen nach sich ziehen Es kann auch persönliche Schuldgefühle hervorrufen oder das unangenehme Gefühl, persönlichen Werten und Standards nicht gerecht zu werden (Schwartz & Howard, 1981) Der Wunsch, derartige Kosten zu vermeiden, stellt daher eine weitere Quelle der Motivation zu helfen da Das Modell von Jane Piliavin, John Dovidio, Samuel Gaertner und Russell Clark (1981) beschreibt, welche Verhaltensreaktionen von einem potenziellen Helfer in Abhängigkeit von (a) den antizipierten Kosten des Helfens und (b) den antizipierten Kosten des Nicht-Helfens andererseits zu erwarten sind Direktes Hilfeverhalten am ehesten unter Bedingungen zu erwarten, in denen die wahrgenommenen Kosten des Helfens gering sind, während gleichzeitig hohe Kosten durch das Nicht-Helfen antizipiert werden. Im umgekehrten Fall ist direktes Hilfeverhalten hingegen am unwahrscheinlichsten und es ist mit „Ausweichstrategien“ zu rechnen. Abbau negativer Gefühlszustände: Ein weiterer und in gewisser Weise noch subtilerer Motivationsprozess, der auf dem Prinzip des Eigennutzes beruht, hängt mit den Gefühlen zusammen, die Menschen empfinden, wenn sie eine andere Person in Not sehen Menschen reagieren auf die Notlage anderer Menschen üblicherweise mit eigener emotionaler Erregung (Eisenberg & Fabes, 1991) ⇒ auch schon sehr kleine Kinder, ebenso Primaten oder Ratten) Susanna Lopez Seite 51 29.02.2012 Das gibt zu der Vermutung Anlass, dass diese Verhaltensreaktion eine biologische Grundlage hat In vielen Fällen empfinden Menschen die auftretende Erregung als unangenehm; sie fühlen sich gestresst oder aufgewühlt Das von Robert Cialdini und Kollegen entwickelte „Negative-State-Relief“-Modell (z.B. Cialdini, Kenrick, & Baumann, 1982) liefert eine Erklärung, warum diese negativen Gefühle Menschen dazu motivieren, einer anderen Person zu helfen Kerngedanke: negativ empfundene Gefühlszustände lösen die Motivation aus, diese Gefühle zu reduzieren, um damit das eigene Wohlbefinden wiederherzustellen. Menschen helfen dem Negative-State-Relief-Modell zufolge, um eigene negative Gefühle abzubauen Andere Verhaltensweisen können diesen Zweck genauso gut erfüllen. Wenn also ein alternatives Ereignis den negativen Gefühlszustand einer Person verbessert, bevor sie die Gelegenheit zu helfen wahrnimmt, sollte dies ihre Motivation zu helfen, drastisch reduzieren Unter bestimmten Umständen schon die Antizipation eines stimmungsverbessernden Ereignisses (die Aussicht darauf, gleich einen lustigen Film zu gucken) ausreicht, um die Motivation zu helfen zu unterminieren (z.B. Schaller & Cialdini, 1988). Empathie: Obwohl Helfen in vielen Situationen egoistisch motiviert ist, gibt es auch Belege für altruistisch motiviertes Hilfeverhalten ⇒ Forschungsfrage: gibt es Altruismus überhaupt? ⇒ Welche Rolle spielt Empathie? Empathie-Altruismus-Hypohtese (zum Überblick s. Batson, 1991) Im Kern besagt diese Hypothese, dass das Empfinden von Empathie für eine notleidende Person altruistisches Verhalten begünstigt In dem Modell von Batson ist Empathie auf eine andere Person gerichtete emotionale Reaktion definiert, die Gefühle wie Mitgefühl, Mitleid, Besorgnis, Wärme oder Fürsorglichkeit umfasst Batson nimmt an, dass das Auftreten von Empathie durch Perspektivenübernahme begünstigt wird Dass Menschen die Perspektive einer anderen Person übernehmen, wird wiederum wahrscheinlicher, wenn zwischen den Personen ein Gefühl der Verbundenheit herrscht Definition Empathie: Eine auf eine andere Person gerichtete emotionale Reaktion, die Gefühle wie Mitgefühl, Mitleid, Besorgnis, Wärme oder Fürsorglichkeit umfasst. Ein kognitiver Faktor, der das Auftreten von Empathie begünstigen kann, ist die Übernahme der Perspektive der notleidenden Person. „Elaine“-Experiment • In einem klassischen Experiment dieser Serie beobachteten weibliche Vpn (jeweils einzeln), wie eine andere Vp („Elaine“, tatsächlich eine Assistentin der Versuchsleitung) an einem Lernexperiment teilnahm. Im Zuge dieses Lernexperiments wurden Elaine vermeintlich Elektroschocks appliziert, angeblich um damit Lernen unter belastenden Bedingungen zu untersuchen. Da Elaine unter den (angeblichen) Elektroschocks aufgrund eines Kindheitstraumas scheinbar stark litt, fragte der Vl die Vp, ob sie bereit sei, anstelle von Elaine an dem Lernexperiment teilzunehmen. Um zu demonstrieren, dass Empathie zu altruistischem Helfen führt, manipulierten Batson und seine Mitarbeiter in dem Experiment zwei unabhängige Variablen: • Die Stärke von Empathie für Elaine wurde manipuliert, indem einem Teil der Vpn vor Beginn der Untersuchung mitgeteilt wurde, dass ihnen Elaine sehr ähnlich im Hinblick auf persönliche Werte und Interessen sei („hohe Ähnlichkeit“ – hohe Empathie), den übrigen Teilnehmerinnen wurde mitgeteilt, dass ihnen Elaine eher unähnlich sei („niedrige Ähnlichkeit“ – niedrige Empathie). • Zusätzlich wurden die Kosten des Nichthelfens manipuliert. Zu diesem Zweck wurde den Vpn in einer Bedingung mitgeteilt, dass sie das Labor sofort verlassen könnten, wenn sie dies wollten („leichter Ausweg“ –niedrige Kosten des Nicht-Helfens). In einer anderen Bedingung („schwieriger Ausweg“ – hohe Kosten des Nicht-Helfens) glaubten die Vpn, dass sie bleiben und acht weitere Durchgänge ansehen mussten, bei denen Elaine litt – eine höchst unangenehme und stressreiche Erfahrung, die sich nur durch eigenes Helfen abstellen ließ. • Das Befundmuster bestätigte die Empathie-Altruismus-Hypothese. • Unter der Bedingung „hohe Empathie“ (altruistische Motivation) halfen die Vpn unabhängig von den Kosten des Nicht- Helfens. Unter der Bedingung „niedrige Empathie“ (egoistische Motivation) war dies hingegen nicht der Fall – der überwiegende Teil der Vpn half nur dann, wenn Nicht-Helfen mit hohen Kosten einherging Susanna Lopez Seite 52 29.02.2012 Die Interpretation der Befunde von Batson und Mitarbeitern ist allerdings nicht unumstritten. Cialdini und Kollegen stellen beispielsweise infrage, dass Helfen, das durch Empathie motiviert ist, „wahrhaft“ altruistisch ist (z.B. Cialdini, Brown, Lewis, Luce, & Neuberg, 1997) Empathiemotiviertes Helfen und das Selbstkonzept Zur Begründung hat diese Forschergruppe Untersuchungen vorgelegt, die demonstrieren, dass Empathie offenbar als ein emotionales Signal für die Wahrnehmung von „Einssein“ mit der hilfsbedürftigem Person fungiert und dass es dieses Gefühl des Einsseins und nicht Empathie ist, das Hilfeverhalten motiviert (z.B. Cialdini et al., 1997) Die Befundlage ist nicht eindeutig Empathie kann auch unabhängig vom Gefühl des Einsseins zu Hilfeverhalten führen kann (z.B. Batson et al., 1997) Allerdings weisen auch andere Untersuchungen auf einen Zusammenhang zwischen der Definition des Selbst (insbesondere der Inklusivität dieser Definition) und des Effekts von Empathie auf Helfen hin So zeigt sich beispielsweise, dass der Effekt von Empathie auf Helfen stärker ist, wenn Helfer und Hilfeempfänger zu einer gemeinsamen Gruppe gehören bzw. eine gemeinsame soziale Identität teilen (Stürmer, Snyder, Kropp, & Siem, 2006) Die gegenwärtige Befundlage dennoch dafür, dass die Motivation, die durch Empathie ausgelöst wird, nicht mit egoistischer Motivation gleichzusetzen ist. Viele Forscher gehen daher mittlerweile davon aus, dass prosoziales Verhalten beim Menschen durch zwei prinzipiell unabhängige Motivationssysteme – ein hedonistisch-egoistisches und ein empathisch-altruistisches reguliert werden kann, wobei die Art der Beziehung zwischen Helferund Hilfeempfänger (definiert durch Ähnlichkeit, Verwandtheit, Freundschaft etc.) für die Regulation dieser motivationalen Systeme offenbar eine entscheidende Rolle spielt (z.B. Brown & Brown, 2006). Interindividuelle Unterschiede: Untersuchungen zur prosozialen Persönlichkeit beschäftigen sich mit der Frage, welche relativ zeitstabilen Persönlichkeitsmerkmale bestimmte Menschen dazu dispositionieren, anderen Menschen in einem weiten Spektrum von möglichen Situationen zu helfen. Prosoziale Persönlichkeit: Ein prominenter Ansatz wurde von Louis Penner und Kollegen vorgestellt (z.B. Penner, Fritzsche, Craiger, & Freifeld, 1995). Die prosoziale Persönlichkeit durch hohe individuelle Ausprägung auf zwei Merkmalsdimensionen charakterisieren: 1. Empathische Veranlagung: Diese Dimension umfasst die relativ zeitstabile Tendenz einer Person, auf die Notlagen anderer Menschen mit Empathie zu reagieren, sowie ihre Neigung, sich für das Wohlergehen anderer Personen verantwortlich zu fühlen. Korreliert substanziell mit „Verträglichkeit“ (eine Dimension des Big-Five-Faktor-Modells, McCrae und Costa, 1999), „dispositionelle Empathie“ (Davis, 1983) und „soziale Verantwortung“ (Berkowitz & Daniels, 1964). 2. Dispositionelle Hilfsbereitschaft: Diese Dimension umfasst die Selbsteinschätzung der Person als hilfsbereit (Hilfsbereitschaft wird subjektiv als ein wesentliches Merkmal des Selbstkonzepts angesehen), und die Wahrnehmung, dass man selbst kompetent ist, Hilfe zu leisten. Korreliert z.B. mit internale Kontrollüberzeugungen Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass der Einfluss der Persönlichkeit auf prosoziales Verhalten nicht in allen Situationen gleich stark ist. Typischerweise tritt ihr Einfluss z.B. dann zurück, wenn starke situative Einflüsse vorliegen, die eine „Entfaltung“ der Persönlichkeit in der Situation verhindern (z.B. Zeitdruck) Susanna Lopez Seite 53 29.02.2012 Geschlechtsunterschiede: Eine im westlichen Kulturkreis mit der „traditionellen“ männlichen Geschlechtsrolle verbundene Verhaltenserwartung ist, dass Männer sich beschützend, heldenhaft und ritterlich verhalten sollen Von Frauen wird demgegenüber traditionell eher erwartet, dass sie versorgend, behütend und fürsorglich sind Man könnte erwarten, dass Männer eher Formen des Hilfeverhaltens zeigen, das kompatibel mit der Männerrolle ist, wie beispielsweise das Eingreifen in schwerwiegenden Notsituationen und Frauen sollten eher dazu tendieren, Hilfe zu zeigen, die Pflege und Hingabe beinhaltet Eine Meta-Analyse von Alice Eagly und Maureen Crowly (1986), in der 172 Studien zusammenfassend ausgewertet wurden, liefert einen klaren Beleg für diese Vermutung Zusammengefasst zeigt diese Forschung: Weder Frauen noch Männer helfen mehr, sondern sie helfen in unterschiedlichen Bereichen Wann helfen Menschen nicht? In öffentlichen Debatten werden Fälle der unterlassenen Hilfeleistung in Notfallsituationen häufig auf bestimmte Persönlichkeitsmerkmale der Beobachter zurückgeführt (z.B. mangelnde Zivilcourage). Die sozialpsychologische Forschung legt allerdings eine andere Erklärung nahe. Diese verweist darauf, dass die „Macht der Situation“ in vielen Fällen deutlichstärker ist als der Einfluss von Persönlichkeitsmerkmalen Helfen in Notfallsituationen Je größer die Anzahl der Zeugen („bystander“), die einen Notfall beobachten, desto geringer ist offenbar die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand von ihnen hilft – ein Phänomen, das auch als Bystander-Effekt bezeichnet wird Latané und Darley (1970) haben fünf Schritte spezifiziert, die der Zeuge eines Notfalls nehmen muss, damit er einem Opfer tatsächlich hilft. Dies sind: Ereignis bemerken Ereignis als Notfall interpretieren Verantwortung übernehmen Passende Art der Hilfeleistung auswählen Entscheidung umsetzen Ereignis bemerken: Manche Notfallsituationen – ein Verkehrsunfall, ein Brand – ziehen die Aufmerksamkeit unbeteiligter Personen unmittelbar auf sich. Allerdings sind nicht alle Notfälle derart offensichtlich. Möglicherweise wäre das Ereignis auch gut zu erkennen, die Person widmet aber gerade ihre ganze Aufmerksamkeit einem anderen Gegenstand – sie telefoniert mit dem Handy, ist in Gedanken bei einem wichtigen Termin – und nimmt daher das Ereignis gar nicht wahr Ereignis als Notfall interpretieren: Viele Notfallsituationen sind für den Betrachter häufig nicht eindeutig als solche zu interpretieren, sondern bieten mehrere Interpretationsmöglichkeiten. Handelt es sich bei der Interaktion zwischen dem Mann und der Frau in der Fußgängerzone um einen Partnerschaftsstreit oder belästigt hier ein Fremder eine Passantin? Menschen orientieren sich in Situationen, in denen sie unsicher sind, wie sie ein Ereignis interpretieren sollen, typischerweise am Verhalten anderer. Im Fall von Notfällen kann dieses Verhalten allerdings problematisch sein. Notfallsituationen sind seltene Ereignisse und die meisten Menschen haben daher keine Routinen für das Verhalten in dieser Situation entwickelt. Wenn nun keiner einschreitet, kann dies dazu führen, dass sie alle irrtümlich zu der Schlussfolgerung kommen, die anderen Anwesenden hielten das Ereignis für harmlos – würden sie anderenfalls nicht einschreiten? Diese kollektive Fehleinschätzung einer Notsituation wird auch als pluralistische Ignoranz bezeichnet. Definition Pluralistische Ignoranz: Eine auf informativem sozialem Einfluss beruhende kollektive Fehlinterpretation eines Notfalls als harmloses Ereignis. Die Fehlinterpretation resultiert daraus, dass sich alle Zeugen unsicher sind, wie sie das Ereignis einzuschätzen haben, und sich deshalb aneinander orientieren. Da keiner einschreitet, wird das Ereignis als harmlos angesehen. Susanna Lopez Seite 54 29.02.2012 Verantwortung übernehmen: Wenn eine Person der einzige Zeuge des Notfalls ist, hat sie vermutlich das Gefühl, dass die ganze Verantwortlichkeit für das Eingreifen bei ihr liegt. Was aber geschieht, wenn es mehrere Zeugen gibt? Wie experimentelle Forschungsergebnisse zeigen, führt die Anwesenheit anderer Personen offenbar dazu, dass das Gefühl der eigenen Verantwortlichkeit sinkt – sie verteilt sich nun auf mehrere Schultern, und die eigene Zuständigkeit wird damit unklarer. Dieser Prozess der Verantwortungsdiffusion wiederum reduziert die Wahrscheinlichkeit des eigenen Einschreitens. Definition Verantwortungsdiffusion: Die Abnahme der wahrgenommen individuellen Verantwortlichkeit für das Einschreiten in einer Notfallsituation aufgrund der Anwesenheit anderer handlungsfähiger Personen. Art der Hilfeleistung auswählen: Eine wichtige Entscheidung, die nun zu treffen ist, gilt der Art der Hilfe. Mangelndes Wissen oder das Gefühl, nicht kompetent zu sein, könnten dazu führen, dass die Person letztlich doch davon absieht einzugreifen. Entscheidung treffen, zu helfen: In einem letzten Schritt muss schließlich die Entscheidung getroffen werden, die Art der Hilfe, die für angemessen angesehen wird, auch tatsächlich auszuführen. Ein spezifischer hemmender Faktor, der beim Helfen in Notfallsituationen zum Tragen kommen kann, besteht in der Sorge, sich vor anderen Personen, die das Ereignis ebenfalls bemerkt haben, zu blamieren. Diese „Bewertungsangst“ kann helfen die Motivation zu reduzieren. Wie lässt sich Helfen in Notfallsituationen fördern? Aus den oben dargestellten Befunden lässt sich eine Reihe von Verhaltensregeln ableiten, die Personen, die in einer Notlage die Hilfe von Passanten benötigen, anwenden können, um die Chance zu erhöhen, dass ihnen geholfen wird: Machen Sie durch deutliche Zeichen oder Rufe auf sich aufmerksam, um sicherzustellen, dass Ihre Notlage bemerkt wird! Artikulieren Sie deutlich, in welcher Lage Sie sind („Ich werde angegriffen und brauche Hilfe!“) – Schreie oder Schmerzenslaute allein bieten mehrere Interpretationsmöglichkeiten! Beugen Sie Verantwortungsdiffusion vor, indem Sie von den Personen, die sich in der Nähe aufhalten, eine Person direkt ansprechen („Hey, Sie in der blauen Jacke, bitte helfen Sie mir!“). Erleichtern Sie dem Angesprochenen die Entscheidung bezüglich der Wahl der Hilfe, indem Sie die Hilfe vorschlagen, die Sie für angemessen halten („Bitte rufen Sie die Polizei!“). Die Forschung liefert auch Belege dafür, dass die aktive Aufklärung über die Blockaden von Hilfeverhalten in Notfallsituationen dazu beitragen kann, dass Menschen, die Zeugen einer Notsituation werden, ihr Verhalten ändern. Kapitelzusammenfassung Prosoziales Verhalten ist ein Sammelbegriff für Verhaltensweisen, die allgemein als vorteilhaft für andere Menschen oder die Gesellschaft angesehen werden. Helfen bezieht sich auf prosoziales Verhalten, das in der Absicht ausgeführt wird, das Wohlergehen einer anderen Person zu verbessern. Altruismus ist Hilfeverhalten, das primär durch die Sorge um das Wohlergehen der anderen Person motiviert ist. Evolutionspsychologischen Ansätzen zufolge hat der Prozess der natürlichen Selektion die Evolution prosozialer Verhaltensweisen beim Menschen gefördert, da dieses Verhalten seine Fortpflanzungschance erhöht. Zwei Prinzipien sind in diesem Zusammenhang besonders relevant: Verwandtenselektion und reziproker Altruismus. Hilfeverhalten ist häufig egoistisch motiviert. Zwei Prozesse spielen in diesem Zusammenhang eine besondere Rolle: (1) Die Analysen von Kosten und Nutzen – Menschen helfen dann, wenn sie sich einen persönlichen Vorteil von diesem Verhalten versprechen, und (2) das Bestreben, eigene negative Gefühlzustände abzubauen – Menschen helfen, wenn sie gelernt haben, dass sie sich hinterher besser fühlen. Die Forschung liefert allerdings auch belastbare Belege für altruistischmotiviertes Hilfeverhalten. Altruistisches Helfen wird durch die Empfindung von Empathie vermittelt. Aufgrund bestimmter Persönlichkeitsmerkmale helfen manche Menschen grundsätzlich mehr als andere. Die Prosoziale Persönlichkeit umfasst eine Veranlagung zur Empathie und eine Disposition zur Hilfsbereitschaft. Die Forschung weist auch auf Geschlechtsunterschiede im Hilfeverhalten hin, die sich auf die Geschlechtsrollensozialisation zurückführen lassen. Damit eine Person in einer Notfallsituation hilft, muss sie fünf Schritte überwinden. Sie muss das Ereignis bemerken, sie muss das Ereignis als Notfall interpretieren, sie muss Verantwortung übernehmen, die passende Art der Hilfeleistung auswählen und die Entscheidung umsetzen. Aufklärung über die Faktoren, die Hilfeverhalten in Notfallsituationen verhindern, steigert die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen zukünftig Hilfe leisten. Susanna Lopez Seite 55 29.02.2012 9 Aggressives Verhalten Aggressives Verhalten ist in vielen Lebensbereichen zu beobachten: • In Partnerschaften (Stichwort: Gewalt in der Ehe) • In Interaktionen am Arbeitsplatz (Stichwort: Mobbing) • In Begegnungen zwischen Mitgliedern unterschiedlicher Gruppen (Stichwort: Hassverbrechen) • In den Beziehungen zwischen Nationen (Stichwort: Krieg) Der Schwerpunkt dieses Kapitels liegt auf den Grundlagen für Aggressionen in interpersonalen Beziehungen Begriffsbestimmung: Definition Aggression: Der Begriff Aggression bezeichnet ein intendiertes Verhalten mit dem Ziel, einem anderen Lebewesen zu schaden oder es zu verletzen, wobei dieses Lebewesen motiviert ist, diese Behandlung zu vermeiden. Zwei Aspekte dieser Definition verdienen besondere Beachtung: Erstens wird aggressives Verhalten durch die zugrundeliegende Intention definiert und nicht durch die tatsächlich erzielte Wirkung. Wenn eine Person vergeblich versucht, eine andere Person zu schädigen (sie schlägt zu, verfehlt sie aber), handelt es sich dennoch um einen aggressiven Akt. Zum zweiten geht aus der Definition hervor, dass schädigende Handlungen, die auf Wunsch der Zielperson ausgeführt werden, wie etwa sadomasochistische Sexualpraktiken, nicht als aggressives Verhalten zu klassifizieren sind. Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass die soziale Bewertung eines Verhaltensakts als Aggression vom situativen und normativen Kontext abhängt, in dem das Verhalten stattfindet (Alltagssituation/ Krieg) Im Hinblick auf die subjektive Bewertung von aggressivem Verhalten spielt zudem die Perspektive des Akteurs eine entscheidende Rolle. In Konflikten liegen häufig diskrepante Perspektiven vor Formen aggressiven Verhaltens: Der sozialpsychologische Aggressionsbegriff umfasst zahlreiche unterschiedliche Verhaltenskategorien: • Körperliche Aggression vs. verbale Aggression (z.B. jemanden schlagen vs. jemanden anschreien) • Offene Aggression vs. verdeckte Aggression (z.B. jemanden direkt attackieren vs. hinter seinem Rücken Gerüchte streuen) • Aggression zwischen Individuen vs. Aggression zwischen Gruppen (z.B. eine Schlägerei zwischen Rivalen vs. ein Bandenkrieg) Eine aus sozialpsychologischer Sicht besonders relevante Unterscheidung bezieht sich auf die subjektiven Ziele, denen aggressives Verhalten dient (s. Berkowitz, 1993): Feindselige (heiße oder affektive) Aggression resultiert typischerweise aus dem Empfinden negativer Emotionen, wie Ärger, Zorn oder Wut; das Verhaltensziel besteht in der Schädigung eines anderen Lebewesens (z.B. der Person, über die man sich ärgert) Instrumentelle (kalte oder strategische) Aggression zielt zwar ebenfalls darauf ab, ein anderes Lebewesen zu schädigen, ist jedoch in erster Linie ein Mittel zum Zweck (z.B. Schädigung eines Konkurrenten, um sich selbst einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen). Der Begriff „Gewalt“ bezieht sich auf die Unterkategorien aggressiver Verhaltensweisen, die mit tatsächlicher oder angedrohter körperlicher Schädigung einhergehen (z.B. eine Person verprügeln). Wenn z.B. ein Partner den anderen anschreit, ist dies noch nicht notwendigerweise ein Akt häuslicher Gewalt, sondern es handelt sich um verbale Aggression. Als Gewalt würde der Akt klassifiziert, wenn er die Androhung körperlicher Schädigung beinhaltet. Susanna Lopez Seite 56 29.02.2012 Warum verhalten sich Menschen aggressiv? Biologische Ansätze: Die meisten Sozialpsychologen stimmen darin überein, dass aggressives Verhalten nicht nur soziale und psychologische, sondern auch biologische Grundlagen haben Vergleichende Verhaltensforschung (Ethologie): Viele grundlegende Annahmen zu den biologischen Grundlagen aggressiven Verhaltens beruhen auf Beobachtungen und Experimenten mit anderen Spezies, inklusive den genetisch nächsten Verwandten des Menschen, den nichtmenschlichen Primaten Ein erster Befund bezieht sich auf die Häufigkeit aggressiven Verhaltens unter Primaten. Systematische Sichtungen von Studien zum Sozialverhalten tagaktiver Affenarten legen z.B. nahe, dass aggressives Verhalten unter Primaten vergleichsweise selten ist Kooperatives Verhalten, wie gegenseitiges Füttern und die Fellpflege, ist um ein Vielfaches häufiger zu beobachten als Wettbewerb und Streit Unter Primaten (Menschen eingeschlossen) regeln entgegen vorherrschender Ansicht nicht Aggressionen, sondern Kooperationen das Zusammenleben (z.B. Sussman & Garber, 2004) Berücksichtigt man allerdings die Vielzahl alltäglicher Interaktionen zwischen Menschen, dann erscheint der Anteil aggressiven Verhaltens am menschlichen Sozialverhalten insgesamt ebenfalls vergleichsweise niedrig Ein zweiter Befund betrifft die bemerkenswerten Fähigkeiten von Primaten, ihr Verhalten sozialen Kontextbedingungen anzupassen. Untersuchungen mit Primaten zeigen z.B., dass die elektrische Stimulation bestimmter Hirnareale (speziell der Amygdala) zu aggressiven Verhaltensweisen führt (Moyer, 1976). Allerdings kann diese Tendenz durch den sozialen Kontext erheblich modifiziert werden Verhaltensgenetik: Wenn eineiige Zwillinge einander in Bezug auf ihre Tendenz zu aggressivem Verhalten stärker ähneln als zweieiige Zwillinge, kann dies als Hinweis gewertet werden, dass das untersuchte Merkmal in besonderem Maße genetisch determiniert ist Durch mathematische Analysen kann ferner der genetische Anteil (die Heritabilität) sowie der Einfluss gemeinsam erlebter Umweltfaktoren (z.B. gemeinsame Sozialisation) für die Ausprägung aggressiven Verhaltens geschätzt werden Tatsächlich legen Metaanalysen von Zwillings- und Adoptionsstudien einen signifikanten Einfluss genetischer Faktoren für aggressives Verhalten nahe (z.B. Rhee & Waldman, 2002) Allerdings verweisen diese Studien auch darauf, dass aggressives Verhalten nicht nur durch genetische Dispositionen, sondern auch hochgradig durch Sozialisationserfahrungen im Lauf der individuellen Entwicklung beeinflusst wird Zwillingsstudien legen nahe, dass aggressives Verhalten eine genetische Grundlage hat. Menschen variieren im Hinblick auf ihre genetische Disposition zu aggressivem Verhalten. Umweltfaktoren sind aber entscheidend daran beteiligt, ob die Auswirkung dieser Disposition auf das Verhalten gefördert oder gehemmt wird Neurotransmitter – Serotonin und Testosteron: Forschung zu Neurotransmittern und Hormonen untersucht, durch welche biochemischen Botenstoffe aggressives Verhalten vermittelt wird Da verschiedene Studien zeigen, dass impulsive Gewalt oft mit geringen Serotoninspiegeln korreliert, wird vermutet, dass Serotonin einen hemmenden Einfluss auf impulsive Aggression hat Die gegenwärtige Befundlage ist allerdings nicht einheitlich und der genaue Wirkmechanismus, über den sich ein niedriger Serotoninspiegel auf aggressives Verhalten auswirkt, ist bislang noch unzureichend erforscht (Balaban, Alper, & Kasamon, 1996) Bei dem zweiten Neurotransmitter, der in Zusammenhang mit aggressivem Verhalten diskutiert wird, handelt es sich um das männliche Sexualhormon Testosteron. Tierexperimentelle Studien zeigen, dass Injizierung von Testosteron bei Tieren das Aggressionsverhalten verstärkt Susanna Lopez Seite 57 29.02.2012 Untersuchungen am Menschen weisen ebenfalls auf einen positiven Zusammenhang zwischen dem Testosteronspiegel und der Auftretenswahrscheinlichkeit von aggressiven und antisozialen Verhaltensweisen hin Allerdings ist auch hier die Befundlage nicht eindeutig. Psychologische Ansätze: Psychologische Ansätze zur Erklärung aggressiven Verhaltens beim Menschen spezifizieren die psychologischen, sozialen und kontextuellen Bedingungen, die aggressives Verhalten auslösen, vermitteln und moderieren. Zudem wird untersucht, wie aggressives Verhalten erlernt wird. Frustrations-Aggressions-Hypothese: Einer der ersten empirisch überprüften psychologischen Ansätze zur Erklärung aggressiven Verhaltens war die Frustrations-Aggressions-Hypothese (Dollard, Miller, Doob, Mowrer, & Sears, 1939) Definition Frustration: sie resultiert, wenn Menschen daran gehindert werden, ein angestrebtes Ziel zu erreichen bzw. die von einem Ereignis erwartete Befriedigung ausbleibt. Gemäß der Frustrations-Aggressions-Hypothese erhöht Frustration die Wahrscheinlichkeit des Auftretens aggressiver Verhaltensweisen Allerdings ist dies nicht die einzige, sondern lediglich eine von mehreren möglichen Ursachen von Aggression und ob Frustration zu aggressiven Verhaltensweisen führt (und gegen wen sie sich richtet), hängt von zusätzlichen personalen und situativen Faktoren ab Feldexperiment von Harris (1974) Sie instruierte ihre Assistenten, sich an verschiedenen Positionen in längeren Warteschlangen (z.B. im Kino oder Supermarkt) vorzudrängeln. Außer der Position des Vordränglers wurde noch folgende Variablen variiert: • Das Geschlecht der Person, die sich vordrängelte; • ob er oder sie sich für das Vordrängeln entschuldigten oder nicht, und • ihr sozialer Status (anhand der Kleidung). Ergebnis: Die Reaktionen fielen wesentlich aggressiver aus, wenn sich die Assistenten in unmittelbarer Nähe des angestrebten Ziels (Kasse) vordrängelte oder wenn sie scheinbar einen niedrigen sozialen Status hatte. Gegenüber weiblichen Mitarbeitern der Vl oder Mitarbeitern, die sich entschuldigten, wurde weniger aggressives Verhalten gezeigt. Bei den Zielpersonen bestand die Tendenz, im Fall gleichgeschlechtlicher Interaktionen aggressiver zu reagieren Die Ausübung aggressiven Verhaltens hängt auch von der Einschätzung ab, über welche Sanktionsmöglichkeiten die Zielperson verfügt Definition Aggressionsverschiebung: Die Tendenz Aggressionen gegen unbeteiligte Dritte zu richten, wenn sie nicht gegenüber der ursprünglichen Quelle der Frustration zum Ausdruck gebracht werden können (z.B. aus Furcht davor, dass diese Person sich revanchiert) Leonard Berkowitz, einer der prominentesten Vertreter der sozialpsychologischen Aggressionsforschung, hat ein kognitiv-neoassoziationistisches Modell aggressiven Verhaltens entwickelt, das Befunde der Aggressionsforschung mit allgemeinen, kognitionspsychologischen Modellen (z.B. kognitiven Netzwerkmodellen) verbindet (Berkowitz, 1990) Das Modell spezifiziert die psychologischen Prozesse, die den Zusammenhang zwischen Frustration und Aggression vermitteln In diesem Modell ist Frustration nur eine von vielfältigen Ursachen aggressiven Verhaltens Entscheidend für das Auftreten aggressiven Verhaltens ist, ob ein Ereignis negativen Affekt auslöst Ablauf des kognitiv-neoassoziationistisches Modell: ⇒ Unangenehme Erfahrungen rufen zunächst eine unspezifische negative Affektreaktion hervor, die wiederum zwei unterschiedliche kognitive (oder assoziative) Netzwerke aktiviert Susanna Lopez Seite 58 29.02.2012 ⇒ Einerseits werden durch negativen Affekt Kognitionen, Erinnerungen, Gefühle und motorische Schemata aktiviert, die mit Aggression in Verbindungen stehen ⇒ Gleichzeitig werden aber auch mentale Inhalte aktiviert, die mit Fluchtverhalten assoziiert sind Im Zuge dieses ersten automatisch ablaufenden Assoziationsprozesses erhält der unspezifische negative Affekt eine spezifischere emotionale Qualität in Form von (rudimentärem) Ärger oder (rudimentärer) Furcht ⇒ In einem zweiten, stärker kontrolliert und systematisch ablaufenden Verarbeitungsprozess, interpretiert die Person diese rudimentären Gefühle, sie nimmt Kausalattributionen bzgl. des Ereignisses vor und überlegt, welche Gefühle und Handlungen der Situation angemessen sind ⇒ Dadurch erreicht die Person einen spezifischeren und gefestigteren emotionalen Zustand, entweder Ärger oder Furcht, der wiederum die weitere Einschätzung der Situation lenkt ⇒ Bevor sich die Person für eine Verhaltensreaktion entscheidet, werden weitere Bewertungsschritte vollzogen, indem die potenziellen Handlungsergebnisse bewertet und soziale Normen berücksichtigt werden Lernen: Zwei Lernprinzipien sind von unmittelbarer Bedeutung: 1. Operante Konditionierung (Lernen durch direkte Verstärkung), 2. Modelllernen bzw. das Lernen durch stellvertretende Verstärkung. Allgemein formuliert führt das Prinzip der operanten Konditionierung dazu, dass die Auftretenswahrscheinlichkeit solcher Verhaltensweisen steigt, die zu positiven Verhaltenskonsequenzen führen Ein anderer Prozess, über den aggressives Verhalten erlernt wird, ist das Lernen am Modell Die Beobachtung, dass Personen, die aggressives Verhalten zeigen, für dieses Verhalten belohnt werden, kann beim Beobachter die Auftretenswahrscheinlichkeit aggressiven Verhaltens erhöhen Susanna Lopez Seite 59 29.02.2012 Albert Bandura und Kollegen haben die Bedeutung des Modelllernens und das Prinzip der stellvertretenden Verstärkung in einer Serie von Experimenten dokumentiert (z.B. Bandura, Ross, & Ross, 1963). Kleinkinder im Alter zwischen drei und fünf Jahren wurden zufällig einer von vier experimentellen Bedingungen zugeteilt. In einer Bedingung sahen sie ein Video, in dem ein Junge („Rocky“, das aggressive Modell) durch aggressives Verhalten gegenüber einem anderen Jungen ein angestrebtes Ziel erreicht (d. h. er wurde für sein Verhalten belohnt); in einer anderen Bedingung erreicht der Junge das Ziel nicht und wurde für sein Verhalten zudem sanktioniert. Zusätzlich wurden zwei Kontrollbedingungen realisiert. In einer anschließenden Phase des Experiments beobachteten die Forscher, ob und in welchem Ausmaß die Kinder das aggressive Verhalten in einer Spielsituation mit einer Puppe imitierten. Kinder, die das „erfolgreiche“ aggressive Modell beobachtet hatten, imitierten dieses Verhalten in höherem Ausmaß als Kinder, die das Modell beobachtet hatten, das für sein Verhalten sanktioniert wurde. Diese Ergebnisse sind repräsentativ für eine Vielzahl von empirischen Befunden die belegen, dass aggressives Verhalten oft durch Beobachtung und Nachahmung gelernt wird. Hinweis aus M3, Skript 03413: Dies führte Bandura zu der Annahme, dass alle Kinder Rockys Verhalten im gleichen Maße erlernt haben mussten, aber in Abhängigkeit von den Verhaltensfolgen, die sie bei Rocky gesehen hatten, imitierten. Es besteht also ein Unterschied zwischen Erwerb (Akquisition) und Ausführung (Performanz) des beobachteten Verhaltens. Bandura ergänzte seine Theorie der Persönlichkeit mit den Konzepten der Selbstwirksamkeit und Selbstverstärkung, heute wird dies in den Theorien zur Selbstregulation weiterverfolgt. Die Übernahme von Modellen anderer ist daher keine einfache Kopie, sondern eine persönliche Aneignung. Häufig wird die erfolgreiche Imitation belohnt und verstärkt. Der Erfolg des Nachmachens erlaubt es, sich selber als Urheber der Handlung zu erleben und hilft, ein Gefühl der eigenen Kompetenz und für eigene Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln Der Er- folg des Imitierens hat seine ausgeprägt soziale Komponenten darin, dass das Modell, das imitiert wird, eine Person ist, die das Imitationsverhalten selektiv verstärkt und damit stabilisiert. Die so erworbenen Imitate können sicher hervorgebracht werden und erlauben es, dass sie individuell und kreativ variiert werden. Daraus können dann auch neue Effekte entstehen, die das Entstehen neuer Handlungsweisen begünstigen (vgl. http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at; Zugriff: 03.10) Interindividuelle Unterschiede Feindseliger Attributionsstil: Der feindselige Attributionsstil (z.B. de Castro, Veerman, Koops, Bosch, & Monshouwer, 2002). Definition Feindseliger Attributionsstil: Die relative zeitstabile Tendenz einer Person, die einen Schaden verursacht hat, eine feindselige oder aggressive Verhaltensabsicht zu unterstellen, auch wenn unklar ist, ob diese den Schaden mit Absicht herbeigeführt hat. Geschlechtsunterschiede: Die Kriminalstatistiken vieler Länder weisen eine deutliche Überrepräsentation von Männern als Täter von Gewaltverbrechen aus Metaanalysen der psychologischen Forschungsliteratur zeigen ebenfalls signifikante Geschlechtsunterschiede, und zwar dergestalt, dass offene und v. a. körperliche Aggression häufiger von Männern als von Frauen ausgeübt wird (z.B. Archer, 2004) Auf den zweiten Blick gestaltet sich die Interpretation der Befundlage allerdings komplizierter. Zum einen sind die im Rahmen psychologischer Untersuchungen ermittelten Geschlechtseffekte häufig allenfalls von einer mittleren Größenordnung. Zudem sind sie für verbale Aggression geringer als für körperliche Aggression Des weiteren zeigen Untersuchungen, dass Jungen und Männer zwar in stärkerem Maße zu offener Aggression tendieren als Frauen oder Mädchen (sodass sie eine andere Person direkt körperlich oder verbal attackieren); Frauen und Mädchen neigen hingegen stärker dazu, aggressives Verhalten in verdeckter Form auszuüben, indem sie z.B. gezielt Gerüchte über die Person, die sie schädigen möchten, in Umlauf bringen Bettencourt und Miller (1996) stellten auf der Grundlage einer Metaanalyse von 64 experimentellen Studien fest, dass Männer zwar unter normalen Umständen aggressiver reagieren als Frauen. Diese Geschlechtsunterschiede verringern sich allerdings, wenn Provokationen ins Spiel kommen. Wenn sich Frauen provoziert fühlen, reagieren sie fast ebenso aggressiv wie Männer. Eine Erklärung für die Geschlechtsunterschiede in aggressivem Verhalten im Alltag besteht darin, dass Männer mehrdeutige Verhaltensweisen ihrer Interaktionspartner schneller im Sinne einer persönlichen Provokation interpretieren. Eine Tendenz, die durch Alkoholeinfluss typischerweise noch verstärkt wird. Wann verhalten sich Menschen aggressiv? Aversive Umweltbedingungen: Susanna Lopez Seite 60 29.02.2012 Negativer Affekt kann durch unterschiedliche Situationsfaktoren hervorgerufen werden, v. a. durch solche, die zu einer körperlichen Beeinträchtigung führen und Schmerzen oder Unwohlsein verursachen (Berkowitz, 1993) Die Forschung zeigt, dass v.a. hohe Temperaturen und räumliche Enge zu einer Erhöhung der Auftretenswahrscheinlichkeit aggressiven Verhaltens führen können Aggressive Hinweisreize: Aggressive Hinweisreize sind Stimuli oder Objekte, welche üblicherweise mit aggressivem Verhalten assoziiert werden (z.B. Waffen) und aggressives Verhalten begünstigen. Berkowitz und LePage (1967): Vpn wurden verärgert und hatten anschließend die Gelegenheit sich zu „Rächen“. Um die Wirkung aggressiver Hinweisreize zu untersuchen, war der Raum, in dem der Schockgenerator stand, unterschiedlich ausgestattet. In einer Bedingung befanden sich neben dem Generator Waffen (ein Gewehr und ein Revolver, die angeblich aus einem vorangehenden Experiment stammten), in einer Vergleichsbedingung wurden die Waffen durch zwei Federballschläger ausgetauscht, in einer Kontrollbedingen waren keine weiteren Objekte im Raum. Wie in Abb. 9.2 zu sehen ist, bestätigten die Ergebnisse deutlich die vermutete Wirkung aggressiver Hinweisreize. Waren Waffen im Raum, war die Wahrscheinlichkeit aggressiven Verhaltens als Reaktion auf die Frustration signifikant erhöht Obwohl sich dieser auch als „Waffeneffekt“ bezeichnete Effekt nicht immer replizieren ließ, liefert der überwiegende Teil der empirischen Forschung doch solide Belege dafür, dass aggressive Hinweisreize die Auftretenswahrscheinlichkeit von aggressivem Verhalten erhöhen Zur Erklärung dieses Phänomens werden unterschiedliche Prozesse herangezogen: ⇒ Erstens können aggressive Hinweisreize die Interpretation negativen Affekts im Sinne von Ärger oder Aggression begünstigen ⇒ Zweitens fungieren sie vermutlich selbst als „Prime“ für aggressionsbezogene kognitive oder motorische Schemata ⇒ Drittens können sie vom Beobachter auch als Information über vorherrschende soziale Normen interpretiert werden (z.B. kann die Anwesenheit einer Waffe signalisieren, dass Gewaltanwendung sozial akzeptiert ist). Gewaltdarstellungen in den Medien: Durch den Konsum von Gewaltdarstellungen in den Medien wird die Wahrscheinlichkeit von aggressivem Verhalten beim Konsumenten erhöht (insbesondere bei Kindern und Jugendlichen) und dies sowohl kurz- auch als langfristig (s. Anderson, Berkowitz, Donnerstein, Huesmann, Johnson, Linz, Malamuth, & Wartella, 2003) Die Effekte des Konsums von Gewaltdarstellungen werden allerdings durch eine Reihe von Persönlichkeits- und Situationsfaktoren moderiert Susanna Lopez Seite 61 29.02.2012 Wie experimentelle Untersuchungen zeigen, hat Gewalt im Fernsehen z.B. eine größere Auswirkung auf Personen, die von vorneherein schon zu aggressivem Verhalten neigen Studien zeigen auch, dass sich der Konsum von Gewaltdarstellungen in den Medien häufig bei Jungen stärker auf ihr Aggressionsverhalten auswirkt als bei Mädchen Die Forschung unterstreicht die Bedeutung von fünf ineinandergreifenden Mechanismen, die die Effekte von Gewaltdarstellungen in Medien auf das Verhalten vermitteln (s. z.B. Berkowitz, 1993): 1) Modelllernen: Charaktere, die aggressives Verhalten zeigen und dadurch ihre Ziele erreichen, können als Modelle für aggressives Verhalten dienen. Ein Großteil der in Medien dargestellten Aggressionen wird entweder belohnt oder bleibt unbestraft 2) Verfügbarkeit: Der Konsum von Gewaltdarstellungen in Medien stärkt die chronische Verfügbarkeit aggressiver Gedanken und Gefühle 3) Soziale Normen: Die Beobachtung, dass andere ungestraft und erfolgreich Aggressionen einsetzen, kann dazu führen, dass der Zuschauer seine Wahrnehmung geltender sozialer Normen dahingehend verändert, dass er davon ausgeht, Aggression und Gewalt seien sozial akzeptierte – wenn nicht sogar erwünschte – Verhaltensweisen 4) Abstumpfung: Der langfristige und wiederholte Konsum von Gewaltdarstellungen kann zu Abstumpfung oder Habituation gegenüber Gewalt und Aggression führen. Zudem können sich die Standards verändern, was als Aggression oder Gewalt eingestuft wird 5) Feindseliger Attributionsstil: Medien beeinflussen das subjektive Bild von der Wirklichkeit. Die überproportional häufige Darstellung von Gewalt in Medien kann den Effekt haben, dass der Konsument die Welt zunehmend für einen gefährlichen und feindseligen Ort hält, was sich auf der Ebene von Persönlichkeitsmerkmalen in einem feindseligen Attributionsstil manifestieren kann. Prävention und Reduktion von Aggression: Die sozialpsychologische Forschung liefert eine Reihe von Ansatzpunkten, um aggressivem Verhalten vorzubeugen und sein Auftreten zu reduzieren. Wir werden uns im Folgenden aus Platzgründen auf die Darstellung von Interventionen konzentrieren, die auf der individuellen Ebene ansetzen. Diese Schwerpunktsetzung sollte nicht missverstanden werden. Aggression und Gewalt sind ebenso sehr durch individuelle wie auch durch soziale oder kulturelle Faktoren bedingt. Entschuldigungen: Eine ebenso einfache wie effektive Maßnahme, um einem Umschlagen der Frustration in Aggression vorzubeugen, besteht darin, dass sich die Person, die die Frustration verursacht hat, dafür entschuldigt Diese Annahme findet durch eine Reihe von Experimenten Unterstützung, die zeigen, dass eine glaubwürdige Entschuldigung, die Wahrscheinlichkeit reduziert, dass die frustrierte Person aggressiv reagiert (z.B. Ohbuchi, Kameda, & Agarie, 1989). Die Effektivität einer Entschuldigung hängt insbesondere von zwei Faktoren ab: • vom Schwergrad des Ereignisses– je schwerwiegender die Frustration, desto umfangreicher muss die Entschuldigung typischerweise ausfallen, um Ärger und Aggression zu mildern; • vom Vertrauen des Adressaten- eine Entschuldigung wirkt nur dann, wenn der Adressat glaubt, dass der Verursacher es mit seiner Entschuldigung ernst meint und sich daher zukünftig anders verhält. Bestrafungen: Die am weitesten verbreitete soziale Maßnahme, um das Auftreten aggressiven Verhaltens zu reduzieren, ist die Bestrafung bzw. die Strafandrohung Die Bestrafung von aggressivem Verhalten ist allerdings ein komplexes Geschehen (z.B. kann der Strafende selbst als Modell für aggressives Verhalten wahrgenommen werden) In der Forschungsliteratur herrscht weitgehend Einigkeit darüber, dass Bestrafung (oder Strafandrohung) nur dann nachhaltig zu einer Reduktion der Auftretens wahrscheinlichkeit zukünftiger aggressiver Verhaltensweisen führt, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind (Berkowitz, 1993): ⇒ die verabreichte (oder zu erwartende) Strafe muss aus Sicht des Akteurs hinreichend unangenehm sein, ⇒ die Strafe muss mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auf das Verhalten folgen, Susanna Lopez Seite 62 29.02.2012 die Strafe muss in einem für die Zielperson unmittelbar nachvollziehbaren Zusammenhang mit dem gezeigten Verhalten stehen, ⇒ die Zielperson muss erkennen, dass in der relevanten Situation alternative und sozial akzeptierte Handlungen zur Verfügung stehen, die nicht zur Bestrafung führen (oder geführt hätten). ⇒ Strafdosis: Insbesondere im Umgang mit Kindern (aber nicht nur hier) ist es häufig sinnvoll, die Stärke der angedrohten Strafe derartig zu dosieren, dass die Zielperson die Möglichkeit hat, das eigene Unterlassen des unerwünschten Verhaltens nicht allein auf die Bedrohung durch die Strafe zu attribuieren (externale Attribution). Die Drohung mit einer milden Strafe – eine Strafe, die gerade stark genug ist, die Zielperson dazu zu bringen, eine unerwünschte Verhaltensweise kurzfristig zu unterlassen – bietet ihr den Spielraum, das Unterlassen des Verhaltens auf interne Faktoren zurückzuführen („Eigentlich macht mir das Verhalten gar keinen Spaß.“), was die zukünftige Attraktivität der Handlung reduziert Ärgerbewältigung: Wie wir gesehen haben, spielen für das Auftreten aggressiven Verhaltens, v.a. feindseliger Aggression, negativer Affekt und Ärger eine wichtige Rolle Zahlreiche Aggressionstrainings zielen daher darauf ab, durch Übungen, Rollenspiele etc. Kompetenzen zur effektiven Ärgerregulation aufzubauen (z.B. Beck & Fernandez, 1998). Hierzu gehören u.a.: ⇒ Das Erkennen der situativen Auslöser von Ärger („Was genau hat mich an der Bemerkung des anderen wütend gemacht?“) ⇒ Das Einüben von Selbstverbalisationen, die dazu beitragen, die Auslöser und die Situation neu zu bewerten (z.B. „Entspann Dich, nimm die Sache nicht gleich so persönlich.“) ⇒ Der Erwerb von Kompetenzen, Wut und Kritik angemessen zu kommunizieren und Kompromisse zu schließen, wenn sich Konflikte ergeben („Ich werde in Ruhe sagen, was mich verletzt hat und warum.“) ⇒ Das Erlernen des gezielten Einsatzes von alternativen und mit Ärger inkompatiblen Verhaltensreaktionen (z.B. der Erwerb der Fähigkeit, durch den Einsatz von mentalen Strategien auch in Stresssituationen zu entspannen) Einschränkung: Die Wirksamkeit von Ärgerbewältigungstrainings setzt allerdings die Einsicht voraus, dass aggressives Verhalten mit mangelnder Impulskontrolle zusammenhängt, sowie die Motivation, dies zu ändern. Sind diese Voraussetzungen nicht gegeben, zeigt der Ansatz wenig Wirkung. Kapitelzusammenfassung Aggressives Verhalten wird definiert als ein intendiertes Verhalten mit dem Ziel, einem anderen Lebewesen zu schaden. Im Falle feindseliger Aggression ist die Schädigung das ultimative Verhaltensziel, im Falle instrumenteller Aggression dient dieses Verhalten als Mittel zur Erreichung eines anderen Ziels. Biologische Ansätze legen nahe, dass aggressives Verhalten zum biologisch verankerten Verhaltensrepertoire des Menschen gehört. Psychologische Ansätze zur Erklärung aggressiven Verhaltens beim Menschen spezifizieren die psychologischen, sozialen und kontextuellen Bedingungen, die aggressives Verhalten auslösen, vermitteln und moderieren. Diese Ansätze wiesen darauf hin, dass negativer Affekt – ausgelöst durch Frustration oder aversive Reize – eine zentrale Rolle für das Auftreten von Aggressionen spielt, da durch diese Empfindung bestimmte Kognitionen, Erinnerungen, Gefühle und motorische Schemata aktiviert werden, die mit Aggression in Verbindungen stehen. Aggressives Verhalten wird u.a. durch Lernen am Modell erlernt. Aggressives Verhalten wird durch bestimmte Personenvariablen beeinflusst (z.B. die Tendenz zu einem feindseligen Attibutionsstil). Zudem finden sich konsistente Geschlechtsunterschiede: Männer zeigen typischerweise mehr körperliche Aggressionen als Frauen. Das Vorhandensein von situativen Reizen, die üblicherweise mit aggressivem Verhalten assoziiert werden (z.B. Waffen) kann die Wahrscheinlichkeit des Auftretens aggressiven Verhaltens erhöhen. Der Konsum von Mediengewalt senkt die Schwelle für aggressives Verhalten. Prävention von Aggression und Gewalt erfordert daher koordinierte Interventionen auf unterschiedlichen Interventionsebenen – Individuum, soziales System, organisatorischer oder gesellschaftlicher Kontext. Der Einsatz von Entschuldigungen, die Androhung von Strafe und die Förderung von Kompetenzen zur effektiven Ärgerregulation sind auf das Individuum gerichtete (sozial-)psychologische Strategien. Susanna Lopez Seite 63 29.02.2012