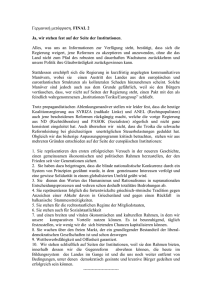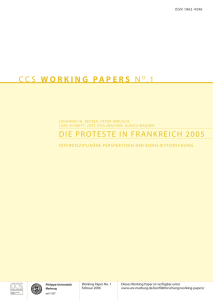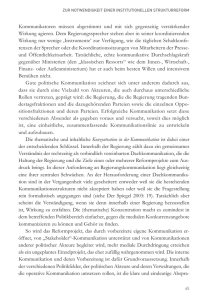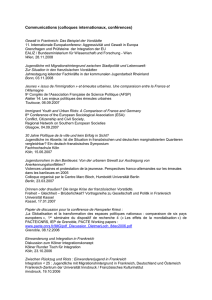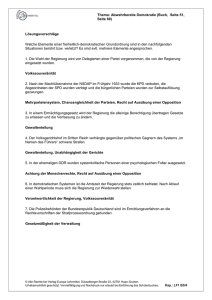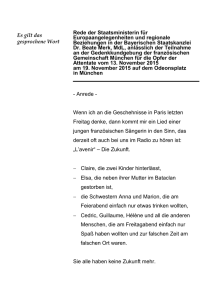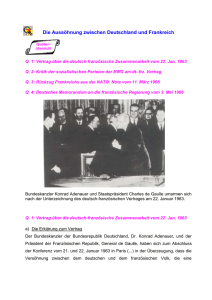Die Banlieues als politisches Experimentierfeld des
Werbung

Die Banlieues als politisches Experimentierfeld des französischen Staates Emmanuelle Piriot In Frankreich ist das »Problem der Banlieues« seit Anfang der 1980er Jahre Thema der Politik. Seitdem entwickelt der französische Staat Sondermaßnahmen, um diesem »Problem« beizukommen. Als Grundlage diente zunächst das 1977 eingeführte Stadtentwicklungsprogramm, Habitat et vie sociale (HVS), das die Sanierung der Sozialwohnungssiedlungen und die Subventionierung sozialer und kultureller Aktivitäten vorsah. Dieses Programm wurde in den 1980er Jahren durch »Développement social des quartiers« (DSQ – Soziale Entwicklung der Stadtviertel) abgelöst, worauf in den 1990er Jahren ein nunmehr schlicht als Politique de la ville (Stadtpolitik) bezeichneter Ansatz folgte. Jeder Übergang von einer Etappe zur nächsten brachte eine Intensivierung und verstärkte institutionelle Festschreibung der für die Banlieues bis dahin entwickelten Maßnahmen mit sich. Jedem neuen Ansatz gingen Aufstände voraus, die landesweite Aufmerksamkeit erregten. Parallel zur Einführung der verschiedenen Sondermaßnahmen ist die Polizeipräsenz in den Banlieues fortlaufend erhöht worden. Dabei wurde systematisch verschleiert, dass die Revolten stets von tödlich verlaufenden Polizeieinsätzen ausgelöst wurden. Der Bau der vornehmlich aus Sozialsiedlungen bestehenden Trabantenstädte war die Antwort des Staates auf die akute Wohnungskrise der Nachkriegszeit, die zugleich der Bau- und Immobilienbranche zugute kam. Im ersten Teil dieses Textes werden sowohl die Entstehung und Veränderung dieser Großsiedlungen dargestellt, als auch die Organisation der Arbeitsmigration – von der Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte über die Neuausrichtung der Migrationspolitik in den 1970er Jahren bis zur Erprobung neuer polizeilicher Kontrolltechniken an den Überausgebeuteten und Illegalisierten. Anschließend gehe ich auf die Konzepte ein, die den in den Banlieues angewandten Sondermaßnahmen zugrunde liegen. Das HVS-Programm war nicht zuletzt eine stadt- und sozialpolitische Ergänzung der gegen die Einwanderer entwickelten Repressionspolitik. Jene EinwandererInnen, auf die Frankreich auch weiterhin nicht verzichten wollte, sollten über HVS in die Gesellschaft »integriert« werden. Der dem Programm eigene Fokus auf die Einwandererviertel trug zur Festschreibung einer Unterscheidung zwischen assimilierbaren EinwandererInnen und solchen bei, die als politisches und soziales Risiko identifiziert wurden. Ein ganz ähnlicher Ansatz lag auch der späteren Politik der »Sozialen Entwicklung der Stadtviertel« zugrunde. Neu war an dieser Politik die Vorstellung, dass es Stadtentwicklung mit einem Maximum an »EinwohnerInnenbeteiligung« zu betreiben gelte. In der zweiten Hälfte der 1980er Jahre wurde die soziale Frage umdefiniert. Klassenkonflikte wurden als Problem des Ausschlusses verhandelt und die Banlieues als Räume der Exklusion und Anomie gesehen. Diese »neue soziale Frage« wurde regelmäßig mit den »Problemen« der Einwanderung, der Delinquenz, der 1 Entstehung migrantisch geprägter Communities und dem periodischen Ausbruch städtischer Revolten in Verbindung gebracht. Die Politique de la ville der 1990er Jahre brachte schließlich einen umfassenderen und systematischer organisierten Zugriff auf die nunmehr als »sensible Stadtgebiete« bezeichneten Viertel mit sich, deren Gesamtbevölkerung aktuell auf etwa fünf Millionen Menschen beziffert wird. Der Imperativ der »Integration« wurde bekräftigt, ging nun aber mit der Rhetorik eines »Kampfes gegen die Ausgrenzung« und einer »Stärkung des sozialen Zusammenhalts« einher. Die Bevölkerungsgruppen, mit denen sich die Politique de la ville befasste, wurden als Problemgruppen definiert, nie jedoch als eigenständige politische Akteure anerkannt. Die Banlieues dienten der Politique de la ville als Experimentierfeld für die Reform des öffentlichen Dienstes und die Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse. Auch die regierungstechnologischen Modelle, mit denen heute an die Kontrolle städtischer Räume herangegangen wird, sind weitgehend ein Resultat der durch die Politique de la ville in den Banlieues eingeleiteten Experimente. Weit davon entfernt, die sozialen Verwerfungen in den Banlieues zu beheben, hat die Politique de la ville neue Formen der sozialen Kontrolle in kapitalistischen Gesellschaften hervorgebracht. 1. Wohnraum und Arbeitskräfte – Der Mythos vom Wohlfahrtsstaat 1.1. Von der Wohnungskrise zum sozialen Wohnungsbau Nach dem Zweiten Weltkrieg erlebte Frankreich eine Wohnungskrise, die weniger auf die Zerstörungen des Krieges als auf mangelhafte Planung zurückzuführen war. Ende der 1940er Jahre fehlten drei Millionen Unterkünfte. Das Problem verschärfte sich durch die anhaltende Verstädterung. Große Teile der Landbevölkerung sowie MigrantInnen aus den Kolonien und dem europäischen Ausland zogen auf der Suche nach Arbeit in die Städte. Der Baby-Boom führte zu zusätzlichem Bedarf an Wohnraum. Das Frankreich der Elendsviertel und Barackensiedlungen In der Hauptstadt lebten die Arbeiter in elenden Verhältnissen. Viele Wohnungen hatten nur ein Zimmer, ein Drittel der Wohnungen war überfüllt, die Hälfte hatte kein fließendes Wasser und viele waren baufällig. Zahlreiche Familien kamen in Hotels unter. Selbst große Teile der Mittelschicht lebten in prekären Wohnverhältnissen. Derweil hausten mehrere zehntausend Menschen, überwiegend algerische und andere Migranten, in Barackensiedlungen (bidonvilles), die erst Ende der 1970er aufgelöst wurden. Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg galt die erste Priorität der Wiederherstellung der industriellen und verkehrstechnischen Infrastruktur. Die Wohnungsbaupolitik wurde vernachlässigt. Um die Kluft zwischen der »französischen Wüste« und dem rasant wachsenden Paris zu verringern, wurden zunächst Raum- und Wirtschaftsplanungkonzepte entwickelt, die mit der Verweigerung von Baugenehmigungen in der Hauptstadt einhergingen. Der Wohnungsmangel wurde dadurch noch verschärft. Erst der besonders strenge Winter des Jahres 1954 veranlasste die Regierung schließlich zum Umdenken. Die »Zonen vorrangiger Stadtplanung« Ab 1955 heizten öffentliche Subventionen die Bautätigkeit privater, öffentlicher und halbstaatlicher Wohnungsbaugesellschaften an. Es entstanden riesige Trabantenstädte mit zahlreichen HLM (habitation à 2 loyer modéré) genannten Sozialwohnungen. Die ersten HLM-Siedlungen wurden auf Freiflächen in den Städten, schließlich an deren äußeren Rändern gebaut. Ab 1958 wurde das Bebauungstempo mittels der Zone à urbaniser en priorité (ZUP – Zone vorrangiger Stadtplanung) noch beschleunigt. Innerhalb von zehn Jahren entstanden 195 ZUPs mit 80.0000 Wohnungen. Gleichzeitig wurden die ArbeiterInnenviertel in den Stadtzentren saniert, die ärmeren BewohnerInnen verdrängt und zum Umzug in günstigere Außenbezirke gezwungen. Die nach den neuen Prinzipien moderner Architektur errichteten Siedlungen mochten bestimmten Bedürfnissen der Bewohner entsprechen. Doch trotz nachdrücklich betriebener Öffentlichkeitsarbeit gelang es nicht, das eigentliche Ziel, viel, schnell und billig zu bauen, zu verschleiern. Es entstanden eintönige Siedlungen mit zu kleinen und schlecht isolierten Wohnungen. Grünanlagen, Kinderspielplätze, Geschäfte, öffentliche Verkehrsmittel usw. waren zwar vorgesehen, ließen aber auf sich warten. Die Wegstrecken zur Arbeit verlängerten sich. Das soziale Leben der EinwohnerInnen veränderte sich radikal. Ein an der bürgerlichen Kleinfamilie ausgerichteter Lebensstil setzte sich in ganz Frankreich durch. Die Menschen fühlten sich trotz der Wohnungsdichte einsam und isoliert. Da die Wohnungen jedoch elektrisch geheizt sowie mit Badewannen, fließend Wasser und besseren Sanitäranlagen ausgestattet waren, konnten sich die EinwohnerInnen als Privilegierte wahrnehmen. Auch die Aussicht auf eine gute Ausbildung für ihre Kinder (1959 wurde der Schulbesuch bis zum 16. Lebensjahr zur Pflicht) und die Hoffnung auf eine künftige qualifizierte und gut dotierte Beschäftigung, trösteten über die Schwierigkeiten des Lebens in den Vorstädten hinweg. Arbeiterklasse und Mittelschicht waren in den HLM-Siedlungen bis Mitte der 1970er Jahre zu annähernd gleichen Teilen vertreten. Die Sozialwohnungen wurden ArbeiterInnen ebenso wie Angestellten und mittleren Führungskräften zugeteilt. So schien sich die französische Utopie der mixité sociale (Soziale Durchmischung) während der Endphase des französischen Nachkriegsbooms realisiert zu haben. Tatsächlich muss das Bild von der gelungenen mixité sociale stark relativiert werden. Die Gemeindeverwaltungen bevorzugten MieterInnen, die ihrer Wählerschaft entsprachen, also französische Arbeiterfamilien. Sie versuchten, die Zahl migrantischer Familien unterhalb der inoffiziellen Quote von 15% zu halten – eine vom Institut national des études démographiques (Institut für demographische Studien) berechnete »Toleranzgrenze«. Das »Frankreich der Hauseigentümer« Als in den 1960er Jahren der Druck auf dem Wohnungsmarkt nachließ, richtete der Staat seine Wohnungsbaupolitik neu aus. Durch günstige Bankkredite sollten Immobilienkäufe gefördert und Frankreich zu einem Land der Hauseigentümer gemacht werden. Ende der 1970er Jahre wurde die Förderung des sozialen Wohnungsbaus zugunsten individueller Unterstützungsleistungen (Wohngeld) weiter zurückgefahren. Der Staat wandte sich von der Politik kollektiver Unterstützung ab und einer Politik punktueller Förderung zu. Immer mehr Mittelschichtfamilien verließen die HLMs. An ihre Stelle traten ärmere Familien und andere Wohnungssuchende, darunter viele Einwandererfamilien, die sich glücklich schätzten, ihre Übergangswohnheime verlassen zu können. Die Wohnungsgesellschaften reagierten mit Investitionen in die profitableren Gebäude und kümmerten sich 3 nicht mehr um weniger attraktive Siedlungen, in denen immer mehr MigrantInnen wohnten. Am Ende der 1970er Jahre waren die aus minderwertigen Baumaterialien errichteten Gebäude bereits am Verfallen und die ursprünglich vorgesehenen Gemeinschaftsanlagen nur in wenigen Fällen realisiert worden. Mit dem Anstieg der Arbeitslosigkeit verarmten die Bewohner der Siedlungen, wo 40% jünger als 25 Jahre sind, zunehmend. 1977 versuchte die Regierung mit dem HVS-Programm die Probleme in den Griff zu bekommen. Die Wohnungsbaugesellschaften kamen in den Genuss von Subventionen, mit denen die dringendsten Renovierungsarbeiten sowie kulturelle Aktivitäten finanziert werden sollten. 1.2. Arbeitsmarktpolitik und Immigration Die Arbeitsimmigration wurde seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs sowohl mit demographischen als auch mit ökonomischen Zielsetzungen staatlich reguliert. Frankreich hatte im Vergleich zu den frühen 1930er Jahren anderthalb Millionen EinwohnerInnen verloren und das Durchschnittsalter der Bevölkerung stieg. Um sich unter den großen Nationen behaupten und die Wirtschaft ankurbeln zu können, musste außerhalb der Landesgrenzen nach den benötigten Arbeitskräften gesucht werden. Obwohl die Experten des Bevölkerungsministeriums (Ministère de la Population) der Einwanderung aus nordeuropäischen Ländern aus rassistischen Motiven den Vorzug gaben, griff man vor allem auf algerische MigrantInnen zurück. Sie boten den Unternehmen aufgrund ihres besonderen Status als »muslimische FranzösInnen aus Algerien«1 den Vorteil, kein Visum zu benötigen. Zudem versuchte man mit der forcierten Auswanderung nach Frankreich, der aufkommenden algerischen Unabhängigkeitsbewegung das Wasser abzugraben. So stieg allein zwischen 1946 und 1954 die Zahl der AlgerierInnen in Frankreich von 22.000 auf 210.000. Ohne den massiven Rückgriff auf die Arbeitskraft von Einwanderern wären die ehrgeizigen Wohnungsbauprogramme nicht zu realisieren gewesen. Ende der 1960er Jahre arbeiteten die Hälfte der in Frankreich ansässigen Algerier und Portugiesen im Bausektor. 2 Auch die Schwerindustrie, die Landwirtschaft und die im Zuge des Nachkriegsbooms zur Fließproduktion übergehenden Konsumgüterindustrien waren auf die Arbeit der MigrantInnen angewiesen, denen die schwersten und zugleich am schlechtesten entlohnten Arbeiten vorbehalten blieben. Der Algerienkonflikt: Krieg gegen die Bevölkerung Mit dem Ausbruch des Algerienkriegs 1954 verschärfte die Regierung die Kontroll- und Repressionsmassnahmen gegenüber den algerischen EinwandererInnen vehement. Die »in ›der Metropole‹ ansässigen muslimischen Franzosen« wurden als das Vermehrungsmilieu eines neuen inneren Feindes wahrgenommen, der sowohl Kommunist als auch Unabhängigkeitskämpfer sein konnte. In Algerien wurden umfassende Counterinsurgency-Maßnahmen ergriffen, die bereits während des Indochinakriegs erprobt und bald schon in einer eigenen Militärdoktrin, der sogenannten doctrine de la guerre révolutionnaire (Revolutionskriegsdoktrin), ausformuliert wurden.3 1 Im September 1947 wurde allen AlgerierInnen die französische Staatsbürgerschaft zuerkannt (Algerien-Statut). Diese Reaktion auf das Erstarken der seit Ende der 30er Jahre bestehenden algerischen Unabhängigkeitsbewegung konnte den Kampf um die Loslösung von Frankreich jedoch nicht aufhalten. 2 L. Pitti, Histoire politique des immigrations (post)coloniales: France 1920-2008, Paris 2008, S. 98. 3 Im Zentrum dieser Militärdoktrin stand die Bevölkerung, die als eigentlicher Ausgangspunkt der militärischen Bedrohung begriffen wurde und deren Kontrolle als vorrangig galt. Im Kalten Krieg wurde die Doktrin gleichermaßen 4 Zur gleichen Zeit als diese Doktrin in Algerien zur Anwendung kam, wurden in der französischen Metropole unter der Schirmherrschaft des Polizeipräfekten von Paris, Maurice Papon, 4 die Kontroll- und Registrierungsverfahren wiederbelebt, denen die jüdische Bevölkerung unter der Vichy-Regierung ausgesetzt gewesen war. Seinen Höhepunkt erreichte das repressive Vorgehen gegen die »muslimischen Franzosen« am 17. Oktober 1961. Einige Tage zuvor hatte die Pariser Polizeipräfektur eine nächtliche Ausgangssperre für die »muslimischen Franzosen« verhängt, woraufhin der algerische Unabhängisgkeitsbewegung FLN zu gewaltlosen Protestdemonstrationen aufgerufen hatte. Der französische Staat reagierte mit der Gefangennahme und Verschleppung mehrerer tausend DemonstrantInnen – unter ihnen zahlreiche Kinder – in verschiedene improvisierte Gefangenensammelstellen wie Fußballstadien und Sporthallen, wo sie mehrere Tage festgehalten wurden. Am Ort der Demonstration richteten Polizei und/oder Armeeeinheiten ein Massaker an. Die Zahl der Getöteten wird auf bis zu 300 geschätzt, zahlreiche Leichen wurden noch Tage später aus der Seine geborgen. Nach der Unabhängigkeit Algeriens Die Unabhängigkeit Algeriens markierte einen Wendepunkt in der Geschichte der Einwanderung nach Frankreich. Nun wurden die AlgerierInnen zu »AusländerInnen«. Dennoch sahen die Abkommen von Evian, mit denen die algerische Unabhängigkeit formal festgeschrieben wurde, Reisefreiheit für FranzösInnen und AlgerierInnen in beiden Ländern vor. Dem französischen Staat war an der Wahrung seiner ökonomischen und militärischen Interessen in Algerien gelegen, wozu vor allem die Versorgung mit günstigem algerischem Erdöl und die Präsenz französischer Militärstützpunkte auf algerischem Territorium gehörte. Mithilfe der Regelung zur Reisefreiheit erhoffte er sich zudem Frankreich eine größere Community in Algerien erhalten zu können, doch die ansässigen Franzosen reisten 1962 massenhaft nach Frankreich aus. Die algerische Unabhängigkeit fiel mit einer neuen Phase wirtschaftlichen Wachstums in Frankreich zusammen. Hunderttausende Arbeitskräfte wurden für die traditionell von Migrationsarbeitern erledigten Jobs (in der industriellen Produktion, in der Bau- und Landwirtschaft) gesucht. Mehr als drei Millionen Menschen ließen sich zwischen 1962 und 1982 in Frankreich nieder. Die Zahl der AlgerierInnen in Frankreich stieg von 350.000 auf 800.000 Personen, die der MarokkanerInnen von 310.000 auf 440.000. 5 Lediglich die Zahl der TunesierInnen sank von 26.000 auf 19.000, während 157.000 Personen aus anderen afrikanischen Ländern zuwanderten. Für Algerien waren die nach Frankreich Ausgewanderten eine willkommmene Devisenquelle, für französiche Unternehmen gern gesehene, billige Arbeitskräfte. Immigration, Sicherheitspolitik und »neue Gesellschaft« 1969 verkündete der französische Premierminister Chaban-Delmas im Parlament sein Ziel, in Frankreich auf kommunistische wie auf antikoloniale Bewegungen angewandt. Kommunist und Antikolonialist verschmolzen gleichsam zu einer einzigen bedrohlichen Figur. Das Mittel der Aufstandsbekämpfung war der Terror gegen die Bevölkerung. Um auf die Aktionen des in der Bevölkerung verwurzelten Gegners zu antworten, müsse das französische Militär innerhalb der Bevölkerung Angst und Schrecken verbreiten. Das Militär sollte dabei gleichsam chirurgisch gegen die als krank wahrgenommenen Glieder des »Volkskörpers« vorgehen und die Bevölkerung gegen subversive Bestrebungen immunisieren oder besser noch, dazu bewegen, sich selbst zu immunisieren. 4 Maurice Papon war ein französischer Politiker, Nazi-Kollaborateur und Kriegsverbrecher. Während des Zweiten Weltkriegs war er Inspektor des Dienstes für jüdische Fragen des Vichy-Regimes. In dieser Position kollaborierte er mit der deutschen Besatzung. Erfolgreich verbarg Papon seine Vergangenheit als Nazi-Kollaborateur, wurde von Charles de Gaulle im Amt bestätigt und machte rasch Karriere. 5 Am stärksten – von 90.000 auf 760.000 Personen – wuchs der Anteil der portugiesischen Bevölkerung. 5 eine »neue Gesellschaft« (nouvelle société) zu errichten, die das »Chaos« des Jahres 1968 überwinden sollte6. Er kündigte u.a. Privatisierungsmaßnahmen an, um die »Wettbewerbsfähigkeit« der französischen Wirtschaft zu steigern. Das Projekt der »neuen Gesellschaft« beinhaltete vor allem aber auch einen neuen sicherheitspolitischen Ansatz. Die Anwendung einiger Aspekte der Revolutionskriegsdoktrin auf dem Territorium der französischen Metropole sollte auf unbestimmte Zeit ausgedehnt werden, um die Entstehung von Protestbewegungen wie jener von 1968 von vornherein zu verhindern. Bevorzugtes Experimentierfeld für die neue Sicherheitspolitik waren die migrantischen Communities: - Abschiebungen galten als Mittel zur »Immunisierung des Volkskörpers gegen revolutionäre Bewegungen«. 7 - Gleichzeitig rückte die Alltagsdelinquenz, die meist mit den migrantischen Communities in Verbindung gebracht wurde, in den Mittelpunkt der Bemühungen um sicherheitspolitische und strafrechtliche Neuerungen. - Das sogenannte »loi anti-casseurs« (Anti-Krawall-Gesetz) griff das aus dem Algerienkonflikt bekannte Prinzip der »responsabilité collective« (kollektiven Verantwortung) wieder auf und richtete sich auch gegen linksradikale Gruppen. - Auch die Verschärfung des französischen Grenzschutzes war Teil dieser »als Reaktion auf die Revolten von 1968 entwickelten Strategie zur Reproduktion und Verteidigung des Kapitalismus«. 8 - 1973 wurden sogenannte brigades anti-gangs (Anti-Gang-Brigaden) geschaffen. Zu ihren Aufgaben zählte die Bekämpfung der Alltagsdelinquenz, der organisierten Kriminalität und des Terrorismus. Der sogenannte Plan Vigipirate, ein in den letzten Jahren mehrfach aktualisiertes Bündel von Antiterrorismusmaßnahmen, trat 1978 erstmals in Kraft. Während sich die Sicherheitspolitik verschärfte, wurde auch das Migrationsregime immer restriktiver. In einer Reihe von Beschlüssen aus dem Jahr 1972 wurden Arbeitsvertrag und »ordnungsgemäßer Wohnort« (logement décent) zu Bedingungen für den Erhalt einer Aufenthaltsgenehmigung erklärt. Der Zugang zu einem legalen Aufenthaltsstatus wurde erschwert, was die Reihen der illegalisierten MigrantInnen, der Sans Papiers, anschwellen ließ. Mit dem Hinweis auf diese Sans Papiers konnte dann wiederum eine intensivere Regulierung der Migration gerechtfertigt werden. Ab 1974 galt das Recht auf »Einwanderung aus ökonomischen oder familiären Gründen« (immigration économique et familiale) nur noch für Personen aus der (damaligen) EG. 1977 führte die Regierung eine als Unterstützungsleistung kaschierte Prämie für die Rückkehr ins Ursprungsland ein. Außerdem wurden durch verschiedene administrative Maßnahmen die Möglichkeiten für migrantische Familien, einer geregelten Erwerbsarbeit nachzugehen, eingeschränkt, ebenso die Möglichkeit, sich ohne französischen Pass an der Universität einzuschreiben. 1980 wurden die ersten Abschiebegefängnisse eröffnet. Die Möglichkeiten für NichteuropäerInnen legal nach Frankreich einzuwandern oder dort Asyl zu erhalten, sind seitdem weiter eingeschränkt worden, und das sowohl unter »linken« als auch »rechten« Regierungen. In den 1960er und Anfang der 1970er Jahre noch primär als politische Bedrohung angesehen, wurden EinwandererInnen nun als ökonomische und demographische Gefahr – als Bedrohung der französischen Identität – wahrgenommen. Der »Assimilierungsdiskurs« gipfelte in der Aussage, diese erweise sich nur bei 6 Jacques Delors, damals Berater von Jacques Chaban-Delmas, kann als einer der Urheber dieses Projekts einer »neuen Gesellschaft« gelten. Delors wurde unter der Regierung Mitterrand 1981 Wirtschafts- und Finanzminister und behielt dieses Amt bis 1984. 7 Rigouste, Purifier le territoire: www.reseau-terra.eu/article738.html, Zugriff: 13.03.2009. 8 Ebd. 6 den EinwandererInnen aus außereuropäischen Ländern als problematisch. Dieser Diskurs stieß auf ein beträchtliches Echo und wirkte lange nach, wie ein Zitat des Vordenkers der französischen Sozialdemokraten, Marcel Gauchet, von 1985 belegt: »Die Prägung eines Menschen durch den Islam lässt sich nicht so einfach beseitigen, wie sich die Spuren des pikardischen Dialekts auslöschen oder die traditionell bretonische Weltsicht beseitigen ließen, und es fehlt uns am nötigen Nachdruck, um aus kleinen Senegalesen gute Franzosen zu machen, so wie uns das einmal mit kleinen Polen gelungen ist.« 9 Die gesamten 1970er Jahre hindurch kämpften Arbeitsmigranten gegen schlechte Arbeitsbedingungen und die hierarchische Spaltung der Belegschaften in den Betrieben. In der Schwer- und Automobilindustrie, wo besonders viele migrantische Arbeitskräfte beschäftigt wurden, fanden zahlreiche, meist wilde Streiks statt. 10 Die MigrantInnen wehrten sich auch gegen schlechte Wohnbedingungen. So kam es u.a. zu einem vierjährigen Mietstreik (1975-1979) in den Wohnheimen der Sonacotra (Société nationale de construction de logements pour les travailleurs – Gesellschaft für Arbeiterwohnungsbau). Schließlich wurde auch gestreikt, um gegen Abschiebungen zu protestieren. Linke Gruppen und Parteien erklärten sich mit diesen Kämpfen solidarisch. Die Mobilisierung zugunsten der Einwanderer trug auch zur organisatorischen Konsolidierung der Linken bei. Nutznießer der gestärkten und zunehmend einheitlich agierenden Linken war die Parti socialiste (PS – Sozialistische Partei), die 1981 die Präsidentschaftswahlen gewann. 1.3. Die 1980er Jahre Der Wahlsieg des PS, nach 25 Jahren »rechter« Regierung, erweckte Hoffnungen auf mehr soziale Gerechtigkeit, die sich in den ersten Monaten der siebenjährigen Amtszeit von François Mitterand auch zu bestätigen schien. Der Mindestlohn wurde um 10% erhöht, die Sozialhilfe aufgestockt, die gesetzlich vorgeschriebene Wochenarbeitszeit von 40 auf 39 Stunden gesenkt, eine fünfte Woche bezahlten Urlaubs gewährt sowie eine Vermögenssteuer eingeführt und die größten Banken und Konzerne wurden verstaatlicht. Im Bereich der Sicherheitspolitik wurden zwar einige der berüchtigsten Gesetze zur Kontrolle der Einwanderer aufgehoben, aber die grundlegenden Konzepte aus den 1960er und 1970er Jahren wurden nicht in Frage gestellt.11 Die PS hatte sich der Modernisierung des Landes, seines Staatsapparates und seiner Wirtschaft verschrieben. Die Politik der neuen Regierung zeichnete sich u.a. durch eine Vorliebe für Kulturveranstaltungen und öffentliche Feste aus, die an den Geist des Pariser Mai anknüpfen sollten. Das Feiern wurde zu einem Instrument der Modernisierung. Das Fest bestimmte geradezu den »Rhythmus des republikanischen Kalenders« ebenso wie die »enthusiastische Verherrlichung der Wissenschaft und der Technologie«.12 Die Institutionalisierung und Orchestrierung der Festkultur wurde Kulturminister Jack Lang anvertraut, auf den u.a. die Fête de la musique zurückgeht, die als »größtes Konzert der Welt« zum ersten Mal am 21. Juni 1982 stattfand. 9 Zit. nach F. Cusset, La décennie. Le grand cauchemar des années 80, Paris 2006, S. 109. 10 Pitti, Histoire politique des immigrations (post)coloniales, S. 95-111. 11 Mathieu Rigouste: L'Ennemi interieur. La généalogie coloniale et militaire de l’ordre sécuritaire dans la France contemporaine, Paris 2009. 12 Francois Cusset: La décennie. Le grand cauchemar des années 80, Paris 2006. S. 62 u. 64. 7 Die »Rodeos« von Les Minguettes und ihre Vorgeschichte Bereits seit Anfang der 70er Jahre kam es immer wieder zu Konfrontationen zwischen Jugendlichen und der Polizei im Großraum Lyon. 13 1971 führte eine rassistische Beleidigung in einem Einkaufszentrum bei Vaulxen-Velin zu einer Schlägerei mit der Polizei. 1978 wurden die ersten Rodeos gemeldet. 1979 kam es zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Einwohnern und Polizei. Seit Anfang der 70er Jahre wurde in Lyon an einer verbesserten polizeilichen Erfassung des Ballungsraums gearbeitet, einschließlich der »permanenten, präventiven und territorialisierten Überwachung gewisser Arbeiterviertel«.14 Trotzdem stand im Frühling 81 Les Minguettes, eine Lyoner Vorstadt, mit ihren futuristischen Türmen, ihren 9.000 Wohnungen, von denen viele leer standen und ihren zahlreichen Arbeitslosen im Blickpunkt der französischen Öffentlichkeit. Mitten im Präsidentschaftswahlkampf waren der katholische Priester, Christian Delorme, der evangelische Pastor, Jean Costil und der algerische Jugendliche, Hamid Boukhrouma, aus dem Viertel für einen Abschiebestopp in den Hungerstreik getreten. Mitterand besuchte sie und wollte sich im Falle eines Sieges für ihre Forderungen einsetzen. Er versprach die Legalisierung aller MigrantInnen ohne gültige Ausweispapiere, die Aufhebung des Verbots zur Gründung von Vereinen für AusländerInnen und die Gewährung des Wahlrechts bei den Kommunalwahlen. Nach dem Wahlsieg Mitterands durften Minderjährige tatsächlich nicht mehr abgeschoben werden. Und den MigrantInnen wurde erlaubt, eigene Organisationen zu gründen. Die anderen Versprechungen hielt der Präsident nur zum Teil. Von 400.000 Personen, die ohne Aufenthaltsgenehmigung in Frankreich lebten, wurden nur 100.000 legalisiert. Und bis heute dürfen sich nicht-europäische Staatsangehörige nicht an den Kommunalwahlen beteiligen. Die Polizei beantwortete den Abschiebestopp für Jugendliche mit vermehrten Razzien und Kontrollen in den Banlieues. Aufgrund des Hungerstreikes, stand Minguettes besonders im Fokus polizeilicher Maßnahmen. So standen sich dort im Laufe des Sommers 1981 mehrere Male Jugendliche und Polizisten bei gewalttätigen Auseinandersetzungen gegenüber. Etwa zehn Fahrzeuge gingen in Flammen auf. Einige wurden im Stadtzentrum gestohlen, bevor sie mit hohem Tempo durch das Viertel gefahren wurden. Diese »Zwischenfälle« – wie die Presse sie bezeichnete – erinnern an ein französisches Remake von »Denn sie wissen nicht was sie tun«15 und gingen als »Rodeos von Minguettes« in die Geschichte ein. Sie gelten als erste Episode einer langen Serie gewalttätiger urbaner Auseinandersetzungen. Öffentliches Interesse Von den Auseinandersetzungen in den 70er Jahren hatte nur die lokale Presse berichtet. Das änderte sich ab den »Rodeos von Les Minguettes«. Am 21. Juli 1981 berichtete der rechtslastige Figaro: »In den Vierteln mit hoher maghrebinischer Dichte wird die Situation explosiv (…). Die Regierung ermutigt die Delinquenten durch den Abschiebestopp für zweifelhafte Individuen«. 16 Der Figaro behauptete, die nicht mehr abschiebbaren Ausländer wären die Unruhestifter. Andere Medien griffen die Berichterstattung auf, doch erschienen die Artikel lediglich auf den hinteren Seiten, da die Ereignisse nur in lokalem Zusammenhang 13 Michelle Zancarini-Fournel, Généalogie des rébellions urbaines en temos de crise (1971-1981), in: Vingtième Siècle. Revue d’histoire, Nr. 84, 2004, S. 119-127. 14 Ebd. 15 Film mit James Dean, in dem es zu einem tragisch endenden Rennen mit gestohlenen Autos kommt. 16 Zitiert in: Gérard Noiriel, Immigration, antisemitisme et racisme en France, Paris 2005. 8 gesehen wurden.17 Schließlich übertrug zwei Monate nach den Zwischenfällen ein öffentlicher Fernsehsender seine 13 Uhr Nachrichten live aus Minguettes. In einer Reportage wurde über die Lebensbedingungen der EinwohnerInnen berichtet: die hohe Bevölkerungsdichte eines baufälligen aber teuren Viertels, den »Auszug der Franzosen«, die Verarmung, die Kriminalität, der hohe Anteil an EinwandererInnen, deren Kinder sich »nicht mehr als Maghrebiner fühlen (…) und die nicht als Franzosen akzeptiert sind«, die Jugendarbeitslosigkeit und die fehlenden Qualifikationsmöglichkeiten für Jugendliche. 18 Eine Soziologin vertrat in einem Interview die Ansicht, dass schließlich »jeder gern mit Leuten zusammenlebt, die leben wie man selber«, also mit »echten« Franzosen. Im Gegensatz dazu versuchte ein Mann, umringt von anderen Jugendlichen des Viertels, deren Position zusammenzufassen: Sie wollen, dass ihnen »die Möglichkeit gegeben wird, sich auszudrücken«, dass sie »von jemand Kompetentem repräsentiert werden«, dass sie »von allen Leuten gehört werden« über das Viertel hinaus, und dass die Leute versuchen, sie zu verstehen«. Er betonte die Entschlossenheit, sich aus der Verachtung zu befreien, der die Ärmsten der Bevölkerung ausgesetzt seien. Sie forderten politische Integration und die Anerkennung der Immigration als wesentlicher Bestandteil der französischen Gesellschaft. Die Sozialistische Partei und die Banlieues Frankreich war 1981 durch den Wahlsieg Mitterands ein Land im Aufbruch. Die Wirtschaftspolitik des PS war nachfrageorientiert: Durch eine Stärkung des Konsums sollte die wirtschaftliche Entwicklung angekurbelt werden. Technologische Innovation sollten Frankreich nach vorne bringen. So weihte Mitterand Ende September 81 in Lyon die erste TGV-Verbindung ein. Seitdem liegt die Hauptstadt der Region Rhône-Alpes nur zweieinhalb Zugstunden von Paris entfernt. Die Ereignisse in Minguettes, das nur unzureichend mit öffentlichen Verkehrsmitteln erschlossen war, schienen von Lyon weiter entfernt zu sein, als der Eiffelturm. Von den Sicherheitspolitischen Leitlinien wollten die Sozialisten allerdings nicht abrücken. »Ich will, dass auf den Straßen Tag und Nacht uniformierte Polizisten zu sehen sind«, erklärte Innenminister Gaston Defferre. 19 Die festgenommenen Jugendlichen von Les Minguettes wurden zu hohen Haftstrafen verurteilt. Eine Kommission von Lokalpolitikern wurde beauftragt, neue Sicherheitsmaßnahmen zu entwickeln. 20 Nur wenige Monate nach der Wahl kam die »linke« Regierung jedoch nicht umhin, soziale Maßnahmen einzuleiten. Eine zweite Kommission von Lokalpolitikern wurde beauftragt, ein umfassendes sozialpolitisches Konzept für den Umgang mit den Banlieues zu entwickeln. Dieser sogenannten »Nationale Kommission zur sozialen Entwicklung der Viertel (CNDSQ) saß Hubert Dubedout, Bürgermeister von Grenoble und aktives Mitglied der deuxième gauche (zweite Linke), vor.21 Seine Ernennung sprach für die Ratlosigkeit der Regierung angesichts der unerwarteten Schwierigkeiten in den Banlieues. Die parteiinterne Opposition bekam die Aufgabe zugeteilt, die man sich selbst anzugehen scheute. Die Dubedout-Kommission 22 knüpfte an das HVS-Programm der 1970er Jahre an und schlug eine Kombination aus Sanierungsmaßnahmen und Kulturveranstaltungen vor. Diese Vorschläge ergänzten die Repressionspolitik. Wer nicht abgeschoben wurde, sollte »integriert« werden. 17 Sylvie Tissot, L’Etat et les quartiers. Genèse d’une categorie de l’action publique, Paris 2007, S. 21. 18 Siehe Archive Ina: www.ina.fr. La vie à Vénissieux. MIDI 2 A2 – 22/09/1981 – 00h05m33s. 19 Zitiert in Nicole Bachmann / Christian Le Guennec, Violences urbaines, Paris 2002. 20 Siehe unten im Text, dritter Absatz. 21 Die »deuxième gauche« war eine sozial-liberale Minderheitenströmung innerhalb der Sozialistischen Partei. Sie forderte u.a. die Partizipation der Zivilgesellschaft an der lokalen Verwaltung. 22 Nach ihrem Vorsitzenden wird die CNDSQ auch Kommission Dubedout genannt. Auf die im Bericht entwickelten Analysen und Strategien, die ab 1983 umgesetzt wurden, wird weiter unter eingegangen. 9 Parallel zur CNDSQ befassten sich andere Kommissionen mit der Jugendarbeitslosigkeit und der Reform des Schulwesens. Die Vorschläge dieser Kommissionen zielten auf eine verbesserte berufliche Eingliederung der Jugendlichen. Bestimmte Gebiete wurden zu »zones d’éducation prioritaire« (ZEP – bildungspolitischen Schwerpunktgebieten) ernannt. Die als ZEP deklarierten Gebiete waren in etwa mit den früheren ZUP identisch. Die dort gelegenen Schulen erhielten Zuschüsse. Die Unterrichtsmethoden wurden allerdings nicht in Frage gestellt – dieser Ansatz aus der Zeit um 1968 hatte sich überlebt. 1982 gab es die ersten Aktivitäten gegen sommerliche Unruhen (anti-été-chaud, wörtlich: gegen den heißen Sommer). Unter dem Vorwand, Jugendlichen aus sozial benachteiligten Stadtvierteln die Möglichkeit zu Fernreisen zu bieten, wurden jene Jugendliche, die als unangepasst galten, den Sommer über aus den Siedlungen entfernt. So durften die Teenager von Les Minguettes im Sommer 1982 in vom Militär zur Verfügung gestellten Zelten kampieren. Es sollte sich jedoch zeigen, dass solche Aktivitäten nicht ausreichten, um weitere Auseinandersetzungen in der Siedlung zu verhindern. Sie waren aber als Modellversuch von Bedeutung, schufen sie doch die Grundlage für einen neuen Umgang des Staates mit den Banlieues: »Partnerschaft« war der Überbegriff für diese neue Politik. 23 Verschiedene soziale und politische Akteure sollten von nun an in Fragen der Prävention und der Sicherheit kooperieren und ihre Kompetenzen einbringen. Der Umbruch von 1983: Austeritätspolitik und Rassismus Trotz der nachfrageorientierten Wirtschaftspolitik kam die Ökonomie nicht wie vorgesehen wieder in Gang. 1982 gab es fast zwei Millionen Arbeitslose. Der Französische Franc wurde abgewertet, ein Lohn- und Preisstopp angeordnet. 1983 schwenkte die Regierung auf einen rigorosen Sparkurs um. Die Sozialisten bekehrten sich zum Neoliberalismus, die Regierung forcierte eine Reihe der üblichen Reformen (Rationalisierung, Automatisierung, Entlassungen, Leiharbeit usw.). Im Frühling 1982 kam es in der Automobilindustrie zu heftigen Arbeitskämpfen, durch die die zahlreichen Migrationsarbeiter in diesem Sektor deutlich sichtbar wurden. Ihre Kampfbereitschaft war groß, denn sie wurden in den am schlechtesten bezahlten Jobs eingesetzt und standen am unteren Ende der hierarchischen Arbeitspyramide.24 Zwar wurden neue gewerkschaftliche Rechte erkämpft, letzlich gingen die Arbeitskämpfe jedoch verloren. Die Automobilindustrie steckte in einer Krise. Weitere Automatisierungen sollten für eine Senkung der Kosten sorgen. Von nun an sollten nur qualifizierte Arbeiter festangestellt werden. Es kam zu Massenentlassungen, die in den Arbeitervierteln heftigen Unmut provozierten. Den (gering qualifizierten) Einwanderern wurde eine Mitschuld an den Schwierigkeiten der Automobilindustrie nachgesagt. Solch rassistische Positionen wurden bis weit in die politische Klasse hinein vertreten. Premierminister Pierre Mauroy äußerte die Ansicht, die »wichtigsten noch ungelösten Probleme« würden auf »eingewanderte Arbeiter« zurückgehen. Diese würden »von religiösen und politischen Gruppen aufgewiegelt, deren Ideen wenig mit den gesellschaftlichen Realitäten Frankreichs zu tun [hätten]«. 25 Indem er einen Zusammenhang zwischen religiösem Fanatismus und den Streiks in Frankreich unterstellte, nahm 23 Das »anti-été-chaud«-Programm führte zu zahlreichen Forschungsprojekten und zu ersten großen soziologischen Untersuchungen über die Jugendlichen in den Banlieues. 24 Laure Pitti, La main d’oeuvre algérienne dans l’industrie automobile (1945-1962), ou les oubliés de l’histoire, in: »Hommes et migrations« n°1263, sept.-oct. 2006. 25 Nicolas Hatzfeld et Jean-louis Loubet: Les conflits Talbot, du printemps syndical au tournant de la rigueur (19821984), Vingtième Siècle. Revue d’histoire 84, 2004, S. 159. Der Hintergrund des aufkommenden antiislamischen Rassismus bildet die Revolution im Iran. 10 Mauroy die Eckpunkte eines neuen Diskurses über die postkoloniale Immigration vorweg, der die Einwanderer und ihre Kinder mit Islamismus und Terrorismus in Verbindung bringt. So war es kein Zufall, dass der Front National bei den Kommunalwahlen von 1983 erfolgreich abschnitt. Dem Wahlerfolg der Rechtsextremen ging eine Kampagne voraus, in deren Mittelpunkt die »Verteidigung französischer Arbeitsplätze« und die Dämonisierung der Einwanderer standen. Im gleichen Jahr erschütterte eine Serie von rassistischen Morden die Öffentlichkeit. In Les Minguettes hatte sich das Verhältnis zwischen den EinwohnerInnenn und der Polizei nicht entspannt. Jugendliche schlossen sich in einem Verein namens SOS Avenir Minguettes zusammen. Sie forderten an den Sanierungsarbeiten im Viertel beteiligt zu werden sowie die Einrichtung einer unabhängigen Untersuchungskommission zur Polizeigewalt. Wie von den Jugendlichen befürchtet, eskalierte die Situation. Als der Präsident von SOS Avenir Minguettes, Toumi Djaïdja, versuchte, während eines massiven Polizeieinsatzes zu schlichten, traf ihn eine Kugel im Bauch. Die AktivistInnen von Les Minguettes reagierten. Sie organisierten eines landesweiten Protestmarsch »für die Gleichheit und gegen den Rassismus« nach dem Modell der gewaltlosen Initiativen von Ghandi und Martin Luther King. Dabei erhielten sie die Unterstützung christlicher, humanistischer und anti-rassistischer Netzwerke, politischer Parteien und Gewerkschaften und mobilisieren viele nichtorganisierte Jugendliche. Die antirassistische Bewegung, die sich bis dahin auf die Verteidigung der zugewanderten Arbeiter konzentriert hatte, veränderte sich radikal. Plötzlich ergriffen auch Jugendliche und Frauen das Wort. Vereinnahmung des Antirassismus Der »Marsch für die Gleichheit und gegen den Rassismus« startete am 15. Oktober in Marseille und erreichte am 3. Dezember Paris, wo er von mehr als 100.000 Menschen feierlich empfangen wurde. Im Demonstrationszug waren keine Fahnen oder parteipolitischen Symbole zu sehen. Es gab lediglich ein Transparent mit der Aufschrift: »Steckt die Waffen ein, wir kommen. Die Jagd ist beendet!« Arabische Mütter liefen vorneweg und hielten die Fotos ihrer ermordeten Kinder in den Händen, ein Bild, das an die damaligen Demonstrationen in Chile erinnerte. Die Organisatoren des Marsches wurden von Präsident Mitterand empfangen. Er kündigte die Vergabe zehnjähriger Aufenthaltsgenehmigungen – die eine Arbeitserlaubnis beinhalteten – sowie die Erweiterung des Strafgesetzbuches um den Tatbestand des rassistischen Übergriffs an. Außerdem verpflichtete sich die Regierung, die »soziale Entwicklung der Stadtviertel« fortan zu einem Schwerpunkt ihrer Politik zu machen. Dieses scheinbare Entgegenkommen der PS verhinderte jedoch nicht die Verschärfung des französischen Aufenthaltsrechts nur wenige Monate später. Der Marsch von 1983 markierte den Auftritt der Einwandererkinder auf der politischen Bühne. Sie formulierten deutlich ihre Kritik an der französischen Gesellschaft. Die »zweite Generation« wollte ihre Zugehörigkeit zur republikanischen Gemeinschaft und die sich daraus ergebenden Rechte durchsetzen. Gleichzeitig sollte der Marsch ihre an die Geschichte ihrer Immigration und Kämpfe gebundene Identität unterstreichen. 11 Der Marsch wurde in den Medien bezeichnenderweise seines ursprünglichen Namens beraubt und in »Marsch der Araber« (marche des beurs) umbenannt. Diese Bezeichnung, die sich im historischen Gedächtnis Frankreichs festgesetzt hat, ist symptomatisch für die Rezeption dieser einzigartigen politischen und kulturellen Bewegung, eine Rezeption, die auf Vereinnahmung hinauslief. 1984 wurde ein zweiter landesweiter Marsch organisiert, an dem sich allerdings bedeutend weniger Menschen beteiligten. Doch entstanden im Zuge der Mobilisierung zahlreiche mittels Staatsgeldern gefördete Organisationen, von denen SOS Racisme am bekanntesten wurde. In den Banlieues verfügte SOS Racisme über so gut wie keine Basis, dafür bestanden jedoch freundschaftliche Beziehungen zur PS. Die Regierung, die aufgrund ihrer Austeritätspolitik erheblich an Popularität eingebüßt hatte, erkannte die Vorteile, die sich aus einem Aufgreifen antirassistischer Themen ergaben. Die autonom 26 agierenden Segmente der antirassistischen Bewegung wurden damit an den Rand gedrängt. Zugleich wusste die PS natürlich um das politische Gewicht der »zweiten Generation«. Immerhin verfügten die Kinder der Einwanderer über 800.000 Wählerstimmen. Ab 1985 war das Symbol, die kleine gelbe Hand, von SOS Racisme allgegenwärtig. Kein Prominenter, der das Logo nicht an seiner Jacke zur Schau stellte, wenn er im Fernsehen auftrat. Unter dem Motto Ne touche pas à mon pote (Rühr meinen Kumpel nicht an) wurden Popkonzerte organisiert, die Hunderttausende anzogen. Auf eine einfache moralische Forderung reduziert und von jeder effektiven politischen Praxis entkoppelt, gerieten der Antirassismus von SOS Racisme und sein »multinationales Unternehmen der Freundschaft« in die Kritik. Viele Aktivisten misstrauten der Wiederannäherung an die politische Klasse und der im Umfeld von SOS Racisme sich bewegenden beurgeoisie.27 Eine andere, fremdenfeindliche Kritik kam aus dem rechten Lager. »Werden wir in 30 Jahren immer noch Franzosen sein?«, fragte Le Figaro und brachte auf der Titelseite der Ausgabe vom 24. Oktober 1985 das Bild einer verschleierten Marianne. Schließlich kam auch aus der PS Kritik. Bildungsminister Chevènement warf SOS Racisme Verrat an den republikanischen Werten und mangelnde Abgrenzung vom Islam vor. Der Integrationsbegriff wurde zum festen Bestandteil des politischen Diskurses der Linken. Den Einwanderern wurde der Verzicht auf jeglichen Versuch, ihre Positionen jenseits der politischen Linie der PS auszudrücken, abverlangt – sie sollten ins Korsett des Staatsbürgers geschnürt werden. Schließlich könne einzig die Republik sie vor Rassismus und den Wechselfällen des Marktes schützen. Das Unterwerfungsdispositiv der republikanischen Rhetorik war in Gang gesetzt. Bald schon sollte es, im Zuge der ersten öffentlichen Debatten über den muslimischen Schleier, außer Kontrolle geraten. In der Politik der »sozialen Entwicklung«, die auf die Wiederherstellung der staatlichen Kontrolle über die Banlieues zielte, wurde dieses Unterwerfungsdispositiv praktische Politik. 2. »Soziale Entwicklung der Stadtviertel« (DSQ) 26 »Autonom« bezeichnet hier die Unabhängigkeit von den Parteien. 27 Beurgoisie: Wortspiel, Vermischung von bourgeoisie (Bürgertum) und beur (Araber). Bezeichnung für gut situierte Personen mit arabischem Hintergrund. 12 2.1. Der Dubedout-Bericht Die nach den Vorfällen von Les Minguettes im Sommer 1981 eingesetzten Dubedout-Kommission wollte die Verzahnung von lokalen Verwaltungsstrukturen und zivilgesellschaftlichen AkteurInnen vorantreiben. Der Ende 1982 vorgelegte Bericht der Kommission »Die Stadt gemeinsam neu gestalten«, wurde breit rezipiert und prägte den staatlichen Umgang mit den Banlieues nachhaltig. Der Bericht diagnostizierte eine »Krise des urbanen Modells, dem es nicht mehr gelinge, den Pluralismus der sozialen und ethnischen Gruppen, aus denen sich die französische Gesellschaft zusammensetze, gerecht zu werden«.28 Das eigentliche Krisenphänomen – die Frankreich seit den 70er Jahren heimsuchende soziale Krise, die in der Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse, Massenarbeitslosigkeit und Verarmung der Unterklassen zum Ausdruck kam – wurde ausgeklammert, um stadtplanerische Probleme in den Mittelpunkt zu rücken. Doch nicht die stadtplanerischen Beschlüsse der Nachkriegszeit, die Abgeschiedenheit der Siedlungen, ihre schlechte Bauqualität oder das Fehlen von Gemeinschaftseinrichtungen wurden als problematisch benannt, sondern die Entwicklung der Banlieues zu migrantisch geprägten Vierteln seit dem weitgehenden Exodus der Mittelschichten. Sie seien keine Orte, an denen die erfolgreiche Assimilierung in die französische Gesellschaft gewährleistet sei. Als »Eingangspforten in die Stadt und in die Republik« hätten sie sich nicht bewährt. Es drohe eine Entwicklung hin zu einer »Ghettoisierung« und »rassischen Aufständen« wie in den USA.29 Gleichzeitig unterstellte der Bericht den MigrantInnen ein doppeltes Versagen: Weder in der französischen Gesellschaft noch in den politischen Strukturen der Republik seien sie aufgegangen. Da die ökonomischen Hintergründe, unter denen die MigrantInnen am stärksten zu leiden hatten, außer Acht gelassen wurden, blieben als Problemursache nur noch die Einwanderer selbst. Damit wurde die Ausgrenzung der EinwohnerInnen der Banlieues weiter festgeschrieben. 2.1.1. Renovierung der HLM-Viertel unter Einbeziehung der Bewohner Der Bericht initiierte das Programm DSQ – Soziale Entwicklung der Stadtviertel. Der Begriff des Quartier(s), der in der Ära funktionalistischer Stadtplanung als antiquiert galt, kam wieder in Mode. Dahinter verbarg sich die Hoffnung, eine simple terminologische Änderung – von »Vierteln« statt von Cités HLM (HLM-Siedlungen) zu sprechen – könne genügen, um die vermeintlich in Auflösung begriffene Gesellschaftlichkeit in den Banlieues wiederherzustellen und in die städtischen Strukturen einzubinden. Neu war der Begriff der »sozialen Entwicklung«. Er sollte weniger an sozialpolitische Maßnahmen als an wirtschaftliche Entwicklung erinnern – und damit die Möglichkeit einer planmäßigen Herstellung und Stärkung von Gesellschaftlichkeit suggerieren. Politisch drückte das Programm den Konsens über das Verschwinden des Wohlfahrtsstaates aus und ging in die gleiche Richtung wie das HVS-Programm von 1977: Es sollten nur lokal begrenzte Staatshilfen gewährt 28 Zit. nach Jacques Donzelot / Catherine Mével / Anne Wyvekens: Faire société. La politique de la ville aux EtatsUnis et en France, Paris 2003, S.105. 29 Die Aufstände von Brixton, die sich nur wenige Wochen vor denen in Les Minguettes ereigneten, wurden jedoch nicht als Vergleich herangezogen. Die politische Klasse Frankreichs scheute offenbar die Auseinandersetzung mit den Parallelen zwischen den sozialen und politischen Verwerfungen in England und Frankreich. 13 werden. Die in den 70er von Linksradikalen entwickelten Prinzipien der Selbstorganisation wurden zur Staatspolitik.30 Der Bericht diskutierte verschiedene Lösungsansätze wie den der Zerstreuung der MigrantInnen über die ganze Stadt oder die Festsetzung von Ausländerquoten pro Gemeinde, um die »Ghettos« der armen Einwanderer aufzulösen. Offensichtlich rassistische Ansätze, die aus unterschiedlichen Gründen wieder verworfen wurden. Fassaden neu streichen, gemeinnützige Einrichtungen bauen, Kultur- und Sportvereine finanzieren, waren schließlich die wichtigsten konkreten Aktivitäten im Rahmen des DSQ-Programms. Keine grundlegenden baulichen Veränderungen, sondern das Renovieren der Wohnsiedlungen unter Beteiligung der BewohnerInnen hatte erhebliche finanzielle Vorteile. Staatliche Kredite erlaubten es ab 1983, in 150 Banlieue-Siedlungen entsprechende Programme einzuleiten. Als unerlässliche Voraussetzung für den Erfolg der DSQ-Programme galt die Beteiligung der EinwohnerInnen. Nach den Vorstellungen der Dubedout-Kommission sollte eine Dynamik der Partizipation in Gang gebracht werden, die die Banlieue-BewohnerInnen zur Selbsthilfe befähigen und aus der Abhängigkeit staatlicher Unterstützung befreien würde. Einerseits sollten also Sozialausgaben gesenkt, die finanzielle Belastung des Staates reduziert werden und andererseits sollte die Partizipation der BewohnerInnen zur Wiederherstellung von sozialen Bindungen beitragen, um so eine vormals über Beruf oder Partei- und Gewerkschaftszugehörigkeit gewährleistete Gesellschaftlichkeit neu herstellen. Die Viertel würden dadurch eine als fehlend betrachtete Identität herausbilden und für BewohnerInnen wie Investoren an Attraktivität gewinnen. Zunächst sollten DSQ-Subventionen nur dort fließen, wo die BewohnerInnen zuvor in Eigeninitiative ein passendes Projekt entwickelt hatten. Da es an solchen Projekten mangelte, wurden umgekehrt den BewohnerInnen bestimmte über lokale Vereine vermittelte Projekte (etwa die Organisation von sportlichen oder kulturellen Aktivitäten) vorgeschlagen. Allerdings waren für die Ausführung der DSQ-Projekte dann nicht die Vereine, sondern die jeweilige Verwaltung zuständig, die diese auch ko-finanzieren musste. Darüber hinaus hatten die Städte einen Abgeordneten als Ansprechpartner für die BewohnerInnen zu ernennen, was kaum zu einer verbesserten Kommunikation zwischen BewohnerInnenn und Verwaltung beitrug. Schließlich waren die lokalen Verwaltungen verpflichtet »Kommunale Räte für die Soziale Entwicklung der Stadtviertel« zu gründen, die sich als bürokratische Einrichtungen zur effizienten Abwicklung der DSQ-Maßnahmen, aber nicht als Foren für einen offenen Dialog über die Zukunft der Viertel, erwiesen. 2.1.2. Ausbau und Institutionalisierung von DSQ Die mit der landesweiten Koordination der DSQ-Programme beauftragten Institutionen wurden zwischen 1983 und 1988 ausgebaut. 1984 wurde das »Interministerielle Komitee der Städte« (CIV) ins Leben gerufen, das bis heute regelmäßig tagt, um Banlieue betreffende Themen zu verhandeln. Die Verlautbarungen und Beschlüsse des Komitees werden noch immer meist ohne jeden kritischen Kommentar in den Medien wiedergegeben. 30 Dies ermöglichten nicht nur ehemalige Linksradikale, die nun innerhalb des Staatsapparates am DSQ-Programm arbeiteten, sondern auch Gewerkschaften wie die CFDT, die die Prinzipien der Selbstorganisation in reformistische Ansätze ummünzten. 14 Auch der »Fonds für städtische Solidarität« (FSU) wurde 1984 gegründet. Er wurde von der Zentralregierung unterhalten und unterstützte die ärmsten Vorstadtgemeinden, die nicht über die Mittel Schulen, Kindergärten, kulturelle sportliche und ähnliche Einrichtungen zu finanzieren, verfügten – war aber nur mit geringen Mitteln ausgestattet und konnte sie nur wenig entlasten. 1988 wurde die CNDSQ-Kommission durch zwei neue Organisationen ersetzt: die Délégation interministérielle à la ville (DIV – interministerieller Ausschuss für die Stadt) und den Conseil national des villes (CNV – Nationaler Rat der Städte). Der CNV ist ein rein beratendes Gremium, das sich paritätisch aus LokalpolitikerInnen, StadtexpertInnen und VertreterInnen zivilgesellschaftlicher Organisationen zusammensetzt. Die DIV ist fester Bestandteil des Staatsapparats und beschäftigt sich ausschließlich mit den Banlieues. An ihr wird die fortschreitende Institutionalisierung der DSQ-Programme im Laufe der 1980er Jahre besonders deutlich. Immer mehr DSQ-Projekte wurden initiiert und die Verfahren vereinheitlicht. Schon bald gab es Projekte in 400 Stadtvierteln. Am Anfang stand stets die Erklärung eines Stadtviertels zum sozialen Brennpunkt und die genaue Erfassung seiner besonderen sozialen Bedingungen. Darauf folgte die Festlegung auf bestimmte Maßnahmen. Die Möglichkeiten, auf Bedürfnisse der BewohnerInnen zu reagieren, blieben, nachdem dieser Entscheidungsprozess einmal in Gang gekommen war, beschränkt. Die Formalisierung des Ablaufs sollte die Projekte vergleichbar und besonders erfolgreiche Strategien als solche erkennbar machen. Das ursprüngliche Ziel der Selbsorganisation wurde zu einem standardisierten Kontrollsystem des sozialen Lebens im Stadtteil durch die Stadtverwaltung. 2.2. Der Aufstand von Vaulx-en-Velin als Wendepunkt Am 6. Oktober 1990 löste der Tod von Thomas Claudio, einem jungen Bewohner der Lyoner Vorstadt Vaulxen-Velin, einen mehrtägigen Aufstand aus. Nacht für Nacht kam es in der Siedlung Mas-du-Taureau zu Auseinandersetzungen zwischen Jugendlichen und der Polizei. Autos wurden angezündet, ein Einkaufszentrum geplündert. Offiziellen Angaben zufolge war Thomas Claudio zu Tode gekommen, nachdem er mit seinem Motorrad gegen eine Polizeisperre gestoßen war, doch die BewohnerInnen des Viertels glaubten diese Version nicht. Zu viele andere Jugendliche waren bereits durch die Polizei ums Leben gekommen. Diese bestand auf ihrer Sichtweise und wies jede Verantwortung für Claudios Tod zurück. Der schwelende Konflikt zwischen der Bevölkerung und der Polizei rückte durch den Aufstand in den Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit. Anders als bei den Rodeos von Les Minguettes berichtete die nationale (und internationale) Presse unverzüglich und umfangreich über die Ereignisse. Auf die Ursachen des Aufstandes wurde allerdings kaum eingegangen. Er wurde als Symptom einer unbestimmten, in den Banlieues schwelenden Wut gedeutet, wo sich die Probleme der gesamten Gesellschaft bündelten .31 Einzig die Libération nannte die Namen einiger Dutzend Personen, die im Laufe der 1980er Jahre bei Polizeieinsätzen gestorben waren; die meisten mit migrantischem Hintergrund. Doch auch die Libération vermied die weitere Analyse des Sachverhalts. Die Wochenzeitung L’Express fragte mit scheinbarer Naivität: »Genügt der tragische Tod eines jungen Motorradfahrers, um den Aufstand in Vaulx-en-Velin zu erklären?« 31 Vgl. Tissot, S. 26-29. 15 Der Aufstand erschien aus dieser Perspektive wie ein Rätsel, dessen versteckten Sinn es ans Tageslicht zu befördern galt. Er war umso unbegreiflicher, als Mas-en-Taureau für ein Erfolgsmodell des DSQ gehalten wurde. Der mediale Konsens lautete: an der »Sozialen Entwicklung der Stadtviertel« gibt es nichts auszusetzen. Kein Aufstand durfte das Vertrauen in die DSQ-Politik in Frage stellen. »Die Methode des Staates ist richtig,« erklärte Mitterand im Dezember 1990 anlässlich eines Besuchs der Lyoner Vorstadt, der DSQ-Politik hätten lediglich die nötigen Mittel gefehlt. Für die Projekte in insgesamt 400 Stadtvierteln waren ca. 100 Millionen Euro zur Verfügung gestellt worden. Hinter der Entscheidung, an der DSQ-Politik (vorläufig) festzuhalten, stand die Einschätzung, die HLMSiedlungen würden sich immer weiter von der übrigen französischen Gesellschaft weg entwickeln, was staatliches Eingreifen erforderlich mache. Was als sozialstaatliche Kontinuität verkauft wurde, beinhaltete tatsächlich eine radikale Transformation sozialstaatlicher Institutionen unter den Leitbegriffen der Modernisierung und Dezentralisierung. 2.3. Exklusion und »neue soziale Frage« Der Begriff des »Quartiers« wurde wieder fallen gelassen und die DSQ-Politik wich der Politique de la ville, die auch unter »Soziale Entwicklung der Stadt« (Développement social urbain) firmierte. Bei diesem neuen Ansatz ging es weniger um eine endogene Entwicklung des gesellschaftlichen Lebens in bestimmten Stadtvierteln, als um die Anbindung dieser Viertel an den Rest der Stadt. Diese Neuausrichtung beruhte auf einem Paradigmenwechsel in den Sozialwissenschaften. Seit Mitte der 80er Jahre warf eine Strömung der französischen Soziologie um Alain Touraine eine »neue soziale Frage« auf. Ihr zufolge war die soziale Frage früherer Zeiten – die des Klassenkonflikts –, nunmehr dem Problem der »Exklusion« gewichen. Die Gesellschaft bestehe nicht mehr aus Klassen, sondern sei auf zwei Gruppen reduziert: Den Menschen, denen gesellschaftliche Teilhabe noch möglich sei, stehe ein wachsendes Heer von »Ausgegrenzten« gegenüber. Die Verschärfung der Arbeitsbedingungen und die gravierende Arbeitslosigkeit seien »der Exklusion und dem Problem der Stadt« gewichen, so wie die »Ausbeutung der Ausgrenzung« gewichen sei.32 Allerdings bestimme die Arbeit »die Identität der Menschen nicht mehr so stark wie in der Industriegesellschaft«.33 An die Stelle der Arbeit seien »die ethnische Herkunft, das Geschlecht, der Bildungsgrad, die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Region und das Alter« getreten, also all das, woran sich die Protest- und Emanzipationsbewegungen der 1970er Jahre orientiert hatten. Dagegen wurde die neue soziale Frage der Exklusion mit Fragen »der Immigration, der jugendlichen Delinquenz und der Unsicherheit« und den gewalttätigen Auseinandersetzungen mit der Polizei, den sogenannnten violences urbaines, in Zusammenhang gebracht.34 Somit drohe ein Zerfall der Gesellschaft. Die intellektuelle Elite Frankreichs akzeptierte dieses Modell weitgehend, ebenso die Mitarbeiter der DIV, unter denen sich viele ehemaligen 68er befanden. 35 Die Zustimmung zu Touraines soziologischem Paradigma sollte nachhaltige Auswirkungen auf den staatlichen Umgang mit den Banlieues entfalten. Touraine war vom Anbruch einer postindustriellen Ära überzeugt, in der zivilgesellschaftliche Organisationen eine ähnlich bedeutende Rolle spielen würden wie zuvor die Organisationen der Arbeiterbewegung bei der Integration der Arbeitern in die kapitalistische Gesellschaft. Zur gleichen Zeit begannen immer mehr 32 33 34 35 Ebd., S. 7. Dubet u. Lapeyronnie, S. 26. F. Dubet u. D. Lapeyronnie, Les Quartiers d’exil, Paris 1992, S. Vgl. Tissot, S. 62-106. 16 SoziologInnen, die lange zur Arbeiterbewegung geforscht hatten, sich mit den Banlieues und ihren BewohnerInnen zu befassen, wobei ihr Interesse insbesondere Jugendlichen mit migrantischem Hintergrund und der Delinquenz galt. François Dubet, der 1987 seine Studie La galère veröffentlichte,36 beschrieb das Aufkommen einer neuen Epoche, die jene der Banlieues rouges ablöse und in der es keinen Klassenkonflikt mehr gebe. Die Jugendlichen der Banlieues seien, da vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen, nicht mehr fähig, auf die Identitäts- und Integrationsangebote früherer Zeiten (Gewerkschaften, politische Parteien) zurückzugreifen und fänden sich stattdessen in einem leeren, ungeregelten Universum wieder. Die Vororte würden zum Raum einer verfallenden Ordnung und der Exklusion. Es gelte nun, die Transformation der Vorstädte den Experten zu überlassen. 3. Politique de la ville: Die Banlieue als Experimentierfeld 1991 wurde ein ministère de la ville (Städteministerium) eingerichtet, das seitdem unter dem Dach des Sozialministeriums für den Umgang mit den Banlieues zuständig ist. Die Politique de la ville übernahm die Hauptfunktion der DSQ, die Verwaltung des Vereinslebens. Ihr wurden darüber hinaus zwei grundlegende Aufgaben zugeteilt: Die Förderung der »sozialen Durchmischung« (mixité sociale) und die »Modernisierung« öffentlicher Dienstleistungen in den »benachteiligten Vierteln«. Parallel wurden in den Banlieues die Sicherheitskräften umgestaltet und verstärkt. Somit wurden die Stadtviertel zum Laboratorium für neue Formen des Regierens. 3.1 Neue rassistische Diskurse und Praktiken Das Konzept der mixité sociale Das 1991 verabschiedete »städtische Orientierungsgesetz« (loi d’orientation pour la ville, LOV), auch bekannt als »Anti-Ghetto-Gesetz«, galt als Antwort der Regierung auf den Aufstand in Vaulx-en-Velin. In den dazugehörigen Debatten war immer wieder davon die Rede, dass es in den Banlieues eine stärkere soziale Durchmischung (mixité sociale) durchzusetzen gelte. Zwei Aspekte des LOV wurden als besonders bedeutsam eingeschätzt. Zum einen wurde ein »Recht auf die Stadt« (droit à la ville) proklamiert, das als Recht der StadtbewohnerInnen auf »Lebensbedingungen und ein Lebensumfeld [definiert wurde], die geeignet sind, den sozialen Zusammenhalt zu fördern und Segregationserscheinungen zu vermeiden oder zu beseitigen«. Diese Regelung verpflichtete den Staat und die lokalen Behörden, »die Wohnmöglichkeiten, die öffentlichen Einrichtungen und die öffentlichen Dienstleistungen zu diversifizieren«. Zum zweiten sollte in den Stadtbezirken, die in Ballungsräumen lagen und mehr als 3.500 Einwohner hatten, ein Anteil von 20% des Gesamtwohnungsbestandes als Sozialwohnungen geschaffen werden. Somit sollte das Gesetz nicht nur symbolischen Charakter haben, sondern konkret die Verteilung des sozialen Wohnungsbaus – bzw. der Armen – über die städtischen Gebiete regeln. 37 Solange das Ideal sozial »durchmischter« Städte nicht erreicht sei, sei es Aufgabe der Politique de la ville, 36 F. Dubet, La Galère. Jeunes en Survie, Paris 1987 Galère bedeutet sowohl Sklavenschiff als auch Zwangsarbeit. Hier steht es umgangssprachlich für die ganzen Schwierigkeiten, die entstehen, wenn man kein Geld hat. 37 Diese Zielsetzung spielte im Umgang mit den Banlieues während der nächsten Jahre eine bedeutende Rolle. Das 2000 unter Jospin verabschiedete »Gesetz für urbane Solidarität und Erneuerung« (loi solidarité et renouvellement urbains) greift die 20%-Richtlinie des LOV wieder auf; sie gilt dort für Bezirke mit mehr als 3.500 Einwohnern, in Städten mit mehr als 50.000 Einwohnern. Bezirke, die der Quote nicht gerecht werden, müssen ein Bußgeld entrichten. 17 für den »sozialen Zusammenhalt« in den Banlieues zu sorgen. Dabei müssten »innovative« Programme gefördert werden, auch mit dem Ziel den verknöcherten, gegenüber den gravierenden Problemen der Banlieues ohnmächtigen Staatsapparat, zu reformieren. Insofern wurde die Politique de la ville als »Ausnahmepolitik« bezeichnet und legitimiert. Somit konnte die Politik der »Ausnahme« zum permanenten Umgang des Staates mit den Banlieues werden, was die Ausweitung der dort gestesten Masnahmen auf das ganze Territorium bzw. die gesamte Bevölkerung ermöglichte. Das »Recht auf die Stadt« blieb eine bloße Proklamation. Die betroffenen Bezirke widersetzten sich der Verpflichtung zum sozialen Wohnungsbau, bis die 20%-Richtlinie infolge des Wahlsiegs der Rechten 1993 schließlich aufgehoben wurde. 1995 gewann Jacques Chirac mit einer am Thema der »sozialen Spaltung« ausgerichteten Kampagne die Präsidentschaftswahl. »Soziale Durchmischung« bedeutete nun, die Mittelschicht in die Banlieues zurückzuholen – beispielsweise indem man den höheren Mietsatz für BewohnerInnen von Sozialwohnungen, deren Einkommen eine gewisse Höhe überschritt, abschaffte. Chiracs Auffassung von der mixité sociale stieß in der politischen Klasse auf breite Zustimmung und prägt bis heute den staatlichen Umgang mit den Banlieues. Ethnisierung des stadtpolitischen Diskurses Der Begriff der »sozialen Durchmischung« verweist unausgesprochen auf den Begriff der »ethnischen Durchmischung«. Die Sorge um die Entstehung »ethnischer Ghettos« waren Anfang der 1980er Jahre bereits im Dubedout-Bericht zum Ausdruck gekommen; im Zuge der Parlamentsdebatten um das LOV tauchte sie wieder auf. Die Abgeordneten der »Rechten« wie der »Linken« hüteten sich zwar davor, offen von »Ghettos« oder »ethnischer Durchmischung« zu sprechen, doch dienten solche Vorstellungen implizit als Grundlage ihrer Überlegungen. Das bezeugt beispielsweise ein im Parlament diskutierter Vorschlag zur Ergänzung des LOV um eine Klausel, nach der die Zuteilung von Wohnraum durch die HLM-Gesellschaften so vorzunehmen sei, »dass die Ansiedlung mehrerer ausländischer Familien im gleichen Gebäude vermieden wird.« Der Vorschlag wurde schließlich mit der Begründung zurückgewiesen, er könne in der Praxis zu Diskriminierung führen. Ein sozialistischer Abgeordneter hielt dennoch fest, dass man nicht »die Augen vor einem realen Problem verschließen« dürfe. 38 Das »Problem« der Banlieues wurde zunehmend ethnisiert. Als in Mantes-la-Jolie und Sartrouville noch während der Parlamentsdebatten über das LOV neue Aufstände ausbrachen, vermieden es die Politiker in ihren Kommentaren erneut, auf Grundlegendes einzugehen, um stattdessen über den Zusammenhang zwischen den Banlieues, der Immigration und der Delinquenz zu sprechen. Die Strategen der Politique de la ville wollten ihre Agenda als sozialpolitische verstanden wissen, und bemühten sich um ein entsprechendes Bild der Stadtpolitik in den Medien. Gleichzeitig trugen sie einiges dazu bei, dass die Banlieues immer häufiger als »sensible Gebiete« wahrgenommen wurden, weil sie den vermeintlichen Zusammenhang zwischen Stadtrandsiedlungen, Einwanderung und der Herausbildung sozial und politisch gefährlicher Bevölkerungsgruppen betonten. So stand in den Medien die »Unsicherheit« in den von ihnen zu »rechtsfreien Räumen« erklärten Banlieues auch im Mittelpunkt der Berichterstattung. Es war die Politique de la ville, die Lage und Ausdehnung der gefährlichen Viertel exakt definierte, und so zur Bestimmung eines sozialen und ethnischen Feindbildes beitrug – dem Bild einer inneren, auf französischem 38 Zit. nach Tissot, S. 47. 18 Territorium verorteten Bedrohung, das eine Forcierung der bisherigen sicherheitspolitischen Maßnahmen erforderlich mache. Aufwind bekam der Diskurs vom inneren Feind nach dem Kollaps der Ostblockstaaten, als in sämtlichen EUStaaten eifrig an neuen Bedrohungsszenarien (illegale Migration, organisierte Kriminalität, Terrorismus) gearbeitet wurde. In diesem Zusammenhang konnte 1991 auch die Umgestaltung der Sicherheitskräfte in den Banlieues legitimiert werden. Die als überholt erklärte politische Abteilung der Renseignements généraux (der innere Nachrichtendienst), wurde nun für die »städischen Ausschreitungen« zuständig. Die sogennante Antikriminalitätsbrigade (Brigade anti-criminalité, BAC), eine auf Einsätze in städtischem Gebiet spezialisierte Sondereinheit der Polizei, wurde geschaffen. Ein weiterer Einschnitt markierte das Jahr 1997, als die Konzeption und Koordinierung der polizeilichen Kontrolle der Banlieues ausdrücklich zu einer Aufgabe der Politique de la ville erklärt wurde. Unter dem Motto einer »Ko-Produktion im öffentlichen Sektor« wurden polizeiliche und sozialarbeiterische Kontrolltechniken immer weitgehender miteinander verschränkt – was sich heute als ein entscheidender Schritt in der Entwicklung neuer Formen des Regierens zu erkennen gibt. 3.2 Die Modernisierung öffentlicher Dienstleistungen Vom Kampf gegen die »Exklusion« in den abgehängten Vierteln zur Modernisierung öffentlicher Dienstleistungen war es ein weiter intellektueller Weg, der hier nur ansatzweise nachgezeichnet werden kann. Nur soviel: Seit den 1970er Jahren war bekannt, dass in den Sozialwohnungssiedlungen ein akuter Mangel an Gemeinschaftseinrichtungen existierte und der Zugang zu den öffentlichen Dienstleistungen schlecht war. Anfang der 90er Jahre konnte die Politique de la ville nur deswegen in den Staatsapparat fest verankert werden, weil sich der Reformwille der DSQ-Vordenker mit dem der Sozialistischen Partei traf. In Frankreich galten damals öffentliche Dienstleistungen noch als Ausdruck der staatsbürgerlichen Solidarität. Nach den Revolten der frühen 1990er Jahre setzte sich nun die Vorstellung durch, dass die Probleme der Banlieues ihre Ursache in den verknöcherten Strukturen des öffentlichen Sektors hätten, und öffentliche Dienstleistungen auf ganz andere Weise zu organisieren wären. In der Folge wurde die Politique de la ville in den Banlieues zum Testlauf für eine umfassende Reform des gesamten Bereichs. Parallel entwickelte sich die Politique de la ville im Vergleich zu den DSQ-Maßnahmen in eine Richtung, in deren Focus weniger die »Einwohner« als die »Staatsbürger« standen, denen es ihre Rechte und vor allem Pflichten zu erklären galt. Somit wurde auch die Politique de la ville zum festen Bestandteil der Integrationspolitik. 1993 wurde die »Modernisierung öffentlicher Dienstleistungen« offiziell zu einem Schwerpunkt der Politique de la ville. Diese »Ausnahmepolitik« bediente sich der Begriffe der Managementliteratur: - »Partnerschaft« und »Transversalität«: Die verschiedenen »lokalen Akteure« wurden angehalten zu kooperieren, was als notwendige Bedingung der Effektivitätssteigerung angesehen wurde. 39 - »Kontraktualisierung«: Staat und lokale Akteure sollten ihre die Politique de la ville betreffenden Aktivitäten durch einen mehrjährigen Vertrag formalisieren. Entgegen der zu Beginn der 80er Jahre verabschiedeten Dezentralisierung-Gesetze ermöglichten solche Übereinkünfte Städte, Départements und Regionen staatlichen Erwartungen nachzukommen. 39 Transversalität ist ursprünglich ein mathematischer Begriff, steht hier für Vernetzung. 19 - »Hebelwirkung«: Nicht allein der Staat solle sich um die Probleme der Vororte kümmern, sondern auch andere Akteure sollten angeregt werden, sich finanziell einzubringen. Dabei handelte es sich zunächst um öffentliche Stellen, dann zunehmend auch um Privatfirmen. Die Politique de la ville nahm somit die umfassenden Reformen des öffentlichen Sektors, die in Frankreich ab Anfang der 1990er Jahre durchgesetzt wurden, im Kleinen teilweise vorweg. Die »sensiblen Viertel«, dienten als Experimentierfeld. Reform des öffentlichen Sektors Zu Beginn der 1990er Jahre ging es allerdings noch nicht um den Abbau öffentlicher Einrichtungen, sondern um deren »Stärkung« sowie um »Annäherung«, also darum, den BewohnerInnen die Einrichtungen und deren Leistungen »näher« zu bringen. Die erste Maßnahme, die ergriffen wurde, um die öffentlichen Dienstleistungen zu »stärken«, bestand in der Einführung einer Prämie für in den Banlieues arbeitende Angestellte. Damit sollte einer allzu hohen Fluktuation entgegengewirkt werden. Das vergrößerte allerdings die Kluft zwischen den Festangestellten im öffentlichen Sektor und einer zunehmend verarmenden Bevölkerung, die auf dessen Leistungen angewiesen war. Darüber hinaus war die Voraussetzung für den Erhalt der Prämie, in einem geographisch definierten »Problemviertel« zu arbeiten, was eine weitere Stigmatisierung der Banlieues bedeutete. Gleichzeitig wurden in den Banlieues die ersten sogenannten Plateformes des services publics eingerichtet: Gebäude, in denen Büros sowohl von Behörden als auch von lokalen Vereinen untergebracht wurden, die zuvor im gesamten Stadtteil verstreut waren. Dem lag die Vorstellung zugrunde, die BewohnerInnen der Banlieues würden sich zu unrecht ihrem Schicksal überlassen fühlen und müssten nur über die ihnen zur Verfügung stehenden Leistungen informiert werden. Durch die Schaffung der Plateformes konnte die Sichtbarkeit des bestehenden Angebots gesteigert werden, ohne dass das Angebot selbst ausgeweitet oder verändert werden musste. Die plateformes wurden und werden als großer Erfolg der Politique de la ville gefeiert: Hier werde das stadtpolitische Imperativ, die Verwaltung zu »öffnen«, um »Transversalität« und »Partnerschaft« herzustellen, umgesetzt. Darüber hinaus sollte sich zeigen, dass sie Einsparungen im Verwaltungsbudget ermöglichen – ein Grund, weshalb sie sich später, zu einer Zeit, als Budgetkürzungen zur Schließung zahlreicher öffentlicher Einrichtungen wie Postämter und Krankenhäuser führten, im ganzen Land ausbreiteten. Neue Arbeistverhältnisse Eine weitere wichtige vermittelnde Rolle spielten (u.a. im Konzept der »Annäherung«) die zahlreichen Vereine, die mit Mitteln der Politique de la ville finanziert, Gesellschaftsabende, Sportveranstaltungen, Nachhilfeunterricht und ähnliches organisierten. Teilweise handelte es sich dabei um die Auslagerung öffentlicher Dienstleistungen, was sich auch in Hinblick auf das Ziel, Beschäftigungsmöglichkeiten in den Banlieues zu schaffen, als funktional erwies. Denn es handelte sich in der Regel um befristete Arbeitsverträge; gearbeitet wurde meist zum Mindestlohn und in Teilzeit. Die Prekarität dieser Jobs sollte durch einen symbolischen Gewinn aufgewogen werden: das Bewusstsein, an der Verbesserung der Lebensbedingungen im Stadtviertel beteiligt zu sein. Freilich sollte sich auch dieses Bewusstsein immer wieder als sehr prekär erweisen. 20 Die staatlich subventionierten Jobs erschienen manchen als Ausdruck des Festhaltens an sozialstaatlichen Prinzipien und als Versuch, die arbeitende Bevölkerung vor der Willkür des »Marktes« zu schützen, für die politische Klasse hatten sie aber vor allem die Funktion, zu einem durchaus günstigen Preis den sozialen Frieden zu sichern. Gleichzeitig schufen diese neuen Jobs jenseits des Normalarbeitsverhältnisses (hors statut) eine Grauzone zwischen Erwerbslosigkeit und Festanstellung. In Ermangelung einer grundsätzlichen Neuausrichtung der Wirtschaftspolitik konnten die ergriffenen Maßnahmen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit nur wenig bewirken. 1991 plädierte »Stadtminister« Michel Delebarre für eine vorrangige Finanzierung jener Arbeitsverhältnisse, die die »Eingliederung« der Erwerbslosen in ihr Stadtviertel zu fördern versprachen. Auf die als »Gemeinnützige Arbeit« (TUC) bekannten Praktika der 1980er Jahre folgten so in den 1990ern zuerst die »Beschäftigungs - und Solidaritätsverträge« (CES) und dann die »Verträge zur Begleitung in die Beschäftigung« (CAE). Später kamen noch andere Vertragsformen im öffentlichen Sektor und in den Vereine hinzu. 40 Auf solche Beschäftigungsverhältnisse folgte zwar nur in den seltensten Fällen eine Festanstellung, sie erlaubten den Behörden aber eine Senkung ihrer Personalkosten. Ein Aufruf Delebarres zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit durch Festanstellung im Privatsektor – der Aufruf richtete sich dabei an »Bürgerbetriebe« (entreprises citoyennes) – stieß auf sehr viel weniger Gegenliebe. Nachfolger Delebarres wurde im April 1992 der bekannte Unternehmer, Bernard Tapie. Mit ihm wurde ein Mann »Stadtminister«, der als Verkörperung eines unternehmerischen Ideals, als der Firmengründer und self-made-man schlechthin, galt. Die Drosselung der Sozialausgaben und die Senkung der Unternehmenssteuer waren Hauptziele der ab 1995 unter rechter Regierung betriebenen Politique de la ville. Dazu gehörte auch das Programm der »Freihandelszonen« (zones franches), über das unten mehr zu sagen sein wird. Eine nennenswerte Senkung der Erwerbslosigkeit brachte keine der in diesem Zusammenhang ergriffenen Maßnahmen mit sich. Jungendliche an die Arbeit Von besonderer Bedeutung für die Kopplung von Beschäftigungspolitik und der Reform des öffentlichen Sektors, wie sie seit den frühen 1990er Jahren betrieben wurde, war das 1997 unter der Regierung Jospin lancierte Programm zur »Jugendbeschäftigung« (emploi-jeunes). Diese neuen Stellen sollten hauptsächlich im Bereich öffentlicher, aber auch privater Dienstleistungen geschaffen werden – schwerpunktmäßig in Bereichen, die als schwach entwickelt galten. Die Regierung erklärte sich bereit, 400.000 auf fünf Jahre befristete und für unter 25jährige reservierte Arbeitsplätze zu finanzieren – dabei deckten die Subventionen 75% des Mindestlohns. Die Träger, lokale Verwaltungsbehörden oder Vereine, wurden zur Ausbildung der Jugendlichen verpflichtet und aufgefordert, die neu entstandenen Stellen möglichst auch nach Ablauf der fünf Jahre zu erhalten, was nur selten geschah. In der Folge entstand ein buntes Spektrum an Stellen mit teilweise abstrusen Bezeichnungen: 40 All diese Vertragsformen zeichnen sich durch miserable Bezahlung sowie das Fehlen von Sozial- und Arbeitsrechten aus, und sie sind bzw. waren zeitlich begrenzt. Es sollten »Etappen auf dem Weg zur Integration« sein, wie Delebarre bemerkte. 21 vom »Beauftragten für öffentliche Dienste« über den an Haupt- und Oberschulen für die Beaufsichtigung der Schüler zuständigen »Ausbildungsassistenten« und dem bei der Polizei beschäftigten »Sicherheitsassistenten« bis hin zu dem im öffentlichen Nahverkehr tätigen »Umgebungsangestellten«. Zwar war die Arbeitslosigkeit unter den Banlieue-Jugendlichen besonders hoch, doch richtete sich das Jugendbeschäftigungsprogramm nicht ausschließlich an sie. Das Programm fügte sich hervorragend in die vom »Städteministerium« betriebene Politik der Modernisierung öffentlicher Dienstleistungen. Die Stellen der Jugendlichen, die unter dem Stichwort der »Vermittlung« (médiation) eingestuft wurden, lagen quer zu den traditionellen bürokratischen, technischen und sozialarbeiterischen Zuständigkeiten der Stadtverwaltungen und wurden zum Ansatzpunkt einer umfassenden Modernisierung der öffentlichen Dienstleistungen. Aufgaben, die traditionell zentral und vertikal organisiert worden waren, konnten nach und nach an die in den Stadtvierteln neu entstandenen horizontalen Strukturen abgegeben werden. Diese »Streuung« von Aufgaben innerhalb der Stadtviertel, die sogenannte Territorialisation, wurde – wie schon viele Maßnahmen zuvor – mit dem Hinweis gerechtfertigt, man werde den »Bedürfnissen der BewohnerInnen« auf diese Weise besser gerecht. Im Laufe der 1990er Jahre konnte sich die Logik der Territorialisation, begleitet von einem »Managementjargon«, auf allen lokalen Verwaltungsebenen durchsetzen. 2003 wurde das Jugendbeschäftigungsprogramm beendet, die entstandenen, staatlich subventionierten Stellen großenteils aufgelöst. Im Mittelpunkt der Arbeitsmarktpolitik stand nun die Ausweitung des Dienstleistungssektors, insbesondere der persönlichen Dienstleistungen (Altenpflege, Kinderbetreuung usw.). Diese neue Arbeitsmarktpolitik ging weitgehend auf den neuen Ministre de la Ville Jean-Louis Borloo zurück und war in die Bemühungen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des Dienstleistungssektors innerhalb der gesamten Eurozone (Bolkestein-Richtlinie) eingebettet, Bemühungen, die bekanntlich auf eine Angleichung der verschiedenen arbeitsrechtlichen Bestimmungen der EU nach unten hinausliefen. Der Übergang zu dieser aktualisierten Politik der prekären Beschäftigung vollzog sich vor dem Hintergrund einer drohenden Rezession, im Zuge derer zahlreiche Jugendliche in die Arbeitslosigkeit entlassen wurden. Im Jahr 2005 war der Einbruch besonders spürbar. »Die Situation ist außerordentlich angespannt,« berichtete ein Sozialarbeiter einige Monate vor Ausbruch der Novemberrevolte. »Wir schaffen es nicht mehr, zu den Jugendlichen durchzudringen. Sie haben überhaupt keine Perspektive.« 41 »Die gesamte Ökonomie ist im Begriff, sich von einer Ökonomie der Arbeiter zu einer der Diener zu entwickeln. Das ist es, was für die Jugendlichen aus den Vierteln vorgesehen ist. Darum befinden sie sich in einer prekären Situation«, erklärte der Philosoph Laurent Ott, der auch Sozialarbeiter ausbildet. »Es gibt einen gewissen Widerstand dagegen. Die Jugendlichen aus den Vierteln weigern sich, Diener zu sein. Das ist auch der Grund, weshalb es eine Jugendrevolte gibt.« 42 3.3. »Sensible Stadtgebiete« Die Institutionalisierung der Politique de la ville ist stets mit ihrer Rationalisierung einhergegangen. In den 41 42 Interview geführt von der Autorin, April 2005. Interview geführt von der Autorin, März 2007. 22 1980er Jahren wurden Stadtviertel, in denen DSQ-Maßnahmen zum Einsatz kommen sollten, von der Zentralregierung, der Regionalverwaltung und der Gemeindeverwaltung gemeinsam ausgewählt. Ab dem Beginn der 1990er Jahre wurden diese Stadtviertel Gegenstand immer intensiver betriebener statistischer Erhebungen, von denen man sich ein genaueres Verständnis der Armutsformen und eine Justierung der angewandten Maßnahmen versprach. Zunächst ging es darum, »Mythen« über die Banlieues aus der Welt zu schaffen – doch das genaue Gegenteil wurde erreicht. Es entstand eine einheitliche und weiverbreitete Vorstellung von den »sensiblen Stadtgebieten« als Orten einer nicht integrierbaren postkolonialen Immigration. Das Bild von den Banlieues als gefährlichen Orten wurde festgeschrieben. Die Presse hat bis heute nicht aufgehört, entsprechende Stereotype beizusteuern. So bemüht sie etwa regelmäßig medizinische Metaphern, die suggerieren, bei den Banlieues handle es sich um »kranke« Glieder der Nation, die einer »Behandlung« bedürften. Enklaven der Armut und Unterentwicklung Die ersten statistischen Erhebungen in den Stadtvierteln mit DSQ-Projekten bezogen sich auf die Anzahl der Sozialwohnungen, die Arbeitslosigkeit, das Durchschnittsalter der BewohnerInnen, den Anteil an MigrantInnen usw. Es ging weniger um eine Darstellung der ungleichen Verhältnisse zwischen verschiedenen Gebieten oder Bevölkerungsgruppen als um den Nachweis, das bestimmte Armutserscheinungen innerhalb bestimmter Personengruppen gehäuft auftreten. Im nächsten Schritt wurden die ermittelten Zahlen mit den Durchschnittszahlen für die betreffende Stadt verglichen und die Abweichungen hervorgehoben. Solche statistischen Erhebungen wurden nach und nach in sämtlichen Stadtvierteln vorgenommen, in denen DSQ-Maßnahmen zur Anwendung kamen. 1993 wurde dann eine zusammenfassende Studie veröffentlicht, die auf die Existenz von 500 »sensiblen Stadtvierteln« (Quartiers sensibles) mit einer Gesamtbevölkerung von drei Millionen Menschen hinwies. Auf diese Weise wurde ein einfaches und widerspruchsfreies Bild der Banlieues gezeichnet. Die teilweise beträchtlichen Unterschiede zwischen den verschiedenen Vierteln verschwanden hinter dem vereinheitlichenden Begriff des »sensiblen Stadtgebiets«. Darüber hinaus verdeckte dieser Begriff auch das, was zu erforschen man anfangs noch vorgegeben hatte: die Armut. Sie erschien nur noch in ihrem statistischen Verhältnis zur Anzahl der Einwanderer – gleichsam, als hätte die Dritte Welt ihre Enklaven von Unterentwicklung innerhalb des französischen Territoriums. An dem Prinzip begleitender empirischer Forschung hielt die Politique de la ville auch in den Folgejahren fest. Allerdings waren es nun die Gemeinden, die bestimmten, in welchen Vierteln Bedarf an sozialpolitischen Eingreiffen bestehe. Dabei hielten sie sich häufig zurück, um nicht in den Ruf zu geraten, mit besonders vielen »Problemvierteln« versehen zu sein. Es gab aber auch Gemeinden, die an den Geldern des Ministère de la ville interessiert waren und die Anzahl ihrer Problemviertel entsprechend nach oben korrigierten. Die statistische Analyse der Banlieues wurde fortlaufend verfeinert. Je nach Ausrichtung der gerade von Paris aus betriebenen Politik wurden unterschiedliche empirische Befunde in den Mittelpunkt gestellt: die Anzahl allein erziehender Mütter, die der Schulabbrecher, die Wahlbeteiligung usw. Wie besessen von ihrem Ziel, möglichst präzise auf die jeweilige BewohnerInnenstruktur zugeschnittene Maßnahmen zu entwickeln, plagte die Funktionäre der Politique de la ville beständig die Sorge, nicht genug zu wissen. Die im Laufe der 23 Zeit angesammelte Datenmenge war bald nicht mehr weit von einer vollständigen Bestandsaufnahme der in den Banlieues angesiedelten Bevölkerungsgruppen entfernt. Wobei sich immer wieder die Neigung durchsetzte, den Datenbestand anhand ethnischer Kategorien aufzuschlüsseln. 2003 wurde das sogenannte »Nationale Zentrum zur Beobachtung der sensiblen Stadtviertel« (observatoire national des zones urbaines sensibles) eingerichtet. Es ist zuständig für die Auswertung des beständig anwachsenden statistischen Materials. Offiziell fühlt sich das »Nationale Zentrum« aber dem Ziel verpflichtet, »die Republik wieder in die Stadtviertel einzuführen und die Stadtviertel wieder in die Republik einzugliedern.« Pakt zur Wiederbelebung der Stadt Einen wichtigen Einschnitt in der umfassenden statistischen Erfassung der Banlieue-BewohnerInnen markiert der sogenannte »Pakt zur Wiederbelebung der Stadt«, ein 1995 unter Premierminister Juppé verabschiedetes Bündel von Maßnahmen, das die Unterscheidung zwischen drei Kategorien von Stadtvierteln einführte: »Städtische Freihandelszonen« (zones franches urbaines, ZFU), »Zonen städtischer Re-Dynamisierung« (zones de redynamisation urbaines, ZRU) und »Sensible Stadtgebiete« (zones urbaines sensible«, ZUS).43 Die Anzahl der ZFU belief sich zunächst auf 44, in 2003 wurden dann weitere 41 Stadtviertel zu ZFU erklärt. Es handelt sich um Freihandelszonen, wie sie auch aus den Entwicklungs- und Schwellenländern bekannt sind, also um Gebiete, in denen Unternehmen Steuerfreiheit und andere Privilegien zugesichert werden. Gearbeitet wird dort meist zum Mindestlohn. Eine Besonderheit der französischen ZFU ist, dass die Unternehmen nachweisen müssen, dass 25% ihrer Belegschaft im ZFU-Gebiet ansässig sind. In den ZRUs sind Unternehmen von Sozialabgaben befreit. In den »sensiblen Stadtgebieten« gelten keinerlei Sonderrechte; es handelt sich schlicht um eine neue Bezeichnung für die Viertel, in denen die Maßnahmen der Politique de la ville zum Einsatz kommen. Die Zahl der »sensiblen Stadtgebiete« beläuft sich mittlerweile auf 751. Es handelt sich um 2.200 Stadtviertel mit etwa fünf Millionen EinwohnerInnen. In Frankreich gibt es keine noch so kleine Stadt mehr, die nicht ein solches Ausnahmegebiet aufzuweisen hätte. Eine Folge des »Paktes« waren drastische Spaltungen in Städten, die sich bis dahin noch vergleichsweise homogen entwickelt hatten. In den Stadtgebieten wurden neue Grenzen gezogen, die zwar auf keiner Landkarte verzeichnet sind, dafür aber umso nachhaltiger die Erfahrungen der Einwohner prägen. Von der ZEP über die ZUP und die »sensiblen Viertel« bis hin zu ZUS, ZRU und ZFU hat es also nicht an Etiketten gefehlt, mit denen die Banlieues im Rahmen einer Politik, die vorgibt, die »Ausgrenzung« zu bekämpfen, abgestempelt wurden. 3.5. Die Politique de la ville und neue Formen des Regierens Auf kommunaler Ebene wird die Politique de la ville von kleinen, vergleichsweise unabhängig agierenden Projektgruppen organisiert. Es gibt einen Projektleiter, dem einige Experten zur Seite stehen, außerdem ausführende »Stadtteilbetreuer« (Animateurs de quartier). In den 1990ern wiesen die Verantwortlichen für die Umsetzung der Projekte noch häufig eine Vorgeschichte als politische AktivistInnen oder SozialarbeiterInnen vor, heute werden sie überwiegend aus den Universitäten rekrutiert, wo eine 43 Eine detaillierte Übersicht über die ZUS inclusive Kartenmaterial gibt es unter: http://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/chercherZUS.htm. 24 entsprechende Ausbildung angeboten wird. »Modernisierung« der Lokalverwaltung Die Arbeit jeder Projektgruppe orientiert sich an der Zielvereinbarung, dem sogenannten »Stadtvertrag« (contrat de ville), auf die sich das Ministère de la ville, die Stadtverwaltung und ihre lokale Partnerorganisationen geeinigt haben. Wo es um die Förderung bestimmter, als innovativ eingestufter Bewohnerinitiativen geht, fällt für die Projektgruppe überwiegend bürokratische Arbeit an wie die Unterstützung der Vereine bei der Formulierung ihrer Finanzierungsanträge. Außerdem gilt es stets, Lageberichte über das Viertel und Zwischenauswertungen der laufenden Projekte zu verfassen. Diese Arbeitsweise – auf eine Lageeinschätzung folgt eine Zielvereinbarung, später werden Resultate ausgewertet – hat sich in Frankreich mittlerweile auf allen Ebenen der öffentlichen Verwaltung durchgesetzt. Auf lokaler Ebene war es die Politique de la ville, die diesem Prinzip zum Durchbruch verhalf. Bei der »Modernisierung« der öffentlichen Verwaltung ist ihr damit eine Schlüsselrolle zugekommen. Verwaltung der Bevölkerung – Verwaltung der Territorien In Frankreich wird bis heute über die Frage diskutiert, ob die Politique de la ville eher an sozialen oder an stadtplanerischen Kriterien auszurichten sei, ob es um die Unterstützung der »Bevölkerung« oder um die der »Territorien« gehe. Es handelt sich insofern um eine Scheindebatte, als sich die Politique de la ville längst durch die Verschränkung beider Ansätze auszeichnet. Im Laufe der zweiten Hälfte der 1990er Jahre wurden die als Grundlage stadtpolitischer Interventionen fungierenden Zielvereinbarungen, die Contrats de ville, von den »sensiblen Stadtgebieten« einer einzelnen Stadt, auf die von Ballungsräumen (agglomérations), die mehrere Städte umfassen können, ausgedehnt. Die Politique de la ville orientierte sich bereits an der Kategorie der agglomérations, bevor diese neue politische sowie Verwaltungsebene ab 2000 geschaffen wurde. Dies ist einerseits als Rationalisierungsmaßnahme, über die eine gesteigerte Kosteneffizienz erreicht werden sollte zu verstehen, andererseits aber auch als Teil eines fortlaufenden Prozesses der Entwicklung neuer Techniken des Regierens. Damit trug die Politique de la ville sowohl zur Kontrolle der ZUS-Bevölkerung bei, als auch zur Rückeroberung dieser Sonderterritorien im Rahmen einer auf ein gesamtes Stadtgebiet bezogenen Strategie. Die politische Intervention in einzelne Viertel oder Siedlungen orientiert sich also mittlerweile explizit an den Planungsvorgaben für ganze »urbane Regionen«. Diese Kopplung von Mikro- und Makroebene wurde später von allen Bereichen der Stadtverwaltung übernommen. Die Politique de la ville war nicht nur Impulsgeber für eine interne Umstrukturierung der Verwaltungsorgane, sondern hat auch deren Herangehensweise an die zu verwaltenden Territorien grundlegend verändert. Bereits seit den 1990er Jahren hatten die Vordenker der Politique de la ville eine Abkehr von der engstirnigen Fixierung auf lokale Kleinprojekte gefordert und von der Notwendigkeit, sich stets an der Gesamtentwicklung der Region zu orientieren, gesprochen. Eine neue Qualität erreichte die Verknüpfung von stadtplanerischen und sozialtechnologischen Zugriffen Ende der 1990er Jahre mit den »Stadterneuerungsmaßnahmen« (opérations de renouvellement urbain, ORU) und den »großen Stadtprojekten« (grands projets de ville, GPV). Mit deutlich mehr Subventionen als die üblichen Maßnahmen der Politique de la ville versehen, ermöglichten es diese Programme, ganze Stadteil radikal umzugestalten, um sie an der Rest der Stadt anzupassen. Der 2003 formulierte »Nationale 25 Plan für die Erneuerung der Städte« (plan national de rénovation urbaine, PNRU, siehe Abschnitt 3.6) hat die Logik von ORU und GPV noch um ein Vielfaches potenziert. Militarisierung Seit den 1990er Jahren wurde die polizeiliche Kontrolle der Banlieues intensiviert, propagandistisch abgesichert durch die denunziatorischen Darstellungen sowohl der Einwanderer und ihrer Kinder als auch der Stigmatisierung der Banlieues als Orte der Verwahrlosung und Delinquenz. Der Katalog der sogenannten »neuen Bedrohungen« (nouvelles menaces) wurde dabei ständig erweitert. Zu »Organisierter Kriminalität« und Drogenhandel kamen Islamismus, Terrorismus und »städtische Ausschreitungen« (violences urbaines) hinzu. Die Rede von den »neuen Bedrohungen« wurde ergänzt durch den Diskurs über die sogenannten »rechtsfreien Räume« (zones de non-droit), die sich weltweit und eben auch innerhalb Frankreichs ausbreiten würden. Sie dienten der Legitimation der Militarisierung der Innenpolitik als Vorbereitung auf zu erwartende Revolten der Unterklassen.44 So bot die Revolte von 2005 den Anlass das kurz zuvor verankerte Sicherheitspaket 45 zu testen, das u.a. die ständige Stationierung von Einheiten der als »republikanische Sicherheitseinheit« (compagnie républicaine sécuritaire, CRS) bekannten Bereitschaftspolizei in der Nähe der Banlieues vorsieht. Auf Einsätze in Stadtgebieten und die Kontrolle größerer Menschenmengen spezialisierte Militäreinheiten wurden aus dem Kosovo und der Elfenbeinküste abgezogen, um in den Banlieues eingesetzt werden zu können. 46 Die rechtliche Grundlage des im November 2005 verhängten Ausnahmezustands, ein Gesetz aus der Zeit des Algerienkonflikts, ist dahingehend verändert worden, dass eine erneute Ausrufung des Ausnahmezustands nun zu jedem Zeitpunkt möglich ist. An der staatlichen Reaktion auf den 2007 in der Banlieue Villiers-le-Bel ausgebrochenen Aufstand war zu sehen, wie weit die Militarisierung der Sicherheitspolitik mittlerweile gediehen ist. In der durch Straßensperren von der Außenwelt abgeriegelten Banlieue kamen Überwachungsdronen, Helikopter, Scharfschützen und Antiterrorismus-Einheiten zum Einsatz, ebenso Flugblätter, in denen zur Denunziation der Aufständischen aufgerufen wurde. Ab 1997 kam es zu einer intensiven Zusammenarbeit zwischen dem Ministère de la ville und den Repressionsapparaten im Rahmen der Wiederbelebung der sogenannten lokalen Sicherheitskommissionen, mit denen bereits nach dem Aufstand in Les Minguettes 1981 experimentiert worden war. Damals trafen sich die französischen Bürgermeister einmal pro Jahr mit lokalen Vertretern der Polizei, der Schulen und der HLM-Gesellschaften, um sich über die Lage in der Stadt auszutauschen, was allerdings kaum konkrete Folgen gehabt hatte. Dies änderte sich mit den nun umgenannten »Lokalkommissionen für Sicherheit und Prävention«, wodurch die Zusammenarbeit zwischen Polizei und SozialarbeiterInnen forciert wurde. Dabei werden die umfangreichen Datenbestände und das Know-how der Politique de la ville dem Polizeiapparat zur Verfügung gestellt. 3.6. Ein »Marshall-Plan« für die Banlieues 2002 wurde Jean-Louis Borloo »Ministre de la ville« in der Regierung Raffarin. Borloo, ein auf Wirtschaftsrecht spezialisierter Anwalt, galt damals bereits als eine Art Volksheld. Anfang der 1990er zum 44 M. Rigouste, La guerre à l’intérieur: La militarisation du contrôle des quartiers populaires, in: L. Mucchielli, Hg., La frénésie sécuritaire, Paris 2008. 45 Vgl. D. Dufresne. Quellenangabe unvollständig! 46 Rigouste, L’ennemi intérieur, S. 280. 26 Bürgermeister von Valenciennes gewählt, war es ihm gelungen, dieser von den Deindustrialisierungsschüben der 1970er und 1980er Jahre verödeten Stadt in Nordfrankreich Subventionen aus Paris und Brüssel zu sichern. Ein Theater und verschiedene Bildungseinrichtungen konnten gebaut werden, wodurch das eine oder andere Viertel an Trostlosigkeit verlor und die Stadt für den Immobiliensektor wieder interessant wurde. Vor allem war Borloo dank guter Beziehungen die Ansiedlung eines ToyotaWerkes gelungen, wodurch 2.000 neue Arbeitsplätze in der Region entstanden. Die Erwartungen an Borloo, der aus seinen politischen Ambitionen nie einen Hehl gemacht hatte, waren 2002 entsprechend hoch, und die Frage, ob es ihm gelingen würde, die sozialen Verwerfungen in den »sensiblen Stadtgebieten« zu beseitigen, wurde ausführlich debattiert. Im Folgejahr hatte Borloo einen »Marshall-Plan für die Banlieues« entwickelt, den sogenannten »Nationalplan für die Erneuerung der Städte« (PNRU), dessen Kosten auf stattliche 30 Milliarden Euro beziffert wurden. Erklärtes Ziel war, den Bevölkerungsgruppen in den »sensiblen Stadtgebieten« eine höhere Lebensqualität zu sichern. Zunächst ging es darum, eine gesteigerten mixité sociale zu verwirklichen. Durch eine ganze Serie von radikalen städtebaulichen Eingriffen sollte die Armutsbevölkerung der Banlieues über das Stadtgebiet zerstreut werden und die »sensiblen Stadtgebiete« für die Mittelschicht wieder zu attraktiven Wohnorten werden. Wenn die HLM-Bauten verschwinden, so die Überlegungen, würde es auch das Problem einer übermäßigen Konzentration von »Risikofamilien« in den Siedlungen nicht mehr geben. An ihrer Stelle wünschte sich Borloo Reihenhäuser mit nicht mehr als fünf Stockwerken und »einer Mutter vor jeder Haustür, wenn die Kinder aus der Schule kommen« – also eine polizeilich und sozialtechnologisch leicht zu überwachende Architektur und patriarchal-kleinfamiliären Reproduktionsverhältnissen. Innerhalb von fünf Jahren sollten die Banlieues so ein völlig neues Gesicht erhalten: Der Plan sah die Sprengung von Siedlungsbauten mit insgesamt 200.000 Wohnungen vor, um Platz für kleinere, komfortablere Gebäude zu machen. Ebenfalls vorgesehen war die Sanierung von Gebäuden mit weiteren 200.000 Wohnungen. Konkrete Bauprojekte mussten drei Zielvorgaben erfüllen: »Wiedereingliederung« des betroffenen Viertels in die Stadt, Diversifizierung des Wohnungsangebots (im Sinne einer gleichmäßigen Verteilung von Sozial- und Privatwohnungen) und Herstellung einer möglichst vollständigen Mischung von Einkaufs-, Arbeits- und Freizeitmöglichkeiten. Transformation des Staatsapparates Um ein derart umfangreiches, an staatliche Programme aus der Blütezeit des französischen Wohlfahrtsstaates erinnerndes Projekt verwirklichen zu können, musste Borloo zufolge erst eine weitreichende Transformation des Staatsapparates bewerkstelligt werden. Zur Finanzierung des PNRU wurde unter Rekrutierung verschiedener Experten aus dem »Interministeriellen Ausschuss für die Stadt« (DIV) eine sogenannte »Nationalagentur für städtische Erneuerung« (ANRU) ins Leben gerufen. Parallel dazu wurde auch eine »Nationalagentur für sozialen Zusammenhalt und Chancengleichheit« (Acsé) gegründet, die bestimmte Aufgaben des Sozialministeriums übernehmen sollte. Aus dem öffentlich angekündigten Budget von 30 Milliarden Euro sollten nicht mehr als 6 Milliarden aus der Staatskasse kommen. Der Großteil des Budgets sollte aus Gewerbeabgaben bestritten werden, wobei auf 27 eine Regelung aus dem Jahr 1953 zurückgegriffen wurde, nach der jeder Betrieb mit mehr als 20 Angestellten eine Summe, die einem bestimmten Prozentsatz seiner jährlichen Lohnkosten (seit 2006 0.45%) entspricht, für den Wohnungsbau 47 zur Verfügung stellen muss. Hinzu kamen Kredite des staatlichen Finanzinstituts Caisse des dépôts et consignations und des Bundes der Wohnungsbaugesellschaften. Die eigentlichen Bauprojekte sollten durch Bankdarlehen finanziert werden, die die Stadtverwaltung und die HLM-Gesellschaften aufnehmen würden. Die ANRU finanzierte so zwar nur einen Teil des Budgets, verfügte aber dank der relativ hohen Subventionen, die sie bereitstellte, über beträchtlichen Einfluss auf die Entscheidungen, die im Rahmen des PNRU getroffen wurden. Die betriebswirtschaftlichen Kriterien, nach denen die ANRU arbeitet, und der sich aus ihnen ergebende Zwang, schnell greifbare Resultate vorzuweisen, hatten zur Folge, dass Projekte, die mit dem erklärten Ziel der Bekämpfung gesellschaftlicher Ausgrenzungserscheinungen wenig zu tun haben, begünstigt wurden. Die Zukunft der abgelegeneren, für den Immobilienmarkt uninteressanten HLM-Siedlungen, blieb offen. Aus den 400 Gebieten, in denen der PNRU aktuell zum Einsatz kommt, werden 189 vom Ministère de la ville als »sensible Stadtgebiete« geführt. Hundertzwanzig sind zwar keine »sensiblen Stadtgebiete«, haben aber bereits Erfahrungen mit ORU und GPV gesammelt. Weitere 90 hatten bislang keinerlei Sonderstatus. Die Parole von der »Wiedereingliederung der Viertel in die Kontinuität der städtischen Struktur« entspricht den Zielsetzungen der Politique de la ville der frühen 1990er Jahre. Der PNRU sollte als eine Reaktion auf die weitreichenden Veränderungen, die sich während der letzten 20 Jahre in den französischen Städten vollzogen haben, verstanden werden. Massive Investitionen in den Stadtzentren haben die Immobilienpreise in die Höhe getrieben und die Wohnviertel immer weiter Richtung Stadtrand verschoben. Dieser Prozess musste in dem Moment an seine Grenze stoßen, als auch am Stadtrand Grundstücke fehlten, die nicht allzu nah an den berüchtigten Siedlungsvierteln oder an heruntergekommen ehemaligen Industriegebieten lagen. Der PNRU bot insofern Abhilfe, als seine drastischen architektonischen und stadtplanerischen Eingriffe die erneute Verdrängung der Armutsgruppen und eine entsprechende Aufwertung der Stadtrandgebiete versprachen. Die Hoffnungen, die in den PNRU gesetzt wurden, haben sich jedoch nicht erfüllt. In einer Ende 2008 vorgelegten Auswertung ihrer bisherigen Tätigkeit wies die ANRU auf akute Finanzierungsprobleme hin. Die ursprünglich formulierten Ziele ließen sich mit den zur Verfügung stehenden Krediten unmöglich realisieren, heißt es dort. Die 2003 genannten Zahlen sind durch andere ersetzt worden. Nicht 200.000, sondern 140.000 Wohnungen sollen nun zerstört werden. Die Zahl der Wohnungen, die den Plänen zufolge von Sanierungen betroffen sein werden, ist auf 280.000 angestiegen. Zugleich sollen 300.000 Wohnungen für den Markt gebaut werden. Etwa die Hälfte der zu zerstörenden Sozialwohnungen soll durch außerhalb des betreffenden Viertels liegende Sozialwohnungen ersetzt werden, d.h. die Tendenz geht eindeutig in Richtung einer Privatisierung des Wohnungsmarktes in den bislang von sozialem Wohnungsbau geprägten Vierteln. Für 80% der Projekte seien Gelder bewilligt worden, doch sei es noch ein weiter Weg bis zu ihrer vollständigen Umsetzung. Dabei sind von den 12 Milliarden Euro der ANRU bereits 9 Milliarden ausgegeben worden. Die Kosten im Bausektor sind seit 2004 um 25% gestiegen, was die Projekte stark verteuert; die entstandenen Zusatzkosten sollen die Stadtverwaltungen übernehmen. Vor allem aber hat sich die Regierung in Paris nicht an ihre finanziellen Zusagen gehalten. Von den zuletzt zugesagten 4 Milliarden Euro wurden nur 307 Millionen ausgezahlt. 48 Die Regierung spielt die Folgen dieses Rückzugs herunter; was sie 47 Seit 1953 wird der Bau von Sozialwohnungen durch Gewerbeabgaben bezahlt, welche heute 0,45% der Lohnkosten entsprechen. Die dafür eigens eingerichtete sogenannte Kasse 1%-Logement hat ausschließlich die Aufgabe Wohnungen zu bauen. 48 Bekanntmachung Nr. 1127 des französischen Parlaments, der Assemblée Nationale, abrufbar unter: 28 selbst nicht bezahle, werde sich anderswo auftreiben lassen. Nachdem die Regierung in Reaktion auf die aktuelle Finanzkrise ankündigte, 2009 würden überhaupt keine Gelder mehr an die ANRU fließen, versprach sie dann im Rahmen des späteren wirtschaftlichen »Rettungspakets« doch 350 Millionen Euro. Diese Zusage genügt aber kaum, um die mittlerweile beträchtlichen Zweifel an der Durchführbarkeit des PNRU auszuräumen. Schließlich haben sich auch die städtebaulichen Prioritäten der Regierung geändert. Aktuell scheint sie auf die Sanierung der Altstädte größeren Wert zu legen als auf die Finanzierung der ANRU. Übrigens gesteht die ANRU in ihrem Rechenschaftsbericht ein, was ihr die wenigen politischen Initiativen, die gegen ihre Projekte protestieren, seit Jahren vorwerfen: dass nämlich die zum Auszug aus ihren Sozialwohnungen gezwungenen Banlieue-Bewohner anschließend in kleinere und teurere Wohnungen ziehen müssen. Ende der Ausnahmepolitik? Unter Präsident Sarkozy wurde Fadela Amara 2007 Staatssekretärin im Ministère de la ville. Der ehemaligen sozialistischen Aktivistin und Gründerin der Bewegung Ni putes ni soumises 49 kommt seitdem die schwierige Aufgabe zu, die wachsenden Zweifel am PNRU auszuräumen. Im Weg stehen Amara dabei nicht nur ihre eigene wachsende Unbeliebtheit, sondern auch die ernüchternden Resultate, die die ANRU in ihrem Rechenschaftsbericht vorgelegt hat. Im Juni 2008 stellte Amara ihren bereits mehrfach angekündigten »Plan der Hoffnung für die Banlieues« (Plan espoir Banlieues) vor, der die für die nächsten drei Jahre anvisierte Politique de la ville darlegt. Als Ziel ihres Plans stellte sie das Ende der bisherigen Ausnahmepolitik gegenüber den Banlieues in Aussicht. Der Plan sieht u.a. beschäftigungspolitische Maßnahmen vor. Zwischen 2008 und 2011 sollen bis zu 45.000 sogenannte Autonomieverträge (contrats d’autonomie) zwischen jungen Arbeitssuchenden und privaten Arbeitsvermittlungsagenturen unterschrieben werden. Die Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen wird weiter forciert. Die privaten Agenturen lassen sich die Vermittlung vom Staat teuer bezahlen. Für jeden unterzeichneten Vertrag erhalten sie 9.300 Euro, die Arbeitssuchenden dagegen nur 300 Euro. Die Gelder der öffentliche Arbeitsagenturen, der sogenannten lokalen Beschäftigungsmissionen (missions locales pour l’emploi) wurden gekürzt, sie erhalten für jeden von ihnen betreuten Fall 500 Euro im Jahr. Im bildungspolitischen Bereich, der aufgrund der anhaltenden Proteste gegen die angekündigte Entlassung tausender Lehrkräfte heftig umkämpft ist, setzt Amara unter dem Motto der »Chancengleichheit« im wesentlichen auf zwei Maßnahmen: zum einen sollen die Möglichkeiten, Nachhilfeunterricht zu erhalten, ausgebaut werden. Zur Zielgruppe gehören vor allem jene Jugendlichen, von denen befürchtet wird, sie könnten in die Delinquenz abrutschen. Zum anderen sollen als besonders begabt eingeschätzte Jugendliche gefördert werden (Sonderbetreuung, Erleichterung des Zugangs zu Eliteschulen und Internaten). Die Anbindung der Banlieues an den Rest der Stadt soll durch Investitionen in die öffentlichen Verkehrsmittel verbessert werden. Damit wird ein Problem angegangen, dessen erstmalige Diagnose über 20 Jahre zurückliegt. Wobei jene Anbindungen bevorzugt werden, die bestimmte Vorstädte für die Mittelschicht wieder attraktiver machen. Vorgesehen ist auch die Wiedereinführung der unter Jospin erprobten »Nachbarschaftspolizei« (police de proximité), was innerhalb des PS für Begeisterung gesorgt hat. Im Rahmen der Schaffung sogenannter »Territorialeinheiten der Stadtviertel« (unités territoriales de quartier, UTEQ) sollen 4.000 Polizisten http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2009/a1200-tIX.asp. 49 Siehe den Beitag von A. Brügmann und E. Piriot in diesem Band. 29 bestimmten Siedlungen fest zugeteilt werden und nach Möglichkeit informelle Kontakte zu den BewohnerInnen pflegen.50 Gleichzeitig soll die Überwachung verschärft werden. So sollen in den als besonders problematisch eingeschätzten Banlieues 60.000 neue Videoüberwachungsanlagen installiert werden. Darüber hinaus soll die Ausbildungseinrichtung des französischen Militärs, das Etablissement public d’insertion de la défense vom Ministère de la ville mit 20 Millionen Euro pro Jahr unterstützt werden, um die Aufnahme von BanlieuebewohnerInnen ins Militär zu fördern. Besondere Aufmerksamkeit widmet die neue Politique de la ville den Frauen und der Bekämpfung der sexuellen Diskriminierung. Amaras Erwartungen an die Frauen sind dabei so hoch wie vielfältig. Nicht nur sollen die Frauen die polizeilichen und sonstigen sicherheitspolitischen Maßnahmen gleichsam von zivilgesellschaftlicher Seite aus begleiten, sondern sie werden auch als potentiell wichtigste Trägerinnen einer anvisierten lokalen Dienstleistungsökonomie begriffen, die an die entwicklungspolitischen Konzepte für Trikont-Gesellschaften erinnert und auf einem breiten Sockel unbezahlter und informeller Arbeit ruhen soll. Sichtlich stolz hat Amara die Einrichtung von 40.000 Kindertagesstätten in den Banlieues versprochen. Die Frauen sind es auch, die von der DIV aufgefordert werden, sich gemeinsam mit anderen »gefährdeten Personengruppen« (publics fragiles) wie älteren oder behinderten Menschen vermehrt in den Straßen zu zeigen – als gelte es, sich selbst und allen anderen zu beweisen, dass die von der Politique de la ville gewünschte soziale Transformation der Banlieues endlich in Gang gekommen ist. Die Experten des Ministère de la villes geben zu, dass eine solche Strategie viel mit der Vermarktung von Politik und wenig mit Feminismus zu tun hat. 51 Ob die von Amara in Aussicht gestellte Beendigung der bisherigen Politique de la ville bedeuten wird, dass auch die Kategorisierung bestimmter Banlieues als »sensible Stadtgebiete« aufgegeben wird, zeigt sich möglicherweise im Laufe des Jahres 2009, dem Jahr, in dem die jetzt noch laufenden 2.500 »städtische(n) Verträge für sozialen Zusammenhalt« (contrats urbain de cohésion sociale, CUCS) – so heißen neuerdings die Zielvereinbarungen, die als Grundlage konkreter stadtpolitischer Projekte dienen – ausgewertet werden. Die Experten der Politique de la ville sind jedenfalls zuversichtlich, dass sich nach dem Abschluss einer maßgeblich von Paris aus gesteuerten Politik zur Bekämpfung gesellschaftlicher Ausgrenzungserscheinungen neue Aufgaben ergeben werden, die allerdings – entsprechend dem institutionellen Transformationsprozess der letzten Jahre – eher regional anzugehen sein werden. Ob die Ballungsräume (Agglomérations) über die nötigen Mittel verfügen, ist fraglicher denn je, denn im Zuge der gegenwärtigen Krisenpolitik werden die Steuereinnahmen der regionalen und lokalen Verwaltungsorgane teilweise drastisch gesenkt. »Aus der Krise wird die Welt verändert hervorgehen, und unsere Reformen müssen Frankreich auf diese neue Welt vorbereiten,« so Henri Guaino, ein Berater Nicolas Sarkozys, in einem Interview mit Le Monde.52 Das mit den Dezentralisierungsgesetzen von 2003 durchgesetzte Verwaltungsmodell schien bis vor kurzem noch stabil, doch jetzt soll es u.a. durch die Abschaffung der Départements aufgebrochen werden. Regionen sollen zusammengelegt und die Entwicklung von Städten wie Lyon zu riesigen Megacities begünstigt werden. Der Vorschlag, die Départements abzuschaffen, um so die Anzahl der Verwaltungsebenen zu reduzieren, ist nicht neu. Doch die Gesetze von 2003 haben aus den Départements die mit Abstand wichtigsten sozialpolitischen Akteure gemacht, die u.a. für die Auszahlung der Sozialhilfe und der 50 Die Uteq wurden bzw. werden nach und nach in verschiedenen Banlieues eingesetzt, so bspw. kurz nach den Auseinandersetzungen um den hochgesicherten NATO-Gipfel erstmals im Mai 2009 in Strasbourg. 51 C. Jacquier, Rede vor dem Inter-Réseau Développement Social Urbain (IRDSU), 6. Juni 2008, abrufbar unter [http://www.irdsu.net]. 52 Le Monde, 5. Januar 2009. 30 verschiedenen Transferleistungen für ältere Menschen, Behinderte usw. zuständig sind. Deren Abschaffung würde also eine völlig neue Verteilung dieser sozialpolitischen Aufgaben erfordern. Angesichts der aktuellen Wirtschaftskrise ist aber mit einer Austeritätspolitik zu rechnen, im Zuge derer viele der bisherigen Leistungen reduziert oder auch gänzlich gestrichen werden dürften. Ob das der gegenwärtigen sozialen Lage gerecht wird, ist die Frage. Allen stadtplanerischen und wohnungspolitischen Neuerungen zum Trotz leben in Frankreich heute 100.000 Menschen ohne festen Wohnsitz, eine Million ohne eigenen Wohnraum und 2.2 Millionen unter Bedingungen, die als unzureichend definiert werden.53 Die Immobilienpreise sind in den letzten zehn Jahren um 130% gestiegen. Die Zahl der Haushalte, die 2008 einen Antrag auf eine Sozialwohnung stellten, beläuft sich auf 1.4 Millionen; die Erfolgschancen eines solchen Antrags stehen etwa eins zu drei. Dagegen befinden sich in den Innenstädten hunderttausende ungenutzte Wohnungen, doch die Regierung denkt nicht daran, dem gesetzlich festgeschriebenen Recht auf Wohnraum Geltung zu verschaffen. Schlussbetrachtung »Einige Beobachter haben jenen Gewaltausbruch [die Novemberrevolte von 2005] auf das Versagen der Politique de la ville zurückführen wollen. Mit der Politique de la ville wurde aber nie bloß das Ziel verfolgt, in zunehmend fragmentierten Gesellschaften und Städten die Bedingungen des Zusammenlebens wieder herzustellen«, so Claude Jacquier, leitendes Mitglied des »Nationalen Zentrums für wissenschaftliche Forschung« (CNRS) und Vertreter Frankreichs bei URBACT, einer von der Europäischen Kommission ins Leben gerufenen internationalen Plattform für den europaweiten Erfahrungsaustausch zu Fragen der integrierten Stadtentwicklung.54 »Davon abgesehen, dass mit ihr auf einige akute Probleme geantwortet werden sollte, war die Politique de la ville vor allem dem Ziel verpflichtet, neue Formen des Regierens von Städten zu erproben, indem sie Akteure kooperieren ließ, die sich bis dahin – aufgrund unterschiedlicher Berufskulturen und Berufsidentitäten, aber auch aufgrund bürokratischer Blockierungen – nicht weiter miteinander beschäftigt hatten. Diese Kooperation fand statt im Rahmen von Projekten, die es innerhalb bestimmter Territorien – das konnten Stadtviertel oder ganze städtische Regionen sein – zu verwirklichen galt. Weder die Grundsätze noch die Methoden dieser Politik sind zu verurteilen.« Und weiter: »Die Politique de la ville zielte vor allem darauf ab, ein Bewusstsein zu schaffen für die Dringlichkeit einer Reform der politischen Repräsentation, der Verwaltungsstrukturen und verschiedener Politikbereiche wie Bildung, Gesundheit, Kultur, Soziales, Wirtschaft usw. Das ist nicht geschehen. Wenn irgendwo versagt wurde, dann hier.«55 Wer also geglaubt hatte, dass es der Politique de la ville um die Verbesserung der Lebensbedingungen in den Banlieues gehe, wie die verschiedenen französischen Regierungen seit den 1980er Jahren behauptet haben, wurde hier eines Besseren belehrt. Das Zitat von Jacquier ist einem Artikel entnommen, den er kurz vor den Präsidentschaftswahlen von 2007 veröffentlichte. Die seit den Wahlen betriebene Politik hat gezeigt, 53 1,1 Millionen leben in Unterkünften ohne WC oder Badezimmer, wie z.B. in Kellern oder Garagen, und 1,03 Millionen müssen sich den spärlichen Wohnraum mit zu vielen Personen teilen. Siehe: www.heise.de/tp/r4/artikel/24/24447/1.html, Zugriff: 06.05.2009. 54 Das Programm URBACT soll der Zusammenarbeit zur Verbreitung bewährter Verfahren dienen. URBACT zielt darauf ab, »bewährte Verfahren« herauszustellen und aus den in diesen Programmen festgestellten Stärken und Schwächen zu lernen. Die Zielgruppe sind Akteure aus 216 Städten, die im Rahmen der Programme URBAN I und II und der Städtischen-Pilotprojekte unterstützt werden. http://ec.europa.eu/regional_policy/urban2/urbact_de.htm. 55 C. Jacquier, Les urnes résonneront-elles des raisons des émeutes?, in: Urbanisme Nr. 353 (März/April 2007), hier zit. nach http://www.urbanisme.fr/issue/magazine.php?code=353&section=AGORA. 31 dass die »sensiblen Stadtgebiete« ihre Funktion als Experimentierfeld zur Erprobung neuer Formen des Regierens nur allzu gut erfüllt haben – auch wenn Jacquier noch meinte, das Experiment für gescheitert erklären zu müssen. »Die in Frankreich gängigen Organisationsformen von Politik und Verwaltung hindern die Stadt daran, als kollektiver Akteur zu fungieren, als ein in den Bereichen Wirtschaft, Soziales und Umwelt aktiver Impulsgeber innovativer Projekte, der das gesamte Spektrum gesellschaftlicher Kräfte in sich aufzunehmen vermag«, so Jacquier an anderer Stelle.56 Zu den Hemmschuhen in Politik und Verwaltung zählt er die hermetische Abgeschlossenheit der Verwaltungsorgane, die »teure und ineffiziente« Doppelstruktur von Zentralregierung und Lokalverwaltung (eine Doppelstruktur, die, wie es im Artikel heißt, »das Subsidiaritätsprinzip ignoriert«), 57 die fehlende Trennung entscheidender und ausführender Organe innerhalb der Lokalverwaltung sowie die anhaltende Spaltung zwischen der Bevölkerung und ihren politischen Vertretern, die maßgeblich auf eine mangelnde politische Einbindung von Jugendlichen, Frauen und Personen mit Migrationshintergrund zurückgehe. All das hindere die französische Demokratie daran, »ihre Humanressourcen bestmöglich zu verwerten, anstatt sie zu verschleißen.« 58 Das Ideal einer schlanken Lokalverwaltung, die ihre Tätigkeit an den Kriterien maximaler Wirtschaftlichkeit ausrichtet, hat sich mittlerweile in fast allen EU-Staaten durchgesetzt. Heute gehen die Bemühungen vor allem dahin, dieses Modell – auch unter Rückgriff auf Instrumente der europäischen Entwicklungspolitik – im gesamten Mittelmeerraum durchzusetzen. Es sind nicht zuletzt auch die Experten für Stadtentwicklung, die die entsprechenden Konzepte beisteuern, etwa das der »integrierten Stadt« (ville integrée), dem das Ideal der politischen Einbindung eines möglichst breiten Spektrums an gesellschaftlichen Akteuren zugrunde liegt. Kombiniert werden diese Konzepte mit allem, was gerade opportun erscheint. So spielt etwa die »nachhaltige Entwicklung« heute eine ähnliche Rolle wie früher die »Bekämpfung der Arbeitslosigkeit.« Wirtschaft, Soziales und Umwelt, die drei in der Lissabon-Strategie von 2000 hervorgehobenen Schwerpunkte der EU-Politik, müssen nach Jacquier heute auch im Mittelpunkt einer »nachhaltigen Stadtentwicklung« stehen.59 Die Verwaltung dieser drei Bereiche obliege nicht mehr den Zentralregierungen, sondern den Régions urbaines, den städtischen Regionen. Damit sei für die wesentlichen Aufgaben auch nicht die politische Klasse im engeren Sinn zuständig. Vielmehr seien jetzt die Experten für Politique de la ville und Stadtentwicklung am Zuge. Nur diese Experten seien im Stande, die zahlreichen Akteure zu mobilisieren, die es auf den verschiedenen Ebenen, vom Stadtviertel bis zur Region, in das neue Entwicklungsprojekt einzubinden gelte. Früher, so Jacquier weiter, sei es üblich gewesen, die französische Politique de la ville in einen Gegensatz zu den Ansätzen anderer EU-Staaten zu stellen. So sei etwa die britische Regierung dafür bekannt, dass sie besondere Maßnahmen zugunsten der ärmsten Stadtviertel ablehne, da sie davon ausgehe, der in einer bestimmten Stadt produzierte Reichtum würde letztlich immer auch diesen Vierteln zugute kommen, sich also über einen trickle-down-effect gleichsam von selbst über das städtische Territorium verbreite. Die Experten der französischen Politique de la ville hätten, wie Jacquier betont, stets auf einen stärker regulativen Ansatz gesetzt, und zwar aufgrund ihrer begründeten Befürchtung, das Wohlstandsgefälle zwischen verschiedenen Stadtteilen könne Unruhen zur Folge haben. Die zur Förderung des »sozialen Zusammenhalts« ergriffenen Maßnahmen hätten dabei stets auch auf eine »Transformation der 56 57 58 59 Jacquier, Rede vom 6. Juni. 2008, Paris. Ebd. Ebd. Ebd. 32 Mentalitäten« abgezielt,60 womit nichts anderes gemeint ist, als dass die Armutsgruppen angeregt wurden, sich aktiv an der Verwaltung der Ungleichheit zu beteiligen. Aus seiner Rückschau auf die Besonderheiten der französischen Politique de la ville entwickelt Jacquier die Perspektive einer auszubauenden »Dienstleistungsökonomie«, die quer zu den eingefahrenen Zuständigkeitsstrukturen früherer Jahre zu liegen habe (»Ko-Produktion«). Die Herstellung von »Sicherheit« wird ausdrücklich als eine der für diese Ökonomie konstitutiven Dienstleistungen benannt. 61 Jacquier ist sich bewusst, dass vergleichbaren Modellen in der Vergangenheit mit Widerstand begegnet wurde, etwa, wenn sich SozialarbeiterInnen geweigerten, mit der Polizei zusammenzuarbeiten. Er spricht in diesem Zusammenhang von einem hoffnungslos antiquierten »Korporatismus«.62 Die von der Politique de la ville für die ZUS entwickelten Techniken sollen Jacquier zufolge in Zukunft im »gesamten Territorium« der städtischen Ballungsgebiete angewandt werden, insbesondere aber in den »von der Einwanderung geprägten Vierteln«.63 Kostspielige Pläne wie der PNRU würden es zwar erlauben, den »Immobilienwert« solcher Viertel wieder auf den Stand von »vor 30 Jahren« anzuheben, doch sei es sinnvoll, sie zunächst noch in ihrem gegenwärtigen Zustand zu belassen, um dort neue Modelle nachhaltiger Stadtentwicklung zu erproben – Jacquier spricht insbesondere von der Schaffung von »Territorien eines städtischen Recycling« (territoires de recyclage de la ville) und hebt in diesem Zusammenhang hervor, dass es von der in Afrika praktizierten Entwicklungspolitik zu lernen gelte, insbesondere von der besonderen sozialen und ökonomischen Bedeutung, die in den neueren entwicklungspolitischen Ansätzen den Frauen zugesprochen wird.64 Auf die Novemberrevolte von 2005 kommt Jacquier in seinem oben zitierten Artikel für die Zeitschrift Urbanisme zu sprechen. Er meint in der Revolte einen »kolonialen Zug« erkannt zu haben, denn bei den Aufständischen habe es sich überwiegend um »Nachkommen von Migranten aus der Karibik und aus Afrika, d.h. aus dem ehemaligen Kolonialimperium« Frankreichs gehandelt, während es zugleich »nur geringe Kontakte zwischen Beurs und Blacks und nur eine geringe Beteiligung von Personen mit türkischem, osteuropäischem, asiatischem oder lateinamerikanischem Hintergrund« gegeben habe. 65 Dieser ethnisierende Blick auf die Revolte kann sich auf keinerlei Forschungsergebnisse stützen. Selbst Polizisten, die während der Revolte im Einsatz waren – und die ebenso wenig wie irgendwer sonst für sich beanspruchen können, unter den Kapuzenpullover eines jeden der 20.000 Aufständischen geblickt zu haben – betonen in ihrem ohne Absprache mit dem Innenministerium herausgegebenen Bericht, die Revolte habe keinerlei »kommunitaristische« Züge aufgewiesen. Aus Jacquiers Aussage spricht also weniger eine konkrete Kenntnis als vielmehr der Wunsch, die soziale Realität zu ethnisieren. So kann er die Jugendlichen der Banlieues als Opfer eines »bruchstückhaften Geschichtsverständnisses voller Verkürzungen« und einer »ideologisierten Umschreibung der Geschichte« denunzieren, und ihnen zugleich vorwerfen »die Begriffe von gestern zu benützen, um die Schmerzen von heute zu benennen«, indem »sie die Sackgassen, in denen sie sich befinden, in Verbindung mit den Erlebnissen ihrer Vorfahren, ihrer Eltern und jener MigrantInnen, die vor den Toren Europas stehen, stellen«. Wir haben in diesem Text dargelegt, wie eine Republik, die ihre Kolonialpolitik jahrzehntelang auf rassistischen Diskursen gegründet hatte, in den 1970er Jahren zur Eindämmung der Arbeitsmigration auf 60 61 62 63 64 65 Ebd. Ebd. Ebd. Ebd. Ebd. Jacquier, Les urnes résonneront-elles des raisons des émeutes? 33 Konzepte und Techniken zurückgegriffen hat, die auf den Krieg gegen die algerische Befreiungsbewegung zurückgehen. Unter Berufung auf die Bekämpfung gesellschaftlicher Ausgrenzungserscheinungen hat dieser Staat innerhalb seines eigenen Territoriums Zonen der Ausnahmepolitik geschaffen, die sich nicht zufällig mit den von der Arbeitsmigration am stärksten geprägten Gebieten decken. In den »sensiblen Stadtgebieten« konnten sicherheitspolitische Dispositive entwickelt werden, die quer zur Unterscheidung zwischen den Bereichen des Militärischen und des Zivilen liegen. Die Sozialpolitische und mililtärisch-polizeiliche Maßnahmen haben sich in Frankreich seit den 1970er Jahren nur scheinbar unabhängig voneinander entwickelt; heute fließen sie in die neuen Techniken des Regierens städtischer Räume ein. Mit dem Jargon der »nachhaltigen Entwicklung« und der Beschwörung einer neuen »Dienstleistungsökonomie« soll eine wirtschaftliche Ordnung abgesichert werden, deren Zukunftsfähigkeit immer fragwürdiger scheint. Die postkoloniale Republik, die auf der Verleugnung aller Kontinuitäten zwischen ihr und dem Kolonialismus gründet, schickt sich heute an, ihre in den »sensiblen Stadtgebieten« erprobten Regierungstechniken zu exportieren. Dass die Entwicklung dieser Regierungstechniken sich nicht zuletzt aus dem staatskritischen Denken der 1970er Jahre zu speisen gewusst hat, ist dabei noch das geringste Übel. 34