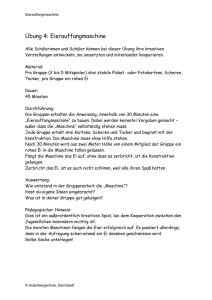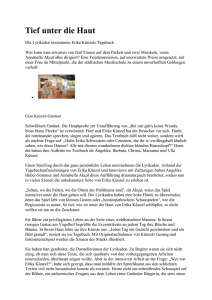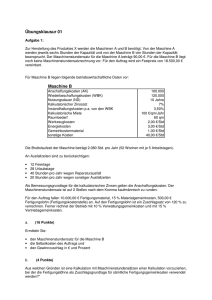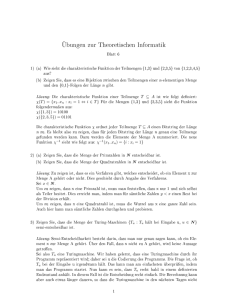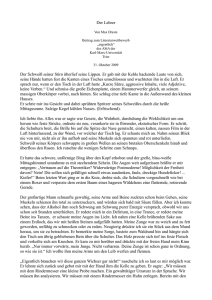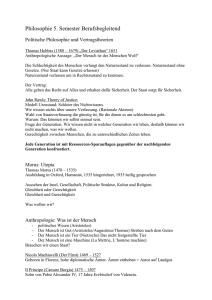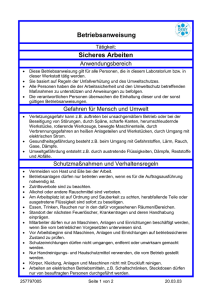Roger Behrens Rezension Werner Künzel/Peter Bexte Maschinende
Werbung

In: Widerspruch Nr. 29 Geist und Gehirn (1996), S. 129-133 Autor: Roger Behrens Rezension Werner Künzel/Peter Bexte Maschinendenken - Denkmaschinen. An den Schaltstellen zweier Kulturen Frankfurt/Main 1996 (Insel-Verlag), 262 S., brosch., 16,80 DM. Werner Künzel und Peter Bexte haben mit ihrem Buch "Allwissen und Absturz. Der Ursprung des Computers" eine, wie sie es selbst nennen, "Archäologie des Computer-Zeitalters" projektiert. Diese Archäologie wird mit dem vorliegenden Band "Maschinendenken / Denkmaschinen" fortgesetzt und um weiteres, beachtliches Material ergänzt. Es ist die besondere Kombination von gemeinhin Disparaten, die hier in einer Walter Benjamin verwandten Form zusammengefügt wird und das Lesen zu einer spannenden und im guten Sinne unterhaltenden Abenteuerreise des abseitigen Denkens macht. Wie Benjamin Grandville und Hegel miteinander konfrontierte, um etwas über die Funktionsmechanik moderner Kultur und Gesellschaft zu erfahren, so verfolgen Künzel und Bexte die Seitenlinien der Philosophie- und Technikgeschichte - und bringen beide fruchtbar zusammen. Programmatisch heißt das: "Genealogie der Computergeschichte aus dem Geiste der Philosophie". Das entscheidende Problem liegt dabei nicht darin, wieviel menschlicher Geist in Maschinen oder Maschinenkonzepten materialisiert ist. Die Kardinalfrage lautet vielmehr: "wo ist das philosophische Denken selbst ein maschinelles Denken, ein Denken der Maschine im genitivus subjektivus". Oder anders formuliert: "wo und wie ist das Denken als Agent der Maschine aufgetreten, die wir als universelle symbolische Maschine begreifen"(78). Archäologie und Genealogie verweisen dabei nicht nur methodisch auf Nähen zu Foucault und Nietzsche; die Autoren verfolgen sozusagen die Spur des Modernsten der Moderne, den Herkunftsweg der Computertechnologie. Und sie legen eine Entwicklung frei, deren Anfang nicht unbedingt mit den Behrens: Künzel großen Zielen der Neuzeit zusammenfällt, sondern mit den abseitigen Ideen, mit dem Barock, mit Leibniz' "ars combinatoria" und der langen Geschichte von Maschinenerfindern, deren Konstruktionen im Zeitalter der Vernunft zu verrückt erschienen, um ernst genommen zu werden. Erst im Rückspiegel der Philosophiegeschichte kommen die verschrobenen Erfinder zu ihrem Recht. Es gibt ein neuronales, nicht der Linearität von Geschichte folgendes Netz: Hegels Wissenschaft der Logik und Charles Babbages "Difference Engine" bzw. "Analytical Engine"; Jean Paul als Datenverarbeiter; Marquis de Sade ließe sich in die Programmiersprache COBOL übersetzen etc. Vor allem aber gibt es die große Linie zwischen Leibniz und dem Computererfinder Konrad Zuse. Diese Erzählperspektive der Computergeschichte lebt vom Charakter der Anekdote. In einer kleinen Erzählungen lesen wir z.B., warum das Befreien des Rechners von Viren "debugging" genannt wird: weil nämlich in den ersten Großrechnern einmal Mottenkäfer in den Relais für Störungen gesorgt haben. Oder mit welchem Feinsinn Konrad Zuse vom "Rechnenden Raum" spricht, wo erst Jahre später die Rede vom Cyberspace gängig wird. Künzel und Bexte arbeiten gewissermaßen mit anderen Speicherkapazitäten; sie erzählen nicht die Geschichte des Computers, die selbst nur ein Teil der Geschichte der Menschheit ist, sondern subsumieren die Menschheitsgeschichte der Maschinengeschichte. Dabei verfallen sie genau dem, was sie aufdecken wollen. Die Maschinen gewinnen keine reale Macht über den Menschen, sondern beherrschen seine Vorstellungen. Wer aber in jedem Philosophen nur einen Datenverarbeiter und Softwareentwickler sieht, betreibt selbst nur noch Datenverarbeitung und Softwareentwicklung. Der phänomenologische Schlachtruf "Zu den Maschinen selbst" wird zur Phrase, die nur bestätigt, was man insgeheim unterstellte: daß die Welt so oder so nur eine Maschine, machina mundi, ist. Die Maschine und der Computer verlieren den Status eines Modells, Sein und Schein verschwimmen, und der Schaltkreis wird zum sozialen Feld. Leibniz, der Philosoph und Maschinenbastler, der schon eine Sprache aus Nullen und Einsen für denkmöglich hielt, ohne freilich ihre computerdigitale Realmöglichkeit zu erkennen, wird in Künzels und Bextes Darstellung zum reinen Maschinenapologeten. Übergangen wird gerade der wertvollste Impuls, den Leibniz gegen die mechanistische Verengung der Welt gegeben hat: "Und denkt man sich aus, daß es eine Maschine gäbe, deren Bauart es bewirke, zu denken, zu fühlen und Perzeptionen zu haben, so wird man sie sich unter Beibehaltung der gleichen Maßstabverhältnisse derart vergrößert vorstellen können, daß man in sie wie in eine Mühle einzutreten vermöchte. Bücher zum Thema Dies gesetzt, wird man in ihr, sobald man sie besucht, nur Stücke finden, die einander stoßen, und niemals etwas, das eine Perzeption erklären möchte. So muß man die Perzeption in der einfachen Substanz und nicht in dem Zusammengesetzten oder in der Maschine suchen." Künzel und Bexte kontern lax: "Etwas mehr als zwei Jahrhunderte später sieht die Sache anders aus. Auf der Tagesordnung der Naturwissenschaften stehen Themen, deren Brisanz diese Leibnizsche Polemik in den Schatten stellen." (210f.) Kurzum: Leibniz irrt, menschliche "Denk- und Empfindungsvorgänge" können sehr wohl mechanisch erklärt werden, spätestens seit Zuses Z 1, dem, wie Zuse ihn nannte, "Intelligenz-Verstärker". Abgesehen davon, daß Künzel und Bexte den Begriff der Perzeption mit der Übersetzung "Denk- und Empfindungsvorgänge" unterbieten, verhüllen sie auch den ganzen Kontext der Leibnizschen Überlegung, die ja schließlich gegen Descartes' Weltmodell von res extensa und res cogitans gerichtet war. Das Hauptargument von Leibniz ist nicht die Allegorie der Maschine, sondern der Verweis auf die "einfache Substanz". Welche Brisanz es hat, diese Kritik an Descartes' Philosophie zu unterschlagen, kann hier nur angedeutet werden. Künzel und Bexte sind nämlich selbst nicht mehr als digitale Cartesianer: die Trennung der Welt in res extensa und res cogitans ist ihnen heilig, sonst ginge nämlich ihre Rechnung nicht auf, die alles in die Kategorien von Hard- oder Software einteilt. Hardware = res extensa, Software rührt Das = res cogitans. vermutlich vom Begriff der Maschine selbst her, die Christian Wolff als "ein zusammengesetztes Werk" definiert, "dessen Bewegungen in der Art der Zusammensetzung gegründet ist". Heinz von Foerster dagegen definiert Maschine als "eine Anordnung von Regeln und Gesetzen, durch die gewisse Tatbestände in andere transformiert werden". Beiden Definitionen, die Künzel und Bexte als Grenzrahmen benutzen, machen schließlich alles zur Maschine und zur Technik. Die Untersuchung wird somit zur selffulfilling prophecy. Zwar klingen die Begriffe gewaltig, letztlich aber sind sie unpräzise. Zwischen beiden Definitionen erstreckt sich ein unendlicher Raum, ein wahrer Cyberspace, in dem eben alles zur Maschine wird, ja längst ist. Künzel und Bexte schrecken vor der logischen Konsequenz ihres erklärten Weltzustands Technik nicht zurück: "Gesucht sind also jene Diskurstypen der Philosophiegeschichte, in denen die Autoren im Medium des Textes agierten wie Maschinenbauer, gesucht werden damit Texte, deren immanente Funktionsweise einer maschinellen Produktion nahe kommt" (78). Und sie finden diese Diskurstypen oder Texte bei Ernst Jünger, Oswald Spengler, Carl Schmitt und selbstverständlich Martin Heidegger (Natur wird "als ein System von Informationen bestellbar"). Die Autoren erläutern: Die Vorwür- Behrens: Künzel fe gegen Heidegger, "mit ausgefallenen Wörterbildungen zu blenden oder durch die Umbesetzung von Wortbedeutungen etwaige Differenzierungen herbeizureden, treffen einfach nicht den Kern der Sache. Ausdrücke wie 'Inder-Welt-sein' oder 'Ge-stell' sind technische Erfindungen - Notationen, wie sie jeder Programmierer nachvollziehen kann. Heideggers Kunstsprache ist im Wesen eine Sprache der Technik, verwandt den Computersprachen, Text-Coding" (236). Rettet das die Philosophie, daß die Programmierer ihre Sprache verstehen? Bill Gates als Interpret Heideggers?! Künzels und Bextes Exkursion in die Welt der universellen Rechenmaschinen endet "an einem Fluchtpunkt, wo sich Zuse, Heidegger und Marshall McLuhan unversehens begegnen: im globalen Dorf" (242). So wird heute postmodern auf Heideggers Frage geantwortet, warum man in der Provinz bleiben solle. Dabei fing doch alles als großer Reise- und Aufbruchsplan an. Roger Behrens