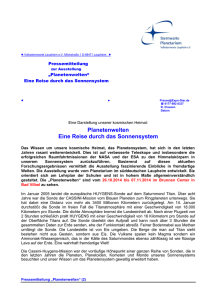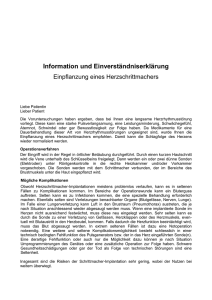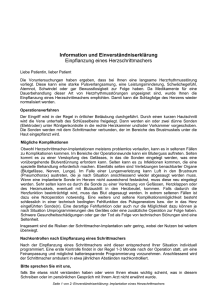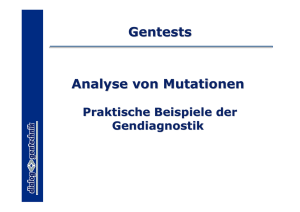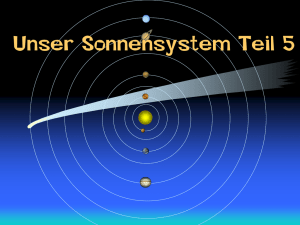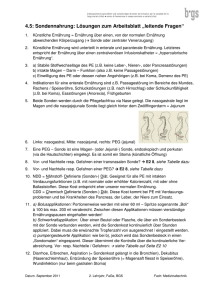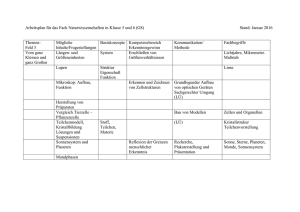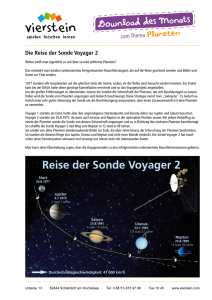Überraschungen vor der haustür
Werbung

Themen der Wissenschaft Überraschungen vor der Haustür Ist die Physik innerhalb des Sonnensystems wirklich verstanden? VON OLIVER PREUSS, HANSJÖRG DITTUS UND CLAUS LÄMMERZAHL 26 Sterne und Weltraum April 2007 Eine Reihe von Beobachtungen deutet darauf hin, dass die grundlegende Dynamik im Sonnensystem vielleicht doch nicht so gut verstanden ist, wie man bislang glaubte. Unerwartete Bahnabweichungen von Raumsonden beim Verlassen des Sonnensystems und beim Vorbeiflug an der Erde, ein kürzlich festgestelltes, geringes Anwachsen der Astronomischen Einheit, und Anomalien in der kosmischen Hintergrundstrahlung sorgen für Ratlosigkeit bei den Astrophysikern. S eit jeher werden Fortschritte in der Physik durch Beobachtungen angeregt, welche sich nicht im Rahmen der jeweils gültigen Standardtheorien erklären lassen. Berühmte Beispiele hierfür sind die Interferenzexperimente von Michelson und Morley, deren Ergebnisse im Widerspruch zur damaligen Ätherhypothese standen und erst mittels der Speziellen Relativitätstheorie eine befriedigende Erklärung fanden, oder die seit etwa 1850 bekannte, anomale Periheldrehung des Merkur, welche anfangs nur als Messfehler angesehen wurde und heute eine wichtige experimentelle Stütze der Allgemeinen Relativitätstheorie darstellt. Auch heutzutage gibt es verschiedene physikalische Phänomene, deren Interpretation die gegenwärtigen Theorien vor große Probleme stellt, wofür die Dunkle Materie und Dunkle Energie als die bekanntesten Beispiele dienen können. Wir wollen im Folgenden vier weitere astrophysikalische Beobachtungen vorstellen, für die auch nach teils mehrjährigen, intensiven Untersuchungen bislang noch keine allgemein anerkannten Erklärungen gefunden werden konnten. Das besondere an diesen Phänomenen ist, dass sie, astronomisch gesehen, quasi vor unserer Haustür gemessen werden und so auch ernsthafte Fragen hinsichtlich der Physik innerhalb des Sonnensystems aufwerfen. Die Flyby-Anomalie Etwas mehr als ein Jahr war seit ihrem Start vergangen, als die Raumsonde Ga­ lileo am 8. Dezember 1990 zu ihrem ersten von insgesamt zwei geplanten Vorbeiflügen an der Erde zurückerwartet wurde. Da die Startgeschwindigkeit für einen direkten Kurs zum Zielplaneten Jupiter zu gering war, wurde die Sonde zunächst zu einem nahen Vorbeiflug an der Venus geleitet. Bei dieser Begegnung wurde sie durch das Gravitationsfeld des Planeten beschleunigt und zurück in Richtung Erde abgelenkt, wo sie bei zwei aufeinander folgenden Vorbeiflügen ausreichend Schwung holen sollte, um mit einer dann ausreichenden Geschwindigkeit die Reise zum Jupiter antreten zu können. Solche nahen Vorbeiflüge, auch Flybys, Swingbys oder Gravity Assists genannt, sind in der heutigen Raumfahrt ein unverzichtbares Hilfsmittel, durch das viele Missionen überhaupt erst möglich werden [1]. Das zugrunde liegende Prinzip ist denkbar einfach: Während des nahen Vorbeiflugs einer Raumsonde an einem Himmelskörper, zum Beispiel einem Planeten, Mond oder Asteroiden, findet eine gravitative Wechselwirkung zwischen beiden Objekten statt. Vom Bezugssystem des Planeten aus betrachtet ändert sich durch die Begegnung nur die Flugrichtung der Sonde, während deren Geschwindigkeit und somit die Bewegungsenergie vor und nach dem Vorbeiflug gleich bleibt. Beobachtet man diesen Vorgang jedoch vom Bezugssystem der Sonne aus, so muss nun auch die Eigengeschwindigkeit des Planeten mit berücksichtigt werden. Gemäß den Newtonschen Bewegungsgesetzen bewirkt die Gravitation eine Änderung der Bewegungsenergie sowohl des Planeten als auch der Sonde, wobei aufgrund der Energieerhaltung die Summe der Bewegungsenergien vor und nach dem Vorbeiflug die gleiche ist. Je nachdem, wie die Flugbahn der Sonde zur Bahn des Planeten orientiert ist, überträgt dabei entweder der Planet einen Teil seiner Energie auf die Sonde, welche dadurch beschleunigt wird, oder die Sonde wird abgebremst, indem sie umgekehrt Bewegungsenergie auf den Planeten überträgt. Aufgrund des gewaltigen Massenunterschieds zwischen Planet und Sonde bleibt in beiden Fällen die Bewegungsänderung des Planeten unmessbar gering, während die Sonde mittels eines solchen Manövers ihre Geschwindigkeit beträchtlich verändern kann. Reine Himmelsmechanik? Flyby-Manöver sind somit nichts anderes als angewandte Himmelsmechanik, deren physikalische Grundlagen man seit Newton als vollständig bekannt und verstanden betrachtet. Aus diesem Grunde erwartete man auch keine Überraschung, als die Sonde Galileo im Dezember 1990 zu ihrem ersten Erdvorbeiflug zurückerwartet wurde. Zu den Routineaufgaben wähSterne und Weltraum April 2007 27 Erdvorbeiflüge. Um nun während eines Flybys mögliche Abweichungen einer Sonde von ihrer geplanten Bahn aufzufinden, bildet man die Differenzen zwischen den gemessenen und den aus dem voraussichtlichen Bahnverlauf theo­ retisch berechneten Doppler-Verschiebungen des Radiosignals. Setzt man nun noch voraus, dass bei der Modellierung der Flugbahn keine wesentlichen Fehler unterlaufen sind und zudem der Einfluss der Erdatmosphäre auf die Ausbreitung des Signals korrekt in die Rechnungen einbezogen wurde, sollten diese Differenzbeträge, auch Doppler-Residuen genannt, während des gesam­ten Vorbeiflugs maximal von der Größe der Messund Modellierungenauig­keit sein. Was jedoch zum allergrößten Erstaunen der beteiligten Wissenschaftler bei Vorbeiflug von Galileo im Dezember 1990 gemessen wurde, ist in Abb. 1 dargestellt. Der plötzliche Anstieg der Doppler-Residuen von etwa 66 Millihertz entspricht einer anomalen Geschwindigkeitszunahme der Sonde von 3.92 ± 0.08 mm/s. Zwar mag diese Abweichung Abb. 1: Doppler-Residuen bei Galileo während seines ersten Flybys im Dezember 1990. Die Ano­ malie zeigt sich im deutlichen Sprung der Messwerte zum Zeitpunkt der größten Annäherung. 28 Sterne und Weltraum April 2007 lächerlich gering erscheinen, aber verglichen mit der Präzision, mit welcher solche Messungen üblicherweise durchgeführt werden, handelt es sich um einen durchaus signifikanten und somit erklärungsbedürftigen Wert. Auch muss beachtet werden, dass hier ein Geschwindigkeitsanstieg im Bezugssystem der Erde gemessen wurde, in welchem, wie oben beschrieben, gemäß der klassischen Dynamik die gesamte Energie der Sonde während des Flybys konstant bleiben sollte. Die gemessene Abweichung würde bei einem auf der Erde senkrecht nach oben geworfenen Stein dem Befund entsprechen, dass dieser mit einer Geschwindigkeit zurückfällt, die größer als seine Abwurfgeschwindigkeit ist und somit den Energieerhaltungssatz klar verletzt. Unmittelbar nach dem Flyby von Ga­ lileo wurde die anomale Geschwindigkeitszunahme sowohl am Jet Propulsion Laboratory (JPL) als auch am Goddard Space Flight Center und an der University of Texas eingehend untersucht, wobei jedoch keine befriedigende Erklärung gefunden werden konnte. Mit gespannter Aufmerksamkeit verfolgte man daher zwei Jahre später Galileos zweiten Vorbeiflug an der Erde. Während allerdings die Sonde bei ihrer ersten Passage noch in einer Höhe von 959.9 Kilometern an der Erde vorbei flog, näherte sich Galileo im Dezember 1992 bis auf 303.1 Kilometer. Dieses Eintauchen in die obere Ionosphäre der Erde wirkte sich leider nachteilig auf die präzise Geschwindigkeitsmessung aus, weil die Wechselwirkung mit der oberen Atmosphäre zu einer nur relativ ungenau modellierbaren Abbremsung der Sonde führte. Dies resultierte in einer Unsicherheit bei der Geschwindigkeitsmessung, welche jeweils un­gefähr der Größenordnung der anomalen Geschwindigkeitszunahme beim ersten Flyby entsprach, sodass eine mögliche Anomalie beim zweiten Vorbeiflug nicht eindeutig feststellbar war. Der rätselhafte Energiegewinn bei Ga­ erstem Vorbeiflug blieb somit eine zwar kuriose, aber dennoch isolierte Einzelmessung, bis am 23. Januar 1998 die Sonde »Near Earth Asteroid Rendezvous« (Near) ebenfalls ein Flyby-Manöver an der Erde durchführte. Bei einer maximalen Annäherung bis auf 538.8 km zeigte sich auch hier wie schon bei Galileo ein unerwarteter, aber deutlicher Sprung in den Doppler-Residuen. Er betrug nun 730 Millihertz, entsprechend einem Geschwindigkeitszuwachs von 13.46 ± 0.13 mm/s. Auch für diese Abweichung konnte nach einer sorgfältigen Analyse keine Erklärung gefunden werden, weshalb danach für dieses Phänomen die Bezeichnung »Flyby-Anomalie« geprägt wurde. lileos Weitere Versuche. Mit einer fortan stetig wachsenden Zahl unbemannter Raumfahrtmissionen stieg im Folgenden auch die Anzahl der Versuche, die Flyby-Anomalie bei Erdvorbeiflügen anderer Raumsonden zu messen. Bei den Passagen von Cassini im August 1999 sowie von Stardust im Januar 2001 ergab sich jedoch das Problem, dass die Dopplerdaten durch das Zünden der Manövriertriebwerke während der Vorbeiflüge stark beeinflusst wurden, weshalb verlässliche Aussagen hinsichtlich des Auftretens der Anomalie nicht möglich waren. Beim Flyby von Rosetta am 4. März 2005 wurde hingegen ein anomaler Geschwindigkeitszuwachs von 1.82 ± 0.05 mm/s gemessen, als die Kometensonde in einer Entfernung von 1954 km an der Erde vorbei flog. Eine Voruntersuchung der Passage der Merkursonde Messen­ ger im August 2005 ergab bislang keinen Hinweis auf eine Anomalie. Die Daten der Japanischen Mission Hayabusa werden gegenwärtig noch analysiert. Obwohl trotz umfangreicher Untersuchungen bislang noch keine Erklärung für die Flyby-Anomalie gefunden werden konnte, bleibt die Frage offen, ob es sich 0.12 ● ● ● ● 0.10 doppler-residuen[mHz] rend eines solchen Vorbeiflugs gehört die Messung von Position und Geschwindigkeit der Raumsonde, um eventuelle Abweichungen von der vorherberechneten Bahn möglichst schnell zu erfassen. Hierzu werden von einer zum Deep Space Network (DSN) der Nasa gehörenden Bodenstation aus Radiosignale mit einer festen Frequenz zur Raumsonde geschickt, welche diese mittels eines Transponders zur Erde zurückfunkt. Die Idee hinter diesem zunächst vielleicht etwas kompliziert anmutenden Verfahren besteht darin, dass auf diese Weise die Geschwindigkeit der Sonden direkt über die Doppler-Verschiebung des zurückgesandten Signals, bestimmt werden kann. Ähnlich wie sich die Tonhöhe eines vorbeifahrenden Autos ändert, je nachdem ob sich das Fahrzeug auf den Beobachter zu oder von ihm fort bewegt, verschiebt sich die Frequenz eines elektromagnetischen Signals wenn sich Sender und Empfänger relativ zueinander bewegen. Die Größe einer solchen Frequenzverschiebung stellt ein Maß für die Geschwindigkeit zwischen dem Sender und der Quelle dar: So erlaubt dieser so genannte Doppler-Effekt die Bestimmung der Relativgeschwindigkeit zwischen einem Satelliten und der Erde. ● ● ● ● ● ● ● ●● ●● ●●●●●●●●●●● ● ●●●● ●●●●● ●●●●●● ●●●● ●●● ●●●●●●●● ●●●●● ● ● ● 0.08 0.06 Größteannäherung 8.dez.1990,20:34:34utC ● ● ● ● ● ● ● ● 0.04 0.02 ● ● ●●●●●●●●●●●● ● ●●●●●●●●●● ●● ●●●●● ●●● ●● ●●● ● ● ●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●● ●●●●●●●●●● ● ● ● ● ● 0 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ● ● ●● –0.02 7.12.1990,12h ● ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●●●●●● ● ●● ● ●●● ● ● ●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●● ●●● ●●●●●●●● ● ●●● ●● ●●●●●●● ● ●● ● ● ● ● ● ● 8.12.1990,12h Zeit[utC] 9.12.1990,12h 10.12.1990,12h Die Pioneer-Anomalie Während die Flyby-Anomalie bislang selbst in Fachkreisen noch weitestgehend unbekannt ist, genießt die Pioneer-Anomalie bereits seit mehreren Jahren eine große Aufmerksamkeit (vgl. auch [2]). Hierbei handelt es sich um eine nicht verstandene, anomale Beschleunigung der Raumsonden Pioneer 10 und 11 in Richtung zur Sonne, welche zur Folge hat, dass die Sonden nach nunmehr 16 Jahren um etwa eine Million Kilometer von den vorhergesagten Positionen abweichen. P ioneer 10 und 11 wurden am 2. März 1972 beziehungsweise am 5. April 1973 als Teil des P ioneer-Programms zur Erforschung des erdfernen Weltraums gestartet (Abb. 3). Als erstes Raumfahrzeug überhaupt durchquerte P ioneer 10 im Juli 1972 den Asteroidengürtel und erreichte am 4. Dezember 1973 den Jupiter. Bei dieser Begegnung beförderte der Planet sie im Rahmen eines Flyby-Manövers auf eine hyperbolische Bahn, auf der die Sonde schließlich das Sonnensystem verließ. Die letzten Messdaten von P io ­ neer 10 wurden am 27. April 2002 aus einer Entfernung von 80.22 AE (Astronomischen Einheiten) empfangen, das letzte Signal erreichte die Empfangssta­ tionen auf der Erde am 23. Januar 2003. Sehr viel früher stellte hingegen Pio­ neer 11 ihren Dienst ein. Ein Jahr nach ihrer Schwestersonde gestartet, wurde Pio­neer 11 beim Vorbeiflug am Jupiter in Richtung Saturn abgelenkt, den sie am 1. September 1979 erreichte. Dieser beschleunigte die Sonde auf einen neuen Kurs in Richtung des Sternbilds Adler, wo Pioneer 11 in etwa vier Millionen Jahren auf den nächsten Stern treffen wird. Weil ihre Energieversorgung zur Neige ging, wurde ihr letztes Signal bereits im September 1995 auf der Erde empfangen, als sie 44.7 AE von uns entfernt war. Hochpräzise Bahnverfolgung. Zu den wissenschaftlichen Zielen von Pioneer 10 und 11 gehörte neben der erstmaligen Erkundung von Jupiter und Saturn auch die Suche nach kleinen Körpern im äußeren Sonnensystem. Da sich solche Objekte in erster Linie durch die Wirkung ihrer Gravitation auf die Raumsonden und somit bei diesem Phänomen tatsächlich um ein Anzeichen neuer Physik handelt oder ob eine konventionelle Ursache bis heute übersehen wurde. Unsere Aufmerksamkeit richtet sich daher auf eine präzise Vermessung der anstehenden RosettaFlybys. Am 25. Februar 2007 flog die EsaSonde in einem Abstand von etwa 250 Kilometern am Mars vorbei (Abb. 2 und S. 16). Im November 2007 und 2009 wird sie den zweiten und dritten Flyby an der Erde durchführen. Insbesondere der Vorbeiflug am Mars ist von großem Interesse, da die Anomalie aufgrund des sehr präzise vermessenen Gravitationsfelds der Erde bislang nur bei Flybys an unserem Planeten gemessen werden konnte. Ein Auftreten der Anomalie während des Marsvorbeiflugs könnte als Indiz dafür gelten, dass der Effekt nicht durch spezifische Eigenschaften der Erde verursacht wird. Die entsprechenden Daten werden gegenwärtig noch analysiert. Abb. 2: Künstlerische Darstellung der Raumsonde Rosetta während ihres Flybys am Mars am 25. Februar 2007. (Bild: Esa) durch kleinste Störungen der Flugbahn bemerkbar machen, wurden die baugleichen Pioneer-Sonden so konstruiert, dass sich ihre Bahnen mit hoher Präzision verfolgen ließen. Diese extrem genaue Navigation ermöglichte schließlich auch die Entdeckung der anomalen Beschleunigung dieser Sonden. Das Kernstück sowohl für die Kommunikation wie auch für die Naviga­tion der Pioneer-Sonden bildete das Deep Space Network (DSN) der Nasa. Ähnlich wie bei den oben beschriebenen Erdvorbeiflügen wurden auch die Geschwindigkeiten von Pioneer 10 und 11 über das DSN mittels der Zwei-Wege-DopplerVerschiebung gemessen. Hierbei wurden von einer der drei Bodenstationen Radiowellen mit einer festen Frequenz zu den Sonden gesandt, welche das empfangene Signal anschließend wiederum mittels einer Acht-Watt-Sendeanlage und eines Transponders mit einer um den Faktor 240/221 konvertierten Frequenz an die Bodenstationen zurückschickten. Die Geschwindigkeit ließ sich so über die Frequenzdifferenz zwischen gesendetem und empfangenem Signal bestimmen. Umgekehrt kann man jedoch auch ohne Verwendung von Doppler-Messungen die Geschwindigkeit der PioneerSonden aus den bekannten Gravitationsfeldern der Sonne, der Planeten und Asteroiden sowie durch Berücksichtigung Sterne und Weltraum April 2007 29 Verfälschte Messungen? Nachdem zu Beginn der 80er Jahre Hinweise auf eine anomale Beschleunigung der Pioneer- Sonden von Wissenschaftlern des Jet Propulsion Laboratory (JPL) entdeckt wurden, lag zunächst die Vermutung nahe, als mögliche Ursache einen bis dahin übersehenen Fehler in der Datenanalyse anzunehmen. Aus diesem Grund wurden daraufhin die Pioneer-Daten mit drei voneinander unabhängigen Programmpaketen nochmals sorgfältig analysiert. Hierbei wurde jedoch stets das gleiche anomale Signal reproduziert, sodass eine programmtechnische Ursache mittlerweile als recht unwahrscheinlich gelten kann. Die Untersuchungen der PioneerAnomalie konzentrierten sich daher in den vergangenen Jahren darauf, die Größenordnungen jener Effekte abzuschätzen, welche die Bahnen der Raumsonden beeinflussen und somit die Messungen verfälschen können. So wurde beispielsweise spekuliert, dass zusätzliche interplanetare Materie in Form von Staub zu den gemessenen Abbremsungen der Pio­ neer-Sonden führen könnten. Ebenso wären bislang unbekannte Objekte im Kuipergürtel mit maximal einem Drittel der Erdmasse durchaus in der Lage, das beobachtete Signal zu produzieren. Inzwischen kann man diese und ähnliche Hypothesen jedoch ausschließen, da beispielsweise eine Masse, die eine Beschleunigung in der Größenordnung der Anomalie erzeugt, ebenso die Planetenbahnen in beobachtbarer Weise beeinflussen würde. Genauso bräuchte man eine etwa 300 000-mal größere Dichte an interplanetarem Staub, als von der Sonde Ulysses tatsächlich gemessen. Intensiv wurden auch satelliteninterne Einflüsse auf die Beobachtung diskutiert. Aufgrund der Vielzahl der dabei zu be- Pluto neptun PiOneer 10 92 VOYaGer 2 90 88 86 Uranus 84 82 80 78 76 Jupiter saturn 74 73 77 mars 79 79 78 79 erde sonne 86 85 81 84 83 82 83 80 81 81 90 88 87 86 87 82 85 80 78 94 92 90 89 88 86 91 PiOneer 11 91 89 VOYaGer 1 85 80 30 Sterne und Weltraum April 2007 82 87 90 88 86 84 89 91 rücksichtigenden Faktoren können viele Effekte nur indirekt abgeschätzt werden. Eine sorgfältige Fehleranalyse der Arbeitsgruppe um J. D. Anderson vom JPL zeigte jedoch, dass bislang kein satelliteninternes Phänomen eine hinreichende Erklärung für alle Aspekte der Pione­ er-Anomalie liefern kann. Ein wichtiges Beispiel hierfür ist die durch die Wärmeabstrahlung der thermoelektrischen Energiequellen der Raumsonden (RTGs) induzierte Beschleunigung der Raumsonden. Zwar würde bereits eine gerichtete Abstrahlung von nur 63 Watt ausreichen, um die Anomalie zu erklären. Allerdings ist in einem Zeitraum von 20 Jahren die zur Verfügung stehende Energie auf 80 Prozent abgefallen, was eine Änderung der Beschleunigung um mehr als 30 Prozent der Anomalie ausmachen würde. Dies ist jedoch nicht beobachtet worden. Die Pioneer-Anomalie wird mittlerweile zu den wichtigsten ungelösten Fragen der Physik gezählt. Trotz umfangreicher Untersuchungen und Fehleranalysen, in die wir hier nur einen winzigen Einblick geben können, ist es bislang nicht gelungen, eine systematische Ursache zu identifizieren. Dies liegt in erster Linie an einer expliziten Zeitabhängigkeit der meisten in Frage kommenden Effekte, was der Konstanz der Anomalie widerspricht. Somit bleiben die Alternativen, dass die Pioneer-Anomalie entweder gravierende Lücken in unserem Wissen bezüglich der Standardphysik unseres Sonnensystems offenbart, oder aber wir haben es hier mit einem Hinweis auf eine vollkommen neue Physik zu tun. Man muss jedoch dazu sagen, dass die Ansätze zu letzterem oft sehr spekulativ und meist auch nicht besonders überzeugend sind. Viel diskutiert wurden beispielsweise phänomenologische Modifikationen des Newtonschen Gravitationsgesetzes bei geringen Beschleunigungen (Mond), Quintessenzmodelle sowie höherdimensionale Brane-Theorien. Interessant ist auch ein möglicher Zusammenhang zwischen der Pioneer-Anomalie und den Problemen der Dunklen Materie und Dunklen Energie. Die erstaunlich gute Übereinstimmung zwischen der anomalen PioneerBeschleunigung und der kosmischen Beschleunigung c 3 H, wobei c die Lichtgeschwindigkeit und H die Hubble-Konstante ist, führte zur Hypothese, dass die anomale Beschleunigung auf die Expansion des Universums zurückgeführt wer des Einflusses des Sonnenwinds, des interplanetaren Staubs etc. berechnen und diese mit der gemessenen Geschwindigkeit vergleichen. Genau hier zeigte sich nun seit 1979 eine stetig wachsende Differenz zwischen theoretischer und gemessener Geschwindigkeit in Form einer anomalen Verschiebung des Doppler-Signals in den kurzwelligeren Bereich des Spektrums. Eine solche Doppler-Verschiebung lässt sich als eine konstante Abbremsung in Richtung der Sonne interpretieren. Die so gemessene, gegenwärtig unverstandene Abbremsung mit einem Wert von 8.74 ± 1.33 3 10–10 m/s2 bezeichnet man als die Pio­neer-Anomalie. Ihr Wert ist zwar recht klein, sie führte aber im Laufe der letzten 16 Jahre dazu, dass beide Sonden heute etwa eine Million Kilometer von ihren vorhergesagten Positionen entfernt sind. Die anomale Abbremsung wurde für beide Sonden unabhängig voneinander bestimmt, wobei die jeweiligen Werte nur um maximal drei Prozent auseinander liegen. Sowohl bei Pioneer 10 als auch bei Pi­ oneer 11 variiert das anomale Signal zudem nur um etwa 3.5 Prozent über die Beobachtungszeit (Abb. 4). Insgesamt erfahren die Sonden somit eine sowohl hinsichtlich der Richtung als auch des Betrags konstante Beschleunigung in Richtung der Sonne, wobei allerdings die Richtung der Abbremsung mit einer Auflösung von drei Grad nur relativ ungenau bestimmt werden konnte. Abb. 3: Die Bahnen der Sonden Pioneer 10 und 11 (sowie von Voyager 1 und 2), die Anfang der 1990er Jahre das Sonnensystem verlassen haben. zusätzlicheBeschleunigung [10–13km/s2] 10 8 6 4 2 0 0 PIOneer10 PIOneer11 5 10 15 20 25 30 35 40 abstandzurSonne[ae] Abb. 4: Die nicht modellierten Beschleunigungen von Pio­neer 10 und 11. Auffallend ist die Gleichheit der Beschleunigungen bei beiden Sonden, obwohl diese das Sonnensystem in entgegengesetzten Richtungen verlassen. den kann. Dies erwies sich allerdings als nicht haltbar. Mehr als 30 Jahre nach dem Beginn der Pioneer-Mission stellt die Interpretation der anomalen Signale eines der aktuellsten Gebiete physikalischer Forschung dar. So arbeiten wir gegenwärtig am Zarm in Bremen (dem als Außeneinrichtung der Esa betriebenen »Center of Applied Space Technology and Microgravity«, wo auch der bekannte Fallturm für Experimente in der Schwerelosigkeit betrieben wird) in enger Kooperation mit dem JPL daran, die gesamte Flugbahn der Pioneer-Sonden digital im Rechner zu rekonstruieren, um so eventuell weitere Hinweise auf den Ursprung der Ano­ malie zu finden. Zusätzlich wird mit der Deep Space Gravity Probe (Abb. 5) eine neue Mission angestrebt, welche durch ihre spezielle Konstruktion in der Lage sein soll, genauere Messdaten zu liefern, um so eine anomale Beschleunigung aufzuspüren und zu verifizieren. 45 50 55 60 Abb. 5: Vorschlag für eine neue Mission. Die Sonde sollte möglichst symmetrisch gebaut sein. Eine Testmasse, deren Position relativ zur Sonde mit Lasern genau vermessen werden kann, gibt zusätzliche Informationen. Vergrößert sich die Astronomische Einheit? Die Astronomische Einheit (AE) ist neben dem Lichtjahr und dem Parsec eine der wichtigsten Einheiten zur Messung von Längen und Abständen in der Astronomie. Im Gegensatz zur weit verbreiteten Meinung wird sie heute jedoch nicht als mittlerer Abstand zwischen Erde und Sonne definiert. Tatsächlich ist sie laut Beschluss der Internationalen Astronomischen Union festgelegt als der Radius einer kreisförmigen Umlaufbahn, welche ein hypothetisches, masseloses Teilchen beschreiben würde, das einen Zentralkörper mit einer Sonnenmasse ungestört in exakt einem siderischen Jahr, das heißt in 365.2568983… Tagen umkreist. Beide Größen, Bahnradius und Umlaufzeit, sind über das 3. Keplersche Gesetz miteinander verbunden, welches besagt, dass für alle Körper eines Planetensystems das Verhältnis der Quadrate der Umlaufzeiten zu den Kuben der großen Halbachsen ihrer jeweiligen Bahnellipsen eine gemeinsame Konstante ist. Diese Konstante und somit auch die Astronomische Einheit hängt in ihrem Wert folglich nur von der Gravitationskonstanten G sowie von der Masse des Zentralkörpers ab. Die Frage der genauen Messung der Astronomischen Einheit sowie generell die Messung von Entfernungen in unserem Sonnensystem gehört zu den ältesten Problemen der Astronomie. Eine unverzichtbare, praktische Bedeutung kommt hierbei dem 3. Keplerschen Gesetz zu: Hat man aus astronomischen Beobachtungen das Verhältnis der Umlaufzeiten zweier Planeten bestimmt, so erhält man aufgrund des oben beschrie- benen Zusammenhangs zwischen Bahnradius und Umlaufzeit automatisch auch das Verhältnis ihrer Abstände zur Sonne. Auf diese Weise ist es möglich, die Entfernungsverhältnisse sämtlicher Planeten im Sonnensystem recht genau zu bestimmen. Da es sich nur um relative Angaben handelt, fehlt jedoch noch ein absoluter Maßstab, welcher die Angabe der Abstände in Kilometern erlaubt. Ein solcher Maßstab kann die gegenseitige Entfernung zweier Planeten sein, oder natürlich auch der Abstand der Erde zur Sonne, welcher im 18. Jahrhundert noch im Rahmen aufwendiger Expeditionen während eines Venustransits gemessen werden musste (siehe SuW 6/2004, S. 22 ff). Hingegen ist es heute im Raumfahrtzeitalter möglich, Distanzen im Sonnensystem auf vielfältige Arten direkt zu bestimmen. So wurden erstmals in den 1960er Jahren die Entfernungen der Erde zu Venus, Merkur und Mars mittels Radarechomessungen bestimmt. Die Genauigkeit der Entfernungsmessung zum Mars konnte seit den 1970er Jahren in Folge der stetig wachsenden Anzahl von Marsmissionen kontinuierlich verbessert werden. Mittlerweile liegt die Unsicherheit im Abstand Erde–Mars, welche sich aus der Analyse von Radiomessungen der verschiedenen Sonden und Lander ergibt, nur noch zwischen fünf Metern (Viking 1 und 2, Pathfinder) und zwei bis drei Metern (Mars Global Surveyor, Mars Odyssey). Diese Messungen stellen nicht nur eine gewaltige Datensammlung dar, welche eine sehr präzise Vermessung der Astronomischen Einheit gestattet. Vielmehr – und das ist genau der springende Punkt – liefert dieses immense Datenmaterial die einmalige Möglichkeit, durch den Vergleich der Messwerte aus verschiedenen JahrSterne und Weltraum April 2007 31 zehnten unter Berücksichtigung der jeweiligen Messgenauigkeit die Frage zu untersuchen, ob die Astronomische Einheit über einen langen Zeitraum hinweg konstant geblieben ist, oder ob sich ihr Wert in den letzten Jahrzehnten verändert hat. Genau diese Frage untersuchten die russischen Astrophysiker George Kra­ sinsky und Victor Brumberg in einer im Juni 2004 veröffentlichten, international viel beachteten Arbeit [5]. Nach sorgfältiger Auswertung aller vorliegenden Daten kamen sie zu dem überraschenden Ergebnis, dass die Astronomische Einheit offenbar nicht konstant ist, sondern sich mit einer Änderungsrate von zehn Metern pro Jahrhundert vergrößert, was später in einer Arbeit von E. V. Pitjeva bestätigt wurde. Ein solches Resultat bringt die theo­ retische Physik nun allerdings in arge Erklärungsnot. Gemäß dem oben erklärten Zusammenhang zwischen der Astronomischen Einheit und dem 3. Kep­ Abb. 6: Mit Wmap gemessene Temperaturfluktuationen der Hintergrundstrahlung. Hierbei wurden die Daten auf eine Himmelskugel projiziert, in deren Mittelpunkt sich der Beobachter befindet. In den blauen und roten Bereichen liegt die Temperatur der Strahlung geringfügig unter bzw. über dem Mittelwert. (Bild: Nasa/Goddard Space Flight Center) 32 Sterne und Weltraum April 2007 lerschen Gesetz gibt es zunächst einmal zwei Effekte, welche ein Anwachsen der Astronomischen Einheit bewirken können: Eine zeitliche Variabilität der Newtonschen Gravitationskonstante G sowie eine hinreichende Verringerung der Sonnenmasse aufgrund der Materieverluste durch den Sonnenwind. Leider lassen sich beide Möglichkeiten mit großer Sicherheit ausschließen. So ist die Änderungsrate der Gravitationskonstante, welche notwendig wäre, um das beobachtete Anwachsen zu erklären, etwa 100-mal so groß wie jener maximale Wert, welcher für eine mögliche Variabilität von G aufgrund verschiedener anderer Experimente (z. B. Laserdistanzmessungen des Mondes) noch erlaubt wäre. Abgesehen davon gibt es bislang noch keine konsistente Theorie, welche zufriedenstellend erklären würde, warum überhaupt die Gravitationskonstante zeitlich variabel sein sollte. Ebenso bietet auch eine Verringerung der Sonnenmasse keinen Ausweg aus dem Dilemma. Der Massenverlust der Sonne aufgrund von elektromagnetischer Strahlung und Sonnenwind ist so gering, dass er ein Anwachsen der Astronomischen Einheit von lediglich 0.3 Metern pro Jahrhundert zur Folge hat, was somit signifikant unter dem von Krasinsky und Brumberg ermittelten Wert liegt. Welche Erklärungsversuche gibt es noch? Die kosmische Expansion kann als Ursache ausgeschlossen werden, da man zeigen kann, dass diese definitiv kei- nen messbaren Einfluss auf physikalische Vorgänge innerhalb des Sonnensystems hat. Exotischere Ansätze, wie beispielsweise multidimensionale Szenarien für die gravitative Wechselwirkung im Rahmen der String-Theorie, sind hoch spekulativ und haben zudem den Nachteil, dass sie den Beobachtungen bislang stets einen Schritt hinterherhinken. Wie kosmisch ist die Hintergrundstrahlung? Während die oben besprochenen Probleme einen natürlichen Bezug zum Sonnensystem aufweisen, ist dies bei den kürzlich entdeckten Anomalien in der kosmischen Hintergrundstrahlung doch vergleichsweise überraschend und nicht sofort offensichtlich. Die kosmische Hintergrundstrahlung ist neben der von Edwin Hubble entdeckten Expansion des Universums einer der fundamentalen experimentellen Belege für das Standardmodell der Kosmologie. Entdeckt wurde sie 1964 eher zufällig, als die Nachrichtentechniker Arno Penzias und Robert Wilson bei Messungen des Rauschhintergrundes einer hochempfindlichen Hornantenne eine unerwartete Strahlung feststellten, welche gleichmäßig aus allen Himmelsrichtungen (isotrop) zu kommen schien. Das Spektrum dieser Strahlung entspricht exakt dem eines Schwarzen Körpers mit einer Temperatur von 2.73 Kelvin. Da die Intensität im Mikrowellenbereich maximal ist und kein Himmelsobjekt als Quelle identifiziert werden kann, etablierte sich hierfür rasch die Bezeichnung »Mikrowellenhintergrundstrahlung«. Bereits George Gamow im Jahre 1946 sowie Ralph Alpher und Robert Herman um 1950 hatten die Existenz einer isotropen Hintergrundstrahlung als Konsequenz des damals noch jungen Urknallmo­dells postuliert. Demzufolge bestand das Universum kurz nach dem Urknall im Wesentlichen aus Strahlung, freien Elektronen sowie einem heißen Plasma aus Protonen und Neutronen. Nach etwa 400 000 Jahren (bei der kosmologischen Rotverschiebung z = 1088) hatte sich das Universum aufgrund der Expansion so weit abgekühlt, dass Elektronen und Protonen sich zu leichten Elementen wie Wasserstoff und Helium verbinden konnten. Standen Strahlung und Materie bis zu diesem Zeitpunkt noch im thermodynamischen Gleichgewicht, so bewirkte nun das weitgehende Fehlen freier Elektronen, dass der Energieaustausch zwischen Strahlung und Materie praktisch zum Erliegen kam. Aufgrund dieser Entkopplung kühlte sich die Strahlung von da an unabhängig von der Materie ab und zurück blieb eine in allen Him- a –0.019 0.019 [Mikrokelvin] –0.034 0.034 [Mikrokelvin] –0.051 0.051 [Mikrokelvin] b c Welchen Einfluss hat nun das Sonnensystem auf die Hintergrundstrahlung? Keinen, sollte man meinen, da diese ja, wie oben beschrieben, kosmischen Ursprungs ist und somit von speziellen Eigenschaften des Sonnensystems unabhängig sein sollte. Eine große Überraschung erlebten die Kosmologen jedoch weltweit, als 2004 Dominik Schwarz von der Universität Bielefeld und Greg Starkman, Armington Professor an der Case Western Reserve University, ihre Analyse der Wmap-Daten in der Fachzeitschrift Physical Review Letters veröffentlichten [6, 7]. Hierbei bedienten sie sich einer Methode, die allgemein als Multipolanalyse bekannt ist: Ebenso wie jeder Klang in eine melsrichtungen extrem gleichmäßige, 3000 Kelvin heiße Hintergrundstrahlung, welche sich bis heute auf 2.73 Kelvin abkühlte. Die Entdeckung einer solchen überraschend isotropen Strahlung wurde somit als wichtige Bestätigung des Urknallmodells gesehen und bescherte Penzias und Wilson 1978 den Nobelpreis für Physik. Eine wichtige Frage blieb jedoch auch weiterhin offen: Wenn die Interpretation der Hintergrundstrahlung richtig ist und das Universum aus einem absolut homogenen, das heißt gleichmäßigen Zustand hervorgegangen ist, so sollte sich nach den Gesetzen der Thermodynamik dieser homogene Zustand bis heute bewahrt haben. Tatsächlich ist unser Kosmos jedoch alles andere als homogen. Materie organisiert sich in Galaxien, welche sich wiederum zu Galaxienhaufen und sogar zu gigantischen Superhaufen gruppieren, sodass von einer homogenen Verteilung der Materie nicht die Rede sein kann. Will man daher am Urknallmodell festhalten, so sollten die Kondensationskeime der späteren Galaxien bereits in einer sehr frühen Phase des noch jungen Universums in Form von quantenmechanisch induzierten Fluktuationen der Ener­giedichte vorgelegen haben. Aufgrund der Gravitation verdichteten sich diese Schwankungen dann im Laufe der Expansion des Kosmos zu großräumigen Strukturen, wobei diese Entwicklung von verschiedenen kosmologischen Parametern wie etwa dem Anteil an Dunkler Materie, Dunkler Energie sowie der Geometrie des Universums entscheidend mitbestimmt wurde. Zum Glück für die heutigen Kosmologen prägten sich jene Fluktuationen allerdings auch in die kosmische Hintergrundstrahlung ein, sodass man heute aus einer genauen Analyse der nur sehr geringen richtungsabhängigen Temperaturschwankungen des Mikrowellenhintergrunds wertvolle Informationen über die Physik des jungen Universums gewinnen kann. Tatsächlich gelang es 1992 mit Hilfe des Cosmic Background Explorer (Cobe) erstmals, die so vorhergesagten, geringen Schwankungen (Anisotropien) der Hintergrundstrahlung zu messen, was schließlich 2006 mit der Verleihung des Nobelpreises für Physik honoriert wurde (siehe SuW 12/2006, S. 19). Eine wesentliche Verbesserung in der Auflösung wurde 2004 mit dem Satelliten Wmap (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe) erreicht (Abb. 6). Die gemessene Amplitude der Temperaturschwankungen ist äußerst gering und beträgt nur etwa 30 Mikrokelvin, was einer maximalen Abweichung von einem Hundertstel Promille vom Mittelwert entspricht. Abb. 7: Multipol-Anteile der kosmischen Hintergrundstrahlung, dargestellt im Koordinatensystem der Ekliptik, d. h. der Äquator wird durch die Ebene des Sonnensystems festgelegt. Die Maxima und Minima verlaufen nahezu senkrecht zur Ekliptik. (a) Quadrupol-Anteil, (b) Oktopol-Anteil, (c) kombinierte Quadrupol- und Oktopol-Darstellung. Auffällig ist die deutliche und bislang unverstandene NordSüd-Asymmetrie in der Quadrupol-Oktopol-Kombination. Sterne und Weltraum April 2007 33 Literaturhinweise [1]Donald Wiss: Swing-by-Manöver – Was steckt dahinter? SuW 12/2003, S. 22 ff. [2]Rudolf Kippenhahn: Die Schwerkraft in der Krise. SuW 6/2006, S. 42 f. [3]Claus Lämmerzahl, Oliver Preuss, Hansjörg Dittus: Eprint arXiv: grqc/0604052 [4]J. D. Anderson et al.: Physical Review D 65, 082004, (2002) Summe bestehend aus Grund- und Obertönen zerlegt werden kann, wird bei der Multipolzerlegung die gemessene Himmelskarte des Mikrowellenhintergrunds in eine Reihe von Schwingungsmoden beziehungsweise Multipolen aufgeteilt. Beginnend mit dem Multipol niedrigster Ordnung, dem Monopol, gefolgt vom Dipol, dem Quadrupol und dem Oktopol, erfassen die Multipole mit steigender Ordnung fortlaufend klein­skaligere Details, wobei die vollständige Karte sich schließlich als Summe der einzelnen Multipole ergibt. Prinzipiell lassen sich mit dieser Methode die Oberflächendetails einer jeden Kugel als Summe von Multipolen darstellen, egal ob es sich dabei um den auf die Himmelskugel projizierten Mikrowellenhintergrund oder um eine Karte der Erdoberfläche handelt. Im letzteren Falle würden die Multipole der kleinsten Ordnung Informationen über großflächige Objekte wie Kontinente und Ozeane erfassen, während jene höherer Ordnung Gebirgszüge oder kleinere Landstriche beschreiben würden. Abb. 7 a und 7 b zeigen nun den Quadrupol- und den Oktopol-Anteil der kosmischen Hintergrundstrahlung, welche mittels der frei erhältlichen Healpix-Software des JPL aus den originalen WmapDaten berechnet wurden. Beide Multipole sind im Koordinatensystem der Ekliptik dargestellt, das heißt der Äquator wird durch die Ebene des Sonnensystems festgelegt. Da nun Multipole niedriger Ordnung großräumige Details erfassen, war es zunächst nicht verwunderlich und sogar durchaus erwartet, dass das Erscheinungsbild sowohl des Quadrupols wie auch des Oktopols von wenigen ausgeprägten Maxima und Minima dominiert wird. Was jedoch bezüglich des oben beschriebenen Standardmodells der Kosmologie keinesfalls zu erwarten war und bei den Forschern seitdem für große Verwunderung sorgt, ist in den Bildern deutlich zu sehen: Anstelle einer zufälligen Verteilung findet man eine unerwartet geradlinige Abfolge der Minima und Maxima, die sich wie auf einer Perlenschnur 34 Sterne und Weltraum April 2007 [5]G. A. Krasinsky, V. A. Brumberg: Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy, 90, 267 (2004) [6]Glenn D. Starkman und Dominik J. Schwarz: Missklänge im Universum. Spektrum der Wissenschaft, 12/2005, S. 30 ff. [7]Dominik J. Schwarz et al.: Physical Review Letters 93, 221301 (2004) über den Himmel aneinanderreihen. Interessanterweise verlaufen die Extremwerte zudem fast senkrecht zur Ekliptik und zeigen in der Quadrupol-OktopolKombination (Abb. 7 c) eine deutliche Nord-Süd-Asymmetrie in der Intensität. Was ist nun der Grund für diese Ano­ malien? Geht man von einem Kopernikanischen Weltsystem aus, wonach unser Sonnensystem keine bevorzugte Stellung im Universum einnimmt, so lassen sich die wahrscheinlichsten und meist diskutierten Erklärungsansätze hierfür gegenwärtig in zwei Gruppen einteilen: Zum einen wäre es denkbar, dass die beobachteten Anomalien auf eine systematische Ursache, das heißt auf bislang unentdeckte Fehler entweder in der Datenanalyse oder in der Konstruktion der Messinstrumente zurückzuführen sind. So sind beispielsweise die thermische Stabilität aufgrund variabler Sonneneinstrahlung und thermischer Abstrahlungen der Instrumente wie auch das verwendete Scanmuster der Wmap-Sonde verhältnismäßig anfällig für das Auftreten systematischer Fehler. Andererseits ist es jedoch schwierig einzusehen, wie hierdurch eine Korrelation der Messungen mit der Ekliptik zustande kommen kann. Deshalb tendieren viele der beteiligten Wissenschaftler mehr zur zweiten, nahe liegenden Alternative, wonach die Ursache der Quadrupol-Oktopol-Anomalie möglicherweise in der Physik des Sonnensystems selbst zu finden sein könnte. Demnach müsste es innerhalb der Heliosphäre einen bislang übersehenen Prozess geben, der eine 2.73Kelvin-Mikrowellenstrahlung erzeugt, die aufgrund einer Überlagerung mit der kosmischen Hintergrundstrahlung die beobachteten, charakteristischen Muster hervorruft. Dabei muss man dann natürlich auch erklären, warum eine solche Vordergrundstrahlung bei allen bisherigen Messungen unentdeckt bleiben konnte. So wird gegenwärtig in einem Projekt am Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung untersucht, ob Mikrowellen­ emissionen von interplanetarem Staub im Bereich des Kuipergürtels ein möglicher Kandidat hierfür sein könnte. Bliebe noch die Frage, ob es sich bei den beobachteten Anomalien nicht vielleicht um zufällige Konstellationen handeln könnte. Diese Frage wurde auch von Dominik Schwarz und Greg Starkman in ihrer oben genannten Publikation anhand von Computersimulationen untersucht. Die Wahrscheinlichkeit für ein zufälliges Auftreten dieser Muster ist danach kleiner als 1:10000, was somit die Suche nach Alternativen durchaus sinnvoll erscheinen lässt. Fazit Für keine der hier beschriebenen Ano­ malien konnte bislang eine konsistente Erklärung im Rahmen der physikalischen Standardtheorien gefunden werden. Durch die prinzipielle Reproduzierbarkeit der Flyby-Anomalie erscheint es deshalb höchst wünschenswert, die Erdvorbeiflüge von Rosetta im November 2007 und 2009 sehr präzise zu vermessen. Ebenso könnte die vorgeschlagene Deep Space Gravity P robe dazu beitragen, das Rätsel der P io­neer-Anomalie zu lösen, und damit einen wichtigen Beitrag zu einem tieferen Verständnis der Physik unseres Sonnensystems liefern. M Oliver Preuss arbeitet am Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Katlenburg-Lindau, wo er sich mit Tests der Speziellen und Allgemeinen Relativitätstheorie beschäftigt. Hansjörg Dittus leitet die Abteilung für Gravitationsphysik und Raumfahrttechnologie am Zentrum für Angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation (Zarm) in Bremen, wo er Experimente zu Gravitations- und Quantenphysik auf orbitalen Plattformen und Satelliten plant und durchführt. Claus Lämmerzahl leitet die Arbeitsgruppe Gravitationsphysik am Zarm, wo er Satellitenprojekte und Tests der Speziellen und Allgemeinen Relativitätstheorie durchführt.