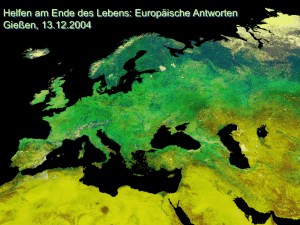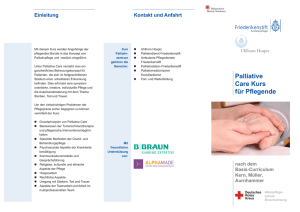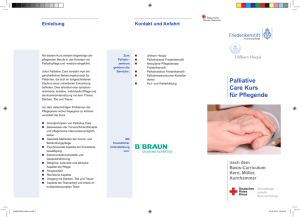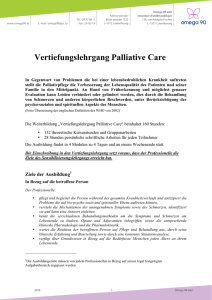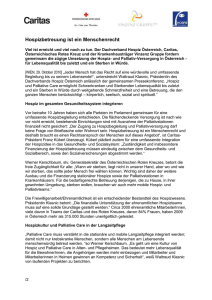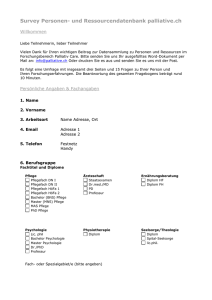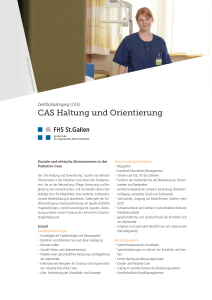Netzwerke brauchen Vertrauen stiftende Verständigungen
Werbung

IFF Wien | Fakultät für Interdisziplinäre Forschung und Fortbilung | Abteilung Palliative Care und OrganisationsEthik Andreas Heller Netzwerke brauchen Vertrauen stiftende Verständigungen Organisationsethische Perspektiven S. Sebastiano (B. Gozzoli – 1464) SAN GIMIGNANO – Chiesa di S. Agostino Diskussionspapier zum hospizlich-palliativen Netzwerktag in Stuttgart, Breuninger-Stiftung am Montag, den 18. Oktober 2010 A. Hospizarbeit und Palliative Care - worum geht es? Palliative Care ist eine Praxis und Theorie, die aus der Hospizarbeit und Hospizbewegung kommt. Sie muss heute mehr sein als ein „Versorgungskonzept“. In Hospizarbeit und Palliative Care geht es um eine neue zivil-gesellschaftliche Sorgekultur mit und für Menschen und ihre Bezugspersonen am Lebensende und darüber hinaus. Es geht darum, mit Menschen am Lebensende sozial und fachlich kompetent umzugehen, so dass ihr Sterben weder beschleunigt noch verzögert wird (WHO-Definition). Interventionen in die Lebensprozesse bis zuletzt, haben sich ethisch in dieser anspruchsvollen zweiwertigen Balancierungsarbeit zu orientieren. Die Etymologie von „palliativ“ wird in der Regel vom Lateinischen pallium = Mantel, dem „Mantel der Umsorge “, um das Wort Fürsorge zu vermeiden, das in unsere deutsche Gesichte eine deutlich maternalistisch-paternalistisch, staatliche Übergriffskultur signalisiert, abgeleitet. Die angelsächsische Tradition verbindet den Begriff „palliativ“ mit dem keltischen Terminus „pelte“ = Schutz und Schild in der kriegerischen Auseinandersetzung. Dann geht es in einer hospizlichpalliativen Sorgekultur auch um die Abwehr von etwas, also um die „Balance von Zuviel und zu Wenig“, Intervention und Begleitung und Behandlung haben sich auch in dieser Balancierung zu orientieren (vgl. A. Heller, S. Pleschberger, Hospizkultur und Palliative Care im Alter, 2010 b). Aber: Es scheint so zu sein, dass durch bestimmte Praxen (palliative terminale Sedierung) in der deutschen Palliativmedizin und durch entsprechende Veröffentlichungen der letzten Monate dieser zweipolige Boden aufgeweicht wird. Deutsche Palliativmediziner überschreiten derzeit bewusst den Pol Beschleunigung des Sterbens durch die Forderung nach Straffreiheit des ärztlich assistierten Suizids. Palliative Care ist in den letzten Jahren zu einem differenziert gewordenen Markt geworden auf dem „perimortale Dienstleistungsangebote“ gemacht werden. Die Verbetriebswirtschaftlichung des Sterbens ist im vollen Gang. Kennzeichnend dafür ist, dass Sterbende zum Mittel der Ertragsteigerung gemacht werden, was die PatientInnen im Kontext DRG-orientierter Krankenhäuser schon länger sind. Die SAPV-Diskussionen haben diese Dimension schmerzhaft sichtbar gemacht. Es gibt beispielsweise einen Wettbewerb um die Sterbenden, es gibt Konkurrenz zwischen Einrichtungen und Berufsgruppen, es gibt eine schleichende Demotivation der Ehrenamtlichen, vielleicht auch durch eine Professionalisierungsund Medikalisierungsdynamik. Und: Der „Sterbemarkt“ hat europäische Dimensionen. Deshalb wird im Zeichen der Autonomie und des neuen moralischen Imperativs: „Du musst dein Leben und Sterben planen und darüber verfügen!“ das Ende des Lebens zum individuellen Projekt (Reimer Gronemeyer). Die Zumutung an die Bürgerinnen: Man muss es planen und man muss sich auf dem Markt der SterbeMöglichkeiten orientieren. Diese Autonomiezuschreibung ist eine Autonomiezumutung, weil sie den sozialen Charakter, der u.a. darin besteht, dass wir als Menschen radikal angewiesen und verwiesen sind auf andere; die Fragmentierung menschlichen Lebens und seine Nicht-Planbarkeit verleugnet. Wenn erst einmal der europäische „Sterbemarkt“ etabliert ist, dann müssen die Einrichtungen (wahrscheinlich auch) alle „perimortale Dienstleitungen“ zur Verfügung stellen. Kaum eine Hospizund Palliativeinheit wird allein aus ökonomischen und aus fachlichen Gründen der Zugehörigkeit zur community, zur state-of-the-art-Kultur dann „aus der Reihe tanzen“ (zu diesem Muster menschlichen Verhaltens: Gerd Gigerenzer, Bauchentscheidungen: die Intelligenz des Unbewussten und die Macht der Intuition, München 2008). B. Ein Netzwerk zur Hospizarbeit und Palliative Care braucht qualitative Verständigungen über seine hospizlich-palliative Philosophie, seine Ziele und sein Leitbild. Es ist eben nicht mehr ausreichend zu behaupten: wir sind eine Hospiz- oder Palliativeinrichtung. Die „hospizlich-palliative Gretchenfrage“ des 3. Jahrtausends lautet: Wie hältst du es mit dem Sterben und den Sterbenden ganz konkret? Ohne einen Prozess der vergewissernden Verständigung über diese grundlegenden Fragen der Umsorge, lässt sich kein kooperationsfähiges Netzwerk in diesem Feld knüpfen. Ein Netzwerk wird bekanntlich deshalb etabliert, um etwas zu erreichen, das man aus eigener Kraft nicht schaffen würde. Deshalb gibt es ein Interesse, bestehende Ressourcen in unterschiedlichen Organisationen zu verbinden. Deshalb sind Ziele und Strategien von Netzwerkpartnern immer zweiwertig und an einem doppelten Nutzen orientiert: sie sollen einen Nutzen für die eigene Herkunftsorganisation und einen für die Netzwerkorganisation stiften. In dieser Spannung liegt die große Herausforderung, die Unberechenbarkeit, aber auch der Erfolg jedes Netzwerkes. Ohne Vertrauen kann kein Netzwerk auf Dauer sinnvoll kooperieren. Vertrauen entsteht nicht durch predigerhafte Appelle. „Vertrauen ist das Ergebnis von Handlungen, die Vertrauen stiften. Für Kooperationen und Netzwerke stellt Vertrauen die Grundlage einer wirksamen Arbeitsbasis dar. Dies aufzubauen ist ein Prozess, der eine Reihe von Besonderheiten zu berücksichtigen hat. Beispielsweise ist die Verlässlichkeit der Vertrauensbasis davon abhängig, auf welche Weise es gelingt, eine vertrauensstiftende Kommunikation zu einem Kulturmerkmal der Arbeitsorganisation des Netzwerks zu machen. Also nicht, wie häufig praktiziert, „zwischen persönlich vertrauensvollen Gesprächen im informellen Bereich und einer eher formalen wenig durchlässigen Kommunikation in den größeren Gruppen und Meetings zu trennen.“ (Ralph Grossmann, Kooperation macht nur Sinn, wenn man einander wirklich braucht, in: Praxis Palliative Care 4/2009, 18.). Ein Netzwerk ist die komplexeste Organisationsform in modernen Gesellschaften. In ihm muss Vertrauen zwischen Personen und Organisationen im Prozess organisiert werden. Mit solchen Fragen befassen sich Prozess- und Organisationsethik. C. Organisationsethische Verständigungen oder vom Was zum Wie? 1. Moderation und Prozess Solche Prozesse brauchen eine allparteiliche Moderation, die den Prozess mit den Akteuren und gesellschaftlichen Partnern moderiert und für den Prozesscharakter der Verständigung entsprechende „kommunikative Arrangements“, oder „Reflexionsarenen“ oder „Verständigungssysteme“ oder „Aufwachorte“ (Otto F. Scharmer) und die Spielregeln dafür aushandelt und etabliert. Es muss anerkannt und ausgehandelt sein und werden, dass es im Prozess, in der Prozeduralisierung zur Antwort auf die Fragen kommt, die in und zwischen den Organisationen des Netzwerks aufgeworfen werden. Ganz allgemein ist etwa die Frage: „Wollen wir all das so, wie wir es uns eingerichtet haben?“ (L. Krainer, P. Heintel, Prozessethik, Zur Organisation ethischer Entscheidungsprozesse, Wiesbaden 2010, 63), zu Beginn einer ethischvertrauensstiftenden organisationalen Netzwerkkultur. Folgende organisationsethische Beobachtungen, „Spielregeln “ können Orientierung stiften und Vertrauen ermöglichen. 2. Unsicher sein dürfen Der Philosoph Hans Jonas, hat einmal gemeint, die einzige Hoffnung für eine menschlichere Zukunft besteh darin. neue „Verständigungssysteme“ zu entwickeln, die sich dadurch auszeichnen, nicht allein am eigenen Nutzen interessiert zu sein. Darin steckt die Zuversicht, dass sich Betroffene in den nicht einfachen und leicht entscheidbaren Fragen und Irritationen zusammensetzen, um sich auseinanderzusetzen, eben sich zu verständigen. Und dass sie dies nicht zufällig tun, sondern systematisch und systemisch, also im Bewusstsein und mit dem Auftrag, hier Zeit, Raum und Ressourcen des gesamten Systems beanspruchen zu dürfen und zu müssen, um zu besseren, weniger schlechten Entscheidungen zu kommen. 3. Kompetenz geteilter Inkompetenz Vertrauen und ethische Kommunikation entstehen aus der „Sicherheit geteilter Unsicherheit“. Wenn klar und eindeutig ist, worum es geht, braucht man sich nicht zusammenzusetzen. Wenn niemand den Anderen braucht, warum Zeit verschwenden? Das Wissen um eine „strukturelle Komplementarität“, eine gemeinsame geteilte Unsicherheit (wie soll es weitergehen), Vertrauen in solchen immer auch ethischen Kommunikationen braucht die „Kompetenz geteilter Inkompetenz“. Niemand hat alleine den Blick auf das Gesamte. Jede Perspektive hat eigene Interessen und möglicherweise auch altruistische, bedarf aber der Ergänzung, weil wir die Augen und die Einsichten anderer brauchen, um selber mehr zu hören und zu sehen, um uns selbst und unsere Organisationen zu entwickeln. 4. Mehrsprachig erzählen Verständigungen beginnen immer erzählend. Im Erzählen werden Menschen, Probleme, Aufgaben wieder anschaulich, werden Erfahrungen begreifbarer. Die Vielschichtigkeit einer Sorgesituation etwa kommt nicht nur in den Informationen der Labordaten, Diagnosekriterien und Messwerten allein zum Ausdruck. Also: Es braucht eine Aufmerksamkeit für die Befunde und das Befinden. Realität ist eben nicht allein in Daten, Zahlen und Gesetzen fassbar. Es braucht neben der Sprache der Medizin und Pflege, der Ökonomie und des Rechts etc. auch die Sprache der Geschichten, die Fähigkeit, die betroffenen Menschen zu Wort kommen zu lassen. Falls diese selbst dazu nicht in der Lage sind, müssen andere stellvertretend versuchen, in Geschichten und Anekdoten (Was ist ihr wichtig? Was ist ihre Geschichte? Woran hängt sie? Was, welche Werte bedeuten ihr was?) ein Bild zu vermitteln. Erzählt werden Situationen, Begebenheiten, Irritationen, die Fragen aufwerfen: Was sollen wir tun oder lassen? Wie geht es weiter? Was ist das Gute für wen? 5. Betroffene beteiligen Vertrauensstiftende Kommunikation gestaltet sich in Beziehungen, im Bewusstsein, ergänzungsbedürftig zu sein und ist grundsätzlich partizipativ. Die Betroffenen sollten beteiligt werden. Das ist alles andere als leicht und manchmal auch nicht möglich. Es braucht einfache und zugleich empathisch-intelligente Formen, dies zu ermöglichen und es braucht Partizipation auf den Ebenen, die für die Bearbeitung der Fragen notwendig sind. Das sind eben nicht immer die PatientInnen, BewohnerInnen, Gäste … 6. Gefühle denken und Gedanken fühlen Vertrauensstiftende organisationsethische Kommunikation berücksichtigt die Einsicht, dass Gefühle eine Quelle der Erkenntnis sind (Bauchentscheidungen). Betroffensein und Betroffenheit auszudrücken, ist keine Schwäche, sondern bildet eine zu reflektierende Basis für gute Entscheidungen. [email protected] Neuere Publikationen: T. Krobath., A. Heller, Ethik organisieren, Handbuch der Organisationsethik, Freiburg 2010a. A. Heller, F. Kittelberger, Hospizkompetenz und Palliative Care im Alter. Eine Einführung, Freiburg 2010 b, Fortlaufend werden mit der Zeitschrift Praxis Palliative Care Themen einer hospizlich palliativen Sorgekultur aufgegriffen und gesetzt..