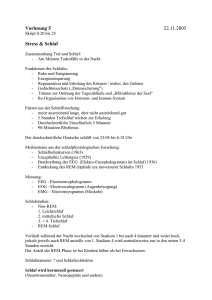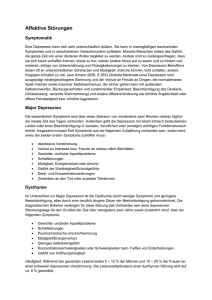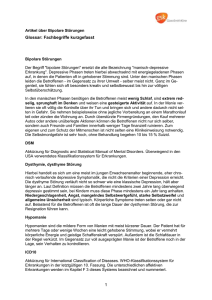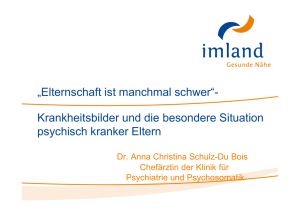file downloaden
Werbung

Weitere Files findest du auf www.semestra.ch/files DIE FILES DÜRFEN NUR FÜR DEN EIGENEN GEBRAUCH BENUTZT WERDEN. DAS COPYRIGHT LIEGT BEIM JEWEILIGEN AUTOR. Verhaltenstherapie: Auch hier verändert sich die Sicht durch wissenschaftstheoretische Kritik und empirische Forschung. Ursprünglich wurde die Überlegenheit der VT damit begründet, dass sie aus Lerntheorie und experimentellen Studien abgeleitet wurde (Eysenck, 1959). Diese Sichtweise wird dann jedoch in frage gestellt (Breger und McGaugh (1965): Die Ableitung ist eher metaphorisch). Manche verhaltenstherapeutische Erklärungen zu Entstehung und Behandlung verschiedener Störungen stellen sich als zu einfach heraus (z.B. Wolpes (1958) Erklärung der Neurosen) und die anfänglich ausgezeichneten Therapieerfolgsraten (nach Wolpe 89,5%) werden angezweifelt. Beobachtbares Verhalten wird durch vorgestellte Bilder und Kognitionen erweitert, es folgt die Entwicklung der kognitiven VT (KVT). Die KVT hat auch schon wieder Kritik erfahren (Zajonc, 1980): Kognitionen gehen Fühlen und Verhalten nicht voraus und bestimmen es; Gefühle und Verhalten werden weitgehend von anderen Nervenstrukturen encodiert und verarbeitet als Kognitionen. Gesprächstherapie: macht auch Entwicklungen. Das Konzept des emphatischen Verstehens und das Repertoire an therapeutischen Interventionsmöglichkeiten wird erweitert. All diese Entwicklungen bereiteten den Weg zu einer weniger schulenorientierten Sichtweise. Gleichzeitig ( ist ein starkes Interessen an Pluralismus, Integration und Eklektizismus (d.h. Theorie- und Methodenvielfalt) zu verzeichnen (sehr stark um 1980 herum). Vertreter des Pluralismus wollen die Originalität der Systeme bewahren, ihre Stärken aus- und ihre Schwächen abbauen. Eine Synthese der Systeme scheint ihnen weder möglich noch wünschenswert (typische Frage hier: Was trennt Schulen?). Eine zweite Einstellung bezieht sich auf die nicht-spezifischen, die gemeinsamen Wirkfaktoren. Hier geht es um das Studium der Gemeinsamkeiten der Systeme, um die Faktoren zu erkennen und zu maximieren, die die therapeutische Wirkung hervorbringen (was haben Schulen gemeinsam?). Eine dritte Perspektive geht der Frage nach: Welche Massnahmen durch welchen Therapeuten wirken am besten bei welchem Patienten mit welchen Problemen? Dieser „technische Eklektizismus“ scheint –wenn systematisch und kritisch angewandt- für Klinik und Forschung am interessantesten, hat schon Diagnostikforschung, Ergebnisforschung (z.B. Analyse des Wirkspektrums), Prozessforschung (z.B. Mikroanalyse der Therapieprozesse) und Indikationsforschung neu belebt. Heute ist also auch in der Praxis eine grösserer Offenheit und ein vermehrtes Interesse an problemorientierten Behandlungspaketen zu verzeichnen. Nach Huber bedeutet das nicht, sich gleich in vielen Schulen ausbilden zu lassen (man sollte auch einen eigenen Standpunkt haben) sondern, die Augen für Bereicherungen aus anderen Bereichen zu öffnen und die empirisch abgestützten verfahren zur Behandlung eines Problems zu kennen und anwenden zu können. 3. Kapitel: Wichtige Störungen und ihre Behandlung l Angst, Agoraphobie und Panik 14 a) Der psychoanalytische Ansatz Schon 1985 beschrieb FREUD die Angstneurose, die sich durch folgende Symptome auszeichnete: 1. Allg. Reizbarkeit, 2. Ängstliche Erwartung, 3. Angstanfälle, 4. Körperfunktionsstörungen, 5. Nächtliches Aufschrecken, 6. Schwindel, 7. Entwicklung von Phobien, 8., Verdauungsstörungen, 9. Parästhesien (Sensibilitätsstörungen und Missempfindungen) und 10. Möglichkeit der Chronifizierung mehrerer Symptome. Die Panikstörung beschreibt FREUD ziemlich zeitgenössisch. Er unterschied drei Arten von Angst: frei schwebende oder Erwartungsangst, phobische oder Situationsangst und Angstanfälle), in der starken und akuten Form nannte er sie traumatische Angst und in der milderen Signalangst. Furcht und Angst unterschied er in dem Masse, dass Angst auf eine innere Gefahr, einen unbewussten Triebwunsch gerichtet ist. Im Laufe der psychosexuellen Entwicklung ändert sich die Angst: 1) die Gefahr, das Liebesobjekt zu verlieren, 2) die Gefahr, die Liebe des Objektes zu verlieren, 3) Kastrationsangst, 4) Überichangst oder Schuldgefühle. Ein Beispiel: Bei Agoraphobie handelt es sich nach FREUD um einen mit unbewussten sex. Phantasien verbundenen Konflikt. Der mit der Triebbefriedigung verbundene Angst wird auf den Raum projiziert – um sich vor der Angst zu schützen, meidet der Patient den gefährlichen Ort. Nach neuerer Auffassung geht man eher von einem Konflikt, der das Problem der Trennung und der Individuation (autonom sein, ausbrechen) betrifft, aus. Die Therapie hat zur Aufgabe, dem Patienten Einsicht in den Grundkonflikt zu ermöglichen, ihn zu interpretieren und aufzulösen. Zum Wirkungsnachweis liegen Fallgeschichten vor, systematische, kontrollierte empirische Evaluationsstudien existieren keine. b) Das biologische Modell von Agoraphobie und Panik 1959 machte KLEIN (1962) Versuche mit dem noch nicht auf dem Markt erhältlichen Antidepressivum Imipramin. Nebst der positiven Wirkung bei Depression konnte er feststellen, dass das Medikament auch Patienten mit Angststörungen helfen konnte, bei denen weder intensive stationäre Psychotherapie, noch Sedativa helfen konnten. Allerdings besserten sich nur die Angstanfälle, nicht aber die allgemeine Ängstlichkeit. Dies veranlasste KLEIN ein biolog. Modell zu erarbeiten, welches auf die Def. im DSM-lll-R grossen Einfluss hatte. 15 Zwischen der Panikstörung und der Agoraphobie besteht nicht nur ein quantitativer, sondern auch ein qualitativer Unterschied: Die Panikstörung ist gekennzeichnet durch ihr spontanes, anfallsartiges Auftreten, welches mit starken körperlichen Symptomen einhergeht. Es handelt sich um eine primär biologische Funktionsstörung mit genetischer Komponente. Die chronische oder antizipatorische Angst ist Angst vor der Panik, also Erwartungsangst. Argumente für die Panikstörung als primär biologisches Phänomen: - spezifische Wirkung von Medikamenten: trizyklische Antidepressiva (v.a. Imipramin) und MAO-Hemmer (v.a. Phenelzin). Beruhigende Medikamente (z.B. Benzodiazepine) und Alkohol haben die umgekehrte Wirkung. - Auslösung der Panikattaken bei Patienten durch Infusion von Natriumlaktat möglich (aber nicht bei gesunden Vp). - Starke genetische Komponente - Eine Anamnese kindlicher Trennungsangst findet sich bei ungefähr der Hälfte der erwachsenen Panikpatienten. Dies könne, wie auch Trennungsangst bei jungen Tieren, mit Imipramin behandelt werden. Fast jeder Punkt dieser Argumente wird wegen mangelnden Beweisen und Belegen kritisiert. Medikamentenstudien zur Wirksamkeit von Imipramin ergaben eine verbesserte Wirksamkeit der Expositionstherapie, aber meist nicht langfristig. Allerdings sind Abbrüche der Therapie wegen Nebenwirkungen zu bemängeln. Auch gibt es mehr Rückfälle, als wenn eine Exposition allein durchgeführt wird. Es existieren Studien auch mit anderen Medikamenten. Zur Wirksamkeit von Benzodiazepinen soll gesagt sein, dass sie zwar rasch wirken, es besteht allerdings eine hohe Rückfallquote (bis 100%) und grosse Abhängigkeitsgefahr. c) Das psychophysiologische (verhaltenstherapeutische) Modell Bei dieser Auffassung wird die Interaktion zwischen biologischen und psychischen Prozessen unterstrichen. Der Panikanfall kommt nicht mehr einfach „spontan“, sondern ist Resultat sich gegenseitig beeinflussender Prozesse (primäre Körperempfinungen, affektiv-kognitive Prozesse und Reaktionen des Patienten). Der Ursprung liegt in biologischen oder psychischen Prozessen und kann unterschiedlich stark wahrgenommen werden. Viele Variablen (biolog. Eigenart, Lerngeschichte, Bewältigungsstrategien, Situation) beeinflussen die Wahrscheinlichkeit, die Art der Auslösung und den Ablauf. 16 Das Modell kann die Aufrechterhaltung gut erklären, nicht aber, wie und wann es zum ersten Anfall kommt. Bei der Behandlung soll gezielt an den Angstanfällen selbst angesetzt werden. Es werden mehrere Behandlungsprogamme vorgeschlagen: Kombination von Konfrontation und kognitiver Umstrukturierung, Einüben von Bewältigungsstrategien. In der diagnostischen Phase ist die Erfassung der Auslöser und Begleitumstände wichtig. Dann wird ein individuelles Erklärungsmodell erstellt. Zur Wirkungsweise bestehen mehrere Studien, welche die gezielte psychologische Behandlung über die nicht-spezifischen psychologischen und pharmakologischen Behandlungsmethoden stellt. d) Behandlungsempfehlungen Antidepressiva, MAO-Hemmer und Benzodiazepine sind wirksam. Allerdings verschwindet die Wirkung rasch, wenn keine Exposition stattgefunden hat. ll Spezifische (einfache) Phobien Die Angst/Panik wird durch einen gut identifizierbaren phobischen Reiz ausgelöst und intensiviert sich mit Annäherung an den Reiz, bzw. vermindert sich mit der Entfernung. Es kann auch Erwartungsangst bestehen. Es gibt alle möglichen Reize, die Angst auslösen können, es scheint aber mit dem Alter zu tun zu haben, wann sich die Störung ausbildet: So entsteht die Angst vor Tieren oder Blut eher im Kindesalter, wobei die Angst vor geschlossenen Räumen, Höhen oder Fliegen eher erst im vierten Lebensjahrzehnt entsteht. 17 Der Verlauf spezifischer Phobien ist unterschiedlich (kurz, verschwinden wieder bis langandauernd ohne einer Neigung zur Spontanremission). Hier soll nur die VT behandelt werden. a) Entstehung und Aufrechterhaltung Anfänglich erklärte man die Entstehung und Aufrechterhaltung durch das Zwei-Faktoren-Modell, nach welchem die Angstreaktionen durch klassisches Konditionieren entsteht (ein neutraler Reiz wird mit einer Angstreaktion gekoppelt) und durch operante Konditionierung aufrechterhalten. Durch Vermeidungsverhalten wird die Löschung verhindert. Nicht jeder Reiz kann jedoch eine Angstreaktion auslösen, darum wurde das Modell mit der Theorie der preparedness (SELIGMAN, 1970/71) ergänzt: Nur biologisch relevante Reize („negative“) sind konditionierbar. Auch musste man das Erlernen der Angst durch Informationen und Modelllernen hinzufügen, da Ängste vor Situationen, in denen sich der Patient nie wirklich befunden hat, existieren können. Weitere Ergänzungen kommen aus der kogn. Lerntheorie und der kogn. Emotionstheorie. b) Therapie spezifischer Phobien Die Therapie folgt zwei Prinzipien: 1. Systematische Desensibilisierung (WOLPE, 1958): schrittweise Konfrontation an die angstauslösende Situation in sensu oder in vivo. Zuerst lernt der Patient eine Entspannungsmethode (z.B. progressive Muskelentspannung nach JACOBSON), dann beginnt er sich der Situation in Gedanken oder real schrittweise anzunähern. 2. Exposition und Reaktionsverhinderung: Da die Angst nach einer gewissen Zeit wieder abklingt, geht es darum, dass der Patient lernt, die Situation auszuhalten. c) Behandlungsempfehlungen Die Exposition in vivo hat sich als am wirksamsten Pharmakotherapie erzielt keine zusätzliche Wirkung. erwiesen. lll Soziale Phobien = anhaltende Angst vor einer oder mehrerer Situationen, in denen die Person im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit anderer steht und befürchtet, etwas zu tun, was demütigend oder peinlich sein könnte (in der Öffentlichkeit sprechen, schreiben oder essen, Angst zu Erröten oder sich ungeschickt zu verhalten). a) Das biologische Modell Bei Patienten mit sozialer Phobie wird immer eine erhöhte autonome Erregung beobachtet, die mit einer übermässigen Katecholaminerzeugung oder mit einer erhöhten Empfindlichkeit für die normale Erhöhung dieses Botenstoffes in Stresssituationen in Verbindung gebracht wird. Die Beruhigung der autonomen Erregung wird durch Psychopharmaka erzielt. MAO-Hemmer: Studien von LIEBOWITZ (1984/86/88) ergaben eine gute Wirkung von Phenelzin. Beta-(Adrenergic) Blocker: Zu Betablockern bestehen drei Studien. FALLOON et al. (1981) fand keine Unterschiede in der Wirkungsweise zwischen Propanolol und Placebo. GORMAN et al. (1985) stellte fest, dass Atenolol bei 50% der Patienten eine fast vollständige Besserung der Symptome, 40% eine mässige Besserung bewirkte. LIEBOWITZ et al. (1988) konnte nur bei einem drittel der Patienten eine Besserung erkennen, dies unterschied sich aber nicht von der Wirkung des Placebos. Diese unterschiedlichen Ergebnisse müssen weiter untersucht werden. 18 Trizyklische Antidepressiva und Benzodiazepine: Hier sind die Ergebnisse unklar. Es liegen Studien zu Clomipramin und Imipramin vor. Auch Diazepam und Alpazolam (Benzos) wurden mit inkonsistenten Ergebnissen untersucht. Alprazolam zeigte eine gute Wirkung, die aber nach dem Absetzen der Medikamente verschwand. b) Das Modell der kognitiven VT Soziale Phobien entstehen auf dem Boden einer biologischen und psychologischen Veranlagung zu Angstreaktionen. Das Modell von HEIMBERG&BARLOW (1988) konzentriert sich auf das Verhalten in sozialen Situationen (weniger auf biolog. und entwicklungsgesch. Bedingungen): Auf soziale Anforderungen wird mit neg. Gefühlen reagiert, die Aufmerksamkeit auf sich, anstatt auf die Aufgaben gelenkt. Somit wird die anfängliche milde körperl. Reaktion gesteigert und somit auch die Angst. Vermeidungsverhalten entwickelt sich. Die Behandlung erfolgt durch Exposition und kogn. Umstrukturierung. HEIMBERG hat ein Behandlungsprogramm für Gruppen (5-6 P.) entwickelt: - Erklärung zu Entstehung und Behandlung sozialer Phobien - Strukturierte Übungen zum Aufbau von Fertigkeiten zum Auffinden und kritischen Analysieren problematischer Kognitionen - Konfrontation - Verfahren kogn. Umstrukturierung erlernen - Verfahren rationaler Selbstanalyse erlernen, um die neg. Selbstbewertung zu ersetzen - Hausaufgaben - Routineverfahren mit kogn. Umstrukturierung erlernen Die Wirksamkeit kognitiver Verhaltenstherapie ist durch mehrere Studien gut belegt. c) Behandlungsempfehlungen MAO-Hemmer (Phenelzin) haben sich als wirksam erwiesen, Beta Blocker (Atenolol) scheint bei Ängsten wie Lampenfieber wirksam zu sein. Alprazolam erzielt starke Besserungen, die aber nach dem Absetzen wieder verschwinden. Bei der Behandlung mit Medikamenten soll aber gleichzeitig Exposition stattfinden. Die kognitive VT ist von den psychotherapeutischen Verfahren am besten. lV Generalisierte Angststörung Hauptmerkmal dieser Störung ist die unrealistische oder übertriebene Angst und Besorgnis (Erwartungsangst) bezügl. zweier oder mehrerer Lebensumstände (Sorge, dem Kind könnte etwas zustossen, Geldsorgen) mind. 6 Monate lang. Motorische Angespanntheit, vegetative Übererregtheit mit Überwachheit und ständigem Überprüfen der Umgebung. Im DSM-III-R werden 18 Symptome in drei Gruppen beschrieben: 1. Motorische Spannung: Zittern, Zucken oder Beben; Muskelspannung, Schmerzen oder Empfindlichkeit; Ruhelosigkeit; leichte Ermüdbarkeit. 2. Vegetative Übererregbarkeit: Atemnot oder Beklemmungsgefühle; Palpitationen (Herzklopfen) oder beschleunigter Herzschlag (Tachykardie); Schwitzen oder kaltfeuchte Hände; Mundtrockenheit; Benommenheit oder Schwindel; Übelkeit, Durchfall oder andere abdomidale Beschwerden 19 (Bauchschmerzen/Unterleibsschmerzen); Hitzewallungen und Kälteschauer; häufiges Wasserlassen; Schluckbeschwerden. 3. Hypervigilanz und erhöhte Aufmerksamkeit: sich angespannt fühlen oder ständig „auf dem Sprung“ sein; übermässige Schreckhaftigkeit; Konzentrationsschwierigkeitn oder Blackout aus Angst; Einoder Durchschlafstörungen; Reizbarkeit. a) der biologische Ansatz Der Störung soll eine Stoffwechselstörung im Gehirn zu grunde liegen. Allerdings gibt es keine biologische Marker oder genetische Hinweise. Benzodiazepine helfen in der akuten Phase, sind aber wegen der Abhängigkeitsgefahr und den Nebenwirkung nicht optimal. Je weniger Depressivität und zwischenmenschliche Konflikte bestehen, um so besser wirken sie. Bei längerer Behandlung empfehlen sich trizykl. Antidepressiva. Neuerdings wurde Buspiron, ein Anxiolytikum, gefunden, welches gut wirkt ohne die Nachteile eines Benzodiazepins. b) der psychophysiologische (VT) Ansatz Diesem Ansatz zu Folge wird die Angststörung von negativen Lebensereignissen bewirkt. Diese rufen bei einer verwundbaren Person neurobiologische Reaktionen hervor, die mit Stress verbunden sind. Unangemessene Wahrnehmung und Interpretation führt zu Angst. Die Behandlung kann bei unterschiedlichen Punkten des Entstehungsprozesses ansetzen (somatisch, kognitiv). Entspannungstechniken werden empfohlen, es gibt aber keinen Nachweis der Wirksamkeit für diese Methoden. Kombinierte Verfahren sind sinnvoll, z.B. kognitive und Entspannungsverfahren. Biofeedback, Stressimpfungstrainigs. V Zwangsstörungen Zwangsgedanken oder Zwangshandlungen verursachen erhebliches Leiden, sind zeitraubend und beeinträchtigen den normalen Tagesablauf, die beruflichen Leistungen oder die üblichen sozialen Aktivitäten. Die Person erkennt – im Falle der Zwangsgedanken – dass diese von ihr selbst ausgehen (also nicht eingegeben werden) und sie versucht diese zu ignorieren oder zu unterdrücken. Es handelt sich oft um Gedanken des Sich-Infiszieren-Könnens, Verschmutzung, Angst, man könnte das eigene Kind umbringen, etc. Zwangshandlungen sind wiederholte, zielgerichtete und beabsichtigte Handlungen, die auf einen Zwangsgedanken hin ritualisiert durchgeführt werden (Kontrollieren, Händewaschen, Zählen oder Berühren). Die Zwangsstörung gehört zur viert oder fünfthäufigsten Störung und werden häufig von Angst oder Depression begleitet. 20 a) Die psychoanalytische Auffassung Die Zwangsstörung ist Folge einer nicht geglückten Abwehr und Verarbeitung der unbewussten sadistischen und feindlichen Impulse des Patienten. Die für diese Patienten typischen Abwehrmechanismen sind: Isolation, Ungeschehenmachen, Verschiebung und Reaktionsbildung. Zur Behandlung werden die unbewussten Konflikte bewusst gemacht und aufgearbeitet. Es gibt allerdings noch keinen gültigen Nachweis für die Wirksamkeit der Therapie. Der Psychoanalytiker MALAN (1979) behauptet sogar, dass er keinen Fall kenne, der durch PA geheilt worden sei und empfiehlt VT. Als Begleittherapie mag sie in gewissen Fällen jedoch sinnvoll sein. b) Das biologische Modell der Zwangsstörung Da Anxiolytika bei Zwangsstörungen wirkungslos sind, kann man davon ausgehen, dass die Basis der Zwangsstörung nicht Angst ist, sondern ein anderes biochemisches System: Mehrere Medikamtenstudien haben ergeben, dass hier das Serotoninsystem geschädigt ist, was durch Medikamente wie Clomipramin und Fluvoxamin gebessert werden kann. Allerdings ist eine gleichzeitige VT ratsam, weil sonst die Gefahr besteht, dass die Symptome wiederkommen. Auch Antidepressiva können hilfreich sein. c) Zwangsstörung aus der Sicht der VT Zwei Theorien versuchen die Entstehung und Aufrechterhaltung der Zwangsstörung zu erklären. Die erste geht von MOWRERS Zwei-FaktorenTheorie (1939) aus: ein neutraler Reiz wird in Verbindung mit einer Angstreaktion selbst zu einem aversivem Reiz (erster Faktor). Dieser wird in der zweiten Phase gemieden und somit verstärkt (zweiter Faktor). Zwangsstörungen werden somit zu einem instrumentellen Vermeidungsverhalten. Das Problem der Theorie ist, dass sie nichts über die biologische Bedeutsamkeit aussagt (siehe... Seligman weiter oben), auch kann man den ursprünglichen aversiven Reiz der ersten Phase kaum zuordnen. Weiter fehlen Aussagen über kognitive Komponenten. Dies versucht die zweite Theorie, die kognitive Theorie miteinzubeziehen: Zwangspatienten leben in einer Welt der Unsicherheiten und des Zweifels mit abnorm hoher Erwartung negativer Ereignisse (CARR, 1974). Allerdings macht die Theorie keine Aussage über den Ursprung der Unsicherheiten und irrigen Überzeugungssysteme. Zur Behandlung: Die VT schreibt der Angst/Erregung und deren Vermeidung bei der Entstehung und Aufrechterhaltung der Zwangsstörungen eine zentrale Rolle zu. Dementsprechend wird die Behandlung ausgerichtet. Vorab muss jedoch eine eingehende Verhaltensanalyse durchgeführt werden, um die konkreten Bedingungsfaktoren und ihre Vernetzung genau herauszuarbeiten. Wichtig ist auch, dass mit dem Patienten ein Kausalkonzept erarbeitet wird, dass mit seinen Vorstellungen übereinstimmt. Ist dieses verständlich und plausibel, kann die Motivation zur Therapie erheblich gesteigert werden. Exposition und Reaktionsverhinderung, die sich direkt auf die Angst/Erregungskomponenten und die Reaktions-/Handlungskomponenten beziehen, sind zentral in der Therapie. Die Gewissheit, die Probleme selber meistern zu können, führt bei den Patienten zu Erleichterung. 21 Zwangsgedanken sind schwieriger zu behandeln. Sie lassen sich nicht nach dem Angst-Reduktions-Modell erklären, da Gedankenzwänge nicht Reduktion, sondern Induktion (Erzeugung) der Angst zur Folge haben. Da Zwangspatienten oft zusätzliche psychiatrische Probleme haben, müssen diese oft mitbehandelt werden, um gute therapeutische Erfolge zu erzielen. Zur Wirksamkeit: VT ist gut belegt. FOA et al. (1985) analysierte 18 Studien und kam zu dem Schluss, dass 51% der Patienten nach der Behandlung symptomfrei oder sehr gebessert, 39% mässig gebessert waren. 10% sprechen gar nicht auf die Therapie an. d) Behandlungsempfehlungen Psychoanalytische Methoden kann man als unwirksam bezeichnen, es sei denn, der Therapeut arbeitet direktiver. Pharmakotherapie: Chlomipramin ist wirksam. Am besten ist die VT, eventuell mit einer Kombination von Psychopharmaka. 22 Vl Depressionen Depressive Störungsbilder weisen eine grosse Zahl verschiedener psychischer und körperlicher Symptome auf, die verschieden miteinander kombiniert sein können und manchmal schwer zu erkennen sind, v.a. die larvierten, somatisierten Formen. Tab. 17 zeigt die häufigsten Symptome. 23 Biologische/Medizinische Faktoren müssen vor einer psychologischen Behandlung genauestens abgeklärt werden, da diese womöglich die Verursacher der Depression sind. a) Biologische Modelle Für ein biologisches Modell sprechen folgende Beobachtungen: Die Depression wird oft von natürlichen körperlichen Veränderungen begleitet: vor der Menstruation, nach der Schwangerschaft oder die Wechseljahre. Die Symptome ähneln sich grösstenteils, unabhängig vom Alter, Geschlecht, Kultur oder Rasse des Patienten. Psychopharmaka und Elektrokrampftherapie sind wirksame Behandlungen. Auch kann eine Depression als Nebenwirkung von Medikamenten (z.B. Reserpin) auftreten. Die Depression geht mit einer erhöhten Vererblichkeit einher: V.a. die bipolaren Störungen (manischdepressiv). Eineiige Zwillinge weisen eine Konkordanz von 69% auf (zweieiige nur 19%). Es existiert eine Katecholamin- und eine Serotoninhypothese, die durch die Wirkung bestimmter Psychopharmaka bestätigt wird. Auch kann man z.T. neuronale Veränderungen (im limb. System oder Locus coeruleus) feststellen. Die Störung ist vermutlich nicht rein biologischen Ursprungs – man geht eher von einem integrativen Modell aus. Abb.3 veranschaulicht ein integratives Erklärungsmodell. 24 Trizyklische Antidepressiva (Tofranil, Tryptizol) und MAO-Hemmer (Parnab, Nardil) zeigen gute Wirkungen, allerdings haben MAO-Hemmer viele Nebenwirkungen. Trotz des schlechten Rufs der Elektrokrampftherapie zeigt sie v.a. bei endogen Depressionen gute Erfolge. b) Psychologische Modelle zur Entstehung und Behandlung 1. LEWINSOHNs (1974) Modell zur Depressionsentstehung geht von Skinners operanter Lerntheorie aus. Die charakteristischen Symptome von Verhaltensreduktion (Interesseverlust, Passivität und Antriebsmangel) werden auf verhaltensbezogene Verstärkungsverluste zurückgeführt. Da dem Patienten eine zeitlang kaum Verstärkung für Aktivitäten und soziales Verhalten zukommt, verarmt sein Verhalten. Durch negative äussere Ereignisse können die möglichen positiven Verstärker vermindert werden oder die Kontrolle über die Verstärkungsmöglichkeiten gehen verloren. Das sich so entwickelnde depressive Verhalten kann durch eventuell folgende soziale Zuwendung aufrechterhalten werden (!). Es ist aber auch möglich, dass daraus soziale Abwendung resultiert, was die Depression verschlimmert. In der Therapie geht es darum, die unangemessenen Verstärkerbedingungen zu verändern. Selbstsicherheit uns soziale Fertigkeiten werden trainiert, mehr Aktivitäten eingeplant. Neuerdings werden kognitive Verfahren zur Verarbeitung von Umweltreizen und Stressbewältigungstechniken hinzugefügt. 2. BECKs Modell gehört zu den kognitiven Modellen. Die Entstehung der Depression ist v.a. kogn. Strukturen und Prozessen zuzuschreiben. Die kognitiven Schemata eines Patienten verzerren die Wirklichkeit. In sogenannten kognitiven Triaden hat der Patient eine negative Sicht von sich selbst, seiner Umwelt und der Zukunft. Negative Ereignisse werden immer auf sich selbst bezogen, in der Umwelt negative Ereignisse selektiv wahrgenommen und von der Zukunft auch nichts besseres erwartet. Die Aktivierung der kogn. Denkmuster führt zu Angst, Traurigkeit, Passivität und Ärger. Typische Denkfehler kommen hinzu. Diese kognitive Verhaltenstherapie, welche dann versucht, die kogn. Schemata zu ändern, ist eine der besten Therapien für Depressive. Mindestens ebenso wirksam wie Antidepressiva mit dem Vorteil, geringere Rückfallquoten aufzuweisen. 3. SELIGMANs Depressionsmodell (1974) gehört zu den kognitiven Modellen: Die Depression wird durch eine Erwartung eines negativen Ereignisses ausgelöst, auf dessen Eintreten kein Einfluss ausgeübt werden kann (das Modell ist aus der Beobachtung mit Hunden entstanden Konzept der erlernten Hilflosigkeit). Das Konzept wurde durch attributionstheoretische Hypothesen (Ursachenzuschreibung) erweitert. In der Therapie geht es darum, die erlernte Hilflosigkeit abzubauen und angemessene Kontrollüberzeugungen aufzubauen mit Hilfe der kognitiven und der VT. 4. REHMs (1977) Selbstkontrollhypothese wurde aus KANFERs Selbstkontrolltheorie (1970/71) entwickelt: die Depression tritt in Folge eines Selbstkontrolldefizits auf. Aufgabe der Therapie ist es, diese Fähigkeiten aufzubauen. 25 5. McLEAN (1976) legte ein Stressbewältigungsmodell vor: Eine Depression entsteht, wenn eine Person zur Verarbeitung ungünstiger Ereignisse und belastender Lebenssituationen keine wirksamen sozialen Bewältigungsfertigkeiten einsetzen kann. Diese Fertigkeiten sollen in der Therapie aufgebaut werden. Dazu werden Bezugspersonen in die Therapie miteinbezogen. 6. KLERMAN & WEISSMAN (1982) haben die interpersonelle Therapie (IPT) entwickelt. Sie betont die Bedeutung sozialer Interaktion und geht von A. MEYERs psychobiologischer Auffassung der Psychiatrie, von H.S. SULLIVANS Theorie der Interpersonellen Beziehungen und von der emp. Forschung der Sozialtheorie aus. Sie stützt sich auch auf die Attachment Theorie: Enge zwischenmenschliche Beziehungen (Intimacy) spielen bei der Vorbeugung depr. Störungen eine wichtige Rolle. Verluste und Probleme in diesen Beziehungen tragen zur Depressionsentwicklung bei, sind aber nicht deren Ursache. VII Zusammenfassung der Behandlungsempfehlungen siehe Tab.19 26 4. Schlafstörungen, funktionelle Partnerschaftsstörungen Sexualstörungen und Ehe- und I Schlafstörungen Die Klassifikation orientiert sich an der ASDC (Association of Sleep Disorder Centers, 1979). a) Formen von Schlafstörungen Es werden vier grosse Störungsformen des Schlafs unterschieden: 1. Insomnien: Betreffen Einschlafen und Durchschlafen und bringen Schlafmangel mit sich. In dieser Gruppe ist die Beteiligung psychologischer Faktoren am deutlichsten, deswegen wird in der Folge bei Huber nur noch diese Störungsgruppe diskutiert (siehe unten). 2. Hypersomnien: Beinhalten eine unwiderstehliche Neigung zum Schlafen ausserhalb der Hauptschlafzeiten, führt zu Schlafüberschuss. Beteiligung psychologischer Faktoren bei der Verursachung wird quasi ausgeschlossen. 3. Störungen des Schlaf-Wach-Rhythmus: Veränderungen dieses Rhythmus im Vergleich mit der sozialen Umgebung, man kann nicht dann schlafen, wenn man es braucht oder wünscht. Mögliche Ursachen: organisch, Medikamente, Umstellung (Jet lag, Schichtarbeit). 4. Parasomnien: Abnorme Ereignisse, die während des Schlafes auftreten (z.B. Alpträume oder Schlafwandeln). b) Merkmale der Insomnien Bezogen auf den Schlaf: Verlängerte Einschlafzeiten oder Wachzeiten. Diese Wachzeiten sind unangenehm, oft von zwangsartigem Grübeln begleitet. Es gibt keine objektiven Kriterien, ab wann eine Wachzeit Störungscharakter hat, als Richtmass wurde eine Dauer von mehr als 30 Minuten eingesetzt. Unruhiger und oberflächlicher Schlaf, der morgens nicht zum Gefühl der Erholung führt. Ungenügende Gesamtschlafdauer. Hier gibt’s wieder kein objektives Kriterium, Richtwert ist weniger als 6,5 Std. Angst, Kontrolle über Schlaf zu verlieren, nicht mehr schlafen zu können. Angst, der schlechte Schlaf könne die Gesundheit beeinträchtigen. Dazu kommt dann Störungen des Befindens am Tag: Müdigkeit, Leistungsunfähigkeit (v.a. subjektive), Unlust, Unzufriedenheit, Antriebslosigkeit und Depression. c) Formen von Insomnien 1. Psychophysiologische oder primäre Insomnien: Sind durch emotionale Erregung oder psychische Konflikte bedingt. Dauer der akuten Form: weniger als drei Wochen. Bei längerer Dauer können sich Erwartungsängste und dann eine chronische Schlafstörung entwickeln. Machen 20% der Insomnien aus. 2. sekundäre Schlafstörungen im Zusammenhang mit psychiatrischen Störungen (v.a. Depressionen). Machen 35% der Insomnien aus. 3. Insomnien im Zusammenhang mit Medikamenten oder Alkoholkonsum (10%). Chronischer Konsum von Alkohol und/oder Barbituraten Verändern das Schlafmuster: REM-Schlaf und Tiefschlaf ist verkürzt (oder weg). 27 4. Weitere Formen: schlafinduzierte Atmungsstörungen (5%), Myoklonus + „restless legs“ (15%), bei körperlichen Erkrankungen (5%), Abweichungen in der Schlafstruktur (5%), mit unbekannten Faktoren verbunden (5%). d) Entstehungsbedingungen primärer Insomnien Veranlagung: Personen mit Schlafstörungen haben oft schon in der Kindheit einen empfindlichen Schlaf und fühlen sich generell körperlich und seelisch weniger wohl. Möglicherweise führt eine vegetative Labilität dazu, dass sie für vorübergehende Belastungen empfindlicher sind und darauf schneller mit gestörtem Schlaf reagieren. Ungelöste Probleme, belastende Situationen, unbewusste Konflikte, mit Schlaf unverträgliches Verhalten und später auch Erwartungsängste können das kognitive und/oder physiologische Erregungsniveau so weit erhöhen, dass es das Einschlafen erschwert. e) Zur Behandlung der Insomnien Pharmakologische Behandlung: Früher Barbiturate (aber: Gefahren + Nebenwirkungen), heute Benzodiazepine (=Tranquilizer). Aber da sie bei längerer Einnahme die Schlafstruktur verändern, keinen erholsamen Schlaf bringen und abhängig machen, ist nur kurzfristiger Einsatz sinnvoll. Psychologische Behandlung: Symptomzentrierte Verfahren (enger) und Konfliktund problemzentrierte Verfahren (weiter). Erst zu Symptomzentrierten Verfahren: Entspannungsmethoden: Autogenes Training, progressive Entspannung oder Biofeedback. Möglicherweise erfolgt hier die Wirkung gar nicht über eine Reduktion der körperlichen Spannung, sondern indem die Aufmerksamkeit (durch Fokussieren auf Körperprozesse) vom Sinnieren über die Schlafstörung abgewendet wird. Paradoxe Intention: Nach Franke (1960): Schlafenwollen führt zu ängstlichen Erwartungen und soll daher unterlassen werden: Der Patient soll versuchen, wach zu bleiben und seine Körperreaktionen zu beobachten. Stimulus- und Bettzeitkontrolle: Gründet auf operanter Analyse von Schlafund Schlafstörungen (Bootzin, 1972), Annahme ist hier, dass bei Schlafstörungen keine starken Hinweisreize für Schlaf (der seinerseits als Verstärker wirkt) vorhanden sind oder dass die vorhandenen Reize mit Schlaf unvereinbar sind. Die Behandlung soll daher: Den Hinweisreiz für den Schlaf (Bett) verstärken, den Hinweisreiz des Bettes für anderes Verhalten (lesen, fernsehen, grübeln usw.) schwächen, einen festen Schlafrhythmus herbeiführen. Dazu muss der Patient dann konsequent verschiedene Regeln befolgen (u.a.: Nur ins Bett legen, wenn schläfrig, dort nicht anderes machen (höchstens Sex), wenn man nach 10 min. Noch wach ist, wieder aufstehen, jeden Morgen zur gleichen Zeit aufstehen (egal wie die Nacht war), nicht tagsüber schlafen). Konflikt- und problemzentrierte Verfahren: Konfliktzentrierte Verfahren: Basieren auf der Annahme, dass Schlafstörung Resultat eines Konfliktes ist. Es werden dann Psychoanalytische Verfahren oder Gesprächspsychotherapie angewandt, aber von beiden Schulen ist bis jetzt kein spezifisch für die Schlafstörung entwickeltes Verfahren vorgestellt worden. Wirksamkeitsnachweise sind nicht vorhanden (PA) oder bescheiden (GT). Kognitiv-verhaltenstherapeutische Methoden: Setzt zuerst an der Störung direkt an, geht jedoch in einer zweiten Phase darüber hinaus und bezieht 28 problemorientert die übrige Lebenssituation des Patienten mit ein. Bsp. ist ein Breitbandprogramm von Hohenberg und Schindler (1984), dass auch (erfolgreich) auf Wirksamkeit überprüft f) Behandlungsempfehlungen Immer erst medizinische Abklärung. Dann sollte von einem in der Behandlung von Schlafstörungen erfahrenen Therapeuten eine Therapie gewählt werden. Ausser den Konfliktund Problemorientierten Ansätzen werden von Huber alle eben aufgeführten psychologischen Verfahren als Möglichkeiten aufgelistet. II. Funktionelle Sexualstörungen a) Beschreibung der Störungen Wegen der engen Wechselwirkung zwischen sexuellen, individuellen und partnerschaftlichen Problemen ist es fragwürdig, ob die getrennte Behandlung von Beziehungsproblemen und Sexualstörungen Sinn macht. Hier werden die Probleme gesondert behandelt, weil viele Patienten über sexuelle Probleme klagen und weil die Behandlung hinsichtlich des Symptoms spezialisiert und somit spezifisch für Sexualstörungen ist. Bedeutung der Begriffe (deutschspr. Raum, Sigusch, 1980): Sexuelle Dysfunktionen: organisch bedingte Funktionsstörungen Funktionelle Sexualstörungen: hier werden psychische Ursachen angenommen Sexuelle Funktionsstörungen: fasst beide Gruppen zusammen Im DSM-III-R werden die funktionellen Sexualstörungen in zwei Gruppen eingeteilt: 1. Paraphilien: „Das Auftreten einer Erregung als Reaktion auf sexuelle Objekte oder Situationen, die nicht den üblichen Aktivierungsmustern entsprechen und die in unterschiedlichem Ausmass die Fähigkeit zur wechselseitigen, liebevollen sexuellen Akitivität beeinträchtigt“. Untergruppen: Exhibitionismus, Fetischismus, Frotteurismus, Pädophilie, sexueller Masochismus, sex. Sadismus, transvestitischer Fetischismus, Voyeurismus, nicht näher bezeichnete Paraphilie 2. (Psycho-)Sexuelle Dysfunktionen: „Hemmung des sexuellen Antriebs oder der psychophysiologischen Veränderungen, die mit dem sexuellen Reaktionszyklus einhergehen“.Untergruppen:Gehemmte Appetenz, geh. Erregung, geh. weibl. Orgasmus, geh. männl. Orgasmus, Ejakulatio Praecox, Funktionelle Dyspareunie (Brennen, Stechen beim Geschlechtsverkehr), Funktioneller Vaginismus (Scheidenkrampf), nicht näher bezeichnete sex. Funktionsstörung. Die Störungen werden hier auf den Ablauf des sexuellen Reaktionszyklus (Appetenz, Erregung, Orgasmus, Entspannung) bezogen Diagnose erfolgt nach expliziten Kriterien bzgl. Bedingungen/Umstände, Häufigkeit, Dauer, Schweregrad. b) Häufigkeit funktioneller Sexualstörungen Die Zahlen sind mit Vorsicht zu geniessen und als „beste verfügbare Schätzwerte“ zu interpretieren , da v.a. die älteren Studien z.T. unterschiedliche Kriterien und andere methodische Mängel aufweisen. Die meisten Menschen erleben Perioden sexueller Symptomatik (Männer 67%-87%, Frauen 48%-88%), die nicht zwingend mit grösserer Unzufriedenheit einhergehen (eine Studie: 60% der Frauen in glücklichen Ehen erwähnten ab+zu Symptome) 29 Chronische Probleme: Frauen: 13% erniedrigte Appetenz, 9% Probleme beim Orgasmuserleben. Männer: 13% allgemeine Sexualprobleme. In Arztpraxen (Schweiz): 4% der Patienten in den Arztpraxen kommen v.a. wegen sexuellen Symptomen, 25% der Männer und 29% der Frauen leiden unter sex. Symptomen. Untersuchung in Toronto: 8,6% der Patienten weisen sexuelle Probleme auf. Häufigkeit der Diagnosegruppen: Reanalyse von 22 Studien (Nathan, 1986): gehemmter weibl. Orgasmus 5%-30%, gehemmter männlicher Orgasmus 5%, Ejakulatio Praecox 35%, gehemmte sexuelle Appetenz 1%-15% (Männer) und 1%-15% (Frauen). Appetenzprobleme scheinen zuzunehmen. c) Entstehung und Behandlung funktioneller Sexualstörungen In vielen Schulen gibt es interessante Ansätze, hier wird eingegangen auf Psychoanalytischen und Verhaltenstherapeutischen Ansatz (letzterer enthält auch systemtheoretische Überlegungen) Psychoanalytischer Ansatz: Entstehung der Störung: Symptome sind – wie bei klassischen Neurosen auch – Ausdruck eines tieferen, unbewussten Konflikt, der auf ungelöste Probleme der frühen Kindheit zurückgeht. Je nach Entwicklungsphase drängt wurden, in der die Probleme nicht gelöst werden konnten und v, gibt es dann verschiedene Probleme. Therapie der Störung: Erfolgt wie bei anderen neurotischen Symptomen durch Interpretation und Durcharbeiten des Konfliktmaterials. Durch Auflösung des unbewussten Grundkonflikts soll die Störung überflüssig gemacht werden. Neben einer klassischen Analyse werden hier auch kürzere und aktivere Verfahren vorgeschlagen. Verhaltenstherapeutischer Ansatz: Geht zurück auf Wolpe (1958) und Lazarus (1963) (Interesse an Lernprozessen) und auf Master und Johnson (1970) (sexologische Klinik und Physiologische Untersuchung des ungestörten Sexualverhaltens). Entstehung der Störung: Durch Lerngeschichte mit klassischen, operanten und kognitiven Lernprozessen. Ausserdem wird mit Hilfe systemtheoretischer Modelle nach Ansatzpunkten in der partnerschaftlichen Interaktion gesucht. Neben somatischen Faktoren gibt es zwei Gruppen von Bedingungen, die zu Sexualstörungen führen können: Frühe Lernerfahrungen in Kindheit und Adoleszenz können das Selbstbild, die Beziehungen zu anderen und das Bild der Sexualität prägen. Wenn so negative Bilder entstehen und die nicht korrigiert werden, können sie zu sexuellen Funktionsstörungen führen. Gegenwärtige Bedingungen betreffen Auslöser der sex. Erregung, Defizite im Kontaktverhalten, mangelnde Aufklärung, unsichere Wertorientierung (was darf und soll geschehen?), Partnerprobleme. (Liegen Erfahrungen von sexuellem Missbrauch in der Kindheit oder Vergewaltigungserlebnisse vor, sollte evtl. eine gesonderte Therapie erwogen werden.) Ein erstes Störungserleben kann verarbeitet werden oder zu Erwartungsangst und somit zu Weiterentwicklung der Störung führen. Therapie der Störung: Weil Angst als konditionierte Reaktion auf sexuelle reize eine zentrale Rolle spielt, können diese Störungen lerntheoretisch als Phobien aufgefasst werden. Behandlung ist daher systematische Desensibilisierung in sensu und in vivo (hier soll Patient immer nur soweit gehen, wie es ihm angenehm und ohne Angst möglich ist). Erweiterung dieses symptomzentrierten Vorgehens durch Einbeziehung interaktioneller 30 Sichtweisen (wie z.B. bei Masters & Johnson): „positiver Austausch im Paar“, „sensate focus“ (Übungen zu Erreichung der Sensibilität für sinnliche Wahrnehmungen, Sensualitätstraining), Ziele sind u.a. Leistungsängste abbauen, Bedürfnisse des Partners kennenlernen, Kommunikation verbessern. Masters & Johnson führten die Therapie ursprünglich stationär mir zwei Co-Therapeuten (Mann+Frau) durch, sie ist aber auch ambulant, mit einem Therapeut und in Gruppen wirksam. Neue Komponente ist „arousal reconditioning“, wenn Abbau der Angst nicht reicht um positives Erlebnis der Sexualität herbeizuführen, indem sexuelle Erregbarkeit und Lustempfinden entwickelt werden. Als Behandlungsmethode der Wahl weist Huber auf ein Psychodynamische (Kaplan, 1974,1981) oder verhaltenstherapeutische (Arentewicz & Schmid, 1986) Weiterentwicklung der Methode von Masters und Johnson hin. III. Störungen der Beziehung und der Interaktion in Ehe und Partnerschaft Kommen nicht als Kategorie in ICD-9 oder DSM-III-R vor, werden hier trotzdem erläutert, weil sie häufig sind, Leid verursachen und bei vielen anderen Störungen von Bedeutung sein können. Zu Begriffen: Hier wird Ehe, Partnerschaft und Intime Beziehung identisch verwendet als Beschreibung für eine Beziehung, die „Seele, Körper und Geist“ und das Erleben eines Wir-Gefühls mit einschliesst. d) Häufigkeit und Bedeutung Es gibt keine repräsentativen Daten zum Ausmass der Unzufriedenheit, aber vielen Arbeiten sind deutliche Hinweise dafür zu entnehmen, dass Partnerprobleme sehr häufig sind: 80% der Ehepaare denken einmal an Scheidung (USA), ca. jede 4. Ehe wird geschieden (BRD+Schweiz), 10% der Frauen (15 bis 45 Jahre) in festen Partnerschaften gaben an in der Beziehung unglücklich zu sein. Beziehungsstörungen sind auch wichtig bei Depressionen, Suizidversuchen, psychosomatischen Störungen. b) Merkmale und Entstehung von Eheproblemen Was unterscheidet glückliche von unglücklichen Paaren? Ein „mehr“ oder „weniger“ an Ehequalität oder –Zufriedenheit. Ein Vergleich von glücklichen Paaren und solchen, die in eine Therapie kamen zeigt, dass sie sich in Art und Häufigkeit der Beziehungsprobleme deutlich unterscheiden. Glückliche Paare sahen meist nur einen Bereich (z.B. Sexualität, Weltanschauung, persönliche Gewohnheiten,...) als konfliktauslösend an, während bei den unglücklichen Paaren im Schnitt 7,1 Bereiche angegeben wurden. Ehequalität kann mit guten Instrumenten (z.B. Dyadic Adjustment Scale) empirisch erfasst werden. Einflussfaktoren auf die Ehequalität werden seit den 30er Jahren in familiensoziologischen und seit den 70er Jahren in psychologischen Studien untersucht. Die meisten Variablen erklären nur wenig Varianz der Ehequalität, die klarsten Ergebnisse stammen aus Studien, die gezielt die Transaktionen (=wechselseitigen Beeinflussungen) der Partner untersuchen: Glückliche Partner sind in Diskussionen nonverbal zugewandter, teilen sich mehr mit und vermitteln mehr Akzeptanz. In kritischen Gesprächsabschnitten (Vorwürfe, Uneinigkeit, Kritik, Drohung) gelingt es glücklichen Paaren nach kurzer Zeit die Eskalation abzukühlen und zu unterbrechen. Unglückliche Paare sind unfähig, sich aus solchen negativen 31 Zirkeln zu lösen und die Atmosphäre (v.a. im nonverbalen Bereich) zu entspannen. Wie kommt es zu diesem Mangel an Kommunikationsund Problemlösefertigkeiten? 1) Psychoanalytische Annahmen zur Entwicklung der Partnerschaft Partnerwahl sowie Art und Weise wie Erwartungen, Frustrationen und Konflikte in Beziehungen verarbeitet werden sind durch Kindheitserfahrungen der Partner, bzw. durch deren Beziehung zu Vater und Mutter, bedingt (Moser, 1957). Willis (1975) Kollusionskonzept entwickelt das Modell weiter und geht von der Annahme aus, dass sich Partner aufgrund affektiver Grundmuster, die sich entsprechen, wählen. Günstig wäre eine Bedürfniskomplementarität (=Ergänzung der Bedürfnisse). Nach Willi gibt’s vier „Grundmuster des unbewussten Zusammenspiels der Partner“, die grob den Themen der psychosexuellen Entwicklungsstufen entsprechen (oral, anal, phallisch, narzistisch). Man wählt Partner auf der gleichen Stufe, aber mit unterschiedlichen Bedürfnissen (z.B. auf der oralen Entwicklungsstufe: Einer regressiv (will umsorgt werden), einer progressiv (will umsorgen)). Konflikte gibt’s wenn man die Bedürfnisse des anderen falsch einschätzt oder wenn sie sich ändern. Forschungsergebnisse sind widersprüchlich. 32