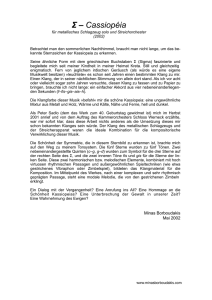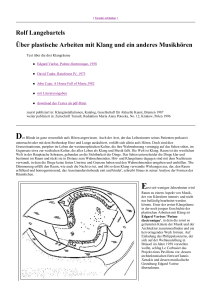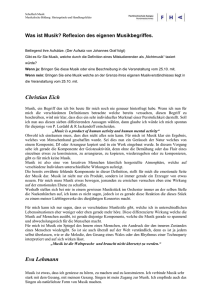pdf, 72 kb - Wien Modern
Werbung

Gérad Grisey Die Entstehung des Klanges … Die verschiedenen Prozesse, die bei der Veränderung eines Klangs in einen anderen oder einer Klanggruppe in eine andere auftreten, bilden die eigentliche Basis meiner musikalischen Schreibweise, die Idee und den Keim jeder Komposition. Der Baustoff kommt von der Klangentstehung her, von der Makrostruktur, und nicht umgekehrt. Anders gesagt: Es gibt kein Grundmaterial (Melodiezelle, Tonkomplex, Notenwerte etc.), von dem die große Form eine Art Entwicklung im nachhinein darstellen würde. Es ist der Prozeß, der am Anfang steht; er bestimmt die Veränderung der Klangfiguren und führt dazu, ohne Unterlaß neue zu schaffen. Ich bin selbst erstaunt zu entdecken, bis zu welchem Punkt die erzeugten Klänge durch diese Prozesse diejenigen überholen, und zwar sehr weit, die man sich a priori abstrakt und zeitlos vorstellen könnte. In meiner Musik kann der Klang niemals für sich selbst betrachtet werden, sondern er ist immer durch den Filter seiner Geschichte gegangen. Wohin geht er? Wo kommt er her? Diese Frage stelle ich mir in jedem Augenblick bei der Partitur, die ich gerade schreibe. Schließlich könnte man sagen, daß der Baustoff nicht mehr so sehr als autonome Quantität existiert, sondern daß er zu reinem klanglichen Werden sublimiert ist, das sich ohne Unterlaß in Veränderung befindet. Ungreifbar für den Augenblick, läßt er sich nur in der Zeitdauer aussondern und ergreifen. Aber diese Versiche­rung führt mich dazu, ihren Inhalt richtig zu erklären; denn gerade durch die Funktion ihrer eigenen akustischen Qualitä­ten sind die verschiedenen Klangtypen in den Prozeß integriert und determinieren eine gewisse Zeit. Es existiert also eigentlich ein Netz fortwährender Relatio­nen, ein beständiges Hin und Her des Gedankens zwischen Baustoff und Prozeß, wie zwischen Mikro- und Makrokos­mos. Zu determinieren, von welcher Klangfigur er ausgeht und zu welcher anderen Figur er hinläuft, darin scheint mir die grundsätzliche Wahl des heutigen Komponisten zu bestehen. Bleibt noch die Zeit, die Zeit dieser Veränderung, die die Form selbst seines Taumels ist. Orientierungspunkte Es wäre noch zu sagen, daß unsere begrenzten Sinne Markie­rungen brauchen, um irgendeine Bewegung wahrzunehmen. Es handelt sich weder um eine Klangzelle noch darum, ein Grundmaterial zu entwickeln, sondern um eine Art überaus einfacher Orientierungspunkte, die jeder wahrnehmen und behalten können sollte. Wir werden zwei davon festhalten: die rhythmische Periodizität und das harmonische Spektrum (andere Form der Periodizität). Wahrnehmung: Das Ähnliche und das Verschiedene Unsere Wahrnehmung ist relativ; ununterbrochen vergleicht sie das Objekt, dessen sie eben inneward, mit einem anderen – zuvor gewahrten oder noch virtuellen – Objekt, das in unserem Erinnerungsvermögen lokalisiert ist. Unterschied oder Fehlen eines Unterschieds qualifizieren alle Wahrnehmung. Wir ordnen Wahrgenommenes nicht, indem wir es auf eine einheitliche Norm beziehen, sondern indem wir es in ein Netz von Beziehungen einfügen, um seine Eigenart zu fassen. Anders ausgedrückt: ein Ton existiert nur vermöge seiner Indi­vidulität, und diese Individualität gibt sich nur in einem Kontext zu erkennen, der sie beleuchtet und rechtfertigt. Daher betrachte ich es – für den Komponisten – als entscheidend, nicht aufs bloße Material mehr einzuwirken, sondern auf den Leerraum, auf die Distanz, die einen Ton von einem anderen trennt. Das Ähnliche und das Verschiedene als eigentliche Basis der musikalischen Komposition in Angriff nehmen erlaubt uns tatsächlich, zwei Klippen zu umschiffen: die Hierarchie und die Gleichmacherei. Zuerst ist es nötig, bei jedem Klang die Qualitäten auszusondern, die ihn von allen anderen unterscheiden, und die, weit davon ihn zu isolieren, seine unersetzliche Eigenart herausstellen. Diese Qualitäten können nur durch akustische Übung eingeschätzt werden. Wir entdecken nun, daß jeder Klangtyp für unser Ohr eine besondere Prägnanz hat: So wird ein aus harmonischen Ober­tönen bestehender Klang niemals dieselbe Prägnaz haben wie weißes Rauschen oder ein aus unharmonischen Obertönen gebildeter Klang; eine Oktave wird für das Ohr niemals denselben Reibungsgrad besitzen wie eine kleine Terz. Handelt es sich darum, eine alte kulturelle Hirarchie wiederaufleben zu lassen: gute Intervalle, schlechte Intervalle, Konsonanzen, Dissonanzen? Überhaupt nicht. Das wäre ein Rückfall in einen vergangenen Dualismus, das hieße auch zu ignorieren, daß der kulturelle Kontext oder die Klangent­ste­hung die Klangqualitäten insofern beeinflussen können, als die Eigenart radikal umgewendet wird. Ich ahne unterdessen, daß irgendwo in unserer Wahrneh­mung eine Grenze existiert, ein Nullpunkt, den zu überschreiten unmöglich ist, ohne im Absurden unterzugehen. Das wäre diese Schwelle, von der ich sprach: von dieser Schwelle aus sollte sich die gesamte Musik entwickeln. Der zweite Punkt führt die Organisation dieses Baustoffes ARCHIV WIEN MODERN | © WIEN MODERN | WWW.WIENMODERN.AT ein, was noch weitere Kapitel nötig machen wird. Inzwischen halten wir fest, daß alle Klänge vom reinen Sinuston bis zum weißen Rauschen daran teilhaben können. Ohne sie dominieren zu wollen, müssen wir lernen, mit der Natur der Klänge zu spielen, indem wir die verschiedenen Arten und Rassen, die sie uns vorschlägt, voll akzeptieren. Zwischen der tonalen oder neo-tonalen Hierarchie und dem seriellen oder neoseriellen Egalitarismus existiert ein dritter Weg: Unterschiede zu erkennen und anzuerkennen. Trachten wir endlich danach, zugleich Nivellierung und «Kolonisierung» zu vermeiden. Geschichte Die Wissenschaft hat uns die Wichtigkeit des horizontalen Netzes der im Kosmos existierenden Beziehungen entdecken oder wiederentdecken lassen. Wir sind am Anbruch einer neuen Ära, die erstmals eine Musik stammelnd hervorbringt, die versucht, alle Klänge zu integrieren, und deren Formen aus dem Netz der Verbindungen entstehen, die zwischen den Klängen existieren. Um das zu vollbringen, sind wir gerade dabei, ein Klangkontinuum klar herauszustellen, in dem jeder Klang durch und für die Klänge lebt, die ihn umgeben, die ihm vorangehen oder ihm folgen. Das Diskontinuum wird später kommen, wenn diese Beziehungen ausreichend klar geworden sind. Dynamismus Es ist mir nicht länger möglich, die Töne als festgesetzte und untereinander permutierbare Objekte aufzufassen. Sie erscheinen mir eher wie Bündelungen zeitlich gerichteter Kräfte. Diese Kräfte – ich verwende den Ausdruck mit Bedacht und bediene mich nicht des Wortes Form – sind unendlich beweglich und fließend; sie leben wie Zellen, haben eine Geburt und einen Tod und tendieren vor allem zu einer ständigen Trans­formation ihrer Energie. Der unbewegliche, fixierte Ton existiert nicht, so wenig wie die Felsschichten der Gebirge unbeweglich sind. Es macht geradezu die Definition des Tones aus, daß er vorübergeht. Weder ein isolierter Augenblick noch auch eine Folge genau beschriebener isolierter und aufeinandergereihter Augenblicke vermöchte ihn zu definieren. Einer besseren Definition des Tons könnte uns wohl einzig die Kenntnis der Energie, die ihn je und je durchfährt, und des Gewebes der Wechselwirkungen näherbringen, das alle seine Parameter bestimmt. Es ließe sich einer Ökologie des Tons als von einer neuen Wissenschaft träumen, die den Musikern zu Gebote stünde … Schon die Praxis des elektronischen Studiums lehrte uns, die Komponenten des Tons nicht als isolierte Tatbestände aufzufassen, wie es die serielle Musik mit ihrer säuberlichen Be­stimmung und Trennung seiner Parameter getan hatte, sondern als ein komplexes Netz vielfältiger Interaktionen und Reaktionen zwischen eben diesen Parametern. Jeder weiß zum Beispiel, daß zwei Töne, deren Frequenzen sehr nah beieinanderliegen, Schwebungen hervorrufen. Sind diese Schwebungen sehr schnell, so bewirken sie eine Änderung der Klangfarbe, sind sie langsamer, so zeitigen sie periodische Ereignisse, die wir als Rhythmen wahrnehmen. Ebenso weiß man, daß die Lautstärke bestimmenden Einfluß auf die Tonhöhenwahrneh­mung hat, daß ein Erkennen der Klangfarbe in hohem Maß von der Dauer eines Tons abhängt etc. Man könnte die Auf­zäh­lung dieser Überlagerungen, die von unserem Wahrneh­mungs­vermögen und seinen Grenzen gezeitigt werden, ins Unendliche fortsetzen. Andererseits ist es nicht überflüssig, daran zu erinnern, daß die Parameter nur ein Leseraster sind, eine Simplifikation, eine Art Axiom, welches es uns überhaupt ermöglicht, das Pro­blem des Tons anzugehen. Es kommt ihnen jedoch keinerlei reale Existenz zu, denn wir nehmen den Ton global und total – nicht analytisch – wahr. Kultur Es sei mir gestattet, an dieser Stelle all jenen öffentlich zu danken, die mir dazu verholfen haben, der Musiker zu sein, der ich heute bin, all jenen, die mich durch das Beispiel ihrer Musik dazu gezwungen haben, ausreichend neidisch zu werden, um ihnen nacheifern zu wollen. Ich nenne: O. Messiaen, G. Scelsi, K. Stockhausen, F. Cerha. E. Varèse, I. Strawinsky, B. Bartók, A. Webern, G. Mahler, C. Debussy, R. Wagner, L. v. Beethoven. W. A. Mozart, L. Couperin, J. S. Bach, C. Monteverdi, G. Fresco­baldi, J. Ockeghem, G. de Machault und all die kollektiven Autoren der außereuropäischen Musik­­kulturen, der tibetanischen, der balinesischen, der japanischen, der pygmeischen … Wenn ich, sollte es der Zufall wollen, Namen oder Völker vergessen haben, so mögen diese sicher sein, wenn auch nicht auf dieser Liste, so doch in meinem Gedächtnis präsent zu sein. Jede Ähnlichkeit zwischen den Klängen, die ich verwende und jenen, die man bei den obengenannten Autoren finden kann, ist mit Wissen und Willen unbewußt. Tempus ex machina Unter Berücksichtigung nicht nur des Klanges, sondern, mehr noch, der wahrgenommenen Unterschiede zwischen den Klängen, wird der Grad der Voraussehbarkeit oder besser der Voraushörbarkeit zum wahren Grundstoff des Komponisten. Folglich bedeutet Handeln nach dem Grad der Vorausseh­bar­keit das direkte Komponieren der musikalischen Zeit, d. h. der wahrnehmbaren Zeit, nicht der chronometrischen Zeit. Stellen wir uns ein klanglichen Ereignis A vor, gefolgt von einem anderen Ereignis B. Zwischen A und B existiert, was man die «Dichte der Gegenwart» nennt, eine Dichte, die keine Konstante ist, sondern die sich ausdehnt oder zusammenzieht unter Einwirkung des Ereignisses. Wenn nämlich der Unter­schied zwischen A und B quasi gleich null ist, anders gesagt, wenn der Klang B vollkommen vorhersehbar ist, scheint die Zeit in einer bestimmten Geschwindigkeit abzulaufen. Im Gegensatz dazu läuft die Zeit, wenn Klang B vollkommen anders ist, in einer anderen Geschwindigkeit ab. Es muß auch «Zeitlöcher» geben, die dem, was Flugpassa­giere Luftlöcher nennen, entsprechen. Die meßbare Zeit ist keineswegs aufgehoben, jedoch verbirgt die Wahrnehmung, die wir von ihr haben, den linearen Aspekt für einen mehr oder weniger langen Moment. So läßt uns z. B. ein unerwarteter akustischer Schock über eine gewisse Zeitspanne schnell hinweggleiten. Die Klänge, die während der Zeit der Dämp­fung wahrgenommen werden – der Zeit, die uns notwendig ist, um ein relatives Gleichgewicht wiederzufinden –, haben keineswegs mehr den gleichen emotionellen, noch den gleichen zeitlichen Wert. Dieser Schock, der den linearen Ablauf der Zeit durcheinander bringt, und der eine heftige Spur im Gedächtnis hinterläßt, verringert unsere Fähigkeit, die Folge des musikalischen Vortrags zu begreifen. Die Zeit hat sich zusammengezogen. Im Gegensatz dazu läßt uns eine Folge von extrem vorhersehbaren, klanglichen Ereignissen einen großen Wahrnehmungsspielraum. Das geringe Ereignis gewinnt an Wichtigkeit. Dieses Mal hat die Zeit sich ausgedehnt. Im übrigen ist es diese Form der Vorhersehbarkeit – jene ausgedehnte Zeit –, die wir benötigen, um den mikrophonischen Aspekt des Klangs zu erfahren. Alles spielt sich so ab, als ob der «Zoomeffekt», der uns die innere Struktur der Klänge nahe bringt, nur auf Grund eines Umkehreffekts funktioniert, der die Zeit betrifft: eine Art Zeitlupe. Je mehr wir unsere Hörschärfe erweitern, um die mikrophonische Welt zu erfahren, desto mehr schränken wir unser Zeitgefühl ein, so daß wir relativ große Zeitwerte brauchen. Vielleicht ist dies ein Gesetz der Wahrnehmung, das man wie folgt formulieren könnte: Die Schärfe der auditiven Wahrnehmung ist umgekehrt proportional der Schärfe der zeitlichen Wahrnehmung. Dies läßt sich auch mittels einer einfachen Energieüber­tragung erklären. Wir wissen z. B., daß die visuelle Wahrneh­mung (Film, Fernsehen) soviel Energie verbraucht, daß man die Lautstärke steigern muß, um eine ausreichende Höremp­findung zu erreichen. Wir sind hier weit vom Ziel entfernt, wie sie die Musiker des 20. Jahrhunderts strukturierten. Innerhalb dieser Struk­turen erscheint die Zeit wie eine Gerade, die, bestimmten Proportionen folgend, unterteilt ist; der Hörer befindet sich demnach in der Mitte dieser Linie miteinbegriffen. Um verständlich zu machen, worum es geht, hätte ich nur die von Olivier Messiaen zwischen umkehrbaren und nichtumkehrbaren Tonlängen aufgestellten Unterscheidungen zu zitieren, zudem jene von Pierre Boulez zwischen symmetrischen und asymmetrischen Tonlängen. Diese statische und räumliche Vision der Zeit ist eine reine Abstraktion, eine Methode der Kompositon, die auf der Ebene der unmittelbaren Wahrneh­mung keinerlei Realität besitzt. Einem Musikwerk gegenüber sind wir nämlich nicht, wie etwa in einem Raum gegenüber, passiver Beobachter auf einem unbeweglichen Punkt. Der Standpunkt der Wahrneh­mung ist im Gegenteil seinerseits ständig in Bewegung, da es sich ja um die Gegenwart handelt. Ich vermute im übrigen, daß wir die Zeit eines Musikwerkes von einer anderen Zeit aus erfahren, die der Rhythmus unseres Lebens ist. Es muß demnach so etwas wie eine Perspektive existieren, eine Fluchtlinie, die die Klänge deformiert, je nachdem, wie diese sich unserem Gedächtnis einprägen. Zu der Zeit-Klang-Dynamik, die wir beschrieben haben, kommt diejenige, die durch die Beziehungen verwirkt wird, die zwischen der psychophysiologischen Zeit des Hörers (seinem Herzrhythmus, seinem Atemrhythmus, seiner Ermüdung im Augenblick des Hörens) und der mechanischen Zeit des Klanges bestehen, der ihn wie eine Art Fruchtwasser umgibt. Zwischen den verschiedenen Zeitebenen gibt es ab und zu Gänge, offene Stellen, die zusammenfallen, verklärte Augen­blicke, in denen uns der Klang bis zur Ekstase erfüllt, da er zu einem gegebenen Zeitpunkt genau die «Menge» ist, die unsere «Leere» erwartete, oder aber genau die «Leere», nach der unser von physiologischen Rhythmen gesättigter Körper trachtete. Messias Ich bin kein Messias, falls Sie es noch nicht bemerkt haben. Es wäre auch zu sagen, daß wir in den letzten Jahren die Gelegenheit hatten, eine reiche, sorgfältig gesammelte und sortierte Ernte einzubringen. Was mir im Gegenteil sehr, sehr wichtig erscheint, ist, daß die Beobachtungen und Untersuchungen, die ich mich hier zu formulieren bemühe, auch von anderen Komponisten meiner Generation hätten ausgedrückt werden können. Es scheint mir in diesem Moment die Gegenrichtung von dem zu beginnen, was man vor einigen Jahren als Auseinandersplittern der Stile und Ästhetiken beschrieb; wir nehmen teil an der Bildung vielleicht nicht etikettierbarer Gruppen, zumindest jedoch am sehr fruchtbaren Austausch zwischen verschiedenen Kompo­nisten. Ich möchte hier besonders eine Art Kollektiv im musikalischen Denken aufzeigen, das sich um das «Ensemble de l’Itinéraire» bildete, und das so verschiedene Komponisten einbezieht wie Tristan Murail, H. Dufourt, J. P. Ostendorf und mich. Sehr nahe dieser Tendenz befinden sich Kompo­nisten, die die Synthese des Klangs mit dem Computer anstreben: am IRCAM J. C. Risset und D. Wessel oder in Stanfort J. Chowning. Ich bedauere, nicht die Zeit zu haben, um Ihnen solche Partituren wie Mémoire-Erosion von T. Murail, L’orage d’après Giorgione von H. Dufourt, Solo für Orchester von J. P. Ostendorf, Y Ahora vamos por aqui von M. Maiguashca vorführen zu können, Partituren, bei denen der musikalische Unterschied nur zu offensichtlich ist, die aber dieselbe Bemü­hung in der Ausarbeitung der Sprache zeigen, die von der inneren Struktur des Klangs ausgeht. Wir haben gemeinsam das gleiche Mißtrauen gegenüber der Abstraktion, dasselbe Augenmerk auf die unmittelbare Wahrnehmung, dieselbe Suche nach der als letzter Schritt einer inneren verborgenen Komplexität zu Tage tretenden Ein­fachheit und oft dasselbe Material, das sich aus der Anwen­dung der Erfahrung des elektronischen Tonstudios und der akustischen Forschung in der Instrumentalmusik ergibt. Vortrag, gehalten bei den Darmstädter Ferienkursen für Neue Musik 1978. Abgedruckt in: Darmstädter Beiträge zur Neuen Musik Bd. XVII, S. 73-79, Mainz 1979. Gérad Grisey: Die Entstehung des Klangs, in: Katalog Wien Modern 2000, hrsg. von Berno Odo Polzer und Thomas Schäfer, Saarbrücken: Pfau 2000, S. 122-125.