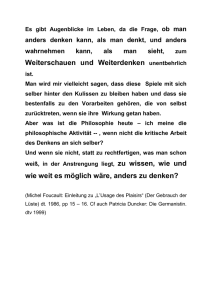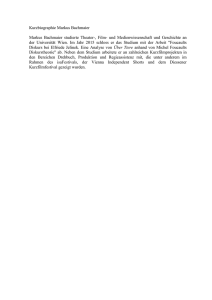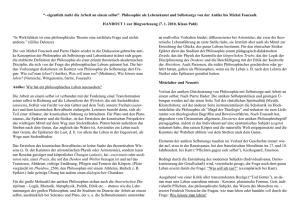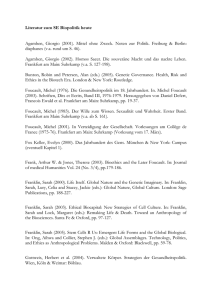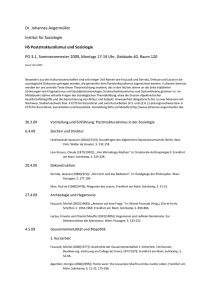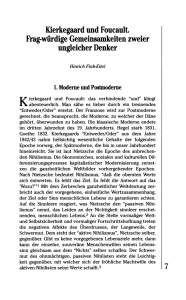Abstract drucken
Werbung

Bernd Goebel: Michel Foucaults Monologe Sic et Non. Politische Philosophie. (www.sicetnon.org) Rezension Michel Foucaults Monologe Fernando Suárez Müller: Skepsis und Geschichte. Das Werk Michel Foucaults im Lichte des absoluten Idealismus [BERND GOEBEL] Fernando Suárez Müller, Skepsis und Geschichte. Das Werk Michel Foucaults im Lichte des absoluten Idealismus. Würzburg (Königshausen & Neumann) 2004, 726 S., ISBN 3-8260-2780-9, € 75,-. Abstract: Die imposante Studie von Suárez Müller versucht das scheinbar Unmögliche, eine systematische Gesamtdarstellung des Werkes von Michel Foucault. Sie will zugleich die philosophische Bedeutung Foucaults aufweisen. Dessen Ansatz wird als radikaler Skeptizismus bestimmt. Foucaults Geschichtsphilosophie und Literaturtheorie stünden ebenso im Zeichen dieses radikalen Skeptizismus wie sein Politischer Aktivismus und seine Ethik. Konsequenter als verwandte Positionen postmoderner Denker, sei dieser Skeptizismus doch nicht radikal genug, weil er nicht auf sich selbst angewandt werde. Dieser Mangel an Konsequenz führe bei Foucault zur Ironisierung der eigenen Position und zu einer undialogischen Grundhaltung. Seine Einsichten ließen sich indes in einer erneuerten idealistischen Philosophie aufheben. Mit einer revisionistischen Genealogie kombiniert, ermögliche Foucaults Archäologie den Entwurf einer alternativen Geschichtstheorie, die Transformationen nicht machttheoretisch nach dem Modell des Kampfes, sondern als dialogische Prozesse erklärt. In engem Bezug auf Foucault - und diesem zum Trotz - wird eine solche dialektische Deutung der abendländischen Kultur im Durchgang durch ihre sämtlichen Konstellationen entwickelt. Kaum ein Denker übt gegenwärtig in der nicht-analytischen Philosophie und generell in den Geistes- und Sozialwissenschaften einen derart großen Einfluss aus wie Michel Foucault, einer der international meistgelesenen und meistkommentierten Philosophen der jüngeren Vergangenheit. Veröffentlichungen über Foucault oder in seinem Geiste scheinen wie Pilze aus dem Boden zu schießen; die sukzessive Publikation des Nachlasses ist angesichts seiner Popularität ein für philosophische Verhältnisse großes Geschäft. Und dennoch trifft die Diagnose eines der immer zahlreicheren Biographen nach wie vor zu, dass von Analysen, die "Foucaults Äußerungen in einen größeren philosophischen Kontext" einordnen, "kaum die Rede" sein kann (B. Taureck, Michel Foucault, Hamburg, Rowohlt 1997, 133). Implizite Systematik Die sehr umfangreiche, um nicht zu sagen monumentale Studie des spanisch-niederländischen Verf. - sie Sic et Non. Zeitschrift für Philosophie und Kultur. Im Netz. #6 2006 Bernd Goebel: Michel Foucaults Monologe verdient eine eingehendere Besprechung - setzt sich nichts Geringeres zum Ziel als eine Rekonstruktion von Foucaults gesamtem Werk in seinem systematischen Zusammenhang; eine Rekonstruktion, die zugleich dessen eminente philosophische Bedeutung aufzeigen soll. Dass sich jener systematische Zusammenhang tatsächlich herstellen lässt, ist selbst eine der Hauptthesen von S., da es Foucault, von wenigen verstreuten Äußerungen abgesehen, unterlassen hat, einen solchen herzustellen. Vielmehr war für Foucault wie für Nietzsche "die ganze Idee eines Systems vielleicht ein Anathema" (30), und dementsprechend hätten viele Anhänger die Brüche in seinem Denken nicht nur hervorgekehrt, sondern regelrecht gefeiert. Ja, Foucault habe sich sogar von der Philosophie distanziert und "gemeint, er sei kein Philosoph". (40) Des ungeachtet existiere in seinem Werk eine "implizite Systematik" (30) und trete in ihm eine ganz bestimmte, pointierte philosophische Position hervor. Die verschiedenen Perioden seines Denkwegs mit ihren, wie Foucault sich ausdrückte, déplacements im Vergleich zu früheren Phasen würden missdeutet, wenn man in ihnen Neuanfänge oder Brüche zu erkennen glaube. Vielmehr handele es sich - die frühen Schriften zur Psychologiegeschichte aus den 50er Jahren ausgenommen - um "komplementäre Weiterentwicklungen einer feststehenden Grundüberzeugung" (39, vgl. 118f.). Radikale Skepsis Diese Grundüberzeugung besteht S. zufolge in einem radikalen Skeptizismus, für den es kein objektives Wissen geben kann. Es ließe sich in Foucault eine Art postmoderner Protagoras redivivus (vgl. 27) sehen. Weil der Postmodernismus als die "letzte Evolution des modernen Skeptizismus" (35) gelten könne, dürfe man Foucault zu Recht als postmodernistischen Denker bezeichnen, obwohl er sich dieser Bezeichnung entschieden widersetzt habe. Letzteres habe seinen Grund darin, dass ihm "etwas noch radikaleres vor Augen" stehe (37) als die von anderen Ikonen der Postmoderne entwickelten Philosophien. Foucault wolle das Philosophieren in der Nachfolge Heideggers und Nietzsches auch noch von seinen letzten metaphysischen und rationalistischen Resten reinigen; dadurch erscheine er als Vollender des gegen die Vernunft gerichteten Programms des Postmodernismus, als wichtigster der Postmodernisten. Während etwa Derridas vernunftmörderisches Denken noch mit der metaphysischen Tradition spiele, an der negativ-theologischen Überlieferung parasitiere und insofern nach Foucault noch voraussetze, was es zu dekonstruieren beabsichtige, habe es für diesen eine einheitliche Geschichte des Logos schlicht nie gegeben. Er plädiere nicht für eine Abschaffung der Vernunft, sondern negiere sie ganz und gar. Noch offensichtlicher werde die dem Foucaultschen Ansatz eigene Gründlichkeit im Vergleich mit Rorty, dessen "inkonsequent antithetisches Denken" Foucault durch eine "viel konsequentere, anspruchsvollere und radikalere Antithese völlig in den Schatten stellt." (74, Anm.) Metamorphose der Postmoderne Die Rekonstruktion des Werkes Foucaults durch den Verf. will ferner kritisch sein. Jede ernst gemeinte Kritik benötigt Maßstäbe, die für wahr gehalten werden (vom Kritiker oder zumindest von seinem Publikum). Dessen ist sich der Verf. bewusst und bezieht in der Auseinandersetzung mit Foucault ausdrücklich eine philosophische Position. Seine Foucaultstudie versteht er als eine Art philosophischen Kommentar; ohne die Entwicklung einer eigenen Position könne eine Rekonstruktion aber nicht dialogisch und folglich kein echter Kommentar sein. Dabei soll S.' eigener Ansatz gerade im Dialog mit dem Foucaultschen Denken Kontur gewinnen. Bei dieser vom Verf. verteidigten Position handelt es sich um "eine Philosophie der Intersubjektivität, Sic et Non. Zeitschrift für Philosophie und Kultur. Im Netz. #6 2006 Bernd Goebel: Michel Foucaults Monologe die aus dem Dialog das Fundament einer neuen idealistischen Metaphysik macht" (26). Gemeint ist ein absoluter Idealismus, der sich in der Tradition Platons und Hegels weiß, obwohl er eigene Akzente setzt: "es geht hier vor allem darum, den Wert Foucaults für die Erneuerung der absolut-idealistischen Philosophie zu bestimmen." (25) Es sei zwar nicht von der Hand zu weisen, dass Platon und Hegel von den postmodernen Denkern als ihre Antipoden erachtet wurden und dass insbesondere Foucault die Philosophie ausdrücklich als Destruktion des Platonismus konzipierte (59), dass er das Ziel ausgab, sich darüber Rechenschaft zu geben "comment n'être pas du tout hégélien" (61, Anm.). Indes erscheine ein solcher Idealismus dem Skeptizismus bei genauerem Hinsehen keineswegs diametral entgegengesetzt, sondern als dessen "radikalere und selbstreflexive Fortsetzung". (26) In diesem Sinne soll der Foucaultsche Ansatz in den vom Verf. vertretenen "aufgehoben" werden, der sich dadurch als die "notwendige und rechtmäßige Erb- und Nachfolge des Postmodernismus" erweisen würde, Foucaults Denken aber als "Bote eines Übergangs zum Idealismus, dessen Konturen heute allmählich hervortreten". (ebd.) Das betreffe sowohl Foucaults Bestimmung der Philosophie als auch seine Geschichtstheorie. Der erneuerte absolute Idealismus gründet bei S. in einer Theorie des kommunikativen Handelns. In engem, wiewohl betont kritischem Anschluss an Apel und Hösle zeichnet S. (mit Vorliebe in "Anmerkungen" genannten systematischen Zwischenkapiteln) die Grundlinien seiner synthetischen Philosophie, wobei er sich "aufs Nötigste beschränkt" (30). Dennoch wird deutlich, was ihm vorschwebt. Jedes Denken, und a fortiori jedes kommunikative Handeln weise immer schon eine dialogische Struktur auf. Um ihr gerecht zu werden, müsse man die eigenen Position geltungstheoretisch verantworten, d.h. sie gegen jede denkbare Kritik sichern. Konsequent dialogisch sei daher allein die "Position des absoluten Selbstbegründers" (50), der sich jener geltungstheoretischen Verantwortung niemals entzieht, der sich selbst und seinem Gegenüber bis zuletzt Rechenschaft zu geben bereit ist. Derart radikale Selbstbegründungsversuche hätten im 20. Jh. vor allem Husserl und Apel vorgelegt. Dagegen sei der in bloßer Antithese verharrende Typus des postmodernen Denkers ein im Grunde "undialogischer Mensch". (49) In der Tat dürfe ein konsequenter Skeptizismus nicht die geltungstheoretische Perspektive einnehmen, dürfe keine philosophische Begründung der eigenen Position anvisieren, weil er sich so selbst widerlegen würde; er dürfe mit anderen Worten gar nicht dialogisch auftreten. Damit geriete er aber in eine Art skeptischen Solipsismus, der sich in der Praxis nicht durchhalten lasse. Wie andere postmodernistische Denker habe auch Foucault aus dieser Not eine Tugend gemacht und sich als "Held des unaufhebbaren Selbstwiderspruchs" verstanden. Zugleich wiesen sein öffentliches Auftreten und Werk einen stark monologischen Charakter auf; bezeichnenderweise habe Foucault auch im Umgang mit Freunden zum Monologisieren geneigt. Aber auch wenn man wie Foucault den Wissensanspruch aufgibt und darauf beharrt, nur eine Meinung zu verbreiten, so erhebe das Gemeinte doch immer einen Wahrheitsanspruch. Deshalb gebe es vor der Geltungsfrage kein Entkommen: "Weigert man sich, die eigenen Geltungsansprüche zu prüfen, dann werden andere es tun." (48) S.' Studie zum Focaultschen Oeuvre berücksichtigt neben den publizierten Schriften auch - so weit zugänglich - die nachgelassenen Aufzeichnungen, die Tonbandaufnahmen der Vorlesungen sowie eine Fülle an Sekundärliteratur in englischer, französischer, deutscher, spanischer, italienischer, portugiesischer und niederländischer Sprache; in den maßvoll eingesetzten Fußnoten werden viele dieser Arbeiten kommentiert, wobei der Verf. nicht vor deutlichen Wertungen zurückschreckt. Seine eigene Arbeit gliedert sich in drei Teile, deren letztere eng zusammenhängen (so dass ebenso eine Zweiteilung in Frage gekommen wäre). Der erste Teil Sic et Non. Zeitschrift für Philosophie und Kultur. Im Netz. #6 2006 Bernd Goebel: Michel Foucaults Monologe ist der Philosophie und Geschichtstheorie gewidmet; der zweite und dritte ist eine zur dialektischen Geistesgeschichte gestaltete Geschichte der Konstellationen. Wesentliche methodische und inhaltliche Einsichten Foucaults aufgreifend, bietet sie zugleich einen sehr eigenständigen Gegenentwurf. Stringent durchdachter Skeptizismus Der erste, systematische Teil umfasst wiederum drei Kapitel. Im ersten und ausführlichsten will der Verf. eine "Bestimmung der Philosophie" Foucaults vorlegen. Dabei ist es ihm vor allem darum zu tun ist, die spannungsvolle Einheit von fundamentalem Skeptizismus und Kritischer Theorie im Denken des Franzosen aufzuzeigen. Ein radikaler Zweifel jedem allgemeinen Geltungsanspruch gegenüber, der anders als bei Descartes nicht methodisch gemeint ist, charakterisiere Foucaults Denken von Anfang an. Philosophieren heiße für ihn wesentlich, Gewissheiten zu zerstören. Als konsequenter Skeptiker habe er nie den Versuch unternommen, seine Position zu begründen. Dennoch habe er sie zu rechtfertigen versucht - S. unterscheidet zwischen einer geltungstheoretischen Begründung und einer genealogischen Legitimation -, und zwar in zweifacher Hinsicht: zum einen als historisch bedingt und insofern zeitgemäß, zum anderen als das auf einer rein subjektiven Entscheidung beruhende Votum für ein dynamisches, sich stets erneuerndes Denken, das alle Normen sprengt, vor allem die moralischen. Die "stringent durchdachte skeptische Einstellung" (80) äußert sich nach S. in vier Bestimmungen des Foucaultschen Denkens: in seiner radikalen Antimetaphysik, seinem Antihumanismus, seiner nominalistischen Sprachtheorie und in seiner historistischen Auflösung eines objektiven Wahrheitsbegriffs. Seine radikale Antimetaphysik zeige sich darin, dass die ganze Philosophie der Moderne seines Erachtens noch auf idealistischen Voraussetzungen aufbaue, ja in weiten Teilen eine bloße Säkularisierung platonisch-christlicher Überlieferungen darstelle. Dies gelte vom Denkstil der Klassik mit ihrer Schlüsselkategorie der "Repräsentation" ebenso wie von Nietzsches Metaphysik der Macht und seiner Rede von der ewigen Wiederkehr. In Husserl und Sartre erkenne er die letzten Vertreter dieser Art des Philosophierens, da sie einer Bewusstseinsphilosophie das Wort redeten, welche noch an einer "von Geschichte und Sprache unabhängigen Dimension der Wahrheit, der Geltung und der Bedeutung festhält". (59) Als Folge jener streng antimetaphysischen Einstellung ergebe sich Foucaults Antihumanismus, eine seiner umstrittensten Auffassungen. Weil es für ihn "keine objektive innere Identität des Menschen", kein Wesen des Menschen gebe - allenfalls als Ideen einer disziplinierenden und normalisierenden Macht -, verliere auch der Gedanke universeller Menschenrechte seine Berechtigung. Das Ziel der Moderne, die säkularisierte Befreiungsideologie der Emanzipationsbewegungen, entbehre einer objektiven Grundlage, gebe sich als bloßes, Ideologien übergreifendes Herrschaftsmittel zu erkennen. Die moderne Kategorie des Menschen - und mit ihr die moderne Gestalt der Humanwissenschaft - sei für Foucault immer noch dem von Kant konzipierten empirisch-transzendenten Doppelbegriff eines infini actuel verpflichtet. Gleiches gelte für die modernen, atheologischen Programme des Humanismus wie den Marxismus und Positivismus; Foucault erblicke in ihnen nur säkularisierte Erscheinungsformen des alten transzendentalen Idealismus. Mit dem Spruch vom "Tode des Menschen" wolle er darauf aufmerksam machen, dass dieses Menschenbild obsolet sei. "Der transzendentale Rest soll der Vorstellung [vom] Menschen radikal entzogen werden." (66) Foucaults Sprachtheorie sei in ihrem radikalen Nominalismus Blanchots Sprachnihilismus verpflichtet, dessen metaphysische Dimensionen von Foucault jedoch nicht aufgegriffen würden. Denken und Bedeutung Sic et Non. Zeitschrift für Philosophie und Kultur. Im Netz. #6 2006 Bernd Goebel: Michel Foucaults Monologe seien danach nur Illusionen und Fiktionen, die innerhalb der Sprache produziert werden, die Sprache selbst am besten als ein "identitätsloses Gemurmel" aufzufassen. (71) - Es liege in der Konsequenz all dieser Auffassungen, dass Foucault die Wahrheit als "historisch-bedingte Form" (74) denkt, deren Anspruch auf Objektivität und Universalität uneinlösbar bleibe. Seine Kulturgeschichte sei der groß angelegte Versuch, das Wissen und die Wahrheit radikal zu historisieren. Erkenntnis sei immer das Produkt historischen Zufalls und Ergebnis eines Kampfes; denn wahr oder falsch könnten Überzeugungen nur innerhalb eines zufällig entstandenen Denksystems sein (welches selber weder wahr noch falsch sein könne). Dies betreffe die Philosophie, die Geistesund die Naturwissenschaften gleichermaßen. Dadurch reduziere Foucault die innere Geltungsdimension der Wahrheit auf deren äußere Genesis. Aus diesem Grunde könne er die Kulturgeschichte auch nicht als dialogischen Prozess betrachten. Was dies für den Anspruch auf Wahrheit seines eigenen Denkens - etwa den seiner historischen Beschreibungen - bedeutet, habe Foucault als konsequenter Skeptiker nie philosophisch zu klären versucht; vielmehr habe er seine eigenen Untersuchungen relativiert, sie gar als Romane und Fiktionen präsentiert. S. legt also eine radikale Interpretation der Foucaultschen Philosophie vor: „Foucault ist derjenige, der die antithetischen Ansätze Nietzsches, Wittgensteins und Heideggers auf einheitliche Weise radikalisiert hat.“ (140) In einer Reihe von Fußnoten nimmt er deshalb Foucault vor seinen eigenen Anhängern und Interpreten in Schutz, wenn er glaubt, dass sie den kompromisslosen Charakter seines Denkens verwässern wollen, oder wenn sie Foucault allzu schnell einen Mangel an Konsequenz vorwerfen: gegen Manfred Frank, der bei Foucault nicht post-, sondern vormoderne Züge diagnostiziert; gegen Gary Gutting, der seinen universellen Skeptizismus herunterspiele; gegen Wilhelm Schmid, der Foucault zum Aufklärungsdenken rechne, weil er nicht sehe, dass Foucault den Begriff der Vernunft sprenge; gegen Rajchman, der gleichfalls die antirationalistische Seite Foucaults beschönige; gegen Jean Baudrillard, der ihm vorwirft, keine Rhetorik anzuwenden und damit nicht radikal genug den Glauben an Normativität und Wahrheit anzugehen, "obgleich nicht deutlich wird, wie dieser Glaube denn auf radikalere Weise zerstört werden kann." (91, Anm.) Kritische Theorie - im Zeichen des Skeptizismus Foucault verbinde nun, was alles andere als selbstverständlich sei, seinen fundamentalen Skeptizismus und Antiuniversalismus mit einer Kritischen Theorie. Eine anspruchsvolle Kulturkritik sei sogar der zentrale Teil seiner Philosophie. Sein Antihumanismus verbiete, dass diese Kritik im Namen des Menschen vorgetragen werde. Sie solle zeigen, dass nicht nur einige Selbstverständlichkeiten willkürlich sind, sondern auch tief verankerte Überzeugungen der Moderne und gerade auch humanistisch oder philanthropisch legitimierte Kulturgestalten (die häufig als Kontrollverhältnisse entlarvt würden), ja dass es schließlich überhaupt keine Wahrheiten oder Evidenzen gebe. Die Kritik sei somit rein negativ; Foucault sehe konsequent davon ab, mögliche Alternativen aufzuzeigen. "Ihr einziger Zweck ist die Zerstörung universalistischer und insbesondere humanistischer Vorstellungen. [...] Seine gesellschaftskritische Wachsamkeit steht also nicht im Dienste der Menschheit, sondern im Dienste der Skepsis." (93f.) Die historistische Kritik Foucaults ist in den Augen des Verf. formal in doppelter Hinsicht problematisch. Zum einen versuche sie, vergangene und gegenwärtige Praktiken und Überzeugungen geltungstheoretisch zu ruinieren, beschreibe jedoch nur die Genesis der kulturellen Formen. "Sie lebt aus einer Verwirrung von Genesis und Geltung." (82) Denn eine jede Praxis und Überzeugung habe ja ihre Entstehungsgeschichte; ihre Geltung im Sic et Non. Zeitschrift für Philosophie und Kultur. Im Netz. #6 2006 Bernd Goebel: Michel Foucaults Monologe Sinne ihrer Wahrheit und Richtigkeit könne man nur bestreiten, wenn man selbst über geltungstheoretisch gesicherte Kriterien verfüge. Zum anderen besitze die kritische Theorie Foucaults selbst eine - wenn auch latente, vorreflexive - normative Grundlage. Worin diese bestehe, offenbare am ehesten die Analyse seiner Ethik und seines politischen Aktivismus (s.u.). Im Vordergrund der kritischen Dimension des Foucaultschen Werks stehe die Kritik der Macht; darum geht S. recht ausführlich (100-116) auf seine Machttheorie ein. Wahrheiten gebe es nach Foucault nur innerhalb eines bestimmten kulturellen Sprachspiels, eines bestimmten "Wahrheitsregimes". In solchen von unbewussten Gesetzen, Regeln und Kategorien bestimmten, relativ stabilen Systemen sehe er in der Hauptsache Machtformen. Die fragliche Macht betrachte Foucault allerdings nicht als Besitz von herrschenden Subjekten, sondern als "zufällige Konstruktion eines unaufhörlichen Kampfes" (102). Die Macht selbst sei eine bataille perpétuelle. Ein kurzer Vergleich der Machttheorien von Focault und Habermas bringt neben wesentlichen Unterschieden auch Gemeinsamkeiten zu Tage: Für Foucault bewirkten Kampfbeziehungen die Transformation der Kultur, für Habermas hingegen kommunikative Prozesse die Reproduktion der Lebenswelt; sie zeichneten also jeweils unterschiedliche soziale Mechanismen aus. Die kritischen Ansätze beider kämen gleichwohl darin überein, dass sie einer philosophischen Begründung entbehren, sich vielmehr auf soziologische und funktionalistische Rechtfertigungen stützen. Was Foucault angeht, so wolle er mit dem Kriegsmodell zur Erklärung der Kulturentwicklung das traditionelle Vernunftmodell ersetzen. Es sei jedoch fraglich, ob wirklich der Kampf allein die Kulturentwicklung hinreichend erklären kann. Aber selbst wenn dem tatsächlich so wäre, gibt S. zu bedenken, ließe sich in der Kulturgeschichte immer noch eine vernünftige Entwicklung ausmachen; denn der Kampf setze keineswegs nur strategische oder instrumentelle Rationalität voraus, sondern auch und sogar in erster Linie "ein reflexives oder dialogisches Vermögen" (113). Der Kampf als Motor des kulturellen Wandels werde angemessener als Kollision von Denkinhalten begriffen. Dadurch erweise sich aber "das lebendige Denken, das heißt der Dialog" als der grundlegendere Mechanismus der Transformation: "Der Kampf wird somit selbst eine Form der Vernunft. Er wäre nicht so sehr ein dialogus interruptus als vielmehr eine Fortsetzung des Dialogs mit primitiveren Mitteln." (172f.) In seinen empirischen Beschreibungen konkreter Machtformen (denen er zu einem großen Teil seine Bekanntheit verdankt) analysiere Foucault das Phänomen Macht auf zwei Ebenen. Auf der makrophysischen Ebene untersuche er die charakteristische Herrschaftsstruktur einer bestimmten Kulturepoche; auf der mikrophysischen Ebene nehme er konkrete institutionelle Gewaltbeziehungen in den Blick, wobei sein besonderes Interesse repressiven Techniken (wie Exklusion oder Integration) und Institutionen (wie Gefängnissen oder psychiatrischen Einrichtungen) gelte, insofern sie - direkt oder indirekt - auf den Körper einwirken. Geschichtstheorie im Zeichen des Skeptizismus Das zweite Kapitel des ersten Teils der Arbeit von S. ist der Geschichtstheorie Foucaults gewidmet, seinem "wichtigsten Mittel einer skeptischen Zerstörung des Überhistorischen und Universellen" (117) und kulturkritischem Instrument par excellence. Foucaults Geschichtstheorie soll wiederum systematisch dargestellt werden. Die drei Perioden, in die sein Werk von seinen Kommentatoren in der Regel eingeteilt wird - die wissensanalytische der 60er, die machtanalytische der 70er und die ethische der 80er Jahre - seien in Wahrheit drei Denkphasen, die "innerlich notwendig zusammenhängen", die "innere Entwicklung einer einheitlichen Sic et Non. Zeitschrift für Philosophie und Kultur. Im Netz. #6 2006 Bernd Goebel: Michel Foucaults Monologe Geschichtstheorie". (118f.) Foucault lege ihr zwei Methoden zugrunde: die archäologische und die genealogische; Archäologie und Genealogie ließen sich aber am besten verstehen als "zwei Aspekte einer einzigen skeptischhistoristischen Methode"; eine Methode, die "nur eines beabsichtigt: die Zerstörung jedes Universalanspruches" (122). Die Genealogie sei eine diachrone Betrachtungsweise; sie analysiere die Herkunft von Wissensformen, institutionellen Praktiken und Verhaltensformen durch verschiedene Kulturepochen hindurch. Die Archäologie sei eine synchrone Betrachtungsweise; sie rekonstruiert aus unterschiedlichen Daten ein real existierendes Denksystem, eine "Rationalität". Mit diesem Ausdruck beziehe sich Foucault auf Wissens-, Macht- und Verhaltensformen, den drei Domänen seines histoire de la pensée genannten Projekts. Sind bestimmte Wissensformen gemeint, nenne er jene Systeme oder Rationalitäten auch "Episteme" (oder "Wahrheitsregime"); sind bestimmte Machtformen gemeint, spreche er auch von "Dispositiven der Macht" oder "Herrschaftsstrukturen". Warum es auf eine Untersuchung gerade jener drei Bereiche - und keiner anderen ankomme, sei eine Frage, die sich Foucault zwar nie gestellt habe; eine "Metaphysik des Dialogs" (161), wie sie der Verf. geltend machen würde, hätte ihn jedoch auf dieselbe Triade gestoßen. Unter Verweis auf eine gewisse Unschärfe der Begriffe der Archäologie und Genealogie bei Foucault greift S. eine alternative Terminologie (die er bei diesem selbst findet) auf und spricht statt von Archäologie von "Analytik"; die Genealogie nennt er "Herkunftsanalyse". Was deren Gegenstände angeht, so habe Foucault zum Begriff der Rationalität bzw. des Denksystems wegen ihrer bewusstseinsphilosophischen Anleihen immer Alternativen gesucht. Von diesen erscheint dem Verf. der Ausdruck "Konstellation" am passendsten. Die Regeln oder Gesetze der historischen Konstellationen zu bestimmen sei die Aufgabe der Analytik. Unter solchen "Regeln" verstehe Foucault zumeist Grundbegriffe, weshalb S. den Ausdruck "Kategorien" bevorzugt, während Foucault selbst dieses Wort wegen der Assoziation transzendentaler Begriffe im Sinne Kants vermieden habe. Die Herkunftsgeschichte solle die Transformation solcher Regelsysteme einerseits beschreiben, andererseits erklären - und zwar als ein rein kontingentes Geschehen, als Ergebnis von gedankenlosen Kämpfen: "Statt einer Innenperspektive, die den Kampf mit einem Denkinhalt verbindet, nimmt Foucault eine Außenperspektive ein, die den Denkinhalt und dessen Geltungsanspruch ausklammert." (170) Wie bereits Nietzsche, von dem er den Ausdruck "Genealogie" übernehme, stelle Foucault damit die an der Geltung orientierte Geschichtsauffassung Hegels auf den Kopf ("Wo etwas hergekommen ist, das ist vollkommen gleichgültig; die Frage ist nur: ist es wahr an und für sich?", Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, Werke XII, 400). Eine so verfahrende Geschichtstheorie sei nicht nur Foucaults schärfste Waffe in seinem skeptischen Feldzug gegen den Mythos der objektiven Vernunft, sie stehe auch ihrerseits im Zeichen seines Skeptizismus. Am Anfang seiner geschichtstheoretischen Überlegungen finde nämlich eine Art begriffliche Selbstreinigung statt: Alle vorgefassten Begriffe sollten suspendiert werden, damit der Gegenstand der Untersuchungen ohne fremde Zutaten in seiner empirischen Reinheit hervortreten könne. Und hier stößt man nach S. auf eines der zentralen Probleme der Foucaultschen Philosophie. (127) Denn natürlich sei eine vollkommene begriffliche Neutralität nicht möglich, weil jede Wahrnehmung, jede Erkenntnis immer schon durch einen hermeneutischen Horizont bestimmt werde. Nun sei sich Foucault über die Aporien eines Positivismus und naiven Empirismus und damit der Unmöglichkeit seines Unternehmens - vollkommen im Klaren. Er relativiere die Problematik durch ein ironisches Selbstverständnis, indem er seinen Standpunkt im Zuge einer bewussten Selbsttäuschung als einen "fröhlichen Positivismus" bezeichnet. "Foucault tut so, als ob er einen unmittelbaren Zugang zur Realität hat und weiß doch, dass dieser Zugang immer schon begrifflich vermittelt ist." (128) Dies lasse die kritische Intention seiner Geschichtstheorie aber kraftlos erscheinen. Die wahre Alternative zum Gebrauch Sic et Non. Zeitschrift für Philosophie und Kultur. Im Netz. #6 2006 Bernd Goebel: Michel Foucaults Monologe irreflexiver Begriffe sei der Versuch, die eigene Begrifflichkeit reflexiv zu begründen. Im Zuge einer radikalisierten Hermeneutik wäre auch der eigene kategoriale Rahmen in Frage zu stellen, jedoch nicht in toto, weil dies nicht möglich sei, sondern Schritt für Schritt. Foucault nehme derweil diesen ironischen Positivismus zur Grundlage für eine strukturalistische Geschichtsmethodologie. Die Ausklammerung aller vorgefassten Begriffe hinterließe eine unbestimmte Vielfalt von Diskursen oder Dokumenten. Daraus ließen sich über Umwege die Kategorien und allgemeinen Gesetze rekonstruieren, welche die Produktion von Bedeutungseinheiten (énoncés) regieren, die verborgene Grammatik der „Rationalität“ einer bestimmten Kulturepoche. Als Skeptiker habe Foucault davon abgesehen, seine Methode zu begründen; eine solche Begründung hätte nach S. lauten können, dass die énoncés „deshalb in [der] Form eines von Regeln bestimmten Denksystems rekonstruiert werden müssen, weil man, wenn man mit Kulturgestalten oder Dokumenten in einen Dialog tritt, notwendig eine bestimmte Rationalität und Logik bei diesen [...] voraussetzen muss“. (130) Die strukturalistische Methode der Foucaultschen Geschichtstheorie sei für zwei ihrer augenfälligsten Merkmale verantwortlich: ihren Anti-Mentalismus sowie ihre Diskontinuitätsthese. Unter dem Titel „Radikale Antibewusstseinsgeschichte“ verfolgt S. den Versuch Foucaults, subjektphilosophische Kategorien aus seiner eigentümlichen Historiographie so weit wie möglich zu verbannen. Alle Kategorien, die uns glauben machen, dass Vernunft in der Geschichte am Werk sei („Bewusstsein“, „Einfluss“, „Tradition“ usw.), würden ausgeklammert, wenn auch terminologisch ohne letzte Konsequenz (vgl. histoire de la pensée, conscience moderne, rationalité). Lineare Kausalerklärungen lehne er genauso ab wie jede Teleologie; deshalb fühle er sich dem Projekt einer Geschichte des Alltags der Annales-Schule verbunden. Foucault gehe dabei so weit, dass er sich vornimmt, jeden Bezug auf denkende Subjekte außer Betracht zu lassen. Die Regeln der Grammatik, welche eine besondere Rationalität ausmacht, blieben den Bewohnern jener Kulturepoche unbewusst. Diskurse nenne Foucault deshalb gerne événements. „Weder die Geschichte noch die Kultur sind Entäußerungen des Geistes.“ (133) Seine These von der radikalen Diskontinuität der Kulturgeschichte habe Foucault mit Bildern veranschaulicht: Der Gang der Geschichte sei weder linear noch zyklisch, sondern den brüsken Bewegungen in einem Kaleidoskop vergleichbar, eine Abfolge unzusammenhängender Inseln, in den Worten des Verf. ein „Saltationismus ohne Evolution“ (136). Dem entspreche, dass Foucaults Systembegriff statisch, geradezu monolithisch sei. Neben dem Humanismus sei nach Foucault vor allem das Ursprungsdenken in all seinen Gestalten zu überwinden; weder Ursprünge noch Abschlüsse irgendwelcher Art würden von ihm anerkannt, die Vorstellungen von Fortschritten oder Rückschritten müssten restlos aufgegeben werden. So gelange er zu einer „relativistischen Kultur- und Wissenschaftsgeschichte, die weit radikaler ist, als diejenigen, die im angelsächsischen Bereich entworfen werden. Nicht Kuhn, nicht Feyerabend, sondern Foucault hat als erster eine konsistente, relativistische Geschichte der Wissenschaften hervorgebracht.“ (126) In der Transformation der Systeme erblicke er das zufällige Resultat einer prinzipiell unüberschaubaren Pluralität von Kräften. Darum habe er sich auch nie auf kulturhistorische Prognosen eingelassen. Die Kategorie der Diskontinuität (oder der rupture) wurzele in einem „von Anfang an dogmatisch aufgestellten, also nicht reflexiv begründeten, Skeptizismus.“ (138) Wege zur Befreiung: Politischer Aktivismus, Literaturtheorie, Ethik Sic et Non. Zeitschrift für Philosophie und Kultur. Im Netz. #6 2006 Bernd Goebel: Michel Foucaults Monologe Das abschließende dritte Kapitel des ersten Teils ist mit "Wege der Befreiung" überschrieben: Das eigentliche Ziel von Foucaults Analytik des Wissens, der Macht und der Normen sei eine Transformation der modernen Kultur mittels einer umfassenden Kritik der gegenwärtigen Zustände. Es gehe ihm letztlich um die "Befreiung der Individualität von den Fesseln der Strukturen, die sich auf den Ebenen des Wissens, der Macht und der Normen entwickelt haben" (175), um die unendliche Steigerung der Autonomie des Subjekts, um eine Ethik des Selbst, die freilich nicht die Vernunft oder das Denken herausstellt, sondern die Subjektivität als Körperlichkeit denkt. In den 60er, 70er und 80er Jahren thematisiere er nacheinander eine ästhetische, eine politische und eine ethische Befreiungsform. Das Mittel der Wahl für die Überschreitung der Wissensgrenzen liege für Foucault in der Literatur. In ihrer Fiktionalität eigne der Literatur ein subversives oder transgressives Potential. Seine literarischen Analysen einer - allerdings keineswegs repräsentativen - Auswahl moderner Werke seien in ein allgemeines historisches Projekt integriert; im Gegensatz zu Derridas Literaturkritik gehe es Foucault nicht eigentlich um die literarische, sondern um die historisch-diskursive Seite der Literatur. Das Mittel der Wahl für die Veränderung des Machtsystems habe Foucault im politischen Aktivismus gesehen. Getreu seinem fundamentalen Skeptizismus sei dieser seiner Grundausrichtung nach negativoppositionell, antiutopisch und bar jeden politischen Programms. Obwohl Foucault sich gelegentlich der marxistischen Sprache bediene, habe er doch den essentialistischen Humanismus der Linken entschieden abgelehnt. Eine fast blinde Glorifizierung des oppositionellen Kampfes erkläre seine Sympathie mit dem islamischen Fundamentalismus während der iranischen Revolution, den er nur als Gegenmacht wahrgenommen habe, ohne sich mit dem Geltungsanspruch seiner Ideen auseinanderzusetzen. Den Terrorismus habe er nicht aus humanitären Gründen abgelehnt, sondern aus rein strategischen, nämlich wegen seiner Kontraproduktivität. Auch Foucaults Ethik mit ihrem Leitgedanken des freien, autonomen Individuums ist nach S. das Resultat seiner skeptisch-kritischen Grundhaltung, ja deren Kulmination: "Die skeptische Auflösung alles Allgemeinen und Universellen konnte nur zur Radikalisierung des Subjektivismus führen, wie sie in Foucaults Ethik am deutlichsten zum Ausdruck kommt." (188) Foucault extremer Subjektivismus nehme im Übrigen die Form eines kritischen Hedonismus an. Dieser liege in der Konsequenz seiner materialistischen Anthropologie im Gefolge Nietzsches und Batailles, seiner energetischen Deutung des menschlichen Innenlebens als eines physikalischen Kampfes irrationaler Vitalkräfte, seiner Deutung des Subjekts als einheitslose Vielfalt libidinöser Energien, als "bloß lustempfindender Körper" (199). Die Subjektivitätsvorstellung der Psychoanalyse lehne er ab, weil sie immer noch von einem im Inneren des Menschen versteckten Gott ausginge, der alles zusammenhält. So seien noch die Forderungen nach sexueller Befreiung eines Reich und Marcuse der Vorstellung von einem "wahren Selbst" verhaftet. Vom Skeptizismus bedingt sei insbesondere die Foucaultsche Konzeption der Ethik als reiner Lebensstil, als eine von einem jeden Subjekt selber konstruierte ästhetische Selbstgestaltung, deren Maßstäbe in einer nicht mehr hinterfragbaren choix personnel gründen. Jenseits des objektiv Guten und Bösen sehe Foucault hierin eine Alternative zum universalistischen Programm einer Prinzipienethik. "Die Ethik des Lebensstils ist die einzige Möglichkeit eines skeptischen Systems, sich als Ethik zu profilieren." (198) Dabei habe Foucault das Modell des antiken Selbstverhaltens vor Augen. Die antike Ethik sei ihm zufolge kein rationales Regelsystem gewesen, sondern eine als Lebenskunst und Selbstsorge konzipierte freie Praxis, gerade auch im Hinblick auf die Gestaltung der eigenen Sexualität; später habe ein freiheitsberaubender Kodifizierungsprozess eingesetzt und Sic et Non. Zeitschrift für Philosophie und Kultur. Im Netz. #6 2006 Bernd Goebel: Michel Foucaults Monologe mit der Etablierung der christlichen Ethik seinen Abschluss gefunden. In der Meinung des Verf. trifft diese "Konstruktion" (189) die wahren antiken Verhältnisse aber nur teilweise. Sie werde der Ethik der Antike nicht gerecht und ließe sich am besten als Projektion der eigenen ethischen Vorstellungen ihres Erfinders verstehen. Foucaults subjektivistische Ethik der Selbstsorge sei ferner eine Absage an die intersubjektive Dimension des Menschseins und Ausdruck eines extremen Individualismus. Der Andere gerate in dieser Ethik nicht in den Blick. Foucault konstruiere einen unnötigen Antagonismus zwischen seiner Ethik der Selbstsorge und einer sich an rationalen Prinzipien orientierenden allgemeinen Verantwortungsethik. "Weder ein Dialog mit der Welt (ökologische Verantwortung) noch ein Dialog mit [...] künftigen Generationen (generationelle Verantwortung) lässt sich mit Foucaults Ansatz theoretisieren. Auch andere ethische Probleme intersubjektiver Art wie die Gerechtigkeitsfrage können [...] unmöglich gelöst werden." (195) Dagegen sieht der Verf. keinen Grund, Selbstsorge und Prinzipienethik einander entgegenzusetzen. Es sei ein Irrtum, wenn Wilhelm Schmid Foucault wegen seines souci de l'hétérogène: seiner Sympathie für die Geisteskranken und Marginalisierten, eine intersubjektive Ethik unterstellt. Denn statt sich um Andere zu sorgen, habe Foucault sich vielmehr um "das Andere" gesorgt, nämlich das Andere der Vernunft: "Foucault liebt die Marginalisierten nicht um ihrer selbst willen, sondern nur insofern, als er in ihnen eine Art Deregulierung der objektiven Vernunft erkennen kann. Foucault liebt also nicht die Geisteskranken, sondern er liebt nur seinen eigenen Skeptizismus." (194f., Anm.) S. weist auf zwei gravierende Probleme der Foucaultschen Ethik hin. Zum einen stelle er bei aller Zurückweisung universaler Geltungsansprüche selbst Forderungen auf, die offensichtlich universale Geltung beanspruchen, so z.B. die Forderung, dass jeder Mensch seine eigene Ethik auszubilden habe oder dass sexuelle Handlungen der Zustimmung der Partner bedürften. Hinter dem Feldzug gegen allgemeine Normen des Verhaltens versteckten sich also ihrerseits allgemeine Normen: "Foucaults Kryptonormativismus weist auf einen Mangel an Selbstkritik hin, der durch den skeptischen Ansatz bedingt ist." (197) Zum anderen lägen seiner Ethik zwei fundamentale Werte zugrunde, nämlich die Autonomie und die Freiheit des Individuums. Diese seien die implizite, heimliche oder unerkannte normative Basis seiner Ethik und seines ganzen kritischen Projekts. "Eine mangelnde Selbstreflexion führt dazu, dass Foucault Autonomie und Freiheit nicht als regulative Ideale anerkennt, obwohl er sie als solche verwendet. In dieser Hinsicht lebt Foucaults Ethik von einem verborgenen Idealismus." (90) Mit Foucault über Foucault hinaus: Relecture der Geschichte der Konstellationen Der zweite und dritte, historische Teil ist eine Geschichte der Konstellationen. Sie versteht sich einerseits als erste systematische Darstellung der gesamten Kulturgeschichte Foucaults, die auch den Nachlass einbezieht; andererseits geht sie als kritische Darstellung weit über die bloße Rekonstruktion hinaus: S. ergänzt Foucaults Ausführungen, wo dieser es bei Andeutungen oder Projektskizzen beließ; er unterbreitet bei aller Zustimmung konstruktive Vorschläge zur Verbesserung oder Korrektur der Foucaultschen Analysen und ihrer Begrifflichkeit (Foucault nähere sich seinem Gegenstand "von unten" anhand von ausgewähltem historischen Material, was seine Analysen für Fehler anfällig mache); vor allem aber verfolgt er das ehrgeizige Ziel, das historische Unternehmen Foucaults "in ein idealistisches System auf[zu]heben, das die Diskursanalyse als Rekonstruktion apriorischer, transzendentaler Begriffe versteht." (203) Während der Verf. mit Foucaults Projekt sympathisiert, die historischen Kategorien des Denkens und kulturgeschichtlichen Rationalitäten in ihrer Abfolge zu bestimmen, lehnt er dessen Diskontinuitätsthese wie gesehen scharf ab; er hält dafür, dass das Problem der Sic et Non. Zeitschrift für Philosophie und Kultur. Im Netz. #6 2006 Bernd Goebel: Michel Foucaults Monologe Transformation jener Konstellationen nicht durch eine Machttheorie gelöst werden kann. Nötig sei stattdessen, historische Positionen freizulegen, die das Denken einer Kulturepoche durch ihren dialogischen Charakter vorangetrieben hätten - nach den Gesetzen der Dialektik. Es geht S. darum, die "Umrisse einer alternativen philosophischen Kulturgeschichte" darzustellen, "die nicht im Skeptizismus, sondern im Idealismus gründet." (690). Das beinhalte unter anderem, die Genealogie im Sinne der Analytik der Macht auf die Archäologie im Sinne einer Analytik der Konstellationskategorien zurückzuführen. Dabei ergebe sich als Desiderat etwas viel Anspruchsvolleres als eine Kulturgeschichte à la Foucault. Es gelte, die logische Verkettung der Konstellationskategorien verschiedener Kulturepochen aufzuweisen, "so dass durch den deduktiven Zusammenhang sich der notwendige Gang der Kulturgeschichte verfolgen ließe". (691) Eine solche logische Verbindung der Konstellationen und ihrer Kategorien trete bei Foucault selbst niemals in Erscheinung, weil er die Kultur zwar als Sprache behandele, jedoch nur als langage und nicht als parole, d.h. als Dialog. S. glaubt, im Werk Foucaults eine Unterscheidung von acht verschiedenen Konstellationen ausmachen zu können - eine Einteilung, der er sich anschließt. Die analytische Durchdringung der entsprechenden Rationalitäten bei Foucault könne freilich kaum unterschiedlicher sein: Am Ausführlichsten habe er sich mit der Neuzeit befasst, die in die Konstellation der "Klassik" (436-635) und diejenige der Moderne (636-689) zerfalle. Vor allem anhand seiner Histoire de la sexualité und des Nachlasses ließen sich seine Darstellungen der drei antiken Konstellationen - des klassischen Griechentums (209-258), des hellenistisch-römischen Zeitalters (258306) und der Spätantike (306-333) - rekonstruieren; was die drei Konstellationen des Mittelalters betrifft, habe Foucault sich noch am meisten über die Renaissance verbreitet (403-431), wohingegen seine knappen Ausführungen zur "Gotik" (345-370) und sporadischen Äußerungen zum frühen Mittelalter (335-345) zum Teil nur mutmaßen ließen, worauf seine Analysen dieser Epochen herauslaufen oder herausgelaufen wären. Dabei ist die Gliederung der einzelnen Kapitel bei S. immer dieselbe: Auf eine kurze Hinführung folgt die Archäologie, nämlich eine Darstellung der "Domänen der Analytik", gemäß der Foucaultschen Trias unterteilt in die Analytik des Wissens, die Analytik der institutionellen Macht und die Analytik der Normen. In einem zweiten Schritt untersucht der Verf. jeweils, wie es zur "Transformation" der fraglichen Konstellation kam; hier ist das Pendant zur Foucaultschen Genealogie. Ergänzt werden die Ausführungen oftmals durch eingehende Literaturanalysen (wie sie sich auch bei Foucault finden), unter anderem der homerischen Epen, der griechischen Tragödie, des antiken Romans, des Don Quijote, der Werke von Racine, De Sade, Hölderlin, Flaubert, Blanchot und Bataille; denn es ist eine These des Verf., dass sich die dialektische Entwicklung der Konstellationen nicht nur anhand der Philosophie-, Rechts- oder Sozialgeschichte, sondern ebenso der Wissenschaft und Kunst nachweisen lässt. Dies ist auch der Grund, warum sich im Abschnitt über die Konstellation der neuzeitlichen Klassik - dem ausführlichsten des ganzen Buches - der höchst eigenständige Versuch findet, die Geschichte zweier neuzeitlicher Wissenschaften als Dialektik zu präsentieren: der klassischen Sprachtheorie, von der Logik von Port-Royal, Leibniz und Vico über Locke, Rousseau und Condillac bis zu Herder, Humboldt und Schlegel (474-571); sowie der klassischen Biologie, von Linnaeus über Buffon, Lamarck und Cuvier bis zu Goethe und Geoffroy de Saint-Hilaire (571-602). Die von S. postulierte dialektische Entwicklung der Kulturgeschichte findet auf zwei Ebenen statt und lässt sich vielleicht am Besten mit Hilfe einer Doppelhelix veranschaulichen: Einerseits verhielten sich die Konstellationen in ihrer unmittelbaren Abfolge zueinander wie These, Antithese und Synthese; thetische Rationalitäten würden durch die klassische Antike, das frühe Mittelalter und die klassische Neuzeit repräsentiert, antithetische Rationalitäten durch die hellenistisch-römische Epoche, durch die Gotik und die Sic et Non. Zeitschrift für Philosophie und Kultur. Im Netz. #6 2006 Bernd Goebel: Michel Foucaults Monologe Moderne, synthetische Rationalitäten schließlich durch die Spätantike, die Renaissance sowie durch das mit dieser Methode im Rahmen einer philosophischen "Futurologie" prognostizierbare, auf die Moderne folgende Zeitalter eines erneuerten Idealismus; den Übergang zu diesem Zeitalter habe der Postmodernismus bereits eingeläutet. Andererseits ließen sich die drei großen Epochen Antike, Mittelalter und Neuzeit ihrerseits im Sinne einer "hyperzyklische[n] Dialektik" (150) als Synthese (Antike), These (Mittelalter) und Antithese (Neuzeit) betrachten, mit den "Achsenperioden" Spätantike und Renaissance. Auch diese Entwicklungslogik lasse auf ein kommendes synthetisches Zeitalter, eine dritte Achsenperiode schließen, die "Religion und Wissenschaft, Metaphysik und Technik wieder zusammen denken wird". (693) Die doppelte These einer derartigen dialektischen und hyperdialektischen Entwicklung der Kulturgeschichte schließe im Übrigen nicht das Auftreten von antizyklischen Denkern aus, also etwa eines synthetischen Kopfes in einem thetischen oder antithetischen Zeitalter: S. geht von einer "verschachtelten Dialektik" (151) aus, die auch für derartige Phänomene aufkommen kann. Dialektische Entwicklungen seien auch innerhalb ein und derselben Konstellation anzutreffen. Die Konstellation der Spätantike als Beispiel Angesichts der gewaltigen Fülle des betrachteten Materials im zweiten und dritten Teil seien im Folgenden lediglich die Ausführungen des Verf. zur Konstellation der Spätantike exemplarisch umrissen. Die Spätantike erscheine für Foucault auf der einen Seite als neue Konstellation von Begriffen, auf der anderen als Transformation des antiken Denkens, nämlich als eine Umgestaltung der herkömmlichen Kategorien in christliche. Diesen Wandel mache er vor allem auf der Ebene der Normativität fest. Dementsprechend ziehe er ausschließlich christliche Dokumente heran, in der Hauptsache patristische Texte. In seiner Analytik der Normen konstatiere Foucault in der Spätantike eine umfassende "Enthedonisierung". Zu den Grundbegriffe des erotischen Diskurses zählten Virginität, Monogamie, Treue und Fortpflanzung. Diese hätten ihren Ort in einem allgemeineren normativen Kontext, in dem Kategorien wie Märtyrertum, Mortifikation und Abstinenz bestimmend seien. Hinter solchen Kategorien stünden wiederum die eigentlichen Leitbegriffe der Spätantike: Reinigung, Rettung und Heil. All diese - nicht in jedem Fall für die Spätantike spezifischen - normativen Kategorien gruppiere Foucault um eine "Hermeneutik des Selbst" genannte Praxis. Sie stehe in der Tradition der antiken Selbstsorge, markiere jedoch zugleich eine wesentliche Verschiebung des antiken Selbstverhaltens, weg von der ungebundenen Ästhetik des Selbst hin zu einer immer zwanghafteren Deutung der eigenen Innerlichkeit, durchdringenden Gedankenkontrolle und Überwachung der Seele aus Sorge um das ewige Leben; sie sei eine Übergangsform auf dem Weg zur dienenden Subjektivität des frühen Mittelalters, die ganz im Zeichen der Kategorie des Gehorsams stehen würde. In seiner Analytik der Macht in der Spätantike befasse sich Foucault mit der Institutionalisierung von Buße und Beichte, mit dem frühen Mönchtum und mit der von ihm so genannten "pastoralen Macht". Was letztere betrifft, stütze er sich auf die Studien von Peter Brown, der gezeigt habe, dass der politische Diskurs der Spätantike völlig auf die Heilsfrage fixiert sei. Das Mönchtum habe in Foucaults Augen der antiken Vorstellung eines autarken Subjekts den Todesstoß versetzt, insofern die mönchische Existenz die Absage alles Individuellen impliziert. Mit der im betrachteten Zeitraum zunehmend institutionalisierten und kodifizierten Buß- und Beichtpraxis entstehe endlich eine neue Überwachungsform des Subjekts. Dadurch komme es zu einem Freiheitsverlust, der mit der Rationalisierung oder "Logozentrierung" der abendländischen Welt zusammenhänge. Diese gerate Foucault zufolge seit der christlichen Spätantike in die Bahnen einer Kultur der Sic et Non. Zeitschrift für Philosophie und Kultur. Im Netz. #6 2006 Bernd Goebel: Michel Foucaults Monologe véridiction, des Wahr-Sagen-Müssens. Der Verf. hält diese Analysen für ebenso wegweisend wie aufschlussreich, weshalb er glaubt, an sie anknüpfen zu können. Zugleich macht er aber auf Lücken, auf Fehlgewichtungen und sogar auf Fehldeutungen in Foucaults Theorie der Spätantike aufmerksam. Deshalb seien Ergänzungen und Korrekturen vonnöten. So blicke Foucault zu kurz, wenn er im Märtyrer - und nicht im Heiligen - den Idealtyp des spätantiken Christentums sehe; der Gedanke des Märtyrertums gehöre eher in die hellenistisch-römischen Zeit mit ihrem Leitbild einer autarken Subjektivität. Die Kategorie der Mortifikation entnehme er fast ausschließlich dem Werk des Extremisten Tertullian, seine eigene These von einer spätantiken Herabwürdigung der Körperlichkeit ignoriere komplett das Heilsversprechen der leiblichen Auferstehung. Mehr noch, die wichtigste Kategorie dieser Konstellation bleibe bei ihm außer Betracht: Hinter den Vorstellungen von Reinigung, Rettung und Heil steht laut S. nochmals diejenige des Aufstiegs (ascensus), nämlich der Erhebung des Menschen zum transzendenten Gott. Foucault müsse sich den Vorwurf gefallen lassen, seine Leitkategorie der Reinigung allzu sehr im Rahmen des Kampfes (gegen die Versuchungen des Fleisches, gegen den Teufel) als rein negative Tätigkeit dargestellt zu haben. Aber die innere Reinigung stelle nicht, wie Foucault meine, das letzte Ziel der Askese dar. Der von ihm unterschlagene positive Zweck der frühchristlichen "Hermeneutik des Selbst", der von den Mönchen praktizierten "Introspektion" sei es, zur Wahrheit emporzusteigen, die Kommunikation mit dem Göttlichen wieder herzustellen: "Die Hermeneutik des Selbst steht vielmehr im Zeichen des ascensus. Erst die Möglichkeit des Aufstiegs und der Erhebung der Seele macht den Sinn der Askese und der Hermeneutik des Selbst aus. (...) Die Kategorie der Reinigung, die Foucault zu Recht hervorgehoben hat, ist ohne den Begriff des ascensus in der Spätantike also nicht zu denken." (313; 328) Vollkommen entgangen sei Foucault schließlich die innere Verwandtschaft zwischen Neuplatonismus und christlichem Denken; sämtliche nichtchristliche Autoren der Spätantike blieben in seiner Histoire de la sexualité unbesprochen. Das christliche Denken dieser Zeit spiele sich aber vor einem neuplatonischen Horizont ab. Die ganze Spätantike werde von neuplatonischen Themen und Motiven bestimmt: "Das Fundament der Spätantike ist (...) im Grunde nicht christlich, sondern neoplatonisch." (327) Dies gelte auch für die spätantike Normativität: "Obwohl Foucault die Kategorien der Reinigung und Rettung nur im Kontext des christlichen Denkens untersucht, ist bekannt, dass diese Kategorien auch im Diskurs neoplatonischer Denker eine fundamentale Rolle spielten. Die Kategorien der Reinigung und der Erlösung setzten in der Spätantike vielmehr eine neoplatonische Weltanschauung voraus, die Ethik und Metaphysik, philosophische Forschung und religiöses Streben untrennbar miteinander verbindet." (309) Gerade dies erweise aber den ascensus als die Grundkategorie der spätantiken Kultur. Da Foucault selbst keine Analytik des spätantiken Wissens vorgelegt hat, versucht der Verf. eine solche zu supplieren. So steht die "Episteme" dieses Zeitalters für ihn im Zeichen der Exegese. Und dies treffe nicht nur für das Christentum zu, sondern auch für den heidnischen Neuplatonismus, dem Platon nicht nur ein Philosoph, sondern ein göttlich inspirierter Heiliger war. Die wichtigste regulative Idee des exegetischen Kommentars sei die Kohärenz, die durch Allegorese gesichert würde. Mit Gedanken zur Transformation der Spätantike beschließt S. dieses Kapitel. Dazu ordnet er die Entwürfe des Origenes, Plotin, Augustinus und Pelagius in ein dialektisches Schema ein; das Werk von Proklos bilde den synthetischen Abschluss dieser Epoche. Unorthodoxe Anstöße für die Foucaultforschung Sic et Non. Zeitschrift für Philosophie und Kultur. Im Netz. #6 2006 Bernd Goebel: Michel Foucaults Monologe Mit Skepsis und Geschichte legt S. eine ebenso umfassende wie genaue, klare wie einfühlsam philosophische Interpretation des Gesamtwerks Michel Foucaults vor. Damit erfüllt diese Studie ein Desiderat und markiert einen Referenzpunkt für die künftige Foucaultforschung, den man nicht wird ignorieren können. Handelt es sich auch um eine der bislang tiefsinnigsten und radikalsten Kritiken am Foucaultschen Denken, so bleibt diese Kritik doch jederzeit konstruktiv, ja sie kommt einer Würdigung des Denkens Foucaults gleich, dessen philosophische Bedeutung und Bedeutsamkeit vom Verf. überall herausgestellt werden und dessen beste Einsichten er in einen Gegenentwurf aufzuheben versucht. Das macht seine Studie in der Tat zu dem angekündigten philosophischen Kommentar, macht sie selbst zu einer provokanten Position im Gegenwartsdiskurs. Als solche zeichnet sie sich durch ein Höchstmaß an begrifflicher Schärfe und Transparenz der Argumentation, durch ein Bemühen um Konsistenz, das man nur vorbildlich nennen kann, und durch die ständige Antizipation von Einwänden aus. Im Einklang mit seinem dialogischen Ansatz sucht S. immer wieder das Gespräch mit rivalisierenden Auffassungen in der Foucaultforschung, die ihm nicht weniger vertraut ist als das Gesamtwerk des französischen Denkers einschließlich des Nachlasses. Selbst wer die Gegenkonzeption des Verf. nicht teilt, dürfte dieses auch stilistisch anspruchsvolle und äußerlich ansprechende Buch mit Gewinn lesen. Ein derart groß angelegtes Projekt steht indes immer vor ganz eigenen Schwierigkeiten. Einige davon sind auch in diesem Buch spürbar, zumal im zweiten und dritten Teil. Zwar legt der Verf. eine ungeheure Belesenheit an den Tag; zwar scheint er eine erstaunliche Gabe zu besitzen, die wesentlichen Elemente und Neuerungen in den Werken großer Philosophen, Wissenschaftler und Literaten pointiert zu Tage zu befördern; aber es ist doch unvermeidlich, dass eine solch globale Perspektive auf die Kulturgeschichte zum einen auf Kosten von Differenzierungen geht, zum anderen dem Spezialisten selektiv und unvollständig erscheinen wird. Wenn der Verf. etwa die Konstellation der "Gotik" analysiert, gewinnt man den Eindruck, dass die Erkenntnisse der neueren und neuesten Quellenforschung, die unser Bild vom lateinischen Mittelalter nicht unerheblich gewandelt haben, nur teilweise verarbeitet sind. Immerhin spricht S. das caveat, dass eine Rekonstruktion der gesamten abendländischen Kulturgeschichte fehlbar ist, wenn sie von ausgewählten Quellen ausgeht, nicht nur im Hinblick auf Foucaults Unternehmen, sondern auch auf sein eigenes aus - obgleich es S. zweifellos gelingt, eine repräsentativere Dokumentenbasis zugrunde zu legen als jener, und obwohl seine dialektische Methode die empirische Herangehensweise Foucaults durch ein apriorisches Moment ausbalanciert. Andererseits hat er infolge dessen einer zweifachen Versuchung zu widerstehen, die Geschichte selektiv zu betrachten: diejenige, welche aus der Archäologie mit ihrer Suche nach einer einheitlichen, epochenspezifischen Rationalität entsteht, und diejenige, welche sich aus der revisionistischen Genealogie mit ihrer Suche nach dialektischen Mustern ergibt. In formaler Hinsicht ist der erste Teil der Arbeit nicht völlig frei von Wiederholungen (z.B. 39/118; 125126/135-144). Anstatt der exkursartigen systematischen Einschübe en passant in Form von "Anmerkungen" - sie trüben etwas den Blick auf die sehr einleuchtende Architektur der Arbeit und stören ein wenig die Dramaturgie des ersten Teiles - hätte man sich auch ein Kapitel am Ende eines jeden seiner drei Akte vorstellen können. Ein Personenregister wäre gewiss nicht von Nachteil gewesen; und bei Zitaten aus Sammelwerken wie den posthumen Dits et écrits hätte man sich bei der Referenz auch den Titel des jeweiligen Beitrages gewünscht (oder ein separates Inhaltsverzeichnis, um diesen nachzuschlagen). An einigen Stellen sind ferner kritische Anfragen möglich. Zwei Beispiele seien genannt: So scheint das Zugeständnis einer "verschachtelten Dialektik" den Ansatz einer absolut-idealistischen Geschichtsbetrachtung im Gefolge Hegels (und Hösles) zu schwächen; Sic et Non. Zeitschrift für Philosophie und Kultur. Im Netz. #6 2006 Bernd Goebel: Michel Foucaults Monologe man ist geneigt zu fragen, wie verschachtelt eine Dialektik sein darf, um noch als Dialektik identifiziert werden zu können. Da ferner ein Haupteinwand von S. gegen Foucaults skeptizistisches Philosophieren darin besteht, dass dieses einen "Mangel an Dialogischem" (187) aufweise, hätte man erwähnen können, dass zumindest die Archéologie du savoir mit einem Mittelding zwischen Dialog und Interview endet, bestehend aus Fragen, die im Kontext des Cercle d'épistémologie tatsächlich aufgeworfen wurden. Auch hätte man die Interviews, die Foucault meisterhaft beherrschte, gesprächstheoretisch analysieren und gegenüber dem Dialog abgrenzen können. Dies hätte die zentrale These des Verf. möglicherweise zu erhärten vermocht: dass Foucault in seinen historischen Arbeiten wenig Verständnis für dialogische Prozesse beweise und einen im Grunde monologischen philosophischen Grundansatz vertrete. Derartige punktuelle Beobachtungen wollen aber keineswegs den Wert dieser brillanten Arbeit in Frage stellen, ein streitbarer und unorthodoxer, mehr als bedenkenswerter Beitrag zur Foucaultforschung, eine akribische Gesamtstudie und ein konstruktiver Beitrag zur Philosophie der Gegenwart. Der Autor: Bernd Goebel, geb. 1967, studierte Philosophie, Theologie, Geschichte und Religionswissenschaften in Würzburg, Oxford, Bonn und Paris. Assistent am Forschungsinstitut für Philosophie Hannover, Lehraufträge in Lille, Hildesheim und Fulda, Gastprofessuren an der EPHE Paris und der University of Notre Dame. Seit 2003 Ordentlicher Professor für Philosophie und Philosophiegeschichte an der Theologischen Fakultät Fulda. Schwerpunkte: Philosophie des Mittelalters und der Gegenwart; Ethik, Anthropologie und Metaphysik. Sic et Non. Zeitschrift für Philosophie und Kultur. Im Netz. #6 2006