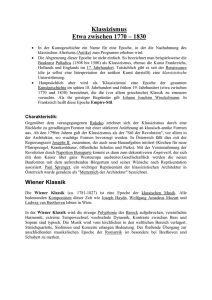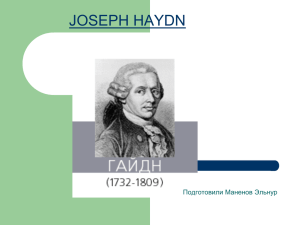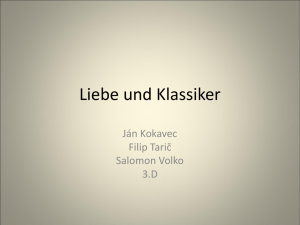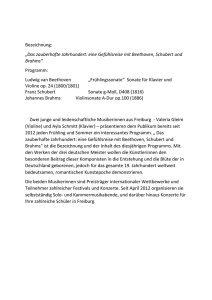Wien – Welthauptstadt der Musik
Werbung

Wien – Welthauptstadt der Musik Wien wird mit Musik gleichgesetzt wie kaum eine andere Stadt der Welt. Sei es Mozarts Zauberflöte, sei es Beethovens neunte Sinfonie, sei es der Wiener Walzer – glücklich ist, wer vergisst und sich dem wiegenden Takt hingibt, den die liebliche Landschaft und die plätschernde Donauwelle vorgeben. Das Leben ist ja so einfach! Und die Wiener haben ein goldenes Herz! Was daran bei näherer Betrachtung Bestand hat? Die Qualität des Wiener Herzgoldes wollen wir lieber ununtersucht lassen, aber eines wird man schon konstatieren: Das Anliegen der Aufklärung, mit der Kunst ALLE Menschen zu erreichen, eine Sprache zu finden, die ALLEN ins Herz geht, das ist den Wiener Klassikern gelungen, zunächst Gluck, der in diesem Bemühen völlig aufging, Haydn, der in der kunstreichen Schöpfung volksnah blieb, Mozart, dessen Papageno jeder liebt und Beethoven, dessen Ode an die Freude, entstanden in der Ungargasse 5, das bekannteste Musikwerk aller Zeiten ist. Ob das an der Nähe zur alpenländischen Volksmusik liegt, an der Aufklärung, der wienerischen musikalischen Seele – richtig ist, dass die Musik in Wien eine sehr spezielle und populäre Rolle spielt und beinahe weltweit verstanden wird. Die Städte gewannen ab dem 14. Jahrhundert verstärkt Bedeutung. Die Forschung bezeugt Wien schon im Mittelalter ein reiches Musikleben, das auch breite Bevölkerungsschichten erfasste, und wie die verschiedenen Handwerke wurde auch die Musik streng geordnet. In Wien war es die Nikolaibruderschaft, eine Musikervereinigung mit Sitz in der Michaelerkirche, die für die Regeln im städtischen Musikleben, Ausbildung, Standards und für die Überwachung der Sitten sorgte. Auswärtige Spielleute mussten ihr einen Obolus entrichten. Die Studenten der 1365 gegründeten Wiener Universität genossen das Privileg, sich durch Straßengesang ein Zubrot zu verdienen, durften aber nur geistliche Lieder singen. Auch sie wurden streng kontrolliert, und obszönes oder kritisches Singen hatte Sanktionen zur Folge. Die Musik stand aber bald im Mittelpunkt der kaiserlichen Repräsentation, die Habsburger waren über viele Generationen persönlich musikalisch engagiert, was sich auf den ganzen Hof und die Stadt auswirkte. Lautenisten, Trommler, Trompeter – sie waren unentbehrlich und hochbezahlt. Sie wurden aus allen Teilen Europas gerufen, und unter Maximilian I. erreichte die Hofmusik Weltniveau. Ferdinand I. und Ferdinand II. bauten Wien endgültig zur Reichshaupt- und Residenzstadt auf, was mit einer Blüte von Theater, Konzert und Oper einherging. Ferdinand III. komponierte selbst, sein Nachfolger Leopold I. ließ ein erstes hölzernes Opernhaus erbauen. Unter Joseph I. sowie unter Karl VI. erreichte die kaiserliche Hofmusik mit 300 Musikern ihren Höchststand. Unter dem Einfluss der Aufklärung büßte die Musik ihre Qualität als Machtvehikel allmählich ein. Zwar pfiff und sang der ganze Hof noch immer, doch Maria Theresia und ihr Sohn Joseph II. pochten auf Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit. Zugleich engagierten sich in Wien zahlreiche unmäßig reiche Adelshäuser, die Gluck, Haydn, Mozart und Beethoven versorgten. Schubert fiel durch den Rost, denn das Bürgertum gewann erst mit der Industrialisierung die Mittel, den Adel abzulösen. Die bürgerliche Musikkultur im Wien des 19. Jahrhunderts erreichte wiederum eine sagenhafte Blüte, ganz Wien spielte Pianoforte, walzte, aus den Gasthäusern drang das Wienerlied und die Konzerte und Bälle nahmen gar kein Ende. Die damals gegründeten Institutionen wie Musikverein und Konzerthaus, Neues Burgtheater und Hofoper stützten (und bekämpften wohl auch) Komponisten wie Brahms, Wolf, Bruckner und Mahler und leben bis heute fort. Höhepunkt dieser Entwicklung war 1892 die Wiener Weltausstellung der Musik, die nicht nur dokumentierte, sondern auch bereits alle jene Klischees bediente, von der die Musikstadt Wien bis heute lebt. Haydn Die Schöpfung schrieb Haydn in seinem letzten Domizil, heute Haydngasse 19, vom Oktober 1796 bis zum April 1798. Er hatte das Haus, das gegenwärtig an den beliebten Einkaufszentren der Mariahilferstraße liegt, vom bürgerlichen Webermeister Ignaz Weißgram wegen der „einsam stillen Lage“ am 14. August 1793 nach seiner ersten Englandreise gekauft und bewohnte es bis zu seinem Tod. Mit dem kinderlosen Ehepaar Haydn – seine Gattin brachte er allerdings nach einem Streit beim Schullehrer Stoll in Baden unter – zogen die Nichte Ernestine Loder, die Köchin Anna Kremnitzer sowie der Sekretär und Notenkopist Johann Florian Elßler (Vater der berühmten Tänzerin) ein. Hier empfing er auch prominente Besucher wie Admiral Lord Nelson, Carl Maria von Weber oder Luigi Cherubini. Am 31. Mai 1809 starb Haydn 77-jährig während der französischen Besetzung. Napoleon ließ am Sterbehaus Ehrenwachen aufstellen, und beim Begräbnis war nicht nur ganz Wien zugegen, sondern auch die französische Generalität. Haydn hatte sich in London, wohin er zwei sehr erfolgreiche und folgenreiche Reisen unternommen hatte, von der Kultur der Oratorienaufführungen beeindrucken lassen. Es ist erstaunlich, dass der alte Haydn in der Lage war, ein etabliertes Genre – das barocke Oratorium Händel‘scher Prägung – der eigenen Musiksprache der späten Klassik anzuverwandeln und einem neuen dauerhaften Höhepunkt zuzuführen. Schöpfung und Jahreszeiten gehören bis heute zu seiner beliebtesten Musik. Der dritte Teil der Schöpfung handelt von ihrer „Krone“ – der Mensch, das erste liebende Paar, Adam und Eva. Die Sicht auf die Schöpfung Gottes ist durchweg positiv, was nicht nur Haydns privater Frömmigkeit geschuldet ist, sondern auch dem weltzugewandten, optimistischen Blick der Aufklärung, die an das Gute glaubt. Das Libretto, ursprünglich wohl für Händel gedacht und von Haydn aus London mitgebracht, übertrug Gottfried van Swieten, der Sohn des holländischen Leibarzts von Maria Theresia, ins Deutsche. Dieser war ein hoher Diplomat, selbst Dichter und (erfolgloser) Komponist, Freimaurerkollege von Mozart und unermüdlicher Förderer der Musik. Er versah seine Textversion mit Kompositionsvorschlägen, die Haydn nach eigener Aussage als sehr hilfreich empfand. Uriel besingt zunächst den Morgen und dann das Hand in Hand schreitende „beglückte Paar“, ein Paradebeispiel für die aufklärerische Lichtmetaphorik – gleichzeitig mit dem Morgenrot erscheint eine neue Ära des Glücks und des Vertrauens. Alle Anspielungen auf die Tragödie des Sündenfalls sind entfernt, es könnte sich auch um das antike Arkadien oder den Rousseau‘schen natürlichen Zustand des Menschen handeln. Der Text folgt Miltons Morning hymn aus Paradise lost. Das Duett zwischen Adam und Eva (Nr. 30/Track 3) gehört zu den großartigsten Passagen der Schöpfung, ja eigentlich zu den innigsten der musikalischen Literatur überhaupt. Swieten hatte für Haydn notiert, dass hier „süßer Klang“ und „reine Harmonie“ am Platz wären – daran hat Haydn sich gehalten. Dass der Chor den intimen Moment des Paares nicht stört, sondern verstärkt, gehört zu den musikalisch gelösten psychologischen Leistungen des Komponisten, die sich Beethoven im Fidelio zu eigen gemacht hat. Der Schlusschor, großartig in seiner Wirkung, setzt vollstimmig ein (zum ersten Mal!) und steigert sich in immer neuer Intensität. Die Doppelfuge wird noch übertroffen durch die Spannung zwischen den unglaublich schwerelosen Melismen der Solisten und den mächtigen Akkord-Exklamationen des Chores, die im Wort „Ewigkeit“ kulminieren. Die denkwürdige öffentliche Uraufführung im Alten Burgtheater (am Michaelerplatz, abgetragen 1888) am 19. März 1799, der bereits mehrere spektakuläre „private“ Aufführungen vorausgegangen waren, fand dank der „Gesellschaft der Associierten“ statt. Diese hatte van Swieten mit anderen Grafen und Fürsten wie Esterházy, Liechtenstein, Lobkowitz, Kinsky, Auersperg, Lichnowsky, Trauttmannsdorff, Sinzendorf und Schwarzenberg gegründet. Sie trug alle Kosten einschließlich eines großzügigen Kompositionshonorars. Haydn verlangte eine immense Besetzung – aus der Anzahl und Nummerierung der Stimmenhefte kann man auf 40 Bläser, 71 Streicher und 64 Sänger schließen; zusammen mit den drei Solisten, Salieri am Flügel und Haydn als Dirigenten ergeben sich 180 Musizierende. Der alte Haydn enttäuschte niemanden, auch sich selbst nicht: Er wurde in den Himmel gehoben, das aufgeklärte Wien feierte sich selbst. Mozart Zauberflötenouvertüre Die Ouvertüre der Zauberflöte: sechs Minuten reines Glück für jeden Musikliebenden. Mag das Libretto dieses Singspiels verhältnismäßig unsinnig, mag sogar die musikalische Qualität nicht durchgehend auf höchstem Niveau sein, Mozarts Zauberflöte ist trotz Freimaurerbrimborium und Volkstümelei ein ergreifendes Zeugnis der tiefen Menschlichkeit, das zu gegenseitigem Verständnis und Großzügigkeit aufruft, vielleicht, weil Mozart den Schmerz und die Verzweiflung nicht ausspart: Wir wissen, dass Mozart in den Aufführungen saß und sie genoss, obwohl die Sänger nicht über allen Zweifel erhaben waren und es sich um das Vorstadtpublikum des (nicht mehr existierenden) Freihaustheaters handelte. Die Ouvertüre wurde, zusammen mit dem Priestermarsch, als letztes Stück der Oper komponiert und am 28. September 1791, zwei Tage vor der Uraufführung, fertiggestellt. Sie beginnt mit den drei Akkordschlägen des vollen Orchesters, der erste auf der Grundstufe Es, der zweite jedoch auf der sechsten Stufe c-Moll, was dem Ablauf einer gebräuchlichen Dreiklangsfanfare nicht entspricht, sondern – im Verbund mit den Fermaten auf jedem Akkord – dem Beginn etwas Schwebendes und Erwartungsvolles verleiht. Klaviervariationen Mozarts Zehn Variationen für Klavier zu zwei Händen KV 455 entstanden im Jahr 1784, und Mozart wählte als Thema eine Melodie aus Glucks 1764 im Burgtheater uraufgeführter Oper Die Pilger von Mekka. Mozarts Entführung ist in vielem diesem Werk verpflichtet, wie Mozart überhaupt Gluck außerordentlich schätzte und ihm viel verdankte. Mozart wählte das Lied des Calender „Les hommes pieusement pour Catons nous prennent ...“, der in seiner Entführung dem Osmin entsprach. Die deutsche Übersetzung in Glucks erhaltener Partitur gibt den Anfang dieses Liedes mit „Dumme fromme Leute zwar meinen wohl wir darbten“, doch Mozart verwendete offensichtlich eine andere Übersetzung, sodass es heißt: „Unser dummer Pöbel meint“. Die Uraufführung fand vermutlich am 23. März 1783 als Zugabe in dem Konzert statt, das Mozart in Gegenwart des Kaisers gab, der im Voraus 25 Dukaten als Eintritt entrichtet hatte. Es war das erste jener sechs Konzerte im Burgtheater, die seine steile Karriere als freier Musiker in Wien begründeten. Mozart leitete vom Klavier aus, an dem er Solostücke spielte, auch die Haffner-Sinfonie (geteilt, die drei ersten Sätze und der letzte Satz rahmten das Konzert ein), und vor allem verschiedene Arien mit Gesangskräften, die er schätzte. Das Konzert war ein großer künstlerischer und kommerzieller Erfolg, und Mozart konnte an seinen Vater berichten: „Ich glaube es wird nicht nöthig seyn ihnen viel von dem erfolg meiner academie zu schreiben, sie werden es vielleicht schon gehört haben. Genug; das theater hätte ohnmöglich völler seyn können, und alle logen waren besezt. – das liebste war mir, daß seine Mayestätt der kayser auch zugegen war, und wie er vergnügt war, und was für lauten beyfall er mir gegeben; …“. Dissonanzenquartett Mozart vollendete das C-Dur-Quartett am 14. Januar 1785, trug es am 15. in sein Werkverzeichnis ein und bereits am nächsten Tag führte er es Freunden vor. Es erhielt den Namen „Dissonanzenquartett“. Das rührt von den schneidenden Reibungen in den ersten Takten des Einleitungsadagios her, die von den Zeitgenossen kritisiert, für einen Fehler gehalten oder jedenfalls für sehr ungewöhnlich angesehen wurden. Mozart verwendete die vorzeichenlose Tonart gerne der Tradition entsprechend für festliche Werke, aber auch, wenn er besondere Helldunkel-Effekte erzeugen wollte. Die unvermuteten DurMoll-Wechsel lassen das Dunkel-Verhangene besonders eindrücklich hervortreten. In gleicher Weise betonen die Querstände der Einleitung die spätere betörend schöne Melodik und Klarheit. Das „Dissonanzenquartett“ ist das letzte einer Serie von sechs Quartetten, die Mozart in einer fruchtbaren und glücklichen Periode schrieb. Dazu angeregt wurde er von Haydns Quartetten op. 33, und diesem „seinem lieben Freund“ widmete er dankbar seine „Kinder“, wie er sie in der Vorrede nannte. Sie seien die Frucht einer langen, mühevollen Arbeit („il frutto di una lunga, e laboriosa fattica”), die er nun im Schutz des großen Haydn in die Welt entlasse, der sich bei seinem letzten Aufenthalt in Wien als zufrieden mit ihnen gezeigt habe. Das ist ein wenig untertrieben, denn bekanntlich veranlassten Haydn diese Quartette zu dem berühmten Lob gegenüber Leopold Mozart: „Ich sage Ihnen vor Gott, als ein ehrlicher Mann, ihr Sohn ist der größte Componist, den ich von Person und dem Namen nach kenne; er hat Geschmack, und überdieß die größte Compositionswissenschaft.“ Die Uraufführung fand am 16. Januar im sogenannten Figaro-Haus statt, ganz in der Nähe des Stephansdoms. Hier hat Wolfgang Amadé Mozart mit seiner Familie von 1784 bis 1787 gelebt und unter anderem Le nozze di Figaro komponiert. Sie ist als einzige der Wiener Wohnungen Mozarts erhalten und gleichzeitig die vornehmste und teuerste Wohnung, die Mozart jemals bewohnt hat. Das aus dem 17. Jahrhundert stammende Gebäude ist heute aufwendig restauriert und kann als Museum besucht werden. Die Wohnung besteht aus vier Zimmern, zwei Kabinetten und einer Küche, in denen das Leben und Treiben der Mozartschen lebendig wird. Insbesondere das große Zimmer auf die Straße regt dazu an, sich vorzustellen, wie Haydn und weitere Freunde gespannt die erste Aufführung der wundervollen herrlich melodienreichen und kunstfertigen Quartette verfolgten. Beethoven Ludwig van Beethoven bewohnte von Januar 1803 bis Mai 1804 eine Dienstwohnung im Theater an der Wien, weil er für das Theater eine Oper schreiben sollte – bekanntlich zog es sich noch bis zur Uraufführung des Fidelio, Beethovens einziger und einzigartiger Oper. Am 5. April 1803 stand ihm der Theatersaal für eine eigene Akademie zur Verfügung, in der er das 3. Klavierkonzert op. 37 uraufführte. Es ist das einzige Klavierkonzert Beethovens in Moll, und mit diesem weist Beethoven der Gattung endgültig den Weg aus dem Salon in den Konzertsaal. Es geht nicht mehr um brillante oder liebenswürdige Einlagen des Solisten, sondern Klavier und Orchester treten in einen spannungsgeladenen, gleichberechtigten Dialog, der einmal von ernstem Wettstreit, ein anderes Mal von Innigkeit, und an anderer Stelle von geistvollem Esprit gekennzeichnet ist. Der Entstehungsprozess hatte sich über etliche Jahre hingezogen, die Uraufführung hatte Beethoven mehrmals verschoben. Auch diesmal hatte er für die Niederschrift nicht viel Zeit aufbringen können, da gleichzeitig die Uraufführung des Oratoriums Christus am Ölberge stattfand. Beethoven saß am Klavier und spielte praktisch auswendig, sein Freund und Komponistenkollege Ignaz Ritter von Seyfried blätterte ihm um – er leitete wohl auch die Aufführung. Seyfried berichtet 1833: „Beim Vortrage seiner Concert-Sätze lud er mich ein, ihm umzuwenden; aber – hilf Himmel! – das war leichter gesagt als gethan; ich erblickte fast lauter leere Blätter; höchstens auf einer oder der anderen Seite ein paar, nur ihm zum erinnernden Leitfaden dienende, mir rein unverständliche egyptische Hieroglyphen hingekrizelt; denn er spielte beinahe die ganze Prinzipal-Stimme blos aus dem Gedächtniß, da ihm, wie fast gewöhnlich, die Zeit zu kurz ward, solche vollständig zu Papiere zu bringen. So gab er mir also nur jedesmal einen verstohlenen Wink, wenn er mit einer dergleichen unsichtbaren Passage am Ende war, und meine kaum zu bergende Aengstlichkeit machte ihm einen ganz köstlichen Spaß, worüber er sich noch bei unserem gemeinschaftlichen jovialen Abendbrote vor Lachen ausschütten wollte.“ An die ferne Geliebte gilt als der erste künstlerisch gelungene Liederzyklus – das Autograf trägt das Datum „1816 im Monath April“. Die Dichtung stammt von dem bedeutenden Arzt und Schriftsteller Alois Jeitteles aus Brünn, der 1819 in Wien promovierte. Wie Beethoven zu den Gedichten kam, ist nicht geklärt, daher wissen wir auch nicht, ob Beethoven an dem Text etwas geändert hat. Es ist nicht verwunderlich, dass Beethoven, dem Formgenie, auf Anhieb der große Wurf des Liederzyklus gelingt. Die Parallele im ersten und letzten Gedicht, die schon textlich einen Bogen spannt, und die Tatsache, dass das gesamte musikalische Material aus dem ersten Lied erwächst, gewährleisten die Einheit und den geschlossenen Gesamteindruck. Gleichzeitig darf man die Worte der dritten Strophe des letzten Liedes „ohne Kunstgepräng“ wörtlich nehmen, denn Beethoven stellt seine fantastische Kunst nirgends zur Schau, die Lieder klingen schlicht und natürlich wie spontane „Herzensergießungen“, wie man in der Zeit sagte. Wir dürfen wohl annehmen, dass Beethovens Liederzyklus etwas mit seiner persönlichen Lebenssituation zu tun hatte. Berühmt ist sein „Brief an die Unsterbliche Geliebte“, der zu vielen Spekulationen Anlass gab, aber doch immerhin sicherstellt, dass Beethoven zwischen Entsagung und Besitzanspruch, zwischen Sehnsucht, Schmerz und Hoffnung hin und her gerissen wurde. In einem Brief an Ferdinand Ries im Mai 1816 schrieb er: „... alles Schöne an Ihre Frau – leider habe ich keine, ich fand nur eine, die ich wohl nie besitzen werde.“ Allerdings, die Wärme und die Innigkeit, die Beethoven diesen melancholischen Liedern verleiht, sind eine Manifestation der Sicherheit, dass Liebe „jeden Raum und jede Zeit“ überwindet, sie sind keine Absage, sondern ein einziges Plädoyer für Vertrauen und Liebe. Schubert Die Geselligkeit (1818) und Der Tanz (aus dem Todesjahr 1828) sind jene Art von geselligen Stücken, die von Schubert erwartet wurden und die für ihn typisch sind, wenngleich wir heute seinen Tiefsinn und seine dunklen Seiten mehr schätzen. Die „Schubertiade“ – ein Begriff, den Schubert selbst verwendete – wurde zum Inbegriff der privaten Veranstaltungen, bei denen sich Kunst und persönliche Anteilnahme oft die Waage hielten. Freundschaft und austauschendes Beisammensein waren einerseits sparsame Vergnügungen im Biedermeier des Metternich‘schen Spitzelstaats, andererseits übernahm das Bürgertum allmählich vom Adel die führende Rolle in der Kulturpflege, die natürlich weit weniger repräsentativ war – man konnte sie sogar alleine veranstalten: „... auch geb’ ich mir zuweilen Schubertiaden“, schrieb Kuppelwieser an Schober am 8. März 1824. Die beiden Gesangsquartette umspannen beinahe den gesamten Schaffenszeitraum des vielleicht geliebtesten Wiener Komponisten. Der Name Franz Schubert öffnet im Herzen aller Musikliebenden die ganz inneren Kammern, gehören doch seine Melodien zu den Schätzen in beinahe jedermanns musikalischen Erinnerungen. Doch der heutige Respekt steht in schroffem Gegensatz zu dem armen, armseligen und kurzen Leben Schuberts. Geboren am 31. Januar 1797 in der Rauchküche als zwölftes von 14 Kindern seiner früh verstorbenen Mutter Elisabeth, verbrachte er eine bestimmt turbulente Kindheit im Haus Zum roten Krebs in der Nussdorferstrasse 54, damals Vorstadt Himmelpfortgrund. Strahlt das Haus heute nostalgische Beschaulichkeit aus (es ist erhalten und als hochinteressantes Museum ausgestaltet), war es damals gewiss voll lärmenden Lebens: 70 Personen hausten in den 16 Wohnungen in dem kleinen einstöckigen Haus, die jeweils aus zwei Räumen bestanden. Zudem unterhielt Schuberts Vater im Erdgeschoss eine zweiklassige Volksschule, für die im Jahr 1796 insgesamt 174 Schüler nachgewiesen sind. Schubert trat in die Fußstapfen seines Vaters, absolvierte die Lehrerausbildung in der Normalhauptschule St. Anna in der Annagasse und stand ihm 1814 bis 1818 als Schulgehilfe zur Seite. In dieser Zeit und in der väterlichen Wohnung entstand eines der bekanntesten Lieder überhaupt: Das Heidenröslein auf ein Gedicht von Goethe, der wichtigste unter Schuberts etwa 120 Textlieferanten für seine über 600 Lieder. Am 19. August 1815 vertonte der 18-jährige Schubert aber nicht nur dieses Goethegedicht, sondern, scheinbar ohne Mühe, insgesamt sechs! Darunter ist auch die erste schlichte strophische Fassung von An den Mond, die erst 1850 veröffentlicht wurde. Vermutlich zwei Jahre später entstand das berühmte Lied Die Forelle, von dem sieben Autografen bekannt sind und das als drittes Lied von Schubert gedruckt wurde. Das Gedicht über den überlisteten Fisch erschien erstmals 1783 im Schwäbischen Musen-Almanach und stammt von Christian Friedrich Daniel Schubart, der es während seiner zehn Jahre andauernden Haft von 1777 bis 1787 auf der Festung Hohenasperg schrieb, in der er aus politischen Gründen ohne rechtmäßige Verurteilung festgehalten wurde. Man darf vermuten, dass die etwas alberne Moral der letzten Strophe, die Mädchen vor bösen Verführern warnt und von Schubert folgerichtig ignoriert wurde, ein Ablenkungsmanöver darstellt und die Forellen-Fabel Schubarts politisches Schicksal abbildet. Schubert schätzte das Lied mit seiner unverwechselbaren Atmosphäre und seiner sofort kennbaren Klavierbegleitung, wodurch sich die vielen Autografe und die weitere Verwendung im „Forellen“-Quintett erklären. Als Schubert sich vom Dienst an väterlicher Schule und Staat löste, blieb er fortan ein freier Komponist, der freilich oft kümmerlich lebte und vom Entgegenkommen seiner zahlreichen und treuen Freunde abhing. Nach dem Erinnerungszeugnis Anselm Hüttenbrenners soll er überzeugt geäußert haben: „Mich soll der Staat erhalten, ich bin zu nichts als zum Komponieren auf die Welt gekommen.“ Aber der Staat setzte bekanntlich andere Prioritäten. Von der Öffentlichkeit weitgehend ignoriert, in der Liebe erfolglos, nur von einigen wenigen geschätzt und gefördert, blieb Schubert als Wirkungskreis weitgehend nur die Runde der Freunde. Vieles ging verloren, vieles wurde erst Jahrzehnte nach seiner Entstehung veröffentlicht – während des 19. Jahrhunderts blieb Schubert ein Geheimtipp, der mit privatem Unglück und biedermeierlicher Idylle assoziiert wurde. Erst das 20. Jahrhundert erkannte Schuberts Modernität und monumentale Bedeutung.