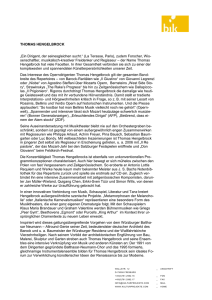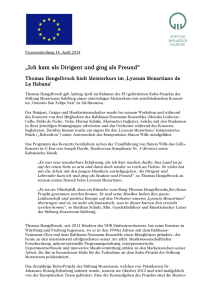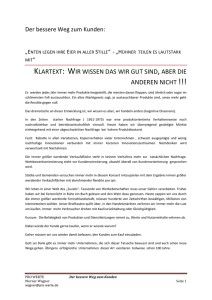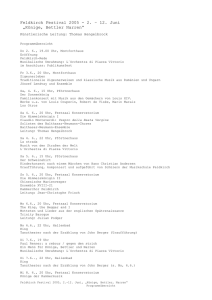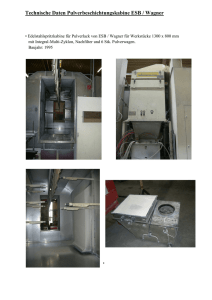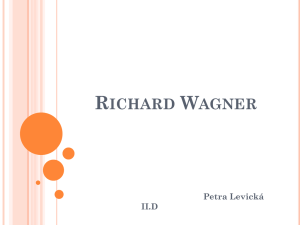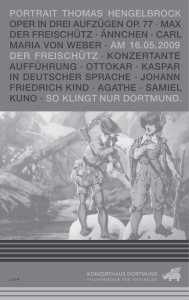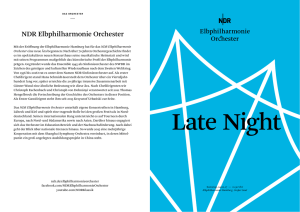Nordbayerischer Kurier_20110811
Werbung

11. August 2011 Leise Töne sorgen für neuen Klang BAYREUTH. Thomas Hengelbrock, der musikalische Leiter des „Tannhäuser“, äußert sich erstmals über seine Arbeit am Grünen Hügel. „Detailgenau“, „filigran“, „behutsam“, „durchsichtig“ – die Kritik war voll des Lobes über Thomas Hengelbrocks Debüt am Pult des Bayreuther „Tannhäuser“. Im Gegensatz zu Sebastian Baumgartens Inszenierung. Im Gespräch mit Alexander Dick äußert sich der Freiburger Dirigent und neue Chef des NDR-Sinfonieorchesters exklusiv über die Arbeit am Grünen Hügel. Frage: Herr Hengelbrock, eine persönliche Frage: Als Sie nach der Premiere im Festspielhaus vor den Vorhang traten, hagelte es ja eine Reihe überraschender Buhs. Was ist da in Ihnen vorgegangen? Thomas Hengelbrock: Erst mal muss ich sagen, dass ich eigentlich mit den musikalischen Ergebnissen sehr zufrieden war – vor allem in Anbetracht der Probensituation. Das sind natürlich Dinge, die ein Publikum nicht weiß. Wir hatten nur vier BOs à drei Stunden (Anm. d. Red.: Bühnenorchesterproben) – für eine Neuinszenierung! Das Bühnenbild war auf der Probebühne nicht zu simulieren, wie Sie sich vorstellen können. Mir ist es nicht anders ergangen als allen Vorgängern und man ist hier aufgrund der extremen und immer extremer werdenden Probensituation gezwungen, etwas abzuliefern, was noch nicht fertig ist. Die zweite Aufführung war unglaublich viel besser, und es gab viele Bravos. Frage: Oder die Buhs gehen auf eine ungewohnte Hörerfahrung in Bayreuth zurück und kamen aus einer Ecke, für die die Gleichung Wagner im Festspielhaus = laut und monumental gilt? Hengelbrock: Es gibt eine ganz bestimmte Fraktion, aber das ist doch normal. Ich habe noch viel mehr an Widerständen erwartet, nach dem, was hier umging an Gerüchten. Die Leute haben nach den ersten Proben erleichtert oder augenzwinkernd reagiert, weil es vorher hieß, die Streicher dürften nicht vibrieren und ... Ich bin hier am ersten Tag, als ich ankam, von der Rezeptionistin an der Pforte angesprochen worden, ob denn jetzt das Orchester auf Darmsaiten spielen müsse. Da gab es viele Unsinnigkeiten, ob das Orchester denn herunterstimmen müsse und so weiter. Manche im Publikum begegnen einem hier einfach mit Vorbehalten, wenn man einen „Tannhäuser“ in seiner Tradition liest. Und die Tradition, das sind die drei Komponisten Carl Maria von Weber, das ist Mendelssohn und auch Bellini – nicht so sehr Meyerbeer. Viele wissen auch nicht, dass der größte Teil des „Tannhäuser“ im Piano geschrieben ist. Daran gemessen war die Aufnahme hier im Haus von allen Seiten sehr positiv. Und ich bin in solchen Punkten eigentlich sehr unemotional – ich habe das Gleiche erlebt, als ich vor gut 20 Jahren mit der Barockmusik anfing und ein Berliner Kritiker mich anlässlich meiner ersten konzertanten Gluck-Oper in Wien als Saddam Hussein der klassischen Musik bezeichnete. Wenn wir jetzt im Wagner-Heiligtum versuchen, das Orchester anders klingen zu lassen und auch bestimmte Parameter beim Gesang, was sicher nicht immer gelungen ist, anders zu machen, dann muss man diesen Aspekten auch ein bisschen Zeit lassen. Und die sind ja nicht willkürlich, die ergeben sich aus dem Notentext und der historischen Stellung dieses Stückes. Frage: Der „Tannhäuser“ ist eine fast unendliche Geschichte im Hinblick auf die Fassungen und Überarbeitungen Richard Wagners. Ihre aktuelle Bayreuther Fassung gründet auf der ersten, der Dresdner. Im Programmheft sagen Sie, dass Sie gerne eine andere gespielt hätten. Welche wäre das gewesen, und warum ist es nicht dazu gekommen? Hengelbrock: Zunächst: „Tannhäuser“ war Wagners größtes Sorgenkind – es gibt kein Werk, an dem er bis zu seinem Lebensende so herumgearbeitet hat. Eigentlich hätte ich gerne, das war mein erster Vorschlag, die allerletzte – „Wiener“ – Fassung gemacht ... Frage: ... die dann ja 1891 auch zur ersten Bayreuther wurde ... Hengelbrock: ... richtig. Dazu eine Inszenierung zu finden, die das ganze Geschehen biografisch aufgearbeitet hätte – Wagner als Tannhäuser –, das hätte ich mir sehr spannend vorstellen können. Als es dann hieß, wir müssen die Dresdner Fassung machen ... Frage: Weshalb? Hengelbrock: Wolfgang Wagner sagte, es sei nicht daran zu rütteln, dass hier in Bayreuth die Dresdner Fassung gespielt würde ... Frage: Mit Verlaub, diese Fassung wird erst seit Wolfgang Wagners Inszenierung 1985 hier regelmäßig gespielt ... Hengelbrock: ... richtig – aber Wagner sagte, er habe beschlossen, diese hier zu spielen. Daraufhin fragte ich ihn: Welche von den Dresdner Fassungen? Denn da gibt es ja schon unzählige. Ich hätte es nun sehr spannend gefunden, die Fassung hier zu machen, zu der Wagner im ersten Jahr nach der Dresdner Uraufführung kam – ohne den Wiederauftritt der Venus im dritten Akt. Weil Wagner sagt: Alles spielt sich im Kopf des zunehmend „vom Wahnsinn ergriffenen“ Tannhäuser ab – das Publikum muss sich das alles vorstellen. Es ist sozusagen eine ganz große romantische Wahnsinnsszene im dritten Akt. Das komplette Gegenstück ist dann viele Jahre später entstanden, weil Wagner gesehen hat: Das Publikum versteht das alles nicht. Die Geschichte des „Tannhäuser“ ist eine Geschichte der zunehmenden szenischen Konkretisierung. Vor diesem Hintergrund – alle Geschehnisse werden real auf der Bühne gezeigt, wird das ganz, ganz starke, in der Romantik präfigurierte Moment der inneren Vorstellung – vergleichen Sie das mit Schumanns „Manfred“, ein „Lesedrama“ – aufgegeben. Notabene: Wagner hat sich selber dafür bestraft, dass er alles auf die Bühne geholt hat – nämlich beim „Ring“. Auch der „Ring“ ist ein Drama im Geiste, und in dem Moment, in dem er 1876 alles auf die Bühne geholt hat, kam ihm das so entsetzlich armselig vor. Er wollte das Haus hier abbrennen, hat gesagt, nächstes Jahr machen wir hier alles anders – es war für ihn ein entsetzlicher Misserfolg. Als Künstler glaube ich, dass der entscheidende Moment, auch im „Tannhäuser“ ist: Wie holen wir etwas, was in unserer Fantasie vorhanden ist, real auf die Bühne? Das ist ein Problem, das Wagner zeit seines Lebens für sich nicht zufriedenstellend gelöst hat. Frage: Zumal in den späteren Fassungen die Ambivalenz seiner Musiksprachen, bedingt durch seine kompositorische Weiterentwicklung, noch stärker zum Tragen kommt. Hengelbrock: Das könnte man natürlich auf fruchtbar machen durch eine Inszenierung, die wirklich aus der Musik geboren wird. Frage: Was hier fehlt. Sie haben in Ihrer Dresdner Fassung zwei Striche gemacht – es fehlen die „Erbarme-dich“-Rufe und eine Strophe der Tannhäuser-Arie. Weshalb? Hengelbrock: Das hat Wagner selber so vorgenommen, und zwar sofort nach der Uraufführung, und hat selber die dafür nötigen Modulationen geschrieben. Er hat es gemacht, um den Sänger zu entlasten, und er hat es selbst in den nächsten Jahren weitere 17 Male so dirigiert – mit übrigens noch viel weitergehenden Strichen. In einem Brief von 1852 hat er dann darauf bestanden, dass dieser „Tannhäuser“ ohne Striche geführt wird. Wagner hat jeden seiner komponierten Takte verteidigt – wie eine Löwenmutter ihr Baby. Seine eigene dirigentische Praxis sah allerdings ganz anders aus. Und seine extreme Rücksichtslosigkeit gegenüber Sängern hat nicht zuletzt hier in Bayreuth auch viele Opfer gefordert. Und da wusste ich, dass wir es hier in Bayreuth mit Lars Cleveman anders machen müssen, und ich bin sehr stolz darauf, ihn so durch die Partie geführt zu haben, dass er am Schluss die Rom-Erzählung vollkommen unangestrengt, kraftvoll und entspannt gesungen hat. Wir werden jetzt nach und nach dazu übergehen, die Striche vielleicht wieder aufzumachen – in dem Maße, in dem er in diese Rolle hineinwächst. Frage: Die werkhistorischen Gründe sind in dem Fall fast den pragmatischen untergeordnet? Hengelbrock: Ja, aber wie bei Wagner selbst. Es gibt auch bei Wagner diese herrliche Diskrepanz zwischen dem Praktiker und dem Theoretiker. Das sollten wir immer im Sinn behalten. Für mich ist Wagner der Zarathustra Nietzsches: Heute predige ich Rotwein, und morgen wollen wir alle Wasser oder gar Champagner trinken. Und da bin ich eben auch Praktiker. Frage: Bei „Tannhäuser“ fällt ja noch eines auf – dieses Werk ist nicht für die akustischen Verhältnisse des Bayreuther Festspielhauses geschrieben. Hätten Sie sich lieber einen nicht gedeckelten Orchestergraben gewünscht? Hengelbrock: Zunächst mal bin ich dankbar und glücklich, hier dirigieren zu dürfen. Für wen das keine Ehre ist, der sollte hier erst gar nicht antreten. Das vorausgeschickt, muss ich sagen, dass diese Akustik hier für Stücke wie „Tannhäuser“ oder „Meistersinger“ nicht günstig ist. Wagners erster größerer stilistischer Bruch kommt mit dem „Lohengrin“ – das hängt zusammen mit der Verflüssigung, der Vergesanglichung der Basslinien, womit der Klang diese ganz spezifischen Legato-Qualitäten bekommt, die er auch später im „Ring“ weiter ausbaut. Frage: Noch mal zur Akustik: Ich hatte nicht den Eindruck, dass das Bühnenbild mit seinen enormen Öffnungen zur Seite den guten Klang in diesem Haus fördert. Waren Sie darüber glücklich? Hengelbrock: Nein. Aber es ist einfach so, dass der Klang bei voll besetztem Haus, und das habe ich erst in der Generalprobe gemerkt, sich über die Seiten, nun ja, „verlustiert“. Ich habe oft Schwierigkeiten, die Sänger im Mezzopiano hier wirklich gut zu hören. Aber wir machen auch keine Konzerte – wir machen Musiktheater. Frage: Wie viel Einfluss hat der Dirigent in den Konzeptionsgesprächen auf solche Dinge? Hengelbrock: Das ist ganz verschieden. In diesem Fall gab es relativ wenig Berührungspunkte. Sebastian Baumgarten hatte sich intensiv mit Katharina Wagner kurzgeschlossen, hatte sehr früh die Idee mit dem Bühnenbild – das ging, ich will sagen, sehr selbstständig vonstatten. Ich wollte mich auch nicht gegen so etwas Prinzipielles sträuben, zumal ich auf dem Standpunkt stehe, dass ich als Operndirigent Regisseure und Bühnenbildner unterstützen muss. Und ich bin nicht jemand, der von vorneherein sagt, aus ästhetischen Gründen wehre ich mich gegen jedes Experiment. Frage: Umgekehrt könnte man ja auch genauso einfordern, dass ein Regisseur einen Dirigenten unterstützen muss. Hengelbrock: Ja ... (macht eine Pause) Das war allerdings hier relativ wenig der Fall. Frage: Das heißt: Sie hätten sich szenisch einen anderen „Tannhäuser“ gewünscht? Hengelbrock: Das ist jetzt ein schwieriger Punkt. Ich möchte nicht illoyal gegen mein Team sein. Frage: Sie haben hier, wie Sie sagten, auf wesentliche Elemente der historischen Aufführungspraxis – Darmsaiten etc. – verzichtet. Hätte es denn einen Vorteil in diesem Haus gebracht? Hengelbrock: Dieses Orchester hier spielt wirklich fantastisch – die kommen in die erste Probe und können das einfach, spielen mit Hingabe, Lust. Da soll man nichts ändern. Wenn ich mit meinem Balthasar-Neumann-Ensemble in anderthalb Jahren den „Parsifal“ mache, dann werden wir das natürlich anders machen, mit historischem Instrumentarium. Das gibt eine vollkommen andere Balance innerhalb des Orchesters. Ich nehme für mich einfach hier in Anspruch, was auch die anderen Kollegen zu mir gesagt haben: Du wirst Vorstellung für Vorstellung nachjustieren. Frage: Wie denken Sie denn in Richtung kommendes Festspieljahr? Hengelbrock: Zunächst müssen wir einen Probenplan festlegen, und da muss man hart verhandeln, was man bekommen kann. Es ist wirklich sehr schwierig mit den Probenbedingungen hier. Dabei impliziert der Name „Werkstatt“ doch schon, dass wir alle nicht hierher kommen wegen des Geldes, sondern dass wir Zeit mitbringen, Dinge ausprobieren wollen. Ich muss dennoch sagen, ich bin im Kern hochzufrieden mit den Ergebnissen, wenn auch nicht mit den Grundbedingungen, die ich hier vorgefunden habe. Da ist eine fabelhafte Basis, um darauf weiter aufzubauen. Frage: Das heißt, wenn kolportiert wird, dass Sie nächstes Jahr in Bayreuth nicht wieder antreten wollen, stimmt das nicht? Hengelbrock: Echt? Natürlich habe ich vor, wiederzukommen. Aber die Entscheidung liegt wie bei den anderen Dirigenten und Sängern bei der Festspielleitung. Frage: Wo sehen Sie Ansatzpunkte zur Verbesserung? Hengelbrock: Es gibt natürlich ganz viele. Zum Beispiel, dass wir vier Wochen vor der Premiere keine einzige Ensembleprobe mehr hatten – das geht nicht. Und so gibt es viele Dinge, die einfach einen besseren Sitz vertragen. Frage: Sehen Sie das auch von der Regie hier mit übernommene Wagner-Zitat „Ich bin der Regie noch einen ,Tannhäuser‘ schuldig“ auf Ihre Person als Dirigent bezogen? Hengelbrock: (seufzt) Nein, ich finde, was wir hier machen, ist immer nur eine Momentaufnahme. Von all dem, was ich bisher gemacht habe, gibt es eigentlich kaum Dinge, wo ich sage: Da kann ich nicht dazu stehen. Man muss alles immer aus seinem biografischen Kontext sehen. Frage: Und was ist Ihr Wunsch an dieses Festspielhaus? Wie sollte es sich weiterentwickeln? Hengelbrock: Das ist jetzt meine ganz bescheidene, persönliche Meinung. Ich würde zwei Dinge ganz fundamental ändern. Erstens: Ich würde radikal bessere Probenbedingungen schaffen. Zweitens: Ich würde nach wie vor diese Werke hier spielen, auch in diesem interessanten Wechsel. Aber ich würde es erweitern um neue Opern: jedes Jahr ein Werk der Gegenwart. Stellen Sie sich mal vor, Sie machen Luigi Nonos „Prometeo“ in diesem Haus, in dieser Akustik. Oder Lachenmanns „Mädchen mit den Schwefelhölzern“. Oder es gäbe jedes Jahr in der Wagner-Werkstatt Kompositionswettbewerbe mit Vorauswahl. Dann könnte man hier wirklich enorme Impulse für das zeitgenössische Musiktheater geben. Das wäre etwas, da bin ich mir ganz sicher, das hätte Richard Wagner wahnsinnig gut gefallen. Er war ja auch jemand, der beständig sich selbst neu erfunden hat, weil er mit den alten Sachen nicht zufrieden war.