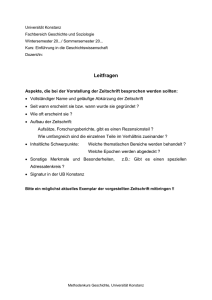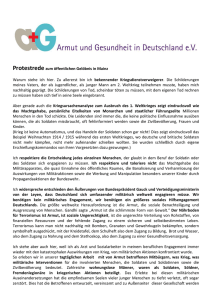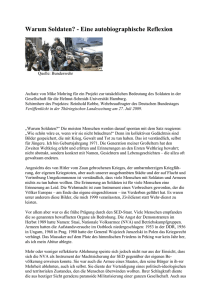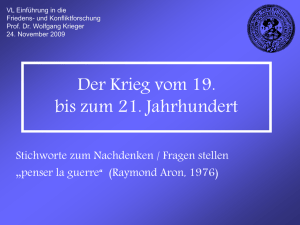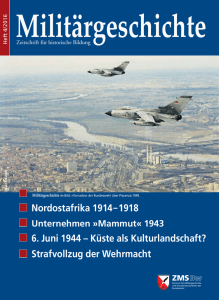Die Balkankriege 1912/13 Erster Weltkrieg: Die 2. und 3. OHL
Werbung

B^a^i~g\ZhX]^X]iZ :EITSCHRIFTFÓRHISTORISCHE"ILDUNG C 21234 ISSN 0940 - 4163 ÊÊ Heft 2/2008 Militärgeschichte im Bild: Niederschlagung des Prager Frühlings durch Warschauer-Pakt-Truppen am 21. August 1968 Die Balkankriege 1912/13 Erster Weltkrieg: Die 2. und 3. OHL Henning von Tresckow 1941 Das Bauwesen der NVA ÌBÀ}iÃV V ÌV iÃÊÀÃV Õ}Ã>Ì Impressum Editorial Militärgeschichte Zeitschrift für historische Bildung Herausgegeben vom Militärgeschichtlichen Forschungsamt durch Oberst Dr. Hans Ehlert und Oberst i.G. Dr. Hans-Hubertus Mack (V.i.S.d.P.) Produktionsredakteur der aktuellen Ausgabe: OTL Dr. Harald Potempa Redaktion: Hauptmann Matthias Nicklaus M.A. (mn) Hauptmann Magnus Pahl M.A. (mp) Oberstleutnant Dr. Harald Potempa (hp) Hauptmann Klaus Storkmann M.A. (ks) Mag. phil. Michael Thomae (mt) Bildredaktion: Dipl.-Phil. Marina Sandig Redaktionsassistenz: Michael Schadow, cand. phil. (ms) Lektorat: Dr. Aleksandar-S. Vuletić Layout/Grafik: Maurice Woynoski / Medienwerkstatt D. Lang Karten: Dipl.-Ing. Bernd Nogli Anschrift der Redaktion: Redaktion »Militärgeschichte« Militärgeschichtliches Forschungsamt Postfach 60 11 22, 14411 Potsdam E-Mail: MGFARedaktionMilGeschichte@ bundeswehr.org Telefax: 03 31 / 9 71 45 07 Homepage: www.mgfa.de Manuskripte für die Militärgeschichte werden an diese Anschrift erbeten. Für unverlangt ein­ gesandte Manuskripte wird nicht gehaftet. Durch Annahme eines Manuskriptes erwirkt der Herausgeber auch das Recht zur Veröffent­ lichung, Übersetzung usw. Honorarabrechnung erfolgt jeweils nach Veröffentlichung. Die Redaktion behält sich Kürzungen eingereichter Beiträge vor. Nachdrucke, auch auszugsweise, fotomechanische Wiedergabe und Übersetzung sind nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch die Redaktion und mit Quellenangaben erlaubt. Dies gilt auch für die Aufnahme in elektronische Datenbanken und Vervielfältigungen auf CD-ROM. Die Redaktion hat keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte derjenigen Seiten, auf die in dieser Zeitschrift durch Angabe eines Link verwiesen wird. Deshalb übernimmt die Redaktion keine Verantwor­ tung für die Inhalte aller durch Angabe einer Link­ adresse in dieser Zeitschrift genannten Seiten und deren Unterseiten. Dieses gilt für alle aus­ge­ wählten und angebotenen Links und für alle Sei­ ten­inhalte, zu denen Links oder Banner führen. © 2008 für alle Beiträge beim Militärgeschichtlichen Forschungsamt (MGFA) Sollten nicht in allen Fällen die Rechteinhaber ermittelt worden sein, bitten wir ggf. um Mitteilung. Druck: SKN Druck und Verlag GmbH & Co., Norden ISSN 0940-4163 Das vorliegende Heft widmet sich in drei Großbeiträgen dem sogenannten Zeitalter der Weltkriege. Diese »Katastrophenzeit« in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist gekennzeichnet durch »die Extensivierung im Einsatz von Gewaltmitteln und -methoden, die Ausbreitung [des Krieges] in den europäischen Großraum und [dessen] Ausweitung in den innergesellschaftlichen Binnenraum« (Bruno Thoß). Ein Schlüsselbegriff im Zeitalter der Weltkriege ist »Vernichtung«. Burkhard Köster arbeitet am Beispiel der 2. und 3. Obersten Heeresleitung (OHL) das Verständnis von »Vernichtungs- und Ermattungsstrategie« im Ersten Weltkrieg heraus, die beide, bei allen Unterschieden, eines zum Ziel hatten: den Feind niederzuwerfen. Die Vernichtung ganzer Bevölkerungen war weder in der einen noch in der anderen dieser Strategien vorgesehen. Michael Schwartz führt am Beispiel der Balkankriege von 1912 und 1913 aus, dass die Niederwerfung des Gegners jedoch schon damals auch die Vernichtung der Zivilbevölkerung oder die Vertreibung ganzer Volksgruppen bedeuten konnte. Thomas Reuthers Beitrag über Generalmajor Henning von Tresckow (1901 bis 1944), einen der führenden Köpfe des militärischen Widerstands gegen Hitler, zeigt unter anderem den Wandel des Verständnisses von Vernichtung bei den obersten Strategen. Das NS-Regime wollte seine Gegner nicht nur militärisch niederwerfen, sondern aus rasseideologischen Gründen sowie zur Gewinnung von »Lebensraum« im Osten Kombattanten und Zivilisten gleichermaßen physisch vernichten. Tresckow war an der Ostfront im Hauptquartier der Heeresgruppe Mitte eingesetzt und hatte Kenntnis von den Vorgängen an der Front und im rückwärtigen Bereich. Seine Entscheidung zum Widerstand und damit letztlich zur Mitwirkung am 20. Juli wurde durch die erlebte Praxis der unterschiedslosen Vernichtung maßgeblich beeinflusst. Innerhalb eines Zeitraumes von wenig mehr als 30 Jahren verlor Deutschland zwei Kriege. Die beiden Kriegsenden konnten unterschiedlicher nicht sein. Burkhard Köster verweist darauf, dass die OHL im Herbst 1918 den Krieg für verloren hielt. Sie drängte die Reichsregierung zu einem raschen Waffenstillstand, der am 11. Nov. 1918 unterzeichnet wurde. 1944/45 zeichnete sich die deutsche Niederlage im Zweiten Weltkrieg ab. Thomas Reuther führt am Beispiel Tresckows die Problematik des militärischen Widerstandes aus: Militärische Widerstandshandlungen gegen das NS-Regime hatten nur angesichts einer Niederlage Aussicht auf Erfolg. Die Soldaten des Widerstandes mussten also die Erfolglosigkeit auf dem Schlachtfeld in ihr Kalkül mit einbeziehen. Ein Mittel, das verbrecherische NS-Regime und den verlorenen Krieg schnell zu beenden, war das (gescheiterte) Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944. Im vierten Großbeitrag beschreibt Klaus Udo Beßer schließlich das Bau­ wesen der Nationalen Volksarmee und stellt sie als Wirtschaftsreserve der DDR vor. Ein Schlusswort in eigener Sache: Die Redaktion begrüßt Herrn Hauptmann Magnus Pahl M.A. in ihren Reihen und dankt Herrn Oberleutnant ­Julian Finke M.A., der aus dem Team der »Militärgeschichte« ausscheidet, für sein gezeigtes Engagement. Der Redaktionsassistent hat ebenfalls gewechselt. Wir danken Herrn cand.phil. Stefan Stahlberg für seine Arbeit und heißen Herrn Michael Schadow willkommen. Oberstleutnant Dr. Harald Potempa Inhalt Die Balkankriege 1912/13: Kriege und Vertreibungen in Südosteuropa 4 Prof. Dr. Michael Schwartz, geboren 1963 in Recklinghausen, Wissenschaftlicher Mit­ arbeiter am Institut für Zeitgeschichte ­(Abteilung Berlin) und Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der Westfälischen ­Wilhelms-Universität Münster Ermattungs- oder Vernichtungsstrategie? Die Kriegführung der 2. und 3. Obersten Heeresleitung (OHL) 10 Das historische Stichwort: Der Entsatz von Wien im September 1683 22 Medien online/digital 24 Lesetipp 26 Ausstellungen 28 Geschichte kompakt 30 Militärgeschichte im Bild Dr. Burkhard Köster, geboren 1961 in Rheine/Westf., Oberstleutnant und Referent im Führungsstab der Streitkräfte I 4 Auf dem Weg zum 20. Juli 1944. Henning von Tresckow im Jahre 1941 Service ČSSR 1968: Militärische Reaktionen des Westens 14 Thomas Reuther, geboren 1973 in Mannheim, Hauptmann d.R. und Historiker, Potsdam Niederschlagung des Prager Frühlings durch Warschauer-Pakt-Truppen am 21. August 1968. Foto: Süddeutsche Zeitung Photo Nationale Volksarmee: ­Arbeitskraftreserve der DDR? Das Bauwesen der NVA Dipl.-Bauingenieur Klaus Udo Beßer, geboren 1950 in Aue/Sachsen, Oberstleutnant und Wissenschaftlicher Mitarbeiter im MGFA 18 Weitere Mitarbeiter dieser Ausgabe: Major Heiner Bröckermann M.A., Wissenschaftlicher Mitarbeiter, MGFA; Dr. Rüdiger Wenzke, Wissenschaftlicher Oberrat, MGFA. 31 Die Balkankriege 1912/13 Die Balkankriege 1912/13 ullstein bild Kriege und Vertreibungen in Südosteuropa 5 Erster Balkankrieg 1912/13: Aus Kleinasien vertriebene Griechen in Saloniki. S erben und Albaner betrachten das seit Februar 2008 unabhängige Kosovo als Mittelpunkt der eigenen Geschichte und als Herz des Balkans gleichermaßen. Wem das Kosovo »eigentlich« gehört, ist zwischen beiden Völkern bis heute heftig umstritten. Der jugoslawische Präsident Slobodan Milošević suchte die Streitfrage durch die großangelegte Vertreibung von Albanern zu lösen – was 1999 zur internationalen Besetzung des Kosovo und 2008 zur Unabhängigkeitserklärung eines albanisch dominierten Staates führte. Die Geschichte Jugoslawiens im 20. Jahrhundert und die Kriege und Konflikte auf dem Balkan im ausgehenden 20. und frühen 21. Jahrhundert prägen unsere Wahrnehmung der Region. Dabei beherrschte vor knapp hundert Jahren der Vorgängerstaat der heute weitgehend auf Kleinasien beschränkten Türkischen Republik, das nach seiner Sultansfamilie benannte »Osmanische Reich«, noch weite Teile Südosteuro- pas: Mazedonien, Albanien und Teile Griechenlands, Serbiens und Bulgariens. Auf dem Höhepunkt seiner Macht, im 16. Jahrhundert, hatte sich dieses Vielvölkerreich von Budapest bis Bagdad, von der Krim bis Kairo und Tunis erstreckt. Osmanische Armeen standen 1529 und nochmals 1683 vor der Kaiserstadt Wien, nach deren Eroberung womöglich weitere Teile des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation den Angreifern in die Hände gefallen und muslimisch geworden wären. Bekanntlich kam es anders. Das Osmanische Reich verlor seitdem immer mehr Grenzprovinzen an mächtiger werdende Nachbarn; Österreich-Ungarn und das Russische Zarenreich profitierten am meisten. Hinzu kam seit dem 19. Jahrhundert die Sprengkraft des modernen Nationalismus, der die Zukunft der Völker nicht in multinationalen »Völkerkerkern« erblickte, sondern in einheitlichen, möglichst »sauber« getrennten »Nationalstaaten«. Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 2/2008 In nur wenig mehr als hundert Jahren – von 1804 bis 1923 – zerstörte der Nationalismus die Stabilität der alten Vielvölkerreiche, darunter auch die des Osmanischen Reiches, von dem sich immer mehr »Nationalstaaten« abspalteten: zuerst die Serben und Griechen, dann die Rumänen, Montenegriner, Bulgaren, schließlich die Albaner. Das letzte Jahrzehnt dieser Entwicklung verlief besonders gewalttätig – beginnend mit dem »Ersten Balkankrieg« (1912/13), fortgesetzt im »Zweiten Balkankrieg« (1913) sowie unmittelbar danach im Ersten Weltkrieg, endend mit ethnischen »Säuberungen« und weiteren Kriegen bis 1923. Die Entstehung eines türkischen Nationalstaates auf den Trümmern des Osmanischen Reiches war der vorläufige Schlusspunkt dieser Entwicklung. Je nachdem, wer gerade die Oberhand in diesen militärischen Konflikten besaß: Es kam stets zu Gewalttaten auch an der Zivilbevölkerung des »Feindes«. Türkische Gräueltaten wie die Ermordung oder Versklavung der orthodoxen Bevölkerung von Chios während des griechischen Aufstands 1822, die türkischen »Bulgarengräuel« während des Aufstands von 1876 oder die türkischen Armeniermassaker von 1896 und 1915/16 prägten nachhaltig die Wahrnehmung der »zivilisierten« christlichen Welt. Letztere übersah dabei oft, dass muslimische Bevölkerungsgruppen unter den Gewalttaten seitens der christlichen Balkanvölker ebenso litten und – da das Osmanische Reich diese Kriege zumeist verlor – letztlich auch die Hauptleidtragenden von Flucht und Vertreibung waren. Ethnische »Säuberungen« im langen 19. Jahrhundert Die ethnische »Säuberung« des Balkans von den meisten Muslimen wurde nach den jahrelangen Aufständen der Serben (1804-1817) und der Griechen (1821-1830) nicht rückgängig gemacht, sondern auch im Frieden fortgesetzt und systematisiert. 1830 wurde den muslimischen Einwohnern Serbiens befohlen, »sich aus den ländlichen Gegenden Serbiens in Garnisonsstädte zurückzuziehen«, und dreißig Jahre später wurden auch diese Städte – allen voran Belgrad – von dort lebenden Türken zwangsweise geräumt. Als sich Serbien zwischen 1876 und 1878 mit russischer Hilfe die Unabhängigkeit vom Osmanischen Reich erkämpfte und sein Gebiet auf türkische Kosten vergrößerte, bewegte sich ein neuer muslimischer Flüchtlingsstrom über die Grenze. Eine ähnliche Vertreibungswirkung erzielte ab 1821 der griechische Unabhängigkeitskrieg. Hier war nicht nur die Zahl der Vertriebenen größer, hier erfolgte die Vertreibung – wiederum begleitet von Massakern – auch rascher. Wie der österreichische Historiker Carl von Sax bemerkte, waren binnen eines Monats auf dem Peloponnes »dreitausend türkische Häuser zerstört und fast zehntausend Mohammedaner getötet« worden, wofür sich die Türken an den Griechen andernorts mit Plünderung, Mord, Brandlegung und Versklavung christlicher Frauen und Kinder rächten. Die bedrohten Muslime des Peloponnes flüchteten aus den Dörfern in die Provinzhauptstadt Tri- Chronologie der Kriege in Südosteuropa 1804–1817Serbischer Aufstand und Befreiungskrieg gegen die Osmanen; Serbien wird autonom. 1821–1830Griechischer Aufstand und Befreiungskrieg gegen die Osmanen. 1830Griechenland wird unabhängig. 1877/78Russisch-Osmanischer Krieg um die Vorherrschaft auf dem Balkan. 1878Berliner Kongress. Die Großmächte regeln die Verhältnisse auf dem Balkan: Serbien, Montenegro und Rumänien werden unabhängig, Bulgarien bleibt tributpflichtig, Bosnien-Herzegowina fällt unter öster­ reichisch-ungarische Verwaltung. 1894–1896Im Osmanischen Reich Unruhen zwischen Muslimen und Armeniern, Massaker an den Armeniern. 1908Bulgarien wird unabhängig, Bosnien-Herzegowina von Österreich­Ungarn annektiert. 1911/12Aufstände der Albaner gegen die osmanische Herrschaft. 1912/13Erster Balkankrieg: Das Osmanische Reich verliert seine europäischen Besitzungen an Serbien, Bulgarien, Griechenland und Montenegro; Albanien wird unabhängig. 1913Zweiter Balkankrieg: Bulgarien kämpft erfolglos gegen Serbien, Griechenland und Montenegro und wird auch von Rumänien und dem Osmani­schen Reich angegriffen; die Osmanen erobern Edirne ­zurück. 1914–1918Erster Weltkrieg. 1918–1922Zerfall des Osmanischen Reiches, das zu den Verlierern des Ersten Weltkrieges gehört. 1920–1922Griechisch-Türkischer Krieg endet mit der Vertreibung der Griechen aus Kleinasien. 1923Vertrag von Lausanne, »Bevölkerungsaustausch« zwischen Griechenland und der Türkei; Mustafa Kemal (Atatürk) gründet die Türkische Republik. 1939–1945Zweiter Weltkrieg. 1991–1999Kriege auf dem Staatsgebiet des früheren Jugoslawiens (1991: Slowenien; 1991–1995: Kroatien; 1992–1995: Bosnien; 1999: Kosovo). politsa (die später von Griechen zerstört wurde) oder in die Festungen an der Küste. Gelang es den Griechen, eine solche Stadt zu erobern, wurde diese dem Erdboden gleichgemacht; deren Einwohner wurden massakriert. Als die Osmanen 1825 mit ägyptischen Hilfstruppen im Bürgerkrieg zeitweilig die Oberhand gewannen, wurde ihnen die Absicht unterstellt, alle Christen nach Ägypten zu verschleppen und sie in Griechenland durch Araber zu ersetzen. Dazu kam es nicht, stattdessen unterbreiteten 1826 die Großmächte Großbritannien und Russland den Vorschlag, »zum Zwecke der völligen Trennung der Nationen«, deren friedliches Zusammenleben nicht mehr möglich erscheine, sollten die Türken die griechischen Gebiete räumen. Diese völlige Ausweisung der Muslime aus dem griechischen Kernstaat wurde 1829/30 friedensvertrag- lich durchgesetzt. Und die territoriale Erweiterung Griechenlands im Laufe des 19. Jahrhunderts bewirkte wie im serbischen Parallelfall immer wieder Flucht oder Vertreibung von Muslimen. Ein besonders heikler Fall war die Insel Kreta – seit den 1860er Jahren von griechischen Aufständen erschüttert, durch griechisch-europäisches Zusammenwirken immer mehr aus dem Osmanischen Reich herausgetrennt und 1912 im Ersten Balkankrieg mit Griechenland vereinigt. Die ethnische »Säuberung« Kretas in diesen Bürgerkriegen vollzog sich ganz nach dem Muster des griechischen Aufstandes von 1821/22: Ein gewalttätiger Partisanenkrieg der Griechen trieb die muslimische Bevölkerung zur Flucht aus den Dörfern in die Hafenstädte, wo ihrerseits die Türken Rache an der griechischen Stadtbevölkerung nahmen. Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 2/2008 Die Balkankriege 1912/13 nerten deutlich an die ganz ähnliche Gewalt während der Balkankriege 1912/13. Auch damals wurde nationale Befreiung durch Massaker und Vertreibung erreicht, und schon damals mündeten Flucht und Vertreibung in staatliche Verträge über Zwangsumsiedlungen. Der Erste Balkankrieg 1912/13 Der Erste Balkankrieg begann im Oktober 1912, als ein »Balkanbund« aus Bulgarien, Serbien, Griechenland und Montenegro das Osmanische Reich angriff, um diesem die letzten europäischen Besitzungen zu entreißen. Die bulgarische Armee eroberte Adrianopel (Edirne) und kämpfte sich bis an die feindliche Hauptstadt Konstantinopel (seit 1930 Istanbul) heran. Währenddessen eroberten die Griechen das südmazedonische Selanik (Thessalonike/Saloniki) und Epiros, die Serben das zentralmazedonische Üsküb (Skopje) und, zusammen mit Montenegro, das Kosovo – jene Region, die für das serbische Nationalbewusstsein besonders wichtig ist, da dort die Hauptorte des mittelalterlichen serbischen Großreiches liegen: die alte Zarenstadt Prizren, der alte Hauptsitz der serbisch-orthodoxen Kirche in Peć, die von den serbischen Nemanjiden-Königen und -Kaisern gegründeten Klös­ ter Visoki Dečani und Sveti ­Arhandjeli (= Erzengelkloster). Was dieser Nationalismus – wie alle übrigen intoleranten Nachbarnationalismen – geflissentlich übersah, war zweierlei: zum einen, dass das mittelalterliche Reich der Serben – ebenso wie das Byzantinische Reich der Griechen oder das Osmanische Reich – kein moderner Nationalstaat, sondern ein Vielvölkerreich gewesen war; zum zweiten, dass das Kosovo seit mehreren hundert Jahren osmanisch beherrscht wurde, weshalb viele Serben – oft nach gescheiterten Aufständen – nach Norden in österreichisch-ungarisches Gebiet geflohen und viele Muslime (besonders Albaner) eingewandert waren. Montenegro versuchte im Ersten Balkankrieg 1912/13 zugleich das heutige Nordalbanien um Shkoder (Skutari) zu erobern. Der Krieg endete unter Vermittlung der Großmächte im Mai 1913 mit dem Frieden von London, der den Siegern die gesamte europäische Türkei zur Teilung überließ. Nur Konstantinopel blieb mit etwas europäischem Vorgebiet osmanisch, und nur der Kern ullstein bild Zeitweilig flüchteten in den 1860er Jahren Tausende kretischer (griechischer) Frauen und Kinder per Schiff nach Griechenland, wo viele verhungerten, da der schwache Staat mit ihrer Versorgung völlig überfordert war. Und obwohl Kreta trotz mehrerer Versuche erst 1913 an Griechenland fiel, wanderten schon lange zuvor viele Muslime aus ihrer unsicher gewordenen Heimat in andere Gebiete des Osmanischen Reiches aus, von denen sie annahmen, dass es für Muslime dort sicherer sei. Konflikte wie auf Kreta blieben daher nur scheinbar begrenzt, denn die Flüchtlinge verbreiteten ihre Gewalterlebnisse und ihre Revanchestimmung auch in den Aufnahmeregionen. Ein Teil der muslimischen KretaFlüchtlinge wandte sich nach Saloniki (Selanik), der Geburtsstadt des späteren türkischen Präsidenten Kemal Atatürk, das 1912 im Ersten Balkankrieg aber ebenfalls von den Griechen erobert wurde, was zur Flucht und Vertreibung von Muslimen und Juden führte. Viele Muslime auf Kreta emigrierten nach Kleinasien, etwa in die große Hafenstadt Smyrna, wo sie auf neue griechische Nachbarn trafen und wo die wechselseitigen Konflikte bald eskalierten – von den Massakern griechischer Besatzungstruppen an türkischen Zivilisten 1919 bis zur Flucht und Vertreibung der griechischen Zivilbevölkerung 1922. Damals wurde die mehrheitlich von Griechen bewohnte Stadt Smyrna von den Türken zurückerobert, verbrannt und brutal von ihren christlichen Minderheiten »gesäubert«, um als türkisch geprägtes Izmir neu errichtet zu werden. Auch bei den osmanischen Türken hatten sich vor dem Hintergrund siegreicher christlicher Nationalismen ein intolerantes nationalistisch-ethnisches Denken durchgesetzt. Der auf beiden Seiten brutal geführte griechisch-türkische Krieg von 1919 bis 1922 mit seinen Massakern und Vertreibungen ging 1923 durch den Vertrag von Lausanne in einen international geregelten »Bevölkerungsaustausch« über, sodass rund eineinhalb Millionen kleinasiatische Griechen nach Griechenland und über 350 000 Muslime aus Griechenland in die klein­ asiatische Türkei zwangsweise umgesiedelt wurden. Diese Vorgänge erin- 5 Erster Balkankrieg: Bulgarische Artilleriestellung während der Belagerung von Adrianopel (Edirne), Januar 1913. Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 2/2008 des albanischen Siedlungsgebiets wurde dem Expansionsstreben der Serben, Griechen und Montenegriner durch die Großmächte entzogen, die einen unabhängigen Staat Albanien zu bilden beschlossen. Diese Unabhängigkeit war, wie sich zeigen sollte, durch innere Konflikte und starke auswärtige Nachbarn immer wieder bedroht. Zugleich gerieten andere Gebiete mit albanischer Bevölkerungsmehrheit unter die Herrschaft der vergrößerten Balkanstaaten; die heutigen Minderheitenprobleme in Serbien, Montenegro und Mazedonien, auch in Nordgriechenland gehen darauf zurück. Hierin liegt auch der Ursprung des nach wie vor bestehenden Kosovo-Problems. Der Zweite Balkankrieg 1913 nische Reich das geostrategisch wie symbolisch wichtige Edirne zurück – eine alte osmanische Sultansresidenz und das wichtigste Bollwerk für die Hauptstadt Konstantinopel. Für die meisten Staaten Europas galt damals die Norm der möglichst auf militärische Auseinandersetzungen begrenzten Staatenkriege, zu deren Einhegung 1899/1907 die Haager Landkriegsordnung geschaffen worden war; auch Bulgarien, Griechenland, Montenegro, Rumänien und Serbien sowie die Türkei hatten den Vertrag 1907 unterzeichnet. Auf dem Balkan aber fanden 1912/13 regelrechte »ethnische Bürgerkriege« statt, deren Brutalität sich aus dem völligen Verzicht auf die Unterscheidung von Soldaten und Zivilisten ergab. Das grausame Vorgehen gegen unerwünschte Teile der Zivilbevölkerung verfolgte das Ziel, durch Ermordung oder Vertreibung ganzer Volksgruppen in ethnisch bisher gemischten Gebieten größere »nationale« Einheitlichkeit zu erzwingen. Eine durch Furcht vor Massenmord ausgelöste panikartige Flucht der muslimischen Bevölkerung vor der serbischen Armee und der christlichen Bevölkerung vor muslimischen Aktio­ nen erlebte der deutsche Journalist ullstein bild Mit den Ergebnissen des Londoner Friedens zeigte sich Bulgarien nicht zufrieden. Zwar hatte dieses Land unter enormen Opfern Ostthrakien mit Edirne erobert, doch das symbolträchtige Hauptziel: die Besetzung bzw. – aus christlich-romantischer Sicht – die »Befreiung« Konstantinopels war gescheitert. Hingegen hatten Bulgariens Verbündete Serbien und Griechenland weit mehr Land erobert. Problematisch wurde die Weigerung Serbiens, auf große Teile des eroberten Mazedoniens zugunsten Bulgariens zu verzichten. Vorangegangen war diesem Schritt Serbiens die Verzichtsforderung seitens der Bulgaren. Die verbündeten Nationen waren sich in der Frage uneins, ob die Bewohner dieser Region eigentlich Serben oder Bulgaren oder Griechen seien; hinzu kam, dass der neue Staat Albanien Serbien den Weg zur Adria verbaute, weshalb Belgrad im Raum Skopje zu keinerlei Kompromissen bereit war. Serbien und Griechenland verbündeten sich bereits kurz nach dem Londoner Frieden, und das isolierte Bulgarien suchte sein Heil im Überraschungsangriff: Im Juni 1913 begann der Zweite Balkankrieg um die Beute aus dem Ersten. Dabei hielt die geschwächte bulgarische Armee den neuen Feinden nicht lange stand, zumal Bulgarien auch noch durch das bisher neutrale Rumänien und das im Ersten Balkankrieg besiegte Osmanenreich im Rücken angegriffen wurde. Im Frieden von Bukarest (Juli 1913) musste Bulgarien den Siegern alle gewünschten territorialen Zugeständnisse machen. Im Separatfrieden von Konstantinopel holte sich das Osma- 5 Zweiter Balkankrieg: Gefangene bulgarische Soldaten auf dem Marsch durch Saloniki, August 1913. Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 2/2008 ullstein bild Die Balkankriege 1912/13 5 Erster Balkankrieg: Montenegrinische Soldaten in Skutari (Shkoder) überwachen die Rückkehr vertriebener Einwohner in die Innenstadt, März 1913. Carl Pauli im Herbst 1912 in der mazedonischen Hauptstadt Üsküb, dem heutigen Skopje, von dessen 47 000 Einwohnern 30 000 Muslime waren. Pauli berichtete: »Die Einheimischen suchten so rasch als möglich die Stadt zu verlassen, die Christen in ihrer Furcht vor einem [türkischen] Gemetzel, die Türken in ihrer Angst vor einem Bombardement der Stadt [...] Auf allen Seiten drängten die Massen heran und strömten gegen den Bahnhof [...] Alle die Hunderte leer liegenden Lastwagen waren besetzt; zu Hunderten hockten Weiber und Kinder in einem Wagen, und auch auf den Wagendächern hockten die kläglichen Gestalten der armen türkischen Frauen mit ihren weinenden Kindern und mit dem in Todesangst zusammengerafften Bündel. Und der kalte Regen rieselte mitleidlos über dem unsäglichen Jammer [...] Menschenknäuel, Flüchtlinge, die nur das eine riefen, baten und bettelten, mussten und kannten: Fort, Flucht, Hilfe! [...] Alles planlos, verwirrt, ohne Kopf und ohne Sinn. Es war die Todesfurcht, die Angst vor etwas nie erlebtem, die alle Menschen gleichmäßig gepackt hatte, und da gab es kein Halten mehr.« Zur selben Zeit herrschte in der von den Bulgaren bedrohten osmanischen Hauptstadt Konstantinopel das Gerücht, die Muslime wollten dort aus Rache alle »Fremden« ermorden. Zugleich ging eine andere »alte Prophe- zeiung« unter Muslimen um: Es werde eine Zeit kommen, in der die alte klein­ asiatische Hauptstadt Brussa, wo die Grabstätten der ersten Sultane liegen, wieder zur Hauptstadt der Türkei werde. Das türkische Volk werde dann in Anatolien einen eigenen Nationalstaat errichten, der ausschließlich ihm gehöre und keine fremden Rassen mehr als Mitbesitzer dulden werde. In diesem erträumten und schon bald von Atatürk (mit der Hauptstadt Ankara statt Brussa) realisierten anatolisch-türkischen Kernstaat war für christliche Minderheiten kaum noch Platz. Die Balkankriege von 1912/13 führten nicht nur zu massenhaften Vertreibungen, sie erzeugten auch die ersten bilateralen Abkommen über »Bevölkerungsaustausch«. Das erste war der 1913 in Konstantinopel geschlossene Friedensvertrag zwischen dem Osmanischen Reich und Bulgarien. Es handelte sich um einen Frieden zwischen zwei geschwächten, hintereinander besiegten Staaten, und gerade diese beiderseitige Erschöpfung ermöglichte die Vereinbarung eines wechselseitigen »Bevölkerungstransfers«. Diese Vereinbarung war allerdings auf eine nur »15 km lange Zone entlang der gemeinsamen Grenze« beschränkt und blieb hypothetisch, da die betroffenen 48 000 Bulgaren und 49 000 Türken bereits während des Krieges »emigriert« waren. Beiden Regierungen ging es daher primär darum, die ethnischen Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 2/2008 »Säuberungen« völkerrechtlich zu bestätigen und die zurückgelassenen Vermögenswerte miteinander zu verrechnen. Die wenig später herbeigeführte griechisch-osmanische »Übereinkunft zu einem Bevölkerungsaustausch« vom Frühsommer 1914 hatte andere Hintergründe, denn Griechenland gehörte zu den Siegerstaaten der Balkankriege. Gerade deshalb wollte das in Konstantinopel regierende »jungtürkische« Regime die an der kleinasiatischen Küste siedelnden rund eine Million Griechen nicht mehr dulden. Seit Anfang 1914 wurden 150 000 Griechen zur Flucht nach Griechenland getrieben, weitere 50 000 nach Zentralanatolien deportiert. Dadurch sah sich die griechische Regierung gezwungen, dem osmanischen Vorschlag zuzustimmen, die hellenische Bevölkerung Thrakiens und Westanatoliens (die Region um Smyrna) gegen muslimische Einwohner Makedoniens und des Epiros auszutauschen. Infolge des Ersten Weltkrieges wurden die vertraglichen Regelungen nicht mehr ratifiziert. Der Unterschied zur osmanisch-bulgarischen Konvention lag bei dieser osmanisch-griechischen »Absichtserklärung« darin, dass sie eine wesentlich größere Zahl von Menschen (über eine Million) innerhalb eines viel größeren Raumes hätte betreffen sollen. Der griechisch-türkische »Bevölkerungsaustausch« von Lausanne 1923, der einen weiteren Krieg beendete, griff dann bekanntlich noch sehr viel weiter aus. Dabei wurde der Lausanner Frieden während des Zweiten Weltkrieges für einige der gegen Hitler-Deutschland kämpfenden Alliierten – namentlich für die Polen und Tschechoslowaken, aber auch für die Briten und USAmerikaner – zu einem wesentlichen Vorbild für die geplante und ab 1944/45 in die Tat umgesetzte Vertreibung und Zwangsaussiedlung von zwölf bis fünfzehn Millionen Deutschen aus den »Ostgebieten» des Deutschen Reiches. Vorspiel für den Ersten Weltkrieg Die Balkankriege von 1912/13 verschärften weitere Konflikte. Der damals als verfolgter Kommunist aus dem Zarenreich emigrierte und als Balkan-Korrespondent tätige spätere so- wjetische Spitzenpolitiker Leo Trotzki interviewte 1912 Andranik Toros Ozanian, der eine armenische Freiwilligenmiliz zur Unterstützung der bulgarischen Armee gegen die Osmanen aufstellte. Ozanian legte Wert auf die Feststellung, dass er »gegen die türkische Zivilbevölkerung [...] niemals irgendwelche feindlichen Aktionen unternommen« habe. Doch als Trotzki im November 1912 in Sofia auf Verwundete dieser armenischen Truppe traf, gaben diese zu, unterdessen türkische Zivilisten massakriert zu haben. Zur Rechtfertigung beriefen sie sich auf zwanzig Jahre zurückliegende osmanische »Armenier-Pogrome«, an die sich jeder Armenier noch gut erinnern könne. Nach Beginn des Ersten Weltkrieges stellten sich solche Freiwilligenverbände osmanischer Armenier sofort auf die Seite der Russen – des Kriegsgegners der Osmanen. Dies wiederum bot Anlass und mehr noch Vorwand für die osmanische Verfolgung sämtlicher Armenier ab 1915: Auch hilflose Frauen und Kinder wurden als »Verräter« eingestuft und unter grausamen Umständen nach Mesopotamien deportiert. Den Tod zahlreicher Menschen kalkulierten die türkischen Verantwortlichen in die Aktion ein. Ein Teil der Opfer kam durch gezielte Mord­aktionen um, was die staatlich organisierte Operation nach Ansicht vieler Historiker zu einem Genozid (Völkermord) machte. Nach den Balkankriegen erlebte Südosteuropa eine kurze Friedenspause. Doch schon im Sommer 1914 begann der Erste Weltkrieg, der auf dem Balkan womöglich noch grausamer geführt wurde als andernorts. Die österreichisch-ungarischen und deutschen Besatzer Serbiens und Montenegros sahen sich ab 1915/16 mit einem Partisanenkrieg konfrontiert und reagierten mit harten Repressalien gegen die Zivilbevölkerung. In Serbien soll während des Ersten Weltkrieges ein Viertel der gesamten Bevölkerung umgekommen sein. Als ihre Besatzungsherrschaft in Montenegro 1918 zusammenbrach, massakrierten die Montenegriner sofort massenhaft Albaner und Muslime. Im Kosovo ließ der Weltkrieg einen schon seit 1912 dauernden Kampf zwischen Serben und Albanern ungehindert eskalieren; und dieser Nationalitätenkonflikt ging dort (wie auch an vielen anderen Orten des Balkans) auch nach Ende des Weltkrieges jahrelang weiter. Bulgarien, ab 1915 Verbündeter der Deutschen und Österreicher, hatte im Weltkrieg Serbisch-Makedonien und das Kosovo besetzt und dort derart brutal gewütet, dass Aufstände die Folge waren. Der Historiker Misha Glenny bezeichnet daher den Ersten Weltkrieg auf dem Balkan als eine Art »Dritten Balkankrieg«. Die Gewalt und der dadurch erzeugte gegenseitige Hass dieser Kriege wirkten lange nach. Diese gegenseitige Gewalt wurde im Zweiten Weltkrieg auf mindestens ebenso grausame Weise eine Generation später erneuert – und wieder nicht vergessen. Seit jeher erklären viele die hier geschilderte Gewalt mit vorgeblich uralten nationalen Gegensätzen auf dem Balkan. Doch die interethnische Gewalt basierte nicht nur auf »uraltem« Hass, sondern war primär die brutale Folge neuartiger Modernisierungsund »Verwestlichungsprozesse«. Die intolerante nationalistische Ideologie selbst, welche die traditionellen Vielvölkerreiche infrage stellte und sie schließlich zerstörte, war ein westeuropäischer Import. Diese Ideologie wurde durch das moderne Schulwesen unter den zuvor analphabetischen Bauern des Balkans verbreitet. Ein weiterer Import erfolgte durch das Militär, das westliche Vorbilder hatte und das für eine flächendeckende »ethnische« Kriegführung unerlässlich war. Die Gewalttaten der Balkankriege dienten nicht nur – wie frühere – der spontanen Rache und Plünderung, bei denen der Effekt ethnischer »Säuberung« eher nebenbei eintrat, sondern sie dienten der Vertreibung als vorgeplantes Hauptziel. Historiker haben festgestellt, dass derart massive Flucht- und Vertreibungsprozesse vor 1914 untypisch für den Rest von Europa gewesen und erst durch die Ereignisse des Zweiten Weltkrieges übertroffen worden seien – sowohl was die Opferzahlen als auch was die räumliche Ausdehnung der Vertreibungen anbelangt. Für den Balkan konstatierte 1914 die Carnegie-Kommission – eine international besetzte, von der privaten Stiftung eines USMultimillionärs finanzierte Untersuchungskommission, welche die Kriegsgebiete 1913 bereist hatte – für Mazedonien und Thrazien eine regelrechte Völkerwanderung mit zahlreichen Todesopfern. Türken seien vor Christen geflüchtet, Bulgaren vor Griechen und Türken, Griechen und Türken vor Bulgaren, Albaner vor Serben. Später haben Historiker die Opferzahlen nachgeliefert. Von dort bei Kriegsbeginn lebenden 2,3 Millionen Muslimen waren bei Kriegsende Mitte 1913 – neun Monate später – nur noch 1,4 Millionen vorhanden. 632 000 Menschen (27 Prozent) sollen durch Massaker, Fluchtstrapazen oder Seuchen zu Tode gekommen sein. Zwar hatten auch türkische Soldaten und albanische Muslime Verbrechen verübt, doch nach Kriegsende sahen sich die verbliebenen Muslime harter christlicher Herrschaft ausgeliefert, die durch Diskriminierung eine scheinbar freiwillige Auswanderung von Muslimen bewirkte oder letztere zu weitgehender Unterwerfung und Anpassung zwang. Zu dieser auf bedingungslose Assimilation zielenden »Nationalitätenpolitik« der Balkanstaaten nach 1912/13 bemerkte die britische Publizistin Mary Edith Durham (eine Verteidigerin der Albaner und Anklägerin der Serben) später sarkastisch: »So manches englische Dorf würde sich für indianisch erklären, wenn fünftausend bewaffnete Männer dies verlangten – und im Weigerungsfalle es mit der Vernichtung bedrohen.« Die Gewaltgeschichte des Balkans ist eine wesentliche (aber nicht alleinige) Ursache für die blutigen Bürgerkriege Ende des 20. Jahrhunderts. Das multi­ ethnische Jugoslawien brach schließlich in den 1990er Jahren auseinander. Ob die durch Kriegsintervention oder mit Friedensmissionen dort engagierten internationalen Organisationen der UN, der NATO und der EU diese Spirale der Gewalt werden eindämmen können, ist ungewiss. Auch wenn wir heute vorsichtig optimistisch sein wollen, gilt immer noch, was der österreichische Historiker Carl von Sax schon vor hundert Jahren – kurz nach den Balkankriegen und kurz vor dem Ersten Weltkrieg – feststellte: »Ruhe wird [...] überhaupt nicht eher eintreten, als bis der blinde Nationalfanatismus, diese moderne Geißel der Menschheit, durch Vernunft, Kultur und Humanitätssinn überwunden sein wird.« Michael Schwartz Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 2/2008 Ermattungs- oder Vernichtungsstrategie? Logo der Reihe »Strategie« ­unter Verwendung eines Bildes von bpk/Antikensammlung; Foto: Jürgen Liepe; Gestaltung: MGFA Ermattungs- oder ­Vernichtungsstrategie? ullstein bild Die Kriegführung der 2. und 3. Obersten Heeres­leitung (OHL) Erich Ludendorff (1865–1937) mit einem Offizier eine Landkarte betrachtend: 3Planung ... Süddeutsche Zeitung Photo 6... und Realität: Stellungskrieg 1916. I m September 1914 war der Erste Weltkrieg bereits verloren! So könnte das Fazit lauten, wenn die operativen und strategischen Planungen des deutschen Generalstabes vor dem Krieg begründet waren. Angesichts der politischen und militärischen Rahmenbedingungen eines Zweifrontenkrieges sowie der begrenzten personellen und materiellen Ressourcen Deutschlands schien nur der Vernichtungsgedanke eines »Schlieffenplans« den notwendigen schnellen Sieg zu ermöglichen. Insbesondere dem Zeitfaktor kam dabei eine existenzielle Bedeutung zu. Folgerichtig wurden die Erfolgsaussichten einer naturgemäß lang anzulegenden Ermattungsstrategie für das Deutsche Reich vor 1914 als äußerst gering bewertet. Dennoch führte die 2. OHL (1914–1916) in den folgenden Kriegsjahren mit General Erich von Falken- 10 hayn ein Offizier, der »gegenüber der neuzeitlichen Waffenwirkung fortan Vernichtungsschläge von feldzugentscheidender Wirkung für ausgeschlossen« hielt. Daher stand seine Kriegführung un­ ter dem Vorzeichen einer Ermattungs­ strategie, so die allgemeine Forschungs­ meinung. Seit Sommer 1916 hätten dann mit Paul von Hindenburg und Erich Ludendorff zwei Offiziere die 3. OHL (1916–1918) geführt, die aufgrund ihrer Vorverwendungen auf dem östlichen Kriegsschauplatz eher offensiv geprägt waren und daher die Entscheidung im Westen 1918 wiederum klassisch durch militärische Vernichtung der Gegner suchten. Der Frage eines Strategiewechsels gilt im Folgenden die Analyse aus ­einer betont militärhistorischen Pers­pektive »von oben«, die einen Zugang zum Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 2/2008 Verständnis der handelnden militärischen Führer aus der ihnen zugänglichen tak­tischen und operativen Gedankenwelt ermöglicht. Anders gefragt: Wie ist der operative Ansatz unter den während des Krieges gegebenen strategischen Zielsetzungen und Rahmenbedingungen zu bewerten? Dies soll anhand des militärischen Vorgehens der Führer der 2. und 3. OHL, der Generale Falkenhayn bzw. Ludendorff, untersucht werden. Operatives Denken Vernichtungsstrategie auf der einen und Ermattungsstrategie auf der anderen Seite waren deutschen Generalstabsoffizieren spätestens durch den Strategiestreit mit dem zivilen Historiker Hans Delbrück wohlvertraut. Beide ullstein bild ullstein bild Erich von Falkenhayn (1861–1922). Paul von Hindenburg (1847–1934). Strategien sollten dem gleichen Ziel dienen: »Das Niederwerfen des Feindes ist das Ziel des Krieges«, so der Vordenker Carl von Clausewitz, der hinzufügte, dass die »Vernichtung der feindlichen Streitkräfte das Mittel« sei. Demnach gehörte in der deutschen Militärtheorie des 19. Jahrhunderts das Niederwerfen als Ziel zur strategischen Ebene und erforderte weitaus mehr als militärische Mittel. Die Vernichtung der feindlichen Streitkräfte betraf dagegen die operative Ebene. Wichtig ist festzuhalten, dass sowohl eine Vernichtungs- als auch eine Ermattungskriegführung zugleich beide Elemente, Angriff und Verteidigung, beinhalten konnte. In diesem Zusammenhang hieß »Vernichtung« für die Offiziere des Ersten Weltkriegs nichts anderes, als die Feinde »so vollkommen niederzuwerfen, dass sie bedingungslos um Frieden bitten müssten« (Falkenhayn). Sie bedeutete aber nicht einmal ansatzweise die Vernichtung der Bevölkerung oder gar die Durchführung eines Genozids. In Deutschland wurde und wird jedem Offizier auf allen Führungsebenen das Führen mit Auftrag (kurz: Auftragstaktik) als zentrales Führungsdenken vermittelt. Das heißt mit den ­prägenden Worten Moltkes, dass der Vorgesetzte das übergeordnete Ziel bekannt gibt, und all das, »aber auch nur das« befiehlt, »was der Untergebene zur Erreichung eines bestimmten Zweckes nicht selbständig bestimmen kann«. Ansonsten blieb und bleibt es dem Untergebenen überlassen, wie er den Auftrag erfüllt, frei von Schemadenken, Spielraum nutzend und selbstständig Initiative zeigend. Dieses Denken kooperierte mit der operativen Führung, auch hier war Statisches verpönt. Vielmehr galt es, die Möglichkeiten des Handelns abzuwägen; Folgerungen mussten in einen Entschluss münden, an dem dann aber zunächst mit aller Kraft festzuhalten war. Auf operativer Ebene ging es um die Planung von verfügbaren Kräften nach Raum und Zeit sowie um die Beurteilung der eigenen und der gegnerischen Kampfkraft. Dabei hatte der militärische Führer das von der Strategie – modern ausgedrückt: Politik – vorgegebene Ziel mit höchster Aussicht auf Erfolg zu erreichen. Angesichts dieser Vorgabe besaßen die Kriegführungen Falkenhayns und Ludendorffs bei allen Unterschieden auch Gemeinsamkeiten: 1. Für beide war eine entscheidende Voraussetzung aller Planungen gleich; sie hatten die Operationen so zu führen, dass am Ende ein – wie auch immer gearteter – militärischer Erfolg mit politischen Gewinnen stand. 2. Ob Abnutzungs- oder Vernichtungsstrategie: In beiden konnten sowohl Angriffs- als auch Verteidigungsoperationen gleichermaßen zum Tragen kommen. 3. Die rein militärischen Führungsprozesse in der OHL waren bis zum Sommer 1918 immer nüchtern lage- und kriegsorientiert. Hinzu traten operative und strategische Rahmenbedingungen, die für beide Akteure während des gesamten Kriegs letztlich gleich blieben: 1. Von Anfang an waren die Deutschen ihren Gegnern materiell und personell deutlich unterlegen. 2. Das sich ständig verschlechternde Kräfteverhältnis konnte nur in begrenztem Rahmen durch eine überlegene Taktik und ein überlegenes Führungsdenken ausgeglichen werden. Daher war der Faktor Zeit ein dominierendes Element bei allen Beurteilungen der Lage. 3. Eine für die Vernichtungsstrategie notwendige Angriffsoperation mit dem Ziel der »Zerstörung der feindlichen Streitmacht« bedurfte im Schwerpunkt einer deutlichen Kräfteüberlegenheit. Angesichts der eigenen Kräfte waren damit Angriffe bei dem gegebenen Mehrfrontenkrieg auf operativer Ebene nur örtlich und zeitlich eng begrenzt zu führen. Falkenhayns Operationsführung Unsicher und gefährlich – so stellte sich die strategische Lage für Falkenhayn im November 1914 dar. Im Westen stand das Heer zwei etwa gleichstarken Gegnern gegenüber, die ebenso wie die Deutschen notgedrungen begonnen hatten, sich an der gesamten Front einzugraben. Unbestritten kommt Falkenhayn, so der Historiker Holger Afflerbach, das Verdienst zu, im November 1914 »die ungünstige Lage erkannt und seine weitere Strategie nach ihr ausgerichtet zu haben«. Angesichts der skizzierten Lage sei Falkenhayn davon ausgegangen, dass der Krieg für ihn schon dann gewonnen wäre, wenn er nicht verloren würde. Eine diplomatische Lösung sollte, so unrealistisch sie auch im Rückblick erscheint, den Ausweg weisen. Andererseits waren der Kaiser, die Armee und die Bevölkerung noch fest davon überzeugt, den Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 2/2008 11 Süddeutsche Zeitung Photo Ermattungs- oder Vernichtungsstrategie? »Ermattungsstrategie«? Deutsche Soldaten in der »Knochenmühle« Verdun. Krieg mit einem »Sieg-Frieden« beenden zu können. Das bedeutete aber im Umkehrschluss eine Erwartungshaltung oder – militärisch formuliert – eine Vorgabe, der die Operationsplanung zu folgen hatte: Ein Kriegsende, dass aus Sicht des Deutschen Reiches nur die Situation vor 1914 wiederherstellen oder gar eine reduzierte Machtposition des Reiches zur Folge haben würde, war unbedingt zu verhindern. Die erhofften diplomatischen Verhandlungen mussten jedoch aus einer Position der Stärke heraus geführt werden. Doch wie war Stärke militärisch zu demonstrieren? Offensive benötigt Überlegenheit an Feuerkraft und an Soldaten sowie den Raum zum Operieren. Die Erfolge Hindenburgs und Ludendorffs im Osten hatten zwar gezeigt, dass großräumiges Operieren mit der Inkaufnahme von Lücken und zeitlich begrenzter Schwerpunktbildungen personelle Unterlegenheit auszugleichen vermochten. Im Westen gab es jedoch nach dem Scheitern der deut- 12 sche Offensive 1914 weder Personal, Material noch den Raum für weitere Offensiven. Eine offensive Kriegführung verbot sich dort wegen mangelnder Aussicht auf Erfolg für 1915 daher von selbst. Damit war der Rahmen für die Operationsführung des Jahres 1915 vorgegeben. Es galt, das Eroberte zu halten und dort offensiv zu werden, wo erwartbare Erfolge nach innen und außen die eigene Verhandlungsposition stärken konnten. Halten im Westen und großräumige Offensiven im Osten waren demnach Ergebnisse eines gemeinsamen militärstrategischen Ansatzes. Im Rückblick erweist sich das Jahr 1915 für die Mittelmächte als das erfolgreichste des Krieges. Im Westen und auf den Dardanellen wurden feindliche Angriffe erfolgreich abgewehrt und im Osten gelangen große operative Raumgewinne. Doch dem eigentlichen Ziel, dem nun einmal eine erfolgreiche Ermattungsstrategie zu- Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 2/2008 grunde liegt, kam Falkenhayn 1915 nicht einen Schritt näher. Der Gegner konnte nicht zum Frieden gezwungen werden. Die für Angriffe notwendige örtliche Überlegenheit von mindestens drei zu eins, an welcher Front auch immer, hätte die anderen Fronten existenzbedrohend von Kräften entblößt. Zugleich zeigte das Beispiel der französischen Offensiven 1915 warnend, dass auch Angriffe mit deutlich überlegenen Kräften »keinen durchschlagenden Erfolg garantierten«. Demnach hätte – wie 1914 – die zweite Variante zum Tragen kommen können: zu halten, um so den Gegner zu schwächen und auf eine politische Lösung zu setzen. Abwegig war dieser Ansatz nicht, wie ein Blick auf die Lage zum Jahresende 1915 zeigt. Im Osten waren die Russen zwar nicht besiegt, aber nur noch zur Verteidigung fähig. In Deutschland war die Umstellung auf die Kriegswirtschaft erfolgreich angelaufen. Der notwendige Ersatz kam in die Regimenter. Vieles, was heute im Strategie Nachhinein als operativ fragwürdig erscheint, war zeitbedingt logisch entwickelt und bedurfte zunächst einmal des Scheiterns, um es als falsch zu erkennen. Das gilt auch für den operativen Ansatz Falkenhayns für das Jahr 1916. Er hatte gelernt, dass Russland durch eine Offensive nicht kriegsentscheidend zu schlagen war und ihm für eine entscheidende Offensive an der Westfront die Kräfte fehlten. Die Operation gegen Frankreich sollte daher keine mit hohen Opfern für Deutschland verbundene Durchbruchsschlacht werden. Vielmehr sollten in der »Blutmühle« von Verdun nur die Franzosen verbluten und so zusammen mit den Erfolgen im U-Boot-Krieg die Briten zum Kriegsaustritt gezwungen werden. Falkenhayns Ansatz war ein bewusst strategischer. Er war auch nicht nur das Produkt einer aus Not geborenen Ermattungsstrategie des Novembers 1914. Vielmehr war er Teil einer Strategie, die jetzt Züge einer Vernichtungsstrategie annahm. So kann es auch kaum verwundern, dass die Truppe seine operativen Planungen für Verdun als offensive Vernichtung des Gegners missinterpretierte. Der Plan, den Gegner zu locken, um ihn dann im Artilleriefeuer ausbluten zu lassen, war zu konstruiert und scheiterte in einem ungeplanten Blutbad. Der Wechsel zu Ludendorff Der Wechsel in der OHL im August 1916 hat etwas vom Wechseln der Trainer im Profimannschaftssport an sich. Die Mannschaft, ihre Gegner und die Regeln bleiben gleich. Und dennoch hofft man mit einer neuen Spitze auf eine entscheidende Neuausrichtung. Aber auch die neue, 3. OHL stellte nach einer nüchternen Analyse im Herbst 1916 fest, dass das Kräfteverhältnis und die Ressourcen am Jahresende 1916 keine Möglichkeiten für eine kriegsentscheidende Offensive im Westen 1917 bieten würden. Die strategische Hoffnung richtete sich nun auf den uneingeschränkten U-Boot-Krieg, der die Briten zum Frieden zwingen und so den Krieg beenden sollte. Offenkundig war aber auch, dass die Alliierten 1917 die Entscheidung mit Angriffen an allen Fronten auf dem Kontinent suchen würden. Daher widmete sich Ludendorff nun vordringlich einer Aufgabe, die er meisterhaft beherrschte: Er ließ ein taktisches Verteidigungsverfahren entwickeln, um den Angreifer mit möglichst geringen eigenen Verlusten abwehren zu können. Der kongeniale operative Ansatz zu der neuen beweglichen Raumverteidigung war dann der operative Teilrückzug in die »Siegfriedstellung« im März 1917. Damit könnte der erfolgreiche operative Ansatz der Kräfte im Westen für 1917 sogar als noch defensiver als der Falkenhayns in den Vorjahren, vielleicht sogar als reine Ermattungsstrategie bewertet werden. Diese Wertung würde jedoch das Wesentliche aus dem Blick verlieren: Ludendorffs Defensive bereitete lediglich die erneute Offensive vor. Dabei fehlte der 3. OHL jedoch der für Falkenhayn nachweisbare strategische Gesamtansatz. Ludendorff wollte den Krieg militärisch gewinnen. Realistische politische Optionen waren ihm fremd. Vor dem Hintergrund des Kriegseintritts der USA fehlte dem operativen Ansatz für die Offensive im Westen jedoch der gesamtstrategische Rahmen. Nur das Frühjahr 1918 erschien günstig. Die drei für den Hauptstoß der Operation Michael vorgesehenen Armeen besaßen jedoch nur bei einer Armee ein Kräfteverhältnis von drei zu eins bei den Divisionen, ansonsten war das Verhältnis etwa zwei zu eins. Der Ansatz 1918, mit einem überlegenen Stoß im Cambraibogen den Gegner zu umfassen und die Briten so zum Verlassen des Kontinents zu zwingen, war ein taktisch-operativer, kein strategischer. Maßgebend blieb der Faktor Zeit. Es gab nur ein enges Zeitfenster für einen erfolgversprechenden Angriff. In dem Augenblick, wo sich die militärische Potenz der USA auswirken würde, spätestens im Sommer 1918, war der Krieg verloren. Ein Vergleich Die Operationsführung während des Ersten Weltkriegs hat mehrfach zwischen offensiven und defensiven Planungen gewechselt. Eine scharfe Trennung zwischen einer Ermattungsstrategie Falkenhayns und der Vernichtungsstrategie Ludendorffs hat es aber nicht gegeben. Vielmehr nahm schon Falkenhayns Kriegführung für 1916 Züge einer Vernichtungsstrategie an. Bezeichnend für diese These ist auch, dass Ludendorff ähnlich wie die 2. OHL zunächst einen defensiven operativen Ansatz wählte, weil er militärisch begründet war. Der Ansatz 1917, aus einer durch erfolgreiche Verteidigung gestärkten Position heraus im Folgejahr offensiv zu werden, verweist auf Parallelen in Falkenhayns Überlegungen Ende 1915. Daher liegt die Schlussfolgerung nahe, Falkenhayn hätte unter den Rahmenbedingungen des Jahresendes 1917 mit seinem Stab zu einem ähnlichen operativen Ansatz gelangen können wie Ludendorff. Das liegt in den militärischen Verfahren begründet, die verlangen, dass eine militärische Beurteilung der Lage immer alle Möglichkeiten des Handelns prüfen muss, offensive wie defensive. Im Zeitfenster März/April 1918 war der Ansatz, den Gegner mit einer Angriffsoperation zu vernichten, beim Abwägen gegenüber anderen Möglichkeiten des Handelns – orientiert an der Absicht der übergeordneten Führung – der am erfolgversprechendste. Der eigentliche Unterschied zwischen 2. und 3. OHL besteht nicht im operativen Denken oder einem Gegensatz von Abnutzungs- oder Vernichtungsstrategie. Er besteht vielmehr darin, dass Falkenhayn strategisch dachte, während Ludendorff in taktisch-operativen Dimensionen verhaftet blieb und damit seiner zugewiesenen politischen Rolle nicht gerecht wurde. Andernfalls hätte er erkennen können, dass selbst ein Durchbruch im Westen den Krieg nicht ohne ein strategisches Gesamtkonzept beendet hätte. Falkenhayn war ein strategischer Kopf mit beschränkter taktischer Begabung, während Ludendorff ein taktisches Genie mit großer Organisationsbegabung war, jedoch ohne die Fähigkeit, über den operativen Tellerrand hinaus zu denken. Burkhard Köster Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 2/2008 13 Auf dem Weg zum 20. Juli 1944 Widerstand in Anlehnung an die militärische Hierarchie Im April 1940 – vor dem Angriff im Westen und nach dem vergeblichen Bemühen um einen Umsturz – traf sich Oberstleutnant i.G. (im Generalstab) von Tresckow mit seinem ehemaligen Regimentskameraden Hauptmann i.G. Wolf Graf von Baudissin. Es war ihr letztes Zusammentreffen. Tresckow zeigte sich skeptisch: Er meinte, der Angriff habe gute Erfolgsaussichten, aus politischer Sicht müsse aber auf ein Scheitern des Angriffs gehofft werden, denn bei einem Sieg wäre an Widerstand gegen Hitler kaum mehr zu denken. Widerstand durch Sabotage der eigenen Angriffsoperationen schloss Tresckow aus. Die Verantwortung für die eigenen Soldaten – sonst ein zentrales Motiv des Widerstandes – war für Tresckow in dieser Situation nicht mit seiner politischen Einsicht vereinbar. Dies änderte sich mit dem Ab- 14 ullstein-bild B is zum Attentat auf Hitler und zu dem Umsturzversuch am 20. Juli 1944 war es ein weiter Weg. Generalmajor Henning von ­Tresckow (1901–1944) war 1944 einer der führenden Offiziere des militärischen Widerstandes. Anfang der dreißiger Jahre hatte er noch als Oberleutnant für Hitler und den Nationalsozialismus Partei genommen, weil er auf die »nationale Wiedergeburt« einer »wehrfähigen« Nation gehofft hatte. Dies änderte sich grundlegend, als Hitler am 30. Juni 1934 bei der »Röhm-Affäre« die SA-Spitze, die innerparteiliche Opposition und konservative politische Gegner wie den ehe­ maligen Reichskanzler General Kurt von Schleicher mit Ehefrau ermorden ließ. Dem folgte Tresckows innere Abkehr von Hitler und dem NS-Regime. Als sich im Jahre 1938 erstmals ein zivil-militärischer Widerstand for­ mierte, gehörte er dazu. Schließlich schloss sich Tresckow spätestens im Herbst 1939 dem Attentatsgedanken an, wie er von Oberst Hans Oster vertreten wurde, der Schlüsselfigur des Widerstandes im militärischen Nachrichtendienst. Der zivil-militärische Widerstand war am 28. September 1938 und am 5. November 1939 einem Staatsstreich nahegekommen. 3 Oberst i.G. Henning von Tresckow an seinem Arbeitsplatz in der Führungs­ abteilung der Heeres­gruppe Mitte bei Smolensk im Sommer 1942. Auf dem Weg zum 20. Juli 1944. Henning von Tresckow im Jahre 1941 schluss der Operationen in Frankreich. Am 24. Juni trat Tresckow an den Generalstabschef des Heeres General der Artillerie Franz Halder heran und schlug die Durchführung des Attentats auf Hitler vor. Halder lehnte ab, indem er auf den Triumph Hitlers durch den Sieg über Frankreich verwies. Eine weitere solche Initiative Tresckows ist bis 1941 nicht überliefert. Im Sommer 1940 begannen die Planungen des Deutschen Reiches für den Überfall auf die Sowjetunion. Am 10. Dezember wurde Tresckow in die Führungsabteilung im Generalstab der Heeresgruppe B versetzt. Die Heeresgruppe sollte im Mittelabschnitt der Ostfront den sowjetischen Schwerpunkt treffen. Oberbefehlshaber der Heeresgruppe war Generalfeldmarschall Fedor von Bock. Dessen Adjutant war der Gutsbesitzer und Major d.R. (der Reserve) Carl-Hans Graf von Hardenberg, den Tresckow seit 1918 durch die damalige Dienstzeit im selben Regiment kannte. Hardenberg war 1941 sein engster Vertrauter im Widerstand. Im Februar 1941 ließ Tresckow zudem einen entfernten Verwandten als Ordonnanzoffizier zu sich versetzen, der auch zum Widerstand gehörte: den Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 2/2008 Rechtsanwalt und Leutnant d.R. ­Fabian von Schlabrendorff. Tresckow erörterte mit diesem mehrfach die Frage: »Warum will Hitler den Angriff auf Russland?« Dies bedeutete den Zweifrontenkrieg, den das Deutsche Reich aller Voraussicht nach verlieren musste, wenn der Feldzug nicht innerhalb von drei Monaten siegreich beendet sein würde. Er hielt aber einen Erfolg für möglich und teilte den Standpunkt des Generalstabs des Heeres, wonach der Angriff zunächst die Masse der sowjetischen Streitkräfte zerschlagen müsse, um dann – ohne Rücksicht auf die Flanken­bedrohung – in einem direkten Stoß auf Moskau das »Herz« des ­Gegners zu treffen. Dadurch sollte das Sowjetsystem zusammenbrechen. Am 28. April 1941 wurde die von Hitler befohlene Einplanung der berüchtigten »Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD« bekannt. Sie sollten als selbstständige Formationen neben dem Heer im rückwärtigen Gebiet auftreten. Die Einsatzgruppen unterstanden dem Reichsführer-SS Himmler und hatten den ideologisch begründeten mörderischen »Rassenkampf« gegen die Zivilbevölkerung in Osteuropa erstmals 1939/40 in Polen Am 31. Mai 1941 gab die Heeresführung den von Hitler ausgehenden »Kriegsgerichtsbarkeitserlass« an die Truppe weiter, der die Zivilbevölkerung praktisch für »vogelfrei« erklärte. Am 13. Juni folgte der »Kommissarbefehl«, der die Ermordung der sowjetischen Parteifunktionäre im Offizierrang anordnete. Damit wurde das Heer selbst zum Träger der verbrecherischen Kriegführung. Tresckow versuchte, dagegen Widerstand zu mobilisieren, scheiterte aber bereits an seinem eigenen Oberbefehlshaber. Ohne Befehlsgewalt, eingebunden in die Kommandostrukturen einer Heeresgruppe unter einem Oberbefehlshaber und unter einem Generalstabschef, war Tresckows Handlungsspielraum auf den fortwährenden Versuch beschränkt, seine Umgebung zu beeinflussen oder seine Gesprächspartner zu überzeugen. Der Übergang zum kompromisslosen Widerstand Mit dem Überfall auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 wurde die Heeresgruppe B in Heeresgruppe Mitte umbenannt. Der KriegsgerichtsbarkeitserPrivat. Uta Freifrau von Aretin geführt. Tresckow erhielt bereits um den 8. März – unter Umgehung des Dienstweges – von Oster Informa­ tionen über deren Einplanung. Mitte Juni stand fest, dass die Einsatzgruppe im Bereich der Heeresgruppe B von dem Reichskriminaldirektor und SSBrigadeführer Arthur Nebe geführt werden würde. Nebe stand in Kontakt mit Oster. Dies war Tresckow nicht bekannt. Besorgt entsandte er Schlabrendorff nach Berlin, um Erkundigungen über Nebe einzuholen. Warum Nebe seit 1938 den Widerstand unterstützte, muss aufgrund der mangelnden Überlieferung offen bleiben. Oster verbürgte sich jedoch für den SS-Führer, der den Widerstand unterstützt habe. Vor dem Überfall nahm Nebe Verbindung zu Tresckow auf. Der Inhalt ihres Gesprächs ist nicht bekannt geworden. Überliefert ist jedoch Tresckows Erleichterung aufgrund des Gesprächs mit Nebe. Er erhoffte sich von der verdeckten Zusammenarbeit mit Nebe die Sabotage der SS-Mordaktionen. Nebe hatte Tresckow also offenbar die Nichtausführung der Mordbefehle oder zumindest die Minimierung der Mordaktionen seiner Einsatzgruppe zugesichert. 5Der Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Mitte Generalfeldmarschall Fedor von Bock (im Vordergrund grüßend), der 1. Generalstabsoffizier Oberstleutnant i.G. von Tresckow (daneben), der Adjutant Major d.R. Graf von Hardenberg (dahinter mit Mütze) und weitere Offiziere des Stabes im Hauptquartier in Borissow (zwischen dem 11. und 30. Juli 1941). lass machte dem Oberkommando der Heeresgruppe eine eindeutige Sprachregelung zur Aufrechterhaltung der Disziplin in der Truppe unmöglich, und der Kommissarbefehl wurde von zahlreichen Verbänden befolgt. Demgegenüber fiel es nicht ins Gewicht, dass Tresckow – seine Befugnisse überschreitend – einmal die Ermordung eines Kommissars verbot oder einen Soldaten mit einem Kriegsgerichtsverfahren bedrohte, nachdem dieser einen Kriegsgefangenen erschossen hatte. Die militärischen Operationen verliefen indessen planmäßig. Am 13. Juli ging aber bei der Heeresgruppe die Nachricht ein, dass Hitler plane, den Angriffsschwerpunkt im Mittelabschnitt – also das Angriffsziel Moskau – aufzugeben. Dabei begann sich zu dieser Zeit das Lagebild zu verdichten, dem zufolge die sowjetischen Reserven zwischen der Heeresgruppe Mitte und Moskau zu treffen waren. Für ­Tresckow war damit der gesamte Feldzug – und damit die weitere Existenz des Deutschen Reiches – infrage gestellt. Am 25. Juli besuchte der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht (OKW) Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel die Heeresgruppe, um die neue Opera­ tions­planung zu vertreten und Hitlers Idee für die künftige Kampfweise darzustellen. Keitel sagte: »Führer [= Hitler] wünscht [...], dass militärische Führung sich von großen, operativen Einkreisungsschlachten umstellt auf taktische Vernichtungsschlachten in kleineren Räumen, in denen gestellter Feind 100%ig vernichtet wird.« Diese von Hitlers Brutalität diktierte Vorstellung kam einer Verhöhnung damaliger militärischer Vernunft gleich. Gleichwohl setzte Hitler im August die Schwerpunktverlagerung nach Nord und Süd durch. Noch deutlicher wurde die Ohnmacht Tresckows angesichts des Vorgehens der Einsatzgruppe B. Ob Nebe seinen Handlungsspielraum zur Verhinderung von Mordaktionen tatsächlich voll ausschöpfte, bleibt unklar. ­Sicher ist, dass bei einem solchen Unterfangen die Unterstützung des Oberbefehlshabers der Heeresgruppe Mitte kaum vorhanden war, vor allem aber, dass Nebe dabei seinem Vorgesetzten, dem Höheren SS- und Polizeiführer Mitte Erich von dem Bach-Zelewski, sowie den untergebenen Chefs der Ein- Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 2/2008 15 Auf dem Weg zum 20. Juli 1944 satzkommandos und Sonderkommandos gegenüberstand. Bach-Zelewski trieb den unterstellten Bereich im »Rassenkampf« gnadenlos an. Er führte unmittelbar, insbesondere die beiden größten Formationen Nebes, die Einsatzkommandos 8 und 9. Es konnte somit keine Rede davon sein, dass Nebe seine Einsatzgruppe mehr oder minder »neutralisierte«. Am 20. Juli wurde ­Tresckow ein Tätigkeitsbericht der Einsatzgruppe B für den Zeitraum vom 9. bis 16. Juli vorgelegt. Am Rand war die Zahl der Ermordeten – insgesamt 1330 – zusammengezählt. Der Bericht offenbarte, wie die Gewalt im rückwärtigen Heeresgebiet Mitte eskalierte. Mit dem Versuch, innerhalb des verbrecherischen Handlungsrahmens auf eine professionelle und zivilisierte Kriegführung hinzuwirken, erreichte Tresckow nichts Wesentliches. In der zweiten Julihälfte 1941 traf er sich deshalb mit Hardenberg zu einer grundlegenden Aussprache: Sie stellten fest, dass »der bisher beschrittene Weg des Versuches der Einflussnahme auf die zur Führung berufenen Persönlichkeiten [gemeint sind die Führungsspitzen des Heeres] zu keinem Erfolge« ­geführt habe. Niemand finde sich, »der kraft seiner Stellung versuchte, sich ­gegen befohlene Verbrechen und mili­ tärischen Wahnsinn aufzulehnen«. ������������������������������� �������� ��������� �������� ������� ������� ������ ���� �� � ������ �� � ���� ����� � ��������� ������� ������ ����� �������� ������� �������� ����� ������� ����� ���� � �������� ������ ������� ���� � ������� ������ ��� ������������ �������� �������� � ��� ������ �������������������������� ��������������������������������������� ���������������������� �������� ������������������������������������ ������������������� �������� ������������������������������ ������������������ � 16 � ������������������������������������� ���������� ������ � ���� ���������� ����������������� ���� ������� � �������� Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 2/2008 ­ resckow und Hardenberg blieb desT halb nur eine Möglichkeit übrig, um auf die moralische Herausforderung zu reagieren: Sie mussten im hochverräterischen Vorgehen gegen die Staatsführung, im Extremfall als Attentäter, die Initiative übernehmen. Eigentlich an mitdenkenden Gehorsam gewöhnt und in elitären Ehrbegriffen altpreußischer Tradition sowie an einem verpflichtenden Glauben gebunden, löste diese Einsicht einen inneren Konflikt aus, den Hardenberg Anfang 1946 so beschrieb: »Die Schwierigkeit der Aufgabe war uns voll bewusst. Es galt zu aktiven revolutionären Taten zu schreiten, d.h. mit allem zu brechen, was uns von den Vätern gelehrt und was mit der Ehre eines preußisch-deutschen Soldaten verbunden war. Besitz, Familie, eigene und Standesehre musste[n] in die Waagschale geworfen werden, wenn dieser Weg beschritten werden sollte. War es notwendig? War es richtig? War es zu vereinbaren mit den ethischen und christlichen Gesetzen, denen wir unterstanden? Wir schieden, als bereits der Sternenhimmel die russische Weite überdeckte, mit dem Versprechen, mit uns selber über diese Frage ins reine zu kommen. Wer [...] glaubt, dass Ehrgeiz, Ruhmsucht oder der Wunsch, sich der kommenden Katastrophe zu entziehen, die Männer [des zivil-militärischen Widerstandes] damals geleitet hat, der weiß nichts von den Gewissensbissen und seelischen Qualen, mit denen jeder für sich allein fertig werden musste. Und was war, wenn uns der Erfolg nicht beschieden sein sollte? War dann nicht der ganze Einsatz vergeblich und nur ein Verbrechen? Es dauerte Tage und Wochen, in denen diese Gedankengänge immer wieder abgesprochen wurden«. Als Hitler am 4. August 1941 das Hauptquartier der Heeresgruppe in Borissow besuchte, wurde die weitere Kriegführung im Osten besprochen. Dabei schnitt die Heeresgruppe die Grundsatzfragen an – auch die Behandlung der Zivilbevölkerung –, ohne dass Hitler sich hätte beeinflussen lassen. Tresckow prüfte bei dieser Lagebesprechung erstmals die Möglichkeit eines Attentats. Im letzten Septemberdrittel fiel bei Tresckow und Hardenberg die Entscheidung: »Das Wohl des Volkes« verlange »den vollen Einsatz [...]. Auch im Falle des Missglückens muss der Welt gezeigt werden, dass es in dieser Zeit Männer gegeben hat, die, wie der Grabstein von Marwitz in Friedersdorf sagt, Ungnade wählten, wo Gehorsam nicht Ehre einbrachte.« Tresckow und Hardenberg waren nicht bereit, die moralische Richtschnur der Ehre aufzugeben. Als traditionell eingestellte Offiziere empfanden sie jedoch zugleich Attentat und Umsturz als unvereinbar mit ihrem Wertegefüge. Der Entschluss zum Handeln fiel letztlich, weil beide nicht damit leben konnten, angesichts der beispiellosen Situation untätig zu bleiben. Die über Jahre gewachsene Opposition und dann der Widerstand seit 1938 waren dafür die Voraussetzungen. Dabei lässt die Überlieferung keine Aussage darüber zu, ob entweder die Beendigung des »militärischen Wahnsinns« – mit dem massenhaften Opfern von Solda­ten auf dem Weg in den Untergang – oder die Beendigung der verbrecherischen Kriegführung mit dem mas­senhaften Morden das stärkere Wider­standsmotiv war. Ohne die »befohlenen Verbrechen« ist allerdings Tresckows und Hardenbergs im September 1941 gefasster Entschluss kaum vorstellbar. Vergebliches Bemühen um den Umsturz Mit dem Umsturz sollte das Deutsche Reich wieder unter die zivilisierten Nationen zurückgeführt werden, um dann den Krieg schnellstmöglich durch einen Verständigungsfrieden zu beenden. Dafür musste verdeckt eine zivilmilitärische Umsturzorganisation aufgebaut werden. Diese Aufgabe bezeichnete Tresckow (Anfang 1944 rückblickend) unter den Bedingungen des Überwachungsstaates als die »Hauptschwierigkeit«. Absprachen waren nur über Kuriere oder durch persönliche Begegnungen möglich. So befand sich Hardenberg vom 30. Juli bis zum 26. August 1941 infolge einer Krankmeldung in Berlin. Schlabrendorff wurde im letzten Septemberdrittel zur Durch­ führung vorbereitender Gespräche nach Berlin entsandt. Am 8. November besprachen Tresckow und Hardenberg im Hauptquartier bei Smolensk das weitere Vorgehen mit dem zum Widerstand gehörenden Verwaltungsfachmann und Oberleutnant d.R. FritzDietlof Graf von der Schulenburg. Dieser hoffte wie Hardenberg, den Umsturz noch 1941 erreichen zu können. Tresckow war skeptischer. In Berlin stellte Schulenburg mehrere Kontakte her. Am 14. November sprach er mit dem Rechtsanwalt und Kriegsverwaltungsrat im OKW Helmuth James Graf von Moltke sowie dem Oberregierungsrat und Leutnant d.R. Peter Graf Yorck von Wartenburg, die ebenfalls den Umsturz anstrebten. Pa­ ral­lel dazu prüften Tresckow und Hardenberg bei einigen Oberbefehlshabern an der Ostfront die Bereitschaft zum Widerstand – mit negativem Ergebnis. Die einzige Ausnahme bei den Führungsspitzen war der Oberbefehlshaber West in Paris, Generalfeldmarschall Erwin von Witzleben. Zeitweilig bestand auch die Hoffnung, dass Generalfeldmarschall Walther von Brauchitsch, der Oberbefehlshaber des Heeres, sich an die Spitze eines Umsturzes stellen würde. Diese Hoffnung endete aber spätestens am 19. Dezember, als Hitler Brauchitsch entließ und selbst dessen Oberbefehl übernahm. Dies war die entscheidende Phase bei dem Bemühen um einen Umsturz, und Tresckow war infolge einer Krankmeldung vom 17. bis zum 27. Dezember in Berlin. Das wichtigste Gespräch führte Tresckow wohl in dieser Zeit mit Halder, dem Generalstabschef des Heeres. Halder versicherte Tresckow unter Tränen, dass ein Staatsstreich wegen der Führungsverhältnisse nicht durchsetzbar sei. Erneut wurde sein ungenügender Widerstand deutlich: Halder setzte wie Tresckow sein gesamtes militärisches Können ein, war aber, im Gegensatz zu Tresckow, ohne innere Distanz gegenüber der strategisch-operativen Kriegführung des Reiches. Die Verbrechen ließ er nicht als Handlungszwang gelten. Ende 1939 hieß es bei ihm, »erst einmal den Krieg glücklich beenden«. Nach dem Sieg über Frankreich hieß es, erst eine Krise müsse den Weg zum Umsturz freimachen. Als dann aber die militärische Krise im Dezember 1941 da war, sah er – wie bei der Krise im Herbst 1939 – keine Möglichkeit für eine Aktion. Moltke fasste am 8. Februar 1942 resigniert zusam- men: »an die Stelle des mir vor Weihnachten entgegengehaltenen ›es ist zu früh‹, ist jetzt getreten ›es ist zu spät‹.« Tresckow wurde wie Moltke angesichts der militärischen Führer, die nicht einmal aus ihrer militärischen Beurteilung der Lage Konsequenzen zogen, zu einem Verächter dieser Offiziere. Die strategische Wende des Krieges war besiegelt, als die Wehrmacht einer unbesiegten Roten Armee gegenüberstand und Hitler den USA am 11. Dezember den Krieg erklärte. Vom 22. Juni 1941 bis Ende Januar 1942 hatte die Wehrmacht mehr als eine Million Tote, Verwundete, Kranke und Vermisste, die Rote Armee etwa zehn Millionen. In den zehn Monaten bis April 1942 erschossen die Einsatzgruppen A, B, C und D mehr als 500 000 Juden. Die »Endlösung der Judenfrage« wurde seit 1942 in Todeslagern wie Auschwitz-Birkenau verfolgt. Aber erst das militärische Desaster von Stalingrad im Winter 1942/43 eröffnete dem zivilmilitärischen Widerstand die Möglichkeit für einen Anlauf zum Attentat und zum Umsturz am 13. März 1943. Der Attentatsversuch misslang jedoch, blieb aber unentdeckt. Es dauerte danach bis zum 20. Juli 1944, ehe Attentat und Umsturzversuch unternommen wurden. Für Tresckow hatte der politische Zweck dieser Unternehmung, die Rettung des Reiches, zu diesem Zeitpunkt keine Bedeutung mehr (siehe Militärgeschichte 2/2004). Er erfuhr am Nachmittag an der Ostfront vom Scheitern des Attentats auf Hitler. Als in der Nacht auch das Scheitern des Umsturzversuchs feststand, nahm sich Tresckow am nächsten Tag das ­Leben. Thomas Reuther Literaturtipps: Winfried Heinemann, Der militärische Widerstand und der Krieg. In: Das Deutsche Reich und der Zweite Welt­ krieg, Bd 9/1, München 2004, S. 743–892 Peter Hoffmann, Oberst i.G. Henning von Tresckow und die Staatsstreichpläne im Jahr 1943. In Vierteljahres­ hefte für Zeitgeschichte, 55 (2007), S. 330–364 Henning von Tresckow. Ich bin der ich war. Texte und Do­ kumente hrsg. von Sigrid Grabner und Henrik Röder, 3., veränderte Aufl., Berlin 2005 Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 2/2008 17 Das Bauwesen der NVA Soldaten der NVA bei der Kartoffel­ernte auf Rügen, 10. Mai 1963. V on der Aufstellung der NVA am 1. März 1956 bis zur Auflösung am 2. Oktober 1990 verrichteten die NVA-Soldaten auch Tätigkeiten, die nicht zu den herkömmlichen Aufgaben des Militärs zählen. Neben der Erbringung von Truppeneigenleis­tun­ gen beim Bau von Unterkünften, Ausbildungsanlagen und Gefechtsständen wurde an der »Getreidefront« und bei der Kartoffelernte »gekämpft«. In der Industrie und Bauwirtschaft der DDR herrschte Arbeitskräftemangel, der durch den Einsatz von Soldaten kompensiert werden sollte. Ob Hochwasser, Schnee oder Frost: Die NVA setzte teilweise die Hälfte ihres Personals im Katastrophenfall ein. Da die Braunkohle- und Energiewirtschaft der DDR krankte und fast jede Schlechtwetterlage eine Krise bedeutete, mussten immer mehr Soldaten helfen. Logische Folge war die Aufstellung neuer Ingenieur- und Pionierbautruppenteile der NVA. Ihre Geschichte soll im Folgenden kurz skizziert werden. Gesellschaftliche Rahmenbedingungen Anders als im Grundgesetz (GG) der Bundesrepublik Deutschland war in der Verfassung der DDR keine Trennung zwischen dem militärischen Teil der Streitkräfte und der zivilen Wehrverwaltung verankert. Dies bedeutete, 18 dass konfliktlos Baueinheiten aufgestellt werden konnten. Neubau, Betrieb und Unterhaltung militärischer Anlagen wurden durch Unterkunftsabteilungen in jedem Bezirk geplant, organisiert und kontrolliert. Ausschreibun­ gen an konkurrierende Firmen gab es in der staatlich gelenkten Planwirtschaft nicht. Der Sonderbedarf I, die sogenannten »Bauwerke mit spezieller militärischer Zweckbestimmung«, musste mindestens zwei Jahre vor Beginn jedes 5-Jahr-Planes durch den ­Nationalen Verteidigungsrat (NVR) bestätigt werden. Die Staatliche Plankommission, deren Abteilung I ein Generalleutnant führte, gliederte die Militärgroßvorhaben in den Staatsplan ein. Die Haushaltsmittel wurden geplant und es wurde eine LVO-Nummer (Leistungs- und Lieferverordnung für die sozialistische Landesverteidigung) vergeben. Die DDR kannte kein Grundrecht auf Kriegsdienstverweigerung. Mit Einführung der Allgemeinen Wehrpflicht am 24. Januar 1962 stellte sich die Frage, wie mit Staatsbürgern zu verfahren sei, die den Waffendienst aus religiösen Gründen ablehnten. Verweigerung der Wehrpflicht wurde mit Freiheitsstrafen bedroht. Das Verhältnis des Staates zu den Kirchen verschlechterte sich, wie auch der Druck der westlichen Öffentlichkeit zu einer Lösung zwang. Als einziger Staat des Ostblocks bot die DDR ab dem 7. Sep- Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 2/2008 tember 1964 den Gläubigen einen waffenlosen Dienst in Baueinheiten der NVA. Diese wurden in die Baupionierbataillone eingegliedert. Baupioniereinheiten (der NVA) 1964–1971 Mit dem Befehl 108/64 des Ministers für Nationale Verteidigung (MfNV) wurden das Baupionierbataillon (BPiB) 5 in Prenzlau und drei weitere in Bärenstein im Erzgebirge für die Landstreitkräfte, das BPiB-14 der Luftstreitkräfte/Luftverteidigung (LSK/LV) Garz und das BPiB-7 der Marine in Nonnewitz auf Rügen aufgestellt. Die Bataillone der Landstreitkräfte setzten sich aus vier Pionierbaukompanien mit wehrdienstleistenden Soldaten und zwei Baueinheiten mit 64 sogenannten Bausoldaten zusammen. Bei den LSK/ LV waren neben den sieben »regulären« Baukompanien drei Baueinheiten mit 96 Bausoldaten eingesetzt, bei der Marine eine Baueinheit mit 32 Angehörigen aufgestellt. Die Möglichkeit der Einberufung von 256 waffenlos Wehrdienstleistenden halbierte die Zahl der Totalverweigerer sofort. An die Stelle der Maschinenpistole trat der Spaten, der als Symbol auch die Schulterklappen zierte. Die eingezogenen Soldaten nannten sich oft »Spatensoldaten«. Bis 1973 wurden sie auch zum Bau von militärischen Ausbildungsan- ullstein bild Das Bauwesen der NVA vember 1983 wurde dem PiBB-MUKRAN eine Baueinheit (BE) mit 150 Mann unterstellt. Im Strukturschema 85 hatte die Baueinheit für den Fähr­ hafenbau auf der Insel Rügen bereits 480 Angehörige. In den Chemiekombinaten Schwedt, Buna, Leuna und Bitter­ feld mussten Bausoldaten Schicht­arbeit leisten, die zudem noch körperlich schwer und gesundheitsgefährdend war. Mit der Auflösung der Baueinheiten im Januar 1990 wurden 1500 Bausoldaten entlassen. Im August 1989 noch hatte der Stellenplan 95 (STAN) des Ministeriums für Nationale Ver­ teidigung 4200 Bausoldaten vorgesehen. 1966 entstanden vier weitere Baupionierbataillone mit Standorten in Bernau (2), Torgau und Prenzlau. Das BPiB-5 wurde zwischenzeitlich nach Torgelow-Drögeheide verlegt. Die Einheiten unterstanden dem Chef der Verwaltung Spezialbauwesen im Bereich Militärbauwesen/Unterbringung des Ministeriums für Nationale Verteidigung. Die militärische Führung der Baueinheiten wurde aus bestehenden Pioniertruppenteilen gebildet. Bauingenieure aus den Reihen der eingezogenen Soldaten erhielten lukrative Angebote. Der Einstellungsdienstgrad für Fachschulabsolventen war der des Unterleutnants, Diplomingenieure erhiel­ ten den Leutnantsrang, ohne die übliche Offizierausbildung durchlaufen zu müssen. Die Verpflichtungszeit betrug drei oder zehn Jahre. Ab Mitte der 1970er Jahre studierten an der Inge­ bpk/Horst E. Schulze lagen, z.B. dem Schießtrainingsplatz in Prenzlau, verwendet. Das führte zu neuen Gewissenskonflikten, weil viele Gläubige auch die Ausbildung zum Töten nicht unterstützen wollten. Die Bausoldaten kannten ihre Rechte sehr genau, die Kirchen unterstützten sie. Nicht zuletzt wegen ihrer Eingaben und Beschwerden erfolgte der Einsatz ab 1973 vorwiegend dezentral in Lazaretten, Ferienheimen und rückwärtigen Einrichtungen. Es ist eine Ironie der Geschichte, dass nach dem Ende der SED-Herrschaft mit Rainer Eppelmann ein ehemaliger Bausoldat zum letzten Verteidigungsminister der DDR ernannt wurde. Teile der Armeeangehörigen aus den Gefechtstruppen mit 85%igem Bereitschaftsdienst beurteilten die Aufgaben der Bausoldaten als »leichte Hilfsarbeiten«. Sie wähnten sich benachteiligt und protestierten ­gegen die vorgeblich angenehmen Dienstbedingungen der Bausoldaten. Die Zahl der Wehrdienstverweigerer wuchs, mancher lehnte den NVADienst nicht nur aus religiösen und Gewissensgründen, sondern grundsätzlich ab und wurde Bausoldat. Er nahm berufliche Benachteiligungen in der DDR in Kauf. Die steigenden Forderungen nach Arbeitskräften in der Industrie veranlassten das Ministerium für Nationale Verteidigung, mit Befehl 45/82 neue Baueinheiten aufzustellen, die im Straßenbauregiment 2 und in Lagern und Einrichtungen der Rückwärtigen Dienste Verwendung fanden. Ab 1. No- Bau des Erdölkombinates Schwedt, 17. September 1962. nieurhochschule in Cottbus, heute Brandenburgische Technische Universität (BTU), die künftigen Spezialisten des Militärbauwesens. Sie erhielten Abschlüsse als Diplomingenieur für Technologie der Bauproduktion. Nach halbjährlichem Grundkurs als Pionier an der Offizierschule der Landstreitkräfte in Zittau folgte der Einsatz auf den Baustellen als Zugführer in einer Ingenieurbaukompanie. Die Aufgaben und Arbeitsorte der vier Bataillone, später auch der beiden Ingenieurbauregimenter, waren streng geheim. Dem Autor ist bekannt, dass das BPiB-6 Prenzlau erstmals 1967 bei Lychen zur Errichtung von Raketenstellungen für die Sowjetarmee eingesetzt wurde. Es folgte der Führungspunkt der Volksmarine als damals größtes militärisches Bauvorhaben zwischen Tessin und Laage, unweit von Rostock. Nach dem Aushub einer riesigen Baugrube betonierten die Baupioniere mehrstöckige, auf riesigen Stahlfedern gelagerte Schutzbauwerke unter Tage. Meterdicke Betonschichten gegen Bombenwirkung wurden aufgebracht. Mehrere Schleusen sorgten für den Schutz vor atomarer Strahlung, Druckwellen oder biologischen bzw. chemischen Kampfstoffen. Spezialisten oblag die Führungstechnik sowie die Einrichtung einer autarken Strom-, Wasser- und Sauerstoffversorgung. In solchen Bunkern sollte die militärische Führung mehrere Tage nach einem Atomwaffenangriff überleben können. Letzte Arbeiten galten der Tarnung, der Wiederherstellung der natürlichen Umgebung und der Sicherung durch eine Hochspannungsanlage. Allerdings enttarnten sich die Objekte oft durch ihre Nebenanlagen, wenn aus dem Wald der Schornstein eines Heizkraftwerkes ragte. Alle Bataillone hatten feste Stammobjekte, von denen aus die Vorhaben erschlossen wurden. Dann erfolgte die Verlegung der Bau- und Sicherungskräfte. Erste Unterkünfte waren Zelte, denen Baracken folgten. Später dienten zusammenschiebbare Raumzellen der Unterbringung der Soldaten. Sie wurden auch als Kultur- und Freizeiteinrichtungen sowie als Depots genutzt. Neben den dem Ministerium direkt unterstellten Baubataillonen waren auch den Teilstreitkräften Einheiten für ihre speziellen Bauvorhaben zugeord- Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 2/2008 19 Das Bauwesen der NVA Pionier- und Ingenieurbautruppen 1971–1978 Auf dem VIII. Parteitag der SED 1971 wurde Erich Honecker zum Parteichef gewählt, der die Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik proklamierte und ein gewaltiges Wohnungsbauprogramm auflegte. Daraus folgte, dass die Bauindustrie ihre Kräfte auf die Errichtung der Plattenbausiedlungen z.B. in Eisenhüttenstadt, Schwedt, HalleNeustadt, Leipzig-Grünau und BerlinMarzahn konzentrieren musste. »Jedem seine Wohnung«, lautete die Parole, wenig später bereits zu »Jedem eine Wohnung« abgeändert. Der volkseigenen Bauwirtschaft fehlten für das ambitionierte Bauprogramm jedoch die Kapazitäten. Sie zeigte sich zunehmend überfordert, die Planauflagen mussten ständig nach unten korrigiert werden. Hilfe sollte die NVA bieten. Mit der Zunahme der »Großbaustellen des Sozialismus« musste die NVA einerseits eigene Strukturen für ihre Bauvorhaben schaffen und andererseits Unterstützungsleistungen für die Bauindustrie erbringen. Hinzu kam die Hilfe für die Kohle- und Energiewirtschaft. Da die DDR keine nennenswerten Steinkohle- oder Erdölvorkommen besaß, konnte die Energie nur aus der heimischen Braunkohle erzeugt werden. Ihre Förderung in offenen Tagebauen war ebenso lebenswichtig wie 20 witterungsabhängig und personalintensiv. Es verwundert nicht, dass die Braunkohlekombinate und Großkraftwerke fast ständig auf die Hilfe der NVA, der Grenztruppen wie auch der Bereitschaftspolizei angewiesen waren. Im Katastrophenwinter 1978/79 wurde ein Großteil der Armee zur Versorgung der Bevölkerung, im Verkehrswesen und zur Sicherung der Energieversorgung eingesetzt. Aufgrund der Auswertung der sich wiederholenden Wintereinsätze beantragte der Minister für Kohle- und Energiewirtschaft zwei Baubataillone für den Gleisbau in den Revieren Cottbus und Borna bei Leipzig. Die ständige Verfügbarkeit der militärischen Arbeitskräfte hatte sich bereits beim Bau des Palastes der Republik in Berlin bewährt. Aus dem NVA-Sonderbaustab und den zukommandierten Kräften rekrutierte sich am 1. Dezember 1975 der Stamm des Pionierbaubataillons 22 (PiBB) in Berlin-Biesdorf, das an allen wesentlichen Bauvorhaben in der Hauptstadt beteiligt war. Gleichzeitig wurden Pionierbaubataillone in Storkow, Prenzlau, Gotha und Merseburg aufgestellt. Zwei Bataillone arbeiteten für die Chemiekombinate in Buna, Leuna und Bitterfeld. Später wurde für den Bau des Hafens der Fährlinie Mukran/Rügen– Klaipeda (damals UdSSR) ein weiterer Truppenteil gebildet. Der Warenaustausch mit der Sowjetunion sollte auf dem Seeweg möglich gemacht werden. Der neue Chef Pionierwesen der NVA Oberst Waldemar Seifert (später Generalleutnant) setzte ab 1978 neue Schwerpunkte. Standen beim Vorgänger, Generalleutnant Harry Strobel, die Volkswirtschaftseinsätze im Vordergrund, sollten sich die Bataillone nun auf ihre militärische Aufgaben konzentrieren. Nach zweitägiger Mobilmachung und Auffüllung mit Reservisten mussten sie Pionier- bzw. Straßen- und Brücken­ bauregimenter für den Kriegsfall (Soll II) bilden. Das PiBB-2 in Storkow errichte­te Feldbefestigungsanlagen und Pioniersperren, in Merseburg wurde der Bau von Scheinbrücken trainiert und in Prenzlau wurden Pontonbrücken vorgehalten. MHM Dresden (MBD 0908/2) net. Hier wurden vor allem Unterkünfte, Technikhallen, Sturm- bzw. Hindernisbahnen gebaut. Dem Kommando der Landstreitkräfte unterstand das Ingenieurbaubataillon 40 in Brandenburg. Die Luftstreitkräfte hatten für den Bau und die Instandsetzung von Flugbetriebsflächen das Flugplatzpionierbataillon 14. Geschlossene Deckungen für Flugzeuge (GDF-12 und 16) errichtete das PiB-24 gemeinsam mit Spezialisten des VEB Schachtbau Nordhausen. Die beiden selbstständigen Einheiten waren in der Ruinenberg-Kaserne in Potsdam stationiert. Bauaufgaben der Marine erledigte das Ingenieurbaubataillon 18 in Saßnitz auf Rügen. Die vier Baukompanien der Grenztruppen hatten ihre Kasernen in Berlin, Gardelegen und Eisenach. Bis 1971 war die Anzahl der Bau-Einheiten der NVA relativ gering. Einsatz einer Pioniereinheit der NVA im Braunkohlenwerk »Jugend« in Schlabendorf bei Lübbenau, 22. Januar 1963. Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 2/2008 ullstein bild Meßner Richtfest des Palastes der Republik am 18. November 1974. Bautruppen ab 1978 Die verstärkte Rüstung der NVA machte den Bau immer neuer Führungsstellen, Einsatzzentralen und Schutzbauwerke erforderlich. Obwohl sich die ökonomische Lage der DDR verschlechterte, wurde dafür Geld und vor allen Dingen Material bereitgestellt. Die dem Chef Militärbauwesen/ Unterbringung unterstellten Einheiten wurden in zwei Ingenieurbauregimentern (IBR) in Bernau und Torgau mit Stärken von 1058 Mann zusammengefasst. Die IBR waren nicht in Bataillone gegliedert, sondern entsprechend der Anzahl von Großbaustellen, in variable Oberbauleitungen unterteilt. Diese erhielten für die Lösung ihrer Aufgaben Ingenieurbaukompanien, Wachund Sicherstellungskräfte sowie Transportmittel und Bautechnik unterstellt. Großtechnik wurde vom Regiment bereitgestellt. Für die Bahnentladung von Ganzzügen (bis 36 Waggons) mit Schüttgütern bildete man »Entladekomplexe«. Zivile Auftragnehmer leisteten Arbeiten, die nicht zum Leistungsumfang der Regimenter gehörten. Die Vorhaben besonderer Geheimhaltung planten die Unterkunftsabteilungen 2 in Leipzig bzw. 12 in Berlin. Sie erarbeiteten die Vorgaben, nach denen das Zentrale Entwicklungs- und Konstruktionsbüro Berlin bzw. das Projektierungsbüro Süd Dresden die Feinplanungen und Bauzeichnungen erstellten. Vorhaben ohne Geheimhaltung planten die Projektierungsgruppen der Unterkunftsabteilung (UKA) in den Bezirken. Die Oberbauleitungen erstellten den Jahreseinsatzplan, den Plan der Militärökonomie und den für Rationalisierung. Mit »Bestenbewegung« und »sozialistischem Wettbewerb« sollten die Vorgaben überboten werden. Deren Nichterfüllung war indes kaum möglich, da alle Pläne so lange »präzisiert« wurden, bis sie dem tatsächlich Geleisteten entsprachen. Die Versorgung mit Baustoffen, »Engpassmaterialien« sowie Spezialdienstleistungen war durch die LVO gesichert. Bis in die frühen 1980er Jahre besaß die Landesverteidigung Priorität. Seit Mitte der 1980er Jahre konzentrierten man sich erneut auf den Wohnungsbau. Hinzu kamen nun devisenbringende Aufträge. Hauptaufgaben des IBR-2 waren die Errichtung von Schutzbauwerken in Berlin-Oberschöneweide und Bad Sulza/Thüringen, Wohn- und Gesellschaftsbauten in Strausberg und des Zentrallazaretts in Bad Saarow. Das IBR-12 baute das »Komplexlager« 23 in Blankenburg/ Harz, in dem Waffen und Ausrüstung deponiert wurden, die Untertageanlage Regenstein, das Tagungszentrum Strausberg, ein Ferienheim in Schierke/ Harz sowie Fla-Raketen-Stellungen bei Apolda. Letztere war die größte Baustelle der NVA vor dem Zusammenbruch der DDR. Auch außerhalb der Befehlsgewalt des Ministeriums für Nationale Verteidigung waren Armeeangehörige an Bauvorhaben beteiligt. Die Abteilung I Spezialbauwesen im Ministerium für Bauwesen führte ein Generalleutnant. Ihm unterstanden unmittelbar jeweils drei Regimenter und Baubetriebe. Das in Seelow stationierte Hochbauregiment 7001 errichtete bis 1988 insgesamt 16 400 Wohnungen für Armeeangehörige. Es war Auftragnehmer für den VEB GAN Schwedt, der die Bauten des Ministeriums für Staatssicherheit ausführte. Der VEB Spezialbau Potsdam zeichnete für die Baumaßnahmen der Gruppe der Sowjetischen Streitkräfte in Deutschland (GSSD) verantwortlich. Auch in Seelow war das Straßen- und Brückenbauregiment 7004 stationiert, dessen Hauptaufgabe die Vorfertigung und Montage von Stahlbetonbrücken für Kettenfahrzeuge auf den Marschstraßen der GSSD und NVA war. Im Kriegsfalle sollten hierauf die Truppen des Warschauer Vertrages Richtung Westen rollen. Das Straßenbauregiment 7002 Neuseddin war zur Gleisnetzstabilisierung bei der Deutschen Reichsbahn befohlen. Bröselnde Betonschwellen mussten ausgetauscht werden. Auch das Eisenbahnbauregiment 2 Walddoehna verlegte Gleise. Eine Kompanie arbeitete ständig im Betonschwellenwerk Reth­ wisch. In Verantwortung der Abteilung Spezialbauwesen im Bauministerium sanierten die Truppenteile Polizeireviere, den Flugplatz Basepohl und bauten ein Internat für die SED-Parteihochschule. Aufgrund des zunehmen­ den Bedarfs erfolgte 1988 die Aufstellung eines weiteren Straßenbauregi­ men­tes. Das Nachrichteninstandsetzungsregiment 2 Oschatz unterstützte das Ministerium für Post- und Fernmeldewesen bei der Wartung und Instandsetzung militärischer Nach­rich­ ten­verbindungen, indem es Über­tra­ gungs­stellen baute und Kabel verlegte. Insgesamt haben acht Regimenter und zehn personalstarke, selbstständige Bataillone im Interesse der bewaffneten Organe und zur Unterstützung der Volkswirtschaft Bauaufgaben erfüllt. Mit dem Fortschreiten des politischen und wirtschaftlichen Niedergangs der DDR wurden ab 1988 alle Soldaten des 3. Diensthalbjahres in der Volkswirtschaft eingesetzt. Wie so viele Entwicklungen in Staat und Gesellschaft nahmen die Unterstützungsleistungen inflationären Charakter an. 1989 setzte die Staatsführung weitere 10 000 Soldaten für die Realisierung wichtiger Volkswirtschaftsvorhaben ein. Der Zusammenbruch der DDR war damit jedoch nicht aufzuhalten. Klaus Udo Beßer Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 2/2008 21 Service Das historische Stichwort akg-images 4 Einzug der Befreier in Wien am 13. September 1683 nach dem Entsatz der belagerten Stadt in der Schlacht am Kahlenberg, 12. September. Holzstich, um 1860, nach einer Zeichnung von Wilhelm Camphausen, spätere Kolorierung. B ereits 1529 belagerten Truppen des Osmanischen Reiches die kaiserlich-erzherzogliche Hauptund Residenzstadt Wien. Die Belagerung scheiterte am entschlossenen Widerstand, an zu geringer Belagerungsartillerie und an schlechten Witterungs­ bedingungen. Die Osmanen zogen ab, beherrschten ab 1541 allerdings große Teile des benachbarten Ungarn. 1664 misslang ein erneuter Versuch, Wien zu erobern, bereits beim Anmarsch auf die Stadt. Bei St. Gotthard/Raab (heute Szentgotthárd in Ungarn) konnte einem osmanischen Truppenteil eine vernich­ tende Niederlage beigebracht werden. Daraufhin wurde zwischen dem Osmanischen Reich und dem Habsburger­ reich ein zwanzigjähriger Friede ge­ schlos­sen. Noch vor Ablauf der Friedensfrist begann das Osmanische Heer unter dem Großwesir Kara Mustafa im Frühjahr 1683 erneut einen Feldzug gegen den »Goldenen Apfel« Wien, wie die Türken die Stadt unter anderem nannten. Die 120 000 Mann starke Truppe – manche sprechen gar von bis zu 350 000 Mann, die schließlich vor Wien standen – setzte sich am 31. März 1683 in Adrianopel (heute Edirne, Bulgarien) in Bewegung. Nach etlichen Gefechten erreichte sie in der zweiten Juliwoche die Umgebung von Wien. Ab dem 15. Juli 1683 belagerten die Truppen die modern befestigte Stadt, was mit einer Verheerung des Umlandes einherging. Hinter den Stadtmauern und Bastionen standen rund 10 000 Verteidiger unter Waffen, die von Ernst Rüdiger Graf Starhemberg kommandiert wurden, unterstützt von etwa 5000 Wiener Bürgern. Schon bald neigten sich die Lebensmittelvorräte dem Ende zu. Seuchen brachen aus, welche die Verluste bei den Verteidigern der Stadt und der Bevölkerung noch zusätzlich in die Höhe schnellen ließen. Hungersnöte plagten auch die Belagerer, denn 120 000 Soldaten, ihre Pferde und der dazugehö- 22 Der Entsatz von Wien im September 1683 rende Tross wollten versorgt werden. Die Belagerten kämpften mit zunehmender Verbissenheit und dem Mut der Verzweifelung. Nach damaligem Kriegsbrauch erhielten einfache Soldaten und Hilfstruppen geringen Sold. Ihre Entlohnung war die Beute: Eine eroberte Stadt war drei Tage lang zur Plünderung freigegeben. Das osmanische Vorgehen unterschied sich allerdings von den üblichen Belagerungen. Die Truppen Kara Mustafas verfügten über zu wenig schwere (Belagerungs-)Artillerie. Somit konnten die Befestigungen weder im Sturm genommen noch sturmreif geschossen werden. Also verlegten die Truppen sich auf die langsameren Belagerungstaktiken des Sappeurkrieges (= Grabenkrieg) und des Mineur- Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 2/2008 krieges. Beim sogenannten Minenkampf wurden unterirdische Stollen an die Bastionen Wiens getrieben, mit Schießpulver gefüllt und gezündet, was Teile der Befestigungen zum Einsturz bringen sollte. Die Gegentaktik bestand darin, selbst Tunnel zu bauen und den Angreifer zu überwältigen. Ein nicht geringer Teil der Belagerung spielte sich also unterirdisch ab. Die Lage in Wien Anfang September war verzweifelt, die Stadt stand kurz vor dem Fall. Die osmanischen Belagerer hatten jedoch die nahe an Wien heranreichende Erhebung des Kahlenberges – einen Ausläufer des Wienerwaldes – weder besetzt noch aufgeklärt. Außerdem hatten sie es versäumt, sich in ihrem Rücken durch eine zweite Befesti- gungslinie zu sichern. Dadurch erhielt die eilig zusammengestellte Armee zum Entsatz der belagerten Stadt ihre Chance. Allerdings hatte es dazu großen diplomatischen Geschicks bedurft. Das »christliche Abendland« war auf dem Kontinent Europa zwar als Idee vorhanden, tatsächlich rangen aber unterschiedliche Mächte um die Vorherrschaft. Ein Dauerkonflikt bestand zwischen dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation und Frankreich, doch König Ludwig XIV. von Frankreich unternahm nun zumindest keine militärischen Aktivitäten gegen das Reich. Somit herrschte Ruhe an dessen Westgrenze. Für die Aufstellung der Entsatzarmee mussten vorhandene Pflichten zur Heerfolge genutzt und zahlreiche Drohungen ausgesprochen werden, Geld musste fließen und Zugeständnisse wurden gemacht, um die Allianz zur Rettung Wiens zu schmieden und sich von mehr oder weniger souveränen Staaten Truppen stellen zu lassen. An den Verhandlungen waren neben dem Kaiser, diversen Reichsständen, darunter Bayern, Sachsen und der Südwesten des Reiches, auch Papst Innozenz IX., König Jan III. Sobieski von Polen und die Republik Venedig beteiligt. Den Oberbefehl über die so geschaffene Entsatzarmee hatte der polnische König inne, die kaiserlichen Truppen 6 Kara Mustafa (um 1630–1683), tür- akg-images kischer Großwesir seit 1676. Öl auf Leinwand, anonym. wurden von Herzog Karl V. von Lothringen kommandiert. Die Truppe bestand aus ca. 80 000 Mann, darunter 24 000 polnische, 21 000 kaiserliche, 10 500 bayerische, 9500 südwestdeutsche (Franken, Schwaben, Baden, Hessen) und 9000 sächsische Soldaten. Sie rückte in zwei Kolonnen vor, die sich am 7. September bei Tulln an der Donau vereinigten und dann durch den Wienerwald auf den Kahlenberg vorstießen. Am 12. September eröffnete die polnische Kavallerie, die »Husaria«, mit ihrer Attacke von den Höhen des Kahlenberges die Schlacht und die gesamte Armee kämpfte sich gegen die überraschten Osmanen vor. Der rechte Flügel, bestehend aus polnischen Truppen, hatte den weitesten Anmarschweg; er befand sich im Kampf mit der osmanischen Hauptmacht. Die wirkungsvolle Unterstützung durch das Zentrum unter Max II. Emanuel von Bayern und Graf Christian Friedrich von Waldeck führte schließlich zum Durchbruch in das Lager der Osmanen. Der linke Flügel unter Karl von Lothringen und Johann Georg III. von Sachsen kämpfte sich zeitgleich zum Wiener Becken vor. Durch diese starken Angriffe sowie durch einen Ausfall der Wiener Verteidiger sahen sich die Osmanen in die Zange genommen, worauf die Führung unentschlossen reagierte. Die Osmanen flohen, auf dem Platz blieben 15 000 tote und verwundete Osmanen, die Entsatzarmee zählte 4000 bis 5000 Verluste. Eine festliche Siegesparade beendete am 18. September den Einsatz der Armee und in ­Teilen auch ihre Existenz, da die nur wegen der osmanischen Bedrohung ruhenden Gegensätze wieder aufbrachen. Den osmanischen Oberbefehlshaber Kara Mustafa erwartete die Todes­strafe. Am 25. Dezember 1683 wurde er in Belgrad auf Befehl des Sultans hingerichtet. Anders als nach der ersten Belagerung Wiens 1529 erfolgte diesmal eine Offensive gegen das Osmanische Reich. In den folgenden Jahren setzten kaiserliche, bayerische, sächsische, polnische und badische Verbände den Türken nach, eroberten in blutigen Kämpfen Ungarn, rückten auf Belgrad und Sarajewo vor. Venezianische Verbände bekämpften die Türken in Griechenland. Der Friede von Karlowitz 1699 been- dete diesen Krieg, der Konflikt mit dem Osmanischen Reich schwelte jedoch weiter. Österreich schuf sich durch diese Siege einen Großmachtstatus, beherrschte fortan Ungarn und sicherte seine gemeinsame Grenze mit dem ­Osmanischen Reich durch die Einrichtung einer besonderen »Militärgrenze«. Es hat nicht an zeitgenössischen Versuchen gefehlt, diesen Konflikt als einen Kampf der Religionen zu deuten: Der Türke sei der Antichrist, sein Heiliges Buch, der Koran, ein Lügengespinst. Er weigere sich, die überkommenen Regeln des Krieges anzuerkennen. Es waren nicht zuletzt die weltlichen und geistlichen Führer des Abend­landes, welche die »Türkenangst« schü­rten. Allerorten fürchtete man die Grausamkeit, insbesondere gegen Frauen, Kinder und Alte, des plündernden, raubenden und mordenden Feindes. Die Bilder vom »Türken«, die so gezeichnet wurden, dienten nicht zuletzt dazu, die Stellung der Obrigkeiten zu festigen. Darüber hinaus sollten die Menschen für den Kampf gegen die Türken mobilisiert werden. Und der zeitgenössische Prediger Abraham a Sancta Clara sprach von »der Anfrischung der christlichen Waffen wider den Tuerckischen Bluetengel«. Aus den erbeuteten osmanischen Bronzekanonen wurde eine neue Glocke für den Stephansdom gegossen. Die katholische Kirche schuf im Gedenken an den Sieg am 12. September den Feiertag »Mariä Namen«. Im oberösterreichischen Stift St. Florian ist der Kampf gegen die Osmanen in zahllosen Bildern und Skulpturen präsent. Die an den Kämpfen beteiligten Truppenführer verewigten sich und ihre Siege in weltlichen Bauten: Prinz Eugen von Savoyen (»der edle Ritter«) im Wiener Belvedere, Kurfürst Max II. Emanuel von Bayern (»der blaue König«) in Schleißheim und Markgraf Ludwig Wilhelm von Baden (»Türkenlouis«) in Rastatt. Auf den Konflikt sind aber auch kulturelle Importe aus dem Orient zurückzuführen. So fanden der Schellenbaum der osmanischen Musikgruppen, auf dessen Herkunft vor allem der englischsprachige Begriff »Turkish crescent« hinweist, und die ihn zierenden Rosshaarschweife Eingang in die deutsche Militärmusik. Harald Potempa Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 2/2008 23 Service Medien online/digital Freiheit und Unfreiheit Markus Bultmann, Erfahrung von Freiheit und Unfreiheit in der deutschen Geschichte. Rastatt und Offenburg: Erinnerungs­orte der Revolution 1848/49. Darstellung – Dokumentation – Vermittlung, Koblenz 2007 (= Mate­ rialien aus dem Bundesarchiv, Heft 19). ISBN 978-386509-768-2; 312 S., und eine CD, 15,50 Euro Die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr bekennen sich durch ihr feierliches Gelöbnis bzw. ihren Eid, »der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen«. Als »Staatsbürgerinnen und Staatsbürger in Uniform« sind sie den Werten und Normen des Grundgesetzes in besonderer Weise verpflichtet. Die politische Bildung in den Streitkräften soll daher auch verdeutlichen, dass die freiheitlich demokratische Grundordnung schützens- und verteidigenswert ist. Für diese Grundwerte wurde lange gestritten, sie sind verletzlich. Es bedurfte Mut, sich für sie einzusetzen und es bedarf nach wie vor des Mutes, sie zu verteidigen. Dies vermittelt die Publikation »Erfahrung von Freiheit und Unfreiheit in der deutschen Geschichte«. Der Autor, Markus Bultmann, ist Gymnasiallehrer in Offenburg und entwarf in den Jahren 2003 bis 2005 ein museumspädagogisches Konzept für die »Erinnerungsstätte für die Freiheitsbewegungen in 24 der deutschen Geschichte« in Rastatt. Dementsprechend versteht sich die nun vorliegende Studie als eine Handreichung für die historisch-politische Bildung. Der inhaltliche Schwerpunkt liegt auf der Revolution von 1848/49. Aus erfahrungsgeschichtlicher Perspektive werden die historischen Wurzeln unserer heutigen Demokratie erschlossen. Die Darstellung beschränkt sich dabei nicht nur, wie man aufgrund des Untertitels glauben könnte, auf regionalgeschichtliche Ereignisse, sondern umfasst die gesamtdeutsche Entwicklung ebenso wie die europäische Dimension. Das Militär spielt bei der Erfahrung von Freiheit und Unfreiheit eine zentrale Rolle: Es fungierte damals als Instrument der obrigkeitsstaatlichen Unterdrückung. Zugleich konnte es sich dem revolutionären Gedankengut nicht völlig entziehen, wie Bultmann eindrucksvoll am Leitbild des »Bürgersoldaten« erörtert. Neben dem darstellenden Teil und der Vorstellung der Städte Rastatt und Offenburg als historische Lernorte bietet die Publikation zusätzlich auf einer beigefügten CD zahlreiche Vermittlungshilfen und umfangreiches Quellenmaterial – alles im PDF-Format. Das digitale Begleitmedium beinhaltet eine 192 Seiten umfassende kommentierte Quellensammlung, darunter allein 20 Quellen zum Thema »Der Kampf um die Streitkräfte«, eine Auswahl an digitalisierten Handschriften, Arbeitsmaterialien für den Besuch der Erinnerungsstätte, praktische Vermittlungshilfen Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 2/2008 für die Bildungsarbeit und Längsschnitte zur deutschen Demokratiegeschichte. Buch und CD geben dem Nutzer sowohl theoretische Grundlagen als auch eine Vielzahl von praktischen Hilfestellungen zur Thematik. mn DDR www.nationaler-verteidigungsrat.de Das Militärgeschichtliche Forschungsamt (MGFA) hat in Zusammenarbeit mit dem Bundesarchiv und dem Institut für Zeitgeschichte, München–Berlin, eine Website mit den digitalisierten Akten der Protokolle des Nationalen Verteidigungsrates der DDR von 1960 bis 1989 erstellt. Das Gemeinschaftsprojekt wurde von der »Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur« gefördert. Die bis Anfang 1990 streng geheimen Akten des Nationalen Verteidigungsrates der DDR sind ein Schlüsselinstrument für die Erforschung der Sicherheits- und Militärpolitik der SED, aber auch des Warschauer Paktes insgesamt sowie der UdSSR. An der Spitze dieses geheim tagenden Gremiums standen die Spitzenfunktionäre der SED: Walter Ulbricht bis 1971, dann Erich Honecker und schließlich in der Endphase 1989 Egon Krenz. Die Protokolle der Sitzungen dokumentieren neben den eigentlichen militärischen Sicherheitsund Verteidigungsanstrengungen des SED-Regimes die umfassende Militari- digital sierung von Staat und Gesellschaft in der DDR und erlauben auch einen Blick auf die NATO von außen. So wurden regelmäßig Auswertungen von Manövern und Übungen vor dem hochrangigen Plenum präsentiert. Ferner spiegeln die Dokumente des NVR den Aufbau des Warschauer Paktes als Instrument zur Wahrung der sowjetischen Hegemonial- und Sicherheitsinteressen in Osteuropa wider. Sie ­erlauben somit tiefe Einblicke in entscheidende Dimensionen des ostdeutschen sowie sowjetischen Herrschaftssystems. Deshalb waren die Projektpartner der Ansicht, dass die Akten des Nationalen Verteidigungsrates der DDR Wissenschaftlern in aller Welt sowie einer breiteren, interessierten Fachöffentlichkeit ohne Beschränkungen zugänglich gemacht werden sollten. Eine Veröffentlichung der mehr als 20 000 Blatt umfassenden Sitzungsprotokolle des NVR von 1960 bis 1989 nebst Anlagen konnte daher nur im Publikationsmedium Internet erfolgen. So wird erreicht, dass gerade Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Osteuropa, deren einzige Quelle aus Mangel an Finanzen zumeist das Internet ist, einen unbeschränkten und vergleichsweise kostengünstigen Zugang zu historisch bedeutenden Akten­be­ ständen erhalten, die auch für die Auf­ arbeitung der Nachkriegsgeschichte ihrer eigenen Staaten von erheb­licher Bedeutung sein können und es zugleich ermöglichen, Besonderheiten der von Westeuropa nach 1945 teilweise abgekoppelten gesellschaftlichen und politischen Entwicklung Osteuropas besser zu verstehen. Ein weiterer Nutzen soll darin bestehen, ein Zeichen in Richtung dieser ehemaligen Ostblockstaaten zu setzen, ebenfalls ihre Akten für die Wissenschaft weiter zu öffnen. Hierzu wurde auf der Internetplattform des Projektes ein Bereich für die ehemaligen Staaten des Warschauer Vertrages – Albanien, Bulgarien, Polen, Rumänien, Tschechoslowakei, Sowjetunion und Ungarn – geschaffen, der Forschern aus diesen Ländern die Möglichkeit eröffnet, über die Verteidigungsräte ihrer Länder und den Verbleib der dazugehörigen Akten zu informieren. Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände Mit Nürnberg werden beim Blick auf die NS-Zeit vier Dinge eng verbunden: die Reichsparteitage der NSDAP, die »Nürnberger Gesetze« des Jahres 1935, der Verlagsort der NS-Hetzschrift »Der Stürmer« sowie die Nürnberger Prozesse 1945/46. Das »Dokumentationszentrum Reichs­ parteitagsgelände« stellt alle vier der Öf­fentlichkeit vor, unter anderem auch auf der Internetseite www.museen.­ nuernberg.de/dokuzentrum. Die Homepage präsentiert neben aktuellen Veranstaltungshinweisen die Themenbereiche »Die Stadt der Reichsparteitage«, »Das Reichsparteitagsgelände« und die Dauerausstellung »Faszination und Gewalt«. So wird einerseits deutlich, wieso die NS-Bewegung gerade die alte Kaiserstadt Nürnberg zur Stadt ihrer »Reichsparteitage« wählte. Die Verbindung zwischen MittelalterMythos, Gedenken an die Gefallenen des Ersten Weltkrieges, das den »Frontkämpfer-Mythos« einschloss, und NSBewegung wird herausgestellt. Ein Lage­plan, zahlreiche Fotos und Texte informieren über die Größe des Reichsparteitagsgeländes, über die verschiedenen Bauten und Einrichtungen. Die Dauerausstellung »Faszination und Gewalt« wird in Grundriss und Detail vorgestellt. Der Bogen spannt sich hier von dem Aufstieg der NSDAP über »Führer-Mythos«, »Volksgemeinschaft« und »Rassismus/Antisemitismus« bis hin zur Nutzung des Geländes nach 1945. Die Homepage gewährt einen Einblick in den Aufbau einer Ausstellung am historischen Ort. Die auf der Seite angesprochenen Filmpräsentationen, Bilder, Zeitzeugeninterviews und elektronischen Schaustationen zeigen die Möglichkeiten heutiger historisch-politischer Bildung. hp www.museen.nuernberg.de/dokuzentrum Heiner Bröckermann Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 2/2008 25 Service Lesetipp Eisernes Kreuz W elt-online titelte »Ein Orden, in dem deutsche Geschichte steckt«, am 6. März 2008 über das Eiserne Kreuz. 1813 wurde es vom preußischen König Friedrich Wilhelm III. als Tapferkeitsauszeichnung in den Befreiungskriegen gegen Napoleon gestiftet. Zu Beginn der Kriege 1870, 1914 und 1939 wurde die Stiftung von König, Kaiser und »Führer« jeweils erneuert. Seit 1956 ist das Eiserne Kreuz Hoheitszeichen der Bundeswehr. In modernerer Erscheinungsform ist es seit einigen Jahren auch als Symbol und quasi Markenzeichen der deutschen Streitkräfte erkannt, respektiert und geachtet im In- und Ausland. Die Symbolgeschichte des Eisernen Kreuzes war nicht frei von Brüchen, Widersprüchen und Missbrauch. ­Einen Teil dieser Historie untersucht Ralph Winkle in seinem Buch. Er beschränkt sich auf den Zeitraum 1914 bis 1936. Im Mittelpunkt der Untersuchung steht der Begriff der »sozialen Ehre«. Winkle zeigt die Ordenspolitik und die Rituale der Verleihung des Eisernen Kreuzes im Ersten Weltkrieg als Funktionselement symbolischer Ordnung im Heer. Orden und Ehrenzeichen waren »billige Zahlungsmittel« und zugleich »mo­ ra­lisches Kapital«. In der Nachkriegsoder vielmehr Zwischenkriegszeit forderten Kriegsinvaliden, Veteranen oder deren Hinterbliebene den »Dank des Vaterlands« ein. »Der tote Held und der bettelnde Kriegskrüppel« symbolisierten die Verweigerung sozialer Anerkennung. Nach 1933 folgten »Glorifizierung« und »Wiederaufwertung« des Eisernen Kreuzes und damit der »soldatischen Ehre«, so Winkle. »Das soziale Drama der Ehrung und der Entehrung, der Verleihung, der Verweigerung [...] von Orden« ist für den Autor Ralph Winkle, Der Dank des Vater­ landes. Eine Symbolgeschichte des Eisernen Kreuzes 1914 bis 1936, Essen 2007. ISBN 978-3-89861610-2; 400 S., 35,00 Euro 26 Ausdruck eines Konflikts innerhalb des deutschen Heeres, der sich nach 1918 in der zivilen Gesellschaft fortsetzte. Wer mehr über die Geschichte des Eisernen Kreuzes erfahren will, dem sei Winkles Buch empfohlen. ks Reichstagsbrand Sven Felix Kellerhoff, Der Reichstags­ brand. Die Karriere eines Kriminalfalls, Berlin 2008. ISBN 9783-89809-078-0; 160 S., 14,90 Euro D er Brand des Reichstagsgebäudes im Februar 1933 erhitzt noch immer die Gemüter. War es Marinus van der Lubbe, der junge Niederländer? Hatte er kommunistische Hintermänner, wie die Nationalsozialisten sofort lautstark behaupteten? Oder waren es die Nationalsozialisten selber, um sich einen Vorwand für die Verfolgung der Opposition zu schaffen? Die These von der »kommunistischen Verschwörung« wurde schon 1933 in einem spektakulären Prozess vor dem Reichsgericht in Leipzig ad absurdum geführt. Der Reichstagspräsident und preußische Ministerpräsident Hermann Göring, als Zeuge wohl eher Ankläger, fand sich verbal selbst in der Rolle des Angeklagten wieder. Das NS-Regime erlitt eine herbe Niederlage: die kommunistischen Parteifunktionäre wurden freigesprochen. Bis heute diskutieren Historiker und Publizisten das pro und contra der Thesen einer Verstrickung der NS-Führung oder des Einzeltäters van der Lubbe. Zum 75. Jahrestag des Brandes legt Sven Felix Kellerhoff ein wichtiges Buch zum Thema vor: »Die Karriere eines Kriminalfalls«. Kellerhoff gibt zunächst das Geschehen in der Nacht vom 27. auf den 28. Februar 1933 minutiös und detailliert wieder. Dabei stützt er sich auf die protokollierten Aussagen der Kriminalbeamten. Der größere Teil des Buches befasst sich mit den Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 2/2008 weitreichenden Folgen des Brandes: Hetze gegen und Jagd auf Kommunisten, »Schutzhaft«, die Reichstagswahlen im Schatten der Verfolgungen und der Hysterie gegen alle Oppositionellen, schließlich in Konsequenz dessen das Ermächtigungsgesetz vom März 1933. Kellerhoff schreibt leicht verständlich und anschaulich. Er zitiert auch aus dem Prozessprotokoll, wie der Angeklagte Georgi Dimitroff den Zeugen Göring vorführte: »Gegen die kommunistische Partei in Deutschland einen Kampf zu führen, ist Ihr Recht. Mein Recht ist [...] Ihre Regierung zu bekämpfen [...].« Göring antwortete: »Sie sind in meinen Augen ein Gauner, der längst an den Galgen gehört!« Dimitroff: »Haben Sie Angst [...], Herr Ministerpräsident?« Der Richter entzog Dimitroff das Wort. Vor den Augen der Öffentlichkeit aber war Göring bloßgestellt. ks Der Kaukasus Marie-Carin von Gumppenberg und Udo Steinbach (Hg.), Der Kaukasus. Geschichte – Kultur – Politik, München 2008. ISBN 978-3406-56800-8; 240 S., 12,95 Euro D er EU-Beitritt Rumäniens und Bulgariens im Jahr 2007 rückte den Kaukasus in unmittelbare Nachbarschaft zu Europa. Dennoch ist die Region nach wie vor für viele Europäer »Terra incognita«. Die drei südkaukasischen Staaten Georgien, Armenien und Aserbaidschan waren Teil der Sowjetunion und wurden Anfang der 1990er Jahre unabhängig. Innerhalb Georgiens versuchen seitdem die Provinzen Abchasien und Südossetien die Unabhängigkeit zu erlangen. Die daraus resultierenden Konflikte und die langjährige Auseinandersetzung zwischen Armeniern und Aserbaidschanern um »Berg Karabach« beschäftigen die Weltöffentlichkeit. Im Gegensatz zu den »eingefrorenen« Konflikten im Südkaukasus dauern die bewaffneten Auseinandersetzungen in den zur Russischen Föderation gehörenden nordkaukasischen Teilrepubliken weiter an. Zwar wurde der Tschetschenienkonflikt offiziell längst beigelegt. Anschläge und Gefechte stehen aber bis heute auf der Tagesordnung. Allerdings haben sie an Zahl und Intensität in Tschetschenien abgenommen bzw. sich in die Nachbarrepubliken verlagert. 16 namhafte Wissenschaftler zeigen in dem über 250 Seiten umfassenden Buch zunächst kenntnisreich die politische Situation auf. Mit der Türkei und dem Iran werden dabei auch zwei an den Kaukasus grenzende Staaten in den Blick genommen. Die Perspektiven, die Rolle internationaler Organisationen sowie die wirtschaftliche Lage in der Region sind Gegenstand weiterer profunder Beiträge. Darauf aufbauend werden die eingangs skizzierten vielschichtigen Konflikte analysiert und dem Leser gut verständlich vorgestellt. Im Mittelpunkt des Bandes stehen allerdings nicht nur die politischen Verhältnisse und die Konflikte. Informative Beiträge über ausgesuchte kulturelle Aspekte erzählen über die Ethnien, Sprachen, Religionen, Kunst, politischen Tradi­ tionen und Rechtskultur. Sie bringen dem Leser in gelungener Weise den kulturellen Reichtum der Region nahe. Mehrere Karten zu Geografie, Ethnien, Politik und Wirtschaft erleichtern dem Leser die Orientierung und runden das Buch ab. mp Militärbiografie » Jedesmal, wenn ein Buch mit einer Erfahrung zusammenstößt, kommt es zu einer Interferenz, zu einer pro- duktiven Störung«, so der Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger 1979 bei seiner Übersetzung von Molières »Der Menschenfeind«. Reich an produktiven Störungen ist sein Versuch, das Leben des Generalobersten Kurt von Hammerstein-Equord (1878-1943) für ein breites Publikum zu »übersetzen«. Hammerstein war ein erklärter Gegner der Nationalsozialisten, Russland-Spezialist und hatte Kontakt zum Widerstand. In der Endphase der Weimarer Republik war er Chef der Heeresleitung (1930-1934). Hitler hielt seine berühmt-berüchtigte erste Rede zur künftigen Militärpolitik vor den Spitzen der Reichswehr am 3. Februar 1933 in Hammersteins Dienstwohnung im Bendlerblock. Zwei seiner Söhne waren am 20. Juli 1944 beteiligt, die Töchter sympathisierten offen bzw. verdeckt mit der KPD. Enzensberger schrieb ein Psychound Soziogramm einer deutschen Adelsfamilie, die Widerstand leistete. Es gewährt Einblicke in die persönlichen Verbindungen führender Militärs sowie in die Struktur der (1933 verbotenen) KPD sowie der KPdSU. Es macht zugleich die Problematik und Vielschichtigkeit des Widerstandes gegen das NS-Regime fassbar. Elf fiktive Unterhaltungen mit Toten sowie sieben eingeschobene Glossen (etwa »Die Schrecken der Weimarer Republik«) bieten einen eigenwilligen Zugang zur deutschen Geschichte. Sie rütteln auf – und erreichen dadurch beim Leser mehr als so manche nüchterne Darstellung von Historikern. »Es bleibt ein ungesagter Rest, den keine Biographie auflösen kann; und vielleicht ist es dieser Rest, auf den es ankommt«, so Enzensberger am Ende seines ungewöhnlichen Buches (S. 343). hp Hitlers Helfer Hans Magnus ­Enzensberger, Hammer­ stein oder der Eigen­ sinn. Eine deutsche Geschichte, Frankfurt a.M. 2008. ISBN 978-3518-41960-1; 376 S., 64 Abb., 22,90 Euro W er in einer beliebigen deutschen Stadt Kriegerdenkmäler betrachtet oder sich in den populären Medien über Kriege der letzten 200 Jahre mit Beteiligung deutscher Truppen informiert, der kann einen falschen Eindruck bekommen. Er oder sie mag annehmen, dass diese Kriege die Unternehmungen von nur einem deutschen Staat oder dem Deutschen Reich gewesen seien. Diesem schiefen Bild eines »einfachen« nationalen Krieges wird dann gerne die heutige komplexe Gemengelage von Bündnissen, »Rules of Engagement« und Truppenstellerkonferenzen entgegengehalten. Rolf-Dieter Müller, An der Seite der Wehrmacht. Hitlers ausländische Helfer beim »Kreuzzug gegen den Bolschewismus« 1941-1945, Berlin 2007. ISBN 978-386153-448-8; 275 S., 24,90 Euro Rolf-Dieter Müller ist es gelungen, dieses Bild mit Blick auf den Zweiten Weltkrieg an der Ostfront im Zeitraum 1941 bis 1945 zu korrigieren. Was sich auf den ersten Blick als der »letzte deutsche Krieg« darstellt, entpuppt sich als Einsatz von Truppen aus 20 europäischen Völkern, die an der Seite der Wehrmacht – gezwungen oder freiwillig – gegen die Rote Armee im Einsatz waren. Das Buch ist nach Ländern gegliedert. Die Analyse der drei Gruppen – Verbündete, Freiwillige aus neutralen und besetzten Gebieten, osteuropäische Völker im Kampf gegen den Stalinismus – macht den Hauptteil des Buches aus. Der Autor kommt zu dem Ergebnis, dass die Zahl der Verbündeten 1941 an der Ostfront etwa eine Million Mann ausmachte, bei einer Wehrmachtsstärke von drei Millionen deutscher Soldaten. Während des Krieges sank die Stärke der Wehrmacht auf 2,5 Millionen Mann, die der Verbündeten erhöhte sich auf zwei Millionen. Ohne diese Verbündeten hätte sich die Wehrmacht nicht auf den Hauptstoß Richtung Moskau konzentrieren können, wäre die Sommeroffensive 1942 nicht möglich gewesen und hätte die Wehrmacht niemals so lange durchhalten können. Hinzu kam der Einsatz hinter der Front im Rahmen der »Partisanenbekämpfung«. Auch sie wäre ohne Deutschlands Verbündete nicht möglich gewesen. hp Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 2/2008 27 Service Ausstellungen Alzey Bad Bocklet Als Not erfinderisch machte. »Notprodukte« aus der Zeit vor und nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Museum der Stadt Alzey Antoniterstraße 41 55232 Alzey Telefon: 0 67 31/49 88 96 Telefax: 0 67 31/99 08 85 www.museum-alzey.de [email protected] 18. Mai bis 6. Juli 2008 Dienstag bis Sonntag 10.00 bis 12.00 und 14.00 bis 16.30 Uhr Montag geschlossen Eintritt frei Aufstand des Gewissens Wandelhalle im Kurpark 97708 Bad Bocklet Telefon: 0 97 08 / 7 07 03-0 Telefax: 0 97 08 / 7 07 03-9 www.badbocklet.de [email protected] 2. Juli bis 4. August 2008 Öffnungszeiten: täglich 8.30 bis 22.00 Uhr Eintritt frei Berlin The Making of ... Die Männer und Frauen der Berliner Luftbrücke 1948/49 Artstetten Feldmarschallleutnant Freiherr Guido von Novak Arienti: »Ein Leben für Gott, Kaiser und Vaterland«. Ein Offizier und seine Zeit Schloss Artstetten Erzherzog Franz Ferdinand Museum A-3661 Artstetten Telefon: +43 (0) 74 13 / 80 06-0 Telefax: +43 (0) 74 13 / 80 06-15 www.schloss-artstetten.at [email protected] 1. April bis 2. Nov. 2008 täglich von 9.00 bis 17.30 Uhr Eintritt: 7,00 € ermäßigt ab 4,00 € Verkehrsanbindung: Pkw: A1 Ri chtung Linz/ Salzburg Abfahrt »Pöchlarn«. 28 AlliiertenMuseum Clayallee 135 14195 Berlin Telefon: 030 / 81 81 99-0 Fax: 030 / 81 81 99-91 www.alliiertenmuseum.de [email protected] 27. Juni 2008 bis 20. September 2009 Öffnungszeiten täglich außer Mittwoch 10.00 bis 18.00 Uhr Eintritt frei Verkehrsanbindung: S-Bahn: S 1 bis Station »Zehlendorf«, weiter mit Bus 115 bis Haltestelle »Alliierten­ Museum«; U-Bahn: U 3 bis Station »Oskar-HeleneHeim«; Bus: Linie 115 oder 183 bis Haltestelle »AlliiertenMuseum«. Welt im Umbruch. Fotojournalismus in den 90er Jahren Deutsches Historisches Museum – Pei-Bau Hinter dem Gießhaus 3 10117 Berlin Telefon: 0 30 / 20 30 40 Telefax: 0 30 / 20 30 45 43 www.dhm.de [email protected] (Führungen) 14. März bis 15. Juni 2008 täglich 10.00 bis 18.00 Uhr Eintritt: 4,00 € (unter 18 Jahren frei) Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 2/2008 Verkehrsanbindung: S-Bahn: Stationen »Hackescher Markt« und »Friedrichstraße«; U-Bahn: Stationen »Französische Straße«, »Hausvogteiplatz« und »Friedrichstraße«; Bus: Linien 100, 157, 200 und 348 bis Haltstellen »Staatsoper« oder »Lustgarten«. Brennpunkt Berlin: Die Blockade 1948/49. Der Foto­ journalist Henry Ries Deutsches Historisches Museum – Pei-Bau (siehe oben) 12. Juni bis 21. Sept. 2008 Jewgeni Chaldej – Der bedeutende Augenblick. Eine Retrospektive Martin-Gropius-Bau Niederkirchnerstraße 7 10963 Berlin Telefon: 030 / 2 54 86-0 Telefax: 030 / 2 54 86-1 07 www.gropiusbau.de [email protected] www.chaldej.de 8. Mai bis 28. Juli 2008 Mittwoch bis Montag 10.00 bis 20.00 Uhr Eintritt: 5,00 € ermäßigt 3,00 € Verkehrsverbindung: U-Bahn: U 2 bis Station »Potsdamer Platz« ; S-Bahn: Linien 1, 2, 25 bis Stationen »Potsdamer Platz« oder »Anhalter Bahnhof«; Bus: M 29 bis Station »S Anhalter Bahnhof«, M 4 bis Station »Abgeordnetenhaus«. Geschichte der Luftfahrzeugantriebe Luftwaffenmuseum der Bundeswehr Kladower Damm 182 14089 Berlin-Gatow Telefon: 030 / 36 87 26 01 Telefax: 030 / 36 87 26 10 www.luftwaffenmuseum.com LwMuseumBwEingang@ bundeswehr.org 12. Oktober 2007 bis 31. Oktober 2008 Dienstag bis Sonntag 9.00 bis 17.00 Uhr Eintritt frei Verkehrsanbindung: Eingang zum Museum: Ritter­ felddamm /Am Flugfeld Gatow. Celle Nec Aspera Terrent. ­Hannoversche Militär­ geschichte vom Sieben­ jährigen Krieg bis zur Schlacht bei Langensalza. Zinnfiguren-Ausstellung in der Ehrenhalle der ­Hannoverschen Armee Bomann-Museum Celle Schloßplatz 7 29221 Celle Telefon: 0 51 41 / 1 23 72 Telefax: 0 51 41 / 1 25 35 www.bomann-museum.de (links unter »Museen« auf ­»Bomann-Museum« klicken) [email protected] 20. April bis 26. Okt. 2008 Dienstag bis Sonntag 10.00 bis 17.00 Uhr Eintritt: 3,00 € ermäßigt ab 1,00 € Verkehrsanbindung: Pkw: (von Norden) A 7 ­Hamburg-Hannover, Abfahrt Soltau-Süd, B 3 Soltau-Celle bzw. A 250 Hamburg-Lüneburg, B 4 Lüneburg-Uelzen, B 191 Uelzen-Celle (von ­Süden), B 214 Braunschweig-Celle bzw. A 7 Hannover-Hamburg, Abfahrt AB-Kreuz HannoverKirchhorst: A 37 HannoverBurgdorf, B 3 Burgdorf-Celle. Frankfurt (Oder) Friedrich Wilhelm Carl von Schmettau – Pionier der modernen Kartographie, Übersetzer, Militärschriftsteller, Gestalter von Parks und Gärten Kleist-Museum Faberstraße 7 15230 Frankfurt (Oder) Telefon: 03 35 / 53 11 55 Telefax: 03 35 / 5 00 49 45 www.kleist-museum.de [email protected] 27. April bis 29. Juni 2008 Eintritt: 3,00 € ermäßigt 2,00 € Verkehrsanbindung: Wegbeschreibung: www.kleist-museum.de (Menüpunkt »Museums­ besuch«). Kossa/Söllichau Militärmuseum Bunker Kossa Dauerausstellung zur NVAGeschichte Dahlenberger Str. 1 04849 Kossa/Söllichau Telefon: 03 42 43 / 2 21 20 Telefax: 03 42 43 / 2 31 20 www.bunker-kossa.de [email protected] Dienstag bis Sonntag 9.00 bis 16.00 Uhr (Führungen jeweils 10.00 und 13.00 Uhr) Eintritt: 5–10 € Verkehrsanbindung: Von Bad Düben nach ­Söllichau, am Ortsausgang Söllichau hinter Bahnübergang links der Waldstraße fol­ gen, Ausschilderung ­beachten. Krefeld Das Geheimnis der Kelten Museum Burg Linn Rheinbabenstraße 85 47809 Krefeld Telefon: 0 21 51 / 57 00 36 www.diekelten.de [email protected] 20. Jan. bis 3. Aug. 2008 bis Ende März Dienstag bis Sonntag 11.00 bis 17.00 Uhr ab April Dienstag bis Sonntag 11.00 bis 18.00 Uhr Eintritt: 3,00 € ermäßigt: ab 1,50 € Verkehrsanbindung: Pkw: A 57 Abfahrt KrefeldOppum/Linn; Straßenbahn: ab Hauptbahnhof Linie 044Rheinhafen bis Haltestelle »Burg Linn«. Ludwigsburg Zwischen Kunst und Kitsch – Erinnerungs­ kultur der Soldaten Garnisionmuseum Ludwigs­burg Asperger Straße 52 71634 Ludwigsburg Telefon: 0 71 41 / 9 10 24 12 Telefax: 0 71 41 / 9 10 23 42 www.garnisionmuseum­ludwigsburg.de info@garnisionmuseum­ludwigsburg.de Verkehrsanbindung: Anfahrtsbeschreibung per Bus und Kfz: www.museum.speyer.de (Menüpunkt Informationen, Anreise). 1. Juli 2007 bis 27. Juli 2008 Mittwoch 15.00 bis 18.00 Uhr Sonntag 13.00 bis 17.00 Uhr (und auf Anfrage) Eintritt frei Verkehrsanbindung: Pkw: A 81-B 27; S-Bahn: S 4 und S 5 (von Stuttgart bzw. Bietigheim) bis Station »Ludwigs­burg«. Wien Munster Unverschämtes Glück Deutsches Panzermuseum Munster Hans-Krüger-Str. 33 29633 Munster Telefon: 05 19 / 22 55 2 Telefax: 05 19 / 21 30 21 5 www.munster.de (links Verlinkung zum »Panzermuseum«) [email protected] 5. Juni bis 1. Nov. 2008 Dienstag bis Sonntag 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr Montag geschlossen (letzter Einlass 17.00 Uhr) An den Feiertagen auch montags geöffnet Eintritt: 5,00 € ermäßigt 2,50 € Verkehrsanbindung: Pkw: Eine Anfahrtsskizze gibt es auf der Internetseite über »Kontakt«, dann »Anfahrt«; Bahn: Vom Bahnhof Munster entweder mit Taxi oder zu Fuß über Bahnhofsstraße, Wagnerstraße und Söhlstraße zur Hans-Krüger-Straße (ca. 15 Minuten Fußweg). Nordholz Manfred von Richthofen AERONAUTICUM Deutsches Luftschiff- und Marinefliegermuseum Peter-Strasser-Platz 3 27637 Nordholz Telefon: 0 47 41 / 18 19-13 (oder -11) Telefax: 0 47 41 / 18 19-15 www.aeronauticum.de [email protected] 10. April bis 14. Sept. 2008 Februar bis November täglich 10.00 bis 18.00 Uhr Dezember bis Januar täglich 10.00 bis 16.00 Uhr Eintritt: 6,50 € ermäßigt 2,50 € Verkehrsanbindung: Anfahrtsbeschreibung per Kfz: www.aeronauticum.de (Menüpunkt Besucher­ information, Anfahrt). Prora Erinnerung bewahren. Sklaven und Zwangs­ar­ beiter des Dritten Reiches aus Polen 1939–1945 Dokumentationszentrum Prora Objektstraße, Block 3/ Querriegel 18609 Prora Telefon: 03 83 93 / 1 39 91 Telefax: 03 83 93 / 1 39 34 www.proradok.de [email protected] 24. April bis 31. Aug. 2008 täglich 10.00 bis 18.00 Uhr Eintritt: 3,00 € ermäßigt 2,00 € (Kinder unter 14 Jahren freier Zutritt) Verkehrsanbindung: Anfahrtsbeschreibung für Anreise mit Bahn, Bus und Kfz: www.proradok.de/seiten_ deutsch/service.html. Speyer Samurai Historisches Museum der Pfalz Domplatz, 67346 Speyer Telefon: 0 62 32 / 1 32 50 Telefax: 0 62 32 / 1 32 54 0 www. museum.speyer.de [email protected] 24. Februar bis 5. Okt. 2008 Dienstag bis Sonntag 10.00 bis 18.00 Uhr Eintritt: 10,00 € ermäßigt 7,00 € Einmarsch ‘38 Heeresgeschichtliches ­Museum Militärhistorisches Institut Arsenal, Objekt 1 A-1030 Wien Telefon: +43 (1) / 79 56 1-0 Telefax: +43 (1) / 79 56 1-17 70 7 www.hgm.or.at [email protected] 11. Juni bis 9. Nov. 2008 täglich 9.00 bis 17.00 Uhr Freitag geschlossen Eintritt: 5,10 € ermäßigt 3,30 € (bis 10 Jahre frei) Verkehrsanbindung: Schnellbahn: Bis Station »Südbahnhof«; Straßenbahn: Linien 18, D, O; Autobus: Linien 13 A, 69 A; U-Bahn: U 1 bis Station »Südbahnhof«, U 3 bis Station »Schlachthausgasse«. Wilhelmshaven Meuterei – Revolution – Selbstversenkung. Die Marine und das Ende des Ersten Weltkrieges Deutsches Marinemuseum Südstrand 125 26382 Wilhelmshaven Telefon: 0 44 21 / 4 10 61 www.marinemuseum.de [email protected] 25. April bis 9. Nov. 2008 April bis Oktober täglich 10.00 bis 18.00 Uhr November bis März täglich 10.00 bis 17.00 Uhr Eintritt: 8,50 € ermäßigt 5,00 € Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 2/2008 29 Militärgeschichte kompakt 3. September 1783 F riede zu Versailles 1783 – Ende des ullstein bild - Granger Collection ­Amerikanischen Unabhängigkeitskrieges Der Friedensschluss zu Versailles – auch Friede zu Paris genannt – beendete am 3. September 1783 den Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg (1776-1783). Er wurde zwischen Großbritannien und den dreizehn aufständischen Kolonien in Nordamerika geschlossen. Dem Friedensvertrag waren britische Niederlagen und ein Vorfriede vom 20. November 1782 vorausgegangen. Ratifiziert wurde der Friedensvertrag von Versailles seitens der USA am 14. Januar 1784, die britische Seite ließ mit ihrer Unterschrift bis zum 9. April 1784 auf sich warten. Zeitgleich schloss Großbritannien Frieden mit den am Kriege 5 Friede zu Paris, 1783: ebenfalls beteiligten Königreichen Frankreich und Spanien. Die amerikanischen FriedensDie Vereinigten Staaten von Amerika wurden durch den kommissare (3. v. links BenjaFrieden anerkannt, diverse amerikanische Fischereierechte min Franklin). Unvollendetes wurden ebenso garantiert wie die freie Nutzung des MissisGemälde (die britischen Friesippi. Beide Kriegsparteien hatten ihre Kriegsschulden zu denskommissare weigerten bezahlen; verbliebenes britisches Militärmaterial in den sich, für das Gemälde zu posie- USA durfte nicht beschädigt werden, die Kriegsgefangenen ren) von Benjamin West. waren freizulassen. Die USA hatten Gebiete, die nach dem Frieden besetzt worden waren, zu räumen. Der Friede von Versailles bedeutete den Anfang der USA als Nation sowie den Beginn der ersten großen Republik mit demokratischer Herrschaftsform der Neuzeit. Dieses Beispiel wirkte auf Frankreich, wo 1789 die Revolution ausbrach, sowie auf Polen, das sich 1791 die erste geschriebene Verfassung Europas gab. hp 26. August 1978 Start des ersten Deutschen in den ­Weltraum ullstein bild - ADN-Bildarchiv Am letzten Samstag im August 1978 startete Major Sigmund Jähn (Luftstreitkräfte/Luftverteidigung der NVA) als erster Deutscher einen Flug in den Weltraum. Jähn, 1937 im Vogtland geboren, trat nach einer Lehre als Buchdrucker im April 1955 seinen Wehrdienst in der DDR an. Nach mehreren Verwendungen in den DDR-Luftstreitkräften wurde Jähn Mitte der 60er Jahre für ein Studium an die Militärakademie der Luftstreitkräfte der Sowjetunion »J.A. Gagarin« berufen, das er mit dem Diplom eines Militärwissenschaftlers abschloss. Ab 1976 nahm Jähn an einer Kosmonautenausbildung im Rahmen des Interkosmos-Programms der UdSSR teil. Es sah die Einbindung nicht-sowjetischer Technik in 5 Waleri F. Bykowski (links) das sowjetische Raumfahrtprogramm vor. Am 26. August und Sigmund Jähn vor der geflog Jähn schließlich gemeinsam mit Waleri F. Bykowski in borgenen Raumkapsel, der sowjetischen Raumkapsel Sojus 31 ins All. Insgesamt 3.9.1978. 125 Mal sollten die beiden Kosmonauten die Erde umkreisen und dabei etliche wissenschaftliche Experimente durchführen. Nach sieben Tagen, 20 Stunden, 49 Minuten und vier Sekunden landete die Rückkehrkapsel Sojus 29 wieder auf der Erde – unerwartet hart, was bei Jähn bleibende Wirbelsäulenschäden hinterließ. Die DDR würdigte Jähn ausgiebig. Zahlreiche Schulen und Freizeiteinrichtungen tragen noch heute seinen Namen. Der »Held der DDR« und »Held der Sowjetunion« stieg 1986 zum Generalmajor der NVA auf. Der Name Jähn ist auch heute noch zahlreichen Menschen in den neuen Bundesländern ein Begriff: 2005 erinnerten sich im Osten bei einer Umfrage noch 60 Prozent an Jähn. Sigmund Jähn erfuhr im All die ­»totale Glückseligkeit: Unsere Erde, in leuchtendes Blau gehüllt.« Die DDR war das fünfte Land, das an der bemannten Raumfahrt teilhaben konnte; er habe, so der Kosmonaut denn auch im September 1978, seinem Land »das Tor ins Weltall aufgestoßen«. Fünf Jahre später, 1983, flog mit Ulf Merbold der erste Westdeutsche ins All. Mit besonderen Worten würdigte 2002 der damalige Bundespräsident Johannes Rau den ehemaligen NVA-General Jähn: »Sie haben an diesem Tag vielen Menschen das Gefühl gegeben, zum ersten Mal sei ›einer von uns‹ hinaus ins All geflogen.« Sigmund Jähn ist heute als freier Berater für die European Space Agency (ESA) und für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) tätig. mt 30 Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 2/2008 Heft 3/2008 Service Militärgeschichte Zeitschrift für historische Bildung Vorschau Im November vor 90 Jahren endete der Erste Weltkrieg, der auch als die »Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts« bezeichnet wird. Doch nicht nur der Krieg selbst war katastrophal, die Folgen waren es ebenfalls. In Deutschland kam es zu Revolution und Bürgerkrieg. Die »Vielvölkerreiche« Österreich-Ungarn und das Osmanische Reich zerbrachen durch nationale Aufstände. Aus den Trümmern des zaristischen Russlands erwuchs nach blutigen Kämpfen die Sowjetunion. Das damalige Europa und die Welt wurden erschüttert, die Nachwirkungen sind bis heute spürbar. Im Mittelpunkt der nächsten Ausgabe der Militärgeschichte stehen die Ereignisse des Herbstes 1918. Diese waren so vielfältig, dass der Versuch, sie alle historisch zu würdigen, nur scheitern kann. Die Redaktion traf daher eine Auswahl, die unvollständig bleiben muss. Ausschlaggebend war letztlich eine engere Verbindung zur deutschen Militärgeschichte. Werner Rahn blickt auf die Ereignisse in Kiel und Wilhelmshaven im Oktober/November 1918 zurück. Dieter Storz schildert den Zusammenbruch der Westfront. Beide Aufsätze greifen somit zwei Hauptstränge jener militärischen Entwicklungen am Ende des Krieges auf, die, neben anderen tiefer liegenden Ursachen, zur Revolution im November führten. Der Beitrag von Rüdiger Bergien geht zeitlich über den November 1918 hinaus. Er stellt die Zeit des Bürgerkriegs, der bewaffneten Aufstände und deren Zerschlagung durch ehemalige Fronttruppen, vor, wobei die besondere Rolle der Freikorps aufgezeigt wird. Die Kriegsmüdigkeit aller Völker Europas hielt nicht lange an. 21 Jahre später begann Deutschland einen neuen Weltkrieg. Aus den schrecklichen Lehren beider Kriege heraus entstand die Überzeugung der Weltgemeinschaft, dass sich Ähnliches nicht mehr wiederholen darf. Diesem Ziel verpflichtet, verabschiedete die Generalversammlung der Vereinten Nationen im Dezember 1948 die Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermords. Sie jährt sich damit zum 60. Mal, ein Grund für Franz-Joseph Hutter, darauf zurückzublicken. Ein anderes, erfreuliches Jubiläum feiert die Deutsche Marine und mit ihr die Bundeswehr im Dezember: den 50. Jahrestag der Indienststellung des Segelschulschiffs »Gorch Fock«. Die kommende Ausgabe der Militärgeschichte geht auf dieses Jubiläum ein. ks Militärgeschichte im Bild ČSSR 1968: Militärische Reaktionen des Westens I litärischen NATO-Führung kein Zweifel mehr an der Absicht des Warschauer Paktes, in der ČSSR militärisch aktiv zu werden. Doch weder der Militärausschuss noch der Ständige Rat der NATO hielten es für notwendig, vorausschauend eine besondere Spannungs- und Alarmbereitschaft anzuordnen, obwohl der Oberbefehlshaber Europa (SACEUR), General Lyman L. Lemnitzer, zu einer verstärkten militärischen Wachsamkeit riet. Im NATOHauptquartier (SHAPE) bei Mons, 40 km südlich von Brüssel, war man sich offenbar ziemlich sicher, dass dem Westen seitens der sowjetischen Truppen und ihrer Verbündeten keine Gefahr drohte. Eine inoffizielle Nachricht der Russen, dass der Aufmarsch im Ostblock auf keinen Fall gegen den Westen gerichtet sei, soll angeblich in den westlichen Führungskreisen der Hauptgrund für diese Ruhe und Gelassenheit gewesen sein. Es war ein Spiel mit dem Feuer. Die regionalen Befehlshaber und Kommandeure wurden am 21./ 22. August 1968 ohne jegliche »Vorwarnung« seitens der NATO mit der sowjetischen Militäraktion gegen die ČSSR konfrontiert. In dieser Situation befahl der ullstein bild n der Nacht vom 20. zum 21. August 1968 marschierten Truppen des Warschauer Paktes – aus vier Richtungen kommend – auf breiter Front und unter Einhaltung völliger Funkstille in die ČSSR ein. Mehr als 200 000 Mann mit Tausenden von Panzern und Schützenpanzerwagen fluteten ins Land. Die militärische Intervention beendete gewaltsam den Versuch der Tschechen und Slowaken, einen »Sozialismus mit menschlichem Antlitz« aufzubauen, der als »Prager Frühling« in die Geschichte einging. Das totalitäre sowjetische System hatte damit im eigenen Herrschaftsbereich noch einmal seine Macht demonstriert (siehe Militärgeschichte 3/2003). Die zügig durchgeführte Militäroperation der Sowjets kam nicht nur für die Führung der ČSSR, sondern auch für den Westen überraschend. Die tatsächliche Überraschung bezog sich vor allem darauf, dass es bis zuletzt nicht gelungen war, den Tag und die Stunde des Überfalls exakt festzustellen. Freilich waren der NATO die militärischen Aktivitäten der UdSSR und ihrer Verbündeten an den Grenzen zur ČSSR nicht verborgen geblieben. Spätestens seit Ende Juli bestand in der mi- 5 Besatzung eines sowjetischen Panzers in Prag inmitten einer aufgebrachten Menschenmenge, 26. August 1968. Oberbefehlshaber der CENTAG (Central Army Group), General James H. Polk, eigenverantwortlich sofort erste Alarmmaßnahmen für seine Truppen. Ebenso schnell und konzentriert handelte der Kommandierende General des II. Korps der Bundeswehr, Generalleutnant Karl Wilhelm Thilo. Er traf umgehend in seinem grenznahen Verantwortungsbereich einige vorsorgliche Anordnungen zur Erhöhung der Einsatzbereitschaft der Truppe. »Ich meinerseits hatte meinem G 4 [Logis­tik, Nachschub] bereits befohlen, die Munitionsbestände des Korps zu überprüfen und einige vorgezogene Vorratslager mit Munition und Treibstoff einzurichten. Auch einen vorgeschobenen Korpsgefechtsstand ließ ich erkunden«, so erinnerte sich Thilo später. Dieses verantwortungsvolle Handeln stieß in Bonn aber nur auf wenig Verständnis. Hier beharrte man auf äußerste militärische Zurückhaltung. Seitens des Bundesministeriums der Verteidigung wurden jedoch zumindest die Wochenendurlaube der Soldaten ausgesetzt. Als erste militärische Reaktion der NATO auf den Einmarsch war nur die Luftwarnstufe »Gelb« für die Luftverteidigungskräfte der Kommandobereiche »Zentraleuropa« und »Ostseeausgänge« ausgelöst worden. Ab den Mittagsstunden des 21. August und in den folgenden Tagen liefen in den NATO-Landstreitkräften jedoch offizielle Teilmaßnahmen zu den Stufen »Militärische Wachsamkeit« und »Einfacher Alarm« an, die unter anderem ein kurzfristiges Verlegen von Truppen in Konzentrierungs- bzw. Handlungsräume möglich machen sollten. Die Aufklärung und die Beobachtung an den Grenzen zu Lande, zur See und in der Luft wurden wesentlich verstärkt. Ende August kam es jedoch bereits zu Lockerungen im militärischen Bereitschaftssystem. Die Lage in der Tschechoslowakei hatte sich – zumindest für die Militärs im Westen – entspannt. Rüdiger Wenzke Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 2/2008 31 /&6&16#-*,"5*0/&/%&4.('" Das große Standardwerk +FU[UWPMMTUÊOEJH %BT%FVUTDIF3FJDIVOEEFS;XFJUF8FMULSJFH #ÊOEFIFSBVTHFHFCFOWPN .JMJUÊSHFTDIJDIUMJDIFO'PSTDIVOHTBNU Das bei der Deutschen Verlags-Anstalt erscheinende Reihenwerk »Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg« gilt als das wissenscha�liche Flaggschiff des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes (MGFA) und zählt zu den größten und ambitioniertesten Projekten der modernen deutschen Wissenscha�sgeschichte. In zehn Bänden (mit Teilbänden in dreizehn Büchern) haben über fünfzig Autoren zu einer umfassenden Geschichte des Zweiten Weltkrieges beigetragen. ► )PSTU#PPH3JDIBSE-BLPXTLJ8FSOFS3BIO .BOGSFE;FJEMFS+PIO;JNNFSNBOO %FS;VTBNNFOCSVDIEFT%FVUTDIFO3FJDIFT &STUFS)BMCCBOE %JFNJMJUÊSJTDIF/JFEFSXFSGVOHEFS8FISNBDIU *N"VGUSBHEFT.('"ISTHWPO3PMG%JFUFS.àMMFS .àODIFO%FVUTDIF7FSMBHT"OTUBMU9**4 %BT%FVUTDIF3FJDIVOEEFS;XFJUF8FMULSJFH &VSP*4#/ ► +ÚSH&DIUFSOLBNQ"OESFBT,VO[8JMGSJFE-PUI 3PMG%JFUFS.àMMFS3àEJHFS0WFSNBOT.JDIBFM4DIXBSU[ %FS;VTBNNFOCSVDIEFT%FVUTDIFO3FJDIFT ;XFJUFS)BMCCBOE %JF'PMHFOEFT;XFJUFO8FMULSJFHFT *N"VGUSBHEFT.('"ISTHWPO3PMG%JFUFS.àMMFS .àODIFO%FVUTDIF7FSMBHT"OTUBMU7***4 %BT%FVUTDIF3FJDIVOEEFS;XFJUF8FMULSJFH &VSP*4#/ »Eines der größten Unternehmen der modernen Geschichtswissenscha�« Johannes Hürter, Frankfurter Allgemeine Zeitung »Eine überaus eindrucksvolle Gesamtleistung, von der Öffentlichkeit und Forschung fortab profitieren werden« Hans-Ulrich Wehler, Die Zeit