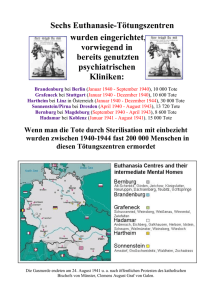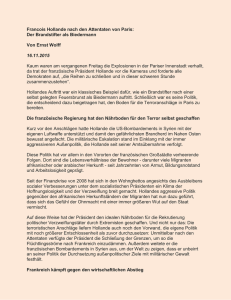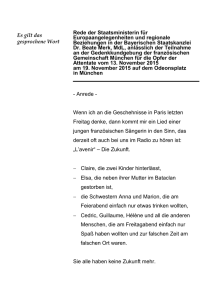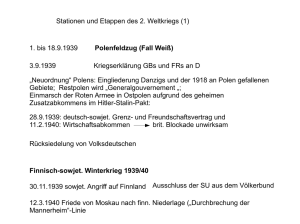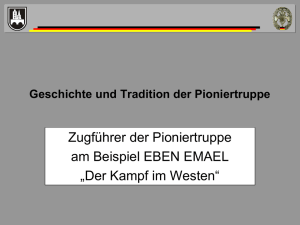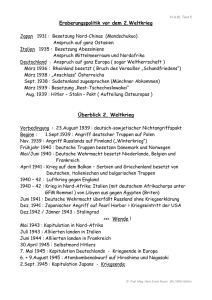Denken auf den Krieg hin Luxemburg im Zweiten Weltkrieg
Werbung

B^a^i~g\ZhX]^X]iZ :EITSCHRIFTFÓRHISTORISCHE"ILDUNG C 21234 ISSN 0940 -ÊÊ 4163 Heft 2/2010 Militärgeschichte im Bild: Deutsche Schützenpanzer des Eurokorps auf Militärparade in Paris, 14. Juli 1994. Denken auf den Krieg hin Luxemburg im Zweiten Weltkrieg Frankreichs »seltsame Niederlage« 1940 Deutsche Kriegsmarine in Frankreich ÌBÀ}iÃV V ÌV iÃÊÀÃV Õ}Ã>Ì Impressum Editorial Militärgeschichte Zeitschrift für historische Bildung Herausgegeben vom Militärgeschichtlichen Forschungsamt durch Oberst Dr. Hans-Hubertus Mack und Oberst i.G. Dr. Winfried Heinemann (V.i.S.d.P.) Produktionsredakteur der aktuellen Ausgabe: Major Klaus Storkmann M.A. Redaktion: Hauptmann Matthias Nicklaus M.A. (mn) Hauptmann Magnus Pahl M.A. (mp) Oberstleutnant Dr. Harald Potempa (hp) Major Klaus Storkmann M.A. (ks) Mag. phil. Michael Thomae (mt) Bildredaktion: Dipl.-Phil. Marina Sandig Lektorat: Dr. Aleksandar-S. Vuletić Layout/Grafik: Maurice Woynoski / Medienwerkstatt D. Lang Anschrift der Redaktion: Redaktion »Militärgeschichte« Militärgeschichtliches Forschungsamt Postfach 60 11 22, 14411 Potsdam E-Mail: MGFARedaktionMilGeschichte@ bundeswehr.org Homepage: www.mgfa.de Manuskripte für die Militärgeschichte werden an obige Anschrift erbeten. Für unverlangt eingesandte Manuskripte wird nicht gehaftet. Durch Annahme eines Manuskriptes erwirkt der Herausgeber auch das Recht zur Veröffentlichung, Übersetzung usw. Die Honorarabrechnung erfolgt jeweils nach Veröffentlichung. Die Redaktion behält sich Kürzun­ gen eingereichter Beiträge vor. Die Wiedergabe in Druckwerken oder Neuen Medien, auch auszugsweise, anderweitige Vervielfältigung sowie Übersetzung sind nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Die Redaktion übernimmt keine Verantwortung für die Inhalte von in dieser Zeitschrift genannten Webseiten und deren Unterseiten. Für das Jahresabonnement gilt aktuell ein Preis von 14,00 Euro inklusive Versandkosten (innerhalb Deutschlands). Die Hefte erscheinen in der Regel jeweils zum Ende eines Quartals. Die Kündigungsfrist beträgt sechs Wochen zum Ende des Bezugszeitraumes. Ihre Bestellung richten Sie bitte an: SKN Druck und Verlag GmbH & Co., Stellmacherstraße 14, 26506 Norden, E-Mail: [email protected] © 2010 für alle Beiträge beim Militärgeschichtlichen Forschungsamt (MGFA) . Druck: SKN Druck und Verlag GmbH & Co., Norden ISSN 0940-4163 Deutsche Soldaten auf den Pariser Champs Elysées, Schützenpanzer mit dem Eisernen Kreuz vor dem Arc de ­Triomphe – seit einigen Jahren marschieren Deutsche in der Parade am französischen Nationalfeiertag mit. Für Franzosen und Deutsche war dies zunächst ein ungewöhnlicher Anblick, rief er doch zwangsläufig Erinnerungen an die Zeit hervor, als die Wehrmacht durch Paris marschierte. Der Jahrestag des deutschen Angriffs fand im Mai diesen Jahres in Frankreich viel Aufmerksamkeit. Im Sommer 1940 kapitulierten die französischen Streitkräfte vor der Wehrmacht. Mit den französischen Kriegserinnerungen befasst sich Stefan Martens. Er hinterfragt die These, dass die Niederlage von 1940 noch heute »Frankreichs Trauma« sei. Mit der Besetzung Frankreichs 1940 beschäftigen sich auch Lars Hellwinkels Forschungen über die deutsche Kriegsmarine an der Kanalküste und Nina Janz´ Blick auf eine historische Quelle zum Waffenstilstand von Compiègne im Juni 1940. Nicht nur Frankreich wurde 1940 von deutschen Truppen erobert, auch die Niederlande, Belgien und Luxemburg wurden besetzt. Doch gerade die Geschichte der Besatzungszeit in Luxemburg fand und findet außerhalb des kleinen Landes wenig Beachtung. Hans-Erich Volkmanns Darstellung will einen Beitrag dazu leisten, dies zu ändern. Er zeichnet die Jahre 1940 bis 1944 in Luxemburg nach. Besondere Beachtung verdient der Beitrag aus der Feder Manfred Messerschmidts. Er untersucht das militaristische Gedankengut in der deutschen Gesellschaft lange vor dem Ersten Weltkrieg: »Denken auf den Krieg hin«. Heute sind Luxemburg, Frankreich und Deutschland durch EU, NATO und Eurokorps auch militärisch eng miteinander verbunden. Deutsche Schützenpanzer während einer Militärparade 1994 in Paris vor dem Arc de Triomphe sind ein starkes Bild für die deutsch-französische Aussöhnung. Für Ihr Interesse an der Militärgeschichte dankt Klaus Storkmann M.A. Major Inhalt Denken auf den Krieg hin 4 Prof. Dr. Manfred Messerschmidt, geboren 1926 in Dortmund, 1970 bis 1988 Leitender Historiker am Militärgeschichtlichen Forschungsamt in Freiburg i.Br. Am Wegrand der Geschichte Luxemburg unter deutscher Besatzung 1940 bis 1944 Frankreichs Trauma bis heute? Das historische Stichwort: Schlacht bei Tannenberg 1410 22 Medien online/digital 24 Lesetipp 26 Quellen deutscher Militärgeschichte 28 Militärgeschichte kompakt 29 Ausstellungen 30 8 Militärgeschichte im Bild Prof. Dr. Hans-Erich Volkmann, geboren 1938 in Montabaur,1994 bis 2003 ­Leiter Abteilung Forschung am Militär­ geschichtlichen Forschungsamt in Potsdam Die »seltsame Niederlage« im Sommer 1940 Service Deutsche Schützenpanzer auf französischer Militärparade 12 An der traditionellen Militärparade zum französischen Nationalfeiertag nahmen am 14. Juli 1994 erstmals deutsche Soldaten des Eurokorps mit Schützenpanzern des Typs Marder teil. Dr. Stefan Martens, geboren 1954 in Sorengo (Schweiz), seit 2002 stellvertretender Direktor des Deutschen Historischen Instituts in Paris Foto: AFP Bertrand Guay/Getty Weitere Mitarbeiter dieser Ausgabe: Die deutsche Kriegsmarine in Frankreich 1940 Dr. Lars Hellwinkel, geboren 1974 in Verden an der Aller, Historiker, Studienrat am Gymnasium Athenaeum, Stade 18 Oberleutnant Boder Erler, Universität der Bundeswehr München; Oberstleutnant i.G. Dr. Martin Hofbauer, MGFA, Potsdam; Nina Janz, Bundesarchiv, Referat MA 5, Freiburg i.Br.; Major d.R. Dr. Agilolf Kesselring, Helsinki Matthias Rawert M.A., Freiburg i.Br.; Christopher Schaefer, Universität Trier, Praktikant am MGFA; Korvettenkapitän Dr. Rüdiger Schiel, MGFA, Potsdam; Leutnant Daniel Uhrig, Offizierschule der Luft­waffe, Fürstenfeldbruck, Praktikant am MGFA; Hauptmann d.R. Rouven Daniel Wauschkies, Studienrat am Vincent-Lübeck-Gymnasium, Stade 31 5Generalmajor Carl von Clausewitz (1780–1831). Lithografie von Franz ­Michaelis nach Karl Wilhelm Wach. 5Der Philosoph Johann Gottlieb Fichte (1765–1814). Gemälde von Heinrich Plähr, Anfang 19. Jahrhundert. Denken auf den Krieg hin S chon vor der Französischen Revolution wandten sich Publizisten in Deutschland gegen die Idee vom Ewigen Frieden. Sie erblickten im »kriegerischen Geist« eine notwendige Stütze des Patriotismus. Dieser vorrevolutionäre »Bellizismus« hielt wiederkehrende Kriege für erforderlich zur Aufrüttelung der trägen Massen. Die revolutionären Ereignisse schienen diese Auffassung zu bestätigen. Übersehen wurde die gänzlich andere Vorstellung in der Frühphase der Revolution, als die Nationalversammlung im Mai 1790 mit einem in den Verfassungstext übernommenen Dekret entschied, dass die französische Nation auf Eroberungskriege verzichte und niemals gegen die Freiheit eines Volkes vorgehen werde. Die innere Dynamik der revolutionären Entwicklung und die Reaktion der europäischen Mächte offenbarten schnell die brüchige Verbindung von Frieden und Freiheit. Die Zeit war nicht reif für die Lösung der Verfassunggebenden (National-)Versammlung (Konstituante). Ihr Scheitern sollte weitreichende Auswirkungen auch auf das bpk/Nationalgalerie SMB/Göken ullstein bild bpk Denken auf den Krieg hin politische Denken in Deutschland im 19. Jahrhundert haben. Der Weg dahin führte zunächst über eine Entscheidung in Paris: Im November 1792 sagte die Konstituante allen Völkern Hilfe zu, die sich von ihrer monarchischen Herrschaft befreien wollten. Damit steuerte sie auf kaum noch kontrollierbare kriegerische Unternehmungen zu, die ideell zwar dem Selbstbestimmungsrecht der zu befreienden Völker dienen sollten, die aber sehr leicht als Vorwand für egoistische Machtentfaltung genutzt werden konnten, wie sie kurz darauf Napoleon I. exzessiv praktizierte. Ermöglicht wurde sein Vorgehen mit den unter den französischen Königen seit Langem aufgebauten Streitkräften und mit neuen national begeisterten Massenaufgeboten, die nahezu unempfindlich gegen Rückschläge machten. Die Befreiungsidee konnte Napoleon zur militärisch tauglichen Offensivstrategie ausformen, wodurch sie in Gefahr stand, zur machtpolitisch nützlichen Ideologie zu degenerieren. Mit ihr sind Kriege zur Sache von Nationen und Gesellschaften gemacht worden. Carl von Clausewitz Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 2/2010 5Der Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Schlegel (1770–1831). Gemälde von Joh. Jacob Schlesinger, 1831. nannte diese Kriege »absolute Kriege«: »man könnte zweifeln, dass unsere Vorstellung von dem ihm [= dem Krieg] absolut zukommenden Wesen einige Realität hätte, wenn wir nicht gerade in unseren Tagen den wirklichen Krieg in dieser absoluten Vollkommenheit hätten auftreten sehen. Nach einer kurzen Einleitung, die die französische Revolution gemacht hat, hat ihn der rücksichtslose Bonaparte bald auf den Punkt gebracht.« Absoluter oder »wahrhaftiger Krieg« Nicht zuletzt liegt in der Instrumentalisierung der Freiheits- oder Befreiungsidee begründet, dass in Deutschland, insbesondere infolge der militärischen Katastrophe Preußens 1806, Bemühungen um die Idee des Friedens oder das bellum iustum, den »gerechten Krieg«, kaum von Belang geblieben sind. Die Nachwirkung Friedrichs des Großen trug zu dieser Entwicklung ebenso bei wie die Haltung der konservativen Eliten. Clausewitz’ Versuch, die Natur des Krieges zu erfassen und zu systematisieren, lieferte nichts zu den großen Themen der naturrechtlichen Völkerrechtswissenschaft. Krieg als Phänomen der Politik, als Gegebenheit an sich, wurde zu seinem Studienobjekt. Er betrachtete den Krieg wie ein Chirurg, der das Problem der Gesundheit der Allgemeinmedizin überlässt. Die Abkoppelung vom Recht zeigt sich, wo Clausewitz von den »positi­ ven Zielen« des Krieges sprach: der Niederwerfung des Gegners oder »nur der Eroberung eines Teiles der feindlichen Länder«. Clausewitz stand die Erfahrung seines Zeitalters vor Augen: das Staat und Gesellschaft wie im Sturm erfassende und umwälzende Ereignis der Französische Revolution, das die ganz Europa umgestaltende Kriegführung Napoleons ermöglichte. Clausewitz zog vor diesem Hintergrund folgendes Resümee: »der Friede ist die Schneedecke des Winters [ ... ], und der Krieg ist die Glut des Sommers [ ... ], die die Kräfte der Erhebung schnell entfaltet und zur Reife treibt.« Wofür? Clausewitz beklagte den Mangel an Nationalsinn in Deutschland. Er selbst sprach vom preußischen und deutschen Patriotismus. Seine Hoffnung richtete sich darauf, dass Deutschland eine Monarchie werde oder sich höchstens in zwei Staaten teile, was mittels Unterjochung der übrigen deutschen Staaten zu bewerkstelligen sei. Kein Krieg der Zukunft, meinte er, werde anders denn als Nationalkrieg angesehen und geführt werden. Um Clausewitz’ Begriff des »absoluten Krieges« wird bis heute kontrovers diskutiert. John Keegan lässt Clausewitz zum »ideologischen Vater des ersten Weltkrieges« werden. Als Verkünder »kriegerischen Geistes« blieb seinem Werk »Vom Kriege« allerdings nahezu jede Wirkung versagt, nicht nur weil es erst 1832/34 erschien. Noch in der Einführung zur 5. Auflage sprach Generaloberst Alfred Graf von Schlieffen 1905 von »einer eher philosophierenden Betrachtungsweise, die den heutigen Leser nicht immer anmutet«. Auch Gerhard von Scharnhorsts Versuch, Preußen gegen Napoleon »kämpferisch« einzustellen, blieb nur geringer Erfolg beschieden. Mit seinem »Vorläufigen Entwurf der Verfassung der Provinzialtruppen« glaubte er, Opferbereitschaft »für die Erhaltung des Staates« erzeugen zu können, »Opferbereitschaft gegen einen Vernichtungskrieg«, die den durch den Krieg erzeug­ ten kriegerischen Geist der stehenden Armee einigermaßen ersetzen könne. Aber das Projekt für einen von Begeisterung getragenen Verteidigungskrieg scheiterte sowohl am Widerstand konservativer Offiziere und des Königs als auch am fehlenden Willen des Bürgertums. Nur knapp zwölf Prozent der Freiwilligen von 1813/14 gehörten den »gebildeten Ständen« an. Höhere Beamte und Professoren wurden ganze 33 Personen gezählt. Den von der Militärpflicht befreiten Gesellschaftsgruppen ist das freiwillige Opferbringen für den Staat nicht leicht gefallen. Der Krieg beförderte ein Umdenken, das bei einigen zum veränderten Denken über den Krieg selbst wurde. Zwischen 1806 und 1813/14 lief dieser Prozess wachsender Einstim­ mung auf einen künftigen Krieg ab. Die Niederlage Napoleons in Russland wirkte dabei nicht unwesentlich mit. Besonders fassbar wird der Ablauf an den Schriften und Reden Johann Gottlieb Fichtes. Wahrhafter Krieg sei der Volkskrieg zur Befreiung des Vaterlandes, der letztlich auf die Einigung der deutschen Länder hinwir­kende Krieg – ein Verteidigungskrieg zwar, aber ein Krieg mit »Anstrengung aller Kräfte, Kampf auf Leben und Tod, keinen Frieden ohne vollständigen Sieg«, stellte Fichte etwa 1813 fest. Der Krieg des Staates Der »Staat« stand nicht im Mittelpunkt von Fichtes politischer Philosophie. Aber bald, in einer sich restaurativ einrichtenden Gesellschaft, sollten Staat und Krieg in eine Beziehung zueinander gesetzt werden, die das einstige philosophische Ideal des freien Weltbürgers nicht zulassen konnte. Der Krieg wurde nun als positive, Staat und Nation befruchtende Kraft gesehen, nicht wie bei den vorrevolutionären Bellizisten primär als Begeisterung weckende Droge. Er erhielt jetzt eine ethische, charakterbildende Qualität zuerkannt und damit eine dem Frieden vorzuziehende nationalpädagogische Bedeutung. In der Idee der Staatsräson des Historikers Leopold von Ranke klingt diese Konsequenz an. Ranke sprach zwar mehr von Machtkämpfen als vom Krieg: Im »Übereinanderherfallen der Staaten« sah er »Kräfte, und zwar geistige, Leben hervorbringende, schöpferische Kräfte, selber Leben, es sind moralische Energien«. Für den Philosophen Georg Wilhelm Friedrich Hegel war »das Volk als Staat« sogar die absolute Macht auf Erden. Den Militärstand bezeichnete Hegel als den »Stand der Allgemeinheit«. Tapferkeit mit dem »Endzweck der Souveränität des Staates« wurde von ihm noch stringenter als in der Definition der Subordination in der preußi­ schen Armee begründet: »Gänzlicher Gehorsam und Abthun des eigenen Mei­nens und Raisonierens, so Abwesenheit des eigenen Geistes und Entschlossenheit – das feindseligste und dabei persönlichste Handeln gegen Individuen, bei vollkommen gleichgültiger, ja guter Gesinnung gegen sie als Individuen.« Die Kriegsartikel verlangten – weniger anspruchsvoll – vom Soldaten, allen Vorgesetzten Achtung und Gehorsam zu erweisen und ihre Befehle genau zu befolgen. Die von Hegel formulierte absolute Verfügbarkeit des Soldaten, die den Vorstellungen der preußischen Reformer – Scharnhorst und August Neidhardt von Gneisenau – vollkommen widersprach, traf sich mit seiner Ansicht vom Kriege, die schon von den Bellizisten des 18. Jahrhunderts vertreten worden war: Krieg sei zur Erhaltung der Gesundheit notwendig, um sie »vor der Fäulnis« zu bewahren. Ein ewiger Friede bewirke »ein Versumpfen der Menschen«. Hegel meinte allerdings, anders als Clausewitz, neuere Kriege würden »menschlich« geführt werden, Feindschaft werde wegen der Pflicht, den Anderen zu achten, zurücktreten. Bemerkenswert ist, dass im Vormärz in der preußischen Armee keine nennenswerten Stimmen zum Krieg und Völkerrecht zu vernehmen waren. Die Revolution und Napoleon hatten einen Schock bewirkt. Monarchie und Revolution wurden als unvereinbare Gegenprinzipien gesehen. Rückkehr zum vorrevolutionären Denken schien gera­ ten. Die wichtigsten Errungenschaften der preußischen Heeresreform wurden beseitigt oder den restaurativen Verhältnissen angepasst, wie durch den Einbau der Landwehr in die Linienarmee und die Reduzierung des als Volksaufgebot geplanten Landsturms zu einer Reserve älterer Gedienter. Die allgemeine Wehrpflicht blieb allerdings als Einrichtung erhalten. Reform­ gegner befürchteten mit Blick auf ­Land­wehr und allgemeine Wehrpflicht denn auch, sie werde Widerstand und Unzufriedenheit organisieren. Tat­ sächlich aber fiel der Soldat ab 1819 wieder in die Rolle des Untertanen zurück. Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 2/2010 bpk ullstein bild/adoc-photos Denken auf den Krieg hin 5Generalfeldmarschall Albrecht Graf von Roon (1803–1879), Aufnahme um 1870. Nationalkrieg ohne Beteiligung des Volkes Erst im Gefolge der Einigungskriege 1866/71, die mit der Linienarmee ohne demokratische Elemente wie den Land­ sturm geführt wurden, änderte sich die Stimmung. Eine sozialdarwinistisch aufgeladene Staats- und Kriegsideologie wurde sichtbar. Noch die Vorgeschichte der Kriege stand unter völlig anderen Erwartungen. Der spätere preußische Kriegsminister Albrecht Theodor Emil Graf von Roon meinte zwar 1854 in der Denkschrift »Etwas Geschriebenes – Unthunlich Gebliebenes«, Preußen sei Deutschlands natürlicher Vorkämpfer, aber für »die politischen Zwecke des Staates« komme es nicht nur auf die materielle Wucht der Armee an, sondern auch auf den »sie nationell und traditionell durchdringenden Geist«. National – das war bei ihm wie bei Generalstabschef Helmuth von Moltke und Prinz Wilhelm von Preußen, dem späteren König und Kaiser, identisch mit dem Aufgehen der liberalen nationalen Bewegung in Preußens Kraft. Aber ein politisches Programm für einen »Nationalkrieg« exis­ tierte nicht. Gedacht wurde an eine Lösung der deutschen Frage ohne Weckung des revolutionären Geistes, der seit dem Olmützer Vertrag von 1850 endgültig zusammen mit der Revolution besiegt schien. Österreich galt der militärischen Führung mehr und mehr als außerdeutsche Macht. Bei Roon 5Generalfeldmarschall Helmuth Graf von Moltke (1800–1891), Aufnahme von 1888. und Moltke zeichnete sich gelegentlich die Vision eines Krieges ab, bei dem es um die Zusammenfassung eines deutschen Staatenkomplexes ging, der Eu­ ro­­pa die Stirn bieten und vielleicht, so Molt­ke, seine magnetische Kraft »bis zu den Deutschen der unerlösten Gebiete« ausstrahlen werde, wie mancher 48er bereits geträumt hatte. Aufgrund solcher Überlegungen dachte Moltke 1859 an einen Präventivkrieg gegen Frankreich zur Erreichung der preußi­schen Hegemonie in Deutschland. Gern hätte er den »Nationalkrieg« nach Westen, »nicht für, aber mit Österreich« geführt. Otto von Bismarck gab der preußi­ schen Politik die nach Königgrätz führende Richtung. Nach dem Sieg über Österreich 1866 schwenkte der nationale Liberalismus auf seine Linie ein. Der preußische Militärstaat war auf dem Weg, die nationalliberalen Hoffnungen zu realisieren. Moltke erkannte die Chancen des eingeschlagenen We­ ges. Während der Luxemburgischen Krise 1867 meinte er, der Anlass sei gut, er habe einen nationalen Charakter, »man benutze ihn also«. In einem deutsch-französischen Krieg erblickte er die wichtigste Voraussetzung für die Entbindung der Energien, die der natio­ nale Kristallisationsprozess erforderte. Im Ergebnis ist wohl festzuhalten, dass dieser »militärische Nationalismus«, begeistert begrüßt und bewundert von der bürgerlichen nationalliberalen Strömung, die »Idee des Krieges« in der deutschen Gesellschaft überwie- Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 2/2010 gend positiv besetzt hat. Seine Resultate widerlegten für diese Gesellschaft die Bestrebungen der demokratischen Kräfte. Der nationale Krieg »ohne Volk« wurde zum Geschenk für das Volk. Wer dies nicht so akzeptierte, geriet in Gefahr, als Staatsfeind betrachtet zu werden. Die Energien allerdings, die er entfesselte, gingen in Richtun­ gen, die seine Planer Bismarck und Moltke nicht wünschen konnten. Immerhin hat Moltke einen Extermina­ tionskrieg (Vernichtungskrieg) gegen Frankreich führen wollen und Bismarck schloss keinen Versöhnungs-, sondern einen Diktatfrieden, der das Selbstgefühl der Franzosen tief verletzte, der aber Frankreich als Großmacht bestehen ließ. Segen der Macht – totaler Krieg Der »Zeitgeist« produzierte nach 1871 radikale Weiterentwicklungen. Nach dem Sieg über Frankreich und der Proklamation des Deutschen Kaiserreiches unter preußischer Führung 1870/71 steuerte der Neuhegelianer Adolf Lasson sozialdarwinistische und völkische Ideen bei. In seinem Buch »Prinzip und Zukunft des Völkerrechts« weissagte er, eine Weltrechtsordnung müsse zur »gemeinsamen Fäulnis und Verwesung« führen, während der Hass der Völker das Mittel zur Sicherung der Heiligtümer des Vaterlandes sei. Der Staat könne »sich niemals einer Rechtsordnung wie überhaupt keinem Willen außer ihm unterwerfen«. Ähnlich argu­ mentierte 1873 der Münchener Staatsrechtler Maximilian Anton Seydel: »Zwischen den Staaten kann mithin kein Recht sein, zwischen ihnen gilt nur Gewalt.« Der einflussreiche nationalkonservative Historiker Heinrich von Treitschke führte die Gerechtigkeit des Krieges auf das Bewusstsein einer sittlichen Notwendigkeit zurück. Er müsse als von Gott gesetzte Ordnung begriffen werden. Treitschke, der 1896 starb, wurde eine Art Vordenker des bürgerli­chen Reichspublikums, das sich sagen ließ, es sei eines Mannes unwürdig, den Gedanken des ewigen Friedens zu denken. Moltke, der noch 1840 angenommen oder doch gehofft hatte, dass der Gang der Weltgeschichte eine Annäherung zum Frieden sei, betrachtete nun den Krieg als Bestandteil der göttlichen bpk/Studio Niermann/Bieber bpk 5Der Historiker Heinrich von Treitschke (1834–1896). Weltordnung. Noch weiter ging General Julius von Hartmann 1878 in seiner Schrift »Militärische Notwendigkeit und Humanität«, deren Tendenz in der für das Offizierkorps bestimmten Ge­ neralstabsstudie »Kriegsbrauch im Landkriege« (1902) wiederzufinden ist. Hart­manns bornierter, kultur- und gesellschaftsindifferenter Standpunkt gip­ felte in dem Satz: »Das militärische Kriegsziel beruht in dem, was der Gewaltact des Krieges selbst und unmittel­ bar zu Wege bringen will.« In besetzten Gebieten forderte dieser »Realismus«, Rechtsgefühl und Patriotismus der Bevölkerung zum Schweigen zu bringen. Einen »richtig angewandten und zweckmäßig geregelten Terrorismus« zählte der General zu den wirksamen Mitteln. Die Generalstabsschrift führte entsprechend aus: »Humanitäre Ansprüche, d.h. Schonung von Menschen und Gütern, können nur insoweit in Frage kommen, als es die Natur und der Zweck des Krieges gestatten.« Dieses Konzept eines totalen Krieges widersprach grundsätzlich den in Genf, Brüssel und in Den Haag erreichten internationalen Vereinbarungen. Die Reichsleitung sah offenbar keinen Grund einzuschreiten. Diesem Denken musste Rücksicht auf neutrale Staaten systemwidrig erscheinen. Der Schlieffenplan wurde zum Anwendungsfall solcher militärischer Weisheit. Er pass­te nicht zu Clausewitz’ Sicht des Krieges. Eine wichtige Stimme war auch der sich auf Treitschke berufende General 5Generaloberst Helmuth von Moltke d.J. (1848–1916). Aufnahme von 1910. Friedrich Adolf Julius von Bernhardi, der in seinem Buch »Deutschland und der nächste Krieg«, das 1913 bereits in 6. Auflage vorlag, ein Kapitel dem Thema »Die Pflicht zum Kriege« widmete. Damit suchte er die Kriegspolitik und den militärischen Aktionsspielraum aus den Fesseln auch der »realistischen« Völkerrechtstradition zu lösen, die ohnehin dem Staat das Recht auf extreme Maßnahmen zwecks Selbsterhaltung zugestand. Bernhardis »Pflicht zum Kriege« forderte indes unabhängig von Bedrohungen solcher Art die Bereitschaft zum Krieg des nationalen Egoismus: gedacht als »Präven­ tivkrieg«, und zwar nicht zur Abwehr eines bevorstehenden Angriffs eines Feindstaates, sondern zwecks Befriedigung von Machtbedürfnissen und Hegemonialbestrebungen. Der Präventivkrieg Bei diesem »Präventivkriegsgedanken« spielte die Überzeugung von der Unvermeidbarkeit des Krieges mit. Dies zeigte sich etwa 1905, als der Generalstab die Schwäche Russlands auszunutzen gedachte. Schlieffen betonte gegenüber dem Reichskanzler »die große Schwächung der russischen Streitkräfte in Europa« und gab damit einer im Generalstab vertretenen Meinung Ausdruck. Wilhelm Groener, 1918 Nachfolger Erich Ludendorffs als Generalquartiermeister, erinnerte sich: Schlieffen habe schon im Mai 1905, als in Großbritannien ein Bündnis mit Frankreich gefordert wurde, den Kaiser und die Regierung zum Krieg gegen Frankreich aufgefordert, um auf diese Weise das Netz zu zerreißen, das sich fest um uns zusammenzog. »Wir waren wohl mehr oder weniger alle mit dem Grafen Schlieffen einer Meinung.« Auf der Lagebesprechung am 8. Dezember 1912 erklärte der Nachfolger Schlieffens, Helmuth von Moltke (d.J.): »Ich halte einen Krieg für unvermeidbar und: je eher, je besser.« Seine Gründe: Die Armee käme in eine immer ungünstigere Lage, »denn die Gegner rüsteten stärker als wir«. Auf dieser Lagebesprechung, von Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg als »Kriegsrat« bezeichnet, waren neben Kaiser und Kanzler die Spitzen von Armee und Marine anwesend. Ob hier der Entschluss zum Krieg gefasst wurde, ist in der Forschung nach wie vor umstritten. Vorherrschend war bei unterschiedlicher Meinung zur Zeitfrage die Auffassung, dass ein baldiger Krieg für Deutschland eher günstig sei. Unabhängig von der Frage des Kriegsziels – Kontinentalhegemonie, Weltpolitikoptionen, Sorge vor Überrüstung durch die Flügelmächte – herrschte die Befürchtung vor, in die Defensive zu geraten, und der Gedanke, Deutschland müsse und könne sich durch einen Präventivkrieg aus dieser Lage befreien. Was so vorbereitet, angedacht bzw. geplant wurde, war jedenfalls völkerrechtlich kein Präventivkrieg. Und mit der am 1. August 1914 erfolgenden Kriegserklärung an Russland wurde er es auch nicht. Dennoch glaubten die Deutschen, sie befänden sich in einem Verteidigungskrieg. Die missbrauchte Metapher vom Präventivkrieg entfaltete ihre Wirkung bis weit in die Zeit der Weimarer Republik hinein, und noch die NS-Propaganda profitierte davon. Der Schatten der Militärstaatstradition lag von Beginn an über der Weimarer Republik. Manfred Messerschmidt Literaturtipp Manfred Messerschmidt, Denken auf den Krieg hin. In: ­Lothar Schröder (Hrsg.), Der 1. September 1939 und der Überfall auf Polen. Erinnerung – Mahnung – Verpflichtung, Schkeuditz 2010 (= Beiträge zur Militärgeschichte und Militärpolitik, 12), S. 55–84. Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 2/2010 Luxemburg unter deutscher Besatzung Am Wegrand der Geschichte Luxemburg unter deutscher Besatzung 1940 bis 1944 SZ-Photo / Rue des Archives S chon im Ersten Weltkrieg hatte das Kaiserliche Deutschland die politische Neutralität des mit ihm in Zollunion verbundenen Großherzogtums Luxemburg durch die militärische Okkupation missachtet. Die deutsche Niederlage 1918 bewahrte Luxemburg vor der Nachkriegsannexion durch seinen großen östlichen Nachbarn. Dafür hatten nicht nur die Alldeutsche Partei im Reich, die die nationale Vereinigung aller deutschen Volksgruppen forderte, sondern vor allem deutsche Großkonzerne der Montanindustrie votiert. Diese bestimmten bis Kriegsende das Wirtschaftsgeschehen in Luxemburg, ehe sie auf französischen Druck ebenso wie deutsche Banken und Versicherungen ihre Unternehmen aufgeben mussten. Mangels des nötigen Eigenkapitals geriet das Luxemburger Wirtschaftsleben nun weitgehend unter französischen und belgischen Einfluss. 1921 ging das Großherzogtum eine Wirtschafts- und Währungsunion mit Belgien ein. Nach der nationalsozialistischen Machtübernahme 1933 witterten die ehemaligen deutschen Eigentümer im Blick auf die Restitution ihrer Unternehmen in Luxemburg Morgenluft. Sogenannte volkstumspolitische Kreise, nicht zuletzt Vertreter der rheinischen Landesgeschichte, gaben aufgrund germanischer Rassengemeinschaft mit den moselfränkischen Luxemburgern und unter Herstellung eines fadenscheini­ gen historischen Beziehungsgeflechtes mit Unterstützung der nationalsozialistischen Volksdeutschen Bewegung im Großherzogtum die Parole »Heim ins Reich« aus. Im Zuge der sich seit der Rheinlandbesetzung 1936 dynamisierenden nationalsozialistischen Expansionspolitik wuchs in Luxemburg die berechtigte Furcht vor einer deutschen Invasion. Durch den raschen militärischen Erfolg in Polen ermutigt, gab Hitler am 9. Oktober 1939 die Anweisung zur Vor- 5Luxemburger Widerstand: Entfernung deutscher Wegweiser. bereitung des Westfeldzuges durch den »luxemburgischen, belgischen und holländischen Raum«. Parallel zu den militärischen Angriffsplanungen liefen bei der Wehrmacht die Vorbereitungen zur Installation von Besatzungsverwaltungen. Anders als in Polen wollte sich die Wehrmacht die ihr völkerrechtlich zufallende Rolle der Okkupationsad- Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 2/2010 ministration nicht durch die Abgabe von Kompetenzen an andere Institutio­ nen, etwa die SS, beschneiden lassen. Hitler trug dem zunächst Rechnung, als er dem Oberbefehlshaber des Heeres, Generaloberst Walther von Brauchitsch, die Besatzungshoheit im Westen übertrug. Als die Wehrmacht am 10. Mai 1940 die Grenzen zu Luxem- Bevölkerung zusätzlich erschwert und das Verhältnis zur Besatzungsmacht weiter belastete hätte. Die rüstungswirtschaftlichen Dienststellen erfassten die in Luxemburg vorhandenen Rohstoffe und kriegswichtigen Güter, trans­ portierten sie aber zugunsten einer Produktion im besetzten Land nur in geringen Mengen ins Reich. All diese Maßnahmen steigerten zwar nicht die Sympathiewerte der Wehrmacht, wohl aber die Bereitschaft der Luxemburger, sich mit ihr zu arrangieren. Das sollte sich abrupt ändern, als Ende Juli 1940 der Gauleiter von Koblenz-Trier, Gustav Simon, der Militäradministration als Chef der Zivilverwaltung (CdZ) zunächst beigegeben wurde. Als am 2. August 1940 ein Führererlass bestimmte: »Der Chef der Zivil­verwaltung untersteht mir unmittelbar und erhält von mir allgemeine Weisungen«, bedeutete dies die Auflösung der Militärverwaltung. Hitlers Auftrag an Simon lautete, »die Herzen der Luxemburger für das Deutschtum« als Voraussetzung zur Eingliederung ihres Landes in das Großdeutsche Reich zu gewinnen. Zur erfolgreichen Erfüllung dieser Aufgabe fehlte es Simon nicht an Handlungsspielraum, denn außer dem mit weitreichenden wirtschaftlichen Vollmachten ausgestatteten »Wirtschaftsdiktator« Hermann Göring konnte dem CdZ keine Oberste Reichsbehörde ins Handwerk pfuschen. Die Bestallung der Gauleiter Robert Wagner für das Elsass sowie Josef Bürckel für Lothringen in ähnlicher Funktion kann als Auftakt für die Eingliederung dieser Territorien in das »Dritte Reich« verstanden werden. Diese blieb zwar offiziell einer Frie- densregelung vorbehalten, was aber einer sukzessiven De-facto-Annexion während des Krieges nicht im Wege stand. Um dieses Ziel zu erreichen, erließ Simon zunächst törichte »Germanisierungsmaßnahmen« unter der Parole: »Luxemburg ist ein deutsches Land«. Sie beruhten auf der irrigen Annahme, man müsse nur einen dünnen kulturellen französischen Firnis entfernen, um darunter ein sich freudig bekennendes Deutschtum freizulegen. Folglich wurde die von der Luxemburger Oberschicht favorisierte französische Sprache nun grundsätzlich verboten. Französische Namen mussten eingedeutscht, entsprechende Aufschriften entfernt werden und selbst das Tragen von Baskenmützen stand unter Strafe. Simon war zutiefst davon überzeugt, durch eine konsequente Beseitigung von französisch-romanischen Einflüssen der Mehrheit der Luxembur­ ger ein Bekenntnis zum Deutschtum und zum Reich abringen zu können. Eine solche »Entwelschungsaktion« war auch der Abriss des Denkmals für die während des Ersten Weltkrieges auf französischer Seite gefallenen Luxemburger, der jedoch zu erheblichen Unmutsäußerungen in der Bevölkerung führte. Die sogenannte Personenbestandsaufnahme vom Herbst 1941, eine Umfrage unter der luxemburgischen Bevölkerung, von der sich der CdZ ein Bekenntnis zum Deutschtum erhoffte, sollte sogar zum politischen Desaster werden. Als erste Stichproben ergaben, dass die Luxemburger die drei politisch brisanten Fragen zu Nationalität, völkischer Zugehörigkeit und Muttersprache weit überwiegend mit »Luxemburgisch« 5Aufmärsche von NS-Formationen in den Straßen der Stadt Luxemburg ... Tony Krier © Photothèque de la Ville de Luxembourg Marcel Duffau © Photothèque de la Ville de Luxembourg burg überschritt, stieß sie nur im industriellen Süden auf schwachen französischen Widerstand, der rasch gebrochen wurde. Die Luxemburger Bevölkerung nahm den deutschen Einmarsch mit stummem Protest zur Kenntnis in der Erwartung, dass die Okkupationsverwaltung nach dem Beispiel des Ersten Weltkrieges sich im Rahmen des Kriegsvölkerrechts bewegen werde, was denn auch im Großen und Ganzen der Fall war. Die Truppe wurde angewiesen, Rücksicht auf die Bevölkerung und deren Eigentum zu nehmen und die Militärverwaltung arbeitete mit den Landesbehörden zusammen. Ansprechpartner war die sogenannte Regierungs- bzw. Landeskommission anstelle der mit der Großherzogin ins Exil gegangenen Luxemburger Regierung. Die Okkupationsmacht suchte so rasch wie möglich die Wirtschaft vor allem durch die Inbetriebnahme der stillgelegten Gruben und Hütten wiederzubeleben. Das fiel besonders schwer, weil rund 100 000 Luxemburger (ein Drittel der Bevölkerung) aus dem industrialisierten Süden in den agrarischen Norden oder nach Frankreich geflohen waren. Sie wurden zunächst mit dem Notwendigsten versorgt und dann sukzessive repatriiert. Der Aufrechterhaltung des Zahlungsverkehrs dienten die neben der weiterhin gültigen Luxemburger und belgischen Währung eingeführten Reichskreditkassenscheine, die einem zugunsten der Besatzungsmacht festgelegten Wechselkurs unterlagen. Sie sollten verhindern, dass Wehrmachteile oder angehörige Waren unbezahlt requirierten, was die Versorgungslage der 5... und vor der Synagoge der Hauptstadt des Großherzogtums, undatierte Aufnahmen. Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 2/2010 Luxemburg unter deutscher Besatzung 10 vention bei seinem »Führer« zu verhindern. Der CdZ vereitelte auch alle Versuche, die ARBED durch die Wiederherstellung ehemaliger deutscher Eigentumsverhältnisse zu zerstückeln. Vielmehr zielte seine Politik darauf ab, Luxemburg dem 1941 in Gau Moselland umbenannten Gau Koblenz-Trier anzugliedern, um seinen agrarstrukturierten Parteisprengel um ein hoch in­ dus­trialisiertes Territorium zu erweitern. Simon war bestrebt, seinen Altgau, der verwaltungsrechtlich zur Preu­ßischen Rheinprovinz zählte, durch Vereinigung mit Luxemburg zu einem adminis­tra­ tiv selbstständigen und wirtschaftlich lebensfähigen Reichsgau umzuwandeln. Da Hitler dieses Ansinnen unterstützte, fanden bezüglich ­ARBED und HADIR wie im gesamtindustriellen Bereich des Großherzogtums keine zwangs­ weisen Eigentumsänderungen statt, sondern es blieb bei der Einsetzung von Treuhändern. Zu Enteignun­gen kam es lediglich im Rahmen der »Arisierung jüdischen Besitzes«, die die Militärverwaltung zuvor strikt abgelehnt hatte. Lediglich an der Existenz­grenze wirtschaftende Luxemburger Bauern erwarben landwirtschaft­liche Parzellen zwangsenteigneter ­Juden. Ansonsten aber ließen sich die Luxemburger durch den billigen Erwerb jüdi­schen Vermögens weder moralisch desavouie­ ren noch politisch kaufen. Nutznießer der »Arisierung« waren daher in der Regel Reichsdeutsche. Mit der Einführung der Reichsmark geriet der Luxemburger Zahlungsverkehr unter deutsche Kontrolle. Die Geld- und Kreditgeschäfte übernahmen zum einen die Deutsche Bank (vormals Banque Générale) und die Dresdner Bank (vormals Banque Internationale à Luxembourg), die einige örtliche Banken schluckten, während die Commerzbank sich mit einer Filiale auf dem Land begnügen musste. Die drei großen deutschen Geld- und Kreditinstitute kamen in Luxemburg nicht so recht zum Zuge, weil Simon der flächendeckenden Einrichtung kommunaler Sparkassen, die sich politisch kontrollieren und in ihrem Finanzgebaren leichter dirigieren ließen und zudem die wirtschaftspolitische Position des CdZ festigten, den Vorzug gab. Deren Gewinne konnte man über erzwungene Reichsanleihen zur Kriegsfinanzierung effizienter abschöpfen als die Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 2/2010 der Banken, von denen die Dividenden der Aktionäre abzuziehen waren. Auch in Luxemburg wurde die Ver­ sor­gung der Bevölkerung durch Ra­ tionierung gewährleistet, wobei diese wegen des dortigen höheren Lebensstandards mit Rücksicht auf die politische Stimmung z.T. großzügiger ausfiel als im Altreich. Trotzdem sank das politische Barometer auf den Gefrierpunkt, als in Anbetracht der desolaten Kriegslage an der Ostfront im September 1942 auf Drängen der Wehrmacht und nach dem Vorbild im Elsass und in Lothringen – entgegen der politischen Einsicht Simons – auch in Luxemburg die allgemeine Wehrpflicht eingeführt wurde. Das löste eine politisch-ökonomische Kettenreaktion aus: Zum einen brach in den Hütten und Gruben ein etwa zweitägiger Streik aus, auf den der CdZ, sein politisches Scheitern vor Augen, nur mit standgerichtlichen Erschießungen und sondergerichtlichen Strafmaßnahmen zu reagieren wusste. Zum anderen konstituierte sich eine Widerstandsbewegung, die neben anderen Obstruktionshandlungen junge Luxemburger, die sich der Wehrpflicht entzogen, versteckte und versorgte. 6Bekanntmachung über vollstreckte Todes­urteile gegen Luxemburger. General Patton Memorial Museum Ettelbruck statt Deutsch beantworteten, verzichtete Simon auf die Veröffentlichung des Auszählungsergebnisses. Parallel zur Germanisierungspolitik verlief die Zerstörung des Luxemburger Staatswesens durch Auflösung der Abgeordnetenkammern, des Staatsrates sowie der Verwaltungskommission. Die preußische Gemeindeverwaltung wurde eingeführt, während gleichzeitig nicht wenige der höheren luxemburgischen Beamten ins Reich versetzt und gegen deutsche ausgetauscht wurden. Die Landräte und der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt stammten aus dem Reich. Hingegen konnten sich Bürgermeister und Amtsbürgermeister weiterhin aus Luxemburgern rekrutieren. Zur politischen Abstützung erfolgte flankierend der Aufbau eines Parteiapparates der NSDAP mit Kreis- und Ortsgruppenleitern. Letztlich erlangte nahezu das gesamte preußisch-deutsche Rechtswesen in leicht modifizierter Form Gültigkeit. Das rassenideologisch- und territorial-machtpolitische Interesse des politischen Regimes traf sich nicht nur mit dem wirtschaftsexpansiven der deutschen Industrie, sondern auch mit dem rüstungsökonomischen der Wehrmacht. Deren Augenmerk galt insbesondere den führenden Hüttenkonzernen ARBED und HADIR, die großteils aus bis 1918 deutschen Unternehmen zusammengefügt worden waren und in etwa die Produktionskraft des europäischen Branchenführers, der Ver­ einig­ten Stahlwerke, besaßen. Wenig verwun­derlich, dass diese luxemburgischen Konzerne die Begehrlichkeiten der deutschen Montanindustrie weckten, die alte Eigentumsrechte für sich reklamierte. Auch die »Reichswerke Hermann Göring«, die sich anstrengten, aus der industriellen Kriegsbeute ein dominantes europäisches Wirtschaftsimperium zu schaffen, zeigten Interesse. Das wirtschaftliche Konkurrenzgerangel offenbarte die Polykratie des NS-Regimes: In Luxemburg paarten sich Reichs- mit Partikularinteressen des CdZ als Gauleiter, konkurrierten staatliche Machtansprüche mit parteipolitischen. Zumeist setzte sich Simon durch. So wusste er einen Zugriff der Reichswerke auf die ARBED, den Hitler zunächst begünstigt hatte, durch eine persönliche Inter- General Patton Memorial Museum Ettelbruck Waren bislang politisch unzuverlässige Beamte und zumeist Intellektuelle samt Familien in Richtung deutscher Osten umgesiedelt worden, so kamen nun die Angehörigen der Wehrdienstflüchtigen in »Sippenhaft« dazu. Hierbei handelte es sich nicht selten um Bauernsöhne, deren Angehörigen die Höfe entzogen und zumeist umgesiedelten Südtirolern und osteuropäischen »Volksdeutschen« übergeben wurden. Letztlich beschwor die Wehrpflicht ein vertracktes politisches und sozioökonomisches Problem herauf – das der ausländischen Zwangsarbeiter. Ohne Fremdarbeiter war die Luxemburger Wirtschaft nie ausgekommen. Während der Besatzung ließ Simon eine vom Reich verfügte »Auskämmaktion« nach Arbeitskräften in allen nicht kriegswichtigen Unternehmen absichtlich scheitern, gerade wegen der politischen Stimmungslage in Luxemburg. Auch den Fraueneinsatz wusste er, ideologiekonform – nach nationalsozialistischer Vorstellung gehörte die deutsche Frau an Herd und Tisch – auf ein Minimum zu reduzieren. Ein Teil der fehlenden Arbeitskräfte wurde durch Verlockung und Zwang vor allem aus Italien, Frankreich und Belgien rekrutiert. Aber letztlich waren die Arbeitsplätze der zum Reichsarbeitsdienst und zur Wehrmacht Eingezogenen ohne »Ostarbeiter« und sowjetische Kriegsgefangene nicht mehr zu besetzen, was der CdZ eigentlich verhindern wollte. Denn deren unzureichende Unterbringung, mangelnde Versorgung und sklavenhalterische Behandlung eigneten sich nicht für einen Werbefeldzug zur freiwilligen Eingliederung der Luxemburger in das »Dritte Reich«. Zudem war ihr Einsatz betriebs­ ökonomisch wenig sinnvoll. In Hütten und Gruben ließen sich ausgemergelte Kriegsgefangene und schlecht ernährte »Ostarbeiter«, zumeist weiblichen Geschlechts, oft mit Kindesanhang, kaum zur Schwerstarbeit einsetzen, die wenigsten mangels Ausbildung auf anderen qualifizierten Arbeitsplätzen. Dennoch leisteten die Luxemburger Industrie wie die Gesamtwirtschaft einen bedeu­tenden kriegsökonomischen Beitrag. Die Befreiung Luxemburgs durch die Amerikaner am 9. September 1944 bedeutete für die Rüstungsstrategen des Reichsministeriums für Bewaffnung 5US-Truppen befreien Ettelbrück, Ende 1944. und Munition in Anbetracht des immer weiter schrumpfenden deutschen Wirtschaftsraumes eine derartige Einbuße an Schwerindustrie und Kriegs­ potenzial, dass sie die Wehrmacht auf möglichst rasche Rückeroberung des verlorengegangenen Territoriums drängten. Sie setzten ihre Hoffnungen auf die Ardennenoffensive Ende 1944, nach deren Scheitern das Schicksal des »Dritten Reiches« auch rüstungsökonomisch besiegelt war. Für Luxemburg hatte das letzte vergebliche militärische Aufbäumen des NS-Regimes verheerende Folgen. Durch die Kampfhandlungen verlor das Großherzogtum etwa ein Drittel des gesamten Wohnraums, 157 Brücken lagen in Schutt. Von den Zerstörungen waren mehr als 38 Prozent der Bevölkerung betroffen. In der überwiegend agrarisch strukturierten nördlichen Hälfte des Großherzogtums galt annähernd die Hälfte der landwirtschaftlichen Nutzfläche als verwüstet. Das dem Land zugefügte menschliche Leid kann hier nicht beschrieben, sondern durch wenige Zahlen nur angedeutet werden. Rund 2 Prozent der luxemburgischen Bevölkerung kamen im Wehrmachteinsatz, in Konzentrationslagern, als Widerständler und im Zusammenhang mit der Ardennenof- fensive ums Leben. Verglichen damit hatte Frankreich 1,5 Prozent seiner Bevölkerung als Opfer zu beklagen und Großbritannien unter einem Prozent. So bedarf es keiner weiteren Erklärung dafür, dass die aus der Besetzung resultierenden tragischen Ereignisse sich tief in das historische Gedächtnis der Luxemburger eingegraben haben und noch heute gegenwärtig sind. Das Großherzogtum hat die materiellen Kriegsschäden weitgehend aus eigener Kraft beseitigt. Die Bundesrepublik Deutschland war lediglich dazu bereit, den Kriegsopfern bzw. deren Angehörigen nach deutschem Recht eine Versorgung zuzugestehen. Statt des ­Blickes zurück im Zorn sahen die Luxemburger Regierungen jedoch von nachhaltigen Reparationsforderungen gegenüber der Bundesrepublik ab. Stattdessen trugen sie zukunftsorientiert dazu bei, den Rechtsnachfolger des kriegsschuldigen Deutschen Reiches, die Bundesrepublik Deutschland, bündnispolitisch zu disziplinieren und mit in die Verantwortung für ein vereinigtes Europa einzubeziehen, um militärische Konflikte zwischen dessen Staaten für die Zukunft auszuschließen. Hans-Erich Volkmann Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 2/2010 11 Die »seltsame Niederlage« im Sommer 1940 Frankreichs Trauma bis heute? 5Sinnbild des französischen Traumas? Wachaufzug der Wehrmacht auf den Champs Elysées, Paris Herbst 1940. A us dem Wald hervorbrechende deutsche Panzer, zerstörte Städte und Flüchtlinge, die am Straßen­ rand verzweifelt Deckung vor Tieffliegern suchen: Mit diesen vom Sirenengeheul der Stukas untermalten Bildern werden die französischen Medien in diesem Jahr wieder an den Westfeldzug und den Zusammenbruch Frankreichs im Sommer 1940 erinnern. Noch einmal wird die Rundfunkansprache, in der Marschall Philippe Pétain am 17. Juni erklärte, dass der Kampf eingestellt werden müsse, zu hören sein – ebenso wie der Appell, mit dem General Charles de Gaulle einen Tag später über die BBC in London zu dessen Fortsetzung aufforderte. Es werden Filmausschnitte der Wochenschau folgen mit Hitler, der beim Erhalt der Siegesnachricht im Führerhauptquartier freudig aufstampft und dann am 22. Juni die französische Delegation zu den Waffenstillstandsverhandlungen im 12 historischen Salonwagen von Marschall Ferdinand Foch in Compiègne empfängt. Und zum Schluss dürfen natürlich jene Bilder nicht fehlen, die ihn vor dem Eiffelturm und bei seiner morgendlichen Rundfahrt durch das menschenleere Paris zeigen. »La débâcle« Die Inszenierung jenes »schrecklichen Jahres«, wie die dramatischen Ereignisse gern umschrieben werden, ist für die Medien Routine geworden. Doch wie ist es tatsächlich um die Erinnerung der Franzosen an ihre »seltsame Niederlage« bestellt? Unter dem Titel »L’étrange défaite« sind posthum die Aufzeichnungen erschienen, mit denen der Historiker und Widerstandskämpfer Marc Bloch noch im Jahr der Niederlage als einer der Ersten das Erlebte zu verstehen versucht hatte. Warum musste Europas führende Militär- Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 2/2010 macht nach nur sechs Wochen kapi­ tulieren? 1,8 Millionen Soldaten gerieten damals in Gefangenschaft, von denen die meisten erst nach dem Ende des Krieges aus Deutschland zurückkehren sollten. Hatte die militärische oder die politische Führung des Landes kläglich versagt? Welche Rolle spielte der Pazifismus, der nach dem Grauen des Ersten Weltkrieges in Frankreich weitverbreitet war? Oder hatten die innen­politischen Gegensätze, die nach der Bildung der ersten Volksfront­Regierung 1936 offen zu Tage traten, die Verteidigungsanstrengungen des Lan­des gelähmt? Wie stand es um den Einfluss der Finanzwelt und der Industrie oder gar der Intellektuellen? Die Forschung hat sich zu vielen dieser Fragen geäußert, doch bis heute gibt es keine verbindliche Antwort, ob, wann und wie Frankreich das Trauma der Nieder­lage von 1940 überwunden hat. BArch 146-1978-052-03 Frankreichs »seltsame Niederlage« »Matratzenautos« beobachtet hatte, verflogen und Panik erfasste nicht nur ihn, als die Deutschen die neue Abwehrfront an der Somme durchbrachen. Am 3. Juni bombardierte die Luftwaffe die Flughäfen Orly, Villacoublay und Le Bourget sowie Teile des 15. und 16. Pariser Arrondissements. Unter den 254 Toten waren 195 Zivilisten. Am 8. Juni wurden die Schulen geschlossen. Verschärft wurde die Lage, als sich das Gerücht verbreitete, die Regierung werde Paris zur offenen Stadt erklären und sich am 10. Juni Richtung Tours absetzen. Der Flüchtlingsstrom verwandelte sich nun endgültig zu einer Flutwelle, die auf ihrem Weg nach Süden alles mit sich riss. Die Szenen, die sich auf den Straßen abspielten, waren unbeschreiblich und das Leid der Menschen unvorstellbar. Die Flüchtlingskarawanen wurden zur Zielscheibe gegnerischer Angriffe, verstopften Straßen und Brücken und behin­ derten dadurch die eigenen Truppen. Deutsche Flugzeuge waren allgegenwärtig, und nach der Kriegserklärung Mussolinis fürchteten viele, dass bald auch italienische Maschinen über ihren Köpfen erscheinen würden. Die eigenen Soldaten waren nicht in der Lage, die Menschen, darunter viele Frauen und Kinder, vor Angriffen zu schützen. Als der Strom die Loire erreichte, mussten die Flüchtenden zu ihrem Entsetzen erkennen, dass auch die zivilen Behörden, von der Präfektur bis hin zu Gendarmerie und Feuerwehr, mit der Situation völlig überfordert waren. Noch schlimmer war für sie die Erkenntnis, dass viele der Beamten längst geflohen waren. Im allgemeinen Chaos achtete kaum einer noch auf die Nachrichten, die von der Regierung zunächst aus Tours und dann aus Bordeaux kamen. Ministerpräsident Paul Reynaud, der seinen Rivalen Édouard Daladier als Kriegsminister am 5. Juni 1940 entlassen hatte, suchte verzweifelt nach Verbündeten. Aus unterschiedlichen Gründen waren jedoch weder Großbritannien noch die USA bereit, den Untergang Frankreichs abzuwenden. Die Hoffnung Reynauds, das Vertrauen der Bevölkerung zurückzugewinnen, indem er den 84-jährigen Marschall und »Helden von Verdun«, Philippe Pétain, in seine Regierung aufnahm, erfüllte sich nicht. Denn schon nach wenigen Tagen machte Pétain deutlich, dass er die Niederlage für unvermeidlich erachtete und den ullstein bild – Roger Viollet Im Gegensatz zu früheren Annahmen wissen wir heute dank der Arbeiten von Karl-Heinz Frieser, dass die französische Armee nach Zahl und Qualität ihrer Waffen der Wehrmacht bei Beginn des Krieges mindestens ebenbürtig war. Die Niederlage war das Ergebnis einer völlig verfehlten Strategie und großer Defizite auf der Führungsebene. Auf die Nachricht vom Angriff hin ließ General Maurice Gamelin am 10. Mai 1940 seine Truppen nach Belgien einmarschieren. Der Oberbefehlshaber erwartete, dass sich der deutsche Vormarsch am Schema von 1914 orientieren würde, und hatte sich deshalb mit General Lord Gort, dem Chef der British Expeditionary Force, darauf verständigt, die besten und schnellsten alliierten Verbände bis an den Fluss Dyle vorrücken zu lassen. Dort, weit vor der französischen Gren­ze, sollten sie die Wehrmacht stoppen. Als drei Tage später in ihrem Rücken die Pan­ zerarmee des Generals Heinz Gude­rian bei Sedan die Maas überquerte, waren ihm die Hände gebunden: eine Umkehr des eigenen Vormarsches, um den Vorstoß der deutschen Verbände zum Kanal zu stoppen, war ausgeschlos­sen und Reserven standen nicht zur Verfügung. So wie Hitler mit seiner Entscheidung für den Sichelschnitt-Plan des Generals Erich von Manstein hatte auch Gamelin alles auf eine Karte gesetzt. Zwar gelang die Evakuierung der eingeschlossenen über 300 000 britischen und französischen Soldaten aus Dünkirchen über See nach England, doch für die weitere Kriegführung standen Frankreich so seine schlagkräftigsten Verbände nun nicht mehr zur Verfügung. Die Flüchtlingsbewegung, die schon beim deutschen Einmarsch in Belgien eingesetzt hatte, schwoll dramatisch an. Nach den Erfahrungen im Ersten Weltkrieg hatte Frankreich in den nördlichen Departements die Errichtung von Auffanglagern vorbereitet, doch statt der erwarte­ ten 800 000 kamen 2 Millionen Flücht­ lin­ge, die nach der Kapitulation des belgischen Königs Leopold III. am 28. Mai und dem Ende der Kämpfe in Dünkirchen am 4. Juni unaufhörlich weiter Richtung Süden drängten. Neugier und Bedauern, mit denen der 1933 aus Deutschland emigrierte Schriftsteller Alfred Döblin in Paris anfangs noch die ersten hochbeladenen 5Zwei, die für die Niederlage verantwortlich gemacht wurden: Édouard Daladier (1884–1970, Ministerpräsident 1938 bis 1940) und Generalstabschef Maurice ­Gustave Gamelin (1872–1958, im Bild links hinter Daladier), hier während eines ­Besuches im Elsass, undatierte Aufnahme. Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 2/2010 13 ullstein bild Frankreichs »seltsame Niederlage« 5Franzosen auf der Flucht vor den Deutschen, Aufnahme vom Juni 1940. des Landes wurden besetzt. Am 10. Juli versammelten sich die französischen Abgeordneten in Vichy, übertrugen Pétain die vollziehende Gewalt und beauftragten ihn mit der Ausarbeitung einer neuen Verfassung. Nach knapp 70 Jahren war die Dritte Republik Geschichte. Schuldzuweisungen Die Katastrophe von 1940 geriet nach dem Krieg rasch in Vergessenheit. Man erinnerte sich lieber an den Freudentaumel bei der Befreiung 1944 und den SZ-Photo/Scherl Kampf um keinen Preis von Nordafrika aus fortsetzen würde. Am 16. Juni resignierte Reynaud und trat zurück. Pétain wurde sein Nachfolger und erklärte sich am 17. Juni zur Aufnahme von Waffenstillstandsverhandlungen mit Deutschland bereit. Der Aufruf des im Vergleich zum greisen Marschall in Frankreich praktisch unbekannten und »jungen«, 49-jährigen Generals Charles de Gaulle verhallte im allgemeinen Chaos zunächst weitgehend ungehört. Am 22. und 24. Juni unterzeichnete Frankreich mit Deutschland und Italien einen Waffenstillstand. Weite Teile 3Unter deutscher Besatzung: Deutsche Soldaten vor dem Tor des mit dem Hakenkreuz beflaggten französischen Innenministeriums in Paris. Auf einem Hinweisschild am Tor steht »Sonderkommando RF-SS Paris«, ­Aufnahme nach 1942. 14 Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 2/2010 heldenhaften Widerstand der Résistance. Neben der allgemeinen Tendenz des Menschen, Unangenehmes im Zweifel zu verdrängen, hatte eine Reihe, zum Teil sehr unterschiedlicher Faktoren diese Entwicklung begünstigt. Zwar war das Vichy-Regime mit dem Versuch kläglich gescheitert, durch den Prozess von Riom 1942 den führenden Vertretern der Dritten Republik und der Volksfront die alleinige Schuld an der Katastrophe zuzuweisen. Die unter dem Schlagwort »AntiFrance« verfolgte Politik der systematischen Ausgrenzung und Verfolgung von Kommunisten, Freimaurern und Juden hatte jedoch das Bewusstsein der Franzosen geprägt. Nach dem Krieg hatten dann die beiden sich unversöhnlich gegenüberstehenden politischen Lager – Kommunisten und Gaullisten – mit ihrer unterschiedlichen Sicht auf die Vergangenheit jeden Versuch einer kritischen Aufarbeitung blockiert. Die Erinnerung an eine innenpolitisch tief gespaltene, militärisch vernichtend geschlagene, am Boden liegende Grande Nation passte in kein politisches Bild. Erst Ende der 1970er Jahre haben sich französische Historiker detailliert mit der Vorgeschichte und dem Beginn des Zweiten Weltkriegs befasst. 1978 lockerte Frankreich seine Archivbestimmungen. In Paris entstand mit dem Institut d’histoire du temps présent (IHTP) erstmals ein auf die Zeitgeschichte spezialisiertes Institut. Lag bis dahin das Hauptaugenmerk auf der Résistance, wandte man sich nun vordringlich der Geschichte des Vichy-Regimes zu. Die Affären um Klaus Barbie, den »Schlächter von Lyon«, René Bousquet, den ehemaligen Polizeiminis­ ter, oder Maurice Papon, der als Unterpräfekt die Deportation der Juden in Bordeaux organisiert hatte, fanden in der Öffentlichkeit große Beachtung. Zum 60. Jahrestag im Jahr 2000 wurden in Paris auf einer internationalen Tagung Strategie und Verlauf der militärischen Operationen von 1940 diskutiert. Angesichts von nach neuesten Berechnungen knapp 60 000 Gefallenen und über 120 000 Verwundeten zwischen dem 10. Mai und dem 22. Juni brauchte die vielgescholtene Armee des Jahres 1940 den Vergleich mit der des Ersten Weltkrieges nicht zu scheuen. Was die Entschlossenheit und mee und vor allem ihrer Luftwaffe im Stich gelassen fühlte, wandte sie sich auf der Suche nach Hilfe an die neuen Herren im Lande – die Regierung in Vichy aber durchaus auch an den deutschen Besatzer. In den ersten Wochen versuchten sowohl Pétain, der »Chef de l’État fran- 5Unter deutscher Besatzung: Deutsche Offiziere in einem Pariser Straßencafe 1940. SZ- Photo / Rue des Archives Henri Philippe Pétain (1856–1951). Marechal de France und Chef de l‘État français. 1877 trat Pétain in die École spéciale militaire de Saint-Cyr ein. Er nahm am Ersten Weltkrieg teil und wurde zum General ernannt, 1916/17 verteidigte er Verdun und wurde so zum »Helden von Verdun«. 1917 folgte seine Ernennung zum Oberbefehlshaber des französischen Heeres, 1918 zum Marschall von Frankreich, 1929 zum Mitglied der Académie Française, 1931 zum Inspektor für die Luftverteidigung, 1934 zum Kriegsminister, und im März 1939 zum Bot-schafter in Spanien. Am 16. Juni 1940, angesichts des Zusammenbruchs, wurde er zum Ministerpräsidenten berufen. Seit dem 10. Juli 1940 war er Chef de l‘État français (Staatsschef der Vichy-Regierung). 1944/45 wurde er unter deutscher Bewachung nach Sigmaringen ver-bracht. Er stellte sich im April 1945 den französischen Behörden und wurde im August 1945 vom Obersten Gericht in Paris zum Tode verurteilt, daraufhin von Regierungschef Charles de Gaulle zu lebenslänglicher Festungshaft auf der Île d‘Yeu begnadigt, wo er auch starb. SZ-Photo/Scherl die Moral der Bevölkerung vor und während des Zusammenbruchs betraf, wurde die angebliche Sabotage der eigenen Rüstungsindustrie durch kommunistische Arbeiter ebenso als Legende entlarvt wie die Existenz einer »fünften Kolonne«. Das Urteil über die 1940 regierende politische und zivile Führungselite des Landes hingegen fiel sehr viel kritischer aus. Von Ausnahmen wie dem Präfekten Jean Moulin abgesehen, der 1943 als Führer des inneren Widerstandes von Klaus Barbie verhaftet und ermordet wurde, erfüllten die Behörden weder die in sie gesetzten Erwartungen noch die ihnen obliegenden Aufgaben. In der Ausnahmesituation des Krieges hatte dieses doppelte Versagen verheerende Folgen. Es waren zwar nur zwei von vielen, aber doch die entscheidenden Ursachen, warum Frankreich im Sommer 1940 in einen tiefen und anhaltenden Schockzustand (traumatisme) verfiel. Die Soldaten der Armee von 1940, die große Opfer gebracht hatten und deren eigentliche Leidenszeit mit Kriegsgefangenschaft und Zwangsarbeit in Deutschland für über eine Million von ihnen erst noch beginnen sollte, las­te­ ten neben der politischen Führung einen Teil der Niederlage der eigenen Zivilbevölkerung an. Diese wiederum hatte sich zunächst hinter der MaginotLinie in Sicherheit geglaubt. Als sie sich dann von den Behörden, der Ar- 5»Seid ihr französischer als er?« Französisches Propagandaplakat mit Marschall Pétain. çais«, als auch der Deutsche Militärbefehlshaber in Paris, die Verzweiflung der Bevölkerung für ihre Ziele zu nutzen. Beide Seiten wollten möglichst rasch wieder zu geordneten Verhältnissen zurückkehren. Die Ernüchterung war groß, wenn die Flüchtlinge bei ihrer Rückkehr erkennen mussten, dass sich die Deutschen bereits in ihrer Stadt häuslich eingerichtet hatten und nichts mehr wie früher war und sein würde. Dabei mussten sie sich sogar noch glücklich schätzen, denn trotz aller Anstrengungen waren noch im März 1941 mehr als eine Million Franzo­ sen nicht nach Hause zurückkehrt. Die wachsende Unzufriedenheit und die Erkenntnis, dass die Regierung in Vichy die Repatriierung der Flüchtlinge offen­ kundig nicht gegen den Willen des Besatzers durchzusetzen vermochte, war eine der Quellen, aus denen der französische Widerstand seine Mitglieder rekrutierte. 1940 rief die Einrich­tung der Flüchtlingslager die ersten Hilfsorganisationen auf den Plan. Sie wuchsen rasch zu einem Netzwerk zusammen, aus dem sich später eines der wichtigsten Hilfsinstrumente bei der Hilfe für verfolgte Juden und insbesondere deren Kinder entwickeln sollte. Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 2/2010 15 Wann hat sich Frankreich vom Schock der Niederlage erholt und wie schnell hat es die Wende zur Résistance vollzogen, oder hatte es mit den Nachwirkungen des Traumas länger zu kämpfen? Denkt man an die Debatten um den Roman »Suite française« der 1903 in der Ukraine geborenen Schriftstellerin Irène Némirovsky, dann spricht vieles für die zweite Vermutung. Némi­ rovsky hatte 1940 den Einmarsch der Deutschen nach Frankreich aus nächs­ ter Nähe erlebt. In der Zwischenkriegszeit noch von der Pariser Gesellschaft begeistert gefeiert, stand sie nun als Ausländerin und Jüdin plötzlich allein. Schonungslos hielt Némirovsky der französischen Gesellschaft des Sommers 1940 den Spiegel vor. Auch der zweite Teil des Romans, in dem sie den täglichen Umgang der Besetzten mit dem Besatzer in einem fiktiven Dorf schilderte, stand im krassem Widerspruch zum Bild der von Anfang an zum Widerstand entschlossenen Franzosen. Der kritische Blick auf die menschlichen Abgründe, die sich während des »Exode« überall in Frankreich auftaten, war nicht neu. In der Beschreibung seiner »Schicksalsreise« hatte zuvor auch schon Alfred Döblin ausführlich seine Erlebnisse auf den verschiedenen Stationen seiner Flucht aus Paris in Richtung Süden beschrieben. Während Döblin auf seiner weiteren Flucht über Lissabon in die USA emigrierte und so den Krieg überlebte, wurde Irène Némirovsky 1942 deportiert und in Auschwitz ermordet – im selben Jahr, in dem Jean Marcel Bruller, genannt Vercors, sein Theaterstück im Untergrund veröffentlichte, mit dem er den Widerstandsgeist dokumentierte. Durch einen Zufall wurde Némirovskys unvollendet gebliebenes Manuskript 60 Jahre später entdeckt und 2004 veröffentlicht. Der Roman elektrisierte die französische Öffentlichkeit, weil die Autorin mit »geradezu brutalem Spürsinn«, so damals die Kritik, darin »das Tableau eines egozentrischen, feigen, deprimierenden, gelegentlich unfreiwillig komischen Frankreich angesichts von Flucht, Kollaboration und Okkupation« aufdeckte. Hatte Frankreich daher nicht allen Grund, im Jahr 2004 seinem deutschen Nachbarn in Caen noch einmal symbolisch die Hand zur Versöhnung zu reichen? 16 ullstein bild Frankreichs »seltsame Niederlage« 5Ein Händedruck symbolisiert die Kollaboration: Der französische Staatschef Marschall Pétain begrüßt Adolf Hitler auf der Bahnstation von Montoire, 24. Oktober 1940 (in der Mitte: Reichsaußenminister Joachim von Ribbentrop). Kurz zuvor hatte auf Einladung von Präsident Jacques Chirac am 6. Juni zum ersten Mal ein deutscher Bundeskanzler an den Feierlichkeiten aus Anlass der alliierten Landung in der Normandie teilgenommen. »Das schreckliche Jahr« Die Folgen des 1940 erlittenen Traumas werden offenkundig immer noch unterschätzt, weil sich die französische Forschung in erster Linie auf das Vichy-Regime und die Besatzungszeit fokussiert. Wie steht es um den »traumatisme« und die Erinnerung an das »schreckliche Jahr« im Jahr 2010, siebzig Jahre nach den Ereignissen? Auf der Suche nach Erklärungen gibt es nach wie vor Unbelehrbare, die von einem Komplott sprechen, wobei als Rädelsführer jene genannt werden, die später zu den führenden Vertretern des Vichy-Regimes zählten. Selten geworden sind diejenigen, die in der Tradi- Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 2/2010 tion der kommunistischen Partei die Schuld bei der französischen Wirtschafts- und Finanzelite suchen. Doch ebenso wenig, wie es Beweise für eine organisierte Rüstungssabotage durch kommunistische Arbeiter gibt, war Frank­reich 1940 Opfer eines politischen Komplotts oder gar einer »Verschwörung des Großkapitals«. Seit jüngstem wird auch in Frankreich das Argument vertreten, dass schon 1920 mit der erzwungenen Unterzeichnung der Pariser Friedensverträge von 1919 der Keim für die spätere Katastrophe gelegt wurde. Das Bild, das von der neuen Friedensordnung und dem Völkerbund gezeichnet wird, ist vernichtend und kaum weniger düs­ ter als die Beschreibung vom gescheiterten Zusammenspiel zwischen den führenden europäischen Mächten nach dem Machtantritt Hitlers. Inkompetenz und Verkennung der Interessen des eigenen Landes ebenso wie der des Gegners, gepaart mit Entschluss- und Nach dem Waffenstillstand übertrugen die Abgeordneten und Senatoren am 10. Juli 1940 Ministerpräsident Philippe Pétain die vollziehende Gewalt und beauftragten ihn mit der Ausarbeitung einer neuen Verfassung. Vichy, ein kleiner Kurort im unbe­setzten südlichen Frankreich, wurde neuer Regierungssitz. Die USA und andere Staaten erkannten die Vichy-Regierung an. Sie kontrollierte außer den südlichen Landesteilen zunächst auch alle französischen Kolonien, verlor aber in Afrika und Nahost nach und nach ihre Macht an die »Freien Franzosen«. Pétains Stellvertreter Pierre Laval trat entschieden für eine Zusammenarbeit mit Deutsch­ land ein, wurde aber von Pétain im Dezember 1940 entlassen. Als neuer Regierungschef versuchte Admiral François Darlan vergeblich, von Deutschland Zugeständnisse für französische Waren- und Rüstungslieferungen zu erhalten. 1942 kehrte ­Laval ins Amt zurück. Er forcierte mit der Einführung der Arbeitsdienstpflicht die Kollaboration mit Deutschland und bekämpfte nach dem deutschen Einmarsch in den unbesetzten Teil Frankreichs im November 1942 mit der 1943 gegründeten Miliz aktiv die Résistance. Kurz vor der Befreiung verließ die Vichy-Regierung im Juli 1944 das Land und nahm bis Kriegsende ihren Sitz in Sigmaringen. Tatenlosigkeit der führenden politischen Akteure, konnten unter diesen Umständen nur in einer vernichtenden Niederlage enden. Doch reicht die Behauptung tatsächlich aus, dass Frankreich angesichts des globalen Versagens im Grunde nie eine Chance hatte, um das Ausmaß der Katastrophe von 1940 zu erklären? Sehr viel gebräuchlicher dagegen ist es nach wie vor zu sagen, dass die bereits im Verfall befindliche Dritte Repu­ blik im Sommer 1940 Schiffbruch erlitt und nicht Opfer einer Selbstversenkung war, weil sie verbraucht und ausgelaugt mit ihren Möglichkeiten am Ende war. In den entscheidenden Stunden herrschte auf der »Brücke des Staatsschiffs« Streit und es fehlte ein erfahrener Lotse, der es aus den Untiefen wieder hätte herausmanövrieren können. Kurzfristig kam dies zwar den Machenschaften der »Totengräber« (Fossoyeurs) entgegen, langfristig aber standen in der Stunde des Untergangs mit Charles de Gaulle und Jean Monnet bereits Männer für den späteren Neuanfang und Wiederaufstieg Frankreichs bereit. Sollte man nicht eher des 11. November 1940 gedenken? Im Herbst 1940 hatte der Deutsche Militärbefehlshaber in Frankreich angeordnet, dass die an diesem Tag bis dahin überall im Land organisierten Feiern aus Anlass des Endes des Ersten Weltkrieges zu unterbleiben hätten. Die Pariser Studenten wollten sich dem nicht fügen und riefen zu einer feierlichen Kranzniederlegung am Grabmal des Unbekannten Soldaten unter dem Arc de Triomphe auf. Auf den Champs-Élysées kam es daraufhin zu zahlreichen Zwischenfällen. Die Zahl der Demonstranten wird auf bis zu 2500 Studenten und Oberschüler geschätzt, von denen 1041 verhaftet wurden – meist von der französischen Polizei. Die Anführer wurden vor Gericht gestellt und die Deutschen ließen die Sorbonne schließen. Über die Wirkung der Niederlegung des Gebin­des in Form eines LothringerKreuzes und des Singens der Marseillaise auf die Passanten ist wenig bekannt. Liegt hier vielleicht der Grund, warum das Ereignis trotz des Votums des Generals in Frankreich bald in Vergessenheit geraten war? In der Rückschau wird die Demon­ stration heute als der Beginn des akti­ ven Widerstandes in Frankreich gesehen. Für viele der Studenten begann am 11. November 1940 der Weg, der sie im weiteren Verlauf des Krieges in die Résistance oder an die Seite de Gaulles in London führte. Eine Inschrift unter dem Arc de Triomphe erinnert heute an beide – am selben Ort, an dem Angela Merkel und Nicolas Sarkozy im Jahr 2009 die deutsch-französische Verständigung symbolisch bekräftigt haben. Allen diesen Erklärungsversuchen ist eins gemein: Auch 70 Jahre nach dem »débacle« bzw. der »seltsamen Niederlage« liefern sie nur Teilantworten auf die eingangs gestellten Fragen nach dem wann und wie. Es bleibt die Frage: Sind in der französischen Gesellschaft die Auswirkungen des 1940 erlittenen Traumas im Grunde bisweilen selbst heute noch spürbar? Wie steht es um die Folgen der damaligen verzweifel­ ten Suche der Menschen nach Halt und Orientierung in Gestalt eines entschlossenen Anführers und den Zweifeln am Führungsgeschick der eigenen politi­ schen und militärischen Eliten? Wie wirkte sich der Vertrauensverlust in die Kompetenz und Ordnungsmacht des Staates und seiner Behörden aus? Der Krieg zwang die Menschen dazu, den Alltag selbst zu organisieren und so das tägliche Überleben zu sichern. Die Franzosen besannen sich ihrer eigenen Fähigkeiten und das »Système D« (von se débroullier = sich zu behelfen wissen) wurde zum geflügelten Wort für dieses Improvisationstalent, von dem sie sich bis weit in die Nachkriegszeit leiten ließen. Stefan Martens szPhoto / dpa Die Vichy-Regierung 5Sinnbild der Aussöhnung: Der französische Staatspräsident François Mitterrand und Bundeskanzler Helmut Kohl gedachten am 22. September 1984 in Verdun der Gefallenen der beiden Weltkriege. Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 2/2010 17 Die deutsche Kriegsmarine in Frankreich Die deutsche Kriegsmarine in Frankreich 1940 M BArch 101II-MW-1079-18 it der deutschen Besatzungs­ zeit in Frankreich eng verbunden ist das Schicksal der französischen Atlantikhäfen als Stützpunkte der deutschen Kriegsmarine. Für die deutsche Marineführung bedeu­ tete die Einnahme der französischen Küsten im Sommer 1940 die unerwartete Realisierung eines schon in der Kai­ serzeit gehegten Wunsches nach einer verbesserten Ausgangsposition für die deutsche Seekriegführung. Plötzlich war die Möglichkeit gegeben, aus der »Enge der Deutschen Bucht« auszubrechen und im offenen Atlantik die Entscheidung gegen den maritimen Haupt­ gegner Großbritannien zu suchen. Innerhalb eines nur sehr kurzen Zeitraums schaffte es die Kriegsmarine, ein funktionierendes Werftensystem, verteilt auf fünf französische Hafenstädte mit unterschiedlichsten Voraussetzungen, aufzubauen. Die Präsenz der deutschen Kriegsmarine hat diese Hafenstädte nicht nur bis heute geprägt, sie war auch ein wichtiger strategischer Faktor in der Führung des deutschen U-Boot-Krieges im Nordatlantik, und spätestens seit der Verfilmung des autobiografischen Romans »Das Boot« des ehemaligen Marine-Kriegsberichterstatters Lothar-Günther Buchheim sind die Atlantikstützpunkte ein Inbegriff für die deutsche Seekriegführung von Frankreichs Küsten aus. Die Kriegsmarine und der ­Westfeldzug 5Französischer Marinesoldat mit Matrosen der deutschen Kriegsmarine, undatiert. Als die deutsche Wehrmacht am 10. Mai 1940 Frankreich angriff, erfolgte die Offensive des Heeres für die Kriegs­ marine völlig unerwartet. Die an der Nordseeküste vorhandenen Einheiten, vor allem Minensuch- und Vorpostenverbände, hatten keinerlei Weisungen erhalten und der damalige Führer der Minensuchboote West, Kapitän zur See und Kommodore Friedrich Ruge, erfuhr von der neuen Lage erst aus den morgendlichen Rundfunknachrichten. In den strategischen Überlegungen der deutschen Seekriegsleitung spielte zu diesem Zeitpunkt das gerade erst besetzte Norwegen eine sehr viel wichtigere Rolle als die französische Küste. Zudem hatte der Generalstabschef des Heeres der Marineführung noch im Oktober 1939 versichert, dass eine Er­ oberung französischer Häfen am Atlantik durch eine Landoffensive mehr als fraglich sei. Im Oberkommando der Kriegsmarine waren also alle Augen nach Norden gerichtet. Während die Seekriegsleitung Pläne für den Ausbau 18 Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 2/2010 des neuen Flottenstützpunktes Trondheim schmiedete und den größten Teil der deutschen Flotte nach Norwegen befahl, überschlugen sich im Westen die Ereignisse. Bereits am 21. Mai 1940 standen die ersten deutschen Truppen an der französischen Kanalküste. Der Kriegsmarine standen für die Kriegführung im Westen anfangs lediglich drei U-Boote zur Verfügung, die im Ärmelkanal operierten. Im Verlauf des deutschen Vormarsches wurden auch noch Schnellboote in den Ka- Die Besetzung der französischen Häfen Die französische Marine hatte sich bis zu Beginn des deutschen Angriffs auf Frankreich auf den Schutz der Geleitzüge zwischen der Biskaya und Nord­ afrika konzentriert. Zwar beteiligten sich französische Seestreitkräfte mit ihren Bordgeschützen an den Kämpfen um die Häfen Boulogne, Calais und Dünkirchen, ihr Einsatz vor der Küste konnte die deutschen Panzerverbände aber nicht aufhalten. Am 14. Juni 1940 wurde Paris kampflos besetzt. An der Küste stieß General Rommel mit der 7. Panzerdivision am selben Tag 240 Kilometer tief nach Westen in Richtung auf den französischen Marinehafen Cherbourg vor. Während die neue französische Regierung unter Marschall Philippe Pétain das Deutsche Reich um einen Waffenstillstand ersuchte, begann die französische Marine mit der Evakuierung ihrer Stützpunkte im Mutterland. Auf Befehl der französischen Admiralität steuerten die größeren Einheiten Nord­afrika an. Die Masse der leichten Seestreitkräfte und Hafenbetriebsfahrzeuge flüchtete sich dagegen in die Häfen entlang der britischen Kanalküste, wo sie bis Kriegsende verbleiben sollte. Auf deutscher Seite stand man diesen Evakuierungsmaßnahmen relativ hilflos gegenüber. Neben dem Werfen von Seeminen durch die Luftwaffe und dem erfolglosen Versuch der Kriegsmarine, die französischen Schiffe durch einen gefälschten Funkspruch ihres Oberbefehlshabers, Admiral François Darlan, zur Umkehr zu bewegen, standen keine weiteren Mittel zur Verfügung. In den Marinehäfen von Brest und Lorient wurden die Schiffe, die nicht mehr seeklar gemacht werden konnten, versenkt und die Docktore und Hafenkräne gesprengt. Über den beiden Städten lagen die Rauchschwaden der angezündeten Treibstoffvorräte. In den Werkstätten der Arsenale machten die Arbeiter die Maschinen unbrauchbar und in den Öfen brannten die Unterlagen der französischen Schiffbauleitungen und die Akten der Marinepräfekturen. Kein Tropfen Öl und keine einzige technische Zeichnung sollte dem deutschen Gegner in die Hände fallen. Als der französische Marinepräfekt von Brest schließlich am 19. Juni 1940 kapitulierte, waren der Hafen verwaist und die Kaiflächen und Trockendocks durch versenkte Schiffe blockiert. Zwei Tage nach dem Einmarsch der deutschen Truppen in Brest erreichte der als Befehlshaber vorgesehene deutsche Vizeadmiral Lothar von Arnauld de la Perière, der erfolgreichste U-BootKommandant im Ersten Weltkrieg und der Seekriegsgeschichte insgesamt, die wichtige Hafenstadt. Diese Tatsache zeigt noch einmal, wie sehr die Vor­ gän­ge im Westen die Kriegsmarine überraschten und wie die ersten Maß­ nah­men durch Hast und Improvisation geprägt waren. Das Hauptaugenmerk des neuen Befehlshabers galt vor allem der schnellen Nutzbarmachung des Hafens. Dabei mangelte es der Kriegsmarine vor allem an für den Hafenbetrieb notwendigen Fahrzeugen. So stand der Kriegsmarine noch im Juli 1940, als vor Brest die Besatzung eines auf See niedergegangenen deutschen Flugzeugs gerettet werden sollte, nur ein einziges hochseetaugliches Fahrzeug zur Verfügung. Alle für den Hafenbetrieb wichtigen Fahrzeuge, vom Leichter, einem Wasser-Transportfahrzeug ohne eigenen Antrieb, über Schlep­ per bis hin zum Schwimmkran, mussten entweder zeitaufwendig geborgen oder aus Deutschland an die Atlantikküste gebracht werden. Auch Minensuchstreitkräfte waren nur unzureichend vorhanden. Trotz der mangelhaften Voraussetzungen entschied das Marinegruppenkommando West schon am 23. Juni 1940, in Brest einen U‑Boot-Stützpunkt einzurichten. Zwar sollte der Befehlshaber der U-Boote, Konteradmiral Karl Dönitz, nach einer persönlichen InBArch 101II-MW-5683-29A/Hamet nal entsandt, um dort die alliierten Truppentransporte anzugreifen. Diese Einheiten sollten jedoch die einzigen im Westfeldzug eingesetzten Verbände der Kriegsmarine bleiben. Größere Schiffe wurden auch dann nicht eingesetzt, als das Oberkommando der Wehrmacht die Kriegsmarine um eine Unterstützung bei der Bekämpfung der britischen Rückzugstransporte vor Dünkirchen bat. Im Oberkommando der Kriegsmarine legte man zu diesem Zeitpunkt mehr Aufmerksamkeit auf die geplante Schlachtschiffoperation »Juno« in Nordnorwegen und zum anderen unterschätzte man einfach die britischen Möglichkeiten für eine Evakuierung der in Dünkirchen eingeschlossenen Expeditionsstreitkräfte. Zwar sollte den deutschen Marineeinheiten neben der Versenkung eines französischen U-Boots auch noch die Zerstörung dreier alliierter Zerstörer gelingen, der Großteil der während der Evakuierung von Dünkirchen versenkten alliierten Schiffe war jedoch aus der Luft unter vernichtenden Beschuss gesetzt worden. Den Alliierten gelang es, 338 266 Mann, darunter 123 000 Franzosen, nach Großbritannien zu überführen. Der Anteil der Kriegsmarine am Kampfgeschehen war also sehr gering, der Nutzen, den sie schließlich aus dem Westfeldzug zog, jedoch weitaus größer. 5Das Arsenal von Brest gekentertes U-Boot im Hafenbecken, Juni1940. Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 2/2010 19 Die deutsche Kriegsmarine in Frankreich spektion der Häfen angesichts der Zerstörungen in Brest dem Hafen von Lorient als neuem Hauptstützpunkt der deutschen U‑Boot-Waffe am Atlantik den Vorzug geben, der Aufbau einer funktionierenden Werftorganisation für die gesamte Atlantikküste war jedoch unumgänglich. Dabei schien die U-Boot-Waffe weitaus organisierter zu sein als der Rest der Marine, denn Dönitz hatte bereits vor seiner Abreise aus Deutschland einen Eisenbahnzug mit Torpedos und anderen Versorgungsgütern in Richtung Atlantikküste beordert. Diese trafen unbeschadet in Lo­ rient ein und bildeten die Grundlage für die neue U-Boot-Reparaturwerft. Bereits am 7. Juli 1940 lief U 30 als ers­ tes deutsches U-Boot im neuen Stützpunkt ein. Der Aufbau der Werften BArch RM 45 747 Der erste Organisationsplan des Oberkommandos der Kriegsmarine für die neuen Stützpunkte in Frankreich vom Juli 1940 sah für Brest den Ausbau zu einem Stützpunkt 1. Ordnung vor. Zu Stützpunkten 2. Ordnung für leichte Überwasserstreitkräfte wurden an der Kanalküste die Häfen Boulogne und Cherbourg bestimmt. Saint-Malo war als Einsatzhafen für Überwasserstreitkräfte vorgesehen. Außerdem sollten an der Atlantikküste Saint-Nazaire und Lorient zu Stützpunkten 2. Ordnung ausgebaut werden – der erste Hafen für Streitkräfte jeder Art, der zweite für U‑Boote. Weiter südlich waren die Häfen von La Rochelle-Rochefort und Bayonne als Einsatzhäfen für leichte Seestreitkräfte gedacht und im Schutz der Halbinsel Quiberon sollte ein An­ ker­platz für Überwasserstreitkräfte aller Art ent­stehen. Das Hauptamt Kriegsschiffbau bat aber bereits am 17. Juli 1940 wegen der Unmöglichkeit, die zahlreichen neuen Stützpunkte personell und materiell auszustatten, die Stützpunktforderungen für Frankreich auf ein Mindestmaß zu beschränken und womöglich sogar auf Brest zu verzichten. Neben den fehlenden Arbeitskräften behinderten auch die Zerstörungen vom Sommer 1940 die Nutzung des Hafens. So verfügte der Hafen im Juli 1940 lediglich über ein betriebsklares Trockendock. Die Dauer der Wiederherstellung der übrigen Dockanlagen war zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht abzusehen und funktionsfähige Kräne waren ebenfalls nicht vorhanden. Jedoch konnten die Werkstätten des ehemaligen französischen Marinearsenals ohne Einschränkungen genutzt werden. Da die deutsche Seekriegsleitung aber zwischenzeitig den Entschluss gefasst hatte, den Seekrieg künftig vor allem im Atlantik zu führen, wurde der Ausbau von Brest immer dringlicher. Dabei war diese Entscheidung gegen den Rat der Marinebefehlshaber vor Ort gefallen und wurde auch innerhalb der Seekriegsleitung kontrovers diskutiert. Als der Oberbefehlshaber der Kriegsmarine am 9. Oktober 1940 endgültig entschied, Brest zum neuen Hauptstützpunkt der deutschen Flotte auszubauen, waren seit der Einnahme der französischen Atlantikküste im Juni 1940 fast vier Monate verstrichen. Die Nutzung des Hafens durch die großen Überwasserstreitkräfte blieb jedoch über die gesamte Okkupationszeit durch die Schäden an den Hafenanlagen beeinträchtigt. Als die deutschen Schlachtschiffe im Februar 1941 in Brest eintrafen, waren die großen Trockendocks noch immer nur bedingt betriebsbereit und die aus Deutschland herangeschafften Hafenkräne befanden sich noch im Aufbau. Ein weiteres Problem war der Luftschutz, da Brest schon 1940 in Reichweite britischer Flugzeuge lag. Lediglich die U-Boote konnten sich ab September 1941 auf eine verbunkerte Reparaturwerft mit allen erforderlichen technischen Anlagen stützen. Zusammenarbeit mit der ­französischen Marine 5Organisationsplan der deutschen Seekriegsleitung für Frankreich, Juli 1940. 20 Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 2/2010 Aufgrund ihres Mangels an Facharbeitern war die Kriegsmarine in der Ausnutzung der französischen Häfen und Arsenale von vornherein auf die Zusammenarbeit mit den mit den Anlagen vertrauten, französischen Stellen angewiesen. Dies traf sowohl für die Handelshäfen von Bordeaux, Saint-Nazaire oder La Pallice als auch für die ehemaligen französischen Marinestützpunkte Cherbourg, Brest und Lorient zu. Vor allem wurden französische Arbeiter gebraucht, da eigene Kräfte nicht ausreichend zur Verfügung standen. Neben dem Umbau ehemaliger französischer Fischdampfer zu deutschen BArch 101II-MW-6687-24 5Der Marinebefehlshaber Westfrankreich, Admiral Eugen Lindau, bei der Inspektion französischer Marinefeuerwehr, 1942. den angewiesen, ihren Arbeitern zu verdeutlichen, dass jedes Entgegenkommen gegenüber der Besatzungsmacht Vorteile für Frankreichs Zukunft bringe. Neben der Arbeit in den Werkstätten unterstützte die französische Marine die deutsche Kriegsmarine aber auch mit der Gestellung von Besatzungen für die Schlepper und Hafenbetriebsboote in den Häfen des besetzten Gebietes, mit Marinegendarmen Lars Hellwinkel Literaturtipp Lars Hellwinkel, Der deutsche Kriegsmarinestützpunkt Brest, Bochum 2010 (= Kleine Schriftenreihe zur Militärund Marinegeschichte, 16). Florentijn Hofman Hilfskriegsschiffen hoben französische Kräfte die in den Arsenalen versenkten Schiffe oder erledigten in den französischen Werkstatteinrichtungen deutsche Reparaturaufträge. Zwar hatte noch im Juli 1940 der Leiter der Amtsgruppe Werften im Hauptamt Kriegsschiffbau gefordert, dass in französischen Werftanlagen aufgrund der Sabotagegefahr keine Reparaturen an deutschen Kriegsfahrzeugen durchgeführt werden sollten, die nur schleppende Arbeiterzuweisung aus der Heimat ließ den deutschen Marinedienststellen vor Ort jedoch keine andere Wahl. Noch im Februar 1941 waren zum Beispiel in Brest trotz der strategischen Bedeutung des neuen Stützpunktes erst 470 deutsche Arbeiter eingetroffen. Ihnen standen 6349 französische Arbeiter gegenüber, die für die Kriegsmarine eine wichtige Arbeiterreserve bildeten, welche, wenn auch nicht auf größeren Kriegsschiffen, dann doch zumindest indirekt in den Werkstätten oder an Bord der nicht weniger wichtigen deutschen Hilfskriegsschiffe eingesetzt werden konnte. Der Oberbefehlshaber der französischen Marine, Admiral Darlan, akzep­ tierte die Annahme der Arbeiten für die deutsche Besatzungsmacht vor dem Hintergrund der Kollaborationspolitik des Vichy-Regimes. Die Direktoren der französischen Arsenale wur- als Wachkräften an den Toren der Arsenale und mit dem Einsatz französischer Marinefeuerwehr bei den alliierten Luftangriffen auf die deutschen Marinestützpunkte am Atlantik. Nach einer Meldung der Kriegsmarine aus dem Jahr 1943 waren nicht weniger als 186 Offiziere, 3069 Soldaten, 909 Beamte, 2313 Angestellte und 25 753 Arbeiter der französischen Marine in den vier Arsenalen von Cherbourg, Brest, Lo­rient und Toulon für die Kriegsmarine tätig. Die meisten versahen ihren Dienst bis zur Befreiung des Landes und nur wenige von ihnen mussten sich nach 1944 für ihr Tun während der Besatzungszeit rechtfertigen; von der französischen Marine wurden sie nach dem Krieg anstandslos übernommen. In der französischen Marinegeschichtsforschung wird diese militärische Zu­ sam­menarbeit weiterhin verschwiegen, sie war jedoch die wesentliche Voraussetzung für die erfolgreiche Nutzung der französischen Häfen durch die deutsche Kriegsmarine. 5Historisches Erbe als Kulisse für ein Kunstprojekt: der deutsche U-Boot-Bunker in Saint-Nazaire 2007. Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 2/2010 21 Service Das historische Stichwort bpk/Dietmar Katz Schlacht bei Tannen­berg 1410 3Zusammenstoß der deutschen Ordens­ritter mit dem polnischlitau­ischen Heer in der Schlacht von Tannenberg. Miniatur aus der Chronik des Diebold Schilling, 1484/85. U m das Jahr 1190, also während des dritten Kreuzzuges, entstand ein Krankenpflegeorden, der 1198 in einen Ritterorden, den sogenannten Deutschen Orden, umgewandelt wurde. Papst Innozenz III. bestätigte dies ein Jahr später. Der Orden erwarb erste Besitzungen in Palästina, Armenien und Zypern, ab 1200 auch in Deutschland und verbreitete sich schließlich über große Teile Europas. Die Konkurrenz mit älteren Ritterorden im Königreich Jerusalem und die gescheiterten Kreuzzüge veranlassten den Orden, sich ein neues Betätigungsfeld zu suchen. Herzog Konrad von Masowien rief 1225/26 den Deutschen Orden zur Bekämpfung der noch heidnischen Prußen, eines baltischen Volksstammes, in das Kulmer Land in Preußen. 1231 begann ein Missionskrieg; rund 50 Jahre später, 1283, war die Eroberung Preußens im Wesentlichen beendet. Die Bestätigung Kaiser Friedrichs II. 1226 in der Goldenen Bulle von Rimini sowie 22 die Urkunde Papst Gregors IX., in der er das Kulmer Land und Preußen unter den Schutz der Kirche stellte, förderten die Unabhängigkeit des Deutschen Ordens und beauftragten ihn zugleich mit »Heidenkampf« und »Heidenmission«. Außer in Preußen fasste der Deutsche Orden auch in Livland – im heutigen Lettland – schnell Fuß. Dort hatte 1202 ein eigener Kreuzzugsorden, der sogenannte Schwertbrüderorden, einen Missionskrieg und Siedlungsausbau begonnen. Nach einer vernichtenden Niederlage 1236 gegen die Litauer an der Saule schlossen sich die Reste dem Deutschen Orden an. Damit verfügte dieser an der nordöstlichen Ostsee über ein zweites gro­ßes Herrschaftsgebiet, das aber keine direkte Landverbindung zu Preußen besaß und von der Region Schemaitien, einer russischen Landschaft, durchtrennt war. Von entscheidender Bedeutung waren die Beziehungen zu den Nachbarn. Das Verhältnis zum christlichen König- Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 2/2010 reich Polen gestaltete sich zunächst neutral, teilweise sogar positiv, verschlechterte sich jedoch ab dem frühen 14. Jahr­hundert aufgrund von Gebietsstreitigkeiten spürbar. Gegen das heidnische Litauen aber unternahm der Orden Jahr für Jahr Kriegszüge, an denen regelmäßig Kreuzfahrer aus dem Reich und aus Westeuropa teilnahmen. Die litauisch-polnische Union von 1386 änderte die Situation grundlegend. In einer spektakulären Hochzeit vermählte sich die polnische Königstochter Jadwiga (Hedwig) mit dem litauischen Großfürsten Jagiełło, der als Władysław IV. zum König von Polen aufstieg. Der Vertrag legte fest, dass sich Jagiełło um die Rückgewinnung verlorengegangener Gebiete für die polnische Krone bemühen sollte und dass sich der litauische Großfürst mit seinem Volk taufen ließ. Damit entstand ein Doppelstaat, dessen Macht von der Grenze des Heiligen Römi­ schen Reiches bis zum Moskauer Umland sowie zum Schwarzen Meer reichte und mit dessen Einzelländern der Deutsche Orden bisher schon heftige militärische Konflikte ausgetragen hatte. Außerdem war Litauen zum Christentum übergetreten, womit die Legitimation eines Kreuzzuges gegen Nichtchristen entfiel. Konsequent verboten 1395 der römisch-deutsche König und 1404 der Papst den Heidenkampf, was aber den Deutschen Orden nicht daran hinderte, die Kreuzzüge fortzusetzen. Ungeklärt blieb zunächst die schwelende Auseinandersetzung um das Gebiet Schemaitien. Der Orden begehrte diese Region, um eine territoriale Verbindung zwischen seinem preußischen Ordensland im Süden und seinem livländischen Besitz im Norden herzustellen. Die Litauer hingegen waren bestrebt, mit dem Erwerb des russischen Besitzes an die Ostsee vorzudringen. Im Jahr 1398 trat zwar der litauische Großfürst Witold aus taktischen Erwägungen (Friede von Sallinwerder) dieses Gebiet an den Orden ab, doch die Unterwerfung gelang dem Orden trotz mehrerer Kriegszüge nicht. 1409 brach schließlich in Schemaitien ein Aufstand mit Unterstützung Witolds aus, der den Beginn des »Großen Krieges« von 1409 bis 1411 zwischen dem Deutschen Orden und Polen-Litauen markierte. Nach dem Angriff des Ordens unter seinem Hochmeister Ulrich von Jungingen und einem auf neun Monate ausgehandelten Waffenstillstand rüsteten sich beide Seiten bis zum Frühsommer des Jahres 1410 zum entscheidenden Schlag. Die zeitgenössischen Quellen über die Kämpfe sind propagandistisch geprägt; eine genaue Rekonstruktion des Schlachtverlaufs ist daher schwierig. So variiert in der heutigen Literatur die Einschätzung der Größe der beiden Heere beträchtlich. Für den Deutschen Orden reichen die Zahlenangaben von 11 000 bis zu 27 000. Die Anzahl der Ordensritter machte dabei nur einen kleinen Anteil aus und dürfte kaum mehr als einige Hundert betragen haben. Hinzu kamen berittene Gefolgsleute, berittene Armbrustschützen, Infanterie und Artillerie. Der Anteil der Söldner war, wie auch auf polnisch-litauischer Seite, beträchtlich. Beim Orden konnten 3700 Söldner nachgewiesen werden. Für das polnisch-litauische Heer reichen die Gesamtzahlen von 20 000 bis 39 000 Kämpfern. Unstrittig ist jedenfalls die numerische Unterlegenheit des Ordensheeres, was sich am Aufmarsch der beiden Kontingente verdeutlicht. Der polnische König formierte sein Heer in drei Linien. Am linken Flügel standen die Polen, verstärkt mit Rittern aus Böhmen, Mähren, Schlesien und Ungarn. Am rechten Flügel befehligte Großfürst Witold neben den Litauern auch tatarische und russische Abteilungen, die allesamt leichter bewaffnet und gerüstet waren als die schwergepanzerten Ritter des Ordens. Der Hochmeister Ulrich von Jungingen hatte sein Heer ursprünglich ebenfalls in drei Linien aufmarschieren lassen. Als er jedoch die lange Front des gegnerischen Heeres sah, gliederte er auf zwei Linien um. Damit dünnte er die eigenen Reihen aus, verbreiterte aber die Aufstellung, um nicht vom Feind umgangen zu werden. Die eigentliche Schlacht fand am 15. Juli 1410 zwischen den Dörfern Tannenberg und Grünfelde statt, weshalb das Ereignis in der polnischen Geschichtsschreibung »Schlacht bei Grunwald« genannt wird. Das Ordensheer hatte bereits einen Nachtmarsch hinter sich, um das polnisch-litauische Heer zu überraschen, was auch gelungen wäre. Ulrich von Jungingen aber wagte keinen sofortigen Angriff. Gewarnt wartete Władysław Jagiełło ab und hielt seine Truppen im kühlen Schatten eines Waldes zurück, während die Ordenstruppen in voller Rüstung mehrere Stunden in der gleißenden Julisonne unter Waffen standen. Erst nachdem Gesandte des Ordens dem polnischen König symbolisch zwei Schwerter überreicht hatten, ließ dieser sein Heer antreten. Um die Mittagszeit begann der Kampf. Auf der rechten Flanke stürmten litauische Truppen gemeinsam mit Russen und Tataren vor, bis sie von Ordensrittern aufgehalten wurden. Daraufhin griffen die Litauer zu einer möglicherweise schlachtentscheidenden List. Sie zogen sich in einer Scheinflucht zurück, sodass die Ordenstruppen die Schlacht für gewonnen hielten. Bei der Verfolgung des weichenden Gegners lösten die Ordensritter ihre eigene Schlachtordnung auf. In die entstandene Lücke drangen polnische Einheiten, umfassten den linken Flügel des Deutschen Ordens und zerschlugen ihn. Im weiteren, wechselvollen Verlauf griff der Hochmeister Ulrich von Jungingen selbst mit seiner Reserve in die Schlacht ein. Er durchbrach zwar mehrfach die Reihen des polnischen Hauptheeres, scheiterte aber schließlich an der Übermacht. Der Hochmeister fiel und mit ihm die Mehrzahl der Ordensritter. Auch die polnisch-litauische Seite erlitt große Verluste. Tannenberg war – gemessen an der Zahl der beteiligten Kämpfer – eine der größten Schlachten des europäischen Mittelalters. Dem Deutschen Orden versetzte die Niederlage »zwar nicht den Todesstoß, bedeutete für ihn aber eine Katastrophe« (Klaus Militzer). Neben der beinahe vollständigen Führungselite hatte der Orden knapp ein Drittel seiner Ritter aus Preußen verloren. In den folgenden Wochen fiel fast das gesamte Ordensland dem polnisch-litauischen Heer in die Hände, nur das Haupthaus, die Marienburg, konnte sich behaupten. Der spätere Hochmeister Heinrich von Plauen organisierte eine eilig aufgestellte Verteidigung, die den Angreifern standhielt. Nach zwei Monaten musste der polnische König Władysław Jagiełło die Belagerung aufgeben. Das verlorene Land fiel schnell wieder an den Deutschen Orden zurück. Ein halbes Jahr später, am 1. Februar 1411, wurde der Erste Frieden von Thorn geschlossen. Hinsichtlich seines Herrschaftsgebietes erlitt der Deutsche Orden praktisch keine Einbußen. Schwierig gestalteten sich dagegen die finanziellen Lasten, vor allem die Auslösung der Geiseln. Die Forderungen beliefen sich auf 100 000 Schock Groschen bzw. 260 000 Gulden und gelten als Ursache für die Finanznot des Ordens in den folgenden Jahrzehnten. Dies soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass »die Gründe für seinen Niedergang ganz überwiegend in Preußen selber zu suchen sind« (Hartmut Boockmann). Martin Hofbauer Literaturtipp Klaus Militzer, Die Geschichte des Deutschen Ordens, Stuttgart 2005. Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 2/2010 23 Service M Medien online/digital ehr sein als scheinen. So könnte das Motto der Verantwortlichen für dieses geschichtswissenschaftliche In­for­mationsangebot lauten. Denn was sich hier in relativ nüchterner Gestaltung präsentiert, bietet dem interessier­ ten Benutzer fundierte und umfassen­de Einblicke sowohl in verschiedene historische Themengebiete als auch in die Grundlagen der Forschung. Gerade einmal vier Rubriken umfasst die Startseite: »Themen«, »Länder«, »Recherche«–, »Lehren und Lernen«. Und es ist die Themenseite, der man den Ursprung von historicum.net anmerkt. Handelt es sich doch um das Ergeb­nis des Projekts »Server Frühe Neuzeit« der Deutsche Forschungsgemeinschaft, der Ludwig-MaximiliansUniversität München und der Bayerischen Staatsbibliothek. So existiert beispielsweise momentan kein Themenblock, der sich mit der Zeit vor der Renaissance befasst. Doch deuten Angebote wie »Bombenkrieg« oder »Zwangs­ arbeit Rhein-Erft-Ruhr« darauf hin, dass die Seite thematisch und chronolo­ gisch zunehmend erweitert werden soll. Die einzelnen Themen werden in unterschiedlicher Intensität abgehandelt. Neben Quellen- und Literaturhinweisen finden sich Aufsätze sowie Links zu ähnlichen Seiten im Web. Dies ist sozusagen der Standard. Manche The- menseiten verfügen jedoch zusätzlich über Zeitleisten, verweisen auf spezifische Archive oder Museen, führen zu im Internet veröffentlichten Magisterarbeiten und bieten eine Übersicht aktueller Forschungsprojekte. Wer sich gerade mit einem der aufgeführten Bereiche beschäftigt, hat hier eine wahre Fundgrube an Informationen vor sich! In der Rubrik »Länder« werden zurzeit zehn Staaten sowie die Region Ostmitteleuropa vorgestellt, wobei deren thematische Unterseiten häufig zu externen Aufsätzen weiterleiten, die in ihrer Gesamtheit allerdings nicht immer ein vollständiges Bild der jeweils behandelten Epoche ergeben. Zahlreiche Verweise zu Quellen und Literatur sowie Links zu Institutionen runden das Angebot ab. Wie man es auf vielen anderen geschichtswissenschaftlichen Webseiten ebenfalls findet, bietet die Rubrik »Recherche« umfangreiche Infos zur bibliografischen Arbeit. Die »Neuerwerbungen« sind dagegen vorwiegend für in München ansässige Forscher relevant, beziehen sie sich doch ausschließlich auf das Angebot der Bayerischen Staatsbibliothek. Das Highlight ist die Rubrik »Lehren und Lernen«. Eingeführt wird hier in das Handwerk des Historikers mit Schwerpunkt auf E-Learning und dem Einsatz von Computern bei der Recherche. Zur Didaktik der Geschichte wird eine umfangreiche Bibliografie www.historicum.net 24 Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 2/2010 angeboten. Die »Links-Winks« als letzter Menüpunkt schließlich stellen derart viele Webseiten für historisch Interessierte vor, dass man aufpassen muss, sich nicht darin zu verlieren. Als Fazit lässt sich feststellen, dass diese Seite mehr als nur einen Besuch wert ist. Angesichts der gewaltigen Fülle an Links und Unterseiten ist den Betreibern von historicum.net nur zu wünschen, dass es ihnen gelingen möge, bei den geplanten Erweiterungen ein gewisses Maß an Übersichtlichkeit zu bewahren. Matthias Rawert Unser Krieg Z wischen dem 1. September 1939, als die Wehrmacht die Grenze zu Polen überschritt, und dem 8. Mai 1945, dem Tag der Unterzeichnung der bedingungslosen Kapitulation, führten Hitler und seine Schergen einen gnadenlosen Krieg. Nach den überraschen­ den anfänglichen Siegen über Polen und Frankreich wendete sich das Blatt bald zu Ungunsten Deutschlands. Die Ausweitung zu einem Weltkrieg durch den Kriegseintritt der USA Ende 1941, spätestens aber Anfang 1943 mit der Niederlage der Wehrmacht bei Stalingrad markierte schließlich den Anfang vom Ende. Auch der Aufruf von Goebbels zum »Totalen Krieg« im Februar 1943 vermochte daran nichts mehr zu ändern. An allen Fronten befand sich die Wehrmacht nun auf dem Rückzug. Wie erlebten die Bevölkerung und der einfache Soldat die Kriegsjahre in der Heimat bzw. an der Front? »Heimat Deutschland 1933–1945« aus der Reihe »Unser Krieg«, produziert von Michael Kuball, zeigt private, ungeschnittene Amateuraufnahmen aus dieser Zeit in Deutschland. Das Filmmaterial folgt der Chronologie des Krieges. Es reicht von ersten Farbfilmaufnahmen, bei denen »viele Amateure irritiert vom stechenden Rot« der Fahnen sind, über die einzigen Aufnahmen des Konzentrationslagers in Dachau vor der Befreiung bis hin zu Aufnahmen eines Kriegsgefangenenlagers bei Dortmund, wo gefangene Afrikaner scheinbar ausgelassen Tänze auf- digital Aufnahmen von Freunden oder Familienangehörigen der Filmer schlicht kommentiert. Originale Radionachrichten aus Großbritannien und Frankreich über den Kriegsbeginn sowie Ansprachen Hitlers ergänzen die Palette. Die als Gemeinschaftsproduktion von ARD und Arte zunächst im Fernsehen ausgestrahlte Sendung gibt ein direktes Bild der Geschichte wider – unzensiert und unverstellt. Die Aufnahmen »zeigen alle dasselbe grauenvolle Szenarium, das verantwortlich ist für den kollektiven Albtraum einer ganzen Generation«. Fazit: Absolut sehenswert. Christopher Schaefer Unser Krieg. Heimat Deutschland 1933–1945, 1 DVD, 52 Minuten, D 2007. ISBN 978-3-89848-826-6. Unser Krieg. Der unbekannte Krieg. Filmtagebücher 1936-1945, 2 DVDs, 263 Minuten., D 2007. ISBN 978-3-89848-827-3 führen; auch finden sich Aufnahmen von einem frisch verheirateten Pärchen, das 1944 das gemeinsame Wo­chen­ende frohgestimmt in Küstrin verbringt – hier »alles noch heile Welt« –, bis der Mann wieder seine Arbeit als Rüs­ tungsingenieur in Berlin antreten muss; schließlich folgt die »Vereidigung des letzten Aufgebots«, der Division Hermann Göring, in Ostpreußen 1945. Während diese 52-minütige DVD aus­ schließlich Aufnahmen aus Deutschland und Österreich enthält, werden 244 Minuten plus Bonusmaterial dem restlichen Europa mit der DVD »Der unbekannte Krieg« gewidmet: angefangen mit Aufnahmen vom »Frontalltag« des Spanischen Bürgerkrieges 1936 über Szenen einer jüdi­schen Hochzeit in Holland, Bildern von zerbombten Städten wie Warschau und London, die Bloßstellung eines Paares wegen »Rassenschande« in Polen 1941 bis hin zu Einblicken in den Russlandfeldzug »Barbarossa« und dem begeis­ terten Empfang für die Alliierten Befreier 1945 in verschiedensten Städten Europas. Kuball vermittelt, in Zusammenarbeit mit weiteren Dokumentarfilmern, mit der DVD-Reihe »Unser Krieg« einen eindrucksvollen Einblick in das Leben der Kriegsjahre. Durch Kommentare in Text oder Wort werden die »Zeitzeugen erzählen« L ässt sich ein so ereignisreiches Jahrhundert wie das 20. auf CD abbilden, und das nur durch Zeitzeugenberichte? Diesen Versuch unternehmen Inge Kurtz und Jürgen Geers mit dem Hörbuch »Meine Geschichte – Zeitzeugen erzählen – 100 Jahre Deutschland«. Auf insgesamt 13 CDs berichten fast 15 Stunden lang Menschen aus ihrem Leben im vergangenen Jahrhundert, von ihren Erfahrungen und Erlebnissen. Als Zeitzeugen erzählen sie dabei zumeist aus ihrer Jugend; es kommen also stets Vertreter unterschiedlicher Generationen zu Wort. Die beiden Autoren umgingen damit auch die Gefahr, ganze Lebensberichte einfach aneinanderzureihen. Stattdessen ist eine Geschichtscollage entstanden, in der jede Thematik immer aus mehreren sorgfältig ausgewählten Beiträgen Gestalt annimmt. Es fügt sich dadurch ein Bild des vergangenen Jahrhunderts in erstaunlicher Breite und Vielfalt zusammen. Personen aus allen Schichten der Gesellschaft und allen Regionen Deutschlands mit den verschiedensten Berufen, familiären Verhältnissen und Hintergründen sprechen über ihre Erinnerungen und bilden so die betreffende Zeit in vielen Perspektiven ab. Die ganz große Politik bleibt dabei zumeist außen vor, vielmehr geht es oft um das tägliche (Über-)Leben in schwieriger Zeit – sowohl in lustiger oder anekdotenhafter, als aber auch in ganz ernster und berührender Weise und dabei stets äußerst interessant wiedergegeben. Es wird erzählt über Berufs- und Familienleben, Schulzeit, über Wohlstand und Armut, Mode und Essen, über Geschlechterrollen, Sexualität und Moral. Vieles war anders damals, aber man stellt auch überrascht fest, dass sich manche Dinge bis heute nicht verändert haben. Neben Kaiserreich und Weimarer Republik nimmt etwa ein Drittel der Do­ ku­mentation die Zeit des Nationalsozia­ lismus und des Zweiten Weltkrieges ein. Dieser Abschnitt stellt den stärks­ ten, ergreifendsten Teil der Berichte dar, etwa wenn Opfer der NS-Diktatur greifbar machen, wie sich Rassenwahn in Verfolgung und schließlich in Massen­ mord verwandelte. Die Nachkriegszeit steht anschließend ganz im Zeichen des Gegensatzes zwischen Bundesrepu­ blik und DDR. Leider ist dieser Bereich etwas blasser geblieben. Themen wie die gesellschaftlichen Veränderungen durch die Anwerbung von »Gastarbeitern« oder auch der Aufstand des 17. Juni werden beispielsweise nicht angeschnit­ ten. Auch die beiden Verantwortlichen für die Dokumentation und die Entstehung ihres Projektes bleiben außen vor. Dies ist jedoch kein gravierendes Man­ko. Stattdessen muss die Eingangsfrage eindeutig mit »ja« beantwortet werden. Die CD-Sammlung ist für alle Geschichtsbegeisterten (und vor allem solche, die es noch werden wollen) unbedingt zu empfehlen. Keine trockene Geschichtsstunde voller Zahlen und Fakten, sondern leisere und lautere Zwischentöne der Menschen, die durch die vergangenen Jahrzehnte geprägt wurden und nun ihre Erfahrungen an uns weitergeben. Daniel Uhrig Meine Geschichte – Zeitzeugen erzählen – 100 Jahre Deutschland, 13 Audio-CDs, 894 Minuten, München 2010. ISBN 978-386717-567-8 Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 2/2010 25 Service Lesetipp Seelower Höhen 1945 Äthiopien 1867 Sezessionskrieg »Der Schlüssel für Berlin« – so lautet der Titel eines sowjetischen Propagan­da­ plakates aus den letzten Kriegswochen. Es zeigt einen lächelnden Rotarmisten, der eine Granate in Schlüsselform im Arm hält, vor dem Hintergrund feuern­ der sowjetischer Geschütze. Mit dem »Schlüssel« waren die über 60 Kilometer östlich von Berlin liegenden See­ lower Höhen gemeint, ein strategisch günstig an der Oder liegender Höhenzug, der von Truppenteilen der deutschen 9. Armee verteidigt wurde. Die Rote Armee bereitete die Erstürmung dieses Geländes ab Februar 1945 akribisch vor, ehe sie am 16. April 1945 zum entscheidenden Angriff antrat. Nach heftigen Kämpfen durchbrach die angreifende 1. Weißrussische Front am 19. April endgültig die deutsche Verteidigung an der Oder und öffnete damit den Weg nach Berlin. Die pünktlich 65 Jahre nach der Berliner Operation erschienene Arbeit von Uwe Klar und Gerd-Ulrich Herrmann, langjähriger Leiter der Gedenkstätte Seelower Höhen, der regelmäßig und fachkundig Besuchergruppen an die Orte des damaligen Geschehens im Oderbruch führt, bietet Informationen zu den politischen Hintergründen, der Vorbereitung, dem Verlauf sowie den Auswirkungen der Schlacht. Dazu zählen auf der Grundlage erstmals von deutscher Seite ausgewerteter Dokumente der 1. Weißrussischen Front Aspekte der letzten sowjetischen Großoffensive in Europa: der ebenso unkonventionelle wie unglückliche Einsatz von Flakscheinwerfern zur Unterstützung eines Panzerangriffs, der Wettlauf um Berlin zwischen den sowjetischen Heerführern Schukow und Konew, Verluste der 1. Weißrussischen Front sowie raffinierte Aufklärungsund Täuschungsmaßnahmen. Dem informativen und reich bebilderten Buch mp sind viele Leser zu wünschen. Tewordos (Theodor) II., Kaiser von Äthio­pien, richtete am 22. Oktober 1862 einen Brief an die britische Königin Victoria. Er bat darin um Unterstützung für durch den Islam unterdrückte Christen. Das Schreiben wurde nie beantwortet, was Tewordos II. erboste. Er setzte zunächst den britischen Konsul und im Weiteren über 60 europäische Geiseln in der äthiopischen Bergfes­ tung Magdala fest. Dieses Vorgehen bedeutete einen Affront gegen das britische Empire, das sich nun zum militärischen Handeln veranlasst sah und seine Fähigkeiten zur Anwendung militärischer Macht über weite Entfernungen hinweg einsetzte. Die Abspaltung der durch Plantagenwirtschaft und Sklavenhaltung geprägten Südstaaten vom industrialisierten Norden der USA entzündete 1861 den Amerikanischen Bürgerkrieg, den blutigsten Konflikt, der jemals auf ameri­kanischem Boden ausgetragen wurde. Nach vier Jahren siegten die in der Union verbliebenen Nordstaaten über die personell wie ma­teriell unterlegenen Konföderierten. Für den preußischen Generalfeldmarschall Helmuth von Moltke war dieser Szessionskrieg ein »Scharmützel zweier bewaffneter Pöbelhaufen, die sich durch das Land verfolgten und von denen nichts gelernt werden kann«. Oberflächlich betrachtet könnte man dem Chef des Großen Generalstabs zustimmen, verfügten doch bei Ausbruch des Krieges weder die Nord- noch die Südstaaten über ein schlagkräftiges reguläres Militär. Beide Seiten konnten zunächst nur provisori­sche, aus Freiwilligen- und Milizverbänden zusammengestellte Armeen in die Schlacht führen. Moltke übersah aber den grundlegenden Wandel, den die Kriegführung angesichts des technischen Fort­schritts genommen hatte. Der Amerika­nische Bürgerkrieg gilt heute als der erste »moderne« Krieg in der Geschichte. Allgemeinverständlich und zugleich wissenschaftlich fundiert benennt Udo Sautter in seinem Überblickswerk Ursachen, Verlauf und Ergebnisse dieses Krieges. Er berücksichtigt die politi­ schen, sozialen sowie wirtschaftlichen Aspekte und beschreibt anschaulich den durch Schützengräben, Minen, Maschinengewehre und Panzerschiffe bedingten Wandel der Kriegführung. Ergänzt wird die Darstellung durch 25 zeitgenössische Fotografien, zwei Überblickskarten, eine Zeittafel, ein Glossar und einige Leseempfehlungen. mn Gerd-Ulrich Herrmann und Uwe Klar, Der Schlüssel für Berlin. Hintergründe, Vorbereitung und Verlauf der Schlacht um die Seelower Höhen, Aachen 2010. ISBN 9783-86933-022-8; 240 S., 19,90 Euro 26 Volker Matthies, Unternehmen Magdala. Strafexpedition in Äthiopien, Berlin 2010 (= Schlaglichter der Kolonialgeschichte, 11). ISBN 978-3-86153-5720; 195 S., 24,90 Euro Ab Oktober 1867 erkundeten die Briten äthiopisches Gelände. In Massawa am Roten Meer errichteten sie einen Hafen und in Zulla eine logistische Basis. Die britische Militärmaschinerie konnte 1867 aus allen Teilen des Empires anrollen. Die Truppe selbst zählte lediglich 13 088 Mann, davon 9050 Inder und 4038 Briten. Das »Hilfs- und Trosspersonal« erhöhte die Stärke der Streitmacht jedoch auf 62 220 Mann. Diese Kräfte besiegten am 13. April 1868 die äthiopische Streitmacht, eroberten Magdala und befreiten die Geiseln. Tewordos II. beging noch am Tag der Schlacht Selbstmord. Er wurde in Äthiopien als Held gefeiert, wie auch die britisch-indi­schen Truppen in ihrer Heimat. Über das gesamte Unternehmen berichteten die zeitgenössische Presse und Memoirenliteratur ausgiebig. Volker Matthies schildert die Machtdemonstration der Briten sehr anschau­ lich. Er zeigt die enormen logis­ti­schen Schwierigkeiten ebenso wie die Auswirkungen des Unternehmens, und auch die interkulturellen Probleme werden ausgiebig dargestellt und anahp lysiert. Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 2/2010 Udo Sautter, Der Amerikanische Bürgerkrieg 1861–1865, Stuttgart 2009. ISBN 978-3-80622232-6; 208 S., 24,90 Euro Piraterie Das Phänomen »Piraterie«, das in den letzten Jahren einen unübersehbaren Wiederaufstieg erlebt hat, ist in allen seinen Ausprägungen und Schichtun­ gen zu vielgestaltig, um ihm mit dem Werkzeug »Marine« allein Herr werden zu können. Der im maritimen Themenbereich einschlägig ausgewiesene Autor Eigel Wiese unterlegt diese Kernbotschaft mit einer großen Anzahl von Kurzreportagen, die, jeweils zumeist in sich abgeschlossen, die Piraterie in ihrer Vielgestaltigkeit ausleuchten. Der Autor führt den Leser an die wichtigsten geografischen Schwerpunkte des »Piratenunwesens«. Er stellt sowohl aufsehenerregende Piratenak­ tionen als auch die manchmal mehr, manchmal weniger gelungenen Rettungsunternehmen in ihren Abläufen dar und analysiert sie. Die Opfer der Piraten – Seeleute, Passagiere, Reedereien und nicht zuletzt die Finanziers des Seehandels – bilden ebenfalls eine Facette des Gesamtbildes, das dieses Eigel Wiese, Piraterie. Neue Dimensionen eines alten Phänomens, Hamburg 2010. ISBN 978-3-7822-108-9; 198 S., 24,90 Euro Buch abdeckt. Schließlich wendet sich Wiese den Gegenmaßnahmen zu. Dabei kommen auch Akteure aus den Bereichen Versicherungen, Sicherheitsunternehmen, Marine oder Reedereien zu Wort. Abgerundet wird das Buch durch einen kurzen Blick hinter die Kulissen der Geldströme, die schon immer die Grundlage der Piraterie gebildet haben. Fazit: Kein hochwissenschaftliches Nachschlagewerk mit Ewigkeitsanspruch, aber ein guter, erster Überblick über das breit gefächerte Geschehen im weiten Feld der Piraterie. Rüdiger Schiel Schönbohm »Wilde Schwermut« – mit diesem Topos aus Ernst Jüngers »Marmorklippen« überschreibt der langjährige Sol- Jörg Schönbohm, Wilde Schwermut. Erinnerungen eines Unpolitischen. Mit Beiträgen von Eveline Schönbohm, Berlin 2010. ISBN 9783938844250; 461 S., 29,90 Euro dat und nachmalige CDU-Politiker Jörg Schönbohm seine im Januar 2010 erschienenen Memoiren. Der Untertitel kokettiert – als weitere literarische Anspielung – bereits mit dem Ruf des streitbaren Politikers als ewiger »General« und Bewahrer »des konservativen Tafelsilbers«. Schönbohm schreibt – in mehreren Exkursen ergänzt von seiner Frau Eveline – über seine Kindheit und Jugend, geprägt durch die Flucht aus der Sowjeti­schen Besatzungszone, seine 39 Jahre im Dienst der Bun­des­ wehr, in der er bis zum Inspek­teur des Heeres aufsteigt und anschließend auf den Posten eines Staatssekretärs wechselt, und von seiner späten politischen Karriere als Berliner Innensenator und schließlich Bran­den­burger Innenminis­ ter. Die Schilderung persönlicher Enttäuschungen spart er nicht aus, wie die von ihm erhoffte, aber von höherer Stelle verhinderte Berufung zum Generalinspekteur der Bundeswehr, um, wie er selbst schreibt, am Ende seiner Laufbahn »Militär und Politik zu versöhnen«. Schönbohm ist und bleibt, das stellt er auf knapp 450 Seiten heraus, ein bekennender Konservativer, der den Weg in die Politik spät aber eindrucksvoll gefunden hat. Der Untertitel – in Anlehnung an Thomas Manns »Betrachtungen eines Unpolitischen« von 1918 – wirkt unnötig aufgesetzt, ein Griff zu viel in den Zitatenschatz der Weltliteratur. Dem Leser liegen eher die Erinne­ rungen eines streitbaren, aber ehrli­ chen und wichtigen Protagonisten der deutschen Wieder­vereinigung vor. Rouven Wauschkies Kuba-Krise 1962 Während des Kalten Krieges waren die Spitzen der beiden Blöcke über das sogenannte »Rote Telefon« verbunden. Es war eines der Ergebnisse der KubaKrise 1962 und sollte im Notfall durch das direkte Gespräch der Regierungs- chefs der UdSSR und der USA helfen, künftige drohende Krisen zu vermeiden. Allein das Gerät und das militärische Personal, das im Oktober 1962 die UdSSR auf Kuba bzw. die USA in Florida aufzubieten hatten, verdeutlichen die Gefahr eines Atomkrieges; darunter befanden sich etwa 36 sowjetische nukleare Mittelstreckenraten mit bis zu 2000 Kilometern Reichweite. Die USA verhängten nach Verstreichen eines Ultimatums zum Abbau der sowjetischen Raketen eine Seeblockade über Kuba und versetzten ihre Streitkräfte in höchste Alarmbereitschaft. Ein Deal zwischen den beiden Mächten beendete die Krise: Abbau der sowjetischen Start­ram­pen und Abzug der Raketen von Kuba, im Gegenzug Rückholung der in der Türkei stationierten, gegen die UdSSR gerichteten US-Mittelstreckenraketen. Bernd Greiner beschreibt anschaulich den gefährlichsten Moment des Kal­ ten Krieges, wobei er der Vorgeschichte und den drei Protagonisten Kennedy, Chruschtschow und Castro besonderes Augenmerk widmet. Er nimmt an, dass es mit anderen Staatsmännern an der Spitze der drei Staaten gar nicht zu einer Krise gekommen wäre. Die nationa­le Sicherheit der USA sei zudem von der Raketenstationierung auf Kuba angesichts ihrer nach wie vor bestehenden nuklearen Überlegenheit nicht berührt gewesen, vielmehr sei es um das Ausloten von Macht und das Sichern von Einflusssphären gegangen, wobei hier jedoch erstmals die beiden großen Kontrahenten direkt am Konflikt beteiligt waren. Er beleuchtet zudem die Rolle von Geheimdiensten und Militärs – darunter auch von untergeordneten Kommandeuren. Ebenso findet die Nachgeschichte ihren Platz. Die KubaKrise als »Gipfelpunkt des Kalten Krie­ ges«? Ja, konstatiert der Autor, doch keinesfalls ein Wendepunkt. mt Bernd Greiner, Die Kuba-Krise. Die Welt an der Schwelle zum Atomkrieg, München 2010. ISBN 978-3-40658786-3; 128 S., 8,95 Euro Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 2/2010 27 Service Die historische Quelle Bundesarchiv-Militärarchiv BArch 183-L05360/Hausen Im Wald von Compiègne waren im Juni 1940 Kriegsberichterstatter der Propaganda-Kompanie 612, Bild-, Filmund Rundfunkberichterstatter sowie Journalisten aus aller Welt Zeugen der Waffenstillstandsverhandlungen zwischen Frankreich und dem Deutschen Reich. Dort, wo am 11. November 1918 die deutsche Heeresführung den Waffenstillstand unterzeichnen musste, hatte sich nun eine französische Delegation einzufinden – diesmal jedoch unter anderen Vorzeichen als 1918. Der Ort sollte die Symbolik der gelungenen Revanche für 1918 unterstreichen. In der Zwischenkriegszeit war der Wald bei Compiègne von den Franzosen zu einem nationalen Erinnerungsort umgestaltet worden. Ein Gedenkstein, eine Statue Marschall Ferdinand Fochs und ein monumentales Siegesdenkmal mit einem durch ein Schwert sterbenden Reichsadler erinnerten an den französischen Sieg von 1918. In einer Museumshalle stand der ehemalige Eisenbahnwagen Marschall Fochs. Für die Waffenstillstandsverhandlungen von 1940 wurde der Wagen aus dem Museum geholt und wieder an seinen ursprünglichen Ort 1918 gerollt. Am 21. Juni 1940 war das französische Siegesdenkmal mit der deutschen Reichskriegsflagge verhüllt. Um 15.15 Uhr fuhren Hitler und die Wehrmachtführung vor, besichtigten kurz den historischen Platz und bestiegen den Salonwagen. Wenig später traf die französische Delegation, geführt von General Charles Huntziger, ein. »Man merkt der französischen Delegation [...] die Überraschung und Erschütterung, ja die Bestürzung an, als sie den freien Platz betreten und diesen weltberühmten Wagen frei vor sich sehen«, heißt es im Schriftstück des unbekannten Kriegsberichters der PropagandaKompanie 612 (BArch, RH 45/19). Die französischen Unterhändler schritten schweigend an der Ehrenkompanie 5An historischer Stelle: Deutsche Soldaten vor dem Eisenbahnwagen, in dem bereits im November 1918 ein Waffen­ stillstand besiegelt worden war. 28 Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 2/2010 BArch, RH 45/19 Compiègne, 21. Juni 1940 vorbei und betraten den Salonwagen. Dort hatten bereits Hitler, Generaloberst Wilhelm Keitel, Generalfeldmarschall Hermann Göring, Generaloberst Walther von Brauchitsch, Großadmiral Erich Raeder und Reichsaußenminister Joachim von Ribbentrop am Verhandlungstisch Platz genommen. Beim Eintritt der französischen Delegierten erhoben sich Hitler und seine Begleiter und grüßten militärisch. Nach der formellen Übergabe der Waffenstillstandsbedingungen verließen Hitler, Göring und andere Generale den Waggon. Keitel führte die Verhandlungen weiter. Unter den Klängen des Deutschlandlieds und des Horst-Wessel-Lieds schritt Hitler die Ehrenkompanie ab. Die Waffenstillstandsverhandlungen zogen sich bis in den späten Abend, bis man sich auf den nächsten Morgen vertagte. Am 22. Juni 1940 um 18.50 Uhr wurden schließlich die Vertragstexte von beiden Seiten unterzeichnet. Nina Janz Militärgeschichte kompakt 1990 Operation Catapult Namibia wird unabhängig Die Kapitulationsbedingungen von Compiègne überließen der französischen Regierung in Vichy neben Südfrankreich und den Kolonien auch die Kontrolle über die Armee und die Flotte. Das Gros der französischen Schiffe lag Anfang Juli im algerischen Mers-el-Kébir, besser bekannt als Oran. Die britische Regierung fürchtete – trotz eines gegenteiligen französischen Versprechens –, die Schiffe könnten in deutsche Hände fallen und dann im Kampf gegen das Empire zum Einsatz kommen. Daher entschied Premierminister Winston S. Churchill, den Franzosen ein Ultimatum zur Übergabe zu stellen. Den Auftrag, die französische Flotte zu übernehmen oder zu versenken, erhielt die in Gibraltar stationierte Force H unter Admiral James Somerville. Er übermittelte den Franzosen am 2. Juli drei Möglichkeiten: 1. Fortsetzung des Kampfes gegen Deutschland auf briti­ scher Seite, 2. Internierung der Schiffe in einem britischen Hafen, 3. Internierung der Schiffe in entfernten französi­ schen Kolonien in der Karibik oder in den USA. Am Morgen des 3. Juli verminten die Briten zunächst die Hafeneinfahrt von Mers-el-Kébir. Der französische Admiral Marcel Gensoul ließ das Ultimatum unbeantwortet verstreichen. Das Schlachtschiff »HMS Hood« eröffnete daraufhin das Feuer auf die Schiffe des einstmaligen Verbündeten. Das Schlachtschiff »Bretange« kenterte und sank. Die Schlachtschiffe »Dunkerque« und »Provence« wurden in flaches Wasser gesteuert, um ihr Sinken zu verhindern. Sie konnten später wieder flott gemacht werden. Dem Schlachtschiff »Strasbourg« gelang trotz der Minensperre die Ausfahrt auf die offene See. Nach unterschiedlichen Quellenangaben kamen bei dem Angriff mehr als 1000 Franzosen ums ­Leben. Die Operation gegen Oran stieß auf französischer Seite auf großen Unmut und schädigte das Verhältnis zwischen ­Vichy und London nachhaltig. Dennoch hielt die französische Flotte ihr Versprechen und lieferte sich nicht den Deutschen aus. Als die Wehrmacht im November 1942 die im südfranzösischen Hafen von Toulon liegenden Schiffe übernehmen wollte, wurden diese von ihren Besatzungen versenkt, darunter die »Dunkerque«, die »Provence« und die »Strasbourg«. ks 1990 erlangte Namibia als eines der letzten afrikanischen Länder die Unabhängigkeit. Dem ging ein jahrzehntelanger militärischer und diplomatischer Unabhängigkeitskrieg voraus. Die vormalige deutsche Kolonie Südwestafrika wurde Ende des Ersten Weltkriegs Mandatsgebiet des Völkerbundes. Mandatsmacht wurde Südafrika, das in den 1940er Jahren auch die strikten Rassentrennungsgesetze der an die Macht gekommenen burischen Nationalisten auf Namibia aus­dehnte. Als die Vereinten Nationen (UN) am Ende des Zweiten Weltkrieges das Erbe des Völkerbunds antraten, forderten sie Südafrika wiederholt auf, Südwestafrika in die Freiheit zu entlassen. Aufgrund der Weigerung wurde Südafrika 1966 das Völkerrechtsmandat aberkannt. Die 1960 gegründete South-West Africa People‘s Organisation (SWAPO), die namibische Unabhängigkeitsbewegung, wurde nunmehr als politischer Vertreter der namibischen Interessen von den UN anerkannt und führte Angriffe von angolani­ schem Boden aus. Die UN veröffentlichten eine Flut von Resolutionen, die das südafrikanische Engagement verurteilten. Jedoch erst nachdem 1978 bei einem südafrikani­ schen Luftschlag gegen ein SWAPO-Camp auf angolani­ schem Boden zahlreiche Frauen und Kinder getötet worden waren, verabschiedete der UN-Sicherheitsrat die Resolution 435. Sie forderte den Abzug der südafrikani­schen Truppen und sah die Einsetzung der United Nations Transition Assistance Group (UNTAG) vor, welche die Abhal­tung freier Wahlen überwachen sollte. Doch erst zehn Jahre später, mit dem beginnenden Abzug der kubanischen Truppen aus Angola, erklärte sich Südafrika bereit, Namibia freizugeben, sodass am 31. März 1989 die ersten UNTAG-Truppen auf dem Flughafen in Windhoek landeten. Auch die Bundesrepublik und die DDR entsandten September 1989 Polizeikontingente nach Namibia, die dort gemeinsam mit anderen Nationen sechs Monate Dienst taten. Trotz Anfangsschwierigkeiten wird die UNTAG-Mission als Erfolg gewertet, da Namibia in eine stabile Unabhängigkeit entlassen werden konnte. Seit 1990 regiert die SWAPO, durch Wahlen mehrfach demokratisch legitimiert, Namibia. Bodo Erler ullstein bild - Roger Viollet ullstein bild - Africa Media Online 3. Juli 1940 »Vergesst Oran nicht!« ­Plakat der französischen Vichy-Regierung. Die Unabhängigkeitsfeier in ­Namibia am 21. März 1990. Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 2/2010 29 Ausstellungen Peter-Strasser-Platz 3 27637 Nordholz Telefon: 04 74 1 / 18 19-13 oder -11 www.aeronauticum.de bis 24. Oktober 2010 täglich 10.00 bis 18.00 Uhr Eintritt: 6,50 Euro ermäßigt: 2,50 Euro Geschichte deutscher Luftstreitkräfte seit 1884 Luftwaffenmuseum der Bundeswehr Kladower Damm 182 14089 Berlin-Gatow Telefon: 0 30 / 36 87-26 01 www.luftwaffenmuseum.de Dauerausstellung Dienstag bis Sonntag 9.00 bis 18.00 Uhr Eintritt frei • Faßberg Bundeswehr im Einsatz Haus Schlichternheide/ Soldatenheim Große Horststraße 20 29328 Faßberg Telefon: 0 50 55 / 17 25 03 Bw: 90-2566-2503 12. August bis 19. September 2010 täglich 8.00 bis 16.00 Uhr Eintritt frei • Großbeeren Preußische Traditionen Privatmuseum Preußische Traditionen Berliner Straße 123 c 14979 Großbeeren Telefon: 033701 / 559 49 oder 0172-527 45 86 Führungen und Veran­staltungen nach Absprache • Herne AufRuhr 1225! Ritter, Burgen und Intrigen LWL-Museum für Archäologie Westfälisches Landes­ museum Europaplatz 1 44623 Herne Telefon: 02 32 3 / 94 62 80 www.lwl-landesmuseumherne.de bis 28. November 2010 Dienstag bis Sonntag 9.00 bis 17.00 Uhr (Wochenende ab 11.00 Uhr) Eintritt: 3,50 Euro ermäßigt: 2,00 Euro 30 • Prora • Kummersdorf Dauerausstellung zur NVA-Geschichte Ständige Ausstellung Objektstraße Block 3/ und Geländeführungen Treppenhaus 2 Historisch-Technisches 18609 Prora Museum Telefon: Versuchsstelle 03 83 93/ 32 69 6 Konsumstraße 5 http://www.kulturkunst 15838 Am Mellensee, statt.de/nva.html OT Kummersdorf-Gut Ganzjährig täglich Telefon: 03 37 03 / 7 70 48 geöffnet www. Eintritt: 6,50 Euro museumkummersdorf.de ermäßigt: 3,50 Euro Sonntag 13.00 bis 17.00 Uhr Führungen nach Anmeldung • Seelow • Ludwigsburg Unter dem Takt- und Tambourstock – Militärmusik in Württemberg im Wandel der Zeit Garnisonmuseum Ludwigsburg Asperger Straße 52 71634 Ludwigsburg Telefon: 0 71 41 / 9 10 24 12 www.garnisonmuseumludwigsburg.de bis 19. Dez. 2010 Mittwoch 15.00 bis 18.00 Uhr Sonntag 13.00 bis 17.00 Uhr (und auf Anfrage) Eintritt: 2,00 Euro ermäßigt: 1,00 Euro • Nordholz Claus Schenk Graf v. Stauffenberg AERONAUTICUM Deutsches Luft­ schiff- und Marine­ fliegermuseum Die Schlacht um die Seelower Höhen im April 1945 Gedenkstätte/Museum Seelower Höhen Küstriner Straße 28a 15306 Seelow Telefon: 0 33 46 / 5 97 www.gedenkstaetteseelowerhoehen.de Dauerausstellung Dienstag bis Sonntag 10.00 bis 16.00 Uhr Eintritt: 3,00 Euro ermäßigt: 1,50 Euro Militärgeschichte Zeitschrift für historische Bildung Vorschau Die Jahre 1989/90 markieren das Ende des Ost-West-Konfliktes. Seither hat sich die sicherheitspolitische Lage der Bundesrepublik Deutschland stark verändert. Aus den zwei Armeen im Kalten Krieg wurde die eine dras­ tisch reduzierte Armee im weltweiten Einsatz. Rudolf J. Schlaffer blickt auf das 20-jährige Jubiläum der Armee der Einheit zurück und skizziert wichtige Meilensteine jüngster deutscher Militärgeschichte. Thomas Lindner stellt eine der blutigsten Schlachten des 18. Jahrhunderts vor. Am 3. No­ vember 1760 wollte Friedrich II. mit seiner 58 500 Mann starken Armee bei Torgau den Zusammenschluss der österreichischen und der Reichsarmee verhindern. Daher griff er die Österreicher in Stärke von 52 000 Mann an. Erst um neun Uhr abends stand sein Sieg fest. Auf preußischer Seiten fielen über 16 700 Soldaten, die Öster­reicher hatten 15 200 Tote zu beklagen. Helmut Rübsam leistet mit seinem Artikel über die Planungen zum Angriff auf den Suez­kanal im Ersten Weltkrieg einen Beitrag zum Verständnis der geostrategischen Gesamtsituation eines Konfliktes. Der Suez­ kanal war die Lebensader des britischen Empire und der wichtigste Verbindungsweg zur Kronkolonie Indien. So verwundert es nicht, dass das Deutsche Reich und das mit ihm verbündete Osmanische Reich den Kanal angreifen wollten. Klaus Storkmann schließlich berichtet von der Anwendung des »Chinesischen Prinzips« in der Nationalen Volksarmee (NVA) der DDR. Ranghohe Offiziere mussten in der chinesischen Volksbefreiungsarmee für eine bestimmte Zeit als einfache Soldaten Dienst tun. In ihrer Frühzeit übernahm die NVA dieses System. hp • Wünsdorf/Zossen »Russischer Soldatenalltag« Garnisonsmuseum Wünsdorf Gutenbergstraße 9 15806 Zossen Telefon: 03 37 02 / 65 4 51 www.garnisonsmuseumwuensdorf.eu Dauerausstellung Montag bis Sonntag 10.00 bis 18.00 Uhr Eintritt: 2,50 Euro Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 2/2010 MHM Dresden • Berlin Heft 3/2010 Service 5SED-Chef Walter Ulbricht und der 1959 als Matrose dienende Konteradmiral Felix Scheffler. Militärgeschichte im Bild 14. Juli 1994: Deutsche Schützenpanzer auf französi­scher Militärparade A picture alliance/dpa n der traditionellen Militärparade zum französischen Nationalfeiertag nahmen 1994 auch erstmals deutsche Soldaten mit ihren Schützen­ panzern des Typs Marder teil. Paraden dienen nicht nur der Präsentation militärischer Macht. Sie sind zugleich Ausdruck staatlicher Souveränität. Die Bundesrepublik Deutschland hat sich bislang dieses Zeremoniells enthalten. Bis zum Inkrafttreten des »Vertrages über die abschließende Regelung in Bezug auf Deutschland«, des Zweiplus-Vier-Vertrages, am 15. März 1991 war die Bundesrepublik Deutschland ohnehin nur eingeschränkt souverän. Angesichts des Missbrauchs militärischen Prunks während der nationalsozialistischen Diktatur galt seit den Anfängen des westdeutschen Verteidigungsbeitrages Zurückhaltung im militärischen Zeremoniell geradezu als Markenzeichen einer Bundeswehr »ohne Pauken und Trompeten«. Es ist indes kein Zufall, dass die erstmalige Teilnahme deutscher Panzer des Eurokorps an der nationalen französischen Parade ausgerechnet 1994 stattfand. Am 1. Oktober 1993 war aufgrund eines Beschlusses auf dem deutsch-französischen Gipfeltreffen von La Rochelle vom 22. Mai 1992 das Eurokorps gegründet worden. Einen Monat später wurde es in der »Europastadt« Straßburg der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Einrichtung eines deutsch-französischen Verteidigungsund Sicherheitsrates (1987) und der deutsch-französischen Brigade (1989) ebneten den Weg dorthin. Gleichzeitig endete vertragsgemäß im selben Jahr die sowjetische Militärpräsenz auf deutschem Boden: Am 25. Juni 1994 hatten sich die russischen Streitkräfte mit einer Parade in Berlin aus Deutschland verabschiedet. Am 12. Juli bestätigte das Bundesverfassungsgericht im »Out-of-area-Urteil« die Verfassungsmäßigkeit des Einsatzes deutscher Truppen außerhalb des NATO-Gebietes. Diese Entscheidung wiederum stand in engem Zusammenhang mit der Entwicklung des Krieges in Bosnien-Herzegowina: Zum Schutz der belagerten bosnischen Hauptstadt Sarajevo hatte die NATO im April einen Kreis von 20 Kilometern um die Stadt zur Sperrzone erklärt. Deren Einhaltung sollte notfalls mit Waffengewalt erzwungen werden. Die Parade im Juli 1994 in Paris fand also einerseits zu einem Zeitpunkt statt, als die Bundesrepublik Deutsch- land die militärische Souveränität erlangte, andererseits zeigte sie aber auch, dass Deutschland die Souveränität nur im Verbund mit seinen europäischen Partnern hatte erreichen können. Nationale Alleingänge sollten ein für allemal der Vergangenheit angehören. Der deutsch-französischen Aussöhnung und Freundschaft kommt in diesem Zusammenhang eine Schlüssel­ funktion zu. Nicht umsonst sind sie seit der Regierungszeit Konrad Ade­ nau­ers unverzichtbarer Bestandteil der bundesdeutschen Staatsraison. Die Symbolik an diesem Julitag hätte stärker nicht sein können: Die deutschen Panzer rollten die Champs Elysées entlang, umrundeten den Arc de Triomphe (Triumphbogen). Dieser war 1806 nach der Schlacht von Austerlitz errichtet worden. Der Sieg Kaiser Napoleons I. bei der sogenannten Dreikaiserschlacht hatte dem Heiligen Römischen Reich deutscher Nation den Todesstoß versetzt. Unterhalb des Triumphbogens befindet sich der Sarg des unbekannten Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg mit der »flamme de souvenir« (Flamme der Erinnerung). Dort findet traditionell am 11. November, dem Tag des deutsch-französischen Waffenstillstandes von 1918, eine eindrucksvolle Gedenkfeier statt. Der Platz ist nach dem französischen General, Präsidenten und Wegbereiter deutschfranzösischer Freundschaft, Charles de Gaulle, benannt. Die Bilder zeigen die deutschen Schüt­ zenpanzer vor dem Arc de ­Triomphe. Als nationales Hoheitszeichen tragen die Marder das 1813 anlässlich der Befreiungskrieg gestiftete und 1870/71 sowie in den beiden Weltkriegen jeweils neu aufgelegte Eiserne Kreuz. Und im Hintergrund wehen »les couleurs«, die blau-weiß-rote französische Trikolore. Agilolf Keßelring Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 2/2010 31 rieges n. Vor mögli­ digung an der nz be­ streit­ analy­ r DDR ng auf e Vor­ Hüter des Luftraumes? samt NEUE PUBLIKATIONEN DES MGFA Julian-André Finke Hüter des Luftraumes? Die Luftstreitkräfte der DDR im Diensthabenden System des Warschauer Paktes Julian-André Finke d 18 Julian-André Finke, Hüter des Luftraumes? Die Luftstreitkräfte der DDR im Diensthabenden System des Warschauer Paktes. Hrsg. vom MGFA, Berlin: Ch. Links 2010, XII, 395 S. (= Militärgeschichte der DDR, 18), 34,90 Euro, ISBN 978-3-86153-580-5 n in den es äußeeinander uhen als union im ndesverriegfühistoriker ste aus A dieses Militär und Staatssicherheit im Sicherheitskonzept der Warschauer-Pakt-Staaten Hrsg. von Torsten Diedrich und Walter Süß Militär und Staatssicherheit im Sicherheitskonzept der Warschauer Pakt Staaten. Im Auftrag des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes und der Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR hrsg. von Torsten Diedrich und Walter Süß, Berlin: Ch. Links 2010, X, 371 S. (= Militärgeschichte der DDR, 19), 34,90 Euro, ISBN 978-3-86153-610-9 ichte.de erlag.de 04.06.10 16:20 Militärgeschichtliches Forschungsamt MGFA Eine aktuelle Übersicht zu den Publikationen des MGFA bietet das Gesamtverzeichnis der Veröffentlichungen 2010. Interessenten erhalten es auf Wunsch kostenlos zugesandt. Gesamtverzeichnis der Veröffentlichungen 2010 Abonnement Jahresabonnement: 14,00 Euro inkl. MwSt. und Versandkosten (innerhalb Deutschlands, Auslandsabonnementpreise auf Anfrage) Kündigungsfrist: 6 Wochen zum Ende des Bezugszeitraumes. Kontakt: mt es Forschungsa h ic tl h ic h sc e rg Militä erger stine Mauersb m ri h C u ra F . d H z. da 22, 14471 Pots Postfach 60 11 99, Fax: 0331/9714 509 45 Tel.: 0331/971 [email protected] Ma Mail: Christine N ber die Firma SK ü t lg fo er ts en rden, es Abonnem Die Betreuung d ellmacher Straße 14, 26506 No ird. w , St Druck und Verlag ressenten in Verbindung setzen te In die sich mit den www.mgfa.de www.mgfa.de nd 19 ngsamt Militär und Staatssicherheit im Sicherheitskonzept der Warschauer-Pakt-Staaten rlag.de