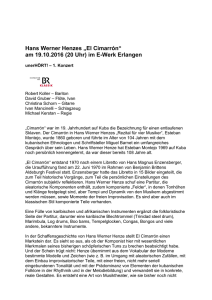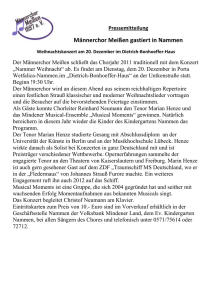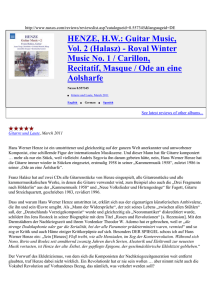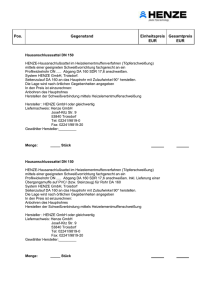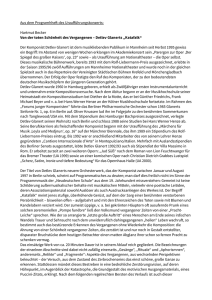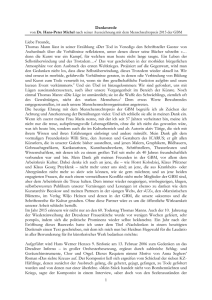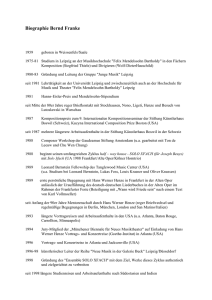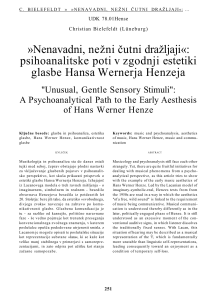41 Über Hans Werner Henze I. Menschenstimmen - Laaber
Werbung
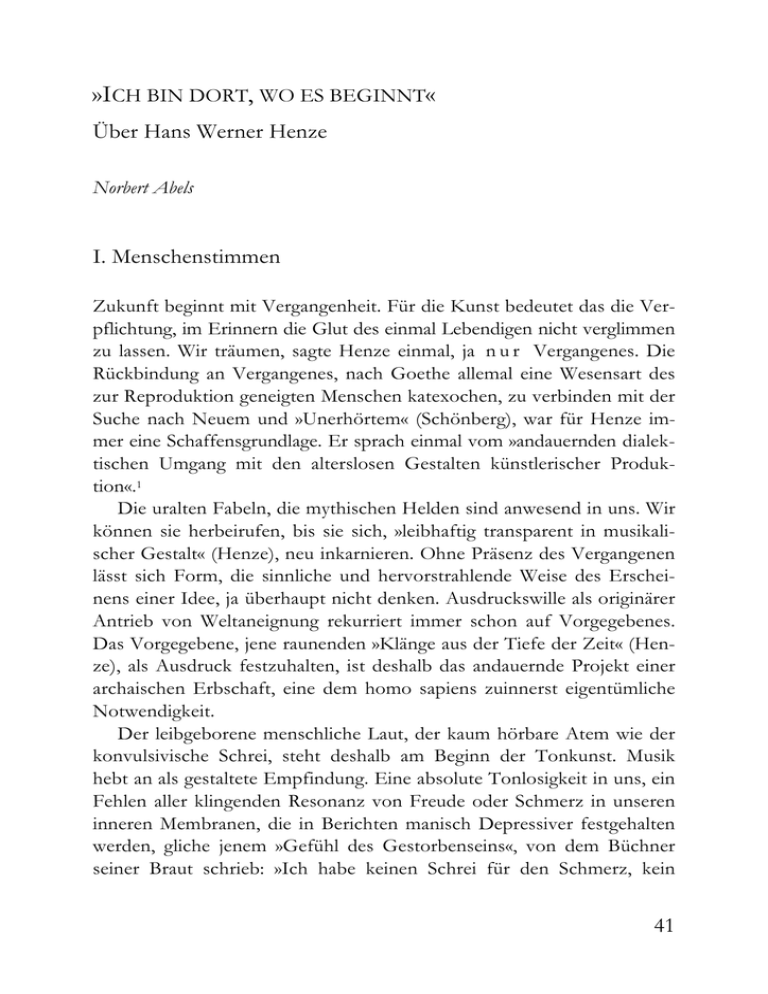
»ICH BIN DORT, WO ES BEGINNT« Über Hans Werner Henze Norbert Abels I. Menschenstimmen Zukunft beginnt mit Vergangenheit. Für die Kunst bedeutet das die Verpflichtung, im Erinnern die Glut des einmal Lebendigen nicht verglimmen zu lassen. Wir träumen, sagte Henze einmal, ja n u r Vergangenes. Die Rückbindung an Vergangenes, nach Goethe allemal eine Wesensart des zur Reproduktion geneigten Menschen katexochen, zu verbinden mit der Suche nach Neuem und »Unerhörtem« (Schönberg), war für Henze immer eine Schaffensgrundlage. Er sprach einmal vom »andauernden dialektischen Umgang mit den alterslosen Gestalten künstlerischer Produktion«.1 Die uralten Fabeln, die mythischen Helden sind anwesend in uns. Wir können sie herbeirufen, bis sie sich, »leibhaftig transparent in musikalischer Gestalt« (Henze), neu inkarnieren. Ohne Präsenz des Vergangenen lässt sich Form, die sinnliche und hervorstrahlende Weise des Erscheinens einer Idee, ja überhaupt nicht denken. Ausdruckswille als originärer Antrieb von Weltaneignung rekurriert immer schon auf Vorgegebenes. Das Vorgegebene, jene raunenden »Klänge aus der Tiefe der Zeit« (Henze), als Ausdruck festzuhalten, ist deshalb das andauernde Projekt einer archaischen Erbschaft, eine dem homo sapiens zuinnerst eigentümliche Notwendigkeit. Der leibgeborene menschliche Laut, der kaum hörbare Atem wie der konvulsivische Schrei, steht deshalb am Beginn der Tonkunst. Musik hebt an als gestaltete Empfindung. Eine absolute Tonlosigkeit in uns, ein Fehlen aller klingenden Resonanz von Freude oder Schmerz in unseren inneren Membranen, die in Berichten manisch Depressiver festgehalten werden, gliche jenem »Gefühl des Gestorbenseins«, von dem Büchner seiner Braut schrieb: »Ich habe keinen Schrei für den Schmerz, kein 41 Jauchzen für die Freude, keine Harmonie für die Seligkeit. Dies Stummsein ist meine Verdammnis.«2 Die dem inneren Tonempfinden komplementären Werkzeuge sind späteren Datums, verwurzelt und tradiert bereits in Kulturgeschichte. Instrumentalmusik geht deshalb aus Vokalmusik hervor. In diesem Sinne war es für den die mannigfaltigsten Genres der Klangwelt auslotenden Komponisten Henze immer axiomatisch, dass am Anfang buchstäblich das Wort war. »Reine Musik«, unabhängig vom menschlichen Wahrnehmungsraum, vermochte ihm einzig eine spekulative, wohl eigentlich nur fiktive Größe zu sein. Henze wagte in seiner musikgenealogischen ›comédie humaine‹ ein durchaus radikal formuliertes Wort: »Auf mich wirken Symphonik und Kammermusik wie Konzepte und Formen einer Vokalmusik ohne Menschenstimmen, sie sind instrumentale Gesangsszenen, Arien, Motetten und Kanzonen. Ich höre den Gesang von Instrumenten, höre Geschrei, Wimmern, Heulen und Zähneklappern, Schmeicheln, Schnurren, Flüstern, es wird gedroht, beschwichtigt, alles wortlos, aber doch ganz eloquent und, wie ich denke, unmißverständlich.«3 Henze erinnerte sich gelegentlich an Paul Valerys These, wonach der mit dem Sprechen nicht auskommende Mensch zu singen beginnt. Musik, verstanden nicht nur als Desiderat des Wortes, sondern als dessen Transzendierung in eine tiefere semantische Dimension, kompensiert demnach einen Mangel. Im lyrischen Werk mögen beide Sphären zum Ausgleich gelangen, was Valery so formulierte: »Das Gedicht – dieses ausgehaltene Zögern zwischen Klang und Sinn«.4 Es kann aber auch geschehen, wie Henze in einer grausamen Metaphorik notiert, dass der Ton sich das Wort ganz einverleibt, dass die Musik »nach Art der Gottesanbeterin den Text, die Wörter, die Syntax während des Koitus langsam mit Haut und Haaren verzehrt, bis nichts übrigbleibt als vereinzelte Silben, Vokale, Konsonanten«.5 II. Theater Der Mensch, nach Schillers berühmtem Axiom nur da ganz Mensch, wo er spielt, steht in der Mitte von Henzes Ästhetik. Es ist eine Ästhetik der 42 Bühne und wo anders als im Theater gerät das Schiller’sche Axiom erst zur vollkommenen sinnlichen Darstellung. »Ich komme vom Theater her«, bekannte Henze einmal kategorisch. Kaum ein zweiter Komponist der zurückliegenden sieben Jahrzehnte mag als Analogon anzuführen sein, wenn es um eben diese tiefe und von Beginn des künstlerischen Schaffens an elementare Affinität geht. Henzes erster und unablässig reklamierter Anspruch an die Theaterkunst zielt auf deren unabdingbare Kompromisslosigkeit. Hierin einig mit Schönberg, von dem das Bonmot stammt, wonach der Mittelweg der einzige ist, der nicht nach Rom führt, gilt ihm jede Art von gekonnter Formkonservierung als Hindernis der dem produktiven Akt immanenten Entäußerung. Alles kommt darauf an, dass das Wissen um das Vergangene, dem das je Neue entwächst, nicht petrifiziert zum Monument der Anbetung. Es muss vielmehr zum Material transformiert werden, das dem ästhetischen Anspruch der jeweils gegenwärtigen Grenzüberschreitung dient. Henze bewahrte sich dabei stets vor dem Anathem gegen jede Anverwandlung des Vergangenen, rühmte vielmehr beherzt die Schönheit der alten Jahrhunderte: »Sich mit ihnen verbunden fühlend, will eine neue Theatergeneration ihren eigenen Schönheitsbegriff nach vorn tragen, von Schmerzerfahrung erfüllt, wissend, aber doch tastend, ahnend, suchend, von einem brennenden Verlangen nach der vollkommenen Gestalt getragen«.6 Henzes neben seiner Passion für das Poetische stehende Theaterobsession versteht es, virtuos auf der Klaviatur der Bühne zu spielen, setzt in unvergleichbarer Effektkenntnis das dramaturgische Instrumentarium in Gang, erweist sich ganz und gar als »wirklich meine Domaine, weil Zauberei, Magie, Maskerade, Exklamation, Pathos und Bouffonade sich mir auf eine Weise zu der Musik gesellen, die es ermöglicht, die ›Richtung‹, in die das Leben läuft, zu verdeutlichen«.7 Die 1996 erschienene Autobiographie Reiselieder mit böhmischen Quinten ist so prall gefüllt von Erlebnissen und Erfahrungen, Leidenschaften und Reflexionen, Freuden und Schmerzen des Theaterlebens, das man sich nur schwer vorzustellen vermag, wie ein dieser Welt nicht Verfallener die ihr von Henze attestierte ungeheure Wirkungsmacht nachvollziehen kann. Das von Freiheit kündende Trompetensignal im Fidelio, dessen Einsatz der noch nicht einmal zwanzigjährige Komponist, positioniert an 43 der Seitenbühne des Bielefelder Stadttheaters, im Spätherbst 1945 dem unsichtbaren Blechbläser zu geben hatte, markiert einen geradezu programmatischen Auftakt seiner bis zum heutigen Tage andauernden theatralischen Sendung, die sich immer auch als politischer Nonkonformismus verstand. Unvergessen blieb ihm seine Präsenz während Brechts Zusammenarbeit mit Paul Dessau und Caspar Neher bei Lenzens Hofmeister. Das Erlebnis von »Freundlichkeit und Demokratie« widerfuhr ihm erstmals in der Welt der Bühne. Das Theater war Henzes Schule der Humanität und seines jedem künstlerischen Elitarismus abschwörenden Verzichts auf einen menschenfremden Ästhetizismus etwa von der Art, wie er ihn später in Elegie für junge Liebende messerscharf in der Figur des Dichters Gregor Mittenhofer gestalten sollte. Noch 2009 insistierte Henze ungeachtet aller ihm errichteten Ruhmesportale auf jenen demokratischen Primat: »Ich wollte immer bei den Menschen sein, im Leben der Menschen und nicht am Rande mit vornehmen Abwendungen. […] Das Verweilen im Elfenbeinturm missfällt mir. […] Jeder Mensch verdient Hochachtung, Sympathie und Aufmerksamkeit. Der Mensch ist ein Wunderwerk.«8 III. Panoptikum Die »großen Dinge der Menschen sind einfach, sehr klar und einfach«, heißt es in einem Brief des jungen Komponisten aus dem Jahre 1947. Darin schildert sich der aufrichtige Absender nicht ganz ohne romantische Ironie als einen Menschen, »der Tiere und Blumen und die Wolken liebt«. Schon wenige Zeilen später aber kommt es zum depressiven Absturz ins Bodenlose und zur Erkenntnis der Eitelkeit allen Schaffens: »Der Globus rollt, an sich sind wir nur fünfzig Kilo Atome und sonst den Ameisen gleich. Faule Schweine, die sich ernst nehmen.« – Zwischen diesen Polen anrührender Weltbejahung und bis zum Selbstauslöschungsversuch gehendem Daseinszweifel entsteht das Werk des deutschen und zugleich immer auch kosmopolitischen Künstlers Hans Werner Henze. Da erklingen beizeiten die Stimmen des ihn bis tief 44 in sein Alterswerk noch begleitenden ›Weltfreundes‹ Franz Werfel in der frühen Konzertarie Der Vorwurf von 1948 und auch die Stimmen von dessen pantheistisch gestimmten Idol Walt Whitman, des die Welt singenden amerikanischen Poeten in der Kantate Whispers from Heavenly Death. Gleichwohl strömen von Anfang an verzweifelte und dunkle Laute in diese Helle. Mit den Improvisationen auf die gottverlassenen herbstlichen Untergangstexte Georg Trakls beginnt dies, setzt sich fort in den labyrinthischen Tanzphantasien über das Theseusmotiv, um einzumünden in den trostlosen Ausblick am Schluss der ersten großen vollendeten Oper Boulevard Solitude, der dem alten Manon-Lescaut-Thema der unumkehrbaren Liebesverfallenheit das zentrale und für das nächste halbe Jahrhundert bestimmende Orpheusmotiv folgen lässt. Ein öder, grauer und eisiger Wintertag begleitet darin noch das Loslassen dieser letzten mythologischen Identifikation. In einem von zwölf Soloinstrumenten angestimmten, zutiefst expressiven zwölftönigen Akkord oszilliert für einen knappen Augenblick ein versteckter C-Dur-Pedalklang. Die Polarität von Ja und Nein formiert sich wiederum. Vorausgegangen sind die Worte des in der großen Stadt Paris untergegangenen jungen Studenten Armand, der sich nun in aller Bewusstheit von seinem mythologischen Modell Orpheus verabschiedet; einer jener Verlorenen und sich nicht mehr Suchenden, die vor dem Hintergrund des kollektiven Weltabsturzes und Untergangsszenarios ohne Weg, ohne Leit- und Vorbild, ohne jedes Programm in der Leere einfach fortexistieren. »Henzes erste Oper entstand in der Stimmung einer bewußt zum Lebensprinzip erhobenen Plan- und Ziellosigkeit des jungen Komponisten. ›Einfach in den Tag hinein – von mir aus hätte das für immer so weitergehen können‹, heißt es über diese Zeit in der Mitte der neunziger Jahre verfaßten Autobiographie Reiselieder mit böhmischen Quinten. Henze las nun endlich, was in den zwölf Jahren der braunen Barbarei von der Proskription des Geistes betroffen war: Heinrich Heine, Thomas Mann, Franz Kafka, aber auch erstmals Autoren wie Gide und Hemingway. Entdeckt wurden jetzt außenseiterische Nonkonformisten wie Artaud und Genet. Es war ein Genuß, nach der alle Kräfte paralysierenden teutonischen Weckglasathmosphäre die Außenwelt zu erfahren, zu entdecken, daß es ein Leben gab jenseits der Trümmerhaufen. Systemphobie: Unter diesen apodiktischen Begriff kann Henzes damalige Sicht gerückt werden. Parallel zur Entstehung der Oper freilich vollzog sich langsam aber unaufhaltsam die Restaurationsmechanik der Adenauer-Ära, entwickelte sich das Klima der Ver- 45 drängung, wurde ›Wiedergutmachung‹ als finanzielles Äquivalent des grausamsten Genozids vorgestellt, gelangten ehemalige SS-Größen in Konzernvorstände, avancierten einstige Nazi-Demagogen zu Universitätslehrern und gestern noch antisemitische Filmemacher zu Exponenten einer neuen fragwürdigen Unterhaltungsindustrie.«9 Das Nichts, das sinnentleerte Vakuum zwischen Zusammenbruch und Neuerwachen interessiert den jungen Henze: »Ich schreie nicht mehr. Mit leeren Händen warte ich darauf zu sterben. Auch nicht Orpheus, der Arme, von den Mänaden zerfleischte, bin ich mehr. Die Lichter sind verloschen […] Ich wollte, ich wäre blind, denn die Welt ist mir verloren. Vom grauen Himmel fällt langsam in dichten Flocken der Schnee.« – Henzes früher Weg wird von Ausbruchsversuchen bestimmt. Zunächst die Befreiung aus der väterlichen und totalitären Umklammerung, der Zitadelle einer am Ende vollständig heruntergekommenen – um mit Thomas Mann zu reden – »machtgeschützten Innerlichkeit«; dann freilich die Entdeckung der Mischklänge der großen Städte; hernach, wenngleich stets noch am Anfang des Weges, das Abrücken von den Schulen, das Misstrauen gegen vorgegebene Ordnungskampagnen auch im ästhetischen Raum. Bei der Uraufführung der Nachtstücke und Arien nach Texten der geliebten Ingeborg Bachmann, der Schwester in Apoll – »ein Blatt, das uns traf, treibt auf den Wellen bis zur Mündung uns nach« –, kommt es zum geplanten und durchaus pubertären Eklat. Die Darmstädter Schule der Pflichtseriellen mutiert zum Tribunal »und es trat so eine Art Bann in Kraft.«10 Bereits nach den ersten Takten springen die Kollegen Nono, Boulez und Stockhausen – der wohl extremste Einheizer – von ihren Plätzen auf, um ostentativ den Saal zu verlassen. Henzes mutmaßlicher Eklektizismus, sein ebenso fingierter, weil gänzlich missverstandener Traditionalismus geraten in den nächsten Jahrzehnten zur stereotypen Verdammungsformel. Für die Exponenten von Donaueschingen und Darmstadt, deren eigene Musik im Rückblick vom Mehltau der Historie nicht eben unbeladen erscheint, firmierte Henze nunmehr als Verräter am erreichten Stand der musikalischen Materialbeherrschung. Ihn focht solches indessen nicht lange mehr an. Sein eigener Weg mochte ihm nach Jahren der Selbst- und Ausdruckssuche nun entschieden und bewusst vor Augen zu stehen. Er führte ihn mit großer Gravitationskraft, immer wie- 46 der flankiert von den großen sinfonischen und kammermusikalischen Expeditionen, unaufhaltsam zum Musiktheater. Dessen bedeutendster Gegenwartskomponist ist er nun. Das Bekenntnis zur Kraft- und zur Expressionsvielfalt der menschlichen Stimme behauptet sich bis zum heutigen Tage ungebrochen. Henze machte sich früh auf zum Ursprungsland der Kunstform Oper, zog nach Italien, entdeckte dort Monteverdis Urheberschaft und verneigt sich in unzähligen Facetten bis in die unmittelbare Gegenwart hinein vor dessen wahrhaft revolutionärer Emanzipation der vox humana. Noch in einer Bemerkung zur im Spätsommer 2007 uraufgeführten Konzertoper Phaedra heißt es: »Mein Grundstück, mein Olivengarten, mein Weinberg, das sind Dinge, die mit der Geschichte dieser Landschaft zu tun haben, und die auch mit mir was zu tun haben. […] Es könnte sein, dass ich aus dem Fenster schaue und es geht gerade Hippolytos mit seinen Pferdefuhrwerken vorbei und grüßt.« – Das Panoptikum der Gestalten, Formen und Situationen in Henzes Opern und Balletten – und es sind tatsächlich und ausdrücklich Opern und Ballette – offenbart sich bevölkert von Suchenden, Irrenden, Scheiternden, Geopferten. Der Student Armand eröffnet den Reigen all dieser bis zu Hippolytos reichenden Figuren seines Theaters. Man vermeint sie bisweilen horizontal, in einer Linie stehend wahrzunehmen, und man muss sich davor hüten, den gestalterischen Wandel, den Henze seit den ersten Nachkriegsjahren durchmessen hat, dabei zu vernachlässigen. Plötzlich erscheint da neben dem schwermütigen Fürsten Myschkin und neben dem Prinzen von Homburg, der sich selbst halb wachend, halb schlafend den Lorbeerkranz windet, der dreizehnjährige Knabe Noburu aus dem viel späteren Verratenen Meer, der die Ordnung der Erwachsenen zertrümmern will. IV. Figuren Homburg, Myschkin und Noburu? Das sind nur gerade drei von all den zahlreichen Gestalten des Komponisten, die von der Wirklichkeit eingeholt werden und hier als Beispiele angeführt werden sollen. Es sind alle- 47 samt wirklichkeitsscheue Illusionisten und Träumer. »Fürst Christus«: so nannte Dostojewski den gegen das Aktivitätskommando und den Fortschrittsfetischismus des Westens gestellten Helden seines Romans. Myschkin, der Idiot, ist der unschuldige Mensch par excellence. Dem von der Gesellschaft als ewig außenstehender Narr belächelten Epileptiker aber gelingt es als einzigem Menschen, das Schöne als ethische Kategorie zu leben. In seinen Konvulsionen wird die ewig lastende seelische Dunkelheit unversehens vom Aufflammen einer höheren Wirklichkeit abgelöst: »Das bisher unbekannte und ungeahnte Gefühl des Lebens, das Bewusstsein seiner selbst, der Versöhnung und der leidenschaftlichen religiösen Vereinigung mit der höchsten Synthese des Lebens.« Ingeborg Bachmann, der Henze 1952 bei einer Tagung erstmals begegnet war und sogleich eine starke Nähe zu der jungen Lyrikerin verspürte, schrieb 1953 eine neue Textfassung des Mimodrams um Dostojewskis einsamsten Helden. Die Uraufführung der ersten Fassung nach einer Idee von Tatjana Gsovsky war mit dem Bühnenbild Jean-Pierre Ponelles (Titelpartie Klaus Kinski) bereits 1952 anlässlich der Berliner Festwochen über die Bühne gegangen. Ingeborg Bachmanns Fassung, die sich inzwischen durchgesetzt hat, wurde 1960 erstmals aufgeführt. Die letzten, von tiefster poetischer Kraft kündenden Worte daraus lauten: »In den Strängen der Stille kommen die Glocken zur Ruhe, es könnte der Tod sein, so komm, es muß Ruhe sein.« Wer erspäht utopisches Licht am Schluss des Kleist’schen Prinz von Homburg? Wer vermag zu jubeln, wenn dort kollektiv angestimmt wird: »In Staub mit allen Feinden Brandenburgs!«? Wie kehrt man die so preußisch-deutsche Dialektik von Traum und Politik, von trancehafter Innerlichkeit und aggressivem Größenwahn hervor? In Henzes dreiaktiger Oper (Uraufführung 1960) wird das Familiendrama, die Keimzelle der staatlichen Tragödie, in das Zentrum gerückt. Ein moderner, tief in Romantizismus getauchter Held, der das persönliche Empfinden, die Willkür und die nervöse Anwandlung über alles andere setzt und trotz aller Heldenredensarten eben doch kein eigentlicher Held sei: So porträtierte 1872 Theodor Fontane missbilligend den Prinzen von Homburg. Das Hauptärgernis in dieser Charakterisierung war das unpreußische und deshalb anstößige Furchteingeständnis, das ein 48 knappes halbes Jahrhundert später Kaiser Wilhelm II. (»wenn nur die fatale Feigheitsszene nicht wäre…«) einfach streichen wollte. Als ihm daraufhin bedeutet wurde, dass dem Stück durch diese Willkür ein Angelpunkt ausgebrochen würde, fragte er nach einer kleinen, von Erstaunen bestimmten Stille kurz: »Wieso?« In der Beantwortung dieser Frage liegt die gleichnishafte Kraft des Stückes und damit auch dessen von Henze und Bachmann erkannte Modernität: die Stärke der Schwäche. Kleist wusste um die Dialektik von Machtgier und Selbstpreisgabe, von staatlicher Ordnung und inwendiger Anarchie, obgleich er ihr mit seinem paradoxen Streben, Offizier und Dichter zu sein, gleichsam ein träumender Kriegspoet, selbst unterlag. Die Lebensunrast, der die Ordnung und die Strenge des Werkes gegenübersteht, zeugt hiervon ebenso wie der penibel und als Selbsthinrichtung inszenierte gemeinsame Tod mit der Geliebten am Wannsee. Am deutlichsten jedoch offenbart sich diese Dialektik am abgründigsten Ort des Dichters: in der Sprache. Sie war mit all ihrer vergeblichen Ausdrucksanstrengung die verräterischste Signatur des unterdrückten Leibes. In ihr vollzog sich der Gegensatz von geordnetem Aufmarsch und aufgelöster Flucht, Aggressivität und Passivität, zufügendem und hingenommenem Schmerz. Genau hierauf zielten Komponist und Librettistin. Sie wussten: Hinter Kleists juridisch-umständlichem und zugleich messerscharfem Duktus lauerte die Drohung vollständiger Selbstauflösung des von der Norm abweichenden Individuums – ein zentrales Thema in Henzes Œuvre. Die mit Militärmetaphern übersäten Sätze, der martialische Tonfall, entsprachen genau der aggressiven Funktion, die Heinrich von Kleist den Worten zugewiesen hat: »…überhaupt wird jeder, der bei gleicher Deutlichkeit, geschwinder als sein Gegner spricht, einen Vorteil über ihn haben, weil er gleichsam mehr Truppen als er ins Feld führt.« Nicht nur das Wort, auch die Liebe zeigt sich in solchem Zusammenhang. Natalie, zunächst erotisches Wunschbild aus des Prinzen Ruhmestraum, ist zugleich – wie Königin Luise – Chefin eines Dragonerregiments. Im Stück fällt beim Wunschtraum des Prinzen der militärische Sieg mit der Liebeserfüllung zusammen. Vorausgenommen aber wird dies in der Pantomime am Anfang des Schauspiels, wenn der Prinz, halb wachend, halb schlafend, den Lorbeerkranz windet. 49 Henzes dreiaktige Oper spürt neben der Zeit Kleists, dem außer Rebellen und Rebellionen ein neuer Opernstil entsprungen ist, auch der Sprache des Dichters nach. Der Versuch, der geballten Kleist’schen Sprache, »welche die Singstimmen in die Höhe zu treiben scheint«, kompositorisch zu entsprechen, richtete sich konsequent auf die in dieser Sprache erscheinende Dialektik von Herrschaft und Weltflucht, auf die große Spannung, die »im Zusammenwirken von Seidigem und Stählernem« (Henze) liegt. Er stellte die Normverletzung als Stärke der Schwäche heraus, mit der die Zersetzung des klassischen Heldenideals einhergeht. Henzes ästhetische Unternehmung, mit der Musik das Wort zu durchleuchten, um es schließlich in jene Höhe zu heben, in der es anfängt zu tönen, war nur möglich durch die wortmusikalische Umwandlung der Dichtung Kleists durch Ingeborg Bachmann. Ein unvergleichbarer Glücksfall in der Geschichte des Verhältnisses von Wort und Ton! Und Noburu, der vaterlose, von sexuellen Nöten heimgesuchte, pubertierende Knabe? Henze interessierte die Qual der Selbstsuche. In Yukio Mishimas Autobiographie Geständnis einer Maske heißt es: »Zu einem Teil meines von Kindheit an geübten Selbsterziehungssystems gehörte es, dass ich mir ständig sagte, es wäre besser zu sterben, als eine laue, unmännliche Persönlichkeit zu werden.« Mit seinem öffentlich angekündigten Seppuku im November 1970 bekräftigte der inzwischen zu Weltruhm gelangte Autor diese Lebensmaxime. Kurz zuvor hatte er den Todesgedanken als »die süßeste Mutter meiner Arbeit« apostrophiert. Auch Mishimas 1963 erschienener Roman Gogo No Eiko (Der Seemann, der die See verriet) handelt vom dialektischen Verhältnis von Selbstbehauptung und Todesbewusstsein. Hinter der Großstadtgeschichte, deren japanischer Hintergrund nur die Folie eines universellen und parabolischen Geschehnisses bildet, steht eine geradezu mythische Revolte gegen den Abfall vom Gesetz einer kosmischen Ordnung. Eine vom eigenen Ehrenkodex durchdrungene Bande von fünf Jungen aus der gutbürgerlichen Gesellschaftsschicht Yokohamas tötet einen ihr prototypisch erscheinenden Repräsentanten der Erwachsenenwelt. Der zum Tode verurteilte Gesetzesbrecher trägt die ›imago‹ der väterlichen ›auctoritas‹. Die Handlung der Prosa, die der Librettist Hans-Ulrich Treichel, eingetaucht in »diese fremde, kalte, leidenschaftliche und gefährliche Welt des japanischen Au- 50 tors«, zum dramatischen Szenario umwandelte, erzählt von dem dreizehnjährigen Jungen und dessen Mutter, der bildschönen Witwe Fusako, die sich in den Schiffsoffizier Ryuji verliebt. Noburus voyeuristischen Strategien bleibt an diesem Liebesverhältnis nichts verborgen. Ambivalent gestaltet sich das Verhältnis zu dem neuen Vater, dessen Herkunft vom Meer archaische Bewunderung auslöst und dessen Entschluss, den Landgang nicht mehr zu beenden, aber als desaströser Schiffbruch erscheint. Deshalb ist seine Exekution für ihn auch die letzte Chance, im Augenblick des Todes wieder zurückzutauchen ins Meer: »Das herzdurchbohrende Weh. Der strahlende Abschied. Der Ruf der hohen Pflicht, die nur ein anderer Name für die tropische Sonne war …« Das Meer behauptet als Sinnbild des Seins im gesamten Werk Mishimas, dieses – so Henze – »fremden Seelenforschers«, seine zentrale Bedeutung. Es ist eine so schöne wie gnadenlose Macht, deren außermoralische und elementare Natur der Macht der Musik gleicht. Hieran knüpfte Henze an: »Musik kann Sympathien und Antipathien zum Ausdruck bringen, ohne Zuhilfenahme von Wörtern, kann klagen, anklagen, höhnen, loben, schmeicheln, hassen und lieben. Aber sie hat keine ›Moral‹«. Die kompositorische Behandlung des Meeres folgt diesem Diktum. In Henzes triadisch strukturierter Klangwelt, die der bodenständigen Mutter das Streichorchester und den pubertierenden Knaben »Klavierstundenmusik« zuweist, wird dem Seemann mit dem expliziten Verweis auf die analoge Verfahrensweise bei Monteverdis Odysseus die Wucht der Bläser verliehen. »Der Mann«, so Henze, gehöre allein in solchem Klangbild dem Meere zu, »der Ferne, dem Sturmwind, der Tropenmacht.« Hier erst erscheint der tragische Untergrund, dessen Zusammenbruch zur Katastrophe führt. Das, was sich als Ganzes und Ewiges inthronisiert hat, versickert auf dem Land. Nur im Sterben kann es erneut zum Leben erwachen. Henze lässt das Werk mit einem gewaltigen Fortissimo enden, im Allegramente und mit der Apotheose durch Glockenklang: »Die Rache des Meeres ist durch den Knaben vollzogen worden.« Am Schluss steht wie in Mishimas Romankosmos nicht das Ethos, sondern die nackte, mythische Naturmacht, das – so Henze – »Vegetative«. Damit aber präsentiert sich das 1990 an der Deutschen Oper Berlin uraufgeführte Werk als Ausdruck eines ausweglosen Fatalismus. Die totalitäre Macht 51 der irdischen Väterwelt gerät darin zum säkularen Spiegelbild einer kosmologischen Tyrannis. Ähnliche Figuren und Konflikte bevölkern in großer Anzahl das Musiktheater Henzes. Schauen wir noch auf den kleinen Pollicino der an den Grimms orientierten gleichnamigen Märchenoper von 1980, der mit den anderen Kindern den Fluss überquert, um der alten menschenfressenden Welt zu entkommen. Werfen wir einen Blick auf den General aus Wir erreichen den Fluß, dem die Gewissheit seines zum baldigen Tode führenden Siechtums endlich die Augen öffnet, begegnen wir dem Landarzt, dessen Pferde zu langsam werden, um nach einem tödlich ausgegangenem Krankenbesuch je wieder nach Hause zu gelangen. – Unaufhebbare Einsamkeit – »Du bist in tiefer Mitternacht« (Georg Trakl) – und die unstillbare Sehnsucht der Liebe danach, in das Sein des Anderen einzutauchen – »wenn weder Finsternis, Schwerkraft, Sinne noch irgendwelche Bande uns binden: Dann stürmen wir vor, dann fluten wir in Raum und Zeit« (Walt Whitman): Das sind, um es nochmals zu sagen, die musikalisch unablässig ausgeloteten Pole des musikalischen Kosmos Hans Werner Henzes. Sie spannen einen großen, das Spielen selbst zum Weltsein erhebenden Phrasierungsbogen vom frühen Wundertheater bis zu den Tänzern und Mimen von Venus und Adonis bis hin zu der »dramatischen Sinfonie« Opfergang über den fortlebenden Geist eines erschlagenen Hündchens in Immolazione nach Franz Werfel aus dem Jahre 2010, worin sich die Worte finden: »Was es war, ist da. / Ich bin dort, wo es beginnt«. Es erscheinen in diesem Kosmos freilich zugleich die Koordinaten unserer eigenen Existenz im Zeitalter von Selbstverlust und Utopieschwund oder des – wie Wystan H. Auden formulierte – Zeitalters der Angst. 52 Anmerkungen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Musiksprache und künstlerische Erfindung, in: Neue Aspekte der musikalischen Ästhetik V, hrsg. von H.W. Henze, Frankfurt am Main 1999, S. 136. Georg Büchner, Werke und Briefe, Leipzig 1968, S. 401ff. H.W. Henze, Sprachmusik, eine Unterhaltung, in: Neue Aspekte der musikalischen Ästhetik IV, hrsg. von H.W. Henze, Frankfurt am Main 1990, S. 10. Paul Valery, Windstriche, Frankfurt am Main 1971, S. 58. H.W. Henze, Musiksprache und künstlerische Erfindung, S. 128. H.W. Henze, Neues Theater, zitiert nach D. Rexroth, Der Komponist Hans Werner Henze, Frankfurt Main 1986, S. 78. H.W. Henze, Neues Theater, S. 88. Zitiert nach H. Noltze, Was macht uns so anbetungswürdig, Herr Henze?, in: FAZ NET, 21. März 2011. N. Abels, Ohrentheater, Szenen einer Operngeschichte, Frankfurt am Main 2009/2010, S. 671. H.W. Henze, Reiselieder mit böhmischen Quinten, Frankfurt am Main 1996, S. 182. 53