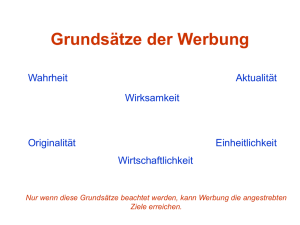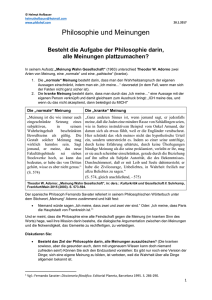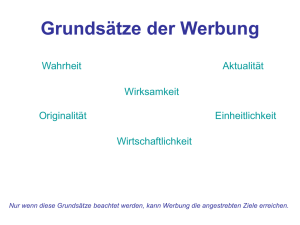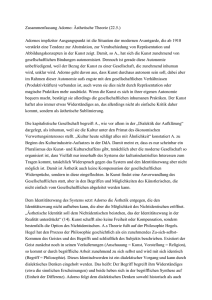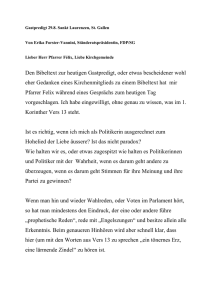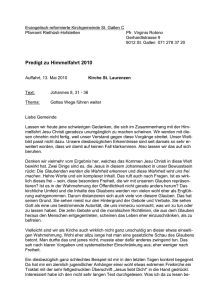Teil I. Grundlagen: Wahrheit, Schein und Antinomie 1
Werbung

Teil I. Grundlagen: Wahrheit, Schein und Antinomie
1. Wahrheitsansprüche
§ 1. Die Erste Philosophie als Lehre von der Wahrheit
Wenn die Philosophie unbeschadet der vielen Disziplinen, in die sie eingeteilt wird, einen einheitlichen theoretischen Diskurs bildet, wenn also beispielsweise die philosophische Semantik
und die philosophische Psychologie in eine Gesamttheorie integrierbar sind und sich andererseits von der linguistischen Semantik bzw. der empirischen Psychologie durch ihre Methode
streng unterscheiden, dann wird man mit einer philosophischen Grundlagensdisziplin rechnen
dürfen, die das Fundament für die Eigenart der philosophischen Theoriebildung legt. Diese
Grundlagendisziplin, was immer ihr Gegenstand und ihre Methode sein mögen, soll im folgenden mit dem Aristotelischen Terminus „Erste Philosophie“ bezeichnet werden.
Ob es eine Erste Philosophie gibt, ob die Philosophie einen theoretischen Diskurs eigener Art
bildet, ist freilich umstritten. Ich skizziere einige gegenteilige Ansichten:
(A) Die Philosophie ist ihrem Wesen nach eine vorläufige und unreife Wissenschaft, ein kozeptionelles und kreatives Denken, dessen theoretischer Nutzen darin besteht, daß es Fragestellungen entwickelt, deren wissenschaftliche Behandlung sich zuguterletzt verselbständigt.
Man muß sich nur klarmachen, daß für Aristoteles die Physik noch zur Philosophie gehörte
(sie war die zweite Philosophie, die Metaphysik die erste) und die Psychologie zur Physik. Zu
Beginn der Neuzeit aber hat sich die Physik, dank mathematischer Formulierung und experimenteller Methode, aus der Philosophie verabschiedet. Die Psychologie zwar blieb damals der
Philosophie noch erhalten; aber inzwischen ist auch sie ein eigenständiges Unternehmen, und
dies wiederum dank der experimentellen Methode und dem Bemühen um mathematische
Theorieformulierung. So gibt die Philosophie stets ab, was unter ihren Händen heranreift, so
lange, bis sie am Ende womöglich mit leeren Händen dasteht. Ihr Triumph wäre es insofern,
sich schließlich überflüssig zu machen und restlos in strenger Wissenschaft aufzugehen.
{Soweit mag niemand gehen. Stattdessen entweder Rorty: Fortsetzung des seit Platon andauernden Gesprächs, oder Quine: Alternative (B).}
(B) Indem die Philosophie wissenschaftlich wird, macht sie sich zwar nicht überflüssig, reiht
sich aber ein unter die übrigen Disziplinen im Gesamtspektrum der Wissenschaft. Der ameri-
2
kanische Philosoph Willard van Orman Quine1 etwa, der dieses Einreihen der Philosophie
unter die (Natur-)Wissenschaften ihre Naturalisierung genannt hat, lehrt, daß die Philosophie
als naturalisierte Erkenntnistheorie eine unter den vielfältigen Beziehungen zwischen unserer
sensorischen Reizung und unserer wissenschaftlichen Theorie der Welt zu betrachten habe,
nämlich die Beziehung der Stützung der Theorie durch Belege, und er unternimmt es sodann,
die Charakteristika dieser Beziehung ohne äußere (neurologische, linguistische, genetische,
historische, ...) Anleihen, mit wenig mehr als den Mitteln bloßer logischer Analyse zu eruieren.2 So ist die Philosophie zwar als Erkenntnistheorie ein respektabler theoretischer Diskurs,
dies aber um den Preis ihrer Integration in den gewöhnlichen theoretischen Diskurs (zu dem
auch die Mathematik und die Logik gehören). Es gibt - das besagt Quines philosophischer
Naturalismus - keine Erste, methodisch ausgezeichnete, keine apriorische Philosophie.
(C) Die Philosophie kann sich weder überflüssig machen noch ist sie naturalisierbar. Gleichwohl kann es keine Erste Philosophie geben; denn die Philosophie ist gar kein theoretischer
Diskurs. Zwar mögen in ihr Argumentationen und Begriffserklärungen eine wichtige Rolle
spielen, und bisweilen mag es gar so aussehen, als würden genuin philosophische Thesen aufgestellt und begründet. Doch das philosophische Denken ist auf etwas ganz anderes aus als
auf Lehrsätze, etwa, wenn wir dem späten Wittgenstein folgen, auf die Linderung des intellektuellen Unbehagens, das sich einstellt, wenn wir uns in der Grammatik unserer Sprache
verfangen.
Mit diesen drei Beispielen einer kritischen Haltung gegenüber dem Unternehmen Erste Philosophie sollte dokumentiert werden, daß es nicht selbstverständlich, sondern eine begründungsbedürftige These ist, wenn behauptet wird, daß es eine Erste Philosophie, d.h. eine prinzipiell ausgezeichnete Grundlagensdisziplin der Philosophie gibt, kraft deren die Philosophie
insgesamt ein theoretischer Diskurs eigener Art ist. Diese These soll im folgenden so begründet werden, daß aus dem wendungsreichen Gang der Begründung eine Einführung in die Philosophie hervorgeht. Konkret besagt die Generalthese dieser Einführung, daß die philosophischen Probleme allesamt mit dem Begriff der Wahrheit zusammenhängen und daß die Erste
Philosophie eine theoretische Reflexion auf den Begriff und das Faktum der Wahrheit zu sein
hat.3 Das Faktum der Wahrheit ist ihr Vorkommen in unseren wahren Sätzen und Meinungen.
1
Als Autor schreibt er sich mit großem „V“ im Mittelnamen, abgekürzt: W.V. Quine. („Van“ wurde er von
Freunden genannt, vgl. seine Korrespondenz mit Rudolf Carnap: Dear Carnap, Dear Van. The Quine-Carnap
Correspondence and Related Work. Hg. von Richard Creath. Berkeley und Los Angeles 1990.)
2
W.V. Quine, Unterwegs zur Sprache, Paderborn 1995. S. 1f.
3
Hans-Peter Falk hat diese These in seinem Buch Wahrheit und Subjektivität ausführlich begründet. Ich folge
ihm in wesentlichen Punkten.
3
Man kann auch sagen, daß wir selber das Faktum der Wahrheit sind, indem wir in unseren
Urteilen Wahrheitsansprüche erheben. Unsere Urteils- oder Aussagepraxis also, sofern sie
mittels des Wahrheitsbegriffes charakterisierbar ist, bildet den Ansatzpunkt und das Ausgangsthema der Philosophie.
Alle Theorien erheben Wahrheitsansprüche, die Erste Philosophie aber ist die Theorie, die auf
dieses Faktum reflektiert. In keiner anderen Theorie kommt der Wahrheitsbegriff wesentlich
vor (außer in der mathematischen Logik ein aseptisches Imitat des Wahrheitsbegriffes); alle
anderen Theorien - Mathematik, Physik, Chemie usw. - lassen, was sie für ihre Theoreme beanspruchen: Wahrheit, unthematisiert, implizit. Daß es wahr sei, daß die Kraft das Produkt
von Masse und Beschleunigung ist, drückt die Newtonsche Mechanik dadurch aus, daß sie die
Gleichung ‘F= ma’ unter ihre Theoreme bzw. Axiome aufnimmt. Das Wort ‘wahr’ braucht sie
dazu nicht. Die Erste Philosophie allein macht, was sie auch für ihre Lehren beansprucht:
Wahrheit, zu ihrem sie definierenden Thema; und die Philosophie insgesamt, in der ganzen
Vielfalt ihrer Disziplinen, reicht gerade so weit wie der begriffliche Einfluß des Wahrheitsprädikates. Dafür jedenfalls werde ich in der Folge argumentieren.
Revolutionär ist diese These nicht, wie ein kurzer Blick in die Philosophiegeschichte zeigt.
Aristoteles, welcher es war, der die Philosophie in eine erste und eine zweite einteilte und der
unter der zweiten die Theorie der Natur in ihrer Prozessualität, also die Physik verstand, faßte
die erste Philosophie als die Theorie der Natur in ihrem schieren Sein, als die Lehre vom on
he on, vom Seienden als Seiendem. Sein Redaktor Andronikus von Rhodos (oder ein Früherer, dem Andronikus sich anschloß) hat diese Reihenfolge in der äußeren Anordnung der aristotelischen Schriften umgekehrt und die Schriften zur ersten Philosophie nach den physikalischen Schrifen - meta ta physika - plaziert. Daher heißt die Lehre vom Sein des Seienden auch
Metaphysik, und nach ihrer Thematik wurde sie sehr viel später, im 16. Jahrhundert, Ontologie genannt. Als wissenschaftliche Betrachtung ist sie Ursachen- und Prinzipienforschung. Sie
fragt folglich nach dem Sein des Seienden mit Blick auf den Grund dieses Seins. Insofern
kann man die Frage, die Leibniz als die logisch erste unter allen Warum-Fragen auszeichnet:
„Warum ist überhaupt Seiendes und nicht vielmehr nichts?“4 mit Heidegger als die Grundfrage der Metaphysik bezeichnen.5 Bei Leibniz wird diese Frage theologisch beantwortet: Damit
4
Principes de la nature et de la grâce (Opp. ed. Gerh. tom. VI, 602. n. 7), S. 382: „[...] la première question
qu’on a droit de faire, sera, pourquoi il y a plus tôt quelque chose que rien.“
5
Vgl. den Schluß von Heideggers Freiburger Antrittsvorlesung „Was ist Metaphysik?“ (1929), in: Wegmarken,
Gesamtausgabe Bd. 9, S. 103-122, S. 122: Die vom Nichts erzwungene Grundfrage der Metaphysik, so heißt es
dort, sei die Frage: „Warum ist überhaupt Seiendes und nicht vielmehr Nichts?“ - In der „Einleitung zu ‘Was ist
4
überhaupt Seiendes ist, bedarf es eines notwendigen Wesens, Gottes, der alles nicht-notwendige Seiende geschaffen hat. Auch in der aristotelischen {Physik und} Metaphysik wird Gott,
wenn auch nicht als Schöpfer, so doch als der selbst unbewegte Beweger des Kosmos thematisiert. Die Metaphysik, die als Ontologie anhebt, entwickelt sich insofern - bei Leibniz wie
bei Aristoteles - fort zu einer philosophischen Theologie.
Soweit die klassische Erste Philosophie. Sie ist Metaphysik, und das heißt Ontologie und Theologie in einem. Hat sie eine Nähe zu der hier anvisierten Lehre vom Begriff und vom Faktum
der Wahrheit? Ja; denn indem ein Wahrheitsanspruch erhoben wird, wird immer ein Sein,
nämlich ein bestimmtes Der-Fall-Sein beansprucht. Wenn der Satz ‘Schnee ist weiß’ wahr ist,
dann ist es der Fall (dann ist es so), daß Schnee weiß ist. Das Sein im Sinne des Der-FallSeins kann man, weil sich in ihm das Wahrsein einer Aussage spiegelt, das veritative Sein
nennen. Und dieses veritative Sein wird sich als der Punkt erweisen, in dem die klassische
Ontologie und die Lehre vom Begriff und vom Faktum der Wahrheit zusammenhängen.
Leibniz, von dem soeben die Rede war, gehört eigentlich schon einem postontologischen Abschnitt der Philosophiegeschichte an. Seine Vorgänger Descartes und Locke hatten je das Ihre
dazu beigetragen, daß die Erste Philosophie einen neuen Ansatzpunkt und Inhalt bekommen
hatte. Sie war seitdem nicht mehr Ontologie, sondern Erkenntnis- und Bewußtseinstheorie.
Lockes philosophisches Hauptwerk trägt den Titel „Über den menschlichen Verstand“; und
Descartes beginnt seine Meditationen über die erste Philosophie, in denen die Existenz Gottes
und die Verschiedenheit der menschlichen Seele vom Körper bewiesen werden mit einer Meditation über das, „woran man zweifeln kann“. Darauf folgt eine Meditation „über die Natur
des menschlichen Geistes: daß seine Erkenntnis ursprünglicher ist als die des Körpers“; und
erst dann, in der dritten Meditation, unternimmt Descartes einen Gottesbeweis. Das Seiende in
seinem Sein ist bei alledem in den Hintergrund getreten.
Ist es dann nicht ein Rückfall hinter die bewußtseinstheoretische Wende der neuzeitlichen
Philosophie, wenn die hier als Lehre von der Wahrheit in Aussicht genommene Erste Philosophie mittels des Begriffes des veritativen Seins in die klassische Ontologie zurückweist? Nein;
denn wir werden sehen, daß der Begriff und das Faktum der Wahrheit ebensosehr auf die Bewußtseins- und Erkenntnistheorie verweisen. Indem nämlich die objektive Wahrheit einer
Aussage beansprucht wird, wird eine Differenz gedacht zwischen dem, was an sich der Fall
ist, und dem erkennenden bzw. beanspruchenden Bewußtsein (von dem, was der Fall ist).
Metaphysik?’“ (1949), ebd. S. 365-383, S. 381, wird diese Grundfrage der Metaphysik mit Verweis auf Leibniz
wiederholt.
5
Man kann diese Differenz zwischen subjektivem Anscheinen und objektivem Der-Fall-Sein
die Geltungsdifferenz nennen, weil sie sich unmittelbar daraus ergibt, daß objektive Geltungsansprüche erhoben werden. Sie markiert den Punkt, in dem die neuzeitliche Bewußtseins- und
Erkenntnistheorie und die Lehre vom Begriff und vom Faktum der Wahrheit zusammenhängen.
Man mag sich darüber streiten, wieviele und welche epochalen Wendungen die Philosophie in
ihrer Geschichte genommen hat, welche Paradigmenwechsel (wenn davon in der Philosophie
die Rede sein kann) in der Philosophiegeschichte vorgekommen sind. Von denen, die sie mitvollzogen haben, wird oft die sprachphilosophische Wende zu Beginn des 20. Jahrhunderts bei Frege, Russell, Wittgenstein und Carnap - als ein weiterer Paradigmenwechsel betrachtet.
Wenn zu Recht, dann stellt sich die Frage, ob eine Lehre vom Begriff und vom Faktum der
Wahrheit auch dieser Wende Rechnung tragen kann; und hier liegt die Bejahung mehr als
anderswo auf der Hand. Durch die sprachphilosophische oder sprachanalytische Wende wurde
der Ansatzpunkt der Ersten Philosophie von unseren Vorstellungen (unseren mentalen Wahrheits- und Wissensansprüchen) auf unsere sprachlichen Verlautbarungen verschoben. Aber die
Sprachphilosophie wetteifert als Erste Philosophie natürlich nicht mit der Sprachwissenschaft
oder gar mit einer umfassenden Theorie des menschlichen Verhaltens. Sie thematisiert die
sprachlichen Verlautbarungen ausschließlich als potentielle Wahrheitsträger bzw., da Ausdrücke unterhalb der Satzebene, einzelne Worte, logische Partikeln zumal, nicht wahr-oderfalsch und demnach keine potentiellen Wahrheitsträger sind, den Beitrag, den Ausdrücke verschiedener Kategorien zu der Wahrheit-oder-Falschheit derjenigen Sätze leisten, in denen sie
vorkommen. Dieser Beitrag eines Ausdrucks zu den Wahrheitsbedingungen der Sätze, in denen er vorkommt, ist seine Bedeutung in dem philosophisch relevanten Sinn des Terminus.
Die Sprachphilosophie in der Rolle der Ersten Philosophie ist demnach philosophische Semantik; und nur dadurch, daß sie sich mit der Lehre vom Begriff und vom Faktum der Wahrheit, untertrieben gesagt, berührt, kann sie sich als philosophische Theorie von der Linguistik
abgrenzen.
Wenn es also überhaupt eine Erste Philosophie gibt, dann ist die Wahrheit sowohl der Sache
nach als auch aus philosophiehistorischen Gründen ein hervorragender Kandidat für ihren
ursprünglichen und eigentlichen Gegenstand.
§ 2. Das realistische Moment der Wahrheit und der metaphysische Realismus
6
Wir wollen zunächst die Legitimität unserer Urteilspraxis als solcher nicht hinterfragen, sondern nur die impliziten Annahmen herausarbeiten, die ihr zugrunde liegen; d.h. wir versuchen
es einfach einmal mit der Ersten Philosophie und sehen zu, wie weit wir kommen. Dabei gehen wir von Urteilen aus, in denen objektive Wahrheitsansprüche erhoben werden. Es wird
sich zeigen, daß nicht alle Wahrheitsansprüche - nicht alle Fälle von Wahrheit, genauer gesagt
- von dieser Art sind; aber zeigen wird es sich gerade im Ausgang von den objektiven. Wir
haben daher keinen Verlust an Allgemeinheit zu befürchten - wir verpassen nichts -, wenn wir
mit den objektiven Wahrheitsansprüchen als den grundlegenden Fällen beginnen.
Was hat es mit der angeführten Objektivität näher auf sich? Wenn ich einen objektiven Wahrheitsanspruch erhebe - sei es in der Wahrnehmung, der Erinnerung oder der Theoriebildung,
sei es in ausdrücklicher Behauptung oder in stillem Dafürhalten oder wie auch immer -, so beanspruche ich, daß etwas sich so und so verhält (daß dies oder das der Fall ist) unabhängig davon, daß ich diesen Anspruch erhebe. In meinem Urteil, etwa daß Schnee (objektiv) weiß ist,
liegt der Anspruch, daß nicht dieser Urteilsakt den Schnee weiß macht, sondern daß Schnee
auch dann weiß wäre, wenn ich aus irgendwelchen Gründen zu der gegenteiligen, falschen
Meinung gekommen wäre (daß Schnee nicht weiß ist). Das Bestehen des Sachverhaltes, hier:
daß Schnee weiß ist, ist unabhängig von meiner Meinung, daß Schnee weiß ist. Daraus folgt
etwas, wovon wir ohnehin überzeugt sind, nämlich, daß bloßes Fürwahrhalten im allgemeinen
noch keine Wahrheit verbürgt; und aus dieser „Platitüde“ (der amerikanische Philosoph Donald Davidson hat sie so genannt6) folgt umgekehrt die Unabhängigkeit des Der-Fall-Seins
von der entsprechenden Meinung. Wenn aber zwei Wahrheiten oder Annahmen wechselseitig
auseinander folgen, dann sind sie logisch äquivalent. Die erwähnte Platitüde ist daher ein angemessener Ausdruck der Objektivität unserer Wahrheitsansprüche; und daß es sich um eine
Platitüde handelt, zeigt, daß wir uns bislang auf theoretisch neutralem Gelände bewegen. Wir
haben als Theoretiker noch keine schwerwiegende Prämisse ins Spiel, sondern nur eine Unterstellung ans Licht gebracht, die wir vortheoretisch in unserem Urteilen immer schon machen.
In diesem Sinn ist das bisher vorgeführte Stück Erste Philosophie voraussetzungslos. Wir haben uns nicht auf Ergebnisse irgendeiner philosophischen oder gar außerphilosophischen Theorie berufen. Wir haben zum Beispiel den Seinsstatus von Wahrheitsansprüchen völlig in der
Schwebe gelassen. Sind sie äußere (sprachliche) oder innere (geistige) Vorgänge oder Zustände? Und wenn letzteres, was ist der Seinsstatus von geistigen Vorgängen? Das sind sicher
interessante Fragen, aber bezüglich ihrer bleiben wir bis auf weiteres neutral. Wir haben noch
7
nichts in der Hand, um sie so oder so entscheiden zu können. Die Erste Philosophie ist methodisch in einer prekären Lage. Sie muß die Unabhängigkeit der Philosophie von außerphilosophischen Theorien verbürgen, darf also bei diesen keine Anleihen machen. Sie kann zudem
als erste unter den philosophischen Disziplinen auch nicht auf etablierte philosophische Lehrmeinungen zurückgreifen. Vielmehr muß sie sich in bloßem Nachdenken über das Faktum der
Wahrheit entwickeln lassen, welches gegenüber anderen Fakten dadurch ausgezeichnet ist,
daß zu seiner Beschreibung der Wahrheitsbegriff nötig ist. In diesem Sinn kann man sagen,
daß die Erste Philosophie a priori (nicht-empirisch) verfährt, noch bevor man über einen präzisen Begriff der Apriorität verfügt.
Die Gefahr, unzulässige Prämissen in die Philosophie einzuschleusen, droht freilich allenthalben. Ein wohlbekanntes Beispiel dafür ist der Übergang von der Platitüde (der Unabhängigkeit des Der-Fall-Seins von der entsprechenden Meinung) zum metaphysischen Realismus.
Wenn wir unter dem Wahren den Inbegriff aller wahren Meinungen und Sätze und unter dem
Realen (oder der Realität) vorläufig den Inbegriff dessen verstehen, was Gegenstand wahrer
Meinungen und Sätze ist, dann können wir mit Donald Davidson den metaphysischen Realismus als die Lehre fassen, „daß das Wahre und das Reale unabhängig von unseren Meinungen
sind“7. Die Realität, so kann man das reformulieren, nimmt keine Rücksicht auf unsere Meinungen und unsere Erkenntnismöglichkeiten; bzw. die Wahrheit ist nicht-doxastisch (nicht
wesentlich auf unsere doxai, Meinungen bezogen) und nicht-epistemisch (nicht wesentlich auf
unsere episteme, unser Wissen und Erkennen bezogen), in einem Wort: sie ist radikal nichtkognitiv. Wenn sie aber nicht-kognitiv ist, dann könnten zufällig (fast) alle meine Meinungen,
aber zufällig auch (fast) keine meiner Meinungen wahr sein. „Möglicherweise sind alle unsere
Meinungen falsch“, lautet daher eine weitere Formulierung des metaphysischen Realismus.
Ferner wird die sogenannte Korrespondenztheorie (oder Übereinstimmungstheorie) der Wahrheit mit dem metaphysischen Realismus assoziiert. Ob unsere Meinungen wahr sind, entscheidet sich an der Realität, die zwar ihrerseits keine Rücksicht auf unsere Meinungen nimmt, die
aber doch, wenn z.B. unsere Meinung, daß Schnee weiß ist, zufällig wahr sein sollte, einen
dieser Meinung korrespondierenden, mit ihr übereinstimmenden Aspekt oder Teil enthalten
muß. Solche einzelne Meinungen wahrmachenden Teile der Realität heißen Tatsachen. Eine
Meinung ist der Korrespondenztheorie zufolge dann und nur dann wahr, wenn sie einer Tatsache (einer Portion der Realität) entspricht; und dieses Entsprechen oder Übereinstimmen-mit,
6
7
Davidson, „The Structure and Content of Truth“, in: The Journal of Philosophy 87 (1990), 279-328, S. 305.
Ebd.
8
wie immer man es präziser fassen mag, ist eine nicht-kognitive, reale Beziehung wie andere
Beziehungen zwischen verschiedenen Sorten von Dingen auch.
Wie kommt man nun von jener vortheoretischen Platitüde zu dieser metaphysischen Lehre?
Durch einen, wenn auch naheliegenden Fehlschluß, ein Non sequitur. Man beginnt mit der
Objektivität unserer Wahrheitsansprüche bzw. damit, daß das Fürwahrhalten nicht die Wahrheit verbürgt. Folglich kann jede (auf Objektivität bezogene) Meinung falsch sein. Wir sind in
unseren Urteilen prinzipiell fehlbar; und das ist kein Zeichen unserer Unzulänglichkeit, sondern ein Zeichen der Objektivität unserer Geltungsansprüche. Soweit, so gut: Wir sind durchgängig fehlbar, d.h. jede einzelne unserer Meinungen kann falsch sein. Aber daraus folgt worauf Davidson wiederholt hingewiesen hat - nicht, daß alle meine Meinungen zusammen
oder daß auch nur die Mehrheit meiner Meinungen falsch sein kann. Davidson seinerseits
meint Gründe für die Gegenthese, nämlich dafür gefunden zu haben, daß die meisten Meinungen jedes Wesens, das überhaupt Meinungen hat, wahr sind, obwohl nach wie vor jede einzelne Meinung falsch sein kann (man kann die wenigen falschen unter den vielen wahren eben
nicht sicher identifizieren). Statt Mehrheiten und Minderheiten von Meinungen ins Spiel zu
bringen, kann man das Non sequitur des metaphysischen Realismus auch wie folgt diagnostizieren: Eines ist die Unabhängigkeit des Bestehens eines Sachverhaltes von meiner Meinung
über ihn, ein anderes die (vermeintliche) Gleichgültigkeit der Realität gegenüber Kognitivität
überhaupt. Ersteres ist das realistische Moment oder, wie Hans-Peter Falk es nennt8, der realistische Aspekt der Wahrheit, letzteres die These des metaphysischen Realismus; und letzteres
folgt ersichtlich nicht ohne Zusatzprämissen aus ersterem. Der metaphysische Realismus, so
zeigt es sich, setzt ein Moment der Wahrheit, das realistische, absolut.
Diese Problematik wird in Teil II ausführlich behandelt werden. Hier soll in diesem Zusammenhang nur noch vorsorglich auf die vielfache Bedeutung des Wortes ‘Realismus’ hingewiesen werden. Zunächst gilt es, von dem skizzierten metaphysischen Realismus die verschiedenen regionalen Realismen streng zu unterscheiden. Ein regionaler Realismus ist jeweils eine
ontologische These von der Form: Entitäten der Kategorie K sind real, d.h. Teil der Realität ob diese nun gegen Kognitivität gleichgültig ist oder ob sie mit einem Wort Hegels „bei uns
sein will“ (in unseren Meinungen nämlich). Ein regionaler Realismus ist beispielsweise der
Universalienrealismus, d.h. die seit dem Mittelalter prominente und oft diskutierte These, daß
Universalien (Gattungen und allgemeine Eigenschaften von Dingen) real sind; ein anderes
Beispiel ist der sogenannte modale Realismus des amerikanischen Philosophen David Lewis,
9
d.h. These, daß das Mögliche nicht minder real ist als das Wirkliche (Aktuale) bzw. daß es
viele mögliche Welten als reale Entitäten gibt. {Der metaphysische Realismus und die regionalen Realismen sind die bösen Buben, weil jener aporetisch ist und zu diesen die Philosophie
im allgemeinen nicht befugt ist. Jetzt noch zwei gute: der erkenntnistheoretische und der semantische Realismus.}
Leichter als einer der regionalen Realismen ist mit dem metaphysischen vielleicht der erkenntnistheoretische Realismus zu verwechseln, da dieser nicht eine je bestimmte Kategorie
von Entitäten (Universalien, mögliche Welten usw.), sondern wie jener die Realität als ganze
betrifft. Sachlich gesehen liegt eine Verwechslung andererseits deswegen fern, weil der erkenntnistheoretische Realismus mit dem metaphysischen unverträglich ist; denn er {er berücksichtigt nicht nur das realistische, sondern ebenso das zweite: kognitve, Moment der
Wahrheit und} lehrt, daß die ansichseiende Realität wesentlich erkennbar, also nicht gleichgültig gegen Kognitivität als solche ist.
Auf dem Boden der geteilten Prämisse, daß, was der Fall ist, auch erkennbar ist, steht der erkenntnistheoretische Realismus im Gegensatz zum Idealismus. Was der Fall ist, so lehrt der
Idealismus, ist deswegen erkennbar, weil es sich vom Erkennen gar nicht unterscheidet; wir
verbleiben im Erkennen innerhalb des Kreises unserer Vorstellungen und Meinungen; aber
das ist keine Beschränkung, weil die „Realität“ selber vorstellungsartig, ideell ist. Der erkenntnistheoretische Realismus hingegen behauptet ein Transzendieren, ein Sich-Überschreiten des Bewußtseins nach außen, hin zu der ansichseienden, nicht vorstellungsartigen Realität
bzw. umgekehrt ein Sich-Offenbaren der Realität in unserem Bewußtsein. {Der erkenntnistheoretische Idealismus und der metaphysische Realismus sind miteinander im Bunde. Der
metaphysische Idealismus wäre die Position, daß das Reale eben auf die Bedürfnisse des Diskurses heruntergestutzt würde, und läge insofern nahe bei der Wahrheitsskepsis.}
Es versteht sich, daß der erkenntnistheoretische Realismus im Laufe der Philosophiegeschichte vielerlei miteinander unverträgliche Ausarbeitungen erfahren hat. Eine Grundentscheidung, die jede solche Ausarbeitung treffen muß, ist die zwischen einer direkten, präsentationalen und einer indirekten, repräsentationalen Gestalt des Realismus: Zeigt sich das Reale
direkt, gleichsam in leibhaftiger Präsenz oder nur indirekt, vermittelt durch innere, bewußtseinsartige Repräsentanten? Im zweiten Fall wäre das Transzendieren des Bewußtseins nach
außen nur virtueller Natur. Eine Herausforderung an den indirekten erkenntnistheoretischen
Realismus - ich nenne ihn auch kurz Repräsentationalismus {was aber zu Mißverständnissen
8
Hans-Peter Falk, [...].
10
Anlaß geben kann} und den direkten Realismus Präsentationalismus - besteht also darin, einsichtig zu machen, wie die Realität wesentlich erkennbar sein kann, wenn andererseits das
Erkennen nicht transzendiert, sondern in sich verharrt. An dieser Herausforderung könnte der
Repräsentationalismus am Ende scheitern und gegen seine erklärte Absicht in einen metaphysischen Realismus kollabieren.
Dies Letztere ist eine Vorwegnahme, die durch die bisherige Argumentation nicht gedeckt ist
und die nur im Rahmen der Erklärung des Realismusbegriffes ihr relatives Recht besitzt. Unsere Argumentation hat bislang nur das realistische Moment der Wahrheit freigelegt und gezeigt, daß es nicht ohne weiteres in eine realistische Metaphysik umgemünzt werden darf.
Wenn nämlich der erkenntnistheoretische Realismus in seiner präsentationalen Form sich als
wahr erweisen sollte, dann gibt es Meinungen und wahre Meinungen nur dank einer ursprünglichen Offenbarkeit oder Unverborgenheit der Realität. Dann aber sind die wahren Meinungen
in einem gewissen Sinne die Regel bzw. das Primäre, und die nicht-wahren Meinungen der erklärungsbedürftige Sonderfall. Die Realität wäre gleichsam mit unseren Meinungen im Bunde, und Wahrheit wäre nicht radikal nicht-kognitiv, sondern hätte neben dem realistischen
auch ein kognitives Moment. Daß es sich tatsächlich so verhält, ist noch nicht bewiesen. Aber
die bloße Möglichkeit des Präsentationalismus (des direkten erkenntnistheoretischen Realismus) zeigt, daß aus dem realistischen Moment der Wahrheit nicht ohne Zusatzprämisse der
metaphysische Realismus gefolgert werden darf.
{Der semantische Realismus lehrt, daß die Bedeutung nicht dem Sprachverhalten immanent
ist, bzw., da dies mißverständlich ist, daß die Bedeutung eines Satzes seine Wahrheitsbedingung ist, so die Bedeutung von „La neve è bianca“ die Bedingung, daß Schnee weiß ist. Der
semantische Idealismus oder Antirealismus hat zwei Varianten: Verifikationismus und Falsifikationismus: Die Bedeutung eines Satzes ist die Methode seiner Verifikation bzw. ist das
Positiv seiner Falsifikation.}
§ 3. Der Satz des Bewußtseins: Wahrheit und Wissen
Wir wollen nun einige weitere Schlußfolgerungen aus dem realistischen Moment der Wahrheit ziehen. Das realistische Moment besteht in der Unabhängigkeit des Der-Fall-Seins von
der jeweiligen Meinung, und die erste Folgerung daraus war unsere durchgängige Fehlbarkeit
im Urteilen. Was immer nun ein Urteil (bzw. ein Erheben eines Wahrheitsanspruches) näher
sein mag, so muß in ihm doch unserer Fehlbarkeit Rechnung getragen, es muß in ihm, mit
11
Wittgenstein zu reden, „die Möglichkeit des Irrtums vorgesehen“ sein.9 Ein Urteil bzw. seine
Verlautbarung in einem Aussagesatz muß, kurz gesagt, falsch sein können. Der Anspruch, der
mit einem Urteil verbunden ist, geht zwar auf Wahrheit, aber er kann stets fehlgehen. Das Urteil als solches ist daher zweiwertig: wahr oder falsch, obwohl natürlich jedes einzelne Urteil
jeweils nur einen dieser beiden sogenannten Wahrheitswerte besitzt.
Die Zweiwertigkeit des Urteils und der Aussage ist sicher keine spektakuläre Folgerung aus
dem realistischen Wahrheitsmoment, weil wir ohnehin bestens mit ihr vertraut sind. Immerhin
ist es aber bemerkenswert, daß diese Zweiwertigkeit nicht als ein logisches Grundfaktum hingenommen werden muß, sondern als notwendige Folge der Objektivität unserer Wahrheitsansprüche eingesehen werden kann. Andererseits ist es uns unbenommen, von der Zweiwertigkeit des Urteils auszugehen und umgekehrt auf die prinzipielle Fehlbarkeit der Urteilenden
und die Objektivität ihrer Wahrheitsansprüche zu schließen; denn die Möglichkeit des Irrtums
ist bei Zweiwertigkeit unausweichlich vorgesehen, auch wenn ein faktisch allwissendes Wesen nie von ihr „Gebrauch machen“ würde, und aus der Fehlbarkeit folgt die Unabhängigkeit
des Der-Fall-Seins vom Urteilsakt. Ein erkennendes Wesen, das sich gar nicht irren kann,
sofern dieses ‘kann’ ein logisches, kein bloß metaphysisches oder gar bloß physikalisches
Können bezeichnet, urteilt nicht, jedenfalls nicht auf zweiwertige Weise, sondern es weiß,
was es weiß, auf irrtumsimmune Weise; und es zahlt dafür den Preis (falls das ein Preis und
kein Gewinn ist) der Nicht-Objektivität dessen, worauf es sich denkend bezieht. Umgekehrt
wäre, um von diesem hypothetischen Wesen zu uns zurückzukehren, wenn unsere Wahrheitsansprüche nicht-objektiv wären (was das heißen mag, wird im Fortgang deutlich werden),
unser Denken nicht der Zweiwertigkeit ausgesetzt, sondern irrtumsimmunes Erkennen.
Indem wir so die Zweiwertigkeit in ein Ausschlußverhältnis zum irrtumsimmunen Erkennen
bringen, zehren wir offenkundig von einer begrifflichen Verbindung zwischen der Aussagewahrheit und dem Erkennen. Das aber heißt, daß wir vom kognitiven Charakter bzw. von einem kognitiven Moment der Wahrheit zehren; und dies bringt uns noch einmal zurück zur
Frage des Realismus.
Ein Wort zur Dämpfung allzu weitgehender theoretischer Hoffnungen vorweg: Wir sind dabei, die grundsätzlichen Unterstellungen freizulegen, die mit unserer Urteilspraxis verbunden
sind. D.h. unsere Ergebnisse haben die Form: ‘Indem wir Wahrheitsansprüche erheben, beanspruchen wir dies und das unweigerlich mit’. Sie haben nicht die Form: ‘Unsere Urteilspraxis
zeigt, daß dies und das als metaphysischer Sachverhalt besteht’. So ist unsere Fehlbarkeit nach
9
Wittgenstein, Das Blaue Buch, [...].
12
allem, was wir bisher wissen, nicht als eine metaphysische Tatsache gesichert, sondern nur als
etwas, das wir in jedem unserer Urteile mitbeanspruchen; ebenso die Objektivität dessen, was
wir jeweils als der Fall seiend beanspruchen; ebenso die Zweiwertigkeit unserer Urteile; ebenso das kognitive Moment der Wahrheit, das sich gerade angekündigt hat. Denn es könnte ja
sein, daß unsere Urteilspraxis ungerechtfertigt ist, daß also nicht nur einzelne Urteile falsch
sind, sondern daß das Urteilen als solches in irgendeiner Weise haltlos ist. Dann wäre auch all
das haltlos, was wir in unseren Urteilen mitbeanspruchen. Es bedarf, mit anderen Worten,
noch einer Legitimation unserer Urteilspraxis als solcher. Aber diese Aufgabe verschieben wir
auf spätere Teile (II und IV).
Wir können also, falls sich die Vermutung eines kognitiven Momentes der Wahrheit erhärten
läßt, nicht behaupten, der metaphysische Realismus sei widerlegt, sondern nur, daß wir im
Vollzug eines beliebigen Urteils die Falschheit des metaphysischen Realismus unterstellen;
und das ist für die Zwecke von Teil I genug. Läßt sich besagte Vermutung also erhärten?
Indem wir Wahrheitsansprüche erheben, erheben wir, jedenfalls in den grundlegenden und
mustergültigen Fällen, zugleich Wissensansprüche. Es mag nachgeordnete Fälle geben, in denen wir mehr oder weniger „ins Blaue“ urteilen müssen. Aber die nachgeordneten Fälle sind
nur verständlich im Licht der paradigmatischen; und für diese gilt, daß Wahrheitsansprüche
nicht aufs Geratewohl, sondern mit dem Anspruch erhoben werden, daß sich grundsätzlich
auch einsehen läßt, daß es sich so und so verhält. Wenn Urteile grundsätzlich nicht verifiziert
oder falsifiziert werden könnten, dann liefe die Urteilspraxis leer. Ein Anspruch („Schnee ist
weiß“), der prinzipiell die gleiche Berechtigung hätte wie ein mit ihm unvereinbarer Anspruch
(„Schnee ist blau“), läßt sich als Anspruch gar nicht konsistent denken. Indem wir objektive
Wahrheitsansprüche erheben, beanspruchen wir also mit, daß urteilsunabhängige Sachverhalte
prinzipiell erkennbar sind, d.h. wir beanspruchen implizit die Wahrheit des erkenntnistheoretischen Realismus und die Falschheit des metaphysischen Realismus und ebenso natürlich die
Falschheit des Idealismus (der Gegenposition zum erkenntnistheoretischen Realismus). D.h.
wir unterstellen in jedem Urteil eine sowohl ansichseiende (urteilsunabhängige) als auch erkennbare (sich offenbarende, für uns seiende) Realität. Damit die beiden gegenläufigen Seiten
dieser Unterstellung in Einklang gebracht werden können, muß das Für-uns-Sein der Realität
so konzipiert werden, daß es sich wesentlich durch unser je fehlbares Urteilen hindurch vollzieht. Eine vorläufige Lösungsformel für diese Aufgabe kann man in der schon erwähnten
These Davidsons erblicken: Notwendigerweise verhält es sich so, daß die meisten unserer
13
Meinungen wahr sind (Präsenz des Absoluten, Hegelisch gesprochen); aber jede einzelne
Meinung ist möglicherweise falsch (Ansichsein des Absoluten).
Daß ich beiläufig auf Hegel verweise, hat seinen guten Grund darin, daß Hegels Phänomenologie des Geistes ihren Ansatzpunkt gerade an der erwähnten gegenläufigen Unterstellung im
Urteilen gewinnt. Hegel definiert durch sie den Gegenstand seiner Untersuchung: das Bewußtsein. In der Einleitung der Phänomenologie wird das Bewußtsein wie folgt charakterisiert (in
eckigen Klammern meine Ergänzungen, Auslassungen und interpretierenden Zusätze):
[Das Bewußtsein] unterscheidet [...] etwas von sich, worauf es sich zugleich bezieht;
oder wie dies ausgedrückt wird: es ist etwas für dasselbe; und die [jeweils so oder so]
bestimmte Seite dieses Beziehens oder des Seins von etwas für ein Bewußtsein ist das
[jeweils beanspruchte] Wissen. Von diesem Sein für ein Anderes [dem Sein des Realen
für das Bewußtsein] unterscheiden wir aber das Ansichsein [des Realen]; das auf das
Wissen Bezogene wird ebenso von ihm unterschieden und gesetzt als seiend auch außer dieser Beziehung; die Seite dieses Ansich heißt Wahrheit [bzw. Realität, sofern
‘Wahrheit’ für Sätze, Meinungen, Bewußtseinsakte reserviert bleiben soll].10
Conrad Cramer hat diese Bestimmung des Bewußtseins treffend Hegels Satz des Bewußtseins
genannt.11 Der Satz enthält die Quintessenz dessen, was wir bisher aus dem realistischen Moment der Wahrheit geschlußfolgert haben. Der Realismus dieses Moments ist nicht der metaphysische, sondern der erkentnistheoretische, d.h. das realistische Moment der Wahrheit (das
des Ansichseins) ist gebunden an ein kognitives Moment (das des Für-mich-Seins). Soviel ist
inbegriffen im bloßen Bewußtsein bzw. im bloßen Erheben irgendeines objektiven Wahrheitsanspruches. Daraus ergibt sich für Hegel das Schicksal des Bewußtseins; denn das Bewußtsein erweist sich in der Phänomenologie des Geistes als der Prozeß, in dem es selber seinen
Realismus und seinen Kognitivismus zur Deckung zu bringen versucht.
Auch den metaphysischen Realismus finden wir in der Einleitung zur Phänomenologie des
Geistes indirekt angesprochen. Indirekt nämlich thematisiert Hegel eine Form der Skepsis, die
der siamesische Zwilling des metaphysischen Realismus ist und die man deswegen die realistische oder auch die metaphysische Skepsis nennen kann. Es ist ja dann, wenn die Wahrheit
radikal nicht-kognitiv ist und in irgendeiner faktischen Korrespondenz zwischen den ansichseienden Tatsachen und unseren Meinungen besteht, in der Tat nicht einzusehen, wie unsere
10
PhG, stw 76. Hervorhebungen im Original.
14
Meinungen mit der Realität und der Wahrheit irgendwie „im Bunde“ sein könnten. Sofern
man nicht eine dritte Instanz, etwa einen allwissenden und allmächtigen Gott, ins Spiel bringt,
die bzw. der unsere Meinungen im großen und ganzen auf die (geschaffene) Realität abgestimmt hat, werden Wahrheit und Wissen für den metaphysischen Realismus zu einem
Glücks- und Ratespiel. Wissentlich (sofern davon noch die Rede sein kann) und willentlich
öffnet der metaphysische Realist der Skepsis Tor und Tür: Je nachdem, wie der Zufall spielt,
sind alle oder fast alle oder die Hälfte oder auch weniger als die Hälfte unserer Meinungen
falsch; wir werden es nie herausfinden.
Gegen seinen Willen wird auch derjenige erkenntnistheoretische Realist in diese Ecke getrieben, der eine repräsentationale Vermittlung - eine Vermittlung durch ein „Begriffsschema“,
wie Davidson sich ausdrückt12 - zwischen der Realität und dem Bewußtsein annimmt. Denn
diese Vermittlung ist unweigerlich ein „Mechanismus“, der, wenn man nicht auch hier wiederum einen allmächtigen „Mechaniker“ bemüht, der ihn wartet, nicht nur hier und da, sondern auch ganz und gar fehlfunktionieren könnte. Ja, selbst wenn er seine Funktion erfüllte,
würde er uns unweigerlich in die Irre führen. Hegel unterscheidet die Fälle rezeptiven und
aktiven Erkennens. Im ersten Fall wäre die repräsentationale Vermittlung eine Art Medium,
durch das hindurch das Reale anscheint; im zweiten Fall eine Art Werkzeug der Erkenntnistätigkeit. In beiden Fällen aber wäre mit einer Zutat zu oder Veränderung an dem Für-uns-Sein
des Realen zu rechnen, die jeweils auf das Konto des Mediums bzw. Werkzeugs ginge, also
mit einer Verfälschung des Ansichseins.
Ich will diesen Gedanken hier nicht weiter ausführen, weil eine ausführliche Kritik des Repräsentationalismus im Lauf der Untersuchung folgen soll. Ich will hier nur dartun, inwiefern Hegel in der Einleitung zur Phänomenologie indirekt den metaphysischen Realismus thematisiert. Die Skepsis, mit der Hegel sich auseinandersetzt, ist diejenige, die aus der Möglichkeit
einer verfälschenden repräsentationalen Vermittlung zwischen der Realität und dem Erkennen
argumentiert. Der betreffende Skeptiker ist also scheinbar sehr bescheiden. Er sagt nicht: „Unser Bewußtsein ist durch ein Begriffsschema oder irgendeine repräsentationale Vermittlung
verfälscht“, sondern vorsichtiger: „Woher wollt ihr wissen, daß unser Bewußtsein nicht verfälscht ist?“ Wenn aber diese Verfälschung prinzipieller Natur sein soll, so daß es logisch
unmöglich ist herauszufinden, daß sie wirklich vorliegt und worin sie besteht (anders als etwa
11
Vgl. [...]. Der Ausdruck „Satz des Bewußtseins“ geht auf Karl Leonhard Reinhold zurück, der mittels des Rekurses auf die Tatsache des Bewußtseins, welcher der Satz des Bewußtseins Ausdruck verleihen sollte, die Kantische Philosophie auf ein unstrittiges Fundament stellen wollte.
15
Farbenblindheit, an der jemand schon seit Jahren leiden mag, bevor es ihm schließlich klar
wird), dann muß der metaphysische Realismus gelten.
Ich will dies noch etwas deutlicher zu machen versuchen anhand zweier bekannter Verfälschungsszenarien. Descartes stellt sich gegen Ende seiner ersten Meditation einen sehr mächtigen bösartigen Dämon vor, der ihn beständig täuscht, selbst bei einfachsten Additionen oder
Schlußfolgerungen. Das ist zwar ein sehr viel eindrucksvolleres skeptisches Szenarium als das
der Farbenblindheit, aber doch insofern vom gleichen Typus, als wir uns, wenn wir schon bei
Dämonen sind, auch einen noch mächtigeren gutartigen vorstellen können, der dem schlimmen Spiel irgendwann ein Ende setzt, so wie der Augenarzt, der uns über unsere Farbenblindheit wenigstens aufklärt, wenn er sie auch nicht kurieren kann. Ganz ähnlich verhält es sich
mit dem Szenarium der Gehirne im Tank, das der amerikanische Philosoph Hilary Putnam
entworfen hat.13 Wenn ein bösartiger Superwissenschaftler mein Gehirn explantiert hat und es
in einer Nährlösung verwahrt und seine Nevenendungen durch einen Großrechner so reizen
läßt, das mir (bzw. meinem Gehirn) eine normale menschliche Umwelt vorgegaukelt wird,
dann kann es auch einen gutartigen Megawissenschaftler geben, der meinem Gehirn bzw. mir
zur Wahrheit zurückverhilft. Das Täuschungsszenarium ist hier das einer Detektivgeschichte,
also ein empirisches, kein philosophisches. Philosophisch wäre es dann und nur dann, wenn
Abhilfe logisch unmöglich wäre, d.h. wenn der metaphysische Realismus gälte. Das war gemeint, als ich oben die realistische bzw. metaphysische Skepsis einen siamesischen Zwilling
des metaphysischen Realismus nannte. Wenn die Wahrheit radikal nicht-kognitiv ist, dann
wird es zur Geschmacksache, ob ich als realistischer Realist oder als realistischer Skeptiker
auftrete; eine theoretisch begründete Entscheidung zwischen diesen Optionen ist dann nicht
mehr möglich.
Daher kann Hegel, ohne sich des Dogmatismus schuldig zu machen, die Skepsis, die sich auf
die Möglichkeit einer epistemischen (repräsentationalen, begriffsschematischen, ...) Vermittlung beruft, als irrelevant beiseiteschieben. Wenn ihr Täuschungsszenarium nicht empirisch,
sondern philosophisch gemeint ist, dann muß es sich um diejenige Skepsis handeln, die den
metaphysischen Realismus voraussetzt.14 Das Bewußtsein aber, das den Gegenstand der Un-
12
Vgl. Davidson, „Was ist eigentlich ein Begriffsschema?“, in: ders., Wahrheit und Interpretation, Ffm 1986,
261-282.
13
Vgl. [...]
14
Hegel geht überdies in die Offensive, indem er den metaphyischen Realismus wie folgt ad absurdum zu führen
versucht: Die Skepsis setzt mit dem metaphysischen Realismus „vorzüglich aber dies [voraus], daß das Absolute
auf einer Seite stehe und das Erkennen auf der andern Seite für sich und getrennt von dem Absoluten doch etwas
Reelles [sei], oder hiermit, daß das Erkennen, welches, indem es außer dem Absoluten, wohl auch außer der
16
tersuchung bildet, ist, wie wir gesehen haben, kein metaphysischer Realist, sondern unterstellt
den kognitiven Charakter der Wahrheit und den Präsentationalismus; und die Phänomenologie des Geistes ist die Theorie einer Entwicklung, in der sich das Bewußtsein an der genannten Unterstellung systematisch abarbeitet.
2. Die prädikative Gliederung
§ 4. Propositionen, Sachverhalte, Tatsachen
Aus dem realistischen Moment der Wahrheit haben wir unsere durchgängige Fehlbarkeit und
die Zweiwertigkeit unserer Urteile hergeleitet. Was heißt es aber, daß wir uns in einem gegebenen Fall irren, daß eines unserer Urteile falsch ist? Nun, in einem solchen Fall meinen wir,
daß etwas der Fall ist, das in Wahrheit nicht der Fall ist. Wenn wir ‘p’ als einen Schemabuchstaben für Sätze verwenden, dann können wir dies schematisch so ausdrücken: Wir meinen,
daß p, aber es ist nicht der Fall, daß p.
Meinungen, Urteile, Bewußtseinszustände sind schwer zu fassen. Die sprachphilosophische
Wende der Philosophie ist daher zumindest insofern zu begrüßen, als sie uns mit den sprachlichen Äußerungen handfeste Vollzugsweisen von Meinungen, Urteilen, Bewußtseinszuständen
vorgibt, an die wir uns fürs erste halten können. Jemand äußert - ernsthaft und aufrichtig - einen falschen Satz - das ist ein klarer Fall von Irrtum. Freilich kann man mit ganz verschiedenen Worten ein und denselben Wahrheitsanspruch erheben. Das liegt zum einen an den sogenannten Indikatoren oder indexikalischen Ausdrücken, die sich zu verschiedenen Äußerungsgelegenheiten auf Verschiedenes beziehen: Das Wort ‘heute’ bezieht sich auf den Tag, an dem
es jeweils geäußert wird, ‘ich’ auf den jeweiligen Sprecher usw. Indexikalische Sätze, d.h.
Sätze, in denen Indikatoren vorkommen, sind wahr zu bestimmten Äußerungsgelegenheiten
und falsch zu anderen Äußerungsgelegenheiten. Mit einem indexikalischen Satz (wie „Gestern war ich krank“) werden zu verschiedenen Gelegenheiten von verschiedenen Sprechern
ganz verschiedene Wahrheitsansprüche erhoben.
Zum anderen gibt es verschiedene Sprachen. Der eine sagt auf englisch: „Snow is white“, die
andere auf deutsch: „Schnee ist weiß“, und beide meinen (und sagen in einem gewissen Sinn)
dasselbe. Die beiden Sätze haben dieselbe Bedeutung oder, in einer anderen Terminologie,
denselben Sinn. Gottlob Frege, der die Mathematik auf die Logik zurückzuführen versuchte
Wahrheit [bzw. Realität] ist, doch wahrhaft sei, - eine Annahme, wodurch das, was sich Furcht vor dem Irrtum
nennt, sich eher als Furcht vor der Wahrheit zu erkennen gibt.“ (PhG, S. 70)
17
und dazu der Logik selber ein neues Fundament gab und der dabei, indem er semantische Begriffe a priori bestimmte, die sprachphilosophische Wende einläutete, nannte den Sinn eines
Satzes den Gedanken, den der Satz ausdrückt. Verschiedene Sätze können denselben Sinn
haben bzw. denselben Gedanken ausdrücken; und mit ein und demselben Satz können, wenn
er mehrdeutig ist oder wenn er einen Indikator enthält, verschiedene Gedanken ausgedrückt
werden.
Freges Terminologie hat sich nicht durchgesetzt. Wo er vom Sinn spricht, redet man allgemein von der (sprachlichen) Bedeutung, und der Sinn eines Satzes bzw. der Gedanke heißt
gewöhnlich Proposition. Das ist deswegen besonders verwirrend, weil Frege das Wort ‘Bedeutung’ seinerseits als einen Terminus technicus, und zwar als einen Kontrastterminus zu
‘Sinn’ benutzte. Unter der Bedeutung eines sprachlichen Ausdrucks verstand er dessen Bezugsgegenstand. Die Eigennamen ‘Abendstern’ und ‘Morgenstern’, um eines seiner Beispiele
anzuführen, haben dieselbe Bedeutung (denselben Bezug), nämlich den Planeten Venus, aber
nicht denselben Sinn; denn jemand kann das Wort ‘Abendstern’ verstehen, d.h. seinen Sinn
kennen, ohne zu wissen, daß der Abendstern mit dem Morgenstern identisch ist (die Identität
mußte durch Himmelsbeobachtung entdeckt werden). Frege unterschied daher grundsätzlich für Namen, Prädikate und Sätze - zwischen zwei verschiedenen semantischen Werten: Sinn
und Bedeutung. Den Sinn eines Ausdrucks erfassen wir im Denken, indem wir den Ausdruck
mit Verständnis gebrauchen. Die Bedeutung andererseits gehört zur Seite der gegenständlichen Realität, auf die wir uns mittels der Sinne im Erkennen beziehen. Um Verwirrung zu
vermeiden, folge ich aber fortan dem allgemeinen Sprachgebrauch und nenne, was Frege Sinn
nennt, meistens die Bedeutung und was Frege Bedeutung nennt, immer den Bezug (latinisierend die Referenz) bzw. den Bezugsgegenstand (den Referenten) eines Ausdrucks.
Aus: „Der Sinn eines Satzes ist der Gedanke, den der Satz ausdrückt“, wird auf diese Weise:
Die Bedeutung eines Satzes ist die Proposition, die der Satz ausdrückt. Und wenn man sich
auf Bedeutungen als auf Entitäten eigenen Rechtes wirklich einlassen möchte, dann kann man
die Propositionen nun als die primären und die Sätze als sekundäre Wahrheitsträger ansehen.
In erster Linie wahr oder falsch wäre demzufolge eine Proposition, in zweiter Linie dann ein
Satz, der sie ausdrückt. (Wir werden aber sehen, daß dies eine unratsame Entscheidung wäre.)
Die Unterscheidung zwischen Bedeutung (Sinn) und Bezug scheint, wenn man sie auf Sätze
bezieht, Wasser auf die Mühlen der Korrespondenztheorie zu leiten. Ein Satz ist wahr, so
könnte man meinen, wenn seine Bedeutung (die Proposition) wahr ist, d.h. mit dem Bezugsgegenstand des Satzes übereinstimmt. Frege selber hat diese korrespondenztheoretischen
18
Hoffnungen, wie wir in Teil II sehen werden, allerdings enttäuscht, indem er als den Referenten aller wahren Sätze ein und denselben seltsamen Gegenstand: das Wahre, einführte und als
den Referenten aller falschen Sätze das Falsche. Aber sehen wir von dieser besonderen Theorieentwicklung einmal ab. Dann liegt es scheinbar auf der Hand zu sagen: Eine Proposition ist
wahr, wenn sie sich auf eine angemessene Portion der Realität: auf eine Tatsache, bezieht.
Worauf aber sollen sich nun falsche Sätze bzw. Propositionen beziehen? In einem falschen
Satz wird etwas ausgesagt, was nicht der Fall ist, also ein - in einem gewissen Sinn - Nichtseiendes (Nicht-der-Fall-Seiendes). Also wird man vielleicht sagen wollen, daß einem falschen
Satz nichts Reales entspricht, daß er folglich keinen Bezug hat. Da das für alle falschen Sätze
gleichermaßen gilt, wird man deren Bedeutungsverschiedenheiten (die verschiedenen Propositionen, die sie ausdrücken) ohne Rückgriff auf Bezugsobjekte erklären müssen. Eine Alternative dazu wäre es, den Begriff der Realität so zu erweitern, daß auch bloß Mögliches als real
gedacht werden kann. Das deutsche Wort ‘wirklich’ ist ja auf interessante Weise zweideutig;
es bedeutet zum einen soviel wie ‘real’, zum anderen soviel wie ‘aktual’, und es ist in dieser
zweiten Bedeutung ein Kontrastwort zu ‘möglich’ und drückt eine der sogenannten Modalitäten, eben die Modalität der Wirklichkeit oder, wie man auch sagen kann, der Aktualität aus.
Wenn man nun annimmt, daß das bloß Mögliche nicht minder real ist als das Aktuale (die
These des modalen Realismus), dann kann man als Bezugsobjekte falscher Sätze, sofern sie
nur nicht notwendigerweise falsch sind, „Tatsachen“ postulieren, die keine aktualen, sondern
bloß mögliche Tatsachen sind. Und da man vielleicht das Wort ‘Tatsache’ lieber für Aktuales
reservieren möchte, kann man stattdessen von Sachverhalten reden und sagen, daß sich jeder
sinnvolle und möglicherweise wahre Satz auf einen Sachverhalt bezieht und daß jeder wahre
Satz sich auf einen Sachverhalt bezieht, der aktualiter besteht und daher eine Tatsache ist.
Jeder (zufällig) falsche Satz bezöge sich demnach auf einen nicht (aktualiter) bestehenden
Sachverhalt und damit - wenn man den modalen Realismus akzeptiert - immerhin noch auf
etwas Reales.
Wir schwelgen ein wenig in theoretischen Optionen, deren Für und Wider im Vagen bleibt.
Wir tun es, um ein theoretisches Verständnis der Irrtumsmöglichkeit zu gewinnen, um zu verstehen, was es heißt, daß jemand etwas Falsches meint oder sagt. Der modale Realismus, d.h.
die Annahme als real des bloß Möglichen, wird zwar von David Lewis beredt propagiert15, ist
aber gewiß nicht jedermanns Sache. Versuchen wir es daher lieber einmal mit der erstgenannten Alternative. Referentielle Ausdrücke, d.h. Ausdrücke, deren Art es ist, sich auf etwas zu
19
beziehen, werden Termini (auch kurz Terme) genannt. Unser Problem ist folgendes: Wenn
Sätze Termini sind, d.h. wenn sie sich (als Sätze) auf etwas beziehen, dann müssen wir achtgeben, daß falsche Sätze uns nicht unter der Hand zu sinnlosen Gebilden zerrinnen und daß
uns nicht in der Folge unsere Fehlbarkeit, die doch aus dem realistischen Moment der Wahrheit folgt, zum unlösbaren Rätsel wird. Wie können wir falsche Sätze verstehen? Wie können
Termini, wenn doch der Objektbezug zu ihrem Wesen gehört, auch in den Fällen sinnvoll
sein, in denen der Bezug entfällt?
Bertrand Russell hat sich diese Frage in Beziehung nicht auf Sätze, sondern auf singuläre Termini, d.h. Termini für einzelne Gegenstände (insbesondere Eigennamen) gestellt und sie durch
seine sogenannte Theorie der Kennzeichnungen beantwortet. Ein Russellsches Beispiel ist der
singuläre Terminus ‘der gegenwärtige König von Frankreich’, der auf nichts zutrifft, keinen
realen Objektbezug hat und den wir dennoch verstehen, da wir Sätze verstehen wie ‘Der gegenwärtige König von Frankreich existiert nicht’ oder ‘Der gegenwärtige König von Frankreich ist kahl’. Wie kommt es, daß wir diesen bezugslosen singulären Terminus dennoch verstehen? Russell beantwortete die Frage, indem er innerhalb der Kategorie der singulären Termini zwischen logischen Eigennamen und Kennzeichnungen unterschied. (Als dritte Subkategorie sollte man die Indikatoren nicht vergessen; aber davon sehen wir im gegenwärtigen Zusammenhang einmal ab.) Logische Eigennamen sind Termini, deren Sinn die Existenz ihres
Bezugsobjektes erfordert. Wenn man jemandem den Sinn (die sprachliche Bedeutung) eines
logischen Eigennamens erklären will, dann muß man - wie indirekt auch immer - den Träger
des Namens ins Spiel bringen. Der Terminus ‘der gegenwärtige König von Frankreich’ ist
nicht von dieser Art. Wir verstehen ihn, obwohl es niemanden gibt, auf den er sich bezieht,
weil wir die Termini verstehen, aus denen er zusammengesetzt ist; es handelt sich nicht um
einen Eigennamen, sondern um eine Kennzeichnung (auch definite Beschreibung genannt).
In seiner Theorie der Kennzeichnungen hat Russell gezeigt, wie jede Kennzeichnung kontextuell definiert, also eliminiert, durch einen anderen Ausdruck ersetzt werden kann. Zwar kann
man eine Kennzeichnung nicht direkt, nicht durch einen nichtkennzeichnenden Ausdruck der
gleichen Kategorie (einen nichtkennzeichnenden singulären Terminus) definieren. Man kann
also beispielsweise nicht schreiben: ‘Der gegenwärtige König von Frankreich =df XYZ’, wobei ‘XYZ’ ein Eigenname oder ein Indikator ist. Aber den Satz ‘Der gegenwärtige König von
Frankreich ist kahl’ und alle anderen Sätzen, in denen der Terminus vorkommt, kann man so
umformulieren, daß der Terminus nicht mehr vorkommt, und zwar nach folgendem Muster:
15
Lewis, On the Plurality of Worlds, [...].
20
Der gegenwärtige König von Frankreich ist kahl ↔df Es gibt einen Gegenstand, x, von
dem gilt: x ist gegenwärtig König von Frankreich [d.h. es gibt mindestens einen gegenwärtigen König von Frankreich], und für alle Gegenstände, y, gilt: wenn y gegenwärtig König von Frankreich ist, dann ist x = y [d.h. es gibt höchstens einen gegenwärtigen König von Frankreich], und x ist kahl.
Der Doppelpfeil ‘↔’ ist zu lesen ‘dann und nur dann, wenn’ oder ‘genau dann, wenn’, und
das wird bisweilen auch abgekürzt als ‘gdw’. In der Schreibweise der Prädikatenlogik läßt
sich das Ganze etwas kürzer formulieren. Für ‘der gegenwärtige König von Frankreich’
schreibt man zunächst in der Standardform für Kennzeichnungen ‘derjenige Gegenstand, x,
für den gilt: x ist gegenwärtig König von Frankreich’. Dabei wird der (zu definierende) Ausdruck ‘derjenige Gegenstand, x, für den gilt’ mittels des sogenannten Kennzeichnungs- oder
Iota-Operators abgekürzt als ‘(x)’. Den komplexen generellen Terminus (das Prädikat) ‘gegenwärtig König von Frankreich’ schreiben wir als ‘F’ und den generellen Terminus ‘ist kahl’
als ‘K’. Den sogenannten Existenzquantor ‘es gibt ein Objekt ..., für das gilt’ kürzt man ab
durch ein umgekehrtes ‘E’: ‘(∃ ...)’, den Allquantor ‘für alle Objekte ... gilt’ durch ein umgekehrtes ‘A’: ‘(∀...)’; für ‘und’ schreiben wir ‘∧’ und für ‘wenn ..., so’ den Pfeil ‘→’. Klammern
benutzen wir als Hilfszeichen, um den Ausdruck zu strukturieren. Dann können wir die Definition wie folgt reformulieren:
(x)(x ist F) ist K ↔df (∃ x)(x ist F ∧ (∀y)(y ist F →x=y) ∧ x ist K)
Das Definiendum ‘(x)(x ist F) ist K‘ entpuppt sich so, auf dem Umweg über sein Definiens,
als ein zwar sinnvoller, aber falscher Satz: Es gibt eben kein solches x, für das gilt: (x ist F ∧
(∀y)(y ist F →x=y) ∧ x ist K). Das ist, in nuce, Russells Theorie der Kennzeichnungen, die
zugleich ein schönes Beispiel für eine Kontextdefinition abgibt. Wir ziehen aus ihr die Lehre,
daß wir einen bezugslosen singulären Terminus dann verstehen können, wenn er komplex ist
und wenn wir seine Bestandteile und sein Kompositionsprinzip verstehen. Unter den Bestandteilen können wiederum bezugslose singuläre Termini vorkommen und unter deren Bestandteilen wiederum - aber nicht ins Endlose. Der Regreß muß irgendwann zu Ende gehen, wenn
der Gesamtausdruck eine Bedeutung haben soll.
Wenn wir diese Lehre von singulären Termini auf Sätze übertragen, dann gewinnt die theoretische Option, uns die Irrtumsmöglichkeit dadurch verständlich zu machen, daß wir falsche
Sätze als bezugslos auffassen, Konturen. Unsere fehlbaren Meinungen drücken wir in Sätzen
21
aus; Sätze sind daher wesentlich zweiwertig und eben deswegen - damit sie sowohl sinnvoll
als auch falsch (bezugslos) sein können - wesentlich komplex. Das muß selbst noch für diejenigen Sonderfälle gelten, in denen ein Satz de facto nur aus einem Wort besteht. Auch die Äußerung eines Einwortsatzes (wie „Rot!“ angesichts einer Ampel) muß noch als logisch komplex aufgefaßt werden können, etwa als eine Anwendung eines Allgemeinbegriffes (‘Rot’) auf
ein gegebenes Raumzeitgebiet.
Nun haben wir zwei Optionen für weitere Bearbeitung zur Auswahl: eine Version des modalen Realismus, der zufolge Sachverhalte, auch nicht-bestehende, real sind, und die These, daß
Meinungen, Urteile, Sätze wesentlich logisch komplex sind (Komplexionsthese).
§ 5. Das propositionale Als
Die Überlegungen des vorigen Paragraphen, die zu der Alternative von Sachverhaltsrealismus
und Komplexionsthese führten, standen unter der Prämisse des Termcharakters bzw. Realitätsbezuges von Sätzen. Wenn wir uns von dieser Prämisse lösen, wird die Komplexionsthese
(mit oder ohne Sachverhaltsrealismus) unvermeidlich. Wenn nämlich Sätze keine Terme sind,
sind sie erst recht komplex, weil sie in diesem Fall, da sie sich um des realistischen Momentes
der Wahrheit willen wenigstens indirekt auf Reales beziehen, Teilausdrücke mit direktem Objektbezug, also Terme enthalten müssen. Die Komplexionsthese können wir daher als gesichert festhalten, womit die theoretische Motivation für den Sachverhaltsrealismus weitgehend
entfällt. Wir wollen die Frage der Sachverhalte aber zunächst noch offenlassen.
Manche Sätze haben wiederum Sätze unter ihren Bestandteilen. Wenn aber die Komplexionsthese gilt, dann muß es bei der Zergliederung eines Satzes früher oder später zu einem Kategoriensprung auf eine subsententiale Ebene kommen, auf der wir Ausdrücke antreffen, die
keine Sätze mehr sind. Denn Sätze sind der These zufolge keine logisch einfachen Ausdrücke,
und selbst die kürzesten, die sogenannten atomaren Sätze, können atomar nur als Sätze, nicht
als sprachliche Ausdrücke sein. Um herauszufinden, aus welchen „subatomaren“ (nämlich
subsententialen) Bestandteilen atomare Sätze auf welche Weise zusammengesetzt sind, haben
wir die Wahl zwischen zwei Ausgangspunkten: Wir können uns der Sache sozusagen von
oben oder von unten nähern. Von oben kommen wir, indem wir uns an der semantischen
Funktion der Sätze orientieren: daran, daß wir sie verwenden, um objektive Wahrheitsansprüche zu erheben. Unten hingegen haben wir den grammatischen Befund, daß die kürzesten Sätze in der Regel aus einem Nomen und einem Verb bestehen. Wenn wir insbesondere an lo-
22
gisch reglementierte Sprachen denken, können wir die grammatische Faktizität noch ein wenig näher an ihre logisch-semantische Basis heranbringen und feststellen, daß in den kürzesten
Ausdrücken, die noch wahr oder falsch sind, also in den atomaren Sätzen, ein singulärer Terminus zusammen mit einem generellen Terminus vorkommt bzw., allgemeiner gesprochen, n
singuläre Termini mit einem n-stelligen generellen Terminus vorkommen. Die atomaren bzw.
singulären Sätze haben also, logisch reglementiert, die Form ‘Fa’ oder ‘Rab’ oder ‘Sabc’, ... ,
wobei ‘F’, ‘R’, ‘S’, ... Schemabuchstaben für generelle und ‘a’, ‘b’, ‘c’, ... Schemabuchstaben
für singuläre Termini sind.
Doch um der grammatischen Faktizität eine Notwendigkeit abzugewinnen, müssen wir uns
dem singulären Satz von oben nähern. Aus dem realistischen Moment der Wahrheit folgt, daß
Sätze irgendwie, sei es direkt, sei es indirekt, auf Realität bezogen sind. Die Notwendigkeit,
zwischen einem direkten oder starken und einem indirekten oder schwachen Realitätsbezug zu
unterscheiden, zeigt sich dabei anfangs gar nicht. Anfangs haben wir nur einen Anspruch auf
ein objektives Der-Fall-Sein, der mit der Satzverwendung einhergeht. Abstrahiert man von
unserer Fehlbarkeit, so könnte das der Fall seiende Reale aus Tatsachen - einzelnen Seienden,
griechisch onta - bestehen, die sich als die Atome des Realen unserem erkennenden Denken
zeigen und die wir in unseren verlautbarten Sätzen, zum Nutzen unserer Mitmenschen,
sprachlich anzeigen. Unsere Fehlbarkeit aber ist eine Folge des realistischen Momentes und
daher so wesentlich wie der Realitätsbezug selber; und das bedeutet, daß unsere Sätze die Tatsachen auch verfehlen können und daß es zu jedem treffenden (wahren) Satz einen verfehlenden (falschen) gibt: seine Negation. Das war der Grund für die Alternative von Sachverhaltsrealismus und Komplexionsthese, und indem wir uns nun an letztere halten, der Grund für die
Einführung von Satzteilen, durch welche der Realitätsbezug des Satzes wesentlich vermittelt und insofern indirekt - sein könnte.
Wenn wir nun kurz auf das andere Glied der Alternative, den Sachverhaltsrealismus, zurückblicken, so ist das Treffen oder Nichttreffen der Realität durch einen Satz wie folgt aufzufassen. Ein sinnvoller Satz trifft unausweichlich Reales, entweder, wenn er wahr ist, einen wirklich bestehenden Sachverhalt, d.h. eine Tatsache, oder, wenn er falsch ist, einen Sachverhalt,
der zwar als ein reales Seiendes existiert, aber eben nicht als ein bestehendes Seiendes, d.h.
nicht als eine Tatsache. Doch diese Irrtumsdiagnose ist so noch unvollständig. Inwiefern, so
ist noch zu fragen, täuschen wir uns eigentlich, wenn wir, indem wir ein falsches Urteil fällen
bzw. einen falschen Satz äußern, doch ein reales Seiendes erfassen, einen Sachverhalt nämlich, wenn auch einen, der die Eigenschaft hat, nicht als Tatsache zu bestehen? Die Antwort -
23
hierfür das ganze Ausweichmanöver hin zu den Sachverhalten - muß offenkundig lauten, daß
das urteilende Erfassen eines Sachverhaltes unweigerlich ein Erfassen-als-bestehend ist und
daß der Irrtum darin liegt, daß wir einen nicht-bestehenden Sachverhalt als bestehend erfassen. Zum Irrtum gehört demnach zweierlei in einem: Bezugnahme und Prädikation, im gedachten Fall die denkende Bezugnahme auf einen realen, aber nicht bestehenden Sachverhalt
und sein prädikatives Erfassen als bestehend.
Diese Antwort ist auf fruchtbare Weise verräterisch. Gerade der Sachverhaltsrealismus, den
wir zunächst als Alternative zur Komplexionsthese gehandelt haben, kommt ohne die Annahme eines prädikativen (auch propositional, auch apophantisch genannten) ‘als’ nicht aus,
welches auf eine unhintergehbare logische Gliederung der Aussage, demnach auf eine komplexe oder synthetische Struktur des Satzes, hinweist. Wenn uns der Sachverhaltsrealismus
das propositionale Als aber nicht ersparen kann, dann können wir uns mit diesem auch auf
eine ontologisch kostengünstigere Weise, ohne reale Sachverhalte in Kauf zu nehmen, anfreunden. Wir brauchen dazu nur die Komplexionsthese zu bekräftigen und die logische
Grundkomplexion als die des propositionalen Als bzw. als die der Prädikation auszulegen. So
schlagen wir viele Fliegen mit einer Klappe: Wir vermeiden den Sachverhaltsrealismus; wir
spezifizieren die logische Komplexion (die Satzverbindung) als die von Bezugnahme und
Prädikation; wir treffen damit den grammatischen Befund, daß der atomare Satz aus einem
generellen Terminus und (mindestens) einem singulären Terminus besteht; und wir deuten
diese faktische grammatische Komplexion als Ausdruck zweier zusammengehöriger semantischer Rollen, der bezugnehmenden (designativen) Rolle singulärer und der charakterisierenden (prädikativen) Rolle genereller Termini, wodurch das grammatische Faktum als Folge des
realistischen Momentes der Wahrheit verständlich wird.
Bevor wir das erreichte Ergebnis weiter bearbeiten, Schlußfolgerungen aus ihm ziehen, es
durch zusätzliche Gründe sichern, es gegen Alternativen profilieren usw., sei kurz auf sein
ehrwürdiges Alter hingewiesen. Wir verdanken die Einsicht in den begrifflichen Zusammenhang von Der-Fall-Sein, Irrtumsmöglichkeit und unhintergehbarer Bifunktionalität von Bezugnahme und Prädikation dem späten (vielleicht schon durch seinen Schüler Aristoteles angeregten?) Platon. In dem Platonischen Dialog Sophistes bemühen sich die Unterredner, ein
fremder Philosoph aus Elea, der Heimat des Parmenides, und der junge athenische Mathematiker Theaitet, eine haltbare Definition des Sophisten zu finden. Nachdem sie sich schließlich
darauf verständigt haben, daß der Sophist als professioneller Verfertiger von täuschendem
Schein zu bestimmen ist, nimmt das Gespräch eine neue, überraschende Wendung. Der eleati-
24
sche Fremde, der das Gespräch lenkt, gibt zu bedenken, daß der Sophist schwer zu fassen ist
und daß er versuchen wird, sich der unfreundlichen Definition zu entziehen. Bemerkenswerterweise kann er sich zu diesem Zweck gerade auf Parmenides, den Lehrer des Fremden, berufen. Parmenides nämlich hatte gelehrt, daß das Nichtseiende weder ist noch denkend erfaßt
werden kann. Sich oder andere täuschen aber besteht darin, zu denken bzw. zu sagen, was
nicht (der Fall) ist. Wenn nun das Nichtseiende nicht gedacht (und folglich auch nicht mit
Verstand gesagt) werden kann, dann gibt es keinen Irrtum und keine Täuschung, und dann
kann es auch keine kunstvolle Verfertigung von täuschendem Schein geben. Also ist die vorgeschlagene Definition des Sophisten falsch.
Soweit der sophistische Versuch, die Definition des Sophisten als Künstler des Scheins zu
entkräften. Der Sache nach haben wir uns im vorigen mit eben dieser Problematik befaßt und
wissen daher, was dem Sophisten zu entgegnen ist. Damit das Nichtseiende wenigstens in
dem minimalen Sinn sein kann, der nötig ist, damit es denkend erfaßt (und in der Folge als
seiend ausgesagt) werden kann, bedarf es einer unhintergehbaren Gliederung des irrtumsanfälligen Denkens, und diese Gliederung ist diejenige des propositionalen Als. Wir finden sie
vor, so läßt Platon den Fremden erklären, als eine Dualität von onoma (Name) und rhema
(Verb) selbst noch in den unüberbietbar kurzen Sätzen wie ‘Theaitet sitzt’ oder ‘Theaitet
fliegt’. Ich nehme mittels eines Namens auf Theaitet Bezug und charakterisiere ihn mittels
eines Verbs als sitzend und sage damit die Wahrheit; ich nehme auf Theaitet Bezug und charakterisiere ihn als fliegend und täusche darin mich und gegebenenfalls meine Zuhörer.
Dieser Platonischen Vorgabe bin ich im vorigen gefolgt; und ich möchte noch eine Weile in
ihrem Umkreis bleiben. Für die Realität von Sachverhalten, jedenfalls von bestehenden Sachverhalten oder Tatsachen, spricht das veritative Sein, das wir in jedem Wahrheitsanspruch für
ein bestimmtes Seiendes, ein on, beanspruchen. Erst das Fehlgehenkönnen unserer Wahrheitsansprüche bringt uns darauf, daß wir neben den Tatsachen auch nicht-bestehende Sachverhalte, neben den onta auch Nicht-der-Fall-Seiendes als irgendwie seiend annehmen müßten,
wenn nicht generell der Realititätsbezug unserer Aussagen, auch der wahren, durch Ausdrücke
unterhalb der Satzebene, Termini, vermittelt wäre. Das aber bedeutet, daß das veritative oder
Der-Fall-Sein in unserem fehlbaren Denken notwendigerweise eine prädikative Form annimmt, die sich in der Urteilsgliederung zeigt und die in der finiten Verbform oder mittels einer Form des Hilfsverbs ‘sein’ auch explizit gemacht werden kann. Das anfängliche, nämlich
das für das Faktum der Wahrheit charakteristische Sein, also das Der-Fall-Sein wird so in unserem Denken gebrochen zum prädikativen Sein, dem Sein im Sinne der Kopula (‘a ist F’).
25
Der Realitätsbezug, der im Der-Fall-Sein liegt, offenbart dabei als seinen angestammten Ort
die Subjektstelle des Satzes, d.h. diejenige Stelle, an der mittels eines singulären Terminus auf
ein Objekt Bezug genommen wird. So löst sich von dem prädikativ gebrochenen Der-FallSein eines Sachverhaltes die Existenz eines Objektes als eine nachgeordnete, aber unverzichtbare Seinsgestalt ab. Diese Differenz zwischen Der-Fall-Sein und Existenz, werde ich im folgenden als die ontologische Differenz bezeichnen. Es gibt andere Verwendungsweisen für
diesen Ausdruck; wie sie mit der gerade eingeführten, die ich für grundlegend halte, zusammenhängen, soll bei passender Gelegenheit erläutert werden.
Die ontologische Differenz vor Augen, kann man sagen, daß Sachverhalte der Fall sein (als
Tatsachen bestehen), aber nicht realiter existieren können. Dasjenige Sein, das um der Irrtumsmöglichkeit willen auch dem Nicht-(der-Fall-)Seienden zugesprochen werden muß, ist
allenfalls eine nachgeordnete Form der Existenz, die sich dann ergibt, wenn man sich erlaubt,
als die Existenz eines Sachverhaltes schlicht sein Bestehen-oder-nicht-Bestehen zu bezeichnen. In verbis simus faciles! Wenn wir wollen, können wir als bequeme Redensarten allerlei
abstrakte Entitäten nach dem Modell realer Objekte einführen. Wie sich in Teil V zeigen wird,
bilden die raumzeitlichen Einzeldinge unsere grundlegenden Objekte, dasjenige also, von dem
wir in erster Linie und ohne Übertragung sagen können es existiere realiter. In zweiter, dritter,
vierter Linie können wir, wie gesagt, nach dem Vorbild des eigentlich Realen weitere Sorten
von Entitäten einführen, sei es ernsthaft, sei es als Redensarten. Sachverhalte gehören, wie
sich weisen wird, zu den Redensarten. Ihre - nachgeordnete, per Analogie gedachte - Existenz
ist, um es zu wiederholen, nichts anderes als ihr Bestehen-oder-nicht-Bestehen, und zwar
nicht an ihnen selbst, sondern an anderem. Das ergibt, wenn man hinter die ontologische Differenz in der Redeweise zurückgeht und das Bestehen mit der Existenz zusammenfallen läßt,
den seltsamen, paradox klingenden Ausdruck: Das Sein (i.S.v. Existenz) eines Sachverhaltes
ist sein Sein-oder-Nichtsein (Bestehen-oder-Nichtbestehen).
§ 6. Einzelnes und Allgemeines
Wenn im propositionalen Als die Lösung des Problems der Irrtumsmöglichkeit liegt, dann
müssen wir nicht nur eine fundamentale semantische Differenz zwischen Sätzen und Termini,
sondern eine nicht minder fundamentale Differenz innerhalb der Termini annehmen. Es verhält sich dann nicht so, daß generelle und singuläre Termini gleichermaßen einen Realitätsbezug herstellen, aus dem der Satz als ganzer dann seinen eigenen Realitätsbezug gewinnt. D.h.
26
es verhält sich nicht so, daß alle Termini etwas bezeichnen und verschiedene Sorten von Termini Verschiedenes: generelle Termini „Generalia“ oder Universalien und singuläre Termini
„Singularia“ oder Partikularien, kurz und deutsch, Allgemeines bzw. Einzelnes. Um die im
vorigen Paragraphen vorgetragene Lösung zu profilieren und noch besser zu begründen, soll
nun diese - unhaltbare - Alternative ein Stück weit entwickelt werden.
Nehmen wir also an, singuläre Termini und generelle Termini seien durchweg Designatoren,
kurz: Namen; jene Namen für Einzeldinge, diese Namen für allgemeine Eigenschaften oder
Relationen. In dem Satz ‘Theaitet fliegt’ werden demnach von den beteiligten Termini die
einzelne Person Theaitet und die allgemeine Tätigkeit des Fliegens bezeichnet. Soweit liegt
freilich nur Bezugnahme auf zwei Entitäten vor, noch kein Satz, der wahr oder falsch sein
könnte. Der Satz muß daher die beiden Entitäten in irgendeinem Verhältnis präsentieren. Ein
Name für dieses Verhältnis oder diese Beziehung ist auch leicht gefunden: ‘Exemplifikation’
ist für unsere gegenwärtigen Zwecke so gut wie jeder andere (‘Instantiierung’, ‘Haben’, usw.).
Wenn Theaitet fliegt, so exemplifiziert (instantiiert, hat, ...) er die temporäre Eigenschaft des
Fliegens. So kann man reden; doch wenn das keine bloße Redensart sein, sondern der Analyse
des Satzes ‘Theaitet fliegt’ dienen soll, dann ergibt sich ein Problem. Beziehungen sind dem
gegenwärtigen Modell zufolge allgemeine Entitäten, die von jeweils mehreren Einzelnen exemplifiziert werden. Die Beziehung des Älterseins etwa wird von allen Paaren von Einzeldingen exemplifiziert, deren erstes älter als das zweite ist. Das gilt dann auch für die Beziehung
der Exemplifikation: Sie wird exemplifiziert von einem oder mehreren Einzelnen und einer
allgemeinen Entität (Eigenschaft oder Beziehung), die durch diese Einzelnen exemplifiziert
wird. Wenn Theaitet fliegt, dann exemplifizieren Theaitet und das Fliegen (in dieser Reihenfolge genommen) die Exemplifikation.
Wir geraten auf diese Weise, wenn wir die Prädikation durch die Annahme einer Exemplifikationsbeziehung analysieren und erklären wollen, in einen unendlichen Progreß von Erklärungen, dem ein unendlicher Regreß im logischen Aufbau des Satzes entspräche. Das ist der
bekannte Regreß des Dritten in der Prädikation, das ein Viertes, Fünftes, Sechstes, ... nach
sich zieht.16
16
Die Annahme, daß alle Termini Namen sind, ist damit noch nicht endgültig widerlegt. Man kann das Dritte
(die Exemplifikation) regreßfrei denken, wenn man es wie Wittgenstein in der Logisch-Philosophischen Abhandlung als eine unvergleichliche Singularität faßt: als das, was allen Tatsachen gemeinsam ist, die bloße Tatsächlichkeit oder, wie Wittgenstein sagt, die Form des Der-Fall-Seins. Die benannten Gegenstände (einzelne wie
allgemeine) kommen dann immer nur in Tatsachen, nie isoliert vor, und sie kommen vor dank der Form des DerFall-Seins. Isoliert betrachtet sind sie gar nicht real oder, etwas zurückhaltender und differenzierter gesprochen:
nur möglicherweise real, nicht aktualiter real. Dann aber ruht der primäre Realitätsbezug - der Bezug auf aktuale
27
Durch die mit dem propositionalen Als zu denkende Differenz der Funktionen der singulären
und generellen Termini entfällt diese Schwierigkeit. Singuläre Termini dienen der Bezugnahme auf etwas, generelle Termini der Aussage über etwas. Der gemeinsame Termcharakter ist
ein grammatisches Oberflächenphänomen, das die Funktionsdifferenz in der Tiefe überspielt
und verdeckt. Eine Konsequenz dieser Sicht ist es, daß die Differenz zwischen Einzelnem und
Allgemeinem nicht ontologisch gefaßt werden darf, d.h. nicht so, als wären Einzeldinge (oder
Partikularien) und allgemeine Entitäten (oder Universalien) zwei Sorten von Entitäten. Ein
ontologischer d.h. ein Existenzanspruch ist nur an die Funktion der Bezugnahme geknüpft.
Das ganze Der-Fall-Sein, das im Urteil beansprucht wird, ist in anderer Währung auf das Konto des oder der existierenden Gegenstände zu verbuchen, auf den bzw. die im singulären Satz
Bezug genommen wird. Wenn man nun in Gedanken von einer Tatsache ihr Bestehen abtrennt, sie also in das aktuale Der-Fall-Sein und einen Sachverhalt zerlegt, und wenn man ferner diese Zerlegung auf die Gegenstände der Bezugnahme projiziert, dann erhält man eine
Differenz zwischen der Existenz und dem Wesen des Gegenstandes und somit das, was traditionell als die ontologische Differenz bezeichnet wird.
Würde mit der Prädikatstelle der Anspruch auf einen ursprünglichen Realitätsbezug verbunden, so wäre übrigens nicht leicht zu sehen, wie man die Reifizierung (Verdinglichung) von
Tatsachen vermeiden sollte. Im singulären Satz kämen dann nämlich zwei Realia zur Sprache,
etwa Theaitet und das Fliegen, und somit auch ein Komplex aus diesen beiden Realia. Warum
aber sollte dieser Komplex weniger real sein als seine Bestandteile? (Hier wird der Regreß des
Dritten vermieden durch Identifikation von Tatsachen mit Gegenstandskomplexen.)
Betrachten wir nun etwas näher die semantische Funktion der Bezugnahme. Durch eine Bezugnahme wird ein Gegenstand für eine mögliche Aussage über ihn ins Denken und Sprechen
eingeführt. Die Bezugnahme ist insofern eine Bedingung der Möglichkeit der Irrtumsmöglichkeit. Dann aber sollte sie ihrerseits irrtumsimmun geschehen können, ja müssen; und dies
hätte unerwünschte Konsequenzen. Der Gegenstand der Bezugnahme wäre uns dann nämlich,
indem wir uns auf ihn bezögen, irrtumsimmun präsent, folglich wäre er nicht unabhängig von
Realität - auf dem Satz, und die eigentlichen Realia sind nicht die Dinge oder Gegenstände, sondern die Tatsachen. So sagt es Wittgenstein: „Die Welt ist alles, was der Fall ist“, und: „Die Welt ist die Gesamtheit der Tatsachen, nicht der Dinge“ (Satz 1 bzw. 1.1). Die Irrtumsmöglichkeit erklärt Wittgenstein durch die Bildtheorie des
Satzes: Der Satz ist kein Ding, sondern seinerseits eine Tatsache, und zwar dank der konventionellen Zuordnung
der Namen im Satz zu Gegenständen in der Welt, das Bild einer anderen Tatsache. ‘Fa’ stellt a und F zusammen
in der Form des Der-Fall-Seins dar, und wenn es eine solche Tatsache gibt, ist der Satz wahr, andernfalls falsch.
Auch in diesem Fall ist der Satz sinnvoll, weil a und F in anderen Tatsachen aktualiter vorkommen und wir uns in
anderen Sätzen auf sie beziehen können. Wir verstehen daher ‘Fa’. - Wittgenstein hat sich von dieser Lehre später distanziert. Ich lasse sie im gegenwärtigen Zusammenhang auf sich beruhen.
28
unserem Akt der Bezugnahme, und da diese Unabhängigkeit, die aus dem realistischen Moment der Wahrheit bzw. der Objektivität unserer Wahrheitsansprüche folgt, im Sinne des erkenntnistheoretischen, nicht des metaphysischen Realismus zu verstehen ist (s. § 2), so gälte
hier ein Idealismus; d.h. die Existenz eines Gegenstandes wäre abhängig von unserer Bezugnahme auf ihn; er wäre gar kein Objekt, sofern im Begriff des Objektes die Objektivität dessen mitgemeint ist, das unabhängig von unseren Akten der Fall ist bzw. existiert. Nicht nur
bedarf es um der Objektivität unserer Wahrheitsansprüche willen der Objekte, sondern die
Objekte sind ihrerseits nur epistemisch zugänglich durch objektive Wahrheitsansprüche.
Um des realistischen Momentes der Wahrheit willen müssen wir also schließen, daß der denkende Bezug auf Objekte selber schon propositional, d.h. durch ein Als gegliedert ist. Bewußtsein von Objekten ist wesentlich propositional. Diese These werde ich fortan die Propositionalitätsthese nennen. Sie besagt, in nochmals anderen Worten, daß alles Bewußtsein von
etwas ein Bewußtsein von etwas als etwas ist; und sie ist sorgsam zu unterscheiden von der
im Fortgang (Teil II.A) kritisierten ontologischen These, daß es Propositionen, d.h. Satzbedeutungen, als Entitäten eigenen Rechtes gibt.
Die Propositionalitätsthese scheint freilich hinsichtlich der Bezugnahme in einen Regreß zu
führen: Die Bezugnahme auf ein Objekt in einem Urteil U setzt ein Urteil U’, demnach eine
weitere Bezugnahme plus Charakterisierung voraus - usf. Aber die Propositionalitätsthese
trifft sich hier, trotz dieser Schwierigkeit, die sie bereitet, mit anderen, ganz unabhängigen
Erwägungen, die in die gleiche Richtung deuten. Da es viele Einzeldinge gibt (und sogar geben muß, wenn Allgemeinvorstellungen denn überhaupt möglich sein sollen), besteht das
grundsätzliche Problem, unter den vielen Einzelnen jeweils das herauszufinden, über das ein
Urteil gefällt, eine Aussage gemacht werden soll. Halten wir uns der Deutlichkeit halber wiederum an die sprachlichen Verlautbarungen von Urteilen, also an die Sätze. „Dieser Baum da
drüben ist kahl“, behaupte ich etwa und unterstelle damit, daß dort drüben ein Baum, und
zwar, wenn ich den Satz durch eine hinweisende Geste untermauert denke, in der Richtung
meines Zeigens genau ein Baum (mindestens und höchstens einer) zu sehen ist. Nun kann die
Wendung „Dieser Baum da drüben“ als eine Art Kennzeichnung mit indexikalischem, näher
demonstrativem Element („dieser ... da drüben“) verstanden werden. Die Russellsche Kennzeichnungstheorie klärt uns dann darüber auf, was in dieser Kennzeichnung alles mitgedacht
ist: daß da drüben mindestens und höchstens, also genau ein Baum anzutreffen ist. Das ist die
Verbindung zweier genereller Sätze: ‘Es gibt da drüben einen Baum’ und ‘Alles was da drü-
29
ben und ein Baum ist, ist mit diesem Baum identisch’. (Das ist eine vergröbernde Erläuterung.
Die präzise Form kann in § 4 nachgelesen werden.)
Wenn nun Einzeldinge im Denken und Sprechen aus einer Menge von Einzeldingen herausgefunden und in diesem Sinn identifiziert werden müssen, dann setzt jedes singuläre Urteil, auch
wenn sein Subjektausdruck keine Kennzeichnung ist (wodurch es Russells Analyse zufolge ja
aufhören würde, ein singuläres Urteil zu sein) ein generelles identifizierendes Urteil voraus.
Nur wenn dieses vorausgesetzte Urteil wahr ist, gelingt die Identifikation eines Einzeldinges
als Bezugsobjekt eines Urteils und nur dann kommt überhaupt ein Urteil zustande. Das ist der
Kern der Theorie der Voraussetzungen der Bezugnahme auf Einzelnes, die Peter F. Strawson
in seinem Buch Individuals entwickelt hat und mit der er eine Gegenposition zu Russell insofern bezogen hat, als Strawson meint, daß singuläre Urteile generelle Urteile nicht implizieren, aber immer voraussetzen.
Russell hingegen unterschied zwischen logischen Eigennamen und Kennzeichnungen: Logische Eigennamen sollen ohne weiteres, auch ohne weitere Voraussetzungen bezeichnen. Da
die Subjektstelle im singulären Satz der mit der Prädikatstelle verbundenen Irrtumsmöglichkeit vorausliegt, markiert sie das Moment der Irrtumsimmunität in unserem Realitätsbezug.
Aber dies zu sagen ist eines, etwas anderes ist es, wenn man das Moment der Irrtumsimmunität in dem Gedanken eines reinen, nicht durch Prädikation vermittelten Objektbezuges verselbständigt. Russell hat das getan. Seine logischen Eigennamen können ihre Objekte nicht
verfehlen, was zur Konsequenz hat, daß es logische Eigennamen eigentlich gar nicht geben
kann. Russells eigene Kandidaten, Ausdrücke wie ‘dies’ angewandt auf mir jeweils gegenwärtige Sinnesdaten, sind in Wahrheit gar keine Namen, sondern Indikatoren. Quine hat aus
dieser Schwierigkeit die Konsequenz gezogen, daß es in der Tiefenstruktur einer reglementierten, in logische Ordnung gebrachten Sprache keine Eigennamen geben sollte. Die umgangssprachlichen Eigennamen kann man, um dieses Ziel zu erreichen, wie Kennzeichnungen behandeln und nach Russells Methode durch Definition eliminieren. ‘Sokrates’ wird auf diese
Weise ersetzt durch: ‘dasjenige Objekt, welches mit Sokrates identisch ist’. ‘Sokrates’ kommt
in dem Definiens dann zwar immer noch vor, aber nur als eine für sich bedeutungslose (wenn
auch mnemotechnisch hilfreiche) Buchstabenfolge innerhalb des Prädikates ‘ist mit Sokrates
identisch’. Diesen Ausdruck aber kann man dann als ein undefiniertes einstelliges Prädikat
betrachten, das umgangssprachlich etwa durch ‘sokratisiert’ wiederzugeben wäre. Der Name
‘Sokrates’ wird auf diese Weise ersetzbar durch die Kennzeichnung ‘dasjenige Objekt, das
sokratisiert’.
30
Allerdings hat diese Konstruktion zur Folge, daß es gar keine singuläre Bezugnahme mehr
gibt. Variablen, sofern sie durch den Kennzeichnungsoperator und in letzter Analyse durch
Quantoren gebunden sind, werden für Quine zu den paradigmatischen referentiellen Ausdrücken. (Mehr darüber in Teil II) Die basale Verbindung (die den Aussagesatz konstituiert)
ist dann nicht mehr die eines Namens mit einem Prädikat wie in ‘Theaitet sitzt’, sondern die
einer Variablen mit einem Prädikat: ‘x sitzt’, oder umgangsssprachlicher: ‘er/sie/es sitzt’. Das
resultierende Gebilde, ein sogenannter offener Satz, ist nicht mehr veritativ, nicht mehr wahr
oder falsch schlechthin, sondern wahr für einige Werte von ‘x’ und falsch für andere Werte.
Will man dagegen am veritativen Charakter der basalen Verbindung festhalten, ohne andererseits eine voraussetzungsfreie und irrtumsimmune Bezugnahme in Kauf nehmen zu müssen,
so macht Strawsons Theorie der Voraussetzungen das gewünschte Angebot. Mag auch die
Subjektstelle das Moment der Irrtumsimmunität in unserem Weltbezug markieren, so ist doch
ein echtes Satzsubjekt immer eingebettet in unser fehlbares Denken. Mit anderen Worten: Bezugnahme kommt nie rein vor, sondern immer nur vermittelt durch vorgängige Prädikationen.
Jede sinnvolle Verwendung eines Designators setzt die Wahrheit von bestimmten generellen
Sätzen voraus. Die sinnvolle Verwendung des Namens ‘Sokrates’ setzt voraus, daß jemand
einmal so (oder ähnlich) genannt wurde und daß zwischen dieser ursprünglichen Namensgebung und unserer heutigen Verwendung des Namens eine bestimmte, natürlich charakterisierungsbedürftige Beziehung besteht. Die sinnvolle Verwendung der Worte ‘dieser Baum da
drüben’ setzt voraus, daß in der betreffenden (vielleicht durch eine Geste des Sprechers angezeigten Richtung) ein und nur ein Baum anzutreffen ist. Wenn derlei empirische Voraussetzungen einer Bezugnahme im konkreten Fall nicht erfüllt sind, wenn z.B. ein ganzer
Wald statt eines Baumes oder gar kein Baum vorhanden ist, dann mißlingt die Bezugnahme
und dann kommt zwar ein grammatisch korrekter Satz, aber keine Aussage zustande, d.h. kein
solcher Satz, der ein Urteil ausdrückt und der wahr oder falsch ist. Russell hingegen würde
hier eine falsche Aussage diagnostizieren; denn seiner These zufolge setzt der Satz ‘Der Baum
da drüben ist kahl’ die Existenz des betreffenden Baumes nicht voraus als Bedingung der
Möglichkeit seines Aussagecharakters, sondern der Satz besagt geradezu, daß sich da drüben
ein und nur ein Baum befindet (und daß dieser Baum kahl ist).
In Strawsons Theorie der Voraussetzungen der Bezugnahme wird demnach die Kennzeichnungstheorie Russells gegen die Intentionen ihres Erfinders gewendet. Dabei zeigt sich, daß
singuläre Bezugnahme nur im Kontext von genereller Bezugnahme bzw. von generellen Sätzen, nie rein vorkommen kann. Dadurch kommt Strawson der Quineschen Position etwas nä-
31
her, als man zunächst meinen mochte. Aber der veritative Charakter der basalen Verbindung
wird dabei nicht preisgegeben.
Wir hatten den Voraussetzungsreichtum der Bezugnahme zunächst unabhängig von Strawson
im Zusammenhang mit der Propositionalitätsthese eingesehen. Die Bezugnahme auf Objekte
ist einerseits ein irreduzibles Moment des propositionalen Bewußtseins und setzt andererseits
propositionales Bewußtsein voraus. Denn Objekte müssen objektiv sein, d.h. nicht irrtumsimmun, sondern nur satzvermittelt erfaßbar. Strawsons Theorie trifft sich mit dieser Einsicht,
und sie lehrt uns zugleich etwas über die mit ihr verbundene Zirkel- bzw. Regreßgefahr: Singuläre Bezugnahme setzt generelle Wahrheiten voraus. Das gibt uns eine Verschnaufpause,
obwohl andererseits die Gefahr damit nicht gebannt ist. Denn wenn der singuläre Satz die basale Verbindung ist, dann setzen generelle Wahrheiten ihrerseits singuläre Wahrheiten voraus
- womit wir eben doch in einem Kreis gegangen wären. Diesen Kreis dürfen wir im Fortgang
nicht aus den Augen verlieren.
§ 7. Generelle Urteile und Sätze
Singuläre Urteile setzen voraus, daß je bestimmte generelle Urteile wahr sind. Und das bringt
uns nun dazu, eine Lücke unserer bisherigen Überlegungen als solche anzuerkennen. Wir haben uns bisher auf singuläre Urteile konzentriert und die generellen behandelt als etwas, das
sich finden wird. Dies müssen wir nun korrigieren.
Die generellen Urteile werden in der traditionellen formalen Logik, die auf Aristoteles zurückgeht, eingeteilt in universelle (allgemeine) und partikuläre (besondere). Zusammen mit
den singulären (einzelnen) Urteilen bilden sie eine Trias in der Rubrik der Quantität der Urteile. Übliche Beispiele sind (a) für ein allgemeines Urteil: ‘Alle Griechen sind Menschen’,
(b) für ein besonderes Urteil: ‘Einige Griechen sind Philosophen’, (c) für ein einzelnes Urteil:
‘Sokrates ist ein Mensch’. In der modernen Prädikatenlogik, die auf Frege zurückgeht und die
in den Logik-Grundkursen gelehrt wird, erhalten diese grammatisch parallel gebauten Sätze
freilich jeweils eine ganz verschiedene Analyse. Die grammatische Oberflächenstruktur verbirgt insofern die logische Tiefenstruktur. Die Analysen lauten:
- für (a)
‘Alle Griechen sind Menschen’:
‘Für alle x gilt: Wenn x ein Grieche ist, so ist x ein Mensch’, formaler:
‘(∀x)(x ist ein Grieche →x ist ein Mensch)’ bzw. ‘(∀x)(Gx →Mx)’
32
- für (b)
‘Einige Griechen sind Philosophen’:
‘Es gibt mindestens ein x, für das gilt: x ist ein Grieche und x ist ein
Philosoph’, formaler:
‘(∃ x)(x ist ein Grieche ∧ x ist ein Philosoph)’ bzw. ‘(∃ x)(Gx ∧ Px)’
- für (c)
‘Sokrates ist ein Mensch’:
dito; formaler: ‘Ms’
(Hierbei sind ‘G’, ‘M’, ‘P’, ‘s’ keine Schemabuchstaben, sondern Abkürzungen
für wirkliche Termini.)
Die Formalisierungen lassen das einzelne Urteil bzw. die singuläre Aussage als einen atomaren Satz erkennen, der nur aus einem generellen Term (einem Prädikat) und einem singulären
Term (einem Namen) besteht. Die generellen Aussagen hingegen sind aus satzartigen Bestandteilen zusammengesetzt, einmal in einer Wenn-dann-Verbindung, einmal verbunden
durch ein ‘und’. Die Wenn-dann-Verbindung, symbolisiert durch den Pfeil, ergibt einen Konditionalsatz, bestehend aus einem Vorderglied (Antezedens) und einem Hinterglied (Sukzedens). Die ‘und’-Verbindung heißt die Konjunktion oder auch das logische Produkt ihrer beiden Teilsätze.
Freilich sind die Teilsätze, mit denen wir es in den gegebenen Fällen zu tun haben, nicht ganz
rund und vollständig: ‘x ist ein Grieche’, ‘x ist ein Mensch’ und ‘x ist ein Philosoph’ sind weder wahr noch falsch. Sie enthalten nämlich, wie das heißt, eine freie Variable, ‘x’, d.h. einen
singulären Terminus, der keinen konstanten Bezug hat. Erst wenn man sich entscheidet, eine
Variable mit einem bestimmten Gegenstand zu belegen, z.B. die Variable ‘x’ durch Sokrates,
bekommen die angeführten Sätze Wahrheitswerte; sie sind im angenommenen Fall nämlich
allesamt wahr. Abgesehen von einer solchen Belegung sind sie nicht wahr oder falsch, sondern werden durch bestimmte Objekte erfüllt (die angeführten Sätze etwa durch Sokrates,
Platon, Aristoteles, ... und nicht durch Europa, den Mond, Berlin, ...). Sätze mit freien Variablen heißen (wie schon im vorigen Paragraphen beiläufig gesagt wurde) offene Sätze; sie können durch bestimmte Operatoren geschlossen werden, welche die freien Variablen binden.
Solche Operatoren sind die beiden Quantoren, der Allquantor und der Existenzquantor, symbolisiert durch ein umgekehrtes ‘A’ bzw. ‘E’. All diese Termini sind logischer Jargon, der den
Absolventen eines Logik-Grundkurses bestens vertraut ist, und in den Logik-Lehrbüchern
leicht nachzuschlagen. Ich beschränke mich bei meinen Erläuterungen daher auf das Nötigste.
33
Die allgemeinen und besonderen Urteile der traditionellen Syllogistik sind dem Gesagten zufolge schon recht komplexe Gebilde und keineswegs die einfachsten quantifizierten Urteile.
Die einfachsten quantifizierten Urteile oder vielmehr Sätze haben schlicht die Form ‘(∀x)Fx’
oder die Form ‘(∃ x)Fx’: ‘Alles ist F’ bzw. ‘Es gibt etwas, das F ist’. Die allgemeinen und
besonderen Urteile enthalten demgegenüber (in ihrem sprachlichen Ausdruck) neben den
Quantoren noch Satzverknüpfungen, wie sie in der Aussagenlogik untersucht werden, die von
der Quantität und der Prädikationsstruktur der Sätze abstrahiert und nur diejenige logische
Komplexion betrachtet, die aus der Verknüpfung vollständiger Sätze zu neuen Sätzen resultiert. Gäbe es nur die aussagenlogische Komplexion, so könnte man sich auf die Betrachtung
der singulären Sätze und der aussagenlogischen Verknüpfungen singulärer Sätze beschränken.
Die generellen Sätze weisen hingegen auf ein neues logisches Moment hin, dem eigens Rechnung zu tragen ist, eben auf das Moment der Generalität.
Zunächst nehmen wir dieses Moment als ein Faktum zur Kenntnis, das von der modernen
Prädikatenlogik und zuvor schon von der traditionellen formalen Logik anerkannt wurde.
Wünschenswert wäre es freilich, wenn wir dieses Moment aus dem realistischen Moment der
Wahrheit herleiten könnten; aber dieses Vorhaben müssen wir einstweilen noch zurückstellen.
Wir behalten dieses Desiderat jedoch im Blick, wenn wir nach der Irrtumsmöglichkeit bezüglich der generellen Sätze fragen. Hier können wir uns nun auf die grundlegenden Fälle: einfache All- und Existenzbehauptungen, d.h. auf Sätze der Form ‘(∀x)Fx’ und ‘(∃ x)Fx’ beschränken; denn die Quantifikation ist das grundlegend Neue, das über die aussagenlogische
Komplexion hinausgeht. Indem wir einen solchen generellen Wahrheitsanspruch erheben,
haben wir das Ganze der Realität im Sinn: Schlechthin alles, so beanspruchen wir in dem einen Fall, ist soundso, z.B. mit sich selbst identisch: ‘(∀x)(x=x)’; unter allen Gegenständen
überhaupt, so meinen wir im anderen Fall, gibt es einiges von der und der Beschaffenheit, z.B.
einiges Rote: ‘(∃ x)(x ist rot)’. Wir dehnen in den generellen - allgemeinen wie besonderen Urteilen unsere Wahrheitsansprüche also über je einzelne Gegenstände, Ausschnitte der Realität, aus auf alles Reale, die ganze Realität, die wir mit einem vertrauten, wenn auch theoretisch etwas vorbelasteten Terminus zusammenfassend als das Absolute bezeichnen können.
Auf den ersten Blick sehen Existenzbehauptungen vielleicht etwas bescheidener und weniger
überzogen aus als die Allbehauptungen. Es genügt ja, daß wir irgendwo etwas Rotes antreffen,
um zu wissen, daß es etwas Rotes gibt. Aber der All- und der Existenzquantor sind mit Hilfe
der Negation einer durch den anderen definierbar, d.h. man könnte einen beliebigen von bei-
34
den als grundlegend ansehen und den anderen auf seiner Basis definieren, denn es gilt ja: (a)
alles ist F gdw es nichts gibt, das nicht F ist; und (b) etwas ist F gdw nicht alles nicht F ist;
formal:
(a’) (∀x)Fx ↔ ¬(∃ x)¬Fx
(b’) (∃ x)Fx ↔ ¬(∀x)¬Fx
Es ist auch nicht möglich, die „überzogenen“ Generalansprüche auf bescheidene Singuläransprüche durch aussagenlogische Mittel zurückzuführen, obwohl dafür ein einfaches Definitionsverfahren zur Verfügung zu stehen scheint. Wenn man nämlich alle Dinge benannt hätte:
‘a’, ‘b’, ‘c’, ..., ‘a’’, ‘b’’, ‘c’’, ..., ‘a’’’, ..., dann könnte man statt eines Allsatzes eine sehr lange, vielleicht sogar unendliche, Konjunktion singulärer Sätzen bilden. Statt zu sagen, daß alles
mit sich identisch ist, könnte man sagen, daß a mit sich identisch ist und daß b mit sich identisch ist und daß c mit sich identisch ist usf.: ‘a=a ∧ b=b ∧ c=c ∧ a’=a’ ∧ ...’. Ebenso könnte
man einen Existenzsatz durch eine sehr lange, vielleicht unendliche Disjunktion singulärer
Sätze ersetzen. Statt zu sagen, daß es etwas Rotes gibt, würde man dann sagen, daß a rot ist
oder b rot ist oder c rot ist usf.: ‘a ist rot ∨ b ist rot ∨ c ist rot ∨ ...’. Aber wir sind im Falle
eines generellen Wahrheitsanspruches weit davon entfernt, zahllose singuläre Wahrheitsansprüche zu bedenken. Außerdem sieht man am Beispiel des Allsatzes leicht ein, daß der langen Konjunktion singulärer Sätze noch etwas Entscheidendes fehlt, sofern sie dem Allsatz
logisch äquivalent sein soll. Logische Äquivalenz ist wechselseitige Implikation, was bedeutet, daß man in beide Richtungen von einem Satz auf den anderen, logisch äquivalenten,
schließen darf. Nun darf man zwar aus dem Allsatz auf die lange Konjunktion schließen, insofern impliziert jener diese. Umgekehrt aber sagt eine noch so lange Konjunktion singulärer
Sätze nichts darüber aus, ob in ihr schlechthin alle Gegenstände Erwähnung gefunden haben.
Man müßte also zu der Konjunktion: ‘Fa ∧ Fb ∧ Fc ∧ ...’, noch hinzufügen: ‘... und sonst gibt
es nichts’, wodurch die unreduzierte Generalität doch wieder ins Spiel gekommen wäre.
Wenn wir aber generelle Wahrheitsansprüche nicht auf singuläre zurückführen können, dann
bedarf es für erstere einer separaten Erklärung der Irrtumsmöglichkeit. Sie wird nach der Erklärung zu modellieren sein, die wir im Fall der singulären Wahrheitsansprüche gegeben haben: Wir haben mit einer unhintergehbaren Dualität zweier Funktionen zu tun, der Bezugnahme auf einen Gegenstand und seiner Charakterisierung als soundso. Direkt läßt sich dies nicht
auf generelle Wahrheitsansprüche übertragen, denn die Funktion der Bezugnahme ist an die
singulären Termini, im Fall der generellen Sätze also an gebundene Variablen vergeben, und
35
die Funktion der Charakterisierung an die Prädikate, die in dem betreffenden generellen Satz
vorkommen mögen. Die Übertragung wird also indirekt sein und darauf hinauslaufen müssen,
daß wir in generellen Sätzen auf den ganzen sogenannten Wertebereich der Variablen Bezug
nehmen und diesen Wertebereich als einen charakterisieren, dessen Elemente allesamt bzw.
unter dessen Elementen einige soundo beschaffen sind. Der Wertebereich der Variablen einer
Sprache ist der Bereich dessen, was in dieser Sprache thematisierbar ist. Sofern wir nun beanspruchen, über alles reden zu können, einfach indem wir das Wort ‘alles’ gebrauchen, und
besonders, wenn wir auf die Frage: „Was gibt es?“ ebenso wahr wie uninformativ antworten:
„Alles“,17 beanspruchen wir, daß der Wertebereich unserer Variablen alles Reale (die ganze
Realität) ist.
Die ganze Realität, gedacht als das unterschwellige Bezugs-„Objekt“ unserer generellen Aussagen, kann in dieser milden Hypostasierung vielleicht tatsächlich mit einigem Recht als das
Absolute gefaßt werden. Wir wollen dies aber zunächst allenfalls im Sinne einer bloßen Redensart tun, d.h. ohne inhaltlich-philosophische Schlußfolgerungen daraus zu ziehen.
Wie steht nun mit der Herleitbarkeit des Gedankens der (absoluten) Allheit aus dem realistischen Moment der Wahrheit? Handelt es sich hier um eine kontingente Zugabe zu den bescheidenen Wahrheitsansprüchen, die wir in singulären Urteilen erheben, oder sind diese ohne
jene unbescheidenen generellen Wahrheitsansprüche gar nicht denkbar? Mit dieser Fragestellung kehren wir zu den singulären Aussagen zurück, von denen zuletzt gesagt worden war,
daß sie generelle Aussagen voraussetzen. Damit ist die gestellte Frage schon beantwortet: Die
vermeintlich bescheidenen, singulären Wahrheitsansprüche setzen jeweils unbescheidene,
generelle voraus, und aus dem realistischen Moment der Wahrheit folgt insofern, daß wir den
unbescheidenen Gedanken der Allheit fassen können müssen. Später wird sich zeigen, daß nur
Sprecher, die generelle Sätze verwenden, als auf einzelne Objekte bezugnehmend interpretiert
werden müssen. Singuläre Bezugnahme und Quantifikation verweisen wesentlich aufeinander.
Außerdem kann für die Unverzichtbarkeit genereller Sätze auch angeführt werden, daß im singulären Urteil ein Einzelnes charakterisiert wird, und zwar durch Subsumtion unter einen Allgemeinbegriff. Die Subjektstelle im singulären Satz symbolisiert Irrtumsimmunität, die Prädikatstelle Irrtumsmöglichkeit. Mit dem Prädikat ist demnach die Möglichkeit seiner Fehlanwendung verknüpft. Dazu muß es eine offene Frage sein, ob ein Prädikat auf ein gegebenes
Einzelnes zutrifft, und dazu muß ein Prädikat gedanklich von jedem gegebenen Einzelnen
auch ablösbar sein. Man muß also ein Prädikat gewinnen, einen Begriff bilden können, ohne
17
Vgl. W.V. Quine, From a Logical Point of View, [...].
36
dazu auf ein bestimmtes Einzelding angewiesen zu sein. Dann aber müssen Prädikate auf
mehrere Einzelne zutreffen können (auch wenn ein gegebenes Prädikat de facto nur auf ein
einziges Einzelnes zutreffen sollte) bzw. mehrere Einzelne müssen unter einen Begriff fallen
können. Mit dem bloßen Begriffsgebrauch bzw. mit der Prädikation als solcher geht also
schon der Gedanke einer unbestimmten, wenn auch je relativierten Allheit einher: Im Begriff
des Roten denke ich alle diejenigen unspezifizierten Einzeldinge, die rot sind, unter Ausschluß aller übrigen Dinge. Ein Begriff legt also einen Schnitt durch den Wertebereich meiner
Variablen und ist nur verständlich, sofern ich mich auf diesen Wertebereich als ganzen in irgendeiner Weise beziehen kann.
§ 8. Ursachverhalte
Wenn Existenzsätze wesentlich generelle Sätze sind, so gilt dies auch für scheinbar singuläre
Existenzbehauptungen wie: ‘Der Yeti existiert’. Hier wird nur dem grammatischen Anschein,
nicht aber der logischen Form nach einem Einzelnen ein Prädikat zugesprochen. Wäre es anders, so ergäbe sich im übrigen die absurde Konsequenz, daß in einer negativen Existenzbehauptung (‘Der Yeti existiert nicht’) einem Einzelnen, auf das einerseits als auf etwas Reales
Bezug genommen wird, andererseits die reale Existenz abgesprochen würde. Diese Absurdität
wird vermieden, wenn man singuläre Existenzaussagen als generelle Aussagen rekonstruiert,
etwa nach folgendem Muster: ‘Es gibt unter allen Objekten mindestens eines, das mit dem
Yeti identisch ist’, formaler: ‘(∃ x)(x = der Yeti)’. Existenz ist, so analysiert, kein reales (sondern allenfalls ein grammatisches) Prädikat von Einzeldingen.
Andererseits hatten wir oben unabhängig von diesen Überlegungen die Rede von der Existenz
eines Einzelnen eingeführt: Wenn man in Beziehung auf ein Der-Fall-Seiendes, d.h. eine Tatsache, zwischen dem Der-Fall-Sein und dem, was da der Fall ist (dem Sachverhalt), gedanklich unterscheidet und diese Unterscheidung auf die Subjektstelle des singulären Satzes projiziert (welche ja den Realitätsbezugs des Satzes in der prädikativen Erbteilung erbt), dann erhält man die gedankliche Differenz zwischen dem Was-Sein (Wesen) und dem Daß-Sein (der
Existenz) eines einzelnen Objektes. Wenn es sich dabei nicht um einen unabhängigen, anderen Existenzbegriff handelt (was hier nicht zu entscheiden ist), dann weist die Existenz eines
einzelnen Dinges wesentlich über es (und das Der-Fall-Sein über die einzelne Tatsache) hinaus auf die Gesamtheit aller Dinge (bzw. Tatsachen). Freilich muß sogleich betont werden,
daß das Wesen von der Existenz eines Dinges gar nicht realiter, sondern nur idealiter (in Ge-
37
danken) ablösbar ist (es sei denn, wir favorisieren eine Form des modalen Realismus, dem
zufolge man mit realen, aber nicht aktualen Wesenheiten rechnen muß).
Da die Existenz an die Bezugnahme gebunden ist, existieren Tatsachen nicht und erst recht
nicht solche Sachverhalte, die gar nicht bestehen. Jedenfalls existieren sie nicht als grundlegende Einzeldinge. Aber in Beziehung auf die grundlegenden kann man nachgeordnete Einzeldinge einführen. Wenn wir uns für den Augenblick auf raumzeitliche Dinge und Ereignisse
- wir wollen sie, Strawson folgend, zusammenfassend Partikularien nennen - als die grundlegenden Einzeldinge einigen, dann können wir in Beziehung auf diese z.B. ihre sogenannten
Akzidentien als nachgeordnete Einzeldinge einführen. Wenn z.B. der Yeti grau ist, so können
wir das individuelle Grau des Yeti als nachgeordnetes Einzelding in Beziehung auf den Yeti
konzipieren und seine - nicht minder nachgeordnete - Existenz behaupten. Nichts hindert uns
dann aber, auch Tatsachen und sogar nichtbestehende Sachverhalte als nachgeordnete Einzelne anzuerkennen. Sachverhalte sind demzufolge nachgeordnete und unselbständige Entitäten.
Sie kommen nicht für sich vor, sondern an anderen, grundlegenderen Einzelnen. Der Sachverhalt, daß Theaitet sitzt, existiert nicht an sich, sondern an Theaitet, und ebenso der nichtbestehende Sachverhalt, daß Theaitet fliegt. Das ergibt noch einmal eine weitergehende Klärung
des Sinnes, in dem das Nichtseiende „irgendwie“ ist: Das Nichtseiende, nämlich der nichtbestehende Sachverhalt, daß Theaitet fliegt, ist, nämlich existiert, d.h. hat sein Bestehen-oderNichtbestehen: nicht an ihm selber, sondern an Theaitet.
Für die generellen Sachverhalte müssen wir als die Träger ihres Bestehens-oder-Nichtbestehens (also ihres Existierens) jeweils die Gesamtheit aller Gegenstände in Ansatz bringen. Das
aber legt es nahe, der Vereinfachung halber auch schon für die singulären Sachverhalte festzulegen, daß sie ihre Existenz an der Gesamtheit aller Gegenstände haben (zumal das Fliegen
ja von Theaitet weg auf andere, eben fliegende Gegenstände verweist und zumal zweitens singuläre Aussagen generelle Aussagen voraussetzen und drittens eine Sache durch ihre Existenz
ohnehin auf die Gesamtheit aller Sachen bezogen ist).
Wir wollen daher den Sachverhalten bis auf weiteres eine nachgeordnete, zweitklassige Existenz relativ zu der Gesamtheit aller existierenden Einzeldinge zugestehen, die in der Folge
noch weiter, zu einer bloßen Redensart, herabgesetzt werden wird (weil es für Sachverhalte
keine klaren Identitätsbedingungen gibt; sie wären also Entitäten ohne Identität).
Wenn wir uns jetzt kurz der metaphysischen Grundfrage zuwenden: ‘Warum gibt es überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts?’, dann erhalten wir eine aufschlußreiche erste Teilaus-
38
kunft. Nehmen wir an, es gäbe nichts. Dann, so könnte man versuchen zu schließen, gäbe es
auch nicht den Sachverhalt, daß es nichts gibt. Dann könnte dieser Sachverhalt auch nicht als
Tatsache bestehe; also wäre es nicht der Fall, daß es nichts gibt - eine Reductio ad absurdum
der Annahme.
Der Fehler in diesem schnellen Räsonnement liegt in der Verdinglichung der Sachverhalte.
Wenn es diese nämlich nur nachgeordneterweise gibt, dann kann es den Sachverhalt, daß es
nichts gibt, ohnehin nicht als eine grundlegende Entität geben; und dennoch könnte er bestehen. Doch schauen wir nun etwas näher hin. Den Sachverhalt, daß es nichts Grundlegendes
(keine Einzeldinge) gibt, muß es seinerseits zumindest nachgeordneter Weise oder, ganz bescheiden, zumindest der Redensart nach geben. Die Redensart ist aber, was ihren Sinn betrifft,
davon abhängig, daß dieser Sachverhalt sein Bestehen-oder-Nichtbestehen (seine Existenz)
irgendwie, notfalls eben an anderem, an grundlegenden Einzeldingen hat. Diese aber soll es
nach Voraussetzung nicht geben. Dann aber muß der Sachverhalt, daß es nichts (Grundlegendes) gibt, sein Bestehen an ihm selber haben, und dadurch gewinnt er einen ganz eigenartigen
und beeindruckenden ontologischen Status. Sein Bestehen(-oder-Nichtbestehen) fällt dann
nämlich zusammen mit seiner Existenz, d.h. die Differenz von Der-Fall-Sein und Existenz
wird in seinem Fall hinfällig; er würde, um die Genesis zu zitieren, sein wie Gott: jenseits der
ontologischen Differenz. Natürlich gäbe es ihn dann in einer unüberbietbar grundlegenden
Weise. Das, was es da gäbe, können wir - wer sollte uns daran hindern - das Nichts (großgeschrieben) nennen. Und nun können wir das Fazit ziehen: Wenn es nichts gäbe, so gäbe es das
Nichts als einen an sich selbst bestehenden Sachverhalt. Damit aber haben wir nun doch die
zunächst verfehlte Reductio ad absurdum erhalten. Wir können also schließen: Notwendigerweise gibt es nicht nichts, sondern etwas, woran dann auch der Sachverhalt, daß es nichts gibt,
seine nachgeordnete Existenz haben kann, ohne zu der großen Form eines grundlegenden und
dabei paradoxen Seienden (genannt ‘das Nichts’) jenseits der ontologischen Differenz auflaufen zu müssen.
Dieses kleine Räsonnement ist in mancherlei Hinsicht aufschlußreich. Zunächst einmal zeigt
es, daß Heidegger sachlich berechtigt war, das kleingeschriebene ‘nichts’ in der metaphysischen Grundfrage durch ein großgeschriebenes ‘Nichts’ zu ersetzen (vgl. § 1, Anm. 3 und 4).
Denn wenn es nichts gäbe, so gäbe es eben das Nichts. Also dürfen wir die Frage: ‘Warum
gibt es etwas und nicht vielmehr nichts?’ reformulieren als die Frage: ‘Warum gibt es etwas
und nicht vielmehr [das] Nichts?’ Die Antwort oder vorsichtiger eine erste Teilantwort lautet,
wie gesehen: Das Nichts wäre insofern eine paradoxe, mit sich selbst unverträgliche Entität,
39
als sie zugleich etwas wäre (was sie aber, wegen der begrifflichen Verbindung mit dem kleingeschriebenen ‘nichts’ nicht sein kann).
Da dies eine Einführung in die Philosophie (noch dazu deren Einleitungsteil) ist, sollte vielleicht eine Warnung vor leichtfertiger Reifizierung des kleingeschriebenen ‘nichts’ ausgesprochen werden. Andererseits ist der Fehler, vor dem da gewarnt wird, so grotesk, daß die Warnung als Zumutung empfunden werden könnte. Wenn A sagt: „Ich habe vor nichts Angst,“ so
wird ihm B allenfalls im Scherz den Rat erteilen: „Dann sieh zu, daß du ihm nicht begegnest.“
B muß keinen Logikkurs absolviert haben, um zu erkennen, daß A seine Bekundung etwas
umständlicher so hätte ausdrücken können: „Es ist nicht der Fall, daß es etwas gibt, vor dem
ich Angst habe“. Für die Reifizierung bleibt dann kein sprachlicher Ansatzpunkt übrig. Wenn
Kinder im Vorschulalter in diesen Dingen kompetent sind, dann sollte man philosophisch gebildeten Erwachsenen wie Hegel oder Heidegger, wenn sie vom Nichts sprechen, keine läppischen Quantorenfehler unterstellen. Und damit hat meine Warnung unter der Hand ihre Richtung und ihren Inhalt geändert.
Wichtiger als der Beweis, daß es notwendigerweise etwas und nicht nichts gibt, ist im Augenblick aber folgendes. Der paradoxe Grundsachverhalt Nichts wäre, wenn es ihn denn gäbe, ein
Beispiel für „etwas“, das es, da es das Nichts nicht gibt, durchaus geben kann: mannigfaltige
Grund- oder Ursachverhalte jenseits der ontologischen Differenz; denn diese müssen ja nicht
allesamt paradox und „nichtig“ sein, sondern es lassen sich ebensogut affirmative, positive
Seiende dieser Kategorie denken. Sie sind in der langen Philosophiegeschichte auch immer
wieder gedacht und in theoretischen Anspruch genommen worden, und zwar als das sogenannte Unmittelbare - sei es als Unmittelbares für die Sinne: sinnliche Gegebenheiten, oder
als Unmittelbares für das Denken: intelligible Gegenstände wie etwa die Platonischen Ideen.
Ein Unmittelbares ist, im Licht der Differenz von Der-Fall-Sein und Existenz besehen, ein
Zwitterwesen: einerseits ein Der-Fall-Seiendes, das in logischen - so müßte man sie nennen,
wenn die Ebene des zweiwertigen Logos nicht unterschritten wäre - Beziehungen zu anderen
Der-Fall-Seienden stehen kann, andererseits ein existierender Gegenstand, der ganz der ontischen Ordnung angehört. Seiner logischen, oder vorsichtiger: quasilogischen, Natur zufolge
kann ein Unmittelbares unserem Erkennen gegeben sein und soll als Gegebenes zur Prämisse
für Folgerungen dienen können. Seiner ontischen Natur gemäß hingegen soll es ein Gegenstand im Wertebereich unserer Variablen sein können. Ihren quasilogischen oder kognitiven
Charakter etwas stärker betonend als ihre Gegenständlichkeit werde ich unmittelbare Gegebenheiten fortan als Ursachverhalte bezeichnen, um damit zum Ausdruck zu bringen, daß sie
40
einerseits, als Sachverhalte, vom Denken und Meinen erfaßt werden können und daß sie andererseits ursprünglicher sein sollen als die propositionale Gliederung. Sie sind seltame, nämlich
vorpropositionale Sachverhalte und in ihrer Vorpropositionalität zugleich eine Art Gegenstände oder Einzeldinge.
Bleiben wir vorerst rein kontrafaktisch: Wenn es Ursachverhalte gäbe - wie müßten sie näher
beschaffen sein? Nun, unterhalb des propositionalen Als gibt es keine Irrtumsmöglichkeit; die
schiere Existenz eines Ursachverhaltes ist sein Der-Fall-Sein, sein veritatives Sein, sein Wahrsein qua Datum. Das erklärt die Beliebtheit, deren sich Ursachverhalte (unter anderen, wechselnden Namen) in der Erkenntnistheorie, besonders der empiristischen, vormals erfreuten. Im
Erfassen von Ursachverhalten, so war die theoretische Hoffnung, besäße unser Meinen und
Denken ein unerschütterliches Fundament, auf dem mit großer epistemischer Sicherheit ein
System wahrer und begründeter Meinungen aufgebaut werden könnte. Das Recht auf ihrer
Seite hat diese Hoffnung aber nur insofern, als Ursachverhalte in der Tat irrtumsimmun erkannt würden. Doch eben dies disqualifiziert sie als Fundament unseres gewöhnlichen, irrtumsanfälligen, objektiven Wissens; denn das irrtumsimmune Wissen wäre kein objektives
Wissen, seine Gegenstände - eben die Ursachverhalte - wären vom Wissensakt gar nicht ablösbar, ihr Sein wäre, in einer bekannten Formel Berkeleys, ihr Wahrgenommenwerden (ihr
Erfaßtwerden durch die Sinne oder durch das Denken).
Um dies einzusehen, greifen wir auf das realistische Moment der Wahrheit zurück. Der Realismus, der in ihm angelegt ist, ist, wie wir gesehen haben, der erkenntnistheoretische. Unvereinbar mit dem realistischen Moment ist also dessen Widerpart, der erkenntnistheoretische
Idealismus (gemäß der Berkeleyschen Formel „esse est percipi“). Wo das realistische Moment
der Wahrheit seinen Einfluß verliert, unterhalb der Ebene des propositionalen Als, da gilt
demnach der Idealismus. Das Sein eines Ursachverhaltes, d.h. sein Der-Fall-Sein, das zugleich
seine Existenz ist, ist demnach sein Erfaßtwerden. Dann aber geht das erfassende Denken
auch seinerseits vollständig in dem je erfaßten Ursachverhalt auf; und es wird zum Rätsel, wie
es sich von einem Ursachverhalt wieder lösen und zu einem weiteren Ursachverhalt übergehen können soll, d.h. wie mir eine Mannigfaltigkeit von Ursachverhalten gegeben sein könnte,
die ich doch im Erfassen durchlaufen und deren Elemente ich memorieren und mit den jeweiligen Nachfolgern zusammenfassen müßte. Kant hat daraus, wie wir in Teil II.C sehen werden, geschlossen, daß in Wahrheit eine objektivierende, propositionale Synthesis das gegebene Mannigfaltige immer schon zusammengenommen und den vermeintlichen Ursachverhalten
ihren vorpropositionalen Charakter genommen hat.
41
Es scheint, daß damit ein infiniter Regreß verbunden ist - die propositionale Synthesis operiert
an solchem, das ihr bereits in anderen Zusammenhängen ausgesetzt war -, der mit dem befürchteten Regreß der Bezugnahme konvergieren dürfte. Eine voraussetzungslose Bezugnahme auf ein Einzelnes wäre eine infallible Bezugnahme auf einen Ursachverhalt mittels eines
logischen Eigennamens à la Russell. Wenn aber die Ursachverhalte immer nur Fluchtpunkt in
der Analyse des Realen, nie erreichtes ontisches Fundament sind, dann ist voraussetzungslose
und irrtumsimmune Bezugnahme nicht möglich. Eine Pointe Kants wird es sein, daß dieser
Regreß die bodenlose Struktur von Raum und Zeit angemessen zum Ausdruck bringt, daß es
sich also um einen Regreß in der Sache, nicht um einen Fehler in der Theorie handelt.
3. Epoché und Subjektivität
§ 9. Die transzendentale Epoché
Unsere Wahrheitsansprüche betreffen, dem realistischen Moment zufolge, eine objektive, von
unserem jeweiligen Urteilsakt unabhängige Realität; und sie sind keine bloßen Ansprüche,
jeweils richtig geraten zu haben, sondern zugleich Wissensansprüche. Aus dem realistischem
Moment der Wahrheit folgt nämlich, wie wir gesehen haben, der erkenntnistheoretische Realismus, d.h. die These, daß die ansichseiende Realität gleichwohl epistemisch zugänglich ist,
daß sie sich uns zeigt - ob unmittelbar oder durch Repräsentationen vermittelt, mag zunächst
dahingestellt bleiben. Zu meinem Wahrheitsanspruch gehört demnach der Anspruch, daß ich
urteile, wie ich urteile, weil die objektive Wahrheitsbedingung meines Urteils erfüllt ist; und
diesen Anspruch mache ich bei Bedarf anderen gegenüber geltend, indem ich die Gründe nenne, die mein Urteil bestimmen.
Aus dem realistischen Moment folgt aber auch meine prinzipielle Fehlbarkeit; und da das realistische Moment konstitutiv für die Praxis des Erhebens von Wahrheitsansprüchen (für die
Urteilspraxis) ist, muß jeder kompetente Teilnehmer an dieser Praxis seine eigene Fehlbarkeit
kennen und in Rechnung stellen. Das aber heißt, daß ich in der Lage sein muß, angesichts
dessen, was mein Urteil bestimmt, den Gedanken zu erwägen, daß es sich anders verhält, als
ich urteile. Der Bestimmungsgrund meines Urteils, daß p, ist der Anschein, daß p, unter dem
ich stehe. Wenn ich nun den Gedanken erwäge, daß mein Urteil, daß p, an dem ich im übrigen
festhalten mag, falsch ist, dann stelle ich mir vor, daß der Anschein, daß p, besteht, ohne daß
es der Fall ist, daß p. Das aber setzt voraus, daß ich den Anschein, daß p, vom Der-Fall-Seindaß-p in Gedanken trennen kann.
42
Nicht nur das Spielen mit dem Gedanken der Falschheit meines Urteils, sondern erst recht der
wirkliche Zweifel setzt dieses Trennvermögen meinerseits voraus. Andererseits ist der Vollzug der Trennung zwischen Anschein und Der-Fall-Sein etwas Einfacheres und Grundlegenderes als der Zweifel und auch als der bloße Gedanke an die Falschheit meines Urteils. Edmund Husserl hat in diesem Zusammenhang vom Ausschalten und Einklammern gesprochen,
und diesen Vorgang wie folgt beschrieben (meine Erläuterungen in eckigen Klammern):
Die Thesis, die wir vollzogen haben [den Wahrheitsanspruch, den wir erhoben haben],
geben wir nicht preis, wir ändern nichts an unserer Überzeugung, die in sich selbst
[rein für sich betrachtet] bleibt, wie sie ist, solange wir nicht neue Urteilsmotive einführen: was wir eben nicht tun [d.h. wir korrigieren unser Urteil nicht durch ein neues,
stellen es auch nicht in Frage, vergleichen es nicht mit Alternativen usw.]. Und doch
erfährt sie [die Thesis] eine Modifikation - während sie in sich verbleibt, was sie ist,
setzen wir sie gleichsam ‘außer Aktion’, wir ‘schalten sie aus’, wir ‘klammern sie
ein’. Sie ist weiter noch da, wie das Eingeklammerte in der Klammer, wie das Ausgeschaltete außerhalb des Zusammenhanges der Schaltung. Wir können auch sagen: Die
Thesis ist Erlebnis [das Urteil ist als der Anschein, der uns zu ihm bestimmte, präsent],
wir machen von ihr aber ‘keinen Gebrauch’ [wir ziehen z.B. keine Folgerungen aus
dem Urteil, d.h. wir behandeln es nicht als Urteil], und das natürlich nicht als Privation
[so als könnten wir gar nicht anders] verstanden (wie wenn wir vom Bewußtlosen sagen, er mache von einer Thesis keinen Gebrauch); vielmehr handelt es sich bei diesem,
wie bei allen parallelen Ausdrücken, um andeutende Bezeichnungen einer bestimmten
eigenartigen Bewußtseinsweise, die zur ursprünglichen schlichten Thesis [...] hinzutritt
und sie in einer eben eigenartigen Weise umwertet. Diese Umwertung ist Sache unserer vollkommenen Freiheit [...].“ 18
Diese eigenartige Bewußtseinsweise der Urteilsenthaltung bei einer womöglich „unerschütterten [...] Überzeugung von der Wahrheit“ des Urteils, in die wir uns aus freien Stücken versetzen, wenn wir gleichsam die logische Kupplung treten und den Motor der objektiven
Wahrheitsansprüche leerlaufen lassen, nennt Husserl mit einem Terminus technicus der antiken, pyrrhonischen Skepsis Epoché („εποχη“).19
18
Ideen zu einer reinen Phänomenologie, § 31, in: Husserl, Gesammelte Schriften 5, hg. von Elisabeth Ströker,
Hamburg 1992, S. 63. Hervorhebungen im Original; meine Zusätze in eckigen Klammern (AFK).
19
Ebd. S. 64. Husserl läßt dort zu, daß sich die Epoché sogar mit einer „unerschütterlichen, weil evidenten Überzeugung von der Wahrheit verträgt“. Dagegen gebe ich zu bedenken, daß die Möglichkeit der Epoché hier (an-
43
Pyrrho von Elis (ca. 365 - ca. 275 v. Chr.) und seine Nachfolger bemühten sich nicht nur aus
erkenntnistheoretischen (weil nichts sicher gewußt werden könne) bzw. logischen Gründen
(weil die Aussage nun einmal in der Symmetrie der Zweiwertigkeit stehe), Urteilsenthaltung
zu üben, sondern sie suchten in der Epoché auch ihre Version vom Glück: die sogenannte Ataraxie, die unerschütterliche innere Ruhe in den Wechselfällen des Lebens. Der pyrrhonische
Skeptiker zweifelt gar nicht daran, daß sieben Pfund Rindfleisch eine gute Suppe geben, sondern kocht und ißt und genießt die Suppe im Modus der Urteilsenthaltung - und ließe sich daher auch nicht erschüttern, wenn die Suppe wider Erwarten verdorben wäre. Am äußeren Lebensvollzug ändert sich für ihn unmittelbar nichts, nur an der Einstellung dazu: das Leben
wird als Anschein, nicht mehr als Der-Fall-Sein vollzogen; doch vermittelt durch die gewandelte Einstellung ergeben sich Konsequenzen dann auch für die äußere Lebensführung, etwa
gelassenes Hinnehmen von Unglück und besonnenes Handeln in Gefahr.
Husserl orientiert sich an der skeptischen Epoché und nicht etwa am Cartesischen Zweifel,
weil die Epoché unsere „thetische“ Einstellung, d.h. unsere gewöhnliche Urteilspraxis, nicht
durch etwas anderes, z.B. eine Zweifelspraxis, ersetzt, sondern sie gleichsam nur abspeckt und
ihre Schwundform übrigbehält: den Anschein im Urteil rein als Anschein, ein minimales „Urteil“ in jedem Urteil, das der Irrtumsmöglichkeit und Zweiwertigkeit, dem weiteren Abspekken und dem Zweifel nicht mehr ausgesetzt ist und das wir sprachlich ausdrücken können
durch ein dem ursprünglichen Urteil (bzw. Satz) vorangestelltes „Es scheint mir, daß ...“ oder
auch ein Cartesisch/Kantisches „Cogito [mit a.c.i.]“ bzw. „Ich denke, daß ...“. Descartes fragt
in seiner zweiten Meditation nach dem, woran ich nicht mit Gründen zweifeln kann, selbst
wenn ein mächtiger und bösartiger Dämon in jedem Wahrheitsanspruch, den ich erhebe, mich
täuscht, und kommt zu dem Ergebnis: Der Dämon mag mich täuschen, soviel er kann, so kann
er doch nicht machen, daß ich mich darin täusche, daß mir scheint (bzw. daß ich denke), daß
das und das der Fall ist.20 Descartes’ Meinung, der Husserl sich anschließt, ist es, daß es sich
hier immer noch um Wahrheitsansprüche handelt, die ich denkend erhebe, um minimale, irrtumsimmune Wahrheitsansprüche eben. Freilich dürfen es, wenn ich dem realistischen Wahrheitsmoment zufolge in allen objektiven Wahrheitsansprüchen fehlbar bin, dann keine objektiven Wahrheitsansprüche mehr sein. Dies scheint Descartes (wie wir in Teil II.C sehen werden), nicht gebührend gewürdigt zu haben, und darin ist Kant der Wahrheit näher gekommen
als er.
ders als bei Husserl) aus dem realistischen Moment der Wahrheit hergeleitet wurde, wodurch ihr Operationsbereich von vornherein auf die zweiwertigen Sätze bzw. die irrtumsanfälligen Überzeugungen eingeschränkt wird.
20
Vgl. [...]
44
Kant nämlich meint, daß das „Ich denke“, von dem er in § 16 der Kritik der reinen Vernunft
sagt, daß es alle meine Vorstellungen begleiten können muß21, sich mittels des Personalpronomens nicht auf ein „minimales“ inneres Objekt, genannt Selbst oder Geist oder Seele, bezieht,
sondern daß es das sogenannte transzendentale Subjekt oder vielleicht besser: die transzendentale Subjektivität, zum Ausdruck bringt, die nicht als Einzelding vergegenständlicht werden darf. Transzendental nennt Kant alles, was zur Theorie der Erkenntnis a priori von Gegenständen, nicht zur Theorie a priori von Gegenständen (Metaphysik) oder zur Theorie a
posteriori von Naturgegenständen (Physik) gehört. Alles Transzendentale also ist ungegenständlich. Insofern nun das minimale Urteil im objektiven Urteil, das in der Epoché isoliert
und durch ein vorangestelltes ‘mir scheint’ oder ‘ich denke’ ausgedrückt wird, keine objektive
Geltung mehr beansprucht, ist das im ‘mir’ bzw. ‘ich’ gemeinte Subjekt ungegenständlich,
also als transzendentale Subjektivität zu verstehen (was das genau heißen mag, kann im Augenblick offenbleiben). Husserl nennt die Epoché daher transzendental,22 und da er sie als
methodisches Rüstzeug im Rahmen seiner sogenannten Phänomenologie einsetzt, nennt er sie
auch phänomenologisch.23 Wir interessieren uns hier für die Epoché nicht unter methodischer,
sondern unter inhaltlicher Fragestellung, d.h. es geht uns nicht um eine spezifisch philosophische oder näher phänomenologische Epoché als unsere Methode, sondern um die naive, vortheoretische Epoché, die uns allen geläufig sein muß, sofern wir kompetent an der Urteilspraxis teilnehmen, als unser Thema. Transzendental aber dürfen wir die vortheoretische Epoché
nennen, weil sie die transzendentale Subjektivität zum Ausdruck bringt.
Letzteres bedarf gewiß weiterer Erläuterung; und diese wird die nächsten beiden Paragraphen
in Anspruch nehmen. Ich beginne mit der Frage der Kognitivität (Wahrheitsfähigkeit) der
Epoché: Inwiefern darf man die Enthaltung vom objektiven Urteil wiederum als eine Art Urteil, wenn auch jenseits der Zweiwertigkeit auffassen? Sollte man von der Epoché nicht viel
eher wie etwa auch vom Zweifel oder von einer Frage sagen, daß sie eben nicht mehr urteilsartig, nicht mehr kognitiv (möglicherweise wahr) ist? Die zitierten Autoritäten - Descartes,
Kant und Husserl - sind sich in dieser Frage offenbar einig. Was mir scheint bzw. was ich
denke, das ist mir Descartes zufolge bekannt, ohne daß die Möglichkeit des Irrtums bestünde;
und Husserl folgt ihm hierin. Kant ist weniger explizit, aber wenn er lehrt, daß ein „Ich denke“ jede meiner Vorstellungen (Wahrheitsansprüche) begleiten können muß, dann bedeutet
das nicht bloß, daß ich zu einem Vollzug dieser Begleitung als denkendes Wesen grundsätz21
KrV B ... .
Vgl. Husserl, Cartesianische Meditationen, § 8.
23
Ideen, § 32.
22
45
lich in der Lage bin, sondern auch, daß jede solche Begleitung legitim, d.h. wahr ist. Wenn ich
denke, daß p, dann ist mein Begleitgedanke, daß ich denke, daß p, eben trivialerweise wahr.
Die letzte Bemerkung geht über die bloße Berufung auf Autoritäten zwar schon hinaus, aber
sie verwickelt uns auch sogleich in neue Probleme, die im folgenden Paragraphen traktiert
werden sollen: Die Wendung ‘ich denke, daß p’ ist, wenn sie einerseits die Epoché ausdrükken soll, zumindest zweideutig; denn sie drückt andererseits auch die Selbstzuschreibung eines Gedankens aus, die aus der Perspektive einer dritten Person als eine Fremdzuschreibung
vorgenommen und ausgedrückt werden kann: ‘N.N. denkt, daß p’. Hier wird offenkundig einer objektiv in Raum und Zeit anzutreffenden Person ein Prädikat zugesprochen, und zwar
näher ein mentales oder psychologisches Prädikat (‘denkt, daß p’). Ich will von dieser Problematik zunächst abstrahieren und strikt bei dem ‘ich denke, daß p’ als Ausdruck der Epoché
verharren: Warum ist dies, als Ausdruck der Epoché, kognitiv? - Hieran entscheidet sich
letztlich die Frage des Naturalismus, d.h. die Frage, ob es eine Erste Philosophie geben kann
oder nicht. Einige Entscheidungsgründe seien im folgenden angeführt.
Erstens kann uns nichts hindern, an einem objektiven Wahrheitsanspruch als Wahrheitsanspruch festzuhalten, aber zugleich den Anspruch auf Objektivität, d.h. Unabhängigkeit des
Der-Fall-Seins von unserem Fürwahrhalten, preiszugeben bzw. ihn einzuklammern. Wenn wir
die Epoché so, als vollständige Deobjektivierung eines Wahrheitsanspruches, fassen, ist sie
per definitionem weiterhin kognitiv: ein minimaler, vollständig deobjektivierter Wahrheitsanspruch.
Zweitens können wir den Fall des Wahrnehmungsanscheins ins Feld führen. Dem erkenntnistheoretischen Realismus zufolge muß es eine Art Schnittstelle zwischen erkennender Subjektivität und erkannter Realität geben: eine Klasse von Wahrheitsansprüchen, mit denen nicht
nur beansprucht wird, daß ihre jeweiligen Wahrheitsbedingungen erfüllt sind (das gilt generell
für alle Wahrheitsansprüche), sondern ferner, daß die jeweiligen Wahrheitsbedingungen auch
die Ursachen für den betreffenden Anspruchsakt sind. Nehmen wir mein Wahrnehmungsurteil, daß gerade die Sonne scheint. Es ist wahr dann und nur dann, wenn gerade in meiner Umgebung die Sonne scheint. Das ist seine Wahrheitsbedingung. Und eben dies: daß gerade die
Sonne scheint, ist auch die Ursache meines Urteils. Wäre etwas anderes die Ursache des Urteils gewesen, etwa daß ich jemanden schwitzend mit Sonnenhut zur Tür hereinkommen sah
und daraus naheliegende Schlüsse zog, dann wäre das Urteil vielleicht wahr, aber kein Wahrnehmungsurteil gewesen. Nun ist es freilich denkbar, daß die wirkliche Ursache eines Urteils,
das ich fälle, mir selber unbekannt ist (z.B. könnte ein bösartiger Dämon mir etwas einflüstern
46
oder ein bösartiger Wissenschaftler irgendwelche Manipulationen an meinem Gehirn vornehmen). Wenn auf diese Weise die Ursache an sich und die Ursache für mich (d.h. das, was ich
für die Ursache halte) meines Urteils auseinanderfallen, dann ist mein Urteil falsch oder bestenfalls zufällig richtig. In einem Wahrnehmungsurteil nun ist die Ursache für mich, d.h.
mein Bestimmungsgrund des Urteils, der betreffende Wahrnehmungsanschein, der, wenn das
Urteil als Wahrnehmungsurteil wahr ist, als Ursache und Wahrheitsbedingung des Urteils
wirklich besteht. Um meiner Fehlbarkeit im Wahrnehmen willen aber muß der Wahrnehmungsanschein als Anschein bestehen können, ohne objektiv der Fall zu sein. Eben dies aber,
das Bestehen eines Anscheins als solchen - nicht mehr, aber auch nicht weniger -, beanspruche ich im Vollzug der Epoché; und insofern ist dieser Vollzug noch ein - minimaler, deobjektivierter - Wahrheitsanspruch, also kognitiv.
Drittens aber können wir uns vom auffälligen Phänomen der Wahrnehmung und unseren
diesbezüglichen Intuitionen lösen und streng aus dem erkenntnistheoretischen Realismus, also
letztlich aus dem realistischen Moment der Wahrheit, argumentieren. Diesem Realismus zufolge zeigt sich die Realität an ihr selber, entweder unmittelbar oder durch die Vermittlung
von Repräsentationen, die sich dann ihrerseits unmittelbar zeigen müßten. Die zunächst recht
unbestimmte Rede von diesem Sichzeigen bekommt einen präziseren Sinn im Hinblick auf
die Epoché: Das Sichzeigen, die Phänomenalität der Realität ist eben jener Anschein, der in
der Epoché isoliert und für sich betrachtet wird. (In diesem Sinne können daher auch wir die
Epoché phänomenologisch nennen.) Diese Betrachtung ist nicht mehr objektivierend, aber
nach wie vor kognitiv.
In diesem Zusammenhang paßt vielleicht folgende Bemerkung zum erkenntnistheoretischen
Idealismus, der Gegenposition des Realismus. Dem erkenntnistheoretischen Idealismus zufolge erschöpft sich das An-sich-der-Fall-Sein des Realen in seiner Präsenz für die wahrnehmende und denkende Subjektivität, in seiner „Idealität“ im Sinne des Für-mich-Seins. Dieser
Idealismus ist insofern revisionär in Beziehung auf unsere Urteilspraxis, als er mit dem realistischen Moment der Wahrheit unvereinbar ist und es theoretisch ausschalten muß. Vortheoretisch schalten wir das realistische Moment aber jeweils im Vollzug der Epoché aus und tragen ihm zugleich Rechnung, wenn wir, anders als die Pyrrhoniker, in diesem Vollzug und
seiner Schwebe nicht verharren wollen. Um ein Urteil, an dem wir festhalten, als möglicherweise falsch denken zu können, müssen wir, durch Deobjektivierung, das aus ihm herauslösen, was von seinem Falschsein unberührt bliebe, damit ebenso verträglich wäre wie mit seinem Wahrsein: den Schein, der ebensogut Illusion wie wahrhaftes Anscheinen sein kann. Es
47
gibt ein kleines Gedicht von Christian Morgenstern von einem Lattenzaun „mit Zwischenraum, um durchzuschaun“, bis eines Tages ein Architekt kam: der „nahm den Zwischenraum
hinaus und baute draus ein großes Haus“. Und der Zaun? - „Der Zaun indessen stand ganz
dumm mit Latten ohne was herum, der Architekt jedoch entfloh nach Afri- od Ameriko.“
Ebenso möchte der Idealist den Schein - die täuschende Illusion oder den wahren Anschein -,
der die Dinge umgibt, von ihnen loslösen und daraus eine ideelle „Realität“ aufbauen. Der
Schein jedoch ist ebenso instabil und unselbständig wie der Zwischenraum zwischen den Latten. (Andererseits wären die Latten ohne Zwischenraum auch kein Zaun mehr; und so wäre
auch die Realität ohne ihr Anscheinen keine Realität mehr; sie ist, zufolge des erkenntnistheoretischen Realismus, an ihr selber offen für unsereins, sie zeigt sich. Davon später mehr.) Zugleich aber ist der Schein nicht nur das Medium des Urteilens über objektiv Der-Fall-Seiendes
und die Präsenz des Der-Fall-Seienden für das Denken, sondern ipso facto selber präsent, ein
Nichtstandard-„Objekt“ des nämlichen Denkens, das sich in ihm vollzieht. Er ist auf eine
nicht leicht zu fassende Weise selbstbezüglich (selbstpräsentierend) in seinem Fremdbezug
auf Reales (seiner Präsentation von Fremdem). Man kann ihn nicht für sich beschreiben, sondern nur im Rückgriff auf Reales, das er jeweils als Inhalt beansprucht; aber einmal, wie auch
immer indirekt, beschrieben, ist er kognitiv und auf seine Weise „real“ zugleich.
Viertens schließlich wird in der Folge die Verwandtschaft der Epoché mit der Selbstzuschreibung eines mentalen Prädikates, die ja auch einen homonymen sprachlichen Ausdruck hat,
und die Verwandtschaft dieser mit den Fremdzuschreibungen mentaler Prädikate, deren Kognitivität kaum zu bestreiten ist, einen zusätzlichen Grund für die Kognitivität der Epoché
sichtbar machen.
§ 10. Die wissende Selbstbeziehung
Wenn gegen den metaphysischen Realismus die Skepsis ins Feld geführt wird, die sein Zwilling ist, so braucht sich der Realist fürs erste nicht getroffen zu fühlen. Denn daß Wahrheit
radikal nicht-kognitiv ist - so springt selbst Davidson seinen realistischen Kontrahenten bei -,
ist kein Einwand gegen den metaphysischen Realismus, sondern dessen eigene Lehre.24 Aber
diese Lehre ist eben doch instabil und wird durch ein, zwei weitere Überlegungen zu einem
Einwand gegen sich selbst. Da es zu jedem Satz einen Satz gibt, der ihn negiert, ist die Hälfte
24
SCT [...]
48
aller Sätze wahr. Damit aber mehr als die Hälfte der ernsthaft und affirmativ geäußerten Sätze
wahr ist, müssen unsere Meinungen, die wir in unseren Sätzen äußern, einen Hang zur Wahrheit haben; d.h. die Wahrheit muß in irgendeinem aufklärungsbedürftigen Sinn kognitiv sein.
Indem der metaphysische Realismus letzteres bestreitet, untergräbt er dann jedoch die Bedingungen der Möglichkeit des Wahr-falsch-Spiels, also unserer Urteilspraxis. Die Wahrscheinlichkeit, daß eine geäußerte Meinung wahr ist, beträgt ihm zufolge durchgängig 0,5; und die
Erläuterung der Wahrheit als Korrespondenz erweist sich als Schlenker, der keine theoretische
Arbeit zu verrichten hat. Denn nicht nur wird das Wahr-falsch-Spiel zu einem reinen Glücksspiel mit fünfzigprozentiger Trefferquote; sondern aus prinzipiellen Gründen wird es auch unmöglich festzustellen, ob ein Treffer erzielt wurde: Auch diese Frage ist wiederum eine
Glücksfrage mit fünfzigprozentiger Gewinnchance, und auch für die Nachfrage, ob hier gewonnen wurde, gilt wiederum das gleiche usf. ad infinitum. Wenn dem aber so ist, dann wird
es unverständlich, was es heißt, einen Wahrheits- bzw. Wissensanspruch zu erheben; denn
was ein Anspruch ist, verstehen wir nur, wenn wir sagen können, wie er im Prinzip eingelöst
werden könnte. Insofern schlägt der metaphyische Realismus, gerade indem er an der Objektivität unserer Wahrheitsansprüche festzuhalten versucht, in eine radikale Wahrheitskritik und
in einen unbeabsichtigten Relativismus um; denn da sich ihm die Norm der objektiven Wahrheit unter der Hand nicht nur als unerfüllbar, sondern als unverständlich zeigt, wird er Wahrheit, statt ihren Begriff zu retten, umdeuten und in der einen oder anderen Weise relativieren
müssen (auf bestimmte Konventionen, Praktiken oder dergleichen ). Der metaphysische Realismus ist eben unverträglich mit dem realistischen Moment der Wahrheit.
Dieses fordert vielmehr den erkenntnistheoretischen Realismus und damit einen kognitiven
Zug der Wahrheit: Unsere Meinungen müssen einen Hang zur Wahrheit haben (mehrheitlich
wahr sein, wie Davidson es formuliert). Dem wäre zum Beispiel dann Rechnung getragen,
wenn die Meinungen einer Person in zwei Teilklassen, A und B, zerfielen, so daß die Meinungen in der Klasse A die Wahrheitswahrscheinlichkeit 1 besäßen, d.h. daß die betreffende
Person in ihnen unfehlbar wäre. Selbst wenn für die Meinungen in der Klasse B nach wie vor
eine Wahrheitswahrscheinlichkeit von 0,5 bestünde, wäre dann der Davidsonschen Anforderung dem Buchstaben nach Genüge getan; freilich wäre die angenommene Situation nach wie
vor unbefriedigend als ein Szenarium des erkenntnistheoretischen Realismus. Letzterem angemessener wäre es, wenn die Meinungen der Klasse A den Meinungen der Klasse B eine
mehr als halbe Wahrheitswahrscheinlichkeit verleihen könnten, was voraussetzen würde, daß
begriffliche Beziehungen zwischen den Meinungen beider Klassen bestünden.
49
Hier entdecken wir übrigens einen weiteren Grund für die Beliebtheit des Unmittelbaren in
der Erkenntnistheorie (vgl. § 8); denn dieses soll ja irrtumsimmun präsent, Gegenstand unfehlbarer Meinungen sein und würde insofern das gerade skizzierte Desiderat einer A-Meinung genau erfüllen. Allerdings ist der entdeckte Grund kein guter, geschweige denn zwingender. Denn wenn die Realität in einen Bereich unmittelbarer Gegebenheiten und einen Bereich gewöhnlicher Objekte zerfiele, so daß die unfehlbaren A-Meinungen jenen und die BMeinungen diesen beträfen, so würde es keine begrifflichen Verbindungen zwischen A-Meinungen und B-Meinungen geben, kraft deren letztere einen Hang zur Wahrheit besitzen könnten. Für unsere objektiven, objektbezogenen Meinungen bliebe also alles beim Alten, d.h. bei
der völligen Gleichberechtigung der beiden Wahrheitswerte Wahr und Falsch, die nur durch
einen folgenlosen, rein verbalen korrespondenztheoretischen Schlenker und einen durchgängigen Relativismus zugunsten des einen der beiden Werte: Wahr - aber warum nicht Falsch?
-, beendet werden könnte. Theoretisch viel erwünschter - um dem realistischen Moment der
Wahrheit Rechnung tragen zu können - wäre es, einen ontologischen Dualismus von Unmittelbarem und Objektivem zu vermeiden und vielmehr eine Klasse, A, unfehlbarer Meinungen
als Brecher der Wahr-falsch-Symmetrie in Ansatz bringen zu können, deren Mitglieder in begrifflichen Beziehungen zu B-Meinungen stünden und sich demnach in irgendeiner Weise
auch auf Objektives bezögen. Gesucht sind, mit anderen Worten, unfehlbare A-Meinungen
ohne eigenen Gegenstandsbereich, die in begrifflichen Beziehungen zu fehlbaren B-Meinungen bezüglich gewöhnlicher, objektiver Gegenstände stehen und letzteren einen Hang zur
Wahrheit zu verleihen vermögen.
Durch die Epoché erhalten wir, was wir suchen: Sie liefert zu jeder B-Meinung eine entsprechende, begrifflich engstens korrelierte A-Meinung, so zu meiner B-Wahrnehmungsmeinung,
daß es gerade regnet, die A-Meinung, daß mir scheint (bzw. daß ich denke), daß es gerade
regnet. Das Cartesische „Cogito“ bzw. das Kantische „Ich denke“ bzw., in einer noch anderen
sprachlichen Wendung, das Mir-so-Scheinen formt als Operator der Epoché aus gewöhnlichen, fehlbaren Meinungen unfehlbare Cartesische Begleitmeinungen (so werde ich sie nennen), die den beiden Anforderungen des Realismus an A-Meinungen: nicht nur (1) unfehlbar
zu sein, sondern (2) in begrifflichen Beziehungen zu fehlbaren Meinungen zu stehen, perfekt
Genüge tun. In einer objektiven Annahme, daß p, bin ich fehlbar; aber darin, daß es mir
scheint, daß p, kann ich mich nicht täuschen. So gibt es zu jeder objektiven Meinung, in der
ich fehlbar bin, eine entsprechende Begleitmeinung, in der ich unfehlbar bin; und die begriffliche Verbindung zwischen Meinung und Begleitmeinung stellt der Satz ‘p’ her, der ohne Zu-
50
satz die objektive Meinung und mit dem Zusatz ‘mir scheint, daß’ die nicht-objektive Begleitmeinung ausdrückt.
Die Cartesische Begleitmeinung ist durch die Epoché vollständig deobjektiviert, d.h. von allen
Objektivitätsansprüchen der begleiteten Meinung ist abstrahiert; und das erklärt die Irrtumsimmunität der Begleitmeinung. Der Satz, der die Begleitmeinung ausdrückt, ist freilich als
Satz zweiwertig und kann daher falsch sein. Ich kann lügen, indem ich sage, daß es mir
scheint, daß p; ich kann also andere darüber täuschen, was mir der Fall zu sein scheint; doch
mich selber kann ich hier nicht täuschen. Meine Meinung, daß mir scheint, daß p, ist irrtumsimmun, sie ist nicht zweiwertig, sondern gleichsam einwertig, so, als wäre das hier Gemeinte
ein Ursachverhalt und mit dem Akt des Meinens untrennbar zusammengewachsen. Im Fall der
Cartesischen Begleitmeinungen kommt das Wahrheitsprädikat also primär den Meinungen
und erst in zweiter Linie den sie ausdrückenden Sätzen zu, so daß der Wahrheitsbegriff zumindest an dieser Stelle aus der Semantik in die Bewußtseins- und Erkenntnistheorie hinüberreicht. Zwar haben wir es hier mit einem zweiten, deobjektivierten Wahrheitssinn zu tun, der
nicht an die Erfüllung objektiver Wahrheitsbedingungen gebunden ist25; denn daß mir scheint,
daß p, ist, wenn es wahr ist, wahr unabhängig vom objektiven Gang der Dinge und in diesem
Sinne wahr schlechthin. Aber der deobjektivierte Wahrheitssinn steht deswegen nicht unverbunden neben dem objektiven, sondern es handelt sich um ein und denselben Wahrheitsbegriff, der sich seinem eigenen Gehalt zufolge so ausdifferenziert, haben wir doch den deobjektivierten Wahrheitssinn aus der Epoché und diese aus dem realistischen Moment der - objektiven - Wahrheit gewonnen. Einem Sinn von Wahrheit entspricht aber jeweils ein Sinn des
Der-Fall-Seins, kurz: ein Seinssinn. Wir haben also zugleich mit den beiden Wahrheitssinnen
zwei Seinssinne, ein objektives und ein nicht-objektives Der-Fall-Sein, unterschieden.
Einen ersten Schritt vom völlig nicht-objektiven Mir-so-Scheinen hin zu etwas Objektiverem
vollzieht man, wenn man den Ausdruck der Epoché - ‘ich denke, daß p’ - zur Selbstzuschreibung eines mentalen Prädikates (‘denke, daß p’) verwendet. Freilich scheint sich die Unfehlbarkeit der Epoché auf die Selbstzuschreibung zu vererben, so daß der Schritt in Richtung Objektivität nicht allzu groß sein kann. Doch immerhin muß, wo prädiziert wird, auch ein logisches Subjekt zur Verfügung stehen; und die Gliederung des singulären Satzes in Subjekt und
Prädikat haben wir als an Objektivität gebunden kennengelernt (§§ 5f.), so daß wir logische
Subjekte als Objekte - objektiv vorhandene Einzeldinge - anzusehen haben. Das aber hat Konsequenzen für die logische Einteilung der Sätze der Form ‘ich denke, daß p’. Werden diese als
51
Selbstzuschreibungen verwendet, so sind sie singuläre Sätze, und ihre wesentliche logische
Gliederung ist in diesem Fall diejenige in Subjekt und Prädikat (‘ich’ / ‘denke, daß p’). Werden sie aber als Ausdruck der Epoché verwendet, dann liegt der wesentliche Einschnitt zwischen dem Operator der Epoché (‘ich denke, daß’) und dem Satz, an dessen Wahrheitsanspruch die mitbeanspruchte Objektivität durch Abstraktion „ausgeschaltet“ werden soll (‘p’).
Wir sehen also, daß der Operator ‘ich denke, daß’, wenn er in Operation tritt, nicht nur an ‘p’
operiert, sondern zugleich an sich selber qua logisch gegliedertem Satzanfang (‘ich denke, daß
...’). Der Operator der Epoché schaltet seine eigene Subjekt-Prädikat-Struktur und den mit ihr
verbundenen Objektivitätsanspruch, indem er an einem gegebenen Satz operiert und dessen
Objektivitätsanspruch ausschaltet, gleich mit aus.
Das Ausgeschaltete bleibt, wie wir wissen, präsent; nur außerhalb seiner üblichen Schaltung.
Das ist wichtig. Denn wenn das Absehen von der Objektivität die propositionale Struktur der
Aussage nicht nur ausschalten, sondern völlig unkenntlich machen würde, dann wäre das Resultat der Epoché ein unmittelbarer Ursachverhalt, der sich zu Objektivem nicht mehr in Beziehung setzen ließe. Einmal gekappt, ließe sich die begriffliche Verbindung zwischen einer
irrtumsimmunen Cartesischen Begleitmeinung und der irrtumsanfälligen begleiteten Meinung
nicht wieder herstellen; und die Epoché würde als eine begriffliche Einbahnstraße in einer
aporetischen Ontologie des Unmittelbaren enden. Die philosophisch interessante Leistung der
Epoché es ist gerade, daß sie uns eine Klasse von Meinungen erkennen läßt, die alle Tugenden
der Unmittelbarkeit besitzen, ohne ihre Laster zu teilen. Auch der Operator der Epoché ist
nichts Unmittelbares, nichts logisch Unartikuliertes, sondern hat zum begrifflichen Ausgangspunkt einen singulären Satz mit unvollständigem, durch einen einzubettenden Satz (‘p’) zu
ergänzendem Prädikat (‘ich / denke, daß ...’); und diese Struktur bleibt, auch wenn sie im
Vollzug der Epoché deaktiviert wird, unzerstört vorhanden und kann jederzeit reaktiviert werden. Für den Inhalt einer irrtumsimmunen Meinung ist und bleibt der Inhalt derjenigen irrtumsanfälligen Meinung konstitutiv, aus der sie durch Epoché entstand. Ich kann den Anschein, unter dem ich stehe, z.B. daß dort ein Baum steht, nicht ohne Rückgriff auf den Begriff des Baumes beschreiben.
Die Notwendigkeit der Möglichkeit der Epoché und der mit ihr verbundene minimale, nichtobjektive Wahrheitssinn lassen sich aus dem realistischen Moment der Wahrheit herleiten.
Doch daß und wie der Operator der Epoché seine begriffliche Grundlage in der Selbstzuschreibung von Wahrheitsansprüchen hat, läßt sich nicht mehr allein mit wahrheitstheoreti25
Das ist die - hier bestätigte - These Hans-Peter Falks in Wahrheit und Subjektivität, [...].
52
schen Mitteln aufklären. An dieser Stelle verweist die philosophische Theorie der Wahrheit
auf die Notwendigkeit einer Evidenz außerhalb ihrer: die Selbstbezüglichkeit der Phänomenalität der Dinge, die sich unabhängig von diesem Verweisen finden müßte und sich auch tatsächlich findet: als die Evidenz des Selbstbewußtseins, d.h. des unfehlbaren Wissens der Subjektivität von sich.26
Einer Selbstzuschreibung eines mentalen Prädikates (‘ich denke, daß p’), für sich erwogen,
sieht man nicht an, was sie dazu qualifiziert, unfehlbares Wissen zu sein. Es liegt daher auch
nicht allzu fern, ihr diesen Charakter streitig zu machen mit dem deflationären Hinweis darauf, daß jeder sich in einem faktischen, rein kausalen Sinn selbst der nächste ist, so daß es wenig sinnvoll wäre, zumal solange es noch keine Zerebroskope gibt, mittels deren wir einander
ins Hirn schauen können, eine Person nicht als die letzte Instanz in den Fragen ihres mentalen
Innenlebens gelten zu lassen. Selbstzuschreibungen mentaler Prädikate würden somit den
Schein absoluter Irrtumsimmunität unserer wohlbegründeten Konvention verdanken, einander
nicht bei Selbstzuschreibungen mentaler Prädikate zu berichtigen; die Unfehlbarkeit erwiese
sich als eine konventionalistisch erklärbare Inkorrigibilität.27 Andererseits wissen wir aus
wahrheitstheoretischen Gründen, daß es dank der Epoché Fälle von irrtumsimmunem Wissen
geben muß, die eines sprachlichen Ausdrucks bedürfen; und wir sehen ferner, daß der zugeschriebene Wahrheitsanspruch durch die Zuschreibung in der Tat eingeklammert wird: Wenn
ich sage: „Ich denke (mir scheint), daß es schneit“, dann ist der Anspruch auf objektive Wahrheit des eingebetteten Satzes ‘es schneit’ in der Tat eingeklammert. Dafür aber ist mit ‘ich
denke (...)’ ein neuer Wahrheitsanspruch erhoben, der auf dem Wege zur Irrtumsimmunität
auch noch der Einklammerung bedürfte. Das ergäbe dann eine Selbstzuschreibung zweiter
Stufe: ‘Ich denke, daß ich denke, daß es schneit’. Freilich tritt nun ein weiteres ‘ich denke’ außerhalb des Skopus der Zuschreibung auf und mit ihm ein weiterer einklammerungsbedürftiger Wahrheitsanspruch: Wir stehen offenkundig am Anfang eines infiniten Progresses der
Selbstzuschreibungen, den wir - wie Achilles die Schildkröte - überholen, bis zu seinem transfiniten Abschluß hin überspringen müßten, um die irrtumsimmune Epoché zu erreichen.
Was als Sprung über einen infiniten Progreß erscheinen mag, ist indessen reinterpretierbar als
eine Schleife bzw. als ein - gutartiger - Zirkel: Wenn der Operator der Selbstzuschreibung als
selbstbezüglich gedacht, d.h. so behandelt wird, als fiele er mit in seinen eigenen Bereich (als
fiele das ‘ich denke, daß’ mit auf die Seite von ‘p’), dann und nur dann ist er der Operator der
26
Daß und wie Wahrheitstheorie und Subjektivitätstheorie sich wechselseitig stützen, hat Falk in Wahrheit und
Subjektivität ausgeführt.
53
Epoché; dann und nur dann ist ein theoretischer Grund gegeben, warum die Iteration des ‘ich
denke’ eine logische Äquivalenz erzeugt: Während ‘p’ und ‘ich denke, daß p’ keineswegs
logisch äquivalent sind, da ‘p’ wahr sein kann, ohne daß ich dies weiß oder glaube, und da
wegen meiner Fehlbarkeit andererseits ‘ich denke, daß p’ wahr und ‘p’ falsch sein kann, ist
doch die Iteration ‘ich denke, daß ich denke, daß p’ notwendigerweise genau dann wahr, wenn
‘ich denke, daß p’ wahr ist; denn wenn ich etwas denke (im Sinne eines wirklichen Gedankenvollzugs, nicht bloß einer Disposition zu Gedankenvollzügen und entsprechenden Verhaltensweisen), dann kann mir dies nicht entgehen, und wenn ich andererseits meine, etwas zu
denken, dann denke ich es auch. Das Meinen ist also in diesem Fall, in dem es dasjenige der
Epoché ist, selbstbezüglich: eine Selbstbeziehung des Meinens oder meinende Selbstbeziehung. Und da in der Epoché das Meinen zugleich irrtumsimmun, also ein Wissen ist, so liegt
hier ipso facto eine Selbstbeziehung des Wissens bzw. eine wissende Selbstbeziehung vor.
§ 11. Selbstzuschreibung und Fremdzuschreibung
Zuschreibungen von propositionalen Einstellungen (Meinungen, Wünschen usw.) können auf
zweierlei Weise vorgenommen bzw. gedeutet werden, de re und de dicto. Halten wir uns zu
Zwecken der Illustration ausschließlich an den uns hier interessierenden Fall der Meinungen
(den Fall dessen, was jemand denkt, was ihm der Fall zu sein scheint), und betrachten wir
folgende Zuschreibung:
(1) Peter glaubt, daß der Bundeskanzler schon bald eine Frau sein wird.
Hier legt es der Inhalt nahe, die Zuschreibung de dicto zu deuten: Peter glaubt das, was hier
als ein mögliches dictum in indirekter Rede vorkäme, wenn ‘glaubt’ durch ‘sagt’ ersetzt würde; denn schwerlich wird Peter meinen, daß der gegenwärtige Kanzler sich einer Geschlechtsumwandlung unterziehen wird. Er meint vielmehr, daß in naher Zukunft eine Frau zur Bundeskanzlerin gewählt werden wird. Bei der Deutung de dicto bleibt der singuläre Terminus
‘der Bundeskanzler’ im Operationsbereich (Skopus) der zuschreibenden Wendung ‘Peter
glaubt, daß (...)’, der hier durch die Klammern angedeutet ist. Bei einer Deutung de re hingegen würde Peter von einer bestimmten res, hier dem gegenwärtigen Bundeskanzler, wie immer (mittels welcher dicta auch immer) er sich auf ihn beziehen mag, glauben, daß er demnächst eine Frau wäre. Der singuläre Terminus ‘der Bundeskanzler’ würde hierbei aus dem
Bereich der Zuschreibung in Gedanken herausgenommen und käme so vor dem ‘daß (...)’ zu
27
Richard Rorty hat eine derartige Position vertreten in [...].
54
stehen. Wer die De-re-Deutung - im vorliegenden Beispiel wider alle Plausibilität - erzwingen
wollte, könnte dies sprachlich wie folgt explizit machen:
(2) Peter glaubt vom Bundeskanzler, daß er schon bald eine Frau sein wird.
Was logisch in den Skopus der Zuschreibung gehört, das ist nicht nur (wie oben) typographisch, sondern auch im Husserlschen Sinne eingeklammert, d.h. von seiner objektiven
Wahrheit und seinem Objektbezug ist abgesehen. Die Zuschreibung
(3) Paul glaubt, daß der Osterhase Eier bringt
kann wahr sein (d.h. Paul mag das tatsächlich glauben), weil ‘der Osterhase’ hier im Bereich
von ‘Peter glaubt, daß (...)’ steht. Wollte man den singulärern Terminus aus dem Zuschreibungsbereich exportieren:
(4) Paul glaubt vom Osterhasen, daß er Eier bringt,
so würde in diesem Fall die Zuschreibung selber fehlerhaft werden (entweder falsch, gemäß
der Russellschen Kennzeichnungstheorie, oder zu einem Satz, mit dem keine Aussage gemacht wird, gemäß der Strawsonschen Theorie der Voraussetzungen).
Betrachten wir nun vor diesem Hintergrund die Differenz zwischen der Epoché und der
Selbstzuschreibung einer Meinung. Wenn wir die Zuschreibung (1) de re lesen wollen, muß
der singuläre Terminus ‘der Bundeskanzler’, obwohl er grammatisch im Bereich der Zuschreibung steht, logisch aus diesem Bereich exportiert werden (wie in Satz (2) explizit geschehen). Dadurch bekommt er eine referentielle Position. Im Fall der Epoché verhält es sich
gerade umgekehrt. Obwohl das Personalpronomen ‘ich’ in ‘ich denke, daß p (...)’ grammatisch außerhalb des durch die Klammern angedeuteten Bereiches steht, gehört es logisch doch
hinein. Es gibt in der Epoché kein logisches Außerhalb des Bereiches der Epoché. Das Personalpronomen ‘ich’ hat im sprachlichen Ausdruck der Epoché also keine referentielle Position;
vom Objektbezug, der sonst mit ‘ich’ verbunden ist, ist abstrahiert. Wird hingegen das grammatische Außerhalb des Bereiches der Epoché als logisches Außerhalb gedeutet und damit das
‘ich’ aus dem Bereich der Epoché in Gedanken exportiert und an eine referentielle Position
gebracht, so verwandelt sich die Epoché in die Selbstzuschreibung einer Meinung.
Mit dieser Verwandlung geht ein Anspruch auf objektive Bezugnahme einher: Von einem bestimmten Objekt, mir selber, prädiziere ich nunmehr etwas (daß ich die und die Meinung habe). Dann aber sollte ich mich in der Selbstzuschreibung irren können, und eben dies, so
scheint es, kann ich nicht. Die Irrtumsimmunität vererbt sich von der Epoché, wo sie am Plat-
55
ze ist, auf die Selbstzuschreibung, wo wir sie theoretisch nicht gut unterbringen können, es sei
denn, daß es auch mit der Objektivität von Selbstzuschreibungen eine ganz eigene Bewandtnis
hätte.
Wir wollen diese Frage hier nicht ausdiskutieren, sondern sie für die Behandlung im Zusammenhang mit dem Cartesischen „Cogito, ergo sum“ in Teil II.C vormerken. Wir wollen nur
einige Bedingungen der Möglichkeit der Irrtumsimmunität von Selbstzuschreibungen sondieren und, um die Sache nicht unter dem ihr eigenen Schwierigkeitsgrad abzuhandeln, zunächst
ein weiteres Problem zur Sprache bringen: das Problem der veritativen Symmetrie von Selbstund Fremdzuschreibungen bei gleichzeitiger epistemischer Asymmetrie.28 Damit ist folgendes
gemeint. Peters Selbstzuschreibung: „Ich denke, daß der Bundeskanzler schon bald eine Frau
sein wird“ ist wahr dann und nur dann, wenn Pauls Fremdzuschreibung wahr ist: „Peter denkt,
daß der Bundeskanzler schon bald eine Frau sein wird“; d.h. zu jeder Selbstzuschreibung (in
der ersten Person singular) gibt es Fremdzuschreibungen (in der dritten Person singular) mit
denselben Wahrheitsbedingungen. Das ist die veritative Symmetrie der Selbst- und Fremdzuschreibungen. Andererseits sind Selbstzuschreibungen (von Meinungen und allgemeiner von
mentalen Prädikaten) nach Voraussetzung irrtumsimmun, die entsprechenden Fremdzuschreibungen aber offenkundig nicht. Irrtumsimmunität schließt objektive Wahrheitsbedingungen
aus, Irrtumsmöglichkeit scheint sie zu verlangen; im gedachten Fall müßten daher die nämlichen Wahrheitsbedingungen sowohl objektiv als auch nicht-objektiv sein können, was freilich
ein Widerspruch wäre.
Wenn wir den Widerspruch vermeiden wollen, müssen die Wahrheitsbedingungen, um der
Irrtumsimmunitität der Selbstzuschreibungen willen, auch im Fall der Fremdzuschreibungen
nicht-objektiv sein. Das bedeutet, daß es keine Möglichkeit geben kann, die Wahrheitsbedingung einer Zuschreibung von mentalen Prädikaten ohne Rückgriff auf mentale Prädikate anzugeben. Betrachten wir ein schematisches Beispiel:
‘Peter glaubt, daß p’ ist wahr dann und nur dann wenn q
Nach dem Gesagten gibt es keine Möglichkeit, für ‘q’ einen Satz einzusetzen, der ohne einen
Glaubenskontext (ohne ein ‘glaubt, daß p’) auskommt. Der Glaubenskontext fungiert als Deobjektivator; d.h. er garantiert den nicht-objektiven Charakter der Wahrheitsbedingung ‘q’.
Mit anderen Worten: man kann nicht in streng objektiver, nicht-mentaler Begrifflichkeit hinreichende und notwendige Bedingungen dafür angeben, wann eine Person denkt, daß p (für
28
Diese Termini übernehme ich von Tugendhat, siehe [...].
56
beliebige Einsetzungen für ‘p’). Das ist ein sehr fruchtbares Resultat, weil es, wenn es sich bewahrheiten läßt, antireduktionistische Konsequenzen in der Philosophie des Geistes (Theorie
des Bewußtseins) hat. Doch sehen wir von solchen Konsequenzen zunächst ab, und versuchen
wir, erst einmal das Resultat gegen naheliegende Bedenken zu verteidigen.
Wie, so könnte man ein solches Bedenken formulieren, sollte ich je mit Gründen Fremdzuschreibungen mentaler Prädikate vornehmen können, wenn es keine objektiven Wahrheitsbedingungen für sie gibt? Im Fall der Selbstzuschreibung verfahre ich ohne Rücksicht auf objektive Bedingungen: Wenn ich meine, daß ich meine, daß p, dann meine ich ipso facto, daß
p. Hier bin ich (nach unserer gegenwärtigen Voraussetzung) irrtumsimmun und kann (ein logisches, kein faktisches ‘kann’) mich nicht irren. Sehr leicht irren kann ich mich hingegen,
wenn ich einer anderen Person eine Meinung zuschreibe. Der in der Fremdzuschreibung behauptete Sachverhalt (daß die betreffende Person meint, daß p) ist also unabhängig von meinem Akt der Zuschreibung und daher - relativ zu mir - objektiv. Relativ zu der betrachteten
Person hingegen ist er nicht-objektiv; sie kann sich die Meinung, daß p, wenn sie sie hat, irrtumsimmun zuschreiben. Der seltsame Gedanke einer relativen Objektivität lädt ein zu verzweifelten Vermeidungsstrategien, etwa zu einer Skepsis bezüglich des Fremdpsychischen:
Vielleicht bin ich das einzige Wesen mit psychischen (geistigen) Zuständen und Vorgängen;
denn meine eigenen geistigen Vorgänge kann ich - noch dazu zweifelsfrei - feststellen. Im Fall
der anderen nehme ich nur objektive, körperliche Vorgänge wahr; und von denen scheint kein
begrifflicher Weg, sondern allenfalls eine vage Analogie mit meinem eigenen Fall zu geistigen Vorgängen zu führen. Die Analogie aber ist zu wenig: Nur weil ein bestimmtes körperliches Verhalten bei mir gewöhnlich mit Schmerzempfindungen korreliert ist, muß dies nicht
ebenso für andere gelten.
In dieser verfahrenen Situation bietet der Begriff des Kriteriums, so wie er beim späten Wittgenstein vorkommt, eine Lösung.29 Das beobachtbare, objektive Verhalten einer Person, so
lehrt Wittgenstein, ist ein Kriterium für ihre geistigen Zustände und Vorgänge.30 Ein Kriterium in diesem spezifischen Sinn ist weniger als eine hinreichende und notwendige Bedingung,
aber mehr als ein bloß faktischer Hinweis (ein Indiz oder Symptom). Weniger als eine notwendige und hinreichende Bedingung: Jemand kann durch sein Verhalten vorgeben, eine bestimmte Meinung zu haben, die er nicht hat, und kann umgekehrt eine Meinung, die er hat,
verbergen; er kann Schmerzen simulieren oder umgekehrt klaglos ertragen. Mehr als ein
29
30
Vgl. Falk, „Person und Subjekt“, [...].
Wittgenstein, PU, passim.
57
Symptom: Was ein Symptom für was ist, muß durch Erfahrung gelernt werden; was ein Kriterium für was ist, wird hingegen als Aspekt der Sprachbeherrschung mit dem Spracherwerb
gelernt. Man versteht das Wort ‘Schmerz’ nicht, wenn man nicht weiß, mit welcherlei äußerem Verhalten Schmerzen in der Regel einhergehen; zum Begriff Schmerz gehört es, daß
Schmerzen sich in den meisten Fällen - wenn auch nicht immer - so und so im Verhalten der
betroffenen Person manifestieren. Wittgenstein nennt dieses Wissen im Unterschied zum
Wissen des Arztes, daß eine bestimmte körperliche Reaktion ein Symptom für eine bestimmte
Erkrankung ist, grammatisches Wissen, wobei natürlich nicht an die Grammatik im Sinne der
Syntax gedacht ist, sondern an die Grammatik in einem umfassenderen Sinn, die auch logischsemantische Aspekte einer Sprache einschließt.
Kriterial für das, was eine Person meint, ist einerseits ihr Gesamtverhalten, speziell aber ihr
Sprachverhalten, noch spezieller das, was sie auf eine entsprechende Nachfrage sagt. Es ist
undenkbar, daß eine Person immer nur Meinungen in ihrem Verhalten ausdrückt, die sie nicht
hat, und Meinungen, die sie hat, für sich behält. Eine solche Person hätte gar nicht lernen können, Meinungen zu haben, auszudrücken und für sich zu behalten; sie hätte die Sprache nicht
lernen können.
Der Begriff des Kriteriums erlaubt nun folgende Lösung für das Problem der veritativen Symmetrie und epistemischen Asymmetrie von Selbst- und Fremdzuschreibungen mentaler Prädikate. Weder für eine Selbstzuschreibung noch für eine Fremdzuschreibung gibt es objektive
Wahrheitsbedingungen. Für eine Fremdzuschreibung aber gibt es äußere Kriterien, durch die
die Zuschreibung auf objektive Sachverhalte bezogen ist; und das erklärt die hier bestehende
Irrtumsmöglichkeit. Sie hat, wie sich nun zeigt, sogar zwei Quellen; denn erstens kann ich
mich darüber täuschen, ob das relevante Kriterium erfüllt ist, ob z.B. jemand die Lautfolge
hervorgebracht hat: „Die Rhön ist ein Fluß“, oder ob ich ein ‘k’ vor ‘ein’ überhört habe. Das
ist der gewöhnliche Irrtumsspielraum, der bezüglich objektiver Sachverhalte besteht. Dazu
kommt zweitens im gegebenen Fall (dem der Zuschreibung auf Grund von Kriterien) der Irrtumsspielraum, den die kriteriale Lücke gewährt, jene Lücke nämlich, die dafür sorgt, daß ein
Kriterium keine notwendige und keine hinreichende Bedingung ist. Vielleicht hat die betreffende Person verlautbart: „Die Rhön ist ein Fluß“, doch nur zum Scherz oder um jemanden
hinters Licht zu führen. Die Verlautbarung ist keine hinreichende Bedingung dafür, daß die
Person glaubt, die Rhön sei ein Fluß; und es ist auch keine notwendige Bedingung für die
Wahrheit dieser Zuschreibung, daß die Person auf meine Nachfrage: „Ist die Rhön ein Fluß?“
mit „Ja“ antwortet.
58
Es gibt in der Philosophie des Geistes eine reduktionistische Strömung, die nacheinander verschiedene Theoriegestalten hervorgebracht hat, zunächst den logischen Behaviorismus (Gilbert Ryle wäre hier als Hauptvertreter zu nennen), der die Pointe von Wittgensteins Kriteriumsbegriff mißachtet und im beobachtbaren Verhalten hinreichende und notwendige Bedingungen für geistige Vorgänge zu finden hofft. „Ja, es gibt geistige Vorgänge“, so lehrt der
Behaviorismus, „aber dabei handelt es sich in Wirklichkeit um bestimmte Dispositionen zu
sprachlichem und nichtsprachlichem Verhalten.“ Der sogenannte Funktionalismus hat den
kontraintuitiven Charakter des logischen Behaviorismus dadurch zu vermeiden gesucht, daß
geistige Vorgänge nicht nur an Verhaltensdispositionen, sondern an ihren kausalen Rollen
überhaupt festgemacht bzw. mit ihnen identifiziert werden sollen (David Lewis wäre unter
anderen hier zu nennen). Gemeinsam ist diesen Reduktionismen, daß sie im Bereich des Physischen notwendige und hinreichende Bedingungen für Geistiges suchen, daß sie in der Folge
keine strenge (logische) Irrtumsimmunität, sondern nur einer faktische oder konventionelle
Inkorrigibilität der Selbstzuschreibungen anerkennen können. Aus dem realistischen Moment
der Wahrheit folgt immerhin für die Epoché die strenge Irrtumsimmunität, und wenn sie von
dort (gemäß dem Cartesischen Übergang vom „cogito“ zum „sum“) auf die Selbstzuschreibungen vererbbar ist, dann ist der Reduktionismus in der Philosophie des Geistes auch um der
Zuschreibungen willen unhaltbar. Er scheitert aber ohnehin an der Irrtumsimmunität der Epoché selber, denn diese ist ja ihrerseits kognitiv, also ein mentaler Zustand bzw. näher eine außergewöhnliche - propositionale Einstellung. So entfällt das Motiv, um der Reduktion des
Geistigen willen den Selbstzuschreibungen mentaler Prädikate die Irrtumsimmunität streitig
zu machen.
Ein anderes Motiv ist damit noch nicht entfallen: Es ist noch unklar, wie sich Bezugnahme auf
ein Objekt (auf je mich selber mittels ‘ich’) mit Irrtumsimmunität vertragen kann; denn Bezugnahme ist, wie wir gesehen haben, im allgemeinen voraussetzungsvoll. Wenn ich sage:
„Dieser Baum da drüben ist kahl“, so mag es sein, daß dort gar kein Baum ist (vielleicht ist
dort ein Werbeplakat mit Baum, vielleicht halluziniere ich usw.). Mein referentieller Irrtum
hat dann zur Konsequenz, daß ich gar keine Aussage gemacht habe (bzw., wenn man Russell
folgt, daß ich eine falsche Aussage gemacht habe). Die Selbstzuschreibung aber ist immun gegen referentiellen Irrtum, obwohl das ‘ich’ in referentieller Position ist. Mit dieser Problematik - mit der Frage, warum bzw. inwiefern die Bezugnahme mittels ‘ich’ nicht scheitern kann werden wir uns in Teil IV und in Teil V beschäftigen.
59
Wenn wir nun auf die Ausgangsfrage des vorigen Paragraphen zurückschauen, dann gibt uns
der Begriff des Kriteriums einen wichtigen Fingerzeig für eine tragfähige Antwort. Die Frage
war, wie die Meinungen in Epoché bzw. wie irrtumsimmune Selbstzuschreibungen (die dort
so genannten A-Meinungen) die mit ihnen korrelierten objektiven Meinungen (B-Meinungen)
stützen können. Konkret: Inwiefern stützt mein irrtumsimmunes Wissen, daß mir scheint, daß
es regnet, meine irrtumsanfällige Meinung, daß es regnet? Wir sehen nun, daß das schiere
Auftreten einer Meinung so etwas wie ein Kriterium ihrer Wahrheit sein könnte - „so etwas
wie“: weil das Auftreten der Meinung kein Krieterium im Sinne eines äußeren Vorganges,
sondern seinerseits mit äußeren Vorgängen (Verhalten) kriterial vermittelt ist; aber dann doch
so etwas wie ein Kriterium, weil das Auftreten einer (objektbezogenen) Meinung selbstverständlich keine hinreichende und notwendige Bedingung der Wahrheit ihres Inhaltes, aber
andererseits auch mehr als ein bloßes Symptom ist. Mehr als ein bloßes Symptom muß es
sein, weil andernfalls der erkenntnistheoretische Realismus, so wie im vorigen Paragraphen
vorgeführt, zugunsten eines metaphysischen Realismus preigegeben werden müßte.
Insbesondere gilt an der Schnittstelle zwischen unseren Überzeugungen und der Realität, also
bei Wahrnehmungsmeinungen, daß ihr Auftreten ein recht verläßliches Anzeichen (im Sinne
eines nicht-äußeren Kriteriums) ihrer Wahrheit ist, und man kann die Standardbedingungen
der Wahrnehmung (zu denen faktisch gesunde Sinne, Tageslicht usw. gehören) geradezu definieren als diejenigen Bedingungen, unter denen Wahrnehmungsmeinungen wahr sind. Es
müssen um des erkenntnistheoretischen Realismus willen diese Bedingungen im Prinzip erfüllbar sein, obwohl wir (um unserer Fehlbarkeit willen) nie sicher wissen können, ob sie gerade erfüllt sind. Vielleicht narrt uns gerade ein sehr mächtiger bösartiger Dämon oder ein
nicht minder bösartiger Neurotechnologe. Aber diese - gelinden - Zweifel machen eine detektivische, keine logische Skepsis aus. Wenn uns ein mächtiger Dämon oder Technologe jetzt
narrt, dann kann ein noch mächtigerer dem schlimmen Spiel ein Ende setzen; dann werden
wir erfahren, was wahrhaft der Fall war und ist. Logisch wird die Skepsis, wenn es prinzipiell
keine Möglichkeit gibt und geben wird, aus unserem Irrtum herauszufinden; und diese Skepsis
ist mit dem erkenntnistheoretischen Realismus unvereinbar.
60
4. Die antinomische Natur des Diskurses
§ 12. Die negierende Selbstbeziehung
Wir haben bisher untersucht, was in unserer Urteilspraxis an allgemeinen Voraussetzungen
enthalten ist; wir haben nicht untersucht, ob sich diese Voraussetzungen und damit unsere
Urteilspraxis selber rechtfertigen oder wenigstens gegen diese oder jene Kritik oder Skepsis
verteidigen lassen. Andererseits haben wir bislang auch keine unerfüllbaren Voraussetzungen
der Urteilspraxis entdeckt. Nichts spricht dagegen, daß etwa der erkenntnistheoretische Realismus, der aus dem realistischen Moment der Wahrheit folgt, eine haltbare Position ist. Wir
haben im Gegenteil an dem Phänomen der Subjektivität insofern eine Stützung der Urteilspraxis vorgefunden, als die Epoché, deren Möglichkeit aus dem realistischen Moment der Wahrheit folgte, sich mit der wissenden Selbstbeziehung identifizieren ließ, die für Subjektivität
charakteristisch zu sein scheint. In den folgenden drei Paragraphen werden wir uns nun mit
einem sehr viel problematischeren begrifflichen Ingrediens der Urteilspraxis beschäftigen, das
einer grundsätzlichen Wahrheitskritik und einem durchgängigen Relativismus Vorschub zu
leisten droht.
Um gleich mit der These ins Haus zu fallen: Die Urteilspraxis als solche, der Logos selber, ist
mit einer unbehebbaren Antinomie behaftet. Der Widerspruch läßt sich nicht vermeiden, denn
er ist immer schon da; er läßt sich allenfalls meiden: fliehen, umgehen, ächten, tabuisieren
oder etwas dergleichen.
Ich möchte diese These durch zwei unabhängige Argumente begründen, eine theoretische
Überlegung und ein wirkliches Beispiel. Zunächst die theoretische Überlegung.
Aus dem realistischen Moment folgt unsere Fehlbarkeit und die Zweiwertigkeit unserer Aussagen. Daraus folgt für einen beliebigen Aussagesatz, α, die Möglichkeit einer Aussage, α’,
die dann und nur dann wahr ist, wenn α nicht wahr ist, mit anderen Worten: die Möglichkeit
der Negation von α, geschrieben: ¬α (lies: es ist nicht der Fall, daß α, oder kurz: nicht-α). Das
Negationszeichen ‘¬’ steht für die Operation der Verneinung, die eine Aussage als Eingabe
nimmt und eine Aussage als Ausgabe liefert, derart, daß Ausgabe und Eingabe immer einen
verschiedenen Wahrheitswert haben: Ist die Eingabe wahr, so ist die Ausgabe falsch, und umgekehrt. Die Ausgabe ist der Eingabe kontradiktorisch entgegengesetzt und heißt die Negation
der Eingabe. (Die Negation ist also das Resultat einer Verneinung.)
61
Nun kann für eine Operation, die zu einer Eingabe jeweils eine Ausgabe liefert, auch derjenige Grenzfall gedacht werden, in dem Eingabe und Ausgabe identisch sind. Angewandt auf die
Verneinung ergäbe dies eine Negation, die die Negation ihrer selbst ist, also eine negierende
Selbstbeziehung. Da die Verneinung ihrer Definition zufolge einen Satz mit entgegengesetztem Wahrheitswert liefert, müßte eine Negation-ihrer-selbst beide Wahrheitswerte besitzen;
sie müßte entweder qua Eingabe wahr und qua Ausgabe falsch sein oder umgekehrt, und da
diese Hinsichtsunterscheidung nur unsere ganz äußerliche ist, müßte sie schlicht wahr und
falsch zugleich sein. Das erscheint natürlich auf Anhieb absurd.
Schauen wir uns diese Absurdität von einer anderen Seite her an. Das Erheben von Wahrheitsansprüchen ist nur dann eine sinnvolle Praxis, wenn ein Wahrheitsanspruch, daß p, nicht
immer schon ebensosehr wahr oder ebensosehr falsch ist wie sein kontradiktorisches Gegenteil, daß nicht p. Ein Widerspruch impliziert daher seine eigene Negation, d.h. von einem Satz
der Form ‘p∧¬p’ dürfen wir schließen auf den Satz ‘¬(p∧¬p)’. Nun könnte es aber durchaus
einen Grenzfall der Praxis des Erhebens von Wahrheitsansprüchen geben, in dem die gewohnten logischen Gesetze ihre Gültigkeit verlieren, ohne daß dadurch diese Praxis als ganze schon
diskreditiert wäre. Der gedachte Grenzfall wäre so etwas wie eine logische Singularität, und
solange er das bliebe, könnte die logische Praxis für die übrigen Fälle ungestört fortgesetzt
werden. Was etwa sollten wir sagen, wenn die Negation irgendeines Widerspruchs sich ihrerseits als widersprüchlich erwiese, so daß von ihr auf den Ausgangswiderspruch zurückgeschlossen werden müßte? Wir hätten dann zwei Sätze, einer das logische Negativ des anderen,
die einander implizierten, die also einander logisch äquivalent wären. Mit anderen Worten,
wir hätten einen Satz, der seiner Negation logisch äquivalent und insofern bis auf logische
Äquivalenz mit ihr identisch wäre: eine Negation-ihrer-selbst. Wenn wir ferner, wie gewöhnlich, davon ausgehen, daß aus einem Widerspruch nicht nur seine Negation, sondern Beliebiges folgt, dann sind alle Negationen-ihrer-selbst bis auf logische Äquivalenz identisch, und
wir können von der negierenden Selbstbeziehung, die sich in all diesen Fällen manifestiert, in
einem singularis maiestatis reden.
Wenn wir die - bisher nur probehalber angenommene - negierende Selbstbeziehung begrifflich
zu fassen versuchen, dann tun wir es notgedrungen mit unseren begrifflichen und logischen
Mitteln, von denen wir andererseits selber sagen, daß sie für die logische Singularität, welche
die negierende Selbstbeziehung um des Funktionierens der Urteilspraxis willen sein müßte,
versagen. Das ist gut so; denn das erlaubt es uns, uns von unseren paradoxen Beschreibungen
der negierenden Selbstbeziehung auch wieder zu distanzieren - uns also unsererseits als Theo-
62
retiker nicht ernsthaft in Paradoxien zu verwickeln - und andererseits doch dabei zu bleiben,
daß das antinomisch beschriebene Phänomen an ihm selbst ein Denken eigener, vorpropositionaler Art ist, das uns vertraut sein muß, auch wenn wir nur in Paradoxien von ihm sprechen
können. Kurz, die Singularität der negierenden Selbstbeziehung ist, wenn es sie gibt, ein Ursachverhalt, keine Proposition.
Betrachten wir die Sache noch von einer dritten Seite. Die Operation der Mengenbildung oder
sagen wir, der Einfachheit der Illustration halber, der Einermengenbildung kann im Grenzfall
so gedacht werden, daß ihre Eingabe und ihre Ausgabe identisch sind. Man erhält in diesem
Grenzfall eine Einermenge, e, für die gilt: e = {e}, also eine Einermenge-ihrer-selbst. Gewöhnlich werden Einermengen-ihrer-selbst in der Mengenlehre durch das sogenannte Fundierungsaxiom ausgeschlossen. Es entsteht aber kein Widerspruch, wenn das Fundierungsaxiom
z.B. durch ein bestimmtes Antifundierungsaxiom, AFA, ersetzt wird, dem zufolge es genau
eine Einermenge-ihrer-selbst, Ω, gibt, die geradezu dadurch definiert ist, daß für sie gilt:
Ω={Ω}.31 Die Möglichkeit der Existenz der Einermenge-ihrer-selbst, Ω, liegt in der Widerspruchsfreiheit der Annahme ihrer Existenz. Ob Ω wirklich existiert, hängt dann von anderen
Erwägungen ab.
Bisher haben wir mit dem Gedanken der Negation-ihrer-selbst nur gespielt, wie etwa auch ein
Mengentheoretiker mit dem Gedanken der Einermenge-ihrer-selbst spielen und ihn dann verwerfen kann. Nun könnte es scheinen, als sei die Negation-ihrer-selbst im Vergleich zur Einermenge-ihrer-selbst schon gründlich diskreditiert. Denn die Negation-ihrer-selbst ist ja inkonsistent. Aber das ist ihre interne Inkonsistenz, nicht die Inkonsistenz ihrer Existenzannahme durch uns. Schließlich gibt es vielerlei widersprüchliche Gedankeninhalte. Zum anderen
gilt für Gedankeninhalte anders als für raumzeitliche Einzeldinge und anders als für mathematische Entitäten, daß ihre Existenz ihr bloßes Gedachtwerdenkönnen (ihr Der-Fall-seinoder-nicht-der-Fall-Sein) ist. Deswegen kommen wir bezüglich der Negation-ihrer-selbst
nicht weniger weit, sondern vielmehr weiter als bezüglich der Einermenge-ihrer-selbst: Es
genügt hier, das zu kennen, was wir gerne durch eine Art Fundierungsaxiom ausschließen
würden (die Negation-ihrer-selbst), um seiner (bzw. ihrer) Existenz sicher sein zu können.
Denn einen Gedankeninhalt, den wir ausschließen wollen, müssen wir verstanden haben (wir
wüßten sonst nicht, was wir ausschließen wollen); und ein verstandener Gedankeninhalt „existiert“ in dem nachgeordneten Sinn, in dem Gedankeninhalte eben existieren. Ein Gedanken-
31
Vgl. Peter Aczel, Non-Well-Founded Sets. CSLI Lecture Notes 14. [Stanford] 1988, S. 6.
63
inhalt, mit dem man spielt, ist ipso facto erfaßt. Es stellt sich dann nur noch die Frage der
Wahrheit, also des Der-Fall-Seins: Ist die Negation-ihrer-selbst der Fall oder nicht? Wenn wir
uns aber auf diese Frage ernsthaft eingelassen haben, dann sind wir in der Antinomie gefangen
- denn das Der-Fall-Sein der Negation-ihrer-selbst ist ihr Nicht-der-Fall-Sein - und dann ist es
zu spät für Proteste.
Gefangen sind wir nicht in einer gewöhnlichen Antinomie - da wären wir nicht wirklich gefangen -, sondern gleichsam in der Mutter aller Antinomien. Eine gewöhnliche Antinomie ist
eine widerspruchsvolle Menge von Sätzen, von denen wir keinen gerne preisgeben. Gern oder
nicht - wir geben schließlich einen der Sätze preis, indem wir ihn negieren, und gelangen so in
die Widerspruchsfreiheit. Die Mutter aller Antinomien, welche die negierende Selbstbeziehung ist, gewährt uns kein solches Schlupfloch. Sie besteht aus einem einzigen Satz, und der
negiert sich bereits selber. Indem wir sie negieren, folgen wir ihr also nach und bekräftigen sie
vielmehr. Die einzige Form der Preisgabe der antinomogenen Prämisse, d.h. der Antinomie
selber, ist in diesem Fall das Vergessen und Verdrängen, die schiere Inkonsequenz. Und das
ist in der Tat unser Ausweg aus dieser Aporie.
Bisher haben wir abstrakt argumentiert, ohne Angabe eines konkreten Beispiels. Deswegen
haben wir auch dem Verdacht, wir operierten mit sinnlosen Sätzen, keine Angriffsfläche geboten. Es wurde gar keine Wortfolge oder Lautfolge präsentiert mit dem Anspruch, dies sei
ein Ausdruck der negierenden Selbstbeziehung. Wir haben nicht einen Kandidaten der negierenden Selbstbeziehung phonetisch oder syntaktisch spezifiziert, wogegen dann der Einwand
der Sinnlosigkeit oder der grammatischen Fehlgeformtheit erhoben werden könnte, sondern
wir haben einen möglichen Satzinhalt logisch spezifiziert als die Negation seiner selbst, für
den ein sprachlicher Ausdruck erst noch gefunden werden müßte.
Wenn ich jetzt einen wirklichen Satz als Beispiel der negierenden Selbstbeziehung anführe,
dann muß natürlich dem Sinnlosigkeitsverdacht Rechnung getragen werden. Doch sofern dies
geschehen kann, erhalten wir ein starkes Zusatzargument für die These vom antinomischen
Charakter des Logos als solchen. Das Beispiel übrigens ist wohlbekannt und vielbesprochen:
die Antinomie des Lügners. Es gibt Sätze, die sogenannten Lügnersätze, die ihre eigene
Falschheit implizieren. Einfache Beispiele sind ‘Ich lüge jetzt’ oder ‘Dieser Satz ist nicht
wahr’. Halten wir uns an den zweiten Beispielsatz, und nennen wir ihn kurz den Lügner. Zunächst müssen wir uns dessen versichern, daß der Lügner tatsächlich ein Beispiel für die negierende Selbstbeziehung ist. Das ist leicht getan: Sofern wir ihm den Wahrheitswert Wahr
zubilligen, müssen wir ihm Glauben schenken, und demnach ist er nicht wahr, also zu vernei-
64
nen. Sofern wir ihn aber als nicht wahr betrachten, bekräftigen wir seine Aussage über sich
selbst, und er wird unter der Hand wahr. Er ist wahr genau dann, wenn er nicht wahr ist. Sein
Wahrheitswert ist einer ständigen Umkehrung ausgesetzt.
Nun gilt es, dem Verdacht der Sinnlosigkeit zu begegnen. An drei Stellen kann er theoretisch
gegen den Lügner gekehrt werden: (1) gegen seinen Subjektausdruck ‘dieser Satz’, (2) gegen
das Prädikat ‘(ist) wahr’, (3) gegen die logische Partikel ‘nicht’. Da man negative Sätze als
solche nicht leicht für unsinnig erklären möchte, bilden (1) und (2) die Standardzielscheiben
der Kritik. Gegen (1) kann vorgebracht werden, daß ein Satz keine Aussage über sich selber
machen, daß daher sein Subjektausdruck sich nicht auf ihn, den Satz, selber beziehen könne.
Dem stehen aber Fälle entgegen, in denen der inkriminierte Selbstbezug harmlos zu sein
scheint. Was spricht etwa dagegen, den Satz: ‘Dieser Satz hat fünf Wörter’, als sinnvoll und
überdies als wahr anzuerkennen? Außerdem hat Kurt Gödel gezeigt, daß jede theoretische
Formulierung der Arithmetik ihre eigene Syntax enthält, daß also bestimmte arithmetische
Lehrsätze als syntaktische Aussagen über arithmetische Lehrsätze interpretiert werden können
und daß es darunter insbesondere solche Sätze gibt, die als Aussagen über sich selber zu deuten sind.
So bleibt allein das Wahrheitsprädikat als die vermeintliche Quelle der Sinnlosigkeit übrig.
Man kann etwa im Anschluß an Alfred Tarski sagen, daß keine Sprache ihr eigenes Wahrheitsprädikat enthält, sondern daß über die Wahrheit der Sätze einer Sprache nur in einer ausdrucksstärkeren Metasprache gesprochen werden kann, oder im Anschluß an Quine, daß das
vermeintlich eindeutige Wahrheitsprädikat unserer Sprache in Wahrheit für eine unendliche
Folge von immer ausdrucksstärkeren Wahrheitsprädikaten steht, und dies so, daß jedenfalls
kein Satz eine Aussage über seine eigene Wahrheit oder Nichtwahrheit machen kann. Aber
die Vorstellung eines unendlichen Progresses von immer stärkeren Sprachen, deren jeweils
eine sich dadurch von ihrer Vorgängerin unterscheidet, daß sie auch deren Semantik enthält,
wollte Tarski selber keineswegs auf die Umgangssprache angewendet wissen. Und ein unendlicher Progreß immer stärkerer Wahrheitsprädikate ist auch nicht das, was wir ohne weiteres
hinter unserem Prädikat ‘(ist) wahr’ vermuten würden.
Doch sei dem, wie es sei. Es gibt eine ganz grundsätzliche Entlastung des Wahrheitsprädikates, die darin besteht, daß es im Lügner gar nicht wesentlich vorkommt. Daß das Wahrheitsprädikat grundsätzlich unwesentlich vorkommt, ist die Lehre der sogenannten Redundanztheorie der Wahrheit. Soweit brauchen wir nicht zu gehen; es genügt zu zeigen, daß das Wahrheitsprädikat in dem besonderen Fall des Lügners nur ein Mittel des sogenannten semanti-
65
schen Aufstiegs ist. Semantischen Aufstieg nennt Quine ein Verfahren, durch das wir indirekt
etwas über außersprachliche Sachverhalte mitteilen können, obwohl wir direkt über Sätze
sprechen.32 Die Mitteilung: „’Schnee ist weiß’ besteht aus drei Wörtern“, ist eine Mitteilung
über einen deutschen Satz (über die Anzahl seiner Wörter). Wir sind mit dieser Mitteilung
ganz bei der Sprache als unserem Thema. Auch die Mitteilung: „’Schnee ist weiß’ ist wahr“
ist nominell eine Mitteilung über den nämlichen deutschen Drei-Wort-Satz. Aber durch das
Reden über den Satz schimmert hier die außersprachliche Realität hindurch; denn was wir
gesagt haben, ist dem zitierten Drei-Wort-Satz äquivalent - dank dem besonderen Prädikat,
das wir benutzt haben, dem Wahrheitsprädikat. Aus „‘Schnee ist weiß’ ist wahr“ folgt
„Schnee ist weiß“ und umgekehrt, so daß man sagen kann, daß die Hinzufügung des Wahrheitsprädikates zu einem zitierten Satz die Wirkung der Anführungszeichen aufhebt; das
Wahrheitsprädikat hat entzitierende bzw. disquotationale Kraft. Bisweilen nun zwingt uns die
Not unserer Sprache dazu, etwas Mitteilenswertes durch semantischen Aufstieg zu verklausulieren. Wenn wir bloß mitteilen wollen, daß Schnee weiß ist, dann geht das natürlich ohne
semantischen Aufstieg. Wenn wir jemandem zustimmen wollen, der dies gerade gesagt hat,
dann können wir das tun, indem wir den Satz wiederholen (einfacher ist freilich ein schlichtes
„Ja“). Wenn wir hingegen jemandem pauschal zustimmen wollen, dann wird es zu mühsam,
alle seine Sätze bekräftigend zu wiederholen. Vielleicht geht es sogar um unendlich viele Sätze, die wir als endliche Wesen gar nicht alle wiederholen könnten. Wenn wir etwa die unendlich vielen Sätze der Arithmetik bekräftigen wollen, dann können wir, ohne uns auf eine endlose Aufzählung einlassen zu müssen, einfach sagen: „Die Arithmetik ist wahr“. Oder wir
können die Axiome der Arithmetik aufzählen und hinzufügen: „Diese Sätze und ihre logischen Folgen sind wahr“. Das ist dann ein Fall von semantischem Aufstieg: Unsere Lippen
sind bei den Sätzen, und unser Herz ist bei den Sachen - dank dem Wahrheitsprädikat.
Gewöhnlich erheben wir Wahrheitsansprüche, ohne daß wir eigens das Wahrheitsprädikat
verwenden, etwa wenn wir sagen, daß Schnee weiß ist. In diesem Fall wäre der semantische
Aufstieg mittels des Wahrheitsprädikates ein unnötiger Aufwand. Bei manchen pauschalen oder besser: allgemeinen - Wahrheitsansprüchen, etwa einem Wahrheitsanspruch für die ganze Arithmetik, ist der semantische Aufstieg hingegen unvermeidlich, ebenso dann die Verwendung des Wahrheitsprädikates. Nichts hindert uns, den Lügner als Fall eines unvermeidlichen semantischen Aufstiegs zu lesen. Wenn wir einen Satz äußern möchten, der seine eigene
32
Vgl. Unterwegs zur Sprache, § 33.
66
Negation ist, dann könnten wir zu einer infiniten Negation greifen, wenn diese nicht unsere
Ausdrucksmöglichkeiten überstiege. Wenn die folgende Äquivalenz
n ↔ ¬(n) ↔ ¬(¬ (n)) ↔ ¬(¬(¬(...)))
gänzlich entfaltet wäre, so bliebe ein infiniter Ausdruck, der nur aus Negationszeichen (und
Klammern) bestünde, übrig. Aber das ist kein Kandidat für einen sinnvollen Satz unserer endlichen Sprache. Also behelfen wir uns mit semantischem Aufstieg und formulieren die Negation-ihrer-selbst in der Form des Lügners.
An dieser Stelle konvergieren unsere beiden Argumente. Wenn wir das theoretische Argument
als erfolgreich unterstellen, so müssen wir einen sprachlichen Ausdruck, der sich des semantischen Aufstiegs bedient, als Formulierung der Negation-ihrer-selbst postulieren und finden
dann das Postulat im Lügner erfüllt. Ohne das theoretische Argument haben wir nicht die Notwendigkeit, wohl aber die Möglichkeit, den Lügner als Fall semantischen Aufstiegs zu deuten
und so das Wahrheitsprädikat aus der Schußlinie zu nehmen, und entdecken, wenn wir es tun,
daß der Lügner die Negation-ihrer-selbst formuliert. Doch was heißt ‘entdecken’? Daß er das
tut, stellen wir ohne Hintergedanken an semantischen Aufstieg fest, sobald wir über seine Botschaft nachdenken. Um so zwingender ist, auch ohne das theoretische Argument, die Folgerung, daß das Wahrheitsprädikat im Lügner nur im Zuge eines semantischen Aufstiegs und in
diesem Sinn unwesentlich vorkommt.
§ 13. Tarskis semantische Konzeption der Wahrheit
Wenn man von einem Satz Wahrheit prädiziert, dann läuft das auf dasselbe hinaus wie der
Satz selber. Wenn man also in dem Satz: ‘‘Schnee ist weiß’ ist wahr’ einerseits das Wahrheitsprädikat und andererseits die Anführungszeichen tilgt, so erhält man den äquivalenten Satz:
‘Schnee ist weiß’. In vielen anderen Fällen aber läßt sich das Wahrheitsprädikat nicht auf diese einfache Weise überflüssig machen; denn in vielen Fällen gibt es keine Anführungszeichen,
die man tilgen könnte, z.B. wenn jemand seinen Glauben an die Arithmetik ausdrückt, die
mehr Sätze enthält, als man einzeln anführen kann, indem er sagt: „Die Arithmetik ist wahr.“
Diejenigen, die meinen, der Witz des Wahrheitsprädikates liege ausschließlich in der Möglichkeit der Zitattilgung, berufen sich deswegen gern auf Tarski, der gezeigt habe, wie das
Wahrheitsprädikat in beliebigen Kontexten zum Verschwinden gebracht werden könne. Das
sei nun kurz erläutert.
67
Bisweilen hat man die Wahl, einen von zwei Begriffen nach Belieben zur Grundlage des anderen zu machen. Man könnte z.B. den Begriff des Möglichen zugrunde legen und das Notwendige als dasjenige definieren, dessen kontradiktorisches Gegenteil nicht möglich ist, oder
umgekehrt das Notwendige zugrunde legen und das Mögliche definieren als das, dessen Gegenteil nicht notwendig ist. Bis zu einem gewissen Grade ähnlich scheint es sich mit Wahrheit
und Bedeutung zu verhalten, und zwar in folgendem Sinn. Wenn wir das, worauf sich die Termini einer Sprache beziehen, also die Semantik der Termini, als geklärt unterstellen, dann - so
hat Tarski für gewisse wohlstrukturierte Sprachen gezeigt - läßt sich das Wahrheitsprädikat
für diese Sprache explizit definieren. Ob diese semantische Konzeption der Wahrheit den begrifflichen Prioritäten Rechnung trägt, ist damit freilich noch nicht entschieden; denn man
kann auch umgekehrt den Wahrheitsbegriff als undefiniert zugrunde legen, um die Bedeutungen der Termini einer je bestimmten Sprache anzugeben. Das wäre dann eine alethische Konzeption der Bedeutung (von ‘aletheia’, dem griechischen Wort für ‘Wahrheit’), wie sie etwa
Davidson in Anlehnung an Tarski bei gleichzeitiger Umkehrung der begrifflichen Abhängigkeiten vertritt (vgl. Teil II, § ...).
Doch bleiben wir bei dem Unternehmen einer semantischen Konzeption der Wahrheit. Ich
gebe zur Illustration ein lächerlich simples Beispiel, eine ganz einfache formalisierte Sprache,
nennen wir sie S1. In S1 gibt es zwei singuläre Sätze, ‘Fa’ und ‘Gb’, außerdem ein einstellige
Satzverknüpfung, die aus einem Satz einen neuen Satz macht: ‘¬( )’, und eine zweistellige
Satzverknüpfung, die aus je zwei Sätzen einen neuen macht: ‘( ) ∧ ( )’. Trotz dieser höchst
bescheidenen Ausdrucksmittel kann man in S1 unendlich viele Sätze formulieren, denn die
beiden Satzverknüpfungen sind beliebig oft anwendbar (und natürlich auch miteinander kombinierbar). ‘(Fa) ∧ (Gb)’ etwa ist ein Satz von S1, dann folglich auch ‘¬((Fa) ∧ (Gb))’,
‘¬(¬((Fa) ∧ (Gb)))’, ‘¬(¬(¬((Fa) ∧ (Gb))))’ usf.
Jetzt wollen wir eine Tarskische Wahrheitsdefinition für all diese unendlich vielen Sätze von
S1 geben. D.h. wir wollen (mit endlichen Mitteln) den Ausdruck definieren: ‘x ist wahr in
S1’. Tarski hat zunächst einmal ein Kriterium für die sachliche Angemessenheit einer solchen
Definition formuliert, die sog. Konvention W:
Konvention W:
Aus einer sachlich angemessenen Definition von „x ist wahr in S1“ muß für jeden der
(unendlich vielen) Sätze von S1 ein Theorem der Form
(W) ‘s ist wahr in S1 gdw p’
68
folgen, wobei ‘s’ durch eine Bezeichnung des Satzes und ‘p’ durch den Satz selber
(bzw. durch eine Übersetzung des Satzes in unsere Sprache) zu ersetzen ist.
Wenn wir eine Wahrheitsdefinition für Deutsch in Deutsch geben wollten, dann müßte also
unter vielen anderen Folgerungen auch dies aus der Definition folgen: ‘’Schnee ist weiß’ ist
wahr im Deutschen gdw Schnee weiß ist.’
S1 ist eine Sprache, die wir selber erfunden haben. Wir legen daher fest, daß der Satz „Fa“
bedeuten soll: Schnee ist weiß. Dann muß aus der Definition von ‘wahr in S1’ u.a. das Theorem folgen:
‘Fa’ ist wahr in S1 gdw Schnee weiß ist,
Und entsprechend für die anderen Sätze. Ich gebe nun kurzerhand eine Tarskische Definition
von ‘wahr in S1’ an, der man entnehmen kann, was die übrigen Sätze von S1 bedeuten sollen:
x ist wahr in S1 ↔df
(1) x = ‘Fa’ und Schnee ist weiß, oder
(2) x = ‘Gb’ und Butter ist grün, oder
(3) x = ‘¬(α)’ und α ist nicht wahr, oder
(4) x = ‘(α)∧(β)’ und α ist wahr und β ist wahr.
Was dort steht, nennt man eine rekursive oder induktive Definition (von ‘wahr in S1’). Diese
rekursive oder induktive Definition ist keine Definition im strengen Sinn, denn Definieren
heißt Eliminieren, und die rekursive Definition eliminiert den zu erklärenden Ausdruck nicht.
Er kommt vielmehr in (3) und (4) wieder vor, er „rekurriert“ (bzw. im Definiens wird auf das
Definiendum rekurriert). Das ist aber deswegen erlaubt - ganz intuitiv gesprochen -, weil für
kurze Ausdrücke schon durch (1) und (2) erklärt ist, was ‘wahr’ heißt. Für längere Ausdrücke
wird es nun im Rückgriff auf die kurzen Sätze erklärt. Wir kennen dieses Verfahren aus der
Schulmathematik. Wenn es z.B. darum geht, eine Definition der natürlichen Zahlen zu geben,
dann kann man sagen: 0 ist eine natürliche Zahl und jeder Nachfolger einer natürlichen Zahl
ist eine natürliche Zahl, und das sind alle natürlichen Zahlen, oder, nach dem obigen Muster:
69
x ist NZ ↔df
(1) x = 0 oder
(2) (∃ y)(y ist NZ und x= σ(y))33
In (2) taucht zwar das Definiendum wieder auf, aber trotzdem ist mit dieser Definition oder
Charakterisierung eindeutig festgelegt, was eine natürliche Zahl ist und was nicht. Wenn man
z.B. wissen will, ob 3 eine natürliche Zahl ist, dann findet man mit der Klausel (2) der induktiven Definition heraus, daß 3 eine natürliche Zahl ist, wenn 2 eine ist, wenn 1 eine ist, wenn 0
eine ist; und da gemäß der Klausel (1) der Definition 0 eine natürliche Zahl ist, ist eben auch 3
eine.
Es gibt auch ein Verfahren, das sich der Mengenlehre bedient, mit dessen Hilfe eine rekursive
Definition in eine explizite Definition überführt werden kann. Der Grundgedanke dabei ist,
daß man statt des zu definierenden Begriffs dessen Umfang betrachtet, also die Klasse der Objekte, auf die der Begriff zutrifft, und daß man diese Klasse oder Menge nicht benennt, sondern anonym betrachtet: ‘Es gibt eine Menge, m, für die gilt, daß ...’. Für die natürlichen Zahlen sähe das dann wie folgt aus:
Explizite Definition von ‘natürliche Zahl’ (‘NZ’):
x ist NZ ↔df
(∃ m) {[x ∈ m ↔ (x=0 oder (∃ y)(y ∈ m und x= σ(y)))] und x ∈ m}
Die beiden Klauseln der induktiven Definition kommen vor als Eingangsbedingungen für die
Menge m (in den eckigen Klammern), und die explizite Definition besagt dann, daß x genau
dann eine natürliche Zahl ist, wenn es Element der Menge m ist. Der Preis für die explizite
Definition ist, daß wir uns auf die Existenz einer bestimmten Entität, nämlich der Menge m,
festlegen müssen. Aber innerhalb der Mathematik, der Mengen überaus geläufig sind, ist das
ist kein hoher Preis.
Nach dem selben Muster kann auch die induktive Definition von ‘wahr in S1’ in eine explizite
Definition überführt werden. Wir müssen dazu die Menge aller wahren Sätze von S1 durch
die vier Klauseln der induktiven Definition bestimmen und dann definieren, daß ein Satz genau dann wahr in S1 ist, wenn er zu dieser Menge gehört:
Explizite Definition von ‘wahr in S1’:
x ist wahr in S1 ↔df
33
Lies: x ist eine natürliche Zahl dann und nur dann, wenn x=0 oder wenn es eine natürliche Zahl y gibt, so daß x
70
(∃ m) {[x ∈ m ↔
x = ‘Fa’ und Schnee ist weiß, oder
x = ‘Gb’ und Butter ist grün, oder
x = ‘¬(α)’ und nicht α ∈ m, oder
x = ‘(α)∧(β)’ und α ∈ m und β ∈ m] und x ∈ m}
Eine wichtige Komplikation für Tarskische Wahrheitsdefinitionen sollte noch genannt werden. Die Definition funktioniert deswegen, weil in ihr die Wahrheitsbedingungen langer Sätze
auf die Wahrheitsbedingungen kurzer Sätze zurückgeführt werden; und die ganz kurzen Sätze
kann man dann einzeln aufzählen, weil es nur endlich viele von ihnen gibt. Das geht aber
nicht immer so glatt wie in unserem einfachen Beispiel. In allen nennenswerten Sprachen gibt
es lange Sätze, deren Wahrheitsbedingungen auf kürzere, aber immer noch lange Gebilde zurückgeführt werden müssen, die ihrerseits gar keine Wahrheitsbedingungen haben, und zwar
geschieht das immer im Fall der Quantifikation. Wenn wir etwa unsere Sprache S1 durch eine
etwas kompliziertere Sprache S2 ablösen, die auch den Existenzquantor enthält, dann gibt es
in S2 unter anderem den Satz: ‘(∃ x)(Fx)’. Das nächstkürzere Gebilde, auf das dessen Wahrheitsbedingung zurückgeführt werden kann, ist ‘Fx’, ein sogenannter offener Satz. Offene
Sätze sind nicht wahr oder falsch, sondern werden von einigen Objekten erfüllt und von anderen nicht (sie treffen zu auf bestimmte Objekte und auf andere nicht). Deswegen braucht man,
wegen der Quantifikation, einen semantischen Hilfsbegriff, den man zunächst definieren muß,
bevor man mit seiner Hilfe den Wahrheitsbegriff definieren kann. Dieser Hilfsbegriff ist ein
zweistelliges Prädikat, also eine Relation, und zwar eine, die zwischen offenen Sätzen oder
noch kürzeren sprachlichen Ausdrücken (Termini) auf der einen und außersprachlichen Objekten auf der anderen Seite besteht (ich vereinfache hier wie auch schon im vorigen). Man
kann dann die Wahrheitsbedingung für den Satz ‘(∃ x)(Fx)’ wie folgt angeben:
‘(∃ x)(Fx)’ ist wahr in S2 ↔ es gibt einen Gegenstand, der ‘Fx’ erfüllt
So kommt mit der Erfüllungsrelation eine semantische oder Sprache-Welt-Beziehung in die
Wahrheitsdefinition, und das macht die zugrundeliegende Konzeption der Wahrheit zu einer
semantischen. Das Wahrheitsprädikat selber nämlich ist einstellig und drückt insofern einfach
eine Eigenschaft von Sätzen aus. Doch auf dem Umweg über ein zweistelliges semantisches
Prädikat, also eine Sprache-Welt-Beziehung wie Erfüllung oder Referenz oder wie immer
man sie nennen will, die als Hilfsbegriff gebraucht wird, schließt Wahrheit so etwas wie Sprader Nachfolger von y ist. (‘σ’ steht für lat. ‘successor’.)
71
che-Welt-Korrespondenz ein. Aber es ist, wie wir noch sehen werden (in Teil II) eine harmlose Korrespondenz, die kein Wasser auf die Mühlen der Korrespondenztheorie leitet.
Tarskis Verfahren zur Definiton der Wahrheit gehört in die Mathematik, in die mathematische
Logik, näher in die sog. Modelltheorie (die Tarski mit seiner Arbeit über den Wahrheitsbegriff
begründet hat), und ist philosophisch neutral. Eine Tarskische Wahrheitsdefinition für irgendeine Sprache ist also nicht schon eine philosophische Wahrheitstheorie. Andererseits kann
man natürlich Tarskis allgemeines Definitionsverfahren zur Basis philosophischer Überlegungen über den Wahrheitsbegriff machen, z.B. zur Basis eher deflationärer, negativer Überlegungen, die für eine Redundanztheorie der Wahrheit sprechen. Mit welchem Recht das geschieht, werden wir in Teil II.A untersuchen. Hier soll noch etwas über die Grenzen von
Tarskis Methode gesagt werden.
Tarski hat nicht nur gezeigt, wie man den Wahrheitsbegriff für eine je bestimmte Sprache
(wenn sie bestimmte Anforderungen erfüllt) definieren kann, sondern auch, daß man den
Wahrheitsbegriff für die Sprache, in der die Definition jeweils gegeben wird, nicht zugleich
definieren kann. Keine ordentliche, logisch wohlstrukturierte Sprache enthält demnach ihr
eigenes Wahrheitsprädikat; und das liegt nicht daran, daß in einer Sprache nicht über sie selber, über ihre eigenen Sätze gesprochen werden könnte. Zwar war unsere simple Beispielsprache S1 zu ausdrucksschwach, um sich selber thematisieren zu können; aber jede Sprache, in
der man die Arithmetik formulieren kann, enthält, wie Gödel gezeigt hat, auch ihre eigene
Syntaxtheorie. Man muß nur auf eine geschickte Weise jedem Ausdruck der Sprache eine
natürliche Zahl, seine sog. Gödelzahl, zuordnen, und schon wird die Syntaxtheorie für die
betreffende Sprache zu einem Teil der Arithmetik. So gibt es also viele logisch wohlbehütete
Sprachen, die ihre eigene Syntax enthalten, aber keine von ihnen enthält ihre eigene Semantik.
Da hingegen die natürlichen Sprachen ihre eigene Semantik zu enthalten scheinen, sind sie
prinzipiell keine logisch wohlbehüteten Sprachen. D.h. für die natürlichen Sprachen kann es meint Tarski - keine Tarskischen Wahrheitsdefinitionen geben.
Der Grund für diese Einschränkung ist die Lügnerantinomie (und verwandte semantische Paradoxien bzw. Antinomien). Das Vertrackte am Lügner ist, wie wir im vorigen Paragraphen
gesehen haben, daß wir den Widerspruch, den er erzeugt, nicht dadurch beheben können, daß
wir irgendeine Annahme, die wir bisher machten, widerrufen. Unser guter Wille, den Lügner
preiszugeben, führt vielmehr gerade zu seiner Bestätigung. Diese andererseits falsifiziert ihn
sogleich wieder. Eine logisch ordentliche Sprache, so schloß Tarski, kann keinen Lügnersatz
enthalten. Da aber viele ordentliche Sprachen, insbesondere alle Sprachen, in denen die Arith-
72
metik ausgedrückt werden kann, unweigerlich auf ihre eigenen Sätze Bezug nehmen können
und da erst recht die Negation zu den ordentlichen Sprachen dazugehört, scheint allein der
Wahrheitsbegriff als Quelle des Übels übrigzubleiben. Also kann keine logisch ordentliche
Sprache ihren eigenen Wahrheitsbegriff enthalten.
Ich kann daher zwar für eine Sprache Si eine Wahrheitsdefinition geben. Aber dazu muß ich
mich einer Sprache S(i+1) bedienen, die erstens alles ausdrücken kann, was Si ausdrücken
kann; denn alle Si-Sätze müssen in die Sprache der Definition übersetzbar sein. Also ist
S(i+1) mindestens so ausdrucksstark wie Si. Tatsächlich aber ist sie noch stärker, denn in ihr
muß außerdem der Wahrheitsbegriff für Si definierbar sein, der in Si selber nicht definierbar
ist. Das gibt dann eine offenendige Reihe von immer ausdrucksstärkeren Metasprachen, von
denen jede die Wahrheitsdefinition für ihre Vorgängerin enthält:
Si
Objektsprache, kein semantisches Vokabular
S(i+1)
semantische Metasprache für Si, enthält „wahr-in-Si“
S(i+2)
semantische Metasprache für S(i+1), enthält „wahr-in-S(i+1)“
usf.
Wir arbeiten also immer auf einer Ebene, für die wir das Wahrheitsprädikat gerade noch nicht
verstehen (wenn wir es nicht schon immer, vor allen Definitionen verstanden haben). Es entzieht sich uns systematisch. Dennoch können wir in unserer Umgangssprache auch deren Semantik thematisieren und verstehen sehr wohl den Lügnersatz. Wir sind also in unserem naiven Wahrheitsverständnis immer schon über den infiniten Progreß der Metasprachen hinweggesprungen in dessen transfinites Jenseits - freilich um dem Preis des Widerspruches.
§ 14. Das Nichts und der logische Raum
Wir sind - wie wir in § 12 gesehen haben: mit guten Gründen - davon überzeugt, daß wir den
Lügner verstehen. Dann aber sind wir in einer wirklichen Aporie, in einem Widerspruch ohne
Ausweg. Sofern aus einem Widerspruch Beliebiges folgt, bedroht er die Bestimmtheit unserer
Wahrheitsansprüche; denn wenn alles folgt, folgt eben nichts Bestimmtes mehr. Sobald wir
bemerken, daß wir einen widerspruchsvollen Wahrheitsanspruch erhoben haben, hören wir
daher in der Regel auf, Folgerungen aus ihm zu ziehen, und geben ihn preis zugunsten seiner
Negation. Doch dieser Ausweg ist uns im Falle des Lügners verwehrt, dessen Negation er
bereits selber und der insofern ein schwarzes Loch für das Licht der Vernunft ist - es aufnimmt und es in der logischen Singularität, die er ist, festhält. Dennoch machen wir uns fak-
73
tisch nicht viel aus dem Lügner, wir fürchten ihn keineswegs als das Grab des wohlbestimmten Denkens, sondern behandeln ihn eher nebenher als eine ausgefallene Logelei und überlassen es den Mathematikern, deren regulatives Ideal die Widerspruchsfreiheit ist, Mittel und
Wege zu ersinnen, ihn aus ihren Theorien zu verbannen - etwa durch eine Tarskische Hierarchisierung der Metasprachen -, so daß wir auch in unseren außermathematischen wissenschaftlichen Theorien, in dem Maß, in dem es uns gelingt, sie mathematisch zu formulieren,
keine bösen, d.h. antinomischen Überraschungen zu gewärtigen brauchen. Es scheint, daß wir
die Inkonsistenz unseres Denkens, die sich im Lügner offenbart, durch Inkonsequenz heilen,
dadurch, daß wir die zu ziehenden beliebigen Folgerungen eben nicht ziehen, daß wir vielmehr gar keine Folgerungen aus dem Lügner ziehen, sondern ihn logisch isolieren, ihn in
Quarantäne halten und unserer Denkwege gehen. In diesem Sinn schreibt Wittgenstein in seinen Bemerkungen über die Grundlagen der Mathematik, ein Satz von der Art des Lügners
könnte [...] als etwas Über-logisches, als etwas Unangreifbares, dessen Verneinung es
nur wieder selber aussagt, gelten. Ja könnte man nicht sogar die Logik mit diesem Widerspruch anfangen? Und von ihm gleichsam zu den Sätzen niedersteigen.
Der sich selbst widersprechende Satz stünde wie ein Denkmal (mit einem Januskopf)
über den Sätzen der Logik.34
Ein solches Satz-Denkmal mit einem Wahr-Falsch-Januskopf würde uns an die Zweiwertigkeit unserer Urteile als an die prekäre, antinomogene Grundlage unserer Urteilspraxis erinnern, daran, daß wir nicht nur fehlbar sind, sondern immer schon gefehlt, uns geirrt haben,
sobald wir etwas meinen oder wissen, daran, daß der Logos aus der Antinomie entspringt, sei
es auch, um ihr sogleich zu entspringen in Richtung Wahrheit, dabei seine mögliche Falschheit, also die Zweiwertigkeit, als Zeichen seiner Herkunft an sich tragend.
Der Lügner, als ein überpropositionales Denkmal aufgefaßt, gemahnt uns also an den vorpropositionalen antinomischen Ursprung des Logos: an die selbstbezügliche Negation, die wir
nur indirekt, durch semantischen Aufstieg ihrerseits als einen Satz formulieren können. Hier
stoßen wir demnach auf einen Ursachverhalt, freilich auf einen ganz besonderen, den wir ob
seiner negierenden Selbstbeziehung mit Fug und Recht als das Nichts bezeichnen können. Für
Ursachverhalte gilt die Indifferenz von Der-Fall-Sein und Existenz, und für die negierende
Selbstbeziehung gilt die Indifferenz von Der-Fall-Sein und Nicht-der-Fall-Sein. Also ist die
Existenz des Ursachverhaltes Nichts seine Nichtexistenz. Das Nichts zwingt uns in Wider-
34
Bemerkungen über die Grundlagen der Mathematik, Teil IV, Ziffer 59, in: Schriften 6, S. 256.
74
sprüche, nicht nur wenn wir es durch semantischen Aufstieg in Worte fassen, sondern auch,
wenn wir uns auf es (als auf einen Ursachverhalt) beziehen und es zu beschreiben versuchen.
Diesen Widersprüchen entkommen wir nur durch heilsame Inkonsequenz, durch die wir das
Nichts bzw. die negierende Selbstbeziehung logisch brachlegen. Dennoch bleibt Inkonsequenz - die Weigerung, Folgerungen aus eigenen Positionen zu ziehen - eine logische Untugend; und das zeigt, wie sehr der Logos durch seine Herkunft aus der antinomogenen Zweiwertigkeit gefährdet bleibt. Unvorhergesehen kann die Antinomie aus der logischen Quarantäne ausbrechen und uns einholen, täglich im Kleinen und bisweilen im Großen, und dann regredieren wir unter ihrer Herrschaft zu unvernünftigen, ja widervernünftigen Lebewesen, ohne
uns jedoch von der Vernunft als einer Norm je ganz ins Tierreich verabschieden zu können.
Wenn wir uns nun noch einmal dem Lügner zuwenden, konkret dem Satz:
(1)
Satz (1) ist nicht wahr,
und nach dem Grund, nicht seiner Sinnlosigkeit, denn er ist sinnvoll, sondern seines antinomischen Charakters fragen, dann werden wir nicht am Selbstbezug (an der Subjektstelle) als solchem und schon gar nicht am Wahrheitsprädikat, sondern vielmehr an der Negation fündig
werden. (Deswegen habe ich den antinomischen Ursachverhalt das Nichts und nicht das ursprüngliche Selbstverhältnis oder das ursprüngliche Wahre genannt.) Operationen können in
Selbstanwendung gebracht werden, siehe die Operation der Einermengenbildung. Es ist die
Operation der Negation, die im Fall der Selbstanwendung antinomisch „reagiert“ und sich
darin als die Antinomie, die sie unter ihrem aussagenlogischen Schafspelz ist, zu erkennen
gibt.
Der Sache nach kommt diese Lügnerdiagnose, ohne daß sie als solche vorgetragen würde,
schon bei Parmenides vor. Der Sache nach hat Parmenides die Negation als den Herd der Antinomie aus dem logischen Raum, dem Inbegriff dessen, was widerspruchsfrei gedacht werden
und der Fall sein kann, verbannt. Wenn aber keine negativen Sachverhalte bestehen können,
dann gibt es insbesondere keine Nichtidentität, folglich keine Vielheit und, da alles Werden
ein Übergehen von einem zu einem anderen ist, auch kein Werden. Der logische Raum gewinnt auf diese Weise eine seltsame Topologie. Parmenides faßt ihn als eine in sich undifferenzierte und gegen nichts Äußeres differenzierbare Kugel: als das eine homogene und wandellose Sein. Das „Äußere“ gegenüber dem Sein ist nichtig, ist das, was in der unbehebbaren
Antinomie zum Ausdruck kommt: das Nichts, also das dunkle logische Chaos, aus dem keine
Kunde ans Denken dringen kann. Wir Sterblichen jedoch können uns zwischen dem Sein und
75
dem Nichts nicht entscheiden, sondern irren doppelköpfig zwischen beiden umher, im Widerspruch. Wir tun so, als gäbe es Wandel und Mannigfaltigkeit. Aber wir gleiten dank unserer
Inkonsequenz nicht in ein Denk-Chaos ab, sondern schaffen es, Bestimmtheit im Widerspruch
zu erzeugen, und gehen dabei weder den strengen Weg des all-einigen Seins noch den Abweg
ins nichtige Unbestimmte, sondern den Weg der Meinung und des Scheins, der eigentlich gar
kein echter Weg ist.
Auf das Lehrgedicht des Parmenides werden wir in Teil III zurückkommen. Was sollen wir
unterdessen, in Abgrenzung zu Parmenides, aus dem Auftreten des Lügnersatzes schließen,
wenn nicht dies, daß unser Denken an seiner Wurzel antinomisch ist? Der strenge Weg des
widerspruchsfreien Seins würde, wie Parmenides unfreiwillig deutlich macht, aus dem Denken hinausführen in einen Seinsmonismus, der sich gar nicht mehr angemessen artikulieren
läßt. Andererseits schafft der Widerspruch, wenn er ungelöst verharrt, Unbestimmtheit, Beliebigkeit, Chaos. Unser Denken aber ist nicht durch und durch chaotisch und beliebig. Also
muß es uns wohl gelingen, in unserem Denken widerspruchsfreie - oder wenigstens widerspruchsarme - Zonen einzurichten und die Zonengrenze zum Chaos wenigstens so gut zu sichern, daß wir sie nicht ständig und nie endgültig überschreiten.
Als Königsweg, um den Widerspruch und das Chaos zu bannen oder vielmehr um uns inmitten des antinomischen Chaos einen Ort der Bestimmtheit einzurichten, hat sich die Mathematik bewährt. Sie ist gleichsam per definitionem widerspruchsfrei; sie soll es sein, so daß, wo
immer ein Widerspruch in ihrer Entwicklung auftritt, er ausgemerzt werden muß. Bei alledem
aber können wir nicht beweisen, daß die Mathematik widerspruchsfrei ist. (Das hat wiederum
Gödel gezeigt.) Die Widerspruchsfreiheit ist ihr definierendes, dabei aber nur ihr regulatives,
nicht konstitutives Ideal. Doch auch so ist die Mathematik unsere Versicherung gegen den
Widerspruch geworden, und zu unserer modernen Vorstellung von Wissenschaftlichkeit gehört es, daß eine wissenschaftliche Theorie mathematisch formuliert werden sollte.
Wenn es nun aber um Grundfragen geht, die noch hinter die Mathematik zurückreichen, also
um philosophische Fragen, dann gibt es keine Versicherung gegen den Widerspruch mehr.
Die Philosophie ist eine theoretische Unternehmung ohne Netz und doppelten Boden. Das
führt dazu, daß sie, ohne es darauf anzulegen, immer wieder in Widerspruch zu sich gerät,
sowohl in Widersprüche zwischen verschiedenen Theorien und Theoretikern als auch in Widersprüche innerhalb ein und derselben Theorie. So schreitet die Philosophie nicht linear voran, sondern bewegt sich eher in Kreisen bzw. in einer Spirale. Jede Generation muß einerseits
76
neu mit ihr beginnen und andererseits, um nicht stets in dieselben Aporien zu geraten, Hilfe
suchen bei den Klassikern, die vielerlei Aporien erkundet und zu umgehen gelehrt haben.
Oben habe ich den logischen Raum als den Inbegriff des widerspruchsfrei Denkbaren bzw.
des Der-Fall-sein-Könnenden bezeichnet. Im allgemeinen ist die Vorstellung des logischen
Raumes aber insofern mit einer Differenzierung verbunden, als das Mögliche (das Der-Fallsein-Könnende) als zu konkurrierenden maximalen mereologischen Summen, den sogenannten möglichen Welten, zusammengefügt gedacht wird. Leibniz, der den Gedanken einer Pluralität möglicher Welten in der Philosophie popularisierte, faßte die Welten als maximale mereologische Summen von möglichen individuellen Substanzen und verstand unter dem Möglichen den Inhalt des Verstandes Gottes als solchen, d.h. als von Gott gedachten. Jede Welt ist
intern widerspruchsfrei und steht zu jeder anderen Welt im Widerspruch; nur eine von ihnen
kann daher verwirklicht werden. Gott in seiner Allweisheit, Allgüte und Allmacht verwirklicht die beste, d.h. die sachhaltigste aller Welten - das ist die Schöpfung. Mit der Prämisse,
daß unsere Welt die wirkliche ist, läßt sich dann schließen, daß sie unbeschadet all ihrer manifesten Mängel die beste aller möglichen Welten ist. Wem diese Folgerung zu absurd erschiene, der könnte mit Leibniz gegen Leibniz wie folgt räsonieren: Da unsere Welt nicht die beste
aller möglichen ist, hat Gott sie nicht verwirklicht; also sind wir unwirkliche, doch mögliche
Wesen in einer bloß möglichen Welt in Gottes Verstand, die ihr Sein, das nur ein Gedachtwerden durch Gott ist, für bare Wirklichkeit - d.h. für Gewolltwerden durch Gott - nehmen.
Eine ganz untheologische Metaphysik möglicher Welten vertritt gegenwärtig David Lewis.
Seine These des sogenannten modalen Realismus besagt, daß die Welten als große konkrete
Einzeldinge ohne raumzeitliche oder kausale Verbindung im logischen Raum existieren. Ein
Sachverhalt oder wahlweise eine Proposition läßt sich dann auffassen als die Klasse derjenigen möglichen Welten, in denen er besteht bzw. sie wahr ist. Da es keinen parteinehmenden
Schöpfergott gibt, vielmehr die Welten ungeschaffen immer schon existieren, ist keine von ihnen objektiv als die wirkliche ausgezeichnet, sondern jede ist sich gleichsam selbst die wirkliche. Dies ist der Grundgedanke von Lewis’ indexikalischer Analyse der Wirklichkeit, der zufolge die Wirklichkeit zu einer indexikalischen Eigenschaft einer Welt wird, wie die Hiesigkeit eine indexikalische Eigenschaft eines Ortes (in einer Welt) ist. Hiesig ist für einen Denker
oder Sprecher jeweils seine eigene nähere oder fernere räumliche Umgebung; wirklich ist für
ihn in Analogie dazu jeweils die Welt, zu der er gehört. Wir nennen unsere Welt wirklich und
andere Welten bloß möglich, deren Bewohner sich mit gleichem Recht für wirklich und uns
77
für bloß möglich halten. Die Wirklichkeit wird zu einer Frage des Standpunktes im logischen
Raum.
Hätten wir mit Ursachverhalten und allein mit ihnen zu tun, so wäre die Unterteilung des logischen Raumes in Welten überflüssig. Das Der-Fall-sein-Können eines Sachverhaltes ist seine
Existenz; die Existenz eines Ursachverhaltes aber ist sein Der-Fall-Sein. Also besteht für Ursachverhalte keine Differenz zwischen Der-Fall-sein-Können und Der-Fall-Sein. Auf der
Ebene der Ursachverhalte wäre der logische Raum schlicht deren Inbegriff; und auf dieser
Ebene bewegt sich denkend Parmenides. Das, was gedacht werden kann, ist ihm daher einerlei
mit dem, was gedacht wird, und mit dem, was der Fall sein kann, was existieren kann, was der
Fall ist, was existiert, was anwesend ist im logischen Raum und ipso facto dem Denken unverborgen. Diese Gleichsetzungen sind nicht Ausdruck theoretischer Naivität, sondern eine
Konsequenz des Versuches, die Ebene der Propositionalität zu unterschreiten, eines Versuches, für den man im Sinne des Parmenides anführen könnte, daß man die Negation aufgrund
ihres antinomogenen Charakters nicht zum logischen Raum zulassen kann. Der logische
Raum reduziert sich in der Folge auf den singulären Ursachverhalt des Seins - inmitten des
nichtigen Ursachverhaltes des Nichts, den Parmenides freilich nicht als solchen anerkennt.
Wie immer wir uns theoretisch entscheiden, ob wir Parmenides folgen, der das Seiende als
homogene Lichtung im völlig abzublendenden logischen Chaos faßt, oder ob wir dem Widerspruch, gezähmt als der Gedanke der Bewegung in der Dialektik des späten Platon oder Hegels oder unkenntlich gemacht als formlose Materie bei Aristoteles oder in irgendeiner anderen Gestalt Zutritt zum logischen Raum gewähren, vor einem sollten wir uns hüten: ihn, den
Widerspruch, zu verharmlosen als einen kontingenten Denkfehler, der jeweils zu vermeiden
ist. Er ist nicht zu vermeiden, denn er ist; allenfalls läßt er sich - eine Zeitlang - meiden, umgehen, verdrängen und verleugnen. Der relative Erfolg der Mathematik und der Mathematisierung der Naturwissenschaften seit dem Beginn der Neuzeit wiegt uns in trügerischer Sicherheit. Aber sobald wir, sei es in universalistischer Theorie, sei es in universalistischer Praxis,
den logischen Raum als das ein für allemal gegebene, unserem Denken restlos zugängliche
Universum des Möglichen unterstellen, erleiden wir Schiffbruch. Unsere Theorie wird inkonsistent, unsere auf die Durchsetzung der allgemeinen Menschenrechte gerichtete Praxis
zur jakobinischen oder stalinistischen Schreckensherrschaft. Der logische Raum ist kein wandelloser unverborgener Kosmos, sondern eine sich entwickelnde, auf ihrer bescheidenen Rodung und Lichtung stets dem undurchdringlichen Urwald des Nichts ausgesetzt bleibende
Polis.
78
Hier finden wir das verborgene Motiv der Skepsis und des Relativismus. Wenn die Philosophie sich seit alters und in jeder Generation neu in schier unlösbare Widersprüche verwickelt,
so muß das wohl mit ihrem Thema zu tun haben. Ihr Grundthema aber ist die Wahrheit; und
wir sehen nun, inwiefern der Widerspruch bzw. die Antinomie in der Tat mit der Aussagewahrheit, der Zweiwertigkeit, der Negation zu tun hat (nicht freilich erst mit dem einen oder
anderen Wahrheitsprädikat in einer Sprache für eine Sprache, sondern mit dem Wahrheitsbegriff als solchem, ob er nun sprachlich explizit gemacht wird oder nicht). Warum also nicht
die Mär von der Wahrheit und dem widerspruchsfreien Sein, auf das sie verweist, endlich
preisgeben? Haben nicht die Metaphysiker seit alters so getan, als sei der logische Raum - der
Inbegriff des Denkbaren und Möglichen - von unseren Theorien bewohnbar, und ist er nicht
tatsächlich chaotisch, unbestimmt, widersprüchlich, eine unbewohnbare Wüste oder ein undurchdringlicher Dschungel für unser Denken, in der bzw. dem wir uns nur kleine Regionen Oasen oder Lichtungen - vorübergehend fürs Denken einzurichten wissen - mehr schlecht als
recht, immer provisorisch, immer vom stärkeren, omnipräsenten Chaos bedroht? Wenn diese
Oasen in der Wüste bzw. Rodungen im Urwald, in denen wir die Gesetze der Wahrheit und
des Seins mit Mühe und Gewalt jeweils eine Zeitlang zur Geltung bringen, der fragile
menschliche Aufenthaltsraum sind, der selbst durchsetzt ist von dem, dem er abgerungen
wurde, gilt es dann nicht, dies mit Gelassenheit und auch mit Heiterkeit anzuerkennen und
künftig in Rechnung zu stellen, statt dem Schein zu verfallen, als sei unsere jeweilige Rodung
das Ganze bzw. als sei dieses Ganze nur eine Fortsetzung unserer Rodung mit vergleichbaren
Mitteln, als herrsche überall ohne unser Zutun bereits das, was wir Wahrheit nennen, als sei
überall bereits Kosmos (Zier, Schmuck, Ordnung) statt Chaos?
Ein Autor, der sich dieser Wahrheitsskepsis nicht entzogen, doch produktiv auf sie zu reagieren versucht hat, ist Heidegger. Die Wahrheit, lehrt er, sei den Griechen ursprünglich nichts
Selbstverständliches gewesen. Bevor man einzelne Wahrheiten erkennen kann, muß man zunächst die Wahrheit selber dem Dunkel und dem Chaos abgerungen haben; daher das private
„α“ im griechischen Wort für Wahrheit: „aletheia“. Die Wahrheit ist ein Raub, gleichsam ein
Holzfrevel, durch den eine bewohnbare Lichtung entsteht im Unbestimmten.
Was ich hier andeute, mag metaphorisch klingen, etwa die Rede von einer Rodung im Urwald. Eine Gruppe Menschen siedelt sich da an, bildet ein Dorf, vielleicht irgendwann eine
Stadt, eine Polis. Aber von außerhalb der Stadtmauern droht stets das Chaos. Diese Metapher
- so scheint es - soll unser rationales Denken und Tun erläutern: Wir schaffen uns im Denken
einen Bezirk von relativer Sicherheit, einen Schutz gegen das Chaos der Antinomie, aus der
79
unser Denken stammt, durch Aufklärung. Das Wort selbst sagt es: Klarheit, Durchsichtigkeit
soll erreicht werden, in der Theorie durch mathematische Ausdrucksmittel und experimentelle
Prüfungsverfahren, in der Praxis durch das Arsenal des Liberalismus. Aber so schön unsere
Fortschritte auf diesem Weg auch sein mögen, immer wieder bricht das Chaos in unser Denken und Handeln ein - als kollektiver Wahn, Irrationalismus, Barbarei, als Grauen, meinetwegen auch als das Böse; und alle Zivilisation, auf die wir stolz waren, erweist sich dann als ein
dünner Lack, der schnell ab ist.
Aber - was nun das Reden in Metaphern dabei betrifft, so verhält es sich geradezu umgekehrt,
als man denken möchte. Die Rede vom Roden, Siedeln, Bauen, Wohnen, von Urwald und
Stadt, von Wüste und Oase zur Charakterisierung logisch-ontologischer Zusammenhänge ist
keineswegs metaphorisch, sondern eher remetaphorisch. Es wird nicht ursprünglich übertragen, sondern vielmehr rückübertragen. Die Begriffe, mittels deren unsere Vorfahren ihr vortechnisches Leben auslegten, darunter Begriffe wie Feldweg und Holzweg, waren ihrerseits
ontologisch aufgeladen, waren ausdrucksstarke - und sind uns heute vielleicht noch schwache
- Metaphern für unsere prekäre logisch-ontologische Situation. Deswegen konnte man sie umgekehrt verwenden, um vom Der-Fall-Sein des Der-Fall-Seienden zu reden.
Die moderne Technik hingegen ist mathematisch, nicht ontologisch aufgeladen. In ihrem
Licht verblaßt der ontologische Gehalt der Begriffe des Bauens, Wohnens, Bebauens usf. Das
ist kein Erkenntnisfortschritt, sondern eine Verblendung. Die Bewohner des vernetzten globalen Dorfes sehen vor Bäumen den Urwald nicht mehr, der sie umgibt. Wie Wilde sind wir (um
eine Wittgensteinsche Wendung aufzugreifen), denen ihr Dorf der wohlgeordnete, übersichtliche Kosmos ist, jenseits dessen es nichts weiter gibt. Man sagt bisweilen, die moderne Naturwissenschaft habe uns gezeigt, wie verloren wir auf unserem kleinen Planeten im großen
Weltall seien. Das ist weit gefehlt; wir halten das Weltall ja für berechenbar; ob es groß oder
klein ist, spielt eine geringe Rolle. Hoffen wir denn nicht, dereinst, wenn uns die Physik die
Unierte Theorie für Alles beschert, den Kosmos im Grundsätzlichen vollständig zu kennen?
Um so größer ist freilich jedes Mal unsere Verwunderung, wenn eine wissenschaftliche oder
eine politische Revolution, eine Naturkatastrophe oder eine technische Katastrophe über uns
hereinbricht: Woher kommt uns dieses, das nicht vorgesehen war? Wir sind, so scheint es,
naiv geworden, sind regrediert im Denken im Vergleich zu den Menschen, die einst auf Holzwegen und Feldwegen gingen und näher an der ontologischen Wahrheit wohnten als wir.
80