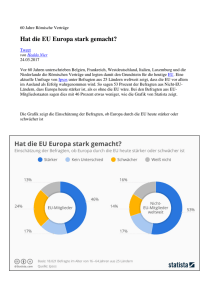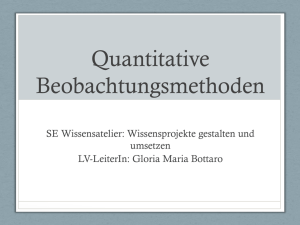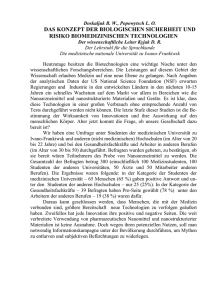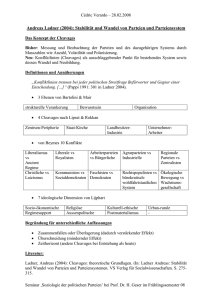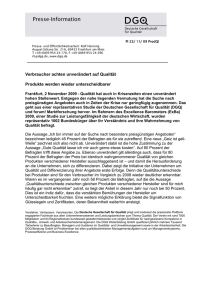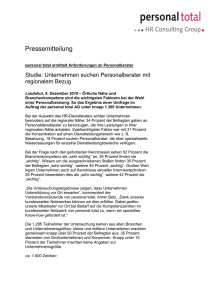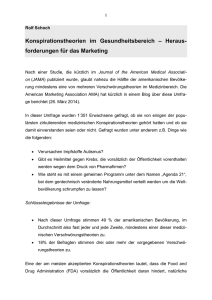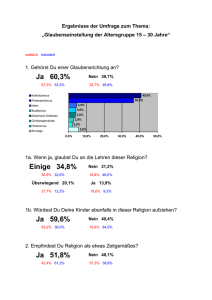Bestimmungsfaktoren des Wahlverhaltens von Bremer Schülern bei
Werbung

Universität Bremen Fachbereich 08 Institut für Politikwissenschaft Bachelorarbeit: Bestimmungsfaktoren des Wahlverhaltens von Bremer Schülern bei der Bürgerschaftswahl 2007 Verfasser: Philip Mehrtens Kontakt: [email protected] 1. Gutachter: Prof. Dr. Lothar Probst 2. Gutachterin: Dr. Manuela Pötschke Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 3 2 Theorien des Wahlverhaltens 5 2.1 2.1.1 2.1.2 Sozialstrukturelle Erklärungsansätze 3 Der mikrosoziologische Ansatz (Columbia School) Der makrosoziologische Ansatz (Cleavage Theorie) Der sozialpsychologische Ansatz (Ann Arbor-Modell) 12 2.3 Der ökonomische Ansatz (Rational Choice) 15 Daten und Analysemethoden 19 3.1 Datenbasis 19 3.2 Statistische Analysemethoden 20 Faktorenanalyse Regressionsanalyse 20 22 Empirische Analyse und Ergebnisse 25 4.1 Parteipräferenz 4.1.1 4.1.2 Deskriptive Darstellung der Bestimmungsfaktoren Regressionsanalysen und empirische Befunde 25 25 27 4.2 Positionierung auf der Links-rechts-Skala 31 4.3 Wahlabsicht 34 4.3.1 4.3.2 5 5 8 2.2 3.2.1 3.2.2 4 5 Deskriptive Darstellung der Bestimmungsfaktoren Regressionsanalyse und empirische Befunde Zusammenfassende Schlussbemerkungen und Ausblick Literaturverzeichnis 34 36 39 42 1 Einleitung Eine aktive Wahlbeteiligung ist die einfachste, elementarste Form politischer Partizipation und das Fundament der modernen Demokratie. Der in Deutschland konstatierte Trend, dass das politische Interesse und Engagement heutiger Jugendlicher immer geringer wird und ihre Wahlbereitschaft abnimmt (vgl. Hurrelmann 2006: 46f), ist deshalb ein ernst zu nehmendes Problem für die demokratische Gesellschaft. Eine Lösungsstrategie, junge Menschen an demokratische Prozesse heranzuführen und zur Wahlteilnahme zu motivieren, besteht in den von Kumulus e.V. entwickelten Juniorwahlen. 1 Anlässlich der Bürgerschaftswahl 2007 wurden sie auch an verschiedenen Schulen in Bremen durchgeführt. Die wissenschaftliche Begleitforschung übernahm eine Projektgruppe der Universität Bremen unter Leitung von Dr. Manuela Pötschke und Prof. Dr. Lothar Probst. Außer der Wahlbereitschaft wurden in dem Projekt auch politische Orientierungen und Wahlverhaltensdispositionen der Jugendlichen untersucht. Die Mitarbeit in dieser Forschungsgruppe hat den Verfasser der vorliegenden Arbeit dazu angeregt, den überaus komplexen, vielschichtigen Vorgang einer Wahlentscheidung genauer zu analysieren. Das vorhandene Datenmaterial aus der Schülerbefragung soll vertiefend ausgewertet werden unter der forschungsleitenden Fragestellung: Welche Bestimmungsfaktoren lassen sich für das Wahlverhalten von Bremer Schülern bei der Bürgerschaftswahl 2007 identifizieren? Die Thematik dieser Arbeit kann in der politikwissenschaftlichen Disziplin der Wahlforschung, genauer der Wahlverhaltensforschung, verortet werden. Die Wahlforschung ist interdisziplinär aufgestellt: neben der Politikwissenschaft tragen vor allem Soziologie, Statistik, Kommunikationswissenschaft und Psychologie aus unterschiedlichen Perspektiven zum Erkenntnisgewinn bei. Es handelt sich um einen ausdifferenzierten Strang der Sozialwissenschaft, der sowohl theoretisch als auch methodisch weit entwickelt ist und immer wieder durch empirische Überprüfungen an die Praxis rückgekoppelt wird. 1 Weitere Informationen zum Juniorwahlprojekt und zum Initiator Kumulus e.V. gibt es im Internet unter http://www.juniorwahl.de/ bzw. http://www.kumulus.net/. 3 Entsprechend dieser Tradition gliedert sich die vorliegende Arbeit in einen theoretischen und einen methodisch-empirischen Teil. Im Detail wird die Forschungsfrage in den folgenden Schritten beantwortet: In Kapitel 2 wird der vielfältigen theoretischen Durchdringung der Phänomene der Wahlforschung Rechnung getragen. Mit der Columbia School, der Cleavage Theorie, dem Ann Arbor-Modell und dem Rational Choice-Ansatz werden die vier einflussreichsten Theorien des Wahlverhaltens vorgestellt und diskutiert. Sie bilden den theoretischen Hintergrund für die empirischen Analysen. Das dritte Kapitel dient dazu, die Brücke zwischen Theorie und Praxis zu schlagen. Zuerst wird die Erhebung der Datengrundlage für die empirischen Auswertungen erläutert. Auch wenn die Daten aufgrund der Stichprobenziehung nicht als repräsentativ für alle Bremer Schüler gelten können, sind sie geeignet, Trends aufzuzeigen. Um die Erläuterung und Interpretation der empirischen Resultate besser nachvollziehen zu können, wird anschließend die Funktionsweise der beiden verwendeten statistischen Methoden „Faktorenanalyse“ und „Regressionsanalyse“ vorgestellt. In Kapitel 4 werden Theorie, Daten und Analysemethoden zusammengeführt und angewendet, um empirisch zu prüfen, welche Faktoren das Wahlverhalten der befragten Schülerinnen und Schüler beeinflusst haben. Zuerst wird herausgearbeitet, welche Determinanten die Parteipräferenz verändern, dann wird beleuchtet, wie sich diese Determinanten auf die Positionierung der Schüler auf einer Links-rechts-Skala auswirken und drittens wird dargestellt, welche Eigenschaften und Einstellungen Auswirkungen auf die Wahlbereitschaft haben. Die Arbeit schließt in Kapitel 5 mit zusammenfassenden Schlussbemerkungen, die die Diskussion der Ergebnisse sowie einen Ausblick beinhalten. 4 2 Theorien des Wahlverhaltens Dieses Kapitel umfasst eine knappe Zusammenschau der wichtigsten Theorieschulen zur Erklärung des Wahlverhaltens, denn keine „Art von empirischer Forschung […] kann ohne Bezug zu soziologischen Theorien valide Aussagen über die soziale Wirklichkeit treffen“ (Winter 1987: 33). Dabei ist zu beachten, dass es nicht die Theorie des Wahlverhaltens gibt, da es auch nicht die Theorie menschlichen Verhaltens gibt (Roth: 1998: 23). Im Wesentlichen haben sich in zeitlicher Reihenfolge drei einflussreiche Forschungstraditionen herausgebildet, die unterschiedliche Aspekte des Wahlverhaltens fokussieren: sozialstrukturelle, sozialpsychologische und ökonomische Ansätze. Diese schließen sich nicht zwangsweise gegenseitig aus, sondern lassen sich häufig gewinnbringend ergänzen. Eine umfassende Darlegung der Theorien würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Ein grober Abriss ist jedoch notwendig, da er das theoretische Fundament bildet, auf dem die empirischen Analysen aufbauen. Jedes der folgenden Kapitel ist in zwei Abschnitte gliedert. Zuerst wird der Begründer und das theoretische Konzept der jeweiligen Pionierstudie vorgestellt. Anschließend werden die spezifischen Stärken und Schwächen der Theorie unter Berücksichtigung etwaiger Anpassungen und Optimierungsvorschläge herausgearbeitet, um die empirische Bedeutung des Erklärungsansatzes für Deutschland zu prüfen. 2.1 Sozialstrukturelle Erklärungsansätze 2.1.1 Der mikrosoziologische Ansatz (Columbia School) Die mikrosoziologische Theorie zur Erklärung des Wahlverhaltens ist von einer Forschergruppe um den US-Soziologen Paul Lazarsfeld in den 1940er Jahren an der Columbia Universität (New York) entwickelt worden und wird deshalb auch als die „Columbia School“ bezeichnet. Eine Panelstudie (600 Befragte, 7 Panelwellen) zur USPräsidentschaftswahl 1940 im ländlichen Gebiet von Erie-County (Ohio) bildet die empirische Grundlage für die erste einflussreiche Publikation „The People’s Choice“ (vgl. Bürklin/Klein 1998: 54). Darin schreiben Lazarsfeld et al. (1968: 27) über die Bestimmungsfaktoren des Wahlverhaltens: „a person thinks, politically, as he is, socially. Social characteristics determine political preference“. Dieses Zitat steht für den Grundgedanken der Columbia School: Die sozialstrukturellen Merkmale eines Menschen 5 bestimmen indirekt über seine Zugehörigkeit zu sozialen Gruppen und politische Sozialisationseffekte die Wahlentscheidung. Die Forscher führen ihr Ergebnis auf den folgenden Wirkungszusammenhang zurück: Jeder Mensch lebt in verschiedenen sozialen Kontexten wie z.B. seiner Familie, seiner Arbeit, seiner Religionsgemeinschaft oder seiner Wohngegend. An all diesen Orten kommt er mit seinen Mitmenschen in Kontakt, interagiert mit ihnen und formt so seine politischen Einstellungen aus. Er durchläuft einen Prozess der politischen Sozialisation, bei dem sich auch seine Parteipräferenz herausbildet. Die politische Prädisposition des sozialen Umfeldes hat folglich entscheidenden Einfluss. Dieser ist umso größer, je enger und vertrauensvoller das Verhältnis der Interaktionspartner ist (Roth 1998: 25). Die Zusammensetzung einer sozialen Gruppe ist in der Regel sehr homogen und schichtspezifisch, da ein gewisser Konformitätsdruck herrscht. Die Mitglieder haben häufig ähnliche Bedürfnisse und vertreten entsprechende gesellschaftspolitische Positionen. Außerdem identifizieren sie sich mit ihrer Gruppe und versuchen Dissonanzen, sog. „Cross-pressure Situationen“, zu vermeiden. Die Orientierung an der Gruppenzugehörigkeit wird darauf zurückgeführt, dass Menschen bestrebt sind, Konflikte und Uneinigkeiten mit Personen des sozialen Umfeldes aus dem Weg zu gehen (Dahlem 2001: 205). „Das Endergebnis solcher Interaktionen zwischen den Gruppenmitgliedern ist also eine Verstärkung, ein gegenseitiges Bekräftigen gemeinsamer Einstellungen“ (Lazarsfeld et al. 1969: 26). Ein ähnlicher Mechanismus wirkt über verschiedene Gruppen hinweg. Je homogener und kongruenter die verschiedenen sozialen Gruppen sind, in denen eine Person lebt, desto stärker ist ihre Parteipräferenz ausgeprägt. Wird eine Person aufgrund einer sehr heterogenen Gruppenkonstellation mit starken politischen Gegensätzen („Crosspressures“) konfrontiert, entwickelt sie tendenziell nur eine schwache oder keine Parteibindung. Aufbauend auf diesen Beobachtungen haben Lazarsfeld et al. (1968: 65-72) drei Haupttypen von Wählern klassifiziert: Erstens die Stammwähler („Crystallizers“), die immer für die gleiche Partei stimmen, zweitens die schwankenden Wähler („Waverers“), deren Parteipräferenz sich im Verlauf der Untersuchung änderte, die aber letztlich doch bei ihrer ursprünglichen geblieben sind und drittens die Wechselwähler („Party changers“), die eine andere Partei gewählt haben, als anfangs angegeben. Die Columbia School betont besonders die Bedeutung der zwischenmenschlichen Kontakte für das politische Verhalten eines Individuums. Den sog. Meinungsführern („Opinion leaders“) innerhalb einer Gruppe wird viel Wirkungsmacht zugesprochen, 6 während die Massenmedien, Wahlkampfveranstaltungen, die Spitzenkandidaten oder politische Sachfragen nur eine untergeordnete Rolle spielen. Als die drei wichtigsten Bestimmungsfaktoren des Wahlverhaltens haben die Vertreter des mikrosoziologischen Ansatzes drei sozialstrukturelle Merkmale identifiziert: Der sozioökonomische Status, die Konfession und der Wohnort einer Person bilden zusammengefasst den Index der politischen Prädisposition („Index of political predisposition“). Dieser Index ist eine vorgelagerte, stabilisierende Einflussgröße, die immer dann auch zu entsprechenden Wahlentscheidungen führt, wenn das politische Interesse hoch und die Cross-pressures niedrig sind (Bürklin/Klein 1998: 55f). Die Forschungsarbeiten von Lazarsfeld et al. haben die Wahl- und Verhaltensforschung nicht nur durch ihre Ergebnisse entscheidend geprägt, sondern auch durch die Reaktionen, die sie hervorgerufen haben; seien es positive oder negative. Ein Hauptkritikpunkt am Erklärungsmodell der Columbia School lautet, dass es zu individualsoziologisch orientiert ist und nicht durch empirische Befunde belegt wird (vgl. Pappi 2001: 615). Es ist ein sehr statisches Modell, da eigentlich nur sozialer Wandel Änderungen im Wahlverhalten bewirken kann; politischer Problemdruck oder Spitzenkandidaten üben dagegen keinen Effekt aus. Darüber hinaus kann es zwar das Verhalten eines klassischen Stammwählers plausibel herleiten und begründen, für die Wahlentscheidung eines Wechselwählers in Cross-pressure Situationen bietet es dagegen keine Erklärung. Wechselwahl erscheint „eher als zielloses Fluktuieren denn als gezielte Wechselentscheidung“ (Schoen 2005: 144). Die mikrosoziologische Erklärung für wechselndes Wahlverhalten greift heute zu kurz, weil in der globalisierten und vernetzten Welt jeder Mensch Cross-pressures ausgesetzt ist. Zudem ist der mikrosoziologische Ansatz, ursprünglich für das präsidentielle System der USA entwickelt, nur bedingt auf Deutschland mit seinem parlamentarischen Mehrparteiensystem übertragbar. Trotz der kritischen Einschränkungen hat die Columbia School die Wahlforschung entscheidend vorangebracht. Lazarsfeld et al. haben mit ihrer Pionierarbeit die Determiniertheit der Wahlentscheidung durch die Mitgliedschaft in sozialen Gruppen nachgewiesen. „Dieses Argument besitzt ein beträchtliches Erklärungspotential […]. Jenseits seines Horizonts liegt jedoch die Frage, warum bestimmte Interaktionspartner bestimmte Parteipräferenzen aufweisen“ (Schoen 2005: 145). Hier setzt der makrosoziologische Ansatz an. 7 2.1.2 Der makrosoziologische Ansatz (Cleavage Theorie) Der makrosoziologische Ansatz zur Erklärung des Wahlverhaltens ist von Seymour M. Lipset und Stein Rokkan in den 1960er Jahren begründet worden. Während Lazarsfeld et al. ihre Studie auf das Zwei-Parteiensystem der USA ausgerichtet haben, geht es Lipset und Rokkan darum, das Wahlverhalten und die Entstehung der Parteiensysteme in Europa zu erklären. Ein wichtiges Ergebnis der Studie lautet: „The party systems of the 1960s reflect, with few but significant exceptions, the cleavage structure of the 1920’s“ (Lipset/Rokkan 1967: 50). Ausgehend von dieser Beobachtung entwickeln die Autoren das folgende Deutungsmuster: Aufgrund sozioökonomischer und kultureller Umwälzungen, verursacht z.B. durch die Reformation, die industrielle Revolution und die Herausbildung der modernen Nationalstaaten, sind in den europäischen Gesellschaften grundlegende Konflikte entstanden. Da sich diese Konfliktlinien oder „Cleavages“ im Parteiensystem widerspiegeln, sind sie für die Autoren die zentralen Erklärungsgrößen und haben den makrosoziologischen Ansatz auch als „Cleavage Theorie“ bekannt gemacht. Im Einzelnen bilden sich die politischen Interessengruppen und Parteien entlang dieser vier Cleavages: 1. Der Zentrum-Peripherie-Konflikt: Er entsteht, wenn es einen Interessenkonflikt zwischen der nationalen Mehrheit (dem Zentrum) und einer regionalen oder ethnischen Minderheit (der Peripherie) gibt. 2. Der Staat-Kirche-Konflikt: Dieser Konflikt wird in Deutschland auch als Kulturkampf bezeichnet, den der säkulare Staat bzw. seine Staatskirche mit der transnationalen katholischen Kirche um die Zuständigkeit bei Erziehungs- und Bildungsfragen oder um die moralische Deutungshoheit führt. 3. Der StadtLand-Konflikt: Aufgrund der fortschreitenden Urbanisierung und Industrialisierung entwickelt sich ein Interessengegensatz zwischen der Bevölkerung auf dem Land (Landadel, Bauern) und den Stadtbewohnern (Bürgertum, Kaufleute, Industriearbeiter) besonders bei Fragen der sozialen Sicherung und dem Freihandel. 4. Der KapitalArbeit-Konflikt: Bei diesem Klassenkonflikt im marxschen Sinne stehen sich die Fabrikbesitzer und die Arbeiterschaft gegenüber. Bei den ersten beiden Cleavages handelt es sich um kulturelle Wertkonflikte, die beiden letzten dagegen sind eher ökonomische Verteilungskonflikte. Grundsätzlich sind die kulturellen Cleavages deutlich schwerer zu überwinden, da es um ideologische Grundsatzfragen geht und sie nicht durch Kompromisse oder materiellen Ausgleich zu lösen sind: „especially […] religious cleavages are more important for political behaviour than class cleavages“ (Nieuwbeerta/de Graaf 1999: 48; vgl. auch Pappi 2002: 26f). 8 Je nachdem welche historische Konstellation in einem Land gegeben ist und welche Konfliktlinien „kulturell überformt“ werden („partisan alignment“), entwickelt sich ein anderes Parteiengefüge (vgl. Mielke 2001: 78). In einigen Ländern deckt eine Partei mehrere Cleavages ab, in anderen bilden sich spezielle Klientelparteien, die hauptsächlich einen bestimmten Konflikt thematisieren, wie z.B. Agrarparteien, Arbeiterparteien oder Regionalparteien. Die Ausgestaltung des Parteiensystems hängt laut Lipset und Rokkan davon ab, ob es den Parteien gelingt, die vier Schwellen „legitimation“, „incorporation“, „representation“ und „majority power“ zu überwinden. Die Mitglieder einer gesellschaftlichen Gruppierung wählen dann geschlossen „ihre“ Partei, weshalb sich eine Wahl idealtypisch als Zählappell der sozialen Großgruppen auffassen lässt (Schoen 2005: 147). Bei der Anwendung der Cleavage Theorie auf Deutschland zeichnet sich folgendes Bild ab: „Germany has inherited a twofold cleavage structure in voting patterns […]: a class cleavage and a religious cleavage“ (Müller 1999: 138). Eine entscheidende Rolle, weshalb es in Deutschland z.B. keinen ausgeprägten Zentrum-Peripherie-Konflikt gibt, spielt der traditionell föderale Aufbau des Landes, der die Konfrontationen der gegnerischen Lager abmildert. Die beiden in Deutschland vorhandenen Cleavages sind im deutschen Kaiserreich entstanden und haben seitdem einige Transformationen durchlaufen. Die religiöse Konfliktlinie z.B. verlief früher ausschließlich zwischen Katholiken und Protestanten. Heute kommt als eine neue Facette die Spaltungslinie zwischen religiösen Menschen und konfessionslosen hinzu. Diese Tatsache deutet schon auf einen allgemeinen Entwicklungstrend hin: Die beiden klassischen Cleavages in Deutschland verlieren an Prägekraft. Dies liegt vor allem daran, dass die relative Größe der die Konfliktlinie konstituierenden sozialen Gruppen abgenommen hat (Brettschneider et al. 2002: 12). Sowohl die Zahl der gläubigen Kirchgänger als auch die Zahl der Industriearbeiter ist im Verlauf der Nachkriegszeit zurückgegangen. „Die Ursachen dafür liegen zum einen im Wandel von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft sowie der sich damit verändernden Erwerbsstruktur […] und zum anderen im Nachlassen der Kirchenbindung“ (Brettschneider 1991: 109). Eine quantitative Abnahme muss jedoch nicht zwangsweise mit einer qualitativen Minderung der Cleavages einhergehen, da die verbliebenen Mitglieder sich radikalisieren können, wodurch die Konfliktlinie stärker betont wird. „Folglich kann man trotz des Bedeutungsrückgangs der klassischen sozioökonomischen Konfliktlinie nicht davon sprechen, 9 daß die politische Differenzierungskraft der sozioökonomischen Position generell erheblich nachgelassen habe“ (Schoen 2005: 172). Aufgrund der beschriebenen sozialen Verschiebungen hat es Versuche gegeben, neue Cleavages zu konstatieren bzw. die alten anzupassen. Die vermutlich prominenteste Neuerung hat Ronald Inglehart mit seiner These vom Wertewandel in Industriegesellschaften formuliert. Er postuliert die Entstehung eines neuen MaterialismusPostmaterialismus-Cleavages, das die alten Konflikte überlagert oder abschwächt: „The rise of postmaterialist issues […] tends to neutralize political polarization based on social class“ (Inglehart 1987: 1297). Postmaterielle Themen wie Umweltschutz oder Selbstverwirklichung bestimmen die politische Agenda und ziehen eine neue Trennlinie zwischen den Wählern, wodurch die affektive Bindung an Parteien, die die alten Cleavages verkörpern, abnimmt („partisan dealignment“). So erklärt Inglehart auch den Aufstieg und die Etablierung der „grünen“ Parteien in vielen Ländern Europas. Besonders einige Autoren im englischsprachigen Raum sehen durch Unterschiede bei Alter oder Geschlecht neue Cleavages entstehen. Geoffrey Evans (1999: 1) fasst diesen Forschungsstrang so zusammen: „Where it does survive, class politics has been redefined and reconstructed so that race, or gender, or `new politics` issues replace the economic conflicts derived from class-based divisions of interests.“ Für Deutschland wird ein neuer Zentrum-Peripherie-Konflikt zwischen der Mehrheitskultur Westdeutschlands und einer ostdeutschen Minderheit diskutiert. Eine andere Herangehensweise wählen die Vertreter des „Lebensstil-Modells“. Sie probieren der gesellschaftlichen Differenzierung durch die Etablierung neuer, immer wieder angepasster sozialer Großgruppen gerecht zu werden und damit das Wahlverhalten zu bestimmen (z.B. Gluchowski 1991). Dieser Ansatz ermöglicht allerdings eher eine genaue Beschreibung der Sozialstruktur als eine Erklärung des Wahlverhaltens, da die politische Prägekraft und die Integrationswirkung der Lebensstile sowie die Dauer der Zugehörigkeit gering sind. Der wohl fundierteste Versuch der „Enthistorisierung“ der Cleavages stammt von Gerd Mielke (2001: 80). Er löst die von Lipset und Rokkan formulierten Cleavages aus ihrem historischen Zusammenhang und generalisiert sie zu „allgemeinen Konfliktmustern der Moderne“ mit dem Ziel, „ein abstraktes, von den historischen Konstellationen abgelöstes Konfliktmodell“ zu schaffen (ebd.: 85). So wird z.B. der Konflikt zwischen Kapital und Arbeit zum Gegensatz Privilegierte vs. Nicht-Privilegierte aktualisiert und statt Land und Stadt stehen sich Traditionalismus und Modernisierung gegenüber. 10 Bei all diesen Versuchen neue Cleavages zu konstatieren, ist jedoch Vorsicht geboten. Mielke (2001: 89) weist zu Recht darauf hin, dass Lipset und Rokkan ihre Cleavage Theorie auf der Grundlage einer mehr als hundertjährigen Zeitspanne entwickeln konnten, während den verschiedenen aktuellen Versuchen nur wenige Jahre zu Grunde liegen. Die Gefahr besteht, dass „geringfügige sozio-kulturelle Oszillationen schon als epochale Zeitwenden gelten können“ (ebd.). Für Harald Schoen (2005: 150) ist es so auch „höchst fraglich“, dass aus den oben aufgezeigten Konflikten neue Cleavages nach der Typologie von Lipset und Rokkan entstehen, da eine stabile soziale Basis sowie ein organisatorischer Schulterschluss auf der Eliteebene fehle. Bei einer kritischen Prüfung der beiden sozialstrukturellen Erklärungsansätze, fällt vor allem auf, dass sie sehr statisch und konservativ sind. Einer ihrer großen Schwachpunkte besteht darin, „rasch wechselndes Wählerverhalten kaum erklären zu können“ (Schumann 2001: 97). Lipset und Rokkan gehen zwar davon aus, dass kurzfristige Einflüsse zu Änderungen im Wahlverhalten führen können, solche Änderungen werden aber durch die stabilisierenden Effekte der tradierten Cleavages sehr stark erschwert (Bürklin/Klein 1998: 20). Im mikrosoziologischen Modell wurde den Massenmedien anfangs nur eine indirekte Einflussnahme gefiltert durch die Meinungsführer zugestanden. Diese These ist jedoch in einer späteren Studie relativiert worden. Allerdings bleibt es eine Tatsache, dass kurzfristige Abweichungen im Wahlverhalten nur ungenügend erklärt werden können. Hinzu kommen die oben bereits angedeuteten Probleme durch die abnehmende Prägekraft sozialstruktureller Merkmale. Ulrich Beck (1983) begründet sie mit seiner „Individualisierungsthese“: In einer modernen Gesellschaft werden die traditionellen Schichtzugehörigkeiten durch die Massenmedien, die Tertiärisierung des Arbeitsmarktes, den Ausbau des Wohlfahrtsstaates und die Bildungsexpansion aufgeweicht. Es ergeben sich neue Handlungsoptionen für die Individuen, wodurch Klasseneffekte bis zu einem Punkt der „irrelevance of class structures“ minimiert werden (Müller 1999: 140). Andere Autoren sehen die Abnahme der sozialstrukturellen Prägekraft jedoch differenzierter und weniger dramatisch. Eine länderübergreifende Studie zu den „overall trends of class voting“ kommt zu dem Ergebnis, dass es einen unterschiedlich starken Rückgang des „class voting“ gibt (vgl. Nieuwbeetra/de Graaf 1999: 47). Die beiden Autoren diagnostizieren eine β-Konvergenz: In Staaten, wo das „class voting“ nach dem zweiten Weltkrieg besonders stark verbreitet war (Großbritannien, Skandinavien), hat es am stärksten abgenommen, während es in Staaten, wo es von Anfang an nur schwach war 11 (USA, Kanada), kaum eine Veränderung gab. Dieses Ergebnis wird in komplexeren Analysen einzelner Länderbeispiele jedoch nicht eindeutig bestätigt. Müller (1999: 177f), der deutlich validere Datensätze zur Verfügung hat, stellt in Deutschland für die Jahre 1976-1994 jedenfalls fest: „For West Germany, claims of a markedly reduced relevance of class position for party choice would appear to be rather misplaced. […] Instead, the data argue for a quite astonishing constancy“. Trotz berechtigter Kritik „dürfte die soziologische Analyse des Wählerverhaltens daher auch in Zukunft einen festen Platz in der empirischen Wahlforschung einnehmen“ (Schoen 2005: 183). An dem Schwachpunkt des makrosoziologischen Ansatzes, individuelles Wahlverhalten nicht ausreichend erklären zu können, setzt die sozialpsychologische Theorie an. 2.2 Der sozialpsychologische Ansatz (Ann Arbor-Modell) Der sozialpsychologische Ansatz wurde von Angus Campbell und seinen Mitarbeitern in Ann Arbor an der Universität von Michigan entwickelt, woher auch die Bezeichnung Ann Arbor- bzw. Michigan-Modell stammt. Die Erklärung der Wahlentscheidung wird hier von gruppenbezogen-soziologischen Faktoren zu individualpsychologischen Variablen verlagert (Bürklin/Klein 1998: 57). Nicht der tatsächliche, sondern der subjektiv wahrgenommene soziale Status und die politischen Einstellungen einer Person determinieren das Wahlverhalten. In ihrem Werk „The American Voter“ schreiben die Autoren: „In casting a vote the individual acts toward a world of politics in which he perceives the personalities, issues, and the parties“ (Campbell et al. 1960: 42). Das Ann ArborModell beruht demnach auf drei zentralen Einflussgrößen: 1. Parteiidentifikation („Party Identification“): Das Konzept der Parteiidentifikation beschreibt eine „langfristig stabile psychische Bindung einer Person an eine Partei“ (Gabriel 2001: 235). Die Zugehörigkeit muss nicht durch eine formale Mitgliedschaft besiegelt sein. Es herrscht vielmehr eine gefühlte Verbundenheit mit den Zielen und Werten der Partei. Diese entwickelt sich aufgrund von Sozialisationsprozessen und individuellen Erfahrungen. Die entscheidende Rolle spielen dabei nicht objektive Umweltfaktoren, sondern deren subjektive Wahrnehmung (Schumann 2001: 98). Die Parteiidentifikation ist folglich „a perfect distillation of all events in the individual’s life history that have borne upon the way in which he relates himself to a political party“ (Campbell et al. 1960: 34). Deshalb ist sie im Gegensatz zu den anderen Erklärungsfaktoren relativ stabil, bildet eher grundlegende Standpunkte ab und wirkt langfristig. Zu- 12 sätzlich erfüllt sie eine Filterfunktion bei der Wahrnehmung der politischen Wirklichkeit und der Bewertung politischer Objekte (Gabriel 2001: 241). Die Parteiidentifikation ist somit der wichtigste Bestimmungsfaktor im Michigan-Modell. 2. Themenorientierung („Issue perception“): Die Themenorientierung bezieht sich auf die Einstellungen einer Person zu einzelnen politischen Sachfragen, aktuellen Problemlagen und Politikinhalten (Policies) und ist idealtypischerweise unabhängig von den Kandidaten oder Parteien. Sie ist damit ein kurzfristiger Effekt, der sich von Wahl zu Wahl wandeln kann. Die Voraussetzung, dass die Issueorientierung bei einer Policy überhaupt eine Auswirkung auf die Wahlentscheidung hat, ist, dass „die Wähler eine bestimmte Streitfrage wahrnehmen (issue familiarity), als bedeutsam einschätzen (intensity of issue opinion) und mit den Positionen einer Partei in Verbindung bringen (issue position of parties)“ (Gabriel 2001: 236f; ausführlich Campbell et al. 1960: 168187). 3. Kandidatenorientierung („Candidates perception“): Bei der Kandidatenorientierung handelt es sich ebenfalls um einen kurzfristig wirksamen Faktor. Sie umfasst die Beurteilung der Kandidaten für ein politisches Amt hinsichtlich ihrer persönlichen Eigenschaften durch den Wähler. Dabei geht es um das körperliche Erscheinungsbild, die Ausstrahlung und die politischen Fähigkeiten des Politikers, aber auch um Attribute wie Ehrlichkeit und Vertrauenswürdigkeit. Die zunehmend personalisierte Berichterstattung in den Massenmedien rückt den Effekt der Kandidatenorientierung stärker in den Vordergrund. Das Zusammenspiel der Determinantentrias aus (langfristiger) Parteiidentifikation und (kurzfristiger) Themen- und Kandidatenorientierung verläuft nach der folgenden Logik: Je mehr die drei Einflussgrößen kongruent übereinander liegen, desto genauer und sicherer ist eine Wahlvorhersage möglich. Bei Widersprüchen zwischen den drei Komponenten liefert das Modell keine eindeutige Prognose, obwohl der Parteiidentifikation im Zweifelsfall am meisten Gewicht zugesprochen wird. Der Kritik am Vorgängerwerk von „The American Voter“ 2 , dass ein psychologischer Reduktionismus vorliege, da die Determinanten zu nahe am Explanadum lägen und somit eine Trivialität erklärt werde (vgl. Schoen/Weins 2005: 193), begegnen die Verfasser u.a. mit der Einführung des sog. Kausalitätstrichters („Funnel of causality“). Bei dieser Metapher befinden sich alle Bestimmungsfaktoren der Wahlentscheidung in ei- 2 „The Voter Decides“, Campbell et al. 1954. 13 nem Trichter. Weiter zurückliegende Einflussgrößen wie z.B. die Sozialisationsbedingungen oder der soziale Status liegen am äußern Rand des Trichters, während sich die politischen Einstellungen direkt in der Mündung sammeln. Jegliche Form der Einwirkung auf das Wahlverhalten kann ausschließlich durch die Trichtermündung passieren, weshalb alle anderen relevanten Faktoren nur mittelbar über die politischen Einstellungen wirken. Damit blenden die Autoren die Genese von wahlverhaltensrelevanten Faktoren nicht aus, machen sie allerdings auch nicht zum zentralen Gegenstand ihrer Untersuchung, sondern betonen die intervenierende Funktion der politischen Einstellungen (vgl. ebd.: 195). Da das Ann Arbor-Modell ursprünglich für die USA entwickelt wurde, gab es bei der Übertragung auf Deutschland einige Schwierigkeiten. So gab es methodische Probleme bei der Operationalisierung der Parteiidentifikation und die Bedeutung der Kandidatenorientierung wurde angesichts der Tatsache, dass man in Deutschland eigentlich primär Parteien wählt, kontrovers diskutiert. Empirische Analysen bestätigen jedoch die Relevanz des sozialpsychologischen Ansatzes (vgl. Gabriel 2001: 244). Bürklin und Klein (1998: 65) konstatieren sogar eine Dominanz des Ann Arbor-Modells in der deutschen Wahlforschung. Dies ist einerseits begründet: Das sozialpsychologische Modell kann sowohl stabiles (durch langfristige Parteiidentifikation) als auch wechselndes Wahlverhalten (durch kurzfristige Issue- und Kandidatenorientierung) gut erklären und ist darüber hinaus offen für Ergänzungen etwa durch die mikrosoziologische Theorie bei der Analyse von Sozialisationsprozessen oder den Rational Choice-Ansatz zur Untersuchung der Issueorientierung. Außerdem hat es sein Erklärungspotential in vielen verschiedenen politischen Systemen über lange Zeiträume immer wieder empirisch bewiesen. Andererseits gibt es auch berechtigte Kritik. Einige Autoren bemängeln eine unzulässige Verkürzung durch das Modell, da es nur individualpsychologische Faktoren berücksichtigt und die Effekte sozialer Strukturen und Kontexte sowie politischer Traditionen und Institutionen nicht in die Erklärung politischen Verhaltens mit einbezieht (Bürklin/Klein 1998: 73). Einige dieser Kritikpunkte sind von Anhängern des sozialpsychologischen Ansatzes durch Ergänzungen der klassischen Determinantentrias um kontextbezogene Faktoren abgeschwächt worden. Andere Probleme wie die Individualisierungstendenzen in der Gesellschaft schwächen dagegen nicht nur die Erklärungsleistung der sozialstrukturellen Ansätze, sondern auch die der wichtigsten Determinante „Parteiidentifikation“ im Ann Arbor-Modell (vgl. ebd.: 90). Außerdem kann das Mo14 dell, wie oben bereits angedeutet, keine eindeutigen Aussagen über das Stimmverhalten liefern, wenn nicht vollständige Einstellungskonsonanz bei Parteiidentifikation, Issueund Kandidatenorientierung herrscht; das relative Gewicht der verschiedenen Einflussfaktoren bleibt theoretisch unbestimmt (Rudi/Schoen 2005: 314). Des Weiteren ist kritisiert worden, dass die drei Komponenten des Modells nicht nur in eine Richtung wirken, sondern sich auch gegenseitig beeinflussen. So sei z.B. die Parteiidentifikation nicht vorgelagert und werde ebenfalls durch Kandidaten- und Issueorientierung verändert. Diese Kritiker fordern deshalb, „die Möglichkeit reziproker Effekte, also von Kausalzusammenhängen zwischen den drei Einstellungsgrößen und dem Wahlverhalten in jeweils beiden Richtungen, ausdrücklich vorzusehen und damit von einem rekursiven zu einem nicht-rekursiven Modell überzugehen“ (Schoen/Weins 2005: 201). Nicht zuletzt aufgrund dieser mangelnden theoretischen Klarheit des Ann Arbor-Ansatzes, der Gegenstand zahlreicher Dispute über die Interpretation und den Bedeutungsgehalt seiner Konzepte auslöste, verlagerte sich der wissenschaftliche Diskurs in den letzten Jahren zunehmend auf klare und sparsame Theorien wie z.B. Rational Choice (Bürklin/Klein 1998: 107). 2.3 Der ökonomische Ansatz (Rational Choice) Entwicklungen wie die Individualisierung und Differenzierung der Lebensformen sowie Wertewandel und Bildungsexpansion formen den gesellschaftlichen Wandel. Solche Veränderungen wirken sich auch auf die Politik und das Wahlverhalten aus. Die Prägekraft von langfristig stabilen sozioökonomischen Faktoren nimmt ab und die kurzfristiger Einflüsse zu. Die Anzahl der klassischen Stammwähler hat sich kontinuierlich verringert. Stattdessen gibt es zunehmend Wähler, die sich spontan überzeugen lassen und zwischen Parteien wechseln. Der Politikbetrieb scheint mehr und mehr einer Marktlogik zu folgen, bei der die Parteien auf der Angebotsseite politische Konzepte und Lösungsvorschläge präsentieren, aus denen der Bürger, einem Konsumenten ähnlich, auswählt und derjenigen Gruppierung seine Stimme gibt, die seinen Bedürfnissen und Vorstellungen am ehesten entspricht. Um die Funktionsweisen und Gesetzmäßigkeiten einer marktähnlichen Ordnung zu ergründen, liegt es nahe, auf etablierte Konzepte aus der Wirtschaftswissenschaft zurückzugreifen. Genau das hat Anthony Downs in seiner Pionierstudie „Ökonomische Theorie der Demokratie“ getan. In Anlehnung an die Kunstfigur des „homo oeconomicus“ 15 entwirft Downs eine Wahlverhaltenstheorie, in der die Akteure ihr Handeln an rationalen Kosten-Nutzen-Kalkülen ausrichten. Es gilt das Prinzip der konsequenten Nutzenmaximierung. Rationales Verhalten bedeutet, dass der Akteur probiert, sein Ziel „mit dem geringsten Aufwand an knappen Mitteln“ zu erreichen (Downs 1968: 4). Dabei ist es wichtig, zwei Dinge zu beachten: Erstens müssen niemals die Ziele selbst rational sein, sondern stets nur der Weg dorthin, also die Mittel, die der Handlungsträger anwendet, um sie zu verwirklichen (ebd.: 5). In Downs Modell ist demnach durchaus Platz für Altruismus, solange er effektiv verfolgt wird. Zweitens sind dem Akteur grundsätzlich seine Ziele und die Kosten, die ihre Erfüllung verursacht, bekannt. Er ist stets umfassend informiert und kann problemlos eine Reihenfolge seiner Präferenzen bilden. Die Entscheidung, welche Partei er wählen soll, basiert bei einem rationalen Akteur auf dem Parteiendifferential. Es dient zur Berechnung des individuellen Nutzeneinkommens einer Person durch jede mögliche Regierung. Die Partei, die in Regierungsverantwortung den höchsten Nutzen verspricht, wird gewählt. In einem Zweiparteiensystem hat es der Wähler einfach. Er bildet das Parteiendifferential, indem er den erwarteten Nutzen durch Partei B von dem durch Partei A subtrahiert. Ist das Ergebnis positiv, wählt er Partei A. Ist es negativ, entscheidet er sich für Partei B. Wenn es keinen Unterschied gibt, geht er nicht zur Wahl. Mehrparteiensysteme machen die Rechnung entsprechend komplizierter. Der Wähler muss jetzt z.B. mit einkalkulieren, ob eine Partei überhaupt eine reelle Chance hat, ins Parlament gewählt zu werden oder welche Koalitionen gebildet werden können. Allerdings relativiert Downs seine Axiome später selbst, um sie den realen Gegebenheiten anzupassen. Zum einen führt er den Faktor der Ungewissheit ein und geht damit nicht mehr vom umfassend informierten Wähler aus. Die Akteure entscheiden weiterhin rational, allerdings nur im Rahmen ihres (lückenhaften) Kenntnisstandes. Zur Senkung ihrer Informationskosten verlassen sie sich z.B. auf Ideologien (Downs 1968: 110) oder schätzen den zukünftigen Nutzen aufgrund des Verhaltens in der Vergangenheit. Zum anderen spricht Downs gewissen Zielen ihre Rationalität ab. „Die politische Funktion von Wahlen in einer Demokratie ist […] das Auswählen einer Regierung. Daher ist im Zusammenhang mit Wahlen ein Verhalten rational, das auf dieses Ziel und auf kein anderes ausgerichtet ist“ (ebd.: 7). Diese Einschränkung der Rationalität ist notwendig, da sonst ein tautologischer Fehlschluss begangen wird. Jede Handlung wäre rational, weil sie immer auf irgendein Ziel gerichtet ist und der Nutzen subjektiv immer die entstandenen Kosten überwiegt. Sonst hätte die Person nicht so gehandelt (vgl. ebd.: 6f). 16 Trotz dieser Einschränkungen hat Downs ein abstraktes Modell entwickelt, das bewusst sparsam mit potentiellen Erklärungsfaktoren umgeht und einige Diskrepanzen zur Realität in Kauf nimmt. Um in der Lage zu sein, allgemein gültige Prognosen über das Wählerverhalten zu machen, bedarf es seiner Meinung nach solcher bewussten und künstlichen Reduktion (Braun 1999: 62). Die Rational Choice-Theorie ist eine in der Ökonomik bewährte Verhaltenstheorie und nicht, wie andere Erklärungsansätze, bloß eine induktive Verallgemeinerung von empirischen Einzelbeobachtungen (Bürklin/ Klein 1998: 107). Sie bietet „den Vorteil der größeren Einfachheit und Klarheit. Ausgehend von wenigen zentralen Basisannahmen eröffnet sie die Möglichkeit einer empirisch gehaltvollen Beschreibung des Wählerverhaltens“ (ebd.). Aufgrund seines hohen Abstraktionsgrades lässt sich der Rational Choice-Ansatz problemlos auf andere politische Systeme übertragen. Er ist universell einsetzbar und braucht keinen institutionellen Kontext zur Entfaltung seines Erklärungspotentials. Besonderheiten beim deutschen Wahlverhalten, wie etwa taktisches Wählen durch das Aufteilen der Erst- und Zweitstimme auf verschiedene Parteien (Stimmensplitting) sowie Protest-, Wechsel- oder Nichtwahl kann er gut begründen. Damit füllt er einige weiße Flecken auf der Karte der Wahlforschung aus, die die anderen Theorien hinterlassen haben. Allerdings muss ebenfalls beachtet werden, dass der Rational Choice-Ansatz bisher nur spezifisch und nicht umfassend empirisch überprüft wurde und dass er stabiles Wahlverhalten bei veränderten Rahmenbedingungen nicht erklären kann. Darüber hinaus sieht sich der ökonomische Erklärungsansatz mit weiterer Kritik konfrontiert. Einige Kritiker akzeptieren zwar die Modellannahmen, formulieren aber theorieinterne Kritik. Andere dagegen widersprechen der These vom rationalen Wähler grundsätzlich. Die interne Modellkritik wurde von Downs selbst angestoßen. Er weist darauf hin, dass es bei der Adaption seiner Theorie auf ein Mehrparteiensystem zu einem rasanten Anstieg der Komplexität komme, da jeder Wähler seine Wahlentscheidung aufgrund der Möglichkeit von Koalitionsbildungen und anderen exogenen Faktoren, die nicht unter seiner Kontrolle stehen, vom Verhalten der anderen Wähler abhängig machen müsse. Dies führe zu einer konjekturalen Variation, die letztlich in einen infiniten Regress münde, der wiederum nur durch irrationales Verhalten durchbrochen werden könne. Die Tatsache, dass eine irrationale Entscheidung unausweichlich ist, schwächt die Theorie (vgl. Braun 1999: 66f). Das wohl gravierendste Problem des Rational Choice-Ansatzes ist jedoch das sog. „Wahlparadoxon“. Es beschreibt das Phänomen, dass bei der Stimmabgabe jede Menge 17 Kosten (Informations- und Opportunitätskosten) anfallen, während aus ihr praktisch kein Nutzen entsteht. In Massendemokratien ist die Chance für jeden einzelnen Wähler, dass gerade seine Stimme die Wahl entscheidet, unendlich klein (Arzheimer/Schmitt 2005: 261). Es gibt demnach für einen rationalen Akteur keinen Anreiz zu wählen. Diese Logik widerspricht jedoch der Realität in vielen Ländern, wo die Wahlbeteiligung hoch ist. Der Rational Choice-Ansatz gelangt bei der Erklärung, warum der Bürger überhaupt wählt, an seine Grenzen. Downs probiert das Wahlparadoxon mit einer Argumentation zu lösen, die über den Horizont seines Modells hinausgeht. Er begreift den Nutzen aus der Wahlteilnahme als einen langfristigen Partizipationswert, den alle Bürger wollen und durch ihre Stimmabgabe gewährleisten: die Demokratie selbst (vgl. Downs 1968: 264f). Dieser Gedankengang kann jedoch rationaltheoretisch nicht überzeugen, da die Demokratie ein klassisches Kollektivgut ist, von dem niemand ausgeschlossen werden kann. Ein rationales Verhalten der Bürger wäre „Free riding“: Der einzelne Akteur wählt selbst nicht, profitiert aber vom Kollektivgut, das ihm nicht entzogen werden kann. Damit nähert sich Downs seinen externen Kritiker an. Sie werfen ihm „ein sehr einseitiges Bild des Bürgers vor, der ausschließlich outputorieniert sei und danach seine Wahlentscheidung treffe. Tatsächlich sei aber das Wählen auch als expressiver Akt der freiwilligen Partizipation zu sehen […]. In diesem Fall würde das Wählen keine Kosten erzeugen, sondern nur einen intrinsischen Nutzen“ (Braun 1999: 76). Eine befriedigende Lösung des Wahlparadoxons, die nicht einer der zentralen Annahmen des Rational Choice widerspricht, ist noch nicht gefunden. 3 Abschließend kann festgehalten werden, dass es gerade die Vorteile des Rational Choice-Ansatzes wie seine Klarheit und die deduktive Strenge sind, die deutlicher als bei anderen Theorien erkennen lassen, wo seine spezifischen Schwächen liegen (Arzheimer/Schmitt 2005: 301). Dennoch gab Downs mit der Übertragung der zentralen Annahmen der Ökonomik auf die Politik den Startschuss für „ein Forschungsprogramm, das sich bis heute als außerordentlich fruchtbar erwiesen hat“ (ebd.: 250). 3 Einen Überblick der möglichen Auswege aus dem Wahlparadoxon geben z.B. Arzheimer/Schmitt 2005: 284-301, Braum 1999: 71-76 oder Bürklin/Klein 1998: 124-128. 18 3 Daten und Analysemethoden Bevor versucht wird, die theoretischen Erkenntnisse auf die Interpretation des Wahlverhaltens der Bremer Schüler anzuwenden, sollen zunächst der Datensatz und die Analysemethoden vorgestellt werden. Der erste Teil dieses Kapitels enthält einen knappen Überblick über die Herkunft der Daten. Die Stichprobenziehung, das Erhebungsverfahren und der Befragungskontext der durchgeführten Studie werden erläutert, um anschließend einen ersten Eindruck von der Struktur des Datensatzes durch die Darstellung einiger Häufigkeitsverteilungen zu vermitteln. Der zweite Teil des Kapitels ist ein Exkurs in die Statistik, in dem die Funktionsweise von zwei komplexeren statistischen Auswertungsinstrumenten vorgestellt wird. 3.1 Datenbasis Die empirische Datengrundlage dieser Arbeit bilden zwei Schülerbefragungen im Rahmen der Begleitforschung zur Juniorwahl 2007 in Bremen. 4 Bei der ersten Befragungswelle vor der Bürgerschaftswahl im Mai 2007 sind 218 Schülerinnen und Schüler 5 befragt worden, bei der Nachwahlbefragung waren es 205. Die teilnehmenden Schulen befinden sich in unterschiedlichen Stadtteilen Bremens. Die Befragung fand mittels eines Online-Fragebogens statt, den die Schüler an Schulcomputern ausgefüllt haben. Für etwaige Rückfragen war während der gesamten Befragung immer mindestens ein Mitglied aus der Forschungsgruppe anwesend. Es nahmen sowohl Schüler von berufsbildenden Schulen (ca. ein Drittel der Befragten) als auch von allgemeinbildenden Schulen (ca. zwei Drittel der Befragten) teil. Überwiegend wurden Schüler der Sekundarstufe II befragt, da möglichst viele der Umfrageteilnehmer auch bei der Bürgerschaftswahl wahlberechtigt sein sollten, was sich in der Altersstruktur der Befragten widerspiegelt. Etwas mehr als die Hälfte der Schüler war zum Erhebungszeitpunkt 18 Jahre oder älter. Die große Mehrheit der Respondenten (ca. 85 Prozent) strebte das Abitur oder Fachabitur an und ca. ein Zehntel einen Realschulab4 Eine ausführliche Beschreibung des Projekts, der Erhebungsmethode und der Begleitforschung zur Juniorwahl in Bremen findet sich im Abschlussbericht: „Eine Studie zur Wahlbereitschaft von Jugendlichen. Ergebnisse aus der Begleitforschung zur Juniorwahl 2007 in Bremen“ von Lothar Probst und Manuela Pötschke (im Erscheinen). 5 Im weiteren Verlauf der Arbeit umfasst der Begriff Schüler aus Gründen der besseren Lesbarkeit beide Geschlechter. 19 schluss. Beide Geschlechter waren ungefähr gleich stark bei der Befragung vertreten. Die große Mehrheit der teilnehmenden Schüler sind deutsche Staatsbürger (84 Prozent). Fast ein Zehntel hat die türkische Staatsbürgerschaft, die verbleibenden Prozente verteilen sich auf verschiedene Nationalitäten. Aufgrund von Bedingungen, die teilweise außerhalb des Einflussbereichs der Forschungsgruppe lagen, konnte die Stichprobenziehung leider nicht wie geplant als geschichtete Zufallsauswahl aus Schulen und Klassen durchgeführt werden. So bestand z.B. keine Möglichkeit, die Auswahl der Klassen zu beeinflussen. Die kontaktierten Lehrer entschieden selbstständig, welche ihrer Klassen teilnahmen. Die Konsequenz daraus ist, dass bei der Aussagekraft der empirischen Analysen Abstriche gemacht werden müssen. Die Stichprobe kann aufgrund des Erhebungsverfahrens nicht mehr als repräsentativ für die gesamte Bremer Schülerschaft gelten. Dennoch lassen sich Trends aus den empirischen Ergebnissen ablesen. 3.2 Statistische Analysemethoden 3.2.1 Faktorenanalyse 6 Die Faktorenanalyse ist ein statistisches Verfahren, das zwei Ebenen unterscheidet: Eine manifeste, messbare Ebene (die Indikatoren) und eine latente, nicht messbare Ebene (die Faktoren). Grafik 1 veranschaulicht das Grundprinzip der Faktorenanalyse: Die manifesten Variablen (X1-X5) Grafik 1 – Das Grundprinzip der Faktorenanalyse können aufgrund ihrer DatenFaktor 1 struktur zu latenten Konstruk- Faktor 2 ten (Faktoren 1 und 2) zusammengefasst werden. Faktor 1 bildet die drei Indikatoren X1X1 X2 X3 X4 X5 X3 und Faktor 2 die beiden Indikatoren X4 und X5 ab. Grundsätzlich muss man zwischen der konfirmatorischen und der explorativen Faktorenanalyse differenzieren. Während bei der konfirmatorischen Analyse die Anzahl der Faktoren durch ein theoretisches Konzept vorher festgelegt ist, wird sie bei der explora6 Die Ausführungen zur Faktorenanalyse wurden vom Autor im Abschlussbericht „Sicherheitswahrnehmung in der Stadt Bremen. Eine Sekundäranalyse von Umfragedaten der Bremer Polizei“ im Methodenpraktikum an der Universität Bremen (SS 2006 und WS 2006/07) in ihren Grundzügen dargestellt und für diese Arbeit spezifiziert und erweitert. 20 tiven durch die statistischen Zusammenhänge zwischen den Variablen ermittelt. Wie viele Faktoren extrahiert werden, bestimmt das Eigenwertkriterium. Der Eigenwert eines Faktors gibt über die Erklärungsleistung des Faktors hinsichtlich der Streuung aller Variablen Auskunft. Ist er größer als eins, besitzt der Faktor genug Erklärungskraft und wird berechnet, ist er kleiner, fällt der potentielle Faktor weg und wird in die folgenden Berechnungen nicht mit einbezogen. Entsprechend diesen unterschiedlichen Prämissen verfolgt man mit den beiden Formen der Faktorenanalyse auch zwei verschiedene Ziele: Bei der konfirmatorischen Faktorenanalyse geht es im Wesentlichen um die Bestätigung theoretisch hergeleiteter Strukturen, bei der explorativen Faktorenanalyse um die Entdeckung von Strukturen. Darüber hinaus ist bei der explorativen Faktorenanalyse eine weitere Differenzierung erfolgt. Man unterscheidet zwischen der Hauptkomponenten- und der Hauptachsenfaktorenanalyse. Das Unterscheidungskriterium hierbei sind die Anfangswerte der Kommunalitäten. Sie stehen für den Beitrag, den alle Faktoren zusammen zur Erklärung der Varianz in einem Indikator leisten. Bei der Hauptkomponentenanalyse werden die Kommunalitäten anfänglich auf eins festgesetzt, das heißt, man geht davon aus, dass alle Faktoren gemeinsam die Streuung in den Indikatoren vollständig (zu 100 Prozent) erklären können. Bei der Hauptachsenanalyse dagegen wird diese Annahme nicht getroffen. Man nimmt nur an, dass ein Teil der Streuung durch die Faktoren erklärt wird. Der Rest der Varianz (die Residualvarianz) soll nicht erklärt werden und geht in die weiteren Berechnungen nicht mit ein, weshalb die Startwerte der Kommunalitäten kleiner als eins sind (weniger als 100 Prozent). Trotz dieser begrifflichen Trennung ist die mathematische Methode zur Berechnung der Faktoren bei allen drei Analysevarianten gleich. Die Ausgangsbasis stellen immer Korrelationsmatrizen der beobachteten Variablen dar. Je nach Stärke des Zusammenhangs zwischen den Indikatoren lassen sich verschiedene Variablencluster bilden. Jedes Cluster wird als ein Faktor bezeichnet. Wie gut eine Variable durch einen Faktor repräsentiert wird, gibt die Faktorladung an. Sie variiert zwischen null und eins und beschreibt die Korrelation zwischen Faktor und Indikator. Je höher der Wert, desto besser bildet der Faktor die Variable ab. Ebenfalls wichtig ist, dass ein Faktor möglichst hoch nur auf eine Variable „lädt“, damit man ihm diese Variable eindeutig zuordnen kann. Schwierig wird die Interpretation dagegen, wenn eine Variable fast gleichmäßig durch zwei Faktoren verkörpert wird und eine klare Separation nicht möglich ist. 21 3.2.2 Regressionsanalyse Mit Hilfe von Regressionen ist es möglich, statistische Zusammenhänge zwischen Variablen zu beschreiben. Im Gegensatz zu Korrelationsanalysen handelt es sich um gerichtete Zusammenhänge. Man unterscheidet deshalb zwischen abhängigen und unabhängigen Variablen. Die unabhängige oder erklärende Variable übt einen Effekt auf die abhängige aus. Die grundsätzliche Funktionsweise einer Regressionsanalyse wird am besten anhand der linearen Einfachregression verdeutlicht. Sie ist das bekannteste Analysemodell für Individualdaten (Andreß et al. 1997: 262) und kann durch die folgende lineare Gleichung ausgedrückt werden: yi = a + bxi + ei Dabei steht yi für eine Ausprägung der abhängigen Variablen und xi für eine Ausprägung der unabhängigen Variablen. Die Regressionskoeffizienten, die den Zusammenhang zwischen den Variablen quantifizieren, sind a und b. Da die Koeffizienten in der Realität unbekannt sind, müssen sie auf der Basis von Stichprobendaten geschätzt werden. Natürlich können diese Schätzungen von den wahren Werten abweichen. Die Differenz zwischen dem wahren Wert und dem Schätzwert wird durch die Residualvariable ei abgebildet. Folglich hat das Modell zur Schätzung des Vorhersagewertes ŷi diese Form: yˆ i = a + bxi Die Regressionskonstante a legt das Niveau der Vorhersagewerte fest. Es ergibt sich, wenn die unabhängige Variable den Wert null hat. In Grafik 2 lässt sich der Wert der Konstanten am Schnittpunkt der Regressionsgeraden mit der y-Achse ablesen. Das Regressionsgewicht b beschreibt die Höhe des Einflusses von der unabhängigen Variable x auf die abhängige Variable y. Wenn sich x um eine Skaleneinheit ändert, verändert sich y um das Regressionsgewicht b. Grafik 2 – Graph einer linearen Regression X Grafik 3 – Graph einer logistischen Regression 1 1 0,75 0,75 0,5 0,5 0,25 0,25 X 0 -3 -2 -1 0 Y 1 2 3 0 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 Y 22 Schätzungen mit linearen Modellen stoßen bei abhängigen Variablen mit nominalem Skalenniveau jedoch schnell an ihre Grenzen. Besonders dichotome Variablen, die nur die zwei Ausprägungen null und eins haben, bereiten Probleme. Neben anderen statistisch-methodischen Vorbehalten (vgl. Andreß et al. 1997: 264) sind es vor allem drei Einwände, die gegen die Verwendung einer linearen Regression sprechen. Erstens wird eine Vorraussetzung für die Anwendung des üblichen Schätzverfahrens bei linearen Regressionen verletzt. 7 Zweitens kann es vorkommen, dass die Vorhersagewerte größer als eins bzw. kleiner als null sind und damit „außerhalb des möglichen Wertebereichs der abhängigen Variablen liegen“ (Kühnel/Krebs 2001: 606). Drittens ist das lineare Modell bei sehr hohen oder sehr niedrigen Schätzwerten besonders unplausibel. Sobald der Vorhersagewert sehr nahe an eins (oder null) heranreicht, gibt es kaum noch Spielraum, da die Regressionsgrade gleichmäßig ansteigt (oder fällt). Viel wahrscheinlicher ist jedoch eine sukzessive Annäherung an die Endpunkte des Wertebereichs. „Ein statistisches Modell, das eine solche nichtlineare Beziehung postuliert, ist das logistische Regressionsmodell“ (Andreß et al. 1997: 265). Die Grafiken 2 und 3 veranschaulichen die Nachteile des linearen Modells und die Vorzüge des logistischen noch einmal durch eine direkte Gegenüberstellung der beiden Kurvenverläufe. Gut zu erkennen ist, dass der Graph der linearen Regression den Wertebereich von null bis eins verlässt, während der Graph der logistischen Regression einem gestreckten „S“ ähnelt, das sich langsam an die eins bzw. die null anschmiegt, sie aber nie überschreitet. Bei dichotomen logistischen Regressionen werden keine Mittelwerte geschätzt, sondern Anteilswerte, die der Wahrscheinlichkeit entsprechen, die Ausprägung eins zu haben. Die Schätzungen von logistischen Regressionsmodellen beruhen auf der „MLMethode“ (Maximum-Likelihood-Methode). Die Regressionskoeffizienten werden dabei so bestimmt, dass „durch ihre Wahl die Wahrscheinlichkeit der tatsächlich beobachteten Stichprobenwerte verglichen mit allen anderen möglichen Parameterwerten maximal ist“ (ebd.: 267). Aufgrund der logistischen Beziehung zwischen den Variablen müssen die Regressionskoeffizienten auch anders interpretiert werden. Bei der Regressionskonstanten a ändert sich allerdings nicht viel. Sie beeinflusst wie bei der linearen Regression das Niveau des 7 Lineare Regressionsmodelle werden nach der OLS-Methode („ordinary least squares“) geschätzt. Bei dieser „Methode der kleinsten Quadrate“ werden die Regressionskoeffizienten bestimmt, indem die Summe der quadrierten Abweichungen der Schätzwerte von den in der Stichprobe beobachteten Werten minimal sein muss. Eine Bedingung für die Anwendung der OLS-Methode ist die Normalverteilung der Residuen, die bei dichotomen abhängigen Variablen verletzt wird (vgl. O’Connell 2006: 13). 23 Anteilswertes. Anders verhält es sich mit dem Regressionsgewicht b. Es gibt zwar ebenfalls genau wie beim linearen Modell durch sein Vorzeichen die Richtung der Beziehung zwischen den Variablen an, der Effekt des Regressionsgewichts wirkt jedoch anders. Je nachdem, wie man die Gleichung der logistischen Regression auflöst, ergeben sich drei mögliche Effekte. „Effects exist for probabilities, odds, and logged odds, and the interpretations of each effect have both advantages and disadvantages“ (Pampel 2000: 18). „Most researchers who use logistic regression rely on the concept of odds to impose theoretical meaning on the results of the analysis” (Jaccard 2001: 3). Die „Odds“ ergeben sich aus dem Quotienten aus der Wahrscheinlichkeit, dass ein Ereignis eintrifft (π1), und seiner Gegenwahrscheinlichkeit (1- π1). Sie bilden also das Chancenverhältnis zwischen zwei Wahrscheinlichkeiten ab: π1 1 − π1 = e a + bx = e a ⋅ ebx (Odds) Der Term, der das Regressionsgewicht enthält (ebx), übt einen multiplikativen Effekt aus, das heißt das Chancenverhältnis wird mit diesem Faktor multipliziert, wenn sich die unabhängige Variable um eine Skaleneinheit ändert. Der Wert eins bedeutet dementsprechend, dass kein Effekt vorliegt, da sich das Chancenverhältnis multipliziert mit eins nicht verändert. Werte zwischen null und eins bewirken einen negativen Effekt, weil sie die Odds verringern und Werte größer als eins bewirken einen positiven Effekt. Sie erhöhen die Odds. Eine andere Möglichkeit der Interpretation stellt das „Logit“ dar. Mit dem Logit wird das logarithmierte Chancenverhältnis der Wahrscheinlichkeiten vorausgesagt: ⎛ π ⎞ ln⎜⎜ 1 ⎟⎟ = a + bx ⎝ 1 − π1 ⎠ (Logit) Der Vorteil einer Interpretation des Logits ist, dass die Koeffizienten wie bei der linearen Regression einen linearen und additiven Effekt ausüben. Allerdings ist die Skaleneinheit der Variablen „counterintuitive and difficult to interpret“ (Jaccard 2001: 10). Ähnliche Schwierigkeiten treten bei der dritten Interpretationsvariante auf. Es wird die Wahrscheinlichkeit, den Wert eins zu haben, berechnet. Das Problem besteht hier darin, dass die Effektstärke der unabhängigen Variablen variiert und sich nicht durch einen einzigen Koeffizienten ausdrücken lässt. π1 = e a + bx 1 + e a + bx (Wahrscheinlichkeit) 24 4 Empirische Analyse und Ergebnisse Nachdem das theoretische und methodische Fundament mit den Kapiteln 2 und 3 gelegt worden ist, können darauf aufbauend in diesem Kapitel die empirischen Ergebnisse vorgestellt werden. Die zentrale Forschungsfrage dieser Arbeit, welche Bestimmungsfaktoren sich für das Wahlverhalten von Bremer Schülern bei der Bürgerschaftswahl 2007 identifizieren lassen, soll in drei Etappen ergründet werden. Im Detail wird untersucht, wie und welche Determinanten 1. die Parteipräferenz, 2. der Positionierung auf einer Links-rechts-Skala und 3. die Absicht zur Wahlteilnahme beeinflussen. 4.1 Parteipräferenz 4.1.1 Deskriptive Darstellung der Bestimmungsfaktoren Zur Erfassung der Determinanten der Parteipräferenz haben die Befragten verschiedene politische Funktionen und Verhaltensweisen beurteilt. Anschließend wurde eine explorative Faktorenanalyse berechnet, um aufgrund der Datenstruktur übergeordnete Einstellungsdimensionen zu identifizieren. Grafik 4 gibt eine Übersicht der Ergebnisse. Grafik 4 – Ergebnis der Faktorenanalyse: Fünf latente Einstellungsdimensionen: Verantwortungsbewusstsein Sicherheit 0,786 Aufrechterhaltung von Gesetz und Ordnung 0,693 Wirtschaftswachstum 0,731 Schaffung von Arbeitsplätzen Nationalverständnis -0,750 Integration von Ausländern Legende: 0,728 0,814 Schutz der Bürger vor Verbrechen Gleichheit 0,817 0,637 Stolz sein auf die deutsche Geschichte latenter Faktor Ausgleich zwischen Arm und Reich 0,793 Konträre Meinungen anerkennen Faktorladung Sich politisch engagieren 0,800 Sich umweltbewusst verhalten Selbstverständnis 0,570 Sich und seine Interessen durchsetzen 0,893 Leben nach religiösen Normen und Werten manifester Indikator 25 Wie Grafik 4 zeigt, bilden zwölf manifeste Indikatoren die Grundlage der Faktorenanalyse. 8 Sie lassen sich aufgrund von statistischen Korrelationen zu fünf latenten Konstrukten bündeln. Der erste Faktor kann als die übergeordnete Einstellungsdimension „Sicherheit“ aufgefasst werden. Er lädt auf vier Variablen, die alle entweder für das Verlangen nach ökonomischer (Wirtschaftswachstum, Schaffung von Arbeitsplätzen) oder innerer Sicherheit (Schutz vor Verbrechen, Aufrechterhaltung von Gesetz und Ordnung) stehen. Angesichts der thematischen Nähe dieses Faktors zu Politikfeldern, die traditionell mit der CDU in Verbindung gebracht werden, ist von ihm ein positiver Effekt in Richtung einer Parteipräferenz für die CDU zu erwarten (vgl. Statistisches Landesamt Bremen 2007a: 11). Der zweite Faktor „Verantwortungsbewusstsein“ fasst politisches Engagement und umweltbewusstes Verhalten zusammen. Die Betonung dieser Einstellungen deutet einen positiven Effekt in Richtung einer Parteipräferenz für Die Grünen an. Den dritten Faktor kann man als „Nationalverständnis“ begreifen. Er bildet zwei Indikatoren ab, die das Deutschlandbild der Befragten betreffen. Die Schüler, die die Integration von Ausländern in Deutschland für unwichtig erachten, legen besonderen Wert darauf, stolz auf die deutsche Geschichte zu sein. Die Vermutung liegt nahe, dass der dritte Faktor vor allem auf eine Parteipräferenz für Die Linke oder Die Grünen negativ wirken dürfte. Der vierte Faktor „Gleichheit“ hebt die Bedeutung des Ausgleichs der Unterschiede zwischen Arm und Reich und der Toleranz gegenüber andersartigen Meinungen hervor, was wiederum auf einen positiven Effekt in Richtung SPD oder Die Linke hindeutet. Mit dem fünften Faktor „Selbstverständnis“ werden zwei Lebensentwürfe zusammengefasst. Die Befragten, die ihr Leben nach religiösen Normen und Werten ausrichten wollen, halten es auch für wichtig, sich und ihre Interessen durchzusetzen. Wenn Religion als christlich-katholischer Glaube verstanden wird, sollte dieser Faktor einen positiven Effekt auf die Parteipräferenz für die CDU haben, da sie am stärksten im katholischen Christentum verwurzelt ist (vgl. Forschungsgruppe Wahlen 2007: 46). Die fünf Faktoren, die mit einem Eigenwert größer als eins isoliert worden sind, können zusammen 63,6 Prozent der Gesamtvarianz erklären. Vorteilhaft ist, dass fast alle Faktoren sehr trennscharf auf die Indikatoren laden. Lediglich die Variable „Sich und seine Interessen durchsetzen“ streut ein wenig über drei Faktoren hinweg. 8 Es wurde eine Hauptkomponentenanalyse mit der Software SPSS berechnet. Dargestellt sind die Ergebnisse der Lösung mit Varimax-Rotation mit Kaiser-Normalisierung. 26 Zusätzlich zu den Effekten der fünf Faktoren auf die Parteipräferenz, ist der Einfluss des materiellen Wohlstands der Befragten berücksichtigt worden. Der ökonomische Status wird z.B. in den sozialstrukturellen Theorien zumindest als (indirekte) Determinante der Parteipräferenz verstanden. Da die wenigsten Schüler ein eigenes Gehalt beziehen dürften, wurde das Taschengeld als ihr Einkommen aufgefasst. Jeweils ca. ein Drittel der Schüler bekommt bis zu 50 EUR, zwischen 50 und 100 EUR oder mehr als 100 EUR Taschengeld pro Monat. Welchen Effekt die Höhe des Taschengeldes auf die Parteipräferenz hat, lässt sich aufgrund fehlender Erfahrungswerte schwer abschätzen. 4.1.2 Regressionsanalysen und empirische Befunde Etwas mehr als die Hälfte der Befragten gab an, eine längerfristige Parteipräferenz zu haben. Von denjenigen Schülern, die sich mit einer Partei identifizierten, bewerteten deutlich mehr als die Hälfte ihre Parteineigung als „sehr stark“ oder „eher stark“, während nur ein verschwindend geringer Anteil der Schüler (3,6 Prozent) sie als „eher schwach“ oder „sehr schwach“ einschätzt. Diese Zahlen lassen darauf schließen, dass es entgegen allen Thesen, die eine Deutungshoheit kurzfristiger Faktoren zur Erklärung des Wahlverhaltens postulieren, auch unter jungen Menschen ein beachtliches Potential an Stammwählern gibt. Eine detaillierte Aufschlüsselung der Verteilung der Parteipräferenzen liefert Tabelle 1. Tabelle 1 – Verteilung der Parteipräferenzen Parteipräferenz Anteil in Prozent Anteil in absoluten Zahlen SPD 54,2 45 CDU 13,3 11 Die Grünen 13,3 11 Die Linke 12,0 10 NPD 4,8 4 FDP 1,2 1 Republikaner 1,2 1 Datenbasis: n = 83 Dass das sozialpsychologische Konzept der langfristigen Parteiidentifikation immer noch große Erklärungskraft für die Wahlentscheidung entfaltet, zeigt ein Vergleich mit der Wahlstatistik des Statistischen Landesamtes Bremen. Die Anteilswerte der Parteien spiegeln sich zumindest in der Tendenz auch im amtlichen Endergebnis der Wahl zur Bremischen Bürgerschaft wider. Die SPD, der die Mehrheit der Schüler zuneigt, erhält auch von allen Wählern klar die meisten Stimmen (36,74 Prozent). Während die CDU 27 (25,66 Prozent), Die Grünen (16,49 Prozent) und die FDP (5,98 Prozent) ein höheres Wahlergebnis erzielen als ihr Anteil bei der Parteiidentifikation der Schüler vermuten lässt, ist der Stimmenanteil der Linken (8,44 Prozent) bei der Bürgerschaftswahl niedriger als die Neigung der Schüler zu dieser Partei (vgl. Statistisches Landesamt Bremen 2007b). Ein ähnliches Bild zeichnet sich ab, wenn man nur die Verteilung der Stimmen junger Wahlberechtigter (18-29 Jahre alt) bei der Bürgerschaftswahl betrachtet. Lediglich die Differenz der Anteilswerte der CDU wird geringer (vgl. Forschungsgruppe Wahlen 2007: 40). Bei der Parteiidentifikation der Schüler gibt es im Vergleich zum Wahlergebnis demnach einen Überhang am linken Ende des Parteienspektrums. Aus der mikrosoziologischen Perspektive ist vor allem interessant, welchen Einfluss das enge soziale Umfeld auf das Wahlverhalten der Schüler ausübt. Angesichts des niedrigen Alters der Befragten kann davon ausgegangen werden, dass besonders die Eltern die politische Sozialisation der Schüler geprägt haben. Deshalb wurde erfragt, ob die Jungwähler ihre Stimme konform zur Parteipräferenz ihrer Eltern abgaben. Bei diesem Aspekt halten sich konträres und übereinstimmendes Verhalten die Waage. Etwas mehr als die Hälfte der Befragten hat bei der Bürgerschaftswahl dieselbe Partei wie die Mutter gewählt. Die gleiche Wahlentscheidung wie der Vater fällten dagegen etwas weniger als die Hälfte der Schüler. Nur ca. ein Drittel der Schüler stimmt der Aussage: „Meine Eltern geben mir in politischen Fragen Orientierung“ eher oder voll und ganz zu. Diese Ergebnisse schwächen die empirische Überzeugungskraft des mikrosoziologischen Ansatzes und stützen die These von einer Abnahme der Prägekraft des sozialen Umfeldes auf das Wahlverhalten. Der Trend wird durch die folgenden Resultate untermauert. Auf die Frage, welche Faktoren ihre Wahlentscheidung beeinflusst haben, nannten die meisten Befragten 1. Medien, gefolgt von 2. Eltern, 3. Schule, 4. Wahlwerbung und schließlich 5. Freunde. Zur Überprüfung, ob die in Kapitel 4.1.1 formulierten Wirkungszusammenhänge zutreffend sind, wurde eine binäre logistische Regression berechnet. Die dichotome abhängige Variable war jeweils „Identifikation mit einer Partei: ja/nein“. Alle sechs Determinanten sind als erklärende Variablen in ein Regressionsmodell aufgenommen worden. Dieses multivariate Vorgehen hat im Gegensatz zu einer bivariaten Betrachtung den großen Vorteil, dass man durch die Kontrolle von Drittvariablen konfundierte Effekte vermeiden kann und die Einflussstärke der jeweiligen unabhängigen Variable somit nicht überschätzt wird. 28 In Tabelle 2 sind die exponentiellen Regressionskoeffizienten zusammengetragen. 9 Tabelle 2 – Koeffizienten der logistischen Regression (Exp(B)) auf die Parteipräferenz Erklärende Variablen F1: Sicherheit F2: Verantwortungsbewusstsein F3: Nationalverständnis F4: Gleichheit F5: Selbstverständnis Taschengeld Konstante Nagelkerkes-R² SPD CDU Die Grünen Die Linke Exp(B) Exp(B) Exp(B) Exp(B) [Standardfehler] [Standardfehler] [Standardfehler] [Standardfehler] 1,416 0,976 1,008 0,376 [0,256] [0,332] [0,465] [0,533] 0,369 1,587 1,871 5,932 [0,339] [0,387] [0,504] [0,803] 0,740 2,139 0,593 0,331 [0,290] [0,337] [0,440] [0,616] 0,653 1,104 2,641 3,999 [0,330] [0,404] [0,516] [0,739] 2,215 0,653 0,624 0,639 [0,293] [0,369] [0,417] [0,532] 1,654 1,137 0,670 0,478 [0,211] [0,244] [0,299] [0,417] 0,301 0,078 0,248 0,153 [0,745] [0,982] [0,992] [1,269] 0,410 0,188 0,256 0,477 Datenbasis: n = 75 Tabelle 2 ist zu entnehmen, dass der Faktor „Sicherheit“ das Chancenverhältnis zu Gunsten einer Parteipräferenz für die SPD und zu Ungunsten einer Präferenz für Die Linke verschiebt. Auf die Identifikationswerte von den Grünen und der CDU hat er praktisch keine Auswirkungen. Für Die Linke war ein solcher Effekt zu erwarten, denn ökonomische und innere Sicherheit sind normalerweise nicht die bedeutsamsten politischen Anliegen ihrer Wähler. Auffallend ist dagegen das Ergebnis für die SPD. Wie oben beschrieben, werden die Politikfelder Wirtschafts- und Innenpolitik in Deutschland traditionellerweise zuerst mit der CDU und nicht mit der SPD assoziiert. Das sehen die Bremer Schüler offensichtlich anders. Damit stehen sie unter Bremens Bürgern allerdings nicht alleine da. Zumindest was die Wirtschaftskompetenz betrifft, liegt die SPD vor der CDU (vgl. Forschungsgruppe Wahlen 2007: 33). Dass der SPD auch in der Wirtschaftspolitik die wichtigste Rolle zugesprochen wird, liegt nicht zuletzt an ihrer hegemonialen Stellung im Bremer Parteiensystem. Sie hat alle Wahlen der Nachkriegszeit klar dominiert und kann, wenn man Mielkes Typologie 9 Aufgrund der teilweise sehr geringen Fallzahlen konnten die Analysen nur für die vier Parteien SPD, CDU, Die Grünen und Die Linke durchgeführt werden. 29 vom „neuen Regionalismus“ folgt, als eine „Staatspartei“ verstanden werden, die im Laufe der Jahrzehnte auch solche Wählergruppen auf sich ziehen konnte, die ihr ansonsten im Blick auf ihre traditionellen, sozialstrukturell im Cleavage-Modell definierten Bindungen eher mit Distanz gegenüberstehen (Mielke 2001: 84). Da in Bremen an der „Staatspartei“ SPD kein Weg vorbeiführt, haben sich auch traditionell eher FDP- und CDU-nahe Akteure, wie Wirtschaftsunternehmen oder Kaufleute, mit ihr arrangiert. Außerdem muss der urban-hanseatische Kontext beachtet werden. Der Anteil der Katholiken, eine typische CDU-Klientel, ist z.B. deutlich geringer als im deutschlandweiten Durchschnitt. Darüber hinaus sei nochmals auf die geringe Fallzahl und Modellgüte (Nagelkerkes-R² = 0,188) bei der Regression für die CDU verwiesen. Die hier präsentierten Ergebnisse deuten Entwicklungstrends an, sie können nicht als repräsentativ für alle Bremer Schüler gelten. Der Effekt der zweiten Determinante „Verantwortungsbewusstsein“ weist in die postulierte Richtung. Er vergrößert die Wahrscheinlichkeit, dass man sich mit den Grünen identifiziert fast um den Faktor zwei. Allerdings erhöht eine Kombination aus politischem Engagement und umweltbewusstem Verhalten die Neigung zur Partei Die Linke sogar beinahe um den Faktor sechs. Die Wahrscheinlichkeit der SPD nahezustehen, wird dagegen deutlich vermindert. Augenscheinlich rekrutiert sich der sozialdemokratische Wählerkreis aus einem breiten und heterogenen Spektrum der Gesellschaft. Auf die SPD entfallen bei der Angabe der Parteipräferenz mehr Nennungen als auf alle anderen Parteien zusammen. In einer derartig diversifizierten Großgruppe, die annähernd einem Querschnitt durch Bremens Bevölkerung gleichkommt, ist die Bereitschaft, sich politisch zu engagieren und umweltbewusst zu verhalten, nicht so deutlich vorhanden, dass sie hier einen positiven Ausschlag bewirken könnte. Der Großteil der SPDAnhängerschaft schätzt sie sogar als unwichtig ein. Die dritte Einflussgröße „Nationalverständnis“ verändert die Odds ebenfalls wie theoretisch vermutet. Schüler, die die Integration von Ausländern für unwichtig erachten und gleichzeitig stolz auf die deutsche Geschichte sind, neigen fast allen Parteien weniger zu. Die einzige Ausnahme bildet die CDU. Hier wird das Chancenverhältnis um mehr als das zweifache positiv verändert. In die gleiche Richtung wie der Faktor „Verantwortungsbewusstsein“ deutet auch der Faktor „Gleichheit“. Wer die Wichtigkeit des Ausgleichs der Unterschiede zwischen Arm und Reich betont und Toleranz gegenüber Meinungen einfordert, denen er selbst nicht zustimmt, identifiziert sich stärker mit den Par- 30 teien Die Grünen und Die Linke. Bei der CDU kommt es praktisch zu keiner Veränderung, während die Wahrscheinlichkeit, SPD-Anhänger zu sein, sinkt. Die fünfte Einstellungsdimension, die die Wichtigkeit eines Lebens nach religiösen Werten und die Durchsetzung eigener Interessen betont, erhöht die Chance der Identifikation mit der SPD und vermindert sie für die CDU, Die Grünen und Die Linke. Dieses Ergebnis verwundert nur hinsichtlich des positiven Effekts auf die SPD und des negativen auf die CDU. Im Allgemeinen besteht eine gewisse Distanz zwischen der Sozialdemokratie und den Positionen religiöser Institutionen, während die CDU traditionell eine engere Bindung zur Religion hat. Auch hier gibt es, zumindest was die evangelische Kirche betrifft, eine Bremer Besonderheit. Denn unter den Protestanten, die quantitativ die weitaus größte Wählergruppe stellen, hat die SPD einen deutlich höheren Stimmenanteil als unter allen Wählern (vgl. Forschungsgruppe Wahlen 2007: 46). Insofern ist das Ergebnis durchaus plausibel, wenn man Religiosität vor allem als Mitgliedschaft in der evangelischen Kirche versteht. Je größer die finanziellen Mittel sind, die den Schülern zur Verfügung stehen, desto eher neigen sie der SPD und desto weniger den Grünen und der Linken zu. Bei der CDU hat das Taschengeld fast keinen Effekt. Ein derartiger Wirkungszusammenhang erscheint recht logisch. Wie oben bereits erläutert, kann die SPD in Bremen als „Staatspartei“, die alle Bevölkerungsgruppen wählen, betrachtet werden und nicht als klassische Arbeiterpartei im Sinne der Cleavage-Theorie. Dass die Wirkung der finanziellen Ausstattung auf die Neigung zur CDU nicht deutlicher ausfällt, liegt vermutlich vor allem an der geringen Fallzahl. 4.2 Positionierung auf der Links-rechts-Skala „Traditionellerweise wird in Deutschland anhand der Begrifflichkeiten ,links’ und ,rechts’ sowohl eine politische Standortbestimmung als auch eine Form von weltanschaulicher Positionierung vorgenommen“ (Schneekloth 2006: 108). Die Befragten sollten sich auf einer siebenstufigen „Links-rechts-Skala“ verorten, wobei „links“ das untere Ende der Skala bildet und „rechts“ das obere. Die Verteilung in dieser Stichprobe weicht dabei praktisch nicht von denen in den Shell Jugendstudien 2002 und 2006 ab (vgl. ebd. und Schneekloth 2002: 95). Mehr als zwei Fünftel der Schüler stufen sich links von der Mitte ein, wo sich etwas weniger als zwei Fünftel positionieren. Das verbleibende Fünftel befindet sich rechts 31 von der Mitte. Ein Mittelwert von 3,5 bringt gut zum Ausdruck, dass der Großteil der Schüler seine politische Orientierung als „Mitte-links“ einschätzt. Betrachtet man die Links-rechts-Skala differenziert nach Geschlecht, verschieben sich die Koordinaten leicht. Die weiblichen Befragten tendieren eher noch weiter nach links, während die männlichen überdurchschnittlich häufig die Mitte und das rechte Ende der Skala wählen. Als Bestimmungsfaktoren für die Links-rechts-Positionierung wurde das gleiche Bündel an erklärenden Variablen wie bei der Parteipräferenz herangezogen. Zur Ermittlung der Effektrichtung und –stärke wurde ein lineares Regressionsmodell geschätzt. Tabelle 3 zeigt die Regressionskoeffizienten für alle Schüler sowie jeweils nur für die weiblichen und die männlichen Befragten. Das Determinanten-Sextett, gebildet aus den fünf Einstellungsdimensionen und dem Taschengeld, kann zwischen einem Viertel (bei allen Befragten) und etwas mehr als einem Drittel (bei den männlichen Befragten) der Varianz der Links-rechts-Skala erklären. Tabelle 3 – Koeffizienten der linearen Regression (B) auf die Links-rechts-Einschätzung Erklärende Variablen Alle Befragten Weibliche Befragte Männliche Befragte B B B [Standardfehler] [Standardfehler] [Standardfehler] -0,034 -0,650 0,286 [0,148] [0,235] [0,197] 0,070 -0,115 0,316 [0,157] [0,186] [0,260] 0,474 0,355 0,320 [0,158] [0,251] [0,240] -0,553 -0,440 -0,539 [0,165] [0,221] [0,243] -0,205 -0,026 -0,420 [0,155] [0,177] [0,311] 0,071 0,281 -0,095 [0,113] [0,148] [0,170] 3,055 2,294 3,869 [0,398] [0,500] [0,672] R² 0,242 0,304 0,346 Datenbasis: n = 91 n = 53 n = 37 F1: Sicherheit F2: Verantwortungsbewusstsein F3: Nationalverständnis F4: Gleichheit F5: Selbstverständnis Taschengeld Konstante Aus Tabelle 3 wird deutlich, dass besonders die beiden latenten Konstrukte „Nationalverständnis“ und „Gleichheit“ dazu beitragen, die Position auf der Links-rechts-Skala zu verschieben; und zwar genau in entgegengesetzte Richtungen. Der Faktor „National32 verständnis“ bewirkt durchgehend, egal bei welchem Geschlecht und bei allen Befragten zusammen, einen positiven Effekt: Je größer der Stolz auf die deutsche Geschichte bei den Befragten ist und für je unwichtiger sie die Integration von Ausländern erachten, desto weiter rechts verorten sie sich. Dieses Ergebnis entspricht dem allgemeinen Verständnis von „rechts“ und „links“ und beweist, dass die Links-rechts-Skala für diese Einstellungsdimension ein adäquates Messinstrument darstellt. Ein ebenso eindeutiges Resultat liefert der Faktor „Gleichheit“. Er beeinflusst die Links-rechts-Positionierung negativ, was in diesem Fall bedeutet, dass er sie für alle Schüler und beide Geschlechter nach „links“ verschiebt. Auch dieser Effekt erscheint logisch. Je mehr man für materielle Umverteilung und Toleranz gegenüber andersartigen Meinungen plädiert, desto weiter „links“ im politischen Spektrum verortet man sich. Auch der Faktor „Selbstverständnis“ zeigt einheitlich in eine negative Richtung; jedoch unterschiedlich stark. Die drei anderen Determinanten dagegen lösen zum Teil widersprüchliche Effekte aus. Werden alle Schüler gemeinsam betrachtet, können alle drei keine entscheidende Veränderung der Links-rechts-Positionierung erreichen. Bei der Differenzierung nach Geschlecht dagegen verlagern „Sicherheit“ und „Verantwortungsbewusstsein“ die Position der weiblichen Befragten weiter nach links und die der männlichen weiter nach rechts. Beim „Taschengeld“ verhält es sich umgekehrt. Dies mag zum einen darin begründet sein, dass sich die weiblichen und männlichen Befragten von vornherein weiter „links“ bzw. „rechts“ verortet haben. Andererseits scheinen besonders die Einstellungsdimensionen „Verantwortungsbewusstsein“ und „Sicherheit“ quer zu der Links-rechts-Skala zu verlaufen. Der Faktor „Verantwortungsbewusstsein“, der politisches Engagement und Umweltschutz abbildet, deutet klar auf eine weitere gesellschaftliche Spaltungslinie „Postmaterialismus vs. Materialismus“ hin, die den Rahmen der eindimensionalen Links-rechts-Achse sprengt. Ähnlich ist es bei dem latenten Faktor „Sicherheit“, der unter Umständen auf einer neuen autoritärkollektivistischen vs. libertär-individualistischen Achse besser abgebildet werden kann (vgl. Ruß/Schmidt 1998). In einigen Fällen erscheint es angebracht, die Links-rechtsSkala um neuere Konzepte zur politischen und weltanschaulichen Verortung von Individuen in einer differenzierten und globalisierten Gesellschaft zu erweitern. Allerdings müssen die vorgestellten Ergebnisse aus methodischer Perspektive etwas relativiert werden. Angesichts des geringen Stichprobenumfangs sind besonders die nach Geschlecht unterteilten Auswertungen mit einer recht großen statistischen Unsicherheit behaftet. 33 4.3 Wahlabsicht 4.3.1 Deskriptive Darstellung der Bestimmungsfaktoren Zur Bestimmung der Wahlentscheidung sind sieben Einflussgrößen berücksichtig worden. Die ersten drei Determinanten sind das Ergebnis einer weiteren explorativen Faktorenanalyse. 10 Grafik 5 beinhaltet die drei latenten Faktoren, die auf statistischen Zusammenhängen zwischen den zehn manifesten Indikatoren basieren. Alle Variablen bilden Aussagen zum Verhalten der Politiker oder zur Politik ab. Grafik 5 – Ergebnis der Faktorenanalyse: Drei latente Einstellungsdimensionen zur Politik: Enttäuschung von der Politik 0,632 Politiker verhalten sich vor und nach der Wahl anders 0,648 Objektive Meinungsbildung ist schwierig 0,639 Die Interessen der Wähler zählen nicht 0,577 -0,517 Äußerungen der Politiker sind Propaganda Mehr Politik 0,835 Wahlrecht ist wichtig Legende: latenter Faktor Der Einfluss der Bürger auf die Politik ist stark Der Wähler hat außer bei der Wahl wenig Einfluss Weniger Politik 0,800 Stärkere politische Betätigung gefordert 0,581 0,819 Politik macht Probleme unnötig kompliziert Faktorladung 0,774 Keine politischen Interventionen in die Wirtschaft manifester Indikator Der erste Faktor „Enttäuschung von der Politik“ fasst sechs Einstellungen zur Politik zusammen, die entweder das Verhalten von Politikern negativ bewerten, die mangelnde Beachtung der Interessen der Wähler beanstanden oder dem Bürger Einflussmöglichkeiten auf die Politikgestaltung absprechen (vgl. Grafik 5). Der zweite Faktor „Mehr Politik“ ist ein latentes Konstrukt, das sich aus zwei Indikatoren zusammensetzt. Beide betonen die Wichtigkeit der bürgerlichen Beteiligung an politischen Prozessen, sei es durch den Wahlakt oder andere Partizipationswege. Der dritte Faktor „Weniger Politik“ dagegen lädt auf zwei Indikatoren, die in die andere Richtung weisen und den Einfluss10 vgl. Anmerkung 8. 34 bereich der Politik beschränkt sehen wollen: Es werden politische Interventionen in die Wirtschaft kritisiert und, dass Politik Probleme erst unnötig kompliziert macht. Ein weiterer Bestimmungsfaktor neben den drei Faktoren ist die Zufriedenheit mit der Landespolitik. Die Schüler haben sie auf einer fünfstufigen Skala bewertet. Deutlich weniger als ein Fünftel von ihnen ist mit der Bremer Politik sehr oder eher zufrieden, während fast zwei Fünftel weniger oder sogar überhaupt nicht zufrieden sind. Der Rest der Schüler ist geteilter Meinung. In einem anderen Abschnitt des Fragebogens wurde mit insgesamt 33 Fragen das Wissen der Schüler über Politik erhoben. Sie sind insbesondere zu Themenfeldern befragt worden, die die Parteien, die amtierende Regierung und das Wahlrecht sowie den Wahlkampf mit den Spitzenkandidaten betreffen. 11 Durch die Bildung einer sog. Additivskala können alle Fragen zum Wissen über Politik in einer Determinante vereint werden. Dafür sind die Fragen nach der Logik „richtig“ oder „falsch“ umgeformt worden. Für jede korrekt beantwortete Frage erhöht sich die Skala (und das Wissen über Politik) um eine Einheit. Dementsprechend kann die Additivvariable theoretisch alle Ausprägungen von 0 (keine Frage richtig beantwortet) bis 33 (alle Fragen richtig beantwortet) annehmen. In dieser Stichprobe konnten die Schüler auf mindestens zwölf und maximal 30 Fragen die richtige Antwort geben. Median und arithmetisches Mittel liegen bei 22. Durchschnittlich wurden also genau zwei Drittel der Wissensfragen korrekt beantwortet. Die Bedeutung politischer Themen im Alltag der Schüler ist ebenfalls eine Einflussgröße. Sie wurde durch die Häufigkeit, wie oft die Schüler in ihrem sozialen Umfeld über Politik sprechen, gemessen. Die Befragten gaben auf einer sechsstufigen Skala an, in welchem Umfang sie in der Familie, in der Schule und mit ihren Freunden über Politik diskutieren. Die Ergebnisse sind genau wie beim Wissen über Politik in einer Additivvariablen zusammengefasst worden. Sie kann als kleinste Ausprägung eine 3 haben, wenn der Befragte in keinem der drei Kontexte jemals über Politik diskutiert. Die Skala endet bei maximal 18, die der Befragte erreicht, wenn er täglich in allen drei Kontexten über Politik spricht. In diesem Sample reicht die Spannweite der Merkmalsausprägungen von 3 bis 16. Das arithmetische Mittel beträgt 9,79 und der Median 10. Das Interesse an Politik ist die siebte Determinante. Sie wurde direkt über eine elfstufige Skala erfragt. Die Antworten verteilen sich relativ gleichmäßig über die gesamte 11 Um welche Fragen es sich im Detail handelt und wie die Antworten verteilt sind, wird in Kapitel 10.4 des Abschlussberichts zur Begleitforschung der Juniorwahlen in Bremen ausführlich dargestellt (für Nachweisinformationen siehe Anmerkung 4). 35 Skala. Die einzigen Ausnahmen bilden die Mitte, auf die deutlich mehr Angaben entfallen und die beiden niedrigsten bzw. höchsten Stufen, die weniger häufig ausgewählt wurden. Die Skala hat ihre Schwerpunkt also in der Mitte und „franst“ an den Rändern aus, was sich auch in einem Mittelwert und Median von 6 widerspiegelt. 4.3.2 Regressionsanalyse und empirische Befunde Mit einer Wahlbeteiligung von 57 Prozent liegt der Anteil der Befragten, die ihre Stimme abgegeben haben, auf gleicher Höhe mit dem Anteil der Wähler unter den Wahlberechtigten und ca. zehn Prozentpunkte über dem ihrer Altersgruppe: Die Wahlbeteiligung bei der Bürgerschaftswahl 2007 beträgt 57,57 Prozent. Unter den 18- bis 21jährigen liegt sie dagegen nur bei 47,9 Prozent (vgl. Statistisches Landesamt Bremen 2007a: 28 und 2007b). Eine mögliche Ursache für die höhere Wahlbeteiligung in der Stichprobe gegenüber allen Erstwählern kann im überdurchschnittlich hohen Bildungsniveau der Befragten liegen. Zu den Gründen, warum sie gewählt oder nicht gewählt haben, sollten die Schüler Auskunft geben. Sie konnten verschiedenen Statements zustimmen oder sie ablehnen. Für zwei Drittel der Befragten ist Wählen eine Bürgerpflicht. Damit passt ihr Verhalten zu Downs Überlegungen vom langfristigen Partizipationswert, die die Grenzen des Rational Choice-Ansatzes überschreiten. Als verantwortungsbewusste Bürger fühlen sie sich zur Stimmabgabe verpflichtet, um das Funktionieren des demokratischen Systems zu ermöglichen. 15,4 Prozent der Schüler stimmten der Aussage zu, dass sie gewählt haben, weil sie sich von den Kandidaten angesprochen fühlten. Damit wird die Aktualität des sozialpsychologischen Ansatzes unterstrichen. Die Schüler haben sich am Charakter und dem Auftreten der Politiker orientiert. Auch das rationaltheoretische Argument bezüglich der Opportunitätskosten, die durch eine Wahlbeteiligung entstehen, entfaltet für diese Stichprobe Erklärungskraft. Ein Drittel der Befragten, die nicht abgestimmt haben, gab an, zum Wählen keine Zeit gehabt zu haben, da sie eine Handlungsalternative vorzogen. Im Einklang mit der Beobachtung, dass für die deutliche Mehrheit der Respondenten eine Wahlnorm existiert, stehen die Angaben zum Wert einer Stimme. Lediglich 5 Prozent der Schüler stimmten der Aussage zu, dass sie nicht gewählt haben, weil ihre Stimme unwichtig ist und nicht zählt. Offensichtlich erzeugt der Wahlakt einen intrinsischen Nutzen. Die Entscheidung, ob man wählt oder nicht, wird nicht aufgrund von rationalen Kosten-Nutzen-Kalkülen über den Wert der eigenen Stimme gefällt. 36 Zur Quantifizierung, welchen Einfluss die in Kapitel 4.3.1 beschrieben Bestimmungsfaktoren auf die Wahlabsicht haben, wurde ein binär-logistisches Regressionsmodell berechnet. Die zwei Ausprägungen der abhängigen Variable „beabsichtigte Wahlteilnahme“ verteilen sich wie folgt: ca. zwei Drittel der Schüler hat sich vorgenommen zu wählen (Ausprägung 1), das verbleibende Drittel wollte nicht wählen oder war sich unsicher (Ausprägung 0). 12 In Tabelle 4 sind die exponentiellen Regressionskoeffizienten mit ihren Standardfehlern aufgelistet. Tabelle 4 – Koeffizienten der logistischen Regression (Exp(B)) auf die Wahlabsicht Erklärende Variablen Wahlabsicht Exp(B) Standardfehler F1: Enttäuschung von der Politik 0,759 0,194 F2: Mehr Politik 1,042 0,251 F3: Weniger Politik 0,675 0,217 Zufriedenheit mit der Politik 1,285 0,236 Diskussion über Politik 0,964 0,086 Wissen über Politik 1,171 0,063 Interesse an Politik 1,324 0,100 Konstante 0,014 1,648 Nagelkerkes-R² 0,247 Datenbasis: n = 170 Wie Tabelle 4 verdeutlicht, entwickeln die Faktoren „Enttäuschung von der Politik“ und „Weniger Politik“ einen negativen Effekt auf die Wahlbereitschaft. Die Wahrscheinlichkeit zu wählen nimmt ab, wenn man über die Ergebnisse der Politik und das Verhalten der Politiker enttäuscht ist und meint, dass die Bürger wenige Einflussmöglichkeiten auf die Politikgestaltung haben. Anscheinend ist die Protestwahl von radikalen Parteien für die meisten Schüler bei dieser Bürgerschaftswahl keine geeignete Möglichkeit gewesen, um ihren Unmut auszudrücken. Sie blieben lieber ganz den Wahllokalen fern. Die Wahrscheinlichkeit nicht abzustimmen sinkt sogar noch stärker, wenn die Befragten allgemein der Überzeugung sind, dass durch Politik Probleme erst unnötig kompliziert werden und politische Interventionen in die Wirtschaft ablehnen. Auch hier ist die Wahl von Parteien, die einen Rückbau der Staatstätigkeit fordern, nicht die erste Option. 12 Bei dieser Frage war es unerheblich, ob die Schüler tatsächlich wahlberechtigt waren oder sie nur hypothetisch antworteten. Für die Determinanten „Interesse an Politik“ und „Wissen über Politik“ wurden im Abschlussbericht der Begleitforschung zur Juniorwahl (für Nachweisinformationen siehe Anmerkung 4) bereits bivariate Regressionen geschätzt. Die Verwendung der hier präsentierten multivariaten Regression stellt eine Weiterentwicklung dar, die Schätzwerte mit höherer statistischer Sicherheit voraussagt, da alle erklärenden Variablen in einem Schätzmodell berücksichtigt werden und so durch die Drittvariablenkontrolle konfundierende Effekte egalisiert werden können. 37 Allerdings trifft das Gegenteil, eine Erhöhung der Wahlbereitschaft, nicht auf den Faktor „Mehr Politik“ zu. Er kann nur einen sehr schwachen positiven Effekt verursachen, der das Chancenverhältnis zwischen Wahl und Nichtwahl praktisch nicht verändert. Diejenigen Schüler, die das Wahlrecht für wichtig halten und mehr politisches Engagement der Bürger fordern, gehen selbst nicht entscheidend häufiger wählen als alle Befragten. Ein ähnliches Bild zeichnet sich bei der Betrachtung des Einflusses „Diskussion über Politik“ ab. Schüler, die in der Schule, in der Familie oder mit ihren Freunden häufig über politische Themen diskutieren, haben ebenfalls keine höhere Wahlabsicht als ihre Mitschüler. Anders sieht es bei den drei Determinanten „Wissen über Politik“, „Zufriedenheit mit der Politik“ und „Interesse an Politik“ aus. Alle drei verändern die Odds zu Gunsten der Wahrscheinlichkeit, wählen zu gehen. Den stärksten positiven Effekt übt das „Interesse an Politik“ aus. Bei Schülern, die am politischen Geschehen interessiert sind, erhöht sich die Wahlabsicht deutlich. Dieses Ergebnis steht in einer langen Reihe von Forschungsresultaten und bestätigt die weit verbreitete Ansicht, dass politisches Interesse die Wahlteilnahme entscheidend fördert. So stellt Dahlem (2001: 206) bezüglich der Erkenntnisse von Lazarsfeld et al. in „The People’s Choice“ fest: „Die Befragten mit geringem Interesse zeigten auch eine geringe Bereitschaft zu wählen“. Auch die Zufriedenheit mit der Landespolitik wirkt sich positiv aus. Je zufriedener die Respondenten mit den Politikresultaten aus der vorherigen Legislaturperiode sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie durch die beabsichtige Wahlteilnahme am politische Geschehen partizipieren und Einfluss nehmen. Die dritte Determinante mit einem klar positiven Effekt auf die Wahlabsicht ist das „Wissen über Politik“. Ein gutes Verständnis und eine hohe Vertrautheit mit der Funktionsweise des politischen Systems in Bremen und den demokratischen Abläufen im Allgemeinen erhöht die Wahrscheinlichkeit, seine Meinung durch die Stimmabgabe zu äußern. 38 5 Zusammenfassende Schlussbemerkungen und Ausblick Das Ziel der vorliegenden Arbeit war es, die Bestimmungsfaktoren des Wahlverhaltens von Bremer Schülern bei der Bürgerschaftswahl 2007 zu ergründen. Mit der Vorstellung und Diskussion der einflussreichsten Theorien des Wahlverhaltens, den sozialstrukturellen, sozialpsychologischen und ökonomischen Ansätzen, wurde ein facettenreicher Analyserahmen präsentiert, der sich bei der Erforschung der vielschichtigen Handlung einer Wahlentscheidung als hilfreich erwiesen hat. Das Datenmaterial war aufgrund der Erhebungsmethode nicht repräsentativ für die gesamte Bremer Schülerschaft, dennoch konnten auf dieser Grundlage aufschlussreiche Entwicklungstrends aufgezeigt werden. Vor diesem theoretischen und methodischen Hintergrund führte die empirische Analyse in ihrer Quintessenz zu folgenden Ergebnissen: Ein Viertel aller befragten Schüler identifiziert sich langfristig „eher stark“ oder „sehr stark“ mit einer Partei. Für diese Stammwähler haben vor allem sozialstrukturelle und sozialpsychologische Ansätze Erklärungspotential. Hinsichtlich der Parteipräferenz gibt es eine klare Dominanz für die SPD, die die Mehrheit der Schüler favorisiert, so dass sie die Rolle als „Staatspartei“ in Bremen voraussichtlich weiterhin einnehmen wird. Der Faktor „Selbstverständnis“ wirkt am stärksten in Richtung einer Neigung zur SPD, der Faktor „Verantwortungsbewusstsein“ schwächt sie dagegen. Die Identifikation mit der CDU wird durch das „Nationalverständnis“ erhöht und durch das „Selbstverständnis“ verringert. Eine Parteipräferenz für Die Grünen haben die Schüler am ehesten, wenn sie dem Faktor „Gleichheit“ zustimmen, für Die Linke, wenn sie den Faktor „Verantwortungsbewusstsein“ für wichtig erachten. Die Wahrscheinlichkeit, sich mit den beiden Parteien zu identifizieren, nimmt am stärksten ab, wenn das „Nationalverständnis“ betont wird. Insgesamt tendieren die Befragten stärker zu „linken“ Parteien. Diese Einschätzung wird durch ihre Positionierung auf der Links-rechts-Skala bestätigt. Auch hier gibt es einen Überhang am linken Ende, der jedoch in dieser Altersgruppe nicht nur in Bremen zu beobachten ist, sondern in ganz Deutschland. Bei einer nach Geschlecht differenzierten Betrachtung ergibt sich das folgende Bild: Die männlichen Befragten verorten sich etwas weiter in der Mitte und auf der rechten Seite der Skala, während die weiblichen noch weiter nach links tendieren. Die stärkste Verschiebung nach links übt der Faktor „Gleichheit“ aus, der für eine Umverteilung zwischen Arm 39 und Reich und die Toleranz gegenüber andersartigen Meinungen steht. Einen Effekt nach rechts bewirkt der Faktor „Nationalverständnis“, der die Unwichtigkeit der Integration von Ausländern und den Stolz auf die deutsche Geschichte betont. Es wird deutlich, dass eine Links-rechts-Achse für die oben beschriebenen Effekte ein gutes und vor allem bekanntes Instrument zur Abbildung des politischen Spektrums in Deutschland ist. Andererseits verursachten Einflussgrößen wie „Taschengeld“ oder „Sicherheit“ keinerlei Veränderungen auf der Skala oder zeigten in uneinheitliche Richtungen, wenn man sie nach Geschlechtern getrennt untersucht hat. Deshalb gilt es in anknüpfenden Forschungsarbeiten genauer zu evaluieren, ob eine adäquatere Beschreibung der politischen Überzeugungen durch die Einführung weiterer Dimensionen, wie etwa einer „Libertär-autoritär-Achse“ oder einer „Materialismus-Postmaterialismus-Achse“, sinnvoll ist und zu aussagekräftigeren Erkenntnissen führt. Die Wahlbeteiligung der befragten Jugendlichen bei der Bürgerschaftswahl 2007 von 57 Prozent lag auf gleicher Höhe mit der Wahlbeteiligung aller Bremer. Damit haben die Schüler jedoch eine um zehn Prozentpunkte höhere Wahlbereitschaft gezeigt, als ihre Altersklasse. Als Grund für die Wahlteilnahme nannten zwei Drittel der Befragten, dass Wählen für sie eine Bürgerpflicht ist. Der Hauptgrund der Nichtwahl sind Opportunitätskosten. Ein Drittel der Nichtwähler gab an, für die Wahl keine Zeit gehabt zu haben. Die Absicht zur Wahl zu gehen, erhöht sich am stärksten, wenn die Befragten an Politik besonders interessiert und sehr zufrieden mit ihr sind sowie viel über das politische Geschehen wissen. Wer dagegen enttäuscht von der Politik ist und ihr allgemein keine Problemlösungskompetenz zuerkennt, geht sehr wahrscheinlich nicht zur Wahl. Wie von der Individualisierungthese postuliert, nimmt die Prägekraft sozialer Gruppen auf das Wahlverhalten ab. Den bedeutendsten Einfluss auf die Wahlentscheidung sprechen die Schüler den Medien zu, gefolgt von den Eltern und der Schule. Nur ein Drittel der Schüler orientiert sich bei politischen Themen an der Einstellung seiner Eltern und die Hälfte der Befragten zeigte bei der Bürgerschaftswahl ein mit den Eltern konformes Stimmverhalten. Hier zeichnet sich ab, dass die sozialstrukturellen Ansätze in Erklärungsnot geraten: Vor allem kurzfristige Faktoren und rationale Abwägungen, die vom sozialpsychologischen und dem ökonomischen Ansatz beleuchtet werden, determinieren das Wahlverhalten dieser Schülergruppe. Damit bestätigen die Resultate der Arbeit im Wesentlichen die beobachteten Entwicklungstrends beim Wahlverhalten in vielen westlichen Demokratien. Statt dem sozialen Umfeld entwickeln die modernen Massenmedien wie Fernsehen 40 und Internet eine enorme Wirkungsmacht und sind zu einer Sozialisationsinstanz geworden. Sie beeinflussen die Wahlentscheidung der befragten Schüler an erster Stelle. Damit tragen sie eine große Verantwortung für die politische Bildung Jugendlicher und sollten ihre Berichterstattung politisch ausgewogen und verständlich präsentieren. Die Ergebnisse dieser Arbeit haben noch einmal gezeigt, wie wichtig es ist, dass Jugendliche an Politik herangeführt werden und sich - durchaus kritisch - mit ihr auseinandersetzen. Wer politisches Interesse und Wissen besitzt, entwickelt auch eine Bereitschaft zur Partizipation in einer demokratischen Gesellschaft. 41 Literaturverzeichnis Andreß, Hans-Jürgen/Hagenaars, Jacques A./Kühnel, Steffen 1997: Analyse von Tabellen und kategorialen Daten. Log-lineare Modelle, latente Klassenanalyse, logistische Regression und GSK-Ansatz. Berlin: Springer. Arzheimer, Kai/Schmitt, Annette 2005: Der ökonomische Ansatz. In: Falter, Jürgen W./Schoen, Harald (Hrsg.): Handbuch Wahlforschung. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 243-303. Beck, Ulrich 1983: Jenseits von Stand und Klasse. In: Kreckel, Reinhard (Hrsg.): Soziale Ungleichheiten. Soziale Welt. Sonderband 2. Göttingen: Schwartz, S. 35-74. Braun, Dietmar 1999: Theorien rationalen Handelns in der Politikwissenschaft. Eine kritische Einführung. Opladen: Leske+Budrich. Brettschneider, Frank 1991: Wahlumfragen. Empirische Befunde zur Darstellung in den Medien und zum Einfluß auf das Wahlverhalten in der Bundesrepublik Deutschland und den USA. München: Minerva-Publikation. Brettschneider, Frank/Deth, Jan van/Roller, Edeltraud 2002: Sozialstruktur und Politik: Forschungsstand und Forschungsperspektiven. In: Brettschneider, Frank/Deth, Jan van/Roller, Edeltraud (Hrsg.): Das Ende der politisierten Sozialstruktur? Opladen: Leske+Budrich, S. 7-22. Bürklin, Wilhelm/Klein, Markus 1998: Wahlen und Wählerverhalten. Eine Einführung. 2. Auflage. Opladen: Leske+Budrich. Campbell, Angus/Converse, Philip E./Miller, Warren E./Stokes, Donald E. 1960: The American Voter. New York: Wiley. Campbell, Angus/Gurin, Gerald/Miller, Warren E. 1954: The Voter Decides. Evanston: Row, Peterson and Company. Dahlem, Stefan 2001: Wahlentscheidung in der Mediengesellschaft. Theoretische und empirische Grundlagen der interdisziplinären Wahlforschung. Freiburg/München: Alber. Downs, Anthony 1968: Ökonomische Theorie der Demokratie. Tübingen: Mohr (Paul Siebeck). Evans, Geoffrey 1999: Class Voting: From Premature Obituary to Reasoned Appraisal. In: Evans, Geoffrey (Hrsg.): The End of Class Politics? Class Voting in Comparative Context. Oxford/New York: Oxford University Press, S. 1-20. Forschungsgruppe Wahlen 2007: Wahlen in Bremen. Eine Analyse der Bürgerschaftswahl vom 13. Mai 2007. Bericht der Forschungsgruppe Wahlen e.V. Nr.128. Mannheim. Gabriel, Oscar W. 2001: Parteiidentifikation, Kandidaten und politische Sachfragen als Bestimmungsfaktoren des Parteienwettbewerbs. In: Gabriel, Oscar W./Niedermayer, Oskar/Stöss, Richard (Hrsg.): Parteiendemokratie in Deutschland. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, S. 233-254. Gluchowski, Peter 1991: Lebensstile und Wählerverhalten. In: Veen, HansJoachim/Noelle-Neumann, Elisabeth (Hrsg.): Wählerverhalten im Wandel. Bestimmungsgründe und politisch-kulturelle Trends am Beispiel der Bundestagswahl 1987. Paderborn: Schöningh, S. 209-244. 42 Hurrelmann, Klaus/Albert, Mathias/Quenzel, Gudrun/Langness, Anja 2006: Eine pragmatische Generation unter Druck. Einführung in die Shell Jugendstudie 2006. In: Shell Deutschland Holding (Hrsg.): Jugend 2006. Eine pragmatische Generation unter Druck. Frankfurt a. M.: Fischer, S. 31-48. Inglehart, Ronald 1987: Value Change in Industrial Societies. In: American Political Science Review. Bd. 81, 4, S. 1289-1303. Jaccard, James 2001: Interaction Effects in Logistic Regression. London: Sage. Kühnel, Steffen/Krebs, Dagmar 2001: Statistik für die Sozialwissenschaften. Grundlagen, Methoden, Anwendungen. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt. Lazarsfeld, Paul F./Berelson, Bernard/Gaudet, Hazel 1968: The People’s Choice. How the Voter Makes up his Mind in a Presidential Campaign. New York/London: Columbia University Press. Lazarsfeld, Paul F./Berelson, Bernard/Gaudet, Hazel 1969: Wahlen und Wähler. Soziologie des Wahlverhaltens. Neuwied/Berlin: Luchterhand. Lipset, Seymour M./Rokkan, Stein 1967: Cleavage Structures, Party Systems, and Voter Alignments. An Introduction. In: Lipset, Seymour M./Rokkan, Stein (Hrsg.): Party Systems and Voter Alignments: Cross-National Perspectives. New York: Free Press, S. 1-64. Mielke, Gerd 2001: Gesellschaftliche Konflikte und ihre Repräsentation im deutschen Parteiensystem. Anmerkungen zum Cleavage-Modell von Lipset und Rokkan. In: Eith, Ulrich/Mielke, Gerd (Hrsg.): Gesellschaftliche Konflikte und Parteiensysteme. Länder- und Regionalstudien. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, S. 77-95. Müller, Walter 1999: Class Cleavages in Party Preferences in Germany – Old and New. In: Evans, Geoffrey (Hrsg.): The End of Class Politics? Class Voting in Comparative Context. Oxford/New York: Oxford University Press, S. 137-180. Nieuwbeerta, Paul/de Graaf, Nan Dirk 1999: Traditional Class Voting in Twenty Postwar Societies. In: Evans, Geoffrey (Hrsg.): The End of Class Politics? Class Voting in Comparative Context. Oxford/New York: Oxford University Press, S. 23-56. O’Connell, Ann A. 2006: Logistic Regression Models for Ordinal Response Variables. London: Sage. Pampel, Fred C. 2000: Logistic Regression. A Primer. London: Sage. Pappi, Franz Urban 2001: Soziale Netzwerke. In: Schäfers, Bernhard/Zapf, Wolfgang (Hrsg.): Handwörterbuch zur Gesellschaft Deutschlands. Opladen: Leske+Budrich, S. 605-616. Pappi, Franz Urban 2002: Die politische Sozialstruktur heute: Historische Reminiszenz oder aktuelles Erklärungspotential? In: Brettschneider, Frank/Deth, Jan van/Roller, Edeltraud (Hrsg.): Das Ende der politisierten Sozialstruktur? Opladen: Leske+Budrich, S. 25-46. Roth, Dieter 1998: Empirische Wahlforschung. Ursprung, Theorien, Instrumente und Methoden. Opladen: Leske+Budrich. Rudi, Tatjana/Schoen, Harald 2005: Ein Vergleich von Theorien zur Erklärung von Wählerverhalten. In: Falter, Jürgen W./Schoen, Harald (Hrsg.): Handbuch Wahlforschung. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 305-325. Ruß, Sabine/Schmidt, Jochen 1998: Herausforderungen von links und rechts: Wertewandel und Veränderungen in den Parteiensystemen in Deutschland und Frankreich. In: Köcher, Renate/Schild, Joachim (Hrsg.): Wertewandel in Deutschland und Frankreich. Nationale Unterschiede und europäische Gemeinsamkeiten. Opladen: Leske+Budrich, S. 265-287. 43 Schneekloth, Ulrich 2002: Demokratie, ja – Politik, nein? Einstellungen Jugendlicher zur Politik. In: Deutsche Shell (Hrsg.): Jugend 2002. Zwischen pragmatischem Idealismus und robustem Materialismus. Frankfurt a. M.: Fischer, S. 91-137. Schneekloth, Ulrich 2006: Politik und Gesellschaft: Einstellungen, Engagement, Bewältigungsprobleme. In: Shell Deutschland Holding (Hrsg.): Jugend 2006. Eine pragmatische Generation unter Druck. Frankfurt a. M.: Fischer, S. 103-144. Schoen, Harald 2005: Soziologische Ansätze in der empirischen Wahlforschung. In: Falter, Jürgen W./Schoen, Harald (Hrsg.): Handbuch Wahlforschung. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 135-185. Schoen, Harald/Weins, Cornelia 2005: Der sozialpsychologische Ansatz zur Erklärung von Wahlverhalten. In: Falter, Jürgen W./Schoen, Harald (Hrsg.): Handbuch Wahlforschung. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 187-242. Schumann, Siegfried 2001: Persönlichkeitsbedingte Einstellungen zu Parteien. Der Einfluß von Persönlichkeitseigenschaften auf Einstellungen zu politischen Parteien. München/Wien: Oldenbourg. Statistisches Landesamt Bremen 2007a: Wahl zur Bremischen Bürgerschaft 2007. Statistische Mitteilungen Heft 110. Bremen. URL: http://www.statistik.bremen.de/sixcms/media.php/13/lw07_heft110.4095.pdf (Zugriff am 07.09.2007). Statistisches Landesamt Bremen 2007b: Endgültiges Ergebnis der Wahl zur Bremischen Bürgerschaft (Landtag) am 13. Mai 2007. URL: http://www.statistik.bremen.de/sixcms/media.php/13/01LW07_Amtliches%20Ergebnis.pdf (Zugriff am 07.09.2007). Winter, Thomas von 1987: Politische Orientierungen und Sozialstruktur. Ein Beitrag zur Theorie des Wählerverhaltens. Frankfurt/New York: Campus. 44