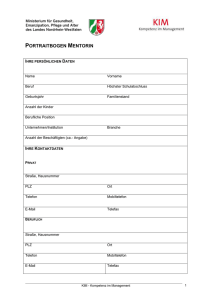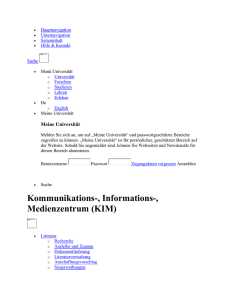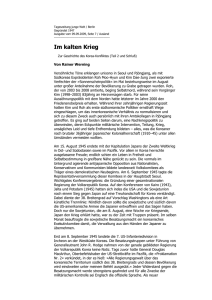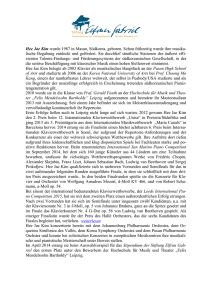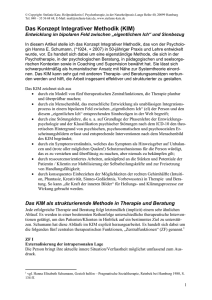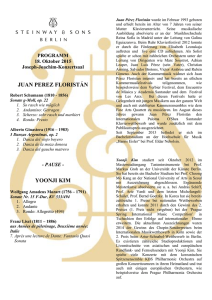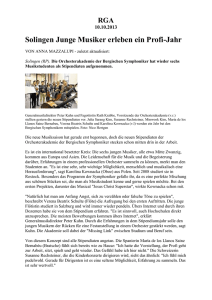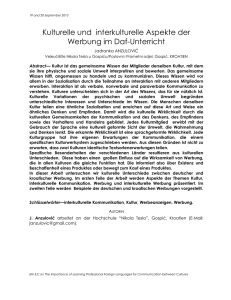Vortrag - Sprache, das Tor zur Welt
Werbung

FACHTAG 2016 - SPRACHE, DAS TOR ZUR WELT Interkulturelle frühkindliche Bildung und Mehrsprachigkeit Referent: Nuka Kim INTERKULTURELLE FRÜHKINDLICHE BILDUNG UND MEHRSPRACHIGKEIT Aufbau des Vortrags Interkulturelle Sensibilisierung frühkindliche Bildung Mehrsprachigkeit/ Zweitspracherwerb INTERKULTURELLE SENSIBILISIERUNG ©opyrights by Nuka Kim INTERKULTURELLE SENSIBILISIERUNG ©opyrights by Nuka Kim INTERKULTURELLE SENSIBILISIERUNG ©opyrights by Nuka Kim INTERKULTURELLE SENSIBILISIERUNG Im Jahr 2015 wurden beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) insgesamt 476.649 formelle Asylanträge gestellt, 273.815 mehr als im Vorjahr, 162.510 Asylbewerber kamen aus Syrien. Unter den 10 Hauptherkunftsländern vier aus Balkanregion: Serbien, Kosovo, Mazedonien und Albanien Mit Bosnien-Herzegowina und Montenegro somit etwa 30 Prozent aller Asylbewerber sechs Staaten des Westbalkans Anteil in der zweiten Jahreshälfte kontinuierlich im Monat Dezember 2015 nur 8 Prozent (Stand 6. 1. 2016) ©opyrights by Nuka Kim INTERKULTURELLE SENSIBILISIERUNG ©opyrights by Nuka Kim INTERKULTURELLE SENSIBILISIERUNG ©opyrights by Nuka Kim INTERKULTURELLE SENSIBILISIERUNG ©opyrights by Nuka Kim INTERKULTURELLE SENSIBILISIERUNG ©opyrights by Nuka Kim INTERKULTURELLE SENSIBILISIERUNG ©opyrights by Nuka Kim INTERKULTURELLE SENSIBILISIERUNG Wieviel Geld bekommt ein Flüchtling in Deutschland? Ein Alleinstehender erhält monatlich 143 Euro Verheiratete jeweils 129 Euro Kind (0-6 Jahre) 84 Euro Kind (7-14 Jahre) 92 Euro Kind (15-18 Jahre) 85 Euro. Sobald den Flüchtlingen ein fester Wohnort (Flüchtlingsheim) zugewiesen wird, steigen die Sätze: Alleinstehender 325 Euro/Monat Verheiratete jeweils 297 Euro Kind (0-6 Jahre) 211 Euro Kind (7-14 Jahre) 238 Euro Kind (15-18 Jahre) 269 Euro ©opyrights by Nuka Kim INTERKULTURELLE SENSIBILISIERUNG Unwissenheit öffnet die Tore für Radikale, wie zum Beispiel die PEGIDA - Bewegung und die Islamisten. FRÜHKINDLICHE BILDUNG Sprache, das Tor zur Welt FRÜHKINDLICHE BILDUNG Romantisches Orgelwerk Theodore Dubois (1827-1924), Messe de Mariage, 25´37“ ©opyrights by Nuka Kim FRÜHKINDLICHE BILDUNG Im Rahmen des universitären Orgelexamens übte schwangere Frau Christina K. täglich mehrere Stunden an der Orgel und spielte die obengenannten Musikstücke für Orgel. So hörte das Kind im Mutterbauch unter anderem die Orgelwerke von Theodore Dubois „Messe de Mariage“ und von Johann Sebastian Bach „Präludium und Fuge a-moll BWV 543“. Ihr Examen absolvierte sie während ihrer Schwangerschaft. Danach spielte sie diese Orgelwerke nicht mehr, weil die Schwangerschaft und die Geburt das Orgelspielen wegen des Bauchumfangs verhinderte. Etwa im sechsten Lebensmonat der kleinen Tochter Julia Maria legte Frau Christian K. die CD mit der Messe de Mariage in den CD-Player und startete sie, um einfach einmal wieder die „alten Stücke“ zu hören. Das kleine Mädchen, das gerade noch auf dem Boden des Wohnzimmers rumkullerte und Krabbelversuche unternahm, horchte auf und robbte auf die Lautsprecher zu und blieb während des Abspielens der Orgelstücke mehr als 25 Minuten aufrecht sitzen, schaute auf die Boxen und war sehr aufmerksam. Die Musikstücke waren dem Kind bekannt und vertraut, obwohl sie sie seit der Orgelprüfung der Mutter während der Schwangerschaft nicht mehr gehört hatte. 17 Jahre später hörte sich Frau Christina K. eine CD mit dem Präludium von Bach an, das sie seit der Prüfung (17 Jahre zuvor!) nicht mehr an der Orgel gespielt hatte. Julia Maria äußerte im Vorbeigehen, „das spielst Du doch immer in der Kirche!“. Frau Christina K. antwortete: „Das habe ich schon 17 Jahre nicht mehr in der Kirche gespielt!“. ©opyrights by Nuka Kim FRÜHKINDLICHE BILDUNG Bedürfnishierarchie nach Maslow Nach Maslow dominieren die Bedürfnisse der niederen Hierarchieebenen die Motivation einer Person, solange sie unbefriedigt bleiben. Wenn diesen Bedürfnissen adäquat entsprochen wurde, dann ziehen die Bedürfnisse der höheren Ebenen die Aufmerksamkeit auf sich. Zuerst werden die niederen Bedürfnisse befriedigt, bevor die Bedürfnisse der nächst höheren Ebene in den Vordergrund treten. ©opyrights by Nuka Kim FRÜHKINDLICHE BILDUNG Physiologische Bedürfnisse ©opyrights by Nuka Kim FRÜHKINDLICHE BILDUNG Bedürfnis nach Sicherheit Physiologische Bedürfnisse ©opyrights by Nuka Kim FRÜHKINDLICHE BILDUNG Bedürfnis nach Zuwendung Bedürfnis nach Sicherheit Physiologische Bedürfnisse ©opyrights by Nuka Kim FRÜHKINDLICHE BILDUNG Bedürfnis nach Anerkennung Bedürfnis nach Zuwendung Bedürfnis nach Sicherheit Physiologische Bedürfnisse ©opyrights by Nuka Kim FRÜHKINDLICHE BILDUNG Bedürfnis nach Selbstverwirklichung Bedürfnis nach Anerkennung Bedürfnis nach Zuwendung Bedürfnis nach Sicherheit Physiologische Bedürfnisse ©opyrights by Nuka Kim FRÜHKINDLICHE BILDUNG Aus dem Mittelalter wird ein Experiment berichtet, das einen sehr tragischen Ausgang nahm. Kaiser Friedrich II. (1212-1250), der an wissenschaftlichen Untersuchungen außerordentlich interessiert war, wollte erforschen, wie sich Kinder verhalten, und welche Ursprache sie entwickeln würden, wenn sie keinerlei Möglichkeit zum sprachlichen Austausch mit anderen Menschen hätten. Um dies herauszufinden, ließ er Neugeborene von Pflegerinnen versorgen, die die strickte Anweisung erhielten, die Kinder zwar zu waschen und zu füttern, aber kein Wort mit ihnen zu sprechen und auch sonst keinerlei Kontakt zu ihnen aufzunehmen. Der Kaiser, der übrigens spekuliert hatte, die gesuchte Ursprache könnte Hebräisch, Griechisch, Latein oder Deutsch sein, musste bald aufgeben, denn die Kinder starben alle nach kurzer Zeit. „Ohne dass Händepatschen, das fröhliche Grimassenschneiden und die Koseworte ihrer Ammen vermochten die Kinder nicht zu leben“, schlussfolgerte eine Chronik. ©opyrights by Nuka Kim FRÜHKINDLICHE BILDUNG Ähnlich traurige Erfahrungen in Waisenhäusern und Heimen: Kinder ausreichend ernährt und hygienisch einwandfrei versorgt ohne Zärtlichkeit und liebevolle Ansprache seelische Verkümmerung deutliche Entwicklungsrückstände (Beispiel Laufen- und Sprechenlernen) Kinder bedrückt und apathisch, sehr anfällig gegen Krankheiten Viele von ihnen starben nach kurzer Zeit. Inzwischen weiß man, dass Kinder, um sich gesund entwickeln zu können, besonders in den ersten Lebensjahren einen Menschen brauchen, der zuverlässig für sie da ist und ihnen liebevolle Zuwendung gibt. Aus diesem Grund versucht man heute in Waisenhäusern und Heimen durch kleine familienähnliche Gruppen den Kindern mehr Geborgenheit zu geben. Doch leider kommt es noch immer vor, dass einzelne Kinder zwischen verschiedenen Pflegefamilien und Heimen hin- und hergeschoben werden und sich nirgendwo zugehörig fühlen können. ©opyrights by Nuka Kim FRÜHKINDLICHE BILDUNG In solchen Heimen konnte man auch sehr oft ein ganz bestimmtes Phänomen beobachten, dass Hospitalismus genannt wird: Kinder, die zwar physisch sehr gut versorgt wurden, also genügend und vor allem auch ausgewogene Nahrung erhalten hatten; diese Waisenhäuser verfügten außerdem über ausreichende sanitäre Anlagen und sie waren relativ sauber, doch die Waisenkinder wiesen plötzlich sehr starke Verhaltensstörungen auf. In russischen Waisenhäusern beobachtete man Kinder, die stundenlang auf ihrem Bett einfach nur hin und her wippten, obwohl sie eigentlich immer von anderen Kindern umgeben waren und ihnen nie hätte langweilig sein müssen. Ihnen war aber keineswegs langweilig, ihnen fehlte nur menschliche Zuneigung und die Sozialfürsorge einer Bezugsperson. ©opyrights by Nuka Kim FRÜHKINDLICHE BILDUNG ©opyrights by Nuka Kim FRÜHKINDLICHE BILDUNG ©opyrights by Nuka Kim FRÜHKINDLICHE BILDUNG ©opyrights by Nuka Kim FRÜHKINDLICHE BILDUNG ©opyrights by Nuka Kim FRÜHKINDLICHE BILDUNG Die Nervenzellen (Neuronen) sind für die Reizaufnahme, Erregungsleitung und Reizverarbeitung zuständig. Sie sind eigenständige Gebilde in der Struktur und der Funktion. Männer besitzen etwa 23 Milliarden und Frauen etwa 19 Milliarden Nervenzellen. Die Neuronen stehen untereinander durch die Synapsen in Verbindung und bilden Neuronenketten. Je mehr Neuronenketten gebildet werden (mehr Verzweigungen), desto effizienter kann die Reizverarbeitung stattfinden. Vereinfacht gesagt, bedeutet das eine bessere Denkfähigkeit bei mehr Neuronen und Synapsen. Musik steigert nachgewiesener Weise die Bildung von Neuronenverbindungen. Die Denkfähigkeit hängt von Veranlagungs- und Umsetzungsfaktoren (Förderung) ab. ©opyrights by Nuka Kim ZWEITSPRACHERWERB Mögliche Hürden beim Erwerb einer Zweitsprache „Schallwellensalat“ bzw. „Sprachbad“ (der Input ist chaotisch) die Kenntnisse der Erstsprache sind wichtig und wirken wie ein Betriebssystem zum Erwerb der Zweitsprache (Achtung: Sprachen sind sprachrhythmisch unterschiedlich!) Satz- bzw. Sprachmelodie neue Sprachmelodien erwerben Sprachbewegungsmuster automatisierte Grundmuster verändern Lautfilter aus der Erstsprache Lautfilter erweitern Satzbauprinzipien aus der Erstsprache Satzbauprinzipien verändern ©opyrights by Nuka Kim ZWEITSPRACHERWERB Wie soll der Zweitspracherwerb gefördert werden? Phasen der Sprachentwicklung müssen bei Migrantenkindern nachträglich erarbeitet werden (gezieltes Training) Lexikalisches, grammatisches und semantisches Wissen sind für eine korrekte Verarbeitung von Äußerungen zu fördern ©opyrights by Nuka Kim ZWEITSPRACHERWERB Schwierigkeiten beim Zweitspracherwerb Migrantenkinder erhalten häufig keinen kontinuierlichen und systematischen sprachlichen Input in der Zielsprache. Dies kann zu systematischen Erwerbslücken führen, die soweit sie grammatische Kenntnisse betreffen nur durch eine gezielte Sprachförderung behoben werden kann. Sprachverarbeitungsprozesse sind äußerst schnell und weitgehend parallelisiert. Für das „online“ – Verstehen gesprochener Sprache ist der automatisierte Zugang zum lexikalischen, grammatischen und semantischen Wissen über die Sprache Voraussetzung ©opyrights by Nuka Kim ZWEITSPRACHERWERB Strategien, die Kinder entwickeln, um sich eine zweite Sprache anzueignen • Zuerst lernt das Kind die zur Verständigung notwendigen Wörter. Dabei lässt es diejenigen Wörter im Satz aus, die wenig Informationen enthalten und deren Bedeutung aus der Situation heraus erfasst werden kann: z.B. „Ball spielen“, statt „ich möchte mit dem Ball spielen“. • Wörter, die Inhaltswörter ausdrücken, werden vorrangig benutzt: Substantive (z.B. Bild), Verben (malen) und Adjektive (dunkel, schön) • Funktionswörter dagegen werden zunächst weggelassen. Dazu zählen u.a. Präpositionen (mit, in), Konjunktionen (und, oder), Hilfsverben (können, wollen, sein) • Sie vereinfachen sich den Zugang zur zweiten Sprache, indem sie Zeitformen weglassen. Beispiel: „Sabine gehen“ (statt ich bin zu Sabine gegangen)- und/oder indem sie Pluralformen weglassen: Beispiel: ein Haus - zwei Haus • Kinder reduzieren die Vielfalt der Wortformen auf einige wenige und erleichtern sich auf diese Weise den Einstieg in die neue Sprache. Sie lassen z.B. Artikel weg bzw. verwenden nur einen statt drei Artikeln (z.B. die Sonne, die Haus, die Buch) ©opyrights by Nuka Kim ZWEITSPRACHERWERB • Sie verwenden Wörter, die sich auf ähnliche Zustände beziehen. (Analogiebildung) z.B. klein für kurz Beispiel: „Fatma, heute hast du kleine Haare“ (Fatma war beim Friseur) • Verneinung des Gegenteils Beispiel: „Okran nicht lachen“ (Okran weint). • Einmal verstandene Regeln werden verallgemeinert. Ein Beispiel. Das Kind hat die Partizipbildung der schwachen Verben verstanden: malen - gemalt; lachen - gelacht. Nun überträgt es diese Regel auf alle Verben, also auch die starken Verben: singen - gesingt. Aus der Sicht des Erwachsenen hat das Kind einen Fehler gemacht. Aus der Sicht des Kindes ist die Regelübertragung gelungen. Es zeigt damit, das es dabei ist, sich Regeln zu erarbeiten. Diese kognitive Leistung sollte anerkannt werde. Es ist wichtig, die Leistung des Kindes beim Zweitspracherwerb anzuerkennen. Die hier beschriebenen Strategien sind oft kreative, intelligente Lösungswege der Kinder, um sich eine zweite Sprache anzueignen. ©opyrights by Nuka Kim DANKE FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT