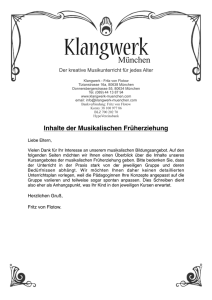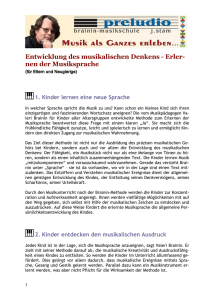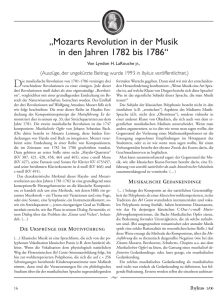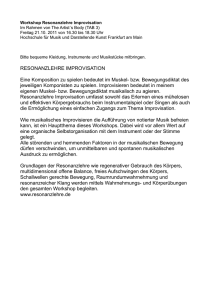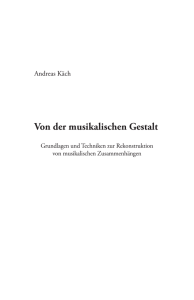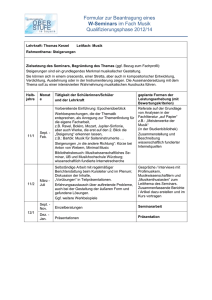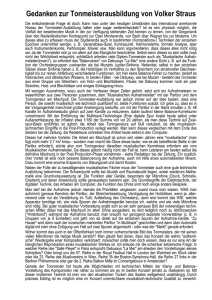als PDF
Werbung

[H. H. Ehrenforth (Hg.): Medieninvasion. Die kulturpolitische Verantwortung der Musikerziehung. Kassel 1985, S. 235 - 245.] WALTER HEIMANN MUSIKALISCHES HANDELN ALS DIDAKTISCHES PROBLEM ÜBER DIE ANTINOMIE VON HANDELN UND ERKENNEN IM MUSIKUNTERRICHT Alles Lernen in der Schule wird zunehmend von zwei Grundsätzen angeregt und verändert. Der erste besagt: Das Denken geht aus dem Handeln hervor. Und der zweite folgert daraus für den Unterricht, dass im Handeln verankertes Denken und Sprechen besseres Denken und Sprechen ist (Aebli 1980, S. 6). Beides sind Aussagen darüber, wie wichtig das praktische Handeln für das Denken ist, wie grundlegend seine Aufgabe, wenn es darum geht, besser zu denken und besser zu sprechen. Im Musikunterricht aber hat das praktische Handeln seit je noch einen anderen Sinn jenseits seiner kompensatorischen Aufgabe, das Denken und Sprechen zu verbessern. Und das liegt im besonderen Charakter des künstlerischen Fachs. In den meisten anderen Fächern, wie z. B. in Erdkunde oder Geschichte, steht das Handeln immer im Dienst des Denkens und nur in diesem Dienst. Denn ein Erd­ kundelehrer kann und will nicht wirklich „Länder erzeugen“, und der Historiker kann und darf in der Schule nicht wirklich „Geschichte machen“; auch nur für eine Partei zu werben, ist ihm im Unterricht verboten. Aber ein guter Musikleh­ rer kann und darf in der Schule wirklich Musik machen und damit in einem sehr viel weitergehenden Sinn praktisch handeln als seine Kollegen in anderen Fä­ chern. So darf er ohne weiteres für eine bestimmte Musik werben mit Faszination und praktisch-musikalischer Arbeit. Ja, er muss es tun, wenn er den Auftrag sei­ nes Fachs nicht verfehlen will. Im gleichen, sehr „ursprünglichen“ Sinn wollen die Schüler Musik machen oder hören und dabei zunächst einmal unbehelligt sein von der Gängelung durch didaktische Denkaufgaben. Denn mit ihrem mu­ sikalischen „Wollen“ haben „Denken und Sprechen“ in der Tat zunächst einmal nichts zu tun. Gerade aber in der größeren Unbefangenheit der Kinder und Jugendlichen bei ihrem musikalischen Wollen zeigt sich oft deutlicher als sonst: dass das musikalische Handeln seinem Sinn nach den Denk- und Sprachsystemen (wie Wissenschaft und Logik) nicht nur fremd und unabhängig gegenübersteht, sondern ihnen auch prinzipiell und unversöhnlich widerspricht. Anders als die meisten anderen Fächer hat der Musikunterricht den klassischen Dualismus zwischen Handeln und Erkennen also noch in einer weiteren Dimensi­ 2 WALTER HEIMANN on in sich selbst zu verarbeiten, jene tiefe innere Spannung, die aus dem Sinn­ gegensatz zwischen den praktischen Aufgaben des musikalischen Handelns und den Aufgaben der Denk- und Sprachsysteme entsteht. Ich frage im folgenden also zuerst: In welchen Merkmalen des musikalischen Handelns wird der prinzipielle Gegensatz zum Denken spürbar und greifbar? Sodann wäre zu fragen: Wie kann und wie soll der Lehrer mit diesem Sinnge­ gensatz im Unterricht praktisch umgehen? Natürlich muss ich dabei ein wenig vereinfachen. I. Musikalisches Handeln ist jedes auf Musik bezogene äußere oder innerliche Tun. Zum Problem wird es uns im folgenden dadurch, dass es durch Werturteile einen subjektiven Sinn erhält. Der einzelne Schüler – ebenso wie der Lehrer ent­ scheidet über alles, was ihn musikalisch umgibt, immer durch positive oder nega­ tive Bewertung und gibt sich innerlich fortlaufend Rechenschaft darüber, ob ein musikalisches Handeln – etwa eine Spielweise oder auch nur eine einzelne Syn­ kope auf dem Kontrabass – ihm gefällt oder nicht, ob es für ihn erfreulich oder unerfreulich ist, erwünscht oder unerwünscht. Er nimmt sich dadurch die grund­ legende, die „existenzielle“ Freiheit, innerlich Stellung zu nehmen zu dem, was ihm musikalisch begegnet. Und in dem Maße, wie er sich diese Freiheit wirklich nimmt – was jeder freilich nur in sehr verschiedenem Maße tut -, bestimmt er durch seine subjektive Stellungnahme und Auswahl den Sinn seines Tuns. Formal betrachtet trifft er diese Auswahl vor dem Hintergrund der verschiedenen musikalischen Sinnalternativen, die sich in Geschichte und Gegenwart her­ ausgebildet haben. Es sind die historischen Epochalstile und die aktuellen Mu­ sikarten wie Schlager, Rock, Jazz, Tanzmusik, Avantgarde usw. Vor diesem Hin­ tergrund trifft er eine ganz auf sich bezogene Auswahl und schafft dadurch zwi­ schen den Sinnalternativen unvermeidlich eine ganz auf sich bezogene Un­ gleichheit. Vor allem dann, wenn er die Auswahl mit großer Entschiedenheit, mit Leidenschaft, mit Hingabe und einer dementsprechenden Ausschließlichkeit trifft, zeigt sich die Tatsache der Ungleichheit besonders deutlich, etwa dort, wo musikalische Sinnentscheidungen – wie im 19. Jahrhundert – mit der Intensität und Absolutheit einer religiösen Überzeugung vertreten wurden – ähnlich wie heute in der Jugendkultur -, oder dort, wo mit musikalischen Sinnkomplexen zu­ gleich heils- und unheils- geschichtliche Perspektiven verknüpft wurden. An Extremen dieser Art zeigt sich der Zusammenhang von Sinnentscheidung und Ungleichheit, von subjektiver Auswahl und subjektiver „Auserwähltheit“ aber nur besonders deutlich. Sie veranschaulichen nur das sonst auch überall spürbare M USIKALISCHES H ANDELN ALS DIDAKTISCHES P ROBLEM 3 Prinzip: Grundsätzlich jede Sinnauswahl schafft in der Grenzenlosigkeit der Sinnalternativen diese ganz parteiliche Auslese. Sie ist logisch immer eine Sinn„Elite“, vom Prinzip her und ganz selbstverständlich also „elitär“. Man hat dieses Streben nach Ungleichheit und nach Herausgehobenheit der Sinnobjekte, diesen ausschließenden „elitären“ Charakter einer jeden entschiedenen Sinnwahl oft be­ obachtet und ihn auch als einen „aristokratischen“ Zug an der Musik bezeichnet. In der Tat begegnet uns dieser Charakter des musikalischen Handelns immer und überall: bei Rock- und Jazzmusikern ebenso wie bei Avantgarde-Komponisten, in großen Musikphilosophien ebenso wie im Urteil von Pop- und Schlagerfans und historisch besonders spürbar in allen Musiklehren seit den frühesten Zeug­ nissen des Nachdenkens über den Sinn der Musik. Beispiele über das Streben nach Ungleichheit bei Schlagerhörern und deren ari­ stokratische Haltung muss ich hier übergehen. In dem angedeuteten gleichsam „elitären“ und „aristokratischen“ Charakter der musikalischen Sinnentscheidung zeigt sich in groben Umrissen zunächst nur ein erster fundamentaler Gegensatz zu so allgemeinen Prinzipien des wissenschaftli­ chen Denkens wie Intersubjektivität, Pluralität der Sinngegensätze und kritische Distanz. Zwar muss auch der Wissenschaftler Gegenstand und Methoden sub­ jektiv auswählen, und in der Regel tut er dies mit großer innerer Anteilnahme. Er steht mit diesen Fragen aber noch ganz im Vorraum seiner Wissenschaft, bei ih­ ren „Vorfragen“, wie Max Weber sie genannt hat. Zwischen diesen und der Wissenschaft im engeren Sinne besteht der gleiche Gegensatz zwischen Handeln und Erkennen, wie er uns hier beschäftigt, der Gegensatz also zwischen der IchBezogenheit einer Sinnentscheidung und den davon prinzipiell abgelösten Grundsätzen wissenschaftlichen Denkens. Aus der gleichsam „aristokratischen“ Subjektivität der Sinnauswahl als der ersten Bedingung musikalischen Handelns folgt nun eine zweite Bedingung: das Partikulare. Wer sich für einen bestimmten musikalischen Sinn entscheidet, ent­ scheidet sich damit zugleich auch immer für eine sinnhafte Begrenzung seiner Welt, auch wenn er sich darüber hinwegtäuscht oder diese Tatsache nicht zur Kenntnis nehmen will. Durch seine Auswahl wendet er sich ab von der Gren­ zenlosigkeit der Sinnalternativen, schlägt gewissermaßen die Türen zu unendlich vielen Freiheitsräumen zu und eröffnet sich dadurch, dass er einen einzigen sub­ jektiv begrenzten Raum betritt, eine neue, ganz andere Freiheit. Die Welt wird dadurch also kleiner für ihn: Sie wird – als logische Folge der subjektiven Ent­ scheidung und Auswahl – sinnhaft geschlossen, nur subjektiv bedeutsam, parti­ kular. Unser wissenschaftliches Denken freilich sträubt sich gegen eine solche Begrenztheit und ist nach seinen Idealen in der Tat auch ganz frei davon. Das wissenschaftliche Denken folgt Prinzipien wie „Offenheit“ gegenüber jeder nur denkbaren Sinnalternative und „Unabhängigkeit“ durch seine grenzenlose Bereit­ schaft, die Wirklichkeit mit Möglichkeit zu durchdringen. Vor dem Hintergrund 4 WALTER HEIMANN dieser universalistischen Prinzipien des Denkens muss jede subjektive Sinnaus­ wahl und das unvermeidlich Partikulare daran so fremd und auch so negativ er­ scheinen, dass viele Autoren davon nur mit einem resignativen Unterton spre­ chen. Ich zitiere hier Christoph Richter: „Die Situation, dass der Mensch gerade durch seine Freiheit zur Entscheidung... seine Freiheit und seine Fähigkeiten not­ wendigerweise einschränkt, ist unabänderlich. Mit dieser Einsicht muss er leben.“ (Richter 1975, S. 42). Sichtbar wird diese Konsequenz der Sinnent­ scheidung vor allem dort, wo sie den Charakter der Einseitigkeit annimmt. In oft sehr rigide Einschränkungen und Unfreiheiten stilistischer Art haben sich fast alle Komponisten und Interpreten begeben. Als produktive Einseitigkeit sind diese Unfreiheiten in der Geschichte der Musik meistens – zumindest aber seit Beginn der Neuzeit regelmäßig – eine notwendige Randbedingung herausragen­ der musikalischer Leistung, im Prinzip aber auch eine Randbedingung eines je­ den musikalischen Handelns, sofern es mit Leidenschaft betrieben wird, wie etwa ganz zweifellos das Schlagerhören unserer Schüler. Zwar sind die Ein­ schränkungen und Unfreiheiten, in welche sich die Schlagerhörer und ihre Stars begeben haben, eher sozialpsychologischer als stilistischer Natur und in ihrem subjektiven Sinn kaum zureichend erkannt. Die typische Verbindung aber von subjektiver Sinnentscheidung und partikularer Einseitigkeit, das also, worum es hier geht, ist besonders oft gerade in diesem Bereich gleichsam mit Händen zu greifen. Grundsätzlich – ob beim Komponisten, Interpreten oder beim Schla­ gerhörer – steht jede entschiedene Sinnauswahl und das Partikulare daran, jede durchschnittliche musikalische Leidenschaft, fremd gegenüber dem Universalis­ mus des Denkens. Ergänzend hierzu wären gewiss noch weitere Merkmale anzudeuten, durch wel­ che der Charakter einer musikalischen Sinnentscheidung in Gegensatz tritt zum Denken und Sprechen. Ich müsste zeigen, dass eine Sinnentscheidung in ihrem Kern unerreichbar ist für logische Argumentation. Sätze wie: Diese Musik ist für mich erfreulich oder unerfreulich, wünschenswert oder unerwünscht, stehen außerhalb logischer Überprüfbarkeit, sind logisch unwiderlegbar (auch wenn andere sie ihrerseits wiederum zu bewerten pflegen als „triftig“ oder „irrelevant“ usw.). Ich müsste schließlich andeuten, dass eine Sinnentscheidung gegenüber der Gesamtheit der Sinnalternativen niemals gerecht ist und etwa im Sinne des Denkens oder der modernen Rechtsidealität – niemals gerecht sein kann. Die Be­ zogenheit einer musikalischen Sinnentscheidung auf mich, auf meine Vergangen­ heit, auf meine Gegenwart und Zukunft, ist logisch etwas anderes als eine denk­ bare Gerechtigkeit etwa gegenüber dem Rang einer musikalischen Leistung oder gegenüber ihrer historischen Relevanz im Rahmen eines bestimmten Geschichts­ bildes. Niemand kann handeln, ohne sich vorher von diesem Gedanken einer „ge­ rechten“ Wahl zu lösen, ja ohne zuvor diese Idee des „gerechten Handelns“ M USIKALISCHES H ANDELN ALS DIDAKTISCHES P ROBLEM 5 durch das Handeln selbst, durch seine Subjektivität, zu verraten. Dazu gehört auch die Frage, ob die Musik in ihrem ursprünglichen Charakter nicht von Natur aus zu allen Idealen der Aufklärung wie etwa Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit in Gegensatz steht, oder, wie Max Weber es formuliert, „ob das Reich der Kunst nicht vielleicht ein Reich diabolischer Herrlichkeit sei... und in seinem tiefinner­ lichst aristokratischen Geist widerbrüderlich“(Weber 1973, S. 600), also gegen­ brüderlich, unfriedlich, intolerant. Ich muss das hier aber übergehen. Und es ge­ nügt vielleicht auch, wenn wir festhalten: Die sinnhaften Orientierungspunkte des musikalischen Handelns sind nicht allseitige Offenheit der Sinnhorizonte, sondern deren Geschlossenheit in einem ganz bestimmten musikalischen Sinn, nicht Unabhängigkeit als Denkprinzip, sondern Abhängigkeit von einer subjek­ tiv-partikularen Begrenzung der Welt, nicht Pluralität der Sinnmöglichkeiten und Toleranz, sondern Einseitigkeit durch Liebe und Hass, durch leidenschaftliche Entschiedenheit für eine ichbezogene Ungleichheit der musikalischen Sinngegen­ sätze. Aus dem Gesagten folgt nun ein drittes Merkmal des musikalischen Handelns, sein Charakter als Sinnkonkurrenz. Er tritt besonders dann zutage, wenn es um äußere Sinnverwirklichung geht. Schon innerlich spürt der einzelne Schüler oft sehr genau, dass viele Mitschüler andere Präferenzen haben und dass auch der Lehrer seine eigenen Sinnentscheidungen vertritt. Er bekommt die Ungleichheit der innerlichen Sinngegebenheiten aber umso empfindlicher zu spüren, je ent­ schiedener er nun auch äußerlich in seinem Sinn zu handeln beginnt. Aus seiner bloß innerlichen Stellungnahme wird dadurch in der Tat eine äußere Teilnahme im Kampf der musikalischen Sinnalternativen gegeneinander. Immer sind Schü­ ler und Lehrer in diese Sinnkonkurrenz hineingezogen, in den prinzipiell nie endenden Kampf um das musikalisch Sein-sollende, um das, was sie musikalisch wollen und nicht wollen. Das Ziel dieses Kampfes ist ganz offen Ungleichheit. Die Mittel sind meist legitim. Sie reichen von purer musikalischer Faszination über Musikkritik in allen ihren Formen, über Musiklehre bis hin zu so äußerlich erscheinenden Mitteln wie Methoden und Organisation. Ausnahmslos jedes Sinn­ ideal – die Hitparade ebenso wie jede musikalische Ästhetik – braucht diesen schöpferischen und zerstörerischen Kampf um Ungleichheit, zieht die Han­ delnden da hinein und lässt sie niemals in Ruhe. Sie werden gleichsam „be­ schlagnahmt“, müssen Opfer bringen, müssen „bezahlen“ mit Energie und anderen Lebensleistungen. Und wenn sie das nicht tun wollen, wird jedes Sinn­ ideal verkümmern. Tucholsky – im Rückblick auf seine Erfahrungen mit der Weimarer Republik – sagt das einmal lakonisch-bitter ganz am Ende seines Lebens: „Ein Ideal, für das man nicht bezahlt, kriegt man nicht. Ein Ideal, für das ein Mann oder eine Frau nicht kämpfen wollen, stirbt – das ist ein Naturgesetz. Der Rest ist familiäre Faschingsfeier im Odeon“ (Tucholsky 1978, S. 182f.). 6 WALTER HEIMANN Der Rest, heißt das, ist für ein Ideal ganz und gar ohne jede Bedeutung. Das Na­ turgesetz aber, von dem Tucholsky spricht, dass ein Ideal, für das ein Mann oder eine Frau nicht kämpfen wollen, stirbt, gilt für das musikalische Handeln von Schülern und Lehrern uneingeschränkt. Die neuen Untersuchungen von Ulrich Günther, Thomas Ott und Fred Ritzel enthalten eindrucksvolle Beobachtungen dazu (Günther u. a. 1983). Oft freilich ist der Charakter als Kampf im äußeren Handeln kaum sichtbar. Ich kenne Kollegen, die eine ganze Schule in Unordnung und auf die Beine bringen für ein Händel-Oratorium, das sie schließlich aufführen, andere für ein Konzert mit Popmusik, andere für Tänze der Renaissance. Sie glauben, man könne bei solchen Gemeinschaftsleistungen doch nicht von Sinnkonkurrenz sprechen, nicht von Kampf um Ungleichheit, aber sie täuschen sich. An ihren Schulen ist die Un­ gleichheit nur vollkommen. Der alltägliche Kampf um dieses Ziel ist vor­ ausgegangen, und er ist siegreich in einem ganz bestimmten musikalischen Sinn, wenn auch immer nur: auf Zeit. Unfriedlich, antipluralistisch, intolerant und ari­ stokratisch ist Musik also immer da, wo sie als praktisches Handeln betrieben wird, und je leidenschaftlicher dies geschieht, desto ausgeprägter. Sie zeigt diese Charakterzüge immer dort, wo die gegensätzlichen musikalischen Sinnwelten um Geltung ringen, um die knappen Überlebenschancen des je eigenen Sinns rivalisieren, wo sie gegeneinander kämpfen um Sinnverwirklichung und Sinner­ füllung. II. Der Charakter des musikalischen Handelns als partikulare Sinnentscheidung und als Kampf der Sinnalternativen gegeneinander bedeutet eine tiefe innere Spannung gegenüber den Realitäten der Schule. Das Normale ist hier das Denken und Sprechen, und als die leitenden Prinzipien gelten hier etwa: Gleichheit der Sinnalternativen, ihre Pluralität, Toleranz und Ausgewogenheit der Standpunkte, kritische Distanz und Unabhängigkeit, Logik und methodische Kontrolle, ja so­ gar das Ideal der Werturteilsfreiheit haben hier einen bestimmten Ort. Wie kann in einer solchen Schule das musikalische Handeln noch sinnvoll betrieben werden, wenn sein ursprünglicher, „dunkler“ Charakter den Realitäten des schu­ lischen Alltags so grundsätzlich widerspricht? Den Tatsachen nach überlebt Mu­ sik in dieser Institution zunächst in sehr vielen didaktischen Überformungen als Grundlage und Objekt für handlungsnahes Denken und Sprechen. Davon soll hier nicht die Rede sein. Daneben aber lebt Musik in der Schule offenkundig auch in ihrem ursprünglichen Charakter als partikulare Sinnkonkurrenz, nicht etwa, weil Lehrer und Schüler wüssten, wie dieser Charakter der Musik mit dem Charakter M USIKALISCHES H ANDELN ALS DIDAKTISCHES P ROBLEM 7 von Schule zu vereinbaren wäre, sondern weil sie ihn einfach in die Schule hin­ eintragen, ohne viel nach den gegenläufigen Kräften zu fragen. Denn sie kennen das musikalische Handeln in seinem ursprünglichen Sinn aus ihrer Freizeit, aus ihrer musikalischen „Lebenswelt“ als Hörer oder als Musiker. Sie wissen, dass es dabei immer um partikulare Sinnverwirklichung geht, um Sinnkonkurrenz mit allem, was dazugehört, um Kampf also mit der Hoffnung auf Sinnerfüllung und mit der Furcht vor Sinnzerstörung. Für viele Lehrer ist es deshalb ganz natürlich, auch in der Schule diesen zukunftsoffenen Wettstreit anzustiften. Und sie kämp­ fen auch hier ganz offen und sinnhaft sehr entschieden für ihre musikalischen Ideale. Umgekehrt will auch der Schüler die Sinnkonkurrenz fortsetzen, die er aus seiner Freizeit kennt, und tut dies im Unterricht zumindest nach zwei Seiten hin: sowohl mit seinen Mitschülern als auch mit dem Lehrer. Neue musikalische Sinnangebote – wie etwa das Händel-Oratorium oder das Schlager-Arrangement im Unterricht – nimmt er entweder auf, oder er wehrt sich dagegen, etwa mit dem höchst wirksamen Mittel des Boykotts oder vielleicht auch nur mit Ironie und amüsiertem Geschmunzel. Schon allein seine äußere Passivität kann für den Lehrer in bestimmten Situationen sinnhaft ein geradezu zerstörerisches Handeln sein. Es gibt viele Kollegen, die das, was sie als Musiker sind, deshalb auf ihre Schüler überhaupt nicht mehr übertragen wollen, die aufgehört haben, für ihre Sinnpräferenzen zu kämpfen. „Das ist mir zu schade“, sagen sie, und sie meinen, dass ihnen das Risiko der Sinnkonkurrenz mit den Schülern zu hoch ist. Sie wissen wahrscheinlich, dass eine verlorene Sinnkonkurrenz durchaus einen Ernstfallcharakter hat und im Grunde Sinnvernichtung bedeuten kann. Im all­ täglichen Kampfgeschehen des Musikunterrichts signalisieren sie mit dieser Haltung das, was Hans-Christian Schmidt als „Erschöpfungszustand der Lehrer“ (Schmidt 1978, S. 4) diagnostiziert: „Und dass einem Lehrer, der nach dem ach­ ten 'Freischütz'-Versuch zum achten Male amüsiertes Geschmunzel erntet, dieser 'Freischütz' dann mit Fug und Recht (pardon) zum Hals raushängt, kann nur der nicht verstehen, der eine Schulstube von innen nicht kennt“ (ebd.). Die meisten aber kennen das und wissen einerseits, was es bedeutet, wenn die Schüler eine Sinnkonkurrenz sehr weitgehend gewinnen, andererseits, was es für sie als Lehrer bedeutet, wenn es ihnen einmal gelingt, den Schüler für ihre mu­ sikalische Sache wirklich zu gewinnen. Die bloße Tatsache der Sinnkonkurrenz ist so unübersehbar und ihre Beobach­ tung so allgemein, dass wohl kaum jemand davon nichts weiß und nichts ver­ steht. Zum Problem wird sie uns im folgenden nun aber dadurch, dass die Lehrer sie in verschiedener Weise beurteilen und ebenso verschieden in sie eingreifen, um sie praktisch zu bewältigen. In der Musikdidaktik haben sich dazu traditionell zwei Standpunkte herausgebildet, die objektive und die subjektive Wertlehre. Beide lehren gegenüber der musikalischen Sinnkonkurrenz als Tatsache eine je 8 WALTER HEIMANN verschiedene Einstellung. Auch das kann nur angedeutet, nicht im einzelnen aus­ geführt werden. Nach Auffassung der objektiven Wertlehre liegt der Sinn einer Musik in ihrer on­ tologischen Struktur, die als Idee erahnt und in philosophischer Explikation erfasst werden kann. Ihr Sinn ist hier also vorgegeben oder ethisch „aufgegeben“, und zwar in Ideen, die als objektive Wahrheit gelten, als Resonanz der ontologi­ schen Sinnstrukturen oder als deren Voraus-Scheinen. Folglich entspricht der Sinn eines konkreten musikalischen Handelns genau dem Maß, in welchem es sich diesen „objektiven“ Sinnstrukturen anzunähern vermag. Zwar belässt die ob­ jektive Wertlehre dem einzelnen durchaus die Freiheit der Entscheidung. Aber diese Entscheidung ist hier eine Wahl zwischen Wahrheit und Unwahrheit, zwi­ schen Scheitern und Gelingen, eine Entscheidung also zwischen den Mächten des Lichts und der Finsternis. So kann es vom Standpunkt dieser Lehre aus auch keinen Zweifel darüber geben, wie der Lehrer in die allgegenwärtige Sinnkon­ kurrenz praktisch einzugreifen hat. Er soll, so lehrt sie, dem Kampf der Sinn­ gegensätze jene Richtung geben, die auf das Wesentliche in der Musik hinführt, auf ihren „objektiven“ Sinn. Zwar muss der Lehrer, so lehrt sie weiter, immer von den subjektiven Gegebenheiten ausgehen, also von den Schülern und ihrem subjektiven Bewusstsein. Er soll aber, wie z. B. Adorno es ausdrückt, „zugleich trachten, jene auf ihr objektives Ziel hinzubewegen“ (Adorno 1964, S. 106). Für uns wichtig an der objektiven Wertlehre ist besonders die Tatsache, dass Kunst und Wissenschaft, Handeln und Erkennen in ihren letzten Zielen hier noch keine völlig getrennten Wege gehen, weil beide sich gleichermaßen an einem „objek­ tiven“ Wahrheitsbegriff orientieren. Wo schon künstlerisches Handeln sich an „objektiver“ Wahrheit orientiert, ist auch für Wissenschaft kein prinzipiell anderes Ziel denkbar. Die subjektive Wertlehre geht von anderen Prämissen aus. Für sie ist die musika­ lische Kultur nicht von „objektiven“ Sinnstrukturen geprägt, sondern von der Souveränität subjektiver Entscheidungen, deren Gesamtheit die sinnhafte Ursa­ che ist für den „Gang der Kultur“, Für diese Lehre ist Musik, kurz gesagt, die Summe dessen, was die Menschen davon halten, die Summe also aller sub­ jektiven, ganz partikularen Sinn- und Bedeutungszusammenhänge, die der ein­ zelne der Musik zuordnet. Das Unterscheidungsmerkmal gegenüber der objek­ tiven Wertlehre ist hier vor allem der rein empirische Sinn- und Wertbegriff. Dort sind die Werte Seinsgegebenheiten mit ethischem Gehalt. Hier entscheidet allein der Handelnde darüber, was ihm Werte sind. Zwar kann er selbst den sub­ jektiv gemeinten Sinn kaum jemals mit eigenen Worten benennen. In seinen Prä­ ferenzen aber kommt doch recht genau zum Ausdruck, dass er eine klare Vor­ stellung darüber hat, ob eine Musik für ihn einen Sinn hat oder nicht, oft auch darüber, ob dieser Sinn für ihn größer ist oder kleiner im Vergleich zu einer M USIKALISCHES H ANDELN ALS DIDAKTISCHES P ROBLEM 9 anderen Musik. So entstehen die Werte hier durch innere Vorgänge im Subjekt, durch Vergleich von Sinnalternativen, durch Abwägen mit subjektiven Maßein­ heiten und Gewichten im Rahmen der je verschiedenen Freiheitsgrade des ein­ zelnen. Für den Lehrer hat die subjektive Wertlehre allerdings ein gewaltiges Problem geschaffen. Denn anders als die objektive Wertlehre beantwortet und „verant­ wortet“ sie die Sinnfrage des musikalischen Handelns nicht. Weder gibt sie an, in welche Richtung der Kampf der Sinngegensätze allgemein entschieden werden muss, noch äußert sie sich dazu, wie besonders der Lehrer darin eingreifen soll durch sein Handeln im Unterricht. Auch die empirische Forschung, die auf der subjektiven Wertlehre gründet, kann sich dazu nicht äußern, weil die Sinnfrage den Bereich ihrer Zuständigkeiten transzendiert. Auch sie überlässt – besonders durch das Postulat der Werturteilsfreiheit – die Sinnentscheidung und Sinnver­ antwortung ganz konsequent dem handelnden Subjekt, also dem Lehrer bzw. dem Schüler und schafft damit die empfindliche Distanz zwischen ihrer empirischen Arbeit, wo Sachverhalte geklärt werden, und dem Musikunterricht, wo musika­ lisch gehandelt werden muss. Wenn der Lehrer den Sicherheiten der objektiven Wertlehre misstraut, steht er also erst einmal allein vor der Frage, wie er in die musikalische Sinnkonkurrenz eingreifen soll. Allerdings kann ihm die Wissen­ schaft zur Beantwortung dieser Frage eine wichtige Hilfe geben und ihm dadurch einen vielleicht entscheidenden Dienst erweisen. Sie kann ihm Klarheit darüber verschaffen, dass er im Musikunterricht immer vor zwei völlig heteronomen Handlungsproblemen steht. Immer nämlich handelt es sich hier entweder um Wertübertragung oder um Wertunterstützung. Beide Handlungstypen prägen der Sinnkonkurrenz einen jeweils ganz verschiedenen Charakter auf. a) Wertübertragung Nach seiner Tradition ist Musikunterricht im gelungenen Fall immer musika­ lische Wertübertragung vom Lehrer auf den Schüler. Gelingen kann dies aller­ dings nur dann, wenn der Lehrer selbst ein Musiker im „ursprünglichen“ Sinn ist, ein musikalisch entschiedenes Wertbewusstsein also wirklich hat. Nur dann, wenn ein musikalischer Wert durch seine Person glaubwürdig ist, kann er anfan­ gen, musikalisch zu wirken, kann er jene Faszination und Überzeugungskraft aufbringen, die immer notwendig ist, um Schüler sinnhaft in Bewegung zu brin­ gen auf das hin, was er mit ihnen erreichen will. Wenn seine Person seine musi­ kalische Lehre nicht legitimiert, wenn sie sie nicht ausweist, sagt Hartmut von Hentig einmal, „dann kann er lehren, was er will – es wird nichts bringen“ (Hopf/Nykrin 1978, S. 11). Dabei ist Wertübertragung als Handlungstypus natür­ lich ganz unabhängig vom Stil einer Musik. Wertübertragung wird nicht nur von dem Lehrer geleistet, der zum Musikleben der Schüler als „Kontrastkonkurrent“ (Antholz) auftritt, sondern ebenso vom Rockmusik-Kollegen, der zwar in der 10 WALTER HEIMANN gleichen musikalischen Idiomatik lebt wie die Schülermehrheit, der aber in­ nerhalb dieser Idiomatik ein differenziertes Wertbewusstsein kennt und die Über­ zeugung lehrt, dass man auch hier – wie überall – gute und schlechte Musik ma­ chen kann. Immer ist Wertübertragung ein asymmetrischer Eingriff in die Sinnkonkurrenz, ein einseitiger Eingriff also von Seiten des Lehrers als Musiker. Ein solches Han­ deln ist auch immer sinnhaft sehr entschieden, konkurriert offen mit allem, was sich ihm praktisch entgegenstellt und verläuft immer in Richtung der Musiker­ natur des Lehrers. Alles musikalische Handeln in der Schule lebt von diesen Mu­ sikernaturen, die vorangehen, ihre Fronten gegen die normalen Widerstände von Schulleitung und Schülern vorantreiben und damit die eigene Sinnentscheidung als Musiker praktisch durchsetzen. Dabei begegnet der Lehrer dem Schüler immer „fordernd“, nicht nur in dem Sinn, dass er ein bestimmtes äußeres Han­ deln verlangt, sondern in der sehr viel weitergehenden Erwartung, dass sein in­ neres Wertbewusstsein sich als persönliches Engagement auf den Schüler über­ trägt. Ich nenne dieses Handeln mit dem Ziel der Wertübertragung (nach Fröbel) daher: „fordernde Musikerziehung“. Ist der Unterricht weiter nichts als fordernde Musikerziehung, dann ist er in einem uralten Sinn „Musiklehre“, worin der Schüler immer nur sehr einseitig be­ stimmt ist als Objekt für die sinnhaften Forderungen des Lehrers. Dem entgegen oder zur Seite steht seit langem das praktisch-pädagogische Postulat einer natür­ lichen Gegenseitigkeit im Verhältnis der Unterrichtspartner. Ebenso nämlich wie der Lehrer seine musikalischen Werte hat und sie als Forderung an den Schüler heranträgt, so bringt auch der Schüler seine musikalischen Werte in die Schule mit und trägt sie an den Lehrer heran. Und damit ist für den Lehrer die zweite wichtige Aufgabe bezeichnet, die Wertunterstützung. b) Wertunterstützung Sie ist ein Handlungstypus, der der allgegenwärtigen Sinnkonkurrenz einen ganz anderen Charakter und eine ganz andere Richtung gibt. Sie ist auch etwas sehr Seltenes, vielleicht schon deshalb, weil sie aus einer doppelten Leistung des Leh­ rers besteht: er muss das kindliche oder jugendliche Musikhandeln in seinem subjektiv gemeinten Sinn erstens beachten, d. h. er muss diesen verborgenen Sinn des Handelns erst einmal aufspüren, entdecken, begreifen und verstehen. Zweitens muss er diesem Sinnzusammenhang nachgehen können durch Verwirk­ lichung mit den Mitteln der Schule. Beides, einen fremden Sinn beachten und einem fremden Sinn nachgehen, ist sehr schwer. Ich nenne einen solchen Unter­ richt (wiederum nach Fröbel): „beachtend nachgehende Musikerziehung“. Die erste und alles entscheidende Frage ist hier: Worin besteht im Einzelfall der Sinn des Schülerhandelns? Die Schüler selbst können wir danach nicht fragen. M USIKALISCHES H ANDELN ALS DIDAKTISCHES P ROBLEM 11 Sie selbst wissen immer nur, was sie konkret wollen, was sie hören, singen, spie­ len möchten. Selten oder nie wissen sie, was das sinnhaft für sie bedeutet, an welchem subjektiven Sinn sich ihr konkretes Tun tatsächlich orientiert, und ob dieser Sinn unter schulischen Bedingungen überhaupt erreichbar ist. Das kann nur der beobachtende Lehrer wissen. Aber er muss es auch wissen, denn nur um diesen subjektiv gemeinten Sinn geht es bei nachgehender Erziehung, nicht etwa um irgend eine bestimmte musikalische Idiomatik. Ich bin deshalb ein wenig skeptisch, ob mit dem Stichwort „ Pop & Rock“ schon sehr viel von diesem Pro­ blem der „ beachtend nachgehenden Musikerziehung“ gelöst ist. Das Singen von alten und neuen Hits kann zwar durchaus ein Schritt in diese Richtung sein. Aber ebenso kann es – wie jedes andere Singen auch – unmittelbar zu „fordernder“ Musikerziehung werden, ja es kann sogar, wie die Erfahrung lehrt, Wert­ vernichtung in ihrer schlimmsten Form bedeuten, wenn bestimmte Schulsitua­ tionen und bestimmte Gegebenheiten darin in diese Richtung drängen und ihre sinnzerstörerische Wirkung entfalten. Welche Interessen Kinder und Jugendliche mit ihrem musikalischen Handeln verfolgen und welche sinnhaften Folgen es für sie hat, erscheint allerdings auch theoretisch nur erst in Ansätzen geklärt. Wohl handelt es sich in der Mehrheit der Fälle um einen interaktionalen Sinn noch weit außerhalb der musikimmanenten Sinnzusammenhänge. Und es ist gewiss erst noch ein Zufallsergebnis, wenn im Blick auf diese Sinnzusammenhänge nachgehende Musikerziehung hier und da wirklich einmal gelingt (ein Beispiel habe ich in der Festschrift für Ulrich Gün­ ther erläutert; Ritzel/Stroh 1984, S. 134-145). Jedenfalls muss der Lehrer im Ver­ gleich zu den Schülern immer mehr wissen, als sie selbst über den latenten Sinn ihres musikalischen Tuns. Und jedenfalls ist dieser verborgene Sinn nicht durch einfache Formalbefragung oder gar durch Abstimmung in der Klasse zu errei­ chen, sondern nur indirekt, durch leidenschaftlich engagierte, gleichsam „mit­ leidenschaftliche“ Beachtung und Beobachtung der Schüler durch den Lehrer, ergänzt durch den kollegialen und durch den wissenschaftlichen Diskurs. So gibt es immer diese beiden heteronomen Handlungsprobleme im Musikun­ terricht: Wertübertragung und Wertunterstützung, die als Sinnmöglichkeiten des Musiklehrers dem Handeln eine je verschiedene Richtung geben. Der Lehrer muss sich entscheiden, ob er – wie einst der Rattenfänger von Hameln – die Kin­ der wegführen will in ein anderes Land, in Sinnzusammenhänge also, die nur er selber kennt, oder ob er die Kinder die Richtung ihres Gehens selbst bestimmen lassen will – wobei er als Lehrer nicht etwa nur stehen bleibt und zuschaut, son­ dern die doppelte Schwierigkeit auf sich nimmt, gleichsam rückwärts vor ihnen herzugehen, um ihnen den nötigen Raum zu schaffen für das, was sich aus ihnen herausentwickeln will. Walter Kempowski, der Lehrer und Schriftsteller, meint, dass „Kindergartentanten“ das am besten könnten: 12 WALTER HEIMANN „Zwei Arten von Lehrern gibt es, Kindergartentanten und Rattenfänger, jeder muss sich entscheiden, was er sein will, ob er die Kinder betreuen will, wie sie es von Natur aus brauchen, ob er also wie die Kindergartentante rückwärts vor ih­ nen her gehen will – oder eben wie der Rattenfänger mit der Flöte“ (Neumann 1980, S. 7). Die zu Beginn gestellte Frage, wie soll der Musiklehrer in die Sinnkonkurrenz eingreifen, ist damit natürlich nicht eindeutig beantwortet – außer durch den Nachweis der Handlungsalternativen. Ich selbst allerdings stelle die Alternativen immer auch in die gleiche Rangfolge wie Fröbel im 19. Jahrhundert, wonach die beachtend nachgehende Erziehung immer die praktisch wichtigste Aufgabe ist. Literatur Aebli, Hans: Denken, das Ordnen des Tuns, Bd. 1, Stuttgart 1980 (Klett) Adorno, Theodor W.: Dissonanzen. Musik der verwalteten Welt, Göttingen 4. Aufl. 1969 (Vandenhoeck & Ruprecht) Günther, Ulrich / Ott, Thomas / Ritzel, Fred: Musikunterricht 5-11, Weinheim und Basel 1983 (Beltz) Hopf, Helmuth / Nykrin, Rudolf: Interview mit Hartmut von Hentig, ZfMP 1978, Heft 6 Neumann, Michael: Walter Kempowski, der Schulmeister, Braunschweig 1980 (Westermann) Richter, Christoph: Musik als Spiel, Wolfenbüttel 1975 (Möseler) Ritzel, Fred / Stroh, Wolfgang M. (Hg.): Musikpädagogische Konzeptionen und Schulalltag, Wilhelmshaven 1984 (Heinrichshofen) Schmidt, Hans-Christian: Rockmusik (Opus musicum), Didaktischer Kom­ mentar, Köln 1978 (Volk) Tucholsky, Kurt: Die Q-Tagebücher, Reinbek bei Hamburg 1978 (Rowohlt) We­ ber, Max: Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftstheorie, Tübingen 4. Aufl. 1973 (J. G. B. Mohr [Paul Siebeck])