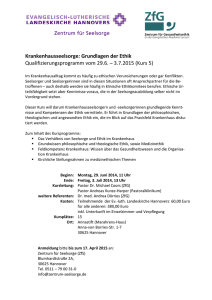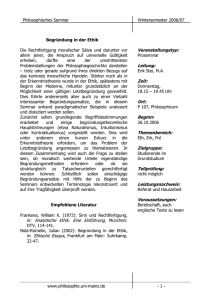Eine Ethik der Affektivitåt: Die Lebensphånomenologie Michel Henrys
Werbung

seul_13 (48403) / p. 1 Frdric Seyler Eine Ethik der Affektivitt: Die Lebensphnomenologie Michel Henrys VERLAG KARL ALBER A seul_13 (48403) / p. 2 Beinhaltet die Lebensphnomenologie Michel Henrys eine Ethik und, wenn dies der Fall ist, welches sind ihre Grundzge? Das vorliegende Buch will dieser Fragestellung nachgehen und den von Henry nur skizzierten ethischen Ansatz systematisch untersuchen. Die henrysche Alternative zwischen Barbarei und Kultur, sowie die zentrale Stellung des Lebensbegriffs als immanenter Affektivitt bieten sich als Leitfaden an, um die Mglichkeit und den Sinn einer Ethik der Affektivitt zu erfassen. Doch wie kann ein ethischer Diskurs ber das immanente und somit vorintentionale Leben berhaupt stattfinden? Der im letzten Teil der Untersuchung entwickelte Begriff der Quasi-Performativität soll dieses Problem lsen helfen und zugleich aufzeigen, dass die Lebensphnomenologie als solche eine ethische Praxis darstellt. Zum Autor: Frdric Seyler (geb. 1967 in Marburg), Dr. phil., Promotion ber die Lebensphnomenologie Michel Henrys (Universitt Metz), Lehrbeauftragter fr Philosophie an den Universitten Metz und Luxemburg; Publikationen in den Bereichen Phnomenologie und Ethik, Forschungs- und bersetzungsarbeiten zu Fichte (GEFLFParis). seul_13 (48403) / p. 3 Seele, Existenz und Leben Band 13: Frdric Seyler Eine Ethik der Affektivitt: Die Lebensphnomenologie Michel Henrys Verlag Karl Alber Freiburg / Mnchen seul_13 (48403) / p. 4 Seele, Existenz und Leben Herausgegeben von Gnter Funke und Rolf Khn in Zusammenarbeit mit dem Institut fr Existenzanalyse und Lebensphnomenologie Berlin (www.guenterfunkeberlin.de) sowie dem Forschungskreis Lebensphnomenologie, Freiburg i. Br. (www.lebensphaenomenologie.de) Gedruckt mit freundlicher Untersttzung der Erzdizese Freiburg Originalausgabe VERLAG KARL ALBER in der Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2010 Alle Rechte vorbehalten www.verlag-alber.de Satz: SatzWeise, Fhren Druck und Bindung: AZ Druck und Datentechnik, Kempten Gedruckt auf alterungsbestndigem Papier (surefrei) Printed on acid-free paper Printed in Germany ISBN 978-3-495-48403-6 Inhalt VORWORT 7 EINLEITUNG: ETHIK UND PATHOS 9 I. DER GEGENSATZ BARBAREI/KULTUR ALS LEITFADEN EINER ETHIK DER AFFEKTIVITÄT 1. Kulturkritik am Beispiel der Technik 2. „Praktiken der Barbarei“ und „Praxis“ der Kultur 3. Die lebensphänomenologische Interpretation der christlichen Ethik II. LEBENSPHÄNOMENOLOGISCHE GRUNDLAGEN DER ETHIK 31 35 40 66 89 1. Gewissheit als Paradigma der Lebensphänomenologie 2. Lebendiges Tätigsein und Pathos 3. Intersubjektivität und Affektivität 91 116 134 III. DIE ETHIK DER AFFEKTIVITÄT ALS PRAXIS 151 1. Gegen-Reduktion und Quasi-Performativität im lebensphänomenologischen Diskurs 2. Die Ethik der Affektivität als Übersetzungspraxis 153 190 ZUSAMMENFASSENDE SCHLUSSBETRACHTUNG: DIE ZWEIFACHE BEDEUTUNG DER ETHIK DER AFFEKTIVITÄT 211 LITERATUR 219 5 Vorwort Während Kierkegaard die Verzweiflung als „Krankheit zum Tode“ bezeichnet, die einem Tod im Leben gleichkommt, thematisiert der französische Phänomenologe Michel Henry diesen Sachverhalt als „Vergessen“ des Lebens und seiner wesenhaften Affektivität. Doch wenn sich das Leben als Affektivität „vergisst“ bzw. selbst verneint, wird notwendig die ethische Frage nach der Bedeutung und Überwindung einer derartigen Lebensverneinung aufgeworfen. Die vorliegende Arbeit untersucht daher die Möglichkeit einer Ethik in der Lebensphänomenologie Michel Henrys, die als „Ethik der Affektivität“ bezeichnet werden kann. Dabei konnte ich mich auf Ergebnisse einer vierjährigen, an der Universität Metz unternommenen Forschung stützen und diese für deutschsprachige Leser erneut aufnehmen. Auch im französischsprachigen Raum fehlte es bis jetzt an systematischen Untersuchungen zur Ethik in der Lebensphänomenologie, was unter anderem daran liegen mag, dass Henry selbst keine allgemeine Abhandlung zu diesem Thema verfasst hat. Der Versuch, die Ethik der Affektivität zu erkunden, muss daher zunächst eine hauptsächlich „werkimmanente“ Perspektive einnehmen, bei der die ethischen Implikationen und der Ethikbegriff der Lebensphänomenologie soweit wie möglich explizit gemacht werden. Dies schließt die Problematisierung der verschiedenen Etappen keineswegs aus, begrenzt aber vorläufig die Konfrontation mit anderen ethischen Ansätzen. Erst wenn deutlich geworden ist, welche Ethik aus der Lebensphänomenologie hervorgeht, kann eine solche Diskussion stattfinden. Daraus, dass Letzterer hier nicht vorgegriffen werden soll, ergibt sich ein Vorgehen, welches die Ethik aus der Sicht der Lebensphänomenologie behandelt und entwickelt. Da sich aber zeigen lässt, dass die Lebensphänomenologie als solche, und somit auch in ihrer Gesamtheit, „ethisch“ ist, eignet sich die hier eingenommene Perspektive zugleich als Einführung in das Werk Henrys unter diesem besonderen Blickwinkel. 7 Um möglichst genaue Darstellungen und Analysen zu erlauben, wurden zahlreiche Stellen aus diesem Werk ausführlich zitiert und kommentiert bzw. mit Bezug auf eine mögliche Ethik der Affektivität problematisiert. Dabei wurde auf bestehende Übersetzungen zurückgegriffen oder, falls diese nicht vorlagen, eine eigene Übersetzung erstellt. Es ist kaum verwunderlich, wenn sich das Übersetzen von Michel Henrys Schriften als schwierig herausstellt, da sich diese bereits in ihrer französischen Originalfassung durch komplexe Ausdrucksweisen und neu geschaffene Begriffe auszeichnen. Um die Rezeption für den deutschsprachigen Leser zu erleichtern, wurde deshalb häufig der französische Ausdruck seiner Übersetzung in Klammern beigefügt. Zudem kann auf die überaus nützlichen Glossare zurückgegriffen werden, die von Rolf Kühn für seine Übersetzungen von ‚Ich bin die Wahrheit’ (dt. 1997) und ‚Inkarnation’ (dt. 2002) angefertigt wurden und die hier aus Platzgründen nicht als Anhang übernommen werden konnten. Auch die weiterführenden Konsequenzen der Lebensphänomenologie für die politische Philosophie, sowie eine vergleichende Analyse mit der ethischen Problematik beim späten Fichte, hätten den für dieses Buch vorgesehenen Rahmen gesprengt, sodass auf die detaillierte Einführung dieser Themen fast gänzlich verzichtet wurde, obwohl sich ihre Kontinuität zur Ethik der Affektivität aufzeigen lässt und somit weitere Perspektiven für die Rezeption und Diskussion der Lebensphänomenologie offen stehen. Für die freundliche Aufnahme der Arbeit in die Reihe „Seele, Existenz und Leben“ danke ich herzlich dem Verlag Alber und ganz besonders Rolf Kühn, dem dieses Buch gewidmet ist. Metz und Marburg, Sommer 2009 F.S. 8 EINLEITUNG: ETHIK UND PATHOS Ob1 die Lebensphänomenologie Michel Henrys eine Ethik impliziert und um was für eine Ethik es sich dabei handeln könnte, muss zunächst als eine offene Frage angesehen werden. Ein Blick auf die Bibliografie des Autors macht deutlich, dass Henry selbst keine explizite und systematische Behandlung der Ethik im Sinne der Lebensphänomenologie abgefasst hat. Hinzu kommt, dass auch die Sekundärliteratur bzw. die weiterführenden Analysen zur Lebensphänomenologie vonseiten anderer Autoren dieses Thema sehr selten direkt angehen (vgl. jedoch Kühn 1996; 2008; Maesschalck u. Kokoszka 1999; Audi 2005). Und doch scheint die Schlussfolgerung, die Lebensphänomenologie könne nicht zum ethischen Diskurs beitragen, falsch zu sein. Zwei Ansatzpunkte sind hier ausschlaggebend: Erstens die Tatsache, dass einige Arbeiten Henrys explizit auf die Ethik verweisen (vgl. Henry 2004b), zweitens der Eindruck, dass weit größere Teile seines Werks keineswegs als wertneutrale Ausführungen gelten können, sondern einen, wenngleich oft impliziten, axiologischen Standpunkt beinhalten und sich somit auch ein möglicher Übergang zur Ethik abzeichnet. Ich will im Folgenden diesem Eindruck nachgehen und zunächst diese vorwiegend implizite ethische Dimension der Lebensphänomenologie aufzeigen. Im Anschluss daran soll aber auch die Problematik einer Ethik im Sinne Michel Henrys aufgezeigt werden, sodass, drittens, entsprechende Lösungsperspektiven sich einführend eröffnen. 1. Die ethische Dimension der Lebensphänomenologie Dass die Lebensphänomenologie nicht auf einem wertneutralen und rein deskriptiven Standpunkt beruht, geht zunächst aus dem 1987 verfassten Essay ‚La barbarie’ (dt. 1994) hervor. Die dort unternommene Kritik der „Barbarei“ sowie die Bildung eines lebensphänomenologischen Kulturbegriffs können kaum als an sich 1 Die vorliegende Einleitung wurde als Beitrag mit dem Titel: ‚Ethik und Pathos. Perspektiven zur Ethik der Affektivität in der Phänomenologie Michel Henrys’ in Psycho-logik. Jahrbuch für Psychotherapie, Philosophie und Kultur 4 (2009) veröffentlicht. 11 indifferente Beschreibungen eines objektiven Weltgeschehens gelten, denen sich ein wissenschaftlich-neutraler Beobachter widmen würde, ohne selbst dabei Stellung zu beziehen. Schon der Terminus „Barbarei“ zielt fast notwendigerweise auf das zu Verurteilende, und der Ausdruck der „Kultur“ auf das Erstrebens- oder Verteidigenswerte. Man kann also durchaus in diesem Sinne von einem normativ-axiologischen Aspekt ausgehen, auch wenn diese Terminologie von M. Henry nicht benutzt wird und sie im theoretischen Rahmen der Lebensphänomenologie nicht unproblematisch ist, wie wir noch sehen werden. Dass jedoch eine solche Position die Priorität der phänomenologischen Wahrheitsfindung nicht beeinträchtigen muss, kann in Analogie zu Freuds ‚Unbehagen in der Kultur’ verdeutlicht werden. Auch wenn Freud sich der Formulierung eines Werturteils über die Kultur ausdrücklich enthält (Freud 1960, 189 f.) und der Ethik mit psychoanalytischer Skepsis begegnet (ebd. 188), so muss doch das, was er im letzten Absatz dieser Schrift als „Schicksalsfrage der Menschenart“ (ebd. 190) darlegt – der Kampf zwischen Eros und Todestrieb, der durch die Beherrschung der Naturkräfte zu einem Kampf auf Leben und Tod für die Menschheit wird – als eine ethisch relevante Frage angesehen werden. Die psychoanalytische Praxis selbst hätte gar keinen Sinn, wenn sie keinen Wertunterschied zwischen psychischer Gesundheit und zum Beispiel der Neurose machen würde, das heißt wenn sie sich nicht grundlegend an dem ethischen Prinzip der Lebensbejahung orientieren würde. Analog dazu schließt ‚Die Barbarei’ ebenfalls mit einer Schicksalsfrage für den „Kulturmenschen“: „Sie möchten gern diese Kultur weitervermitteln; einem jeden erlauben, das zu werden, was er ist; der unerträglichen Langeweile des technisch-medialen Universums zu entkommen, dessen Drogen, seinem monströsen Auswuchs, seiner anonymen Transzendenz. Aber dieses Universum hat die Individuen ein für allemal zum Schweigen gebracht. Kann die Welt noch durch einige von ihnen gerettet werden?“ (Henry 2004a, 247; dt. 1994, 373) Die Rettung der Kultur wird hier zur Heilsfrage der Menschheit. Doch die Frage nach dem Heil ist ihrem Wesen nach eine ethische. Und das, obwohl, ähnlich wie bei Freud, die Normativität der Ethik einer Kritik unterzogen wird: Wer die Ethik 12 als eine normative Disziplin versteht, deren Aufgabe darin besteht, das Handeln einem Prinzipienwissen unterzuordnen, wird sich Henry zufolge immer der Ironie Schopenhauers aussetzen: Der Wille bzw. das Leben2 lassen sich nicht durch an sie von außen herangetragene Prinzipien gestalten oder korrigieren, denn diese Prinzipien bestimmen nur das Erkenntnisvermögen, nicht aber den Willen selbst (ebd. 167, dt. 272 f.). Und doch bedeutet dies keine Ausgrenzung jeglicher Ethik, sondern eben nur einer solchen, die das Erkenntnisvermögen mit einer derartigen Bestimmung des Lebens beauftragt. Ist jedoch das Bestreben, das Leben nach einer Norm bzw. einem Normengeflecht zu bestimmen, nicht selbst Ausdruck des Lebens? Und wäre andererseits eine Ethik, die sich auf das „bloße Leben“ berufen würde, noch eine „Ethik“? Kann noch von einer Ethik gesprochen werden, wenn die einzige Normativität im Leben selbst liegt? Diese letzte Frage deutet darauf hin, dass die Ethik der Lebensphänomenologie, falls es eine solche geben sollte, eine „Lebensethik“ sein muss, und zwar in dem Sinne, dass sie das Leben selbst zur absoluten „Norm“ erhebt. Das wiederum impliziert, dass auf den Begriff des Lebens und seine phänomenologische Erschließung durch Henry zurückgegriffen werden muss. Die Originalität der Lebensphänomenologie besteht darin, das Leben als immanente Selbstaffektion (auto-affection immanente), als transzendentale Affektivität zu verstehen, welche somit zugleich die Grundlage jeder Phänomenalisierung bildet. Was damit gemeint ist, lässt sich konkret am Beispiel des Biologiestudenten zeigen, das Henry in ‚La barbarie’ anführt: Stellen wir uns einen Biologiestudenten beim Lernen bzw. Lesen vor, so können zunächst zwei Formen des Wissens bei dieser Handlung unterschieden werden: Das Erfassen und Erlernen idealer Bedeutungen läuft hier auf die Aneignung eines Wissens im Sinne der empirischen Wissenschaften hinaus. Diese Aneignung ist aber nur durch ein intentionales Gerichtetsein auf das vorliegende Material, zum Bei2 Zur Rezeption Schopenhauers und Freuds durch Michel Henry vgl. Henry 1985 (dt. Teilübersetzung 2005, 93–105), sowie unseren Beitrag in: Psycho-logik 3 (2008). 13 spiel das auf dem Tisch liegende Buch, möglich. Die Intentionalität des Bewusstseins, das Sehen und Schauen des Schreibtisches, des Buches, der Buchstaben und Wörter, ist somit die Bedingung, die jedes empirische Wissen notwendig begleitet. Doch worauf gründet wiederum dieses Wissen des Bewusstseins? Was ermöglicht es dem Studenten, dieses intentionale Wissen auf sich selbst zurückzuführen, das heißt zu wissen, dass er gerade sieht, liest usw., und welches Wissen ermöglicht es ihm, die damit verbundenen Handlungen auszuführen: im Buch zu blättern, eine Zeile nach der anderen mit seinen Augen zu erfassen, aufzustehen, um sich in die Cafeteria zu begeben usw.? Wie Henry unterstreicht, kann es sich hier nicht um ein Objektwissen handeln: Wäre es dies, so würde eine unüberbrückbare Kluft das handelnde Subjekt von sich selbst trennen, und es würde nie zu einer Handlung kommen. In Anlehnung an Henrys Rezeption des cartesianischen Cogito muss es sich um ein immanentes Wissen handeln, das nicht in die Intentionalität aufzulösen ist, sondern ihr zugrunde liegt. Dieses Wissen ist nach Henry das Wissen des Lebens um sich selbst (savoir de la vie). Ein Wissen, das nur dem Lebendigen zukommt und es gerade als solches auszeichnet. Das lebendige Subjekt affiziert sich kontinuierlich selbst als Sehendes, Lesendes, Aufstehendes usw. Dies ist zugleich die Bedingung dafür, dass es selbst ist und dass es etwas für es geben kann. Die immanente Selbstaffektion macht somit das Wesen des Lebens aus, sie ist identisch mit der Ipseität und transzendentale Bedingung der Phänomenalisierung. Nicht das empirische Wissen also, zum Beispiel das der Biologie, ist Wissen um das Wesen des Lebens, sondern das Leben selbst, verstanden als Affektivität, das heißt als kontinuierlicher Prozess der Selbstaffektion. Da es sich dabei nicht nur um ein Wissen des Lebens um sich selbst, sondern gleichzeitig auch um die immanente Erprobung eben dieses sich kontinuierlich wandelnden Lebens handelt, ist die Affektivität mit einem Moment der Passivität verbunden. Daher bezeichnet Henry die Affektivität auch als Pathos und ihre phänomenologische Erscheinungsweise als pathisches Erscheinen (apparaître pathétique). Was aus dieser hier nur kurz skizzierten Darstellung des Lebensbegriffs bei Henry folgt, kommt einem „Schichtenmodell“ der Phänomenalität und des damit ver14 bundenen Wissens nahe: Die pathisch-immanente Erscheinungsweise muss als grundlegend und als bedingend für die intentionaloder ekstatisch-transzendente Phänomenalität (apparaître ekstatique) gelten, und das, obwohl es sich um zwei radikal verschiedene Erscheinungsweisen handelt: Transzendent sind die intentionalen Objekte, immanent die Affektivität eines sich stetig wandelnden und dabei doch sich selbst gleichbleibenden Lebens. Und dennoch gäbe es für uns keine Transzendenz, das heißt auch keine Welt, wenn wir nicht am und im Leben wären, weil es ein „Für-uns“ nur geben kann, insofern wir uns als Lebendige selbst affizieren. Nicht das intentionale Bewusstsein ist es also, das den letzten Grund des „für uns“ Gegebenen liefert, sondern eine tiefere Schicht der Gegebenheitsweise, die das Bewusstsein selbst bedingt: die Affektivität als Wesen des Lebendigen und Subjektiven. Henrys Lebensphänomenologie radikalisiert somit den Ansatz Husserls durch eine vor-intentionale Komponente, die Husserl selbst in der Hylé angesiedelt hatte.3 Die vermeintliche Ethik der Lebensphänomenologie kann deshalb als „radikale Lebensethik“ oder auch als „Ethik der Affektivität“ bezeichnet werden. Doch inwiefern könnte Henrys Lebensbegriff eine Ethik beinhalten? Und welchen Sinn könnte die Rede vom Leben als oberster oder absoluter „Norm“ haben? Ein wesentliches Indiz dafür, dass es in der Tat eine Ethik der Lebensphänomenologie geben könnte, ist gegeben mit dem Gegensatz zwischen Barbarei und Kultur und dem zentralen Stellenwert, der diesem Gegensatz in Henrys Essay von 1987 eingeräumt wird. Die zum Teil heftige Polemik, die diese Schrift bei ihrem Erscheinen auslöste, geht einher mit der Beobachtung, M. Henry habe hier die Position eines Moralisten eingenommen (Cherlonneix 1987, 311). Henrys Kritik der Barbarei bezieht sich nicht auf das selbstverständlich verurteilte und herkömmliche Bild des Barbarischen im Sinne brutaler physischer oder psychischer Gewalt, sondern auf das wissen3 Zu diesem Begriff bei Henry und der wichtigen Diskussion mit Husserls Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins vgl. M. Henry, Phénoménologie matérielle (1990). Daher auch die Termini „phénoménologie matérielle“ oder „phénoménologie radicale“, mit welchen die Lebensphänomenologie ebenfalls bezeichnet wird. 15 schaftlich-technische Weltbild, das seinen Ursprung in der Neuzeit hat: „Wahrscheinlich zum ersten Male in der Geschichte der Menschheit klaffen Wissen und Kultur auseinander, so sehr, dass sie einander in einem gigantischen Kampf gegenüberstehen – einem Kampf auf Leben und Tod, wenn es zutrifft, dass der Triumph des Ersten das Verschwinden der Zweiten zur Folge hat.“ (Henry 2004a, 1; vgl. dt. 1994, 75 f.) Die oben erwähnte Schicksalsfrage der Menschheit wird auf eine Opposition zwischen Wissen und Kultur zugespitzt. Das Wissen, das hier von Henry anvisiert wird, ist das der modernen Wissenschaften, also ein empirisches und objektivierbares Wissen. Dieses impliziert für Henry die Ausklammerung der lebendigen Subjektivität und bereitet ihre ontologische Negation durch den Szientismus vor. Er fasst das galileische Paradigma, das zur Neubegründung der Wissenschaften führte, folgendermaßen zusammen: „Galilei erklärt, dass die Erkenntnis, der die Menschen seit jeher vertrauen, falsch und illusorisch ist. Diese Erkenntnis ist die sinnliche Erkenntnis, die uns glauben macht, die Dinge seien farbig, hätten Geruch, Geschmack und Klang, dass sie angenehm oder unangenehm seien, kurz: dass die Welt eine sinnliche sei. Während das reale Universum aus materiellen und sinnlich nicht erfassbaren Körpern besteht, die Ausdehnung, Form und Figur besitzen, was zur Folge hat, dass die Erkenntnis nicht aus den individuell verschiedenen Empfindungen, die lediglich Erscheinungen produzieren, sondern aus der rationalen Erkenntnis dieser Formen hervorgeht: Die Geometrie, so heißt das neue Wissen, das alle anderen Wissensarten ersetzt und sie zur Bedeutungslosigkeit degradiert.“ (Ebd.; dt. 1994, 79) Dieses Paradigma betrifft sowohl die Erkenntnistheorie als auch die Ontologie: Es sagt nicht nur etwas über das Verfahren, das wir anwenden müssen, um die Wirklichkeit zu erkennen, sondern auch darüber, was das eigentliche Wesen eben dieser Wirklichkeit ist. Aber was die Moderne hier eröffnet, ist nach Henry eine Wende hin zu einer fatalen Trennung zwischen Wissen und Kultur, insofern dem subjektiven Empfinden kein Platz mehr gelassen wird, es sei denn der einer Illusion, die sich mit Hilfe einer objektiven Naturerkenntnis hinreichend erklären lässt. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn das subjektive Erleben im Sinne des Materialismus auf 16 neuronale Prozesse reduziert wird. Dagegen ist Kultur gerade das, was der Potenzialität subjektiven Empfindens zur Aktualität und zur Entfaltung verhilft, ja sie besteht in diesem Akt der Entfaltung schlechthin. Unter Kultur versteht die Lebensphänomenologie „die Gesamtheit aller pathischen Antworten, die das Leben erprobt, um dem immensen Verlangen, das es durchzieht, gerecht zu werden. Solche Antworten kann es nur in sich selbst finden, in einer Sensibilität, die mehr, die intensiver empfinden will“ (ebd. 3; dt. 1994, 81). Doch, so könnte man einwenden, ist nicht die Wissenschaft selbst eine Entfaltung menschlicher und daher auch subjektiver Potenzialitäten und somit ein unbestreitbarer Teil der Kultur? Einführend ist hier hervorzuheben, dass Henrys Kritik nicht die Legitimität der Wissenschaften bestreitet, mit Hilfe möglichst objektiver Methoden zu allgemeingültigen empirischen Ergebnissen zu kommen, sondern die Rechtfertigung der daraus entstehenden szientistischen Ideologie, welche eine philosophische Aussage über das Wesen der Wirklichkeit trifft und diese auf das ObjektivMessbare reduziert. Paradoxerweise findet aber gerade auch diese ideologische Reduktion ihren Ursprung in der lebendigen Subjektivität und ist ein möglicher Ausdruck derselben; denn es gibt schließlich nichts Menschliches, was nicht darin seinen Ursprung fände. Bemerkenswert ist allerdings, dass es sich in diesem Falle um eine Praxis handelt, in der das subjektive Leben vor sich selbst zu fliehen versucht: „eine Lebensform, die sich gegen das Leben richtet, die ihm jeglichen Wert abstreitet und bis zu ihrer Existenz bestreitet. Ein solches Leben, das sich selbst negiert, die Selbstverneinung des Lebens, dies ist das entscheidende Ereignis, das die moderne Kultur als wissenschaftliche Kultur bestimmt“ (ebd. 113; dt. 1994, 204, Hvh. M. H.). Diese Selbstverneinung des Lebens bzw. der Kultur ist es, die Henry mit dem Terminus „Barbarei“ umschreibt. Diese einführenden Betrachtungen zum lebensphänomenologischen Begriff der Kultur verstärken die Annahme einer ethischen Dimension im Werk Michel Henrys. Die Kritik der Moderne und des Szientismus kann nicht als wertneutral angesehen werden und geht daher notwendig mit einer zumindest impliziten Normativität einher. Es bleibt allerdings die Frage, wie denn diese „kritische 17 Normativität“ positiv und explizit zu formulieren sei. Darin würde eine Aufgabe einer „Ethik der Affektivität“ bestehen – eine Aufgabe, die nur gelöst werden kann, indem der gesamte Diskurs der Lebensphänomenologie berücksichtigt wird, weil erst dann der Sinn dieser vermeintlichen Ethik systematisch herausgearbeitet werden kann. Auch lassen die oben gemachten Angaben die Hypothese zu, die radikale Lebensethik Henrys sei gleichbedeutend mit einer „Ethik der Kultur“; denn die Kultur wird als Intensivierung und Potenzierung des Lebens verstanden, Barbarei hingegen als die Selbstverneinung desselben. Schließlich muss dem Einspruch nachgegangen werden, die Alternative Kultur/Barbarei sei nur auf eine und dazu recht polemische Schrift Henrys beschränkt und somit kaum für eine systematische Ausarbeitung einer Ethik im Sinne der Lebensphänomenologie geeignet. Die Ethik der Affektivität auch als eine „Ethik der Kultur“ bezeichnen zu können, würde erfordern, die Kontinuität dieser Alternative im Gesamtwerk Henrys aufzuzeigen. Die Chancen für eine Bestätigung dieser Hypothese scheinen jedoch gut zu stehen, wenn man bedenkt, dass Henry im Vorwort zur zweiten Auflage von ‚La barbarie’, also ca. fünfzehn Jahre nach dem ersten Erscheinen der Schrift, deren zentrale Thesen erneut bekräftigt hat und dass, zweitens, Henrys späte Werke, darunter das 1996 verfasste ‚Ich bin die Wahrheit’ (dt. 1997), wesentliche Aspekte der Opposition Kultur/Barbarei wieder aufgreifen. 2. Die Problematik einer Ethik im Rahmen der Lebensphänomenologie Die Barbarei, verstanden als Selbstverneinung des Lebens, wird von M. Henry häufig in die Nähe der kierkegaardschen „Verzweiflung“ gerückt. Somit entspricht die Alternative zwischen Barbarei und Kultur der zwischen Verzweiflung (désespoir) und Seligkeit (béatitude); denn auch hier handelt es sich um ein Leben, das sich entweder gegen sich selbst kehrt oder aber in sich selbst bzw. in seinem absoluten Grunde ruht und zu einer Potenzierung gelangt. Paradoxerweise ist dann aber die Verzweiflung bzw. die Barbarei 18 nicht nur Ausdruck einer Lebensverneinung, sondern Ausdruck des Lebens selbst. Sie stehen dem Leben nicht gegenüber, befinden sich nicht außerhalb desselben – denn ein „Außerhalb“ des Lebens kann es gar nicht geben, solange dieses als Grund jeglicher Phänomenalisierung gilt –, sondern sie sind im Leben, das heißt bestehen in der Aktualisierung einer prinzipiell immer gegebenen Möglichkeit des Lebens. Daher ergibt sich die Schwierigkeit, das Leben als absolute „Norm“ zu bezeichnen: Da Barbarei und Kultur gleichermaßen Ausdruck des Lebens sind, kann dieses anscheinend nicht zu einem (absoluten) Wertmaßstab gemacht werden, von dem aus über diese Formen der Affektivität verschieden geurteilt werden könnte. Die Tatsache, dass sowohl Kierkegaard als auch Henry die Seligkeit notwendig mit der Verzweiflung verbinden, erschwert um ein Weiteres eine solche Ausdifferenzierung. Eine erste Schwierigkeit für eine „Ethik der Affektivität“ besteht also darin, einerseits die Affektivität als solche zum letztmöglichen ethischen Grund zu erheben, andererseits aber in der Lage zu sein, zwischen lebensverneinenden und lebensbejahenden Formen eben dieser Affektivität ethisch differenzieren zu können. Eine zweite Schwierigkeit betrifft den Zugang zur Affektivität im Sinne der Lebensphänomenologie. Einerseits kann dieser Zugang gar nicht problematisch sein, wenn die Affektivität gerade als immanentes Erscheinen und zudem als Bedingung für das Erscheinen in der Transzendenz verstanden wird. So kann zum Beispiel die Frage nach der Wahrnehmung der Affektivität nur als ein Missverständnis gedeutet werden, insofern sie die Originalität des affektiven Erscheinens verkennt und die Affektivität dem Erscheinungsmodus der Wahrnehmung, der Intentionalität, unterordnet. Wer die Affektivität als vorintentionale Grundlage jeglicher Intentionalität und als Selbstgebung bzw. Selbsterscheinen des Lebens ernst nimmt, kann die Frage nach dem Zugang zur Affektivität gar nicht stellen: Die lebendige Subjektivität ist schon immer „in“ der Affektivität, ja sie ist Affektivität, Leben das sich selbst erscheint bzw. affiziert. Auf der anderen Seite jedoch zeichnen sich Barbarei und Verzweiflung gerade dadurch aus, dass sie, obgleich sie notwendig Formen des Werdens der Affektivität sind, diese zugleich verneinen und aus ihr zu fliehen suchen. So mündet die Verzweif19 lung in eine Negation des Wesens der Affektivität als Pathos, als Selbstaffizierung: Es ist die Unerträglichkeit des Selbstseins, die den Verzweifelten zur Flucht aus dem Leben, aus dem Selbstsein bewegt. Die Unmöglichkeit einer solchen Flucht steigert diese Unerträglichkeit weiter bis hin zum Nihilismus, den Henry in der Objektivierung des Lebendigen am Werke sieht. Paradox ist auch hier, dass, streng genommen, die Flucht aus dem Leben und aus der Affektivität zwar ausweglos ist, sie aber trotzdem mit einem „Verlust“ an Leben einhergeht. Wie Henrys Ausführungen zu einer Philosophie des Christentums deutlich machen, ist die Duplizität des Erscheinens verbunden mit einem „Vergessen“ der Affektivität (oubli de la vie) zugunsten des in der Transzendenz der Welt Erscheinenden. Zwar werden wir im Leben geboren, aber diese transzendentale Geburt (naissance transcendantale) wird zugunsten des eigenen Handlungsvermögens in der Welt in den „Hintergrund“ gedrängt, was zu der Illusion des Ego führt, es sei die eigentliche Quelle seines Vermögens – und nicht das (absolute) Leben in ihm. Mit anderen Worten: Es gibt eine wesensbedingte „Diskretion“ des affektiven Erscheinens, das heißt ein wesensbedingtes In-denHintergrund-Treten der Affektivität, die dem vordergründigen „Ich kann“ zur Aktualisierung der scheinbar eigenen Potenzialitäten verhilft. Dieses Sich-selbst-vergessen-Machen des Lebens kommt dem Fluchtbestreben der Verzweiflung entgegen, das diese Tendenz verstärkt bis hin zur Negation des Lebendigen. Barbarei und Verzweiflung können das Leben nicht verlassen, und dennoch entfalten sie ein Potenzial an Zerstörung und Entfremdung (zum Begriff der Entfremdung vgl. Henry 1976b, 70–137), entsprechen einer Verminderung des Begehrens, gerade weil sich in diesem Falle das Leben gegen sich selbst kehrt. Wenn es nach Henry ein Merkmal der Barbarei ist, das Vergessen des Lebens ideologisch und, wichtiger noch, praktisch zu untermauern und das Leben als Affektivität als nicht-existent zu deklarieren, besteht dann nicht die ethisch-politische Aufforderung der Lebensphänomenologie darin, an das Leben zu „erinnern“? Doch: Wie kann an „etwas“ erinnert werden, was sich seinem Wesen nach der Intentionalität der Erinnerung entzieht? An diesem Punkt angelangt, erweist sich die Fra20 ge nach dem erneuten Zugang zur Affektivität als problematisch für eine Ethik der Affektivität, denn dem Vergessen des Lebens steht ein Erinnern gegenüber, das im Rahmen der Lebensphänomenologie diesen Zugang retentional nicht gewährleisten kann. Dieses Problem zeigt des Weiteren eine interessante Parallele auf, die zwischen erkenntnistheoretischen und ethischen Fragen in Bezug auf die Affektivität besteht. Erkenntnistheoretisch ist die Frage von Belang, wie ein Diskurs wie jener der Lebensphänomenologie überhaupt möglich ist. Denn wenn die Affektivität sich durch Immanenz auszeichnet, dann bleibt zu fragen, wie die Idealitäten eines Diskurses diese erfassen und wiedergeben können. Als Grundlage der Intentionalität bleibt die transzendentale Affektivität selbst vor-intentional. Als eigenständiges und originäres Erscheinen scheint sie sich der intentionalen Wahrnehmung und dem Erfassen durch ideelle Bedeutungszusammenhänge notwendig zu entziehen. Anders formuliert: Die Immanenz der Affektivität kann als nicht-intentionale Gegebenheitsweise nicht in einer ihr fremden, das heißt intentionalen Gegebenheitsweise als solcher erscheinen. Doch wenn die Sprache und der Text nicht das Leben sind, so ist doch ein Diskurs über das Leben möglich. Die Lebensphänomenologie wäre dann eine indirekte Erfassung der Affektivität, ein Sprechen „über“ die Affektivität, das nicht beansprucht, das an sich Unsichtbare in den Status des Sichtbaren und Beschreibbaren zu erheben, sondern gerade in der phänomenologischen Grenzziehung zwischen dem Erscheinen der Affektivität und dem der Transzendenz besteht. Doch auch diese Grenzziehung benötigt einen Zugang zur Affektivität, muss ihn beanspruchen, damit Rede und Text dem Wahrheitsanspruch genügen. Michel Henry hat diese Frage nach dem Wahrheitsanspruch der Lebensphänomenologie und dessen Überprüfbarkeit nicht umgangen. Im Gegenteil, sein vorletztes Werk ‚Incarnation’ (2000; dt. 2002a) hat sie explizit gestellt. Die Problemstellung ist folgende: Wenn das Leben als Affektivität notwendige Bedingung für das Schaffen ideeller Bedeutungszusammenhänge ist, dann ist es das ohne Rücksicht auf den Wahrheitsgehalt dieser Zusammenhänge: Konkret bedeutet dies, dass zum Beispiel philosophische Aussagen und Argumentationen im21 mer Ausdruck des Lebens sind, das heißt in der lebendigen Affektivität ihren letzten Grund haben, mögen diese Behauptungen nun wahr oder falsch sein. Parallel zum Gegensatz zwischen Barbarei und Kultur sind beide Möglichkeiten unentrinnbar mit dem Leben verbunden und im Leben verankert. Diese „Verankerung“ kann also nicht als Wahrheitskriterium fungieren. Doch was vermag dann diese Aufgabe zu erfüllen und damit Wahrheit und Irrtum voneinander zu unterscheiden? Während Husserl in den Göttinger Vorlesungen von 1907 die Evidenz als letztes und selbstbezügliches Wahrheitskriterium beanspruchen konnte, ist dies für Henry kein gangbarer Weg mehr: Die Evidenz bleibt dem „Sehen“ und somit der Intentionalität verhaftet, die für die Lebensphänomenologie immer erst „nach“ der Affektivität kommt. Das ek-statische Erscheinen kann nicht zum Richtmaß des Pathischen werden. Es bleibt also nur die Lösung, die Henry klar im wichtigen § 15 von ‚Inkarnation’ vorträgt, die Affektivität selbst als letztes und selbstbezügliches Wahrheitskriterium für Aussagen über die Affektivität zu nehmen: Die Evidenz wird ersetzt durch die lebendige und affektive Gewissheit. Wenn also Wahrheit und Irrtum, Barbarei und Kultur, Verzweiflung und Seligkeit gleichermaßen im Leben verankert sind, so ist es doch das Leben selbst, verstanden als innere Gewissheit (als Wissen des Lebens um sich selbst), das um den Unterschied dieser Lebensformen weiß. Bezogen auf den Wahrheitsanspruch der Lebensphänomenologie bedeutet dies, dass er auf einer Gewissheit beruht (der des Autors) und nur durch eine andere Gewissheit (der des Lesers) zu überprüfen ist. Konsequent lädt Henry den Leser zu dieser ihm eigenen Überprüfung ein (Henry 2000, 265; dt. 2002a, 292 f.). Doch aus der Tatsache, dass diese Gewissheit unter Umständen nicht geteilt wird, muss geschlossen werden, dass das Wissen des Lebens um sich selbst entweder keine allgemeingültigen Aussagen über das Leben zulässt – was aber dann auch dem Anspruch der Lebensphänomenologie auf allgemeingültige Wahrheit widersprechen würde – oder aber dass dieses Wissen sich nicht bei allen Menschen mit der gleichen Stärke zu erkennen gibt. Diese Schlussfolgerung erweist sich als äußerst problematisch im Hinblick auf die intersubjektive Überprüfbarkeit eines auf Gewissheit beruhen22 den Wahrheitsanspruches;4 sie ist jedoch kohärent mit der zuvor erwogenen Ausdifferenzierung der Lebensformen, das heißt mit der ethischen Alternative zwischen Verzweiflung und Seligkeit, zwischen Flucht aus dem Leben und einer Gelassenheit im Leben, letztendlich zwischen dem Vergessen des Lebens und der Wiederentdeckung der transzendentalen Geburt im Leben. Das Problem, auf das sich Henrys Ethik zuzuspitzen scheint, besteht in dieser Alternative und stellt uns vor die Frage, wie aus der Lebensvergessenheit herausgetreten werden kann, um zu einer „Wiedergeburt bzw. zweiten Geburt im Leben“ (seconde naissance) zu gelangen. Diese „zweite Geburt“ ist der genaue Gegenpart zum Vergessen und zur verzweifelten Flucht aus der Affektivität; sie wird daher auch als „Anerkennung“ des Lebens (reconnaissance de la vie) bezeichnet, denn der Terminus reconnaissance kann sowohl „Wiedererkennen“ als auch „Anerkennung“ bedeuten. Vergessenheit und Anerkennung betreffen nicht nur das affektive Werden des individuellen Lebens, sondern auch und vor allem das in Vergessenheit geratene absolute Leben, das jedem Leben zugrunde liegt, wie Henry im Rahmen seiner lebensphänomenologischen Deutung der christlichen Ethik ausführt (vgl. u.a. Henry 1996; dt. 1997, Kap. 10). Doch der Austritt aus der Lebensvergessenheit ist mit einem Zirkel behaftet: „Ist dann nicht die Möglichkeit des religiösen Erlebnisses in einem Zirkel gefangen? Nur das Hören auf das Wort des Lebens kann uns vom Bösen erlösen, aber das Böse hat das Hören auf das Wort des Lebens unmöglich gemacht.“ (Henry 2002b, 153 f.; dt. 2010) Der Rekurs auf ein religiöses „Erlebnis“ bedeutet hier keine „Lösung“ des ethischen Problems durch den religiösen Glauben oder durch das Befolgen etwaiger religiöser Gebote. Zum einen, weil Henry den Begriff „Re4 Dies liegt auch daran, dass die intersubjektive Überprüfung von Aussagen im letztgültigen Bezug auf Evidenz beruht. Wenn aber nun dieses Paradigma der Evidenz durch das der Gewissheit „ersetzt“ wird, dann müsste gefragt werden, ob es so etwas wie eine Intersubjektivität in der Gewissheit, das heißt in der Immanenz, geben kann. Eine weiter zu verfolgende Spur ist in diesem Kontext der Begriff des „Ko-pathos“ bei Henry sowie die im Zuge seines Schaffens immer stärker hervortretende Ansicht, individuelles Leben müsse von seinem Teilhaben am absoluten Leben her gedacht werden. 23 ligion“ zunächst allgemein als Verbundenheit des individuellen mit dem absoluten Leben versteht, das heißt etymologisch als religio. Zum anderen, weil der Glaube und die Befolgung der Gebote ebenfalls in diesem Zirkel gefangen sind: Nur die Anerkennung des (absoluten) Lebens, das erneute Hören auf das Wort des Lebens (parole de la vie), können den Menschen von seinem Vergessen befreien, aber gerade dieses Vergessen führt dazu, dieses Wort zu überhören. So zum Beispiel, wenn Henry in Anlehnung an die christliche Ethik betont, die Anerkennung des Lebens könne nicht durch das Denken herbeigeführt werden, sondern werde im Handeln, genauer im sich selbst vergessenden barmherzigen Handeln erfahren. Eine authentische Selbstvergessenheit ist jedoch nur dem möglich, der diese Anerkennung bereits vollzieht oder vollzogen hat. Jene ist eher Folge oder Ausdruck dieser als ihre Ursache und scheint sie vorauszusetzen. Wenn also weder das Denken – und somit auch der philosophisch-ethische Diskurs – noch das Befolgen von Handlungsgeboten zur Wiederentdeckung der Affektivität und der Kultur führen, weil diese sozusagen von „Außen“, ausgehend von der Intentionalität des Wissens und des Willens, die Affektivität zu bestimmen suchen, dann scheint der einzig mögliche „Weg“ in einem immanenten Wandel der Affektivität selbst zu bestehen, sodass es nicht das bewusst handelnde Subjekt wäre, das aus der Lebensvergessenheit heraustreten könnte, sondern nur das Leben selbst. Hätte dann aber die Ethik noch einen Sinn? Wenn die Wiederentdeckung der Affektivität vom Werden der Affektivität selbst abhängt, scheint eine philosophische Ethik keinen Einfluss darauf haben zu können, ob es dem Menschen gelingt, sich aus Verzweiflung und Entfremdung zu befreien – und die vermeintliche „Ethik der Affektivität“ würde damit einer praktisch-existentiellen Legitimität entbehren. Des Weiteren kommt eine erneute Parallele zum erkenntnistheoretischen Problem zum Vorschein, denn ist das Wissen um die Affektivität nicht zugleich ihre Wiederentdeckung? Doch das könnte bedeuten, dass ein solches Wissen nur von demjenigen verstanden werden kann, der es eigentlich nicht mehr braucht, weil er die diesem Wissen zugrunde liegende Gewissheit schon besitzt. Und die Aneignung dieses Wissens könnte nicht durch die Rezep24 tion der Lebensphänomenologie geschehen, sondern würde von der Kontingenz individueller „Wachstumsprozesse“ auf dem Niveau der Affektivität abhängen. Nicht minder problematisch scheint die Annahme zu sein, der Wandel der Affektivität würde sich notwendig auf deren eigene Befreiung hin orientieren und zu ihr führen. Im ersten Falle wäre eine Ethik vergebens, im zweiten wäre sie überflüssig. Von einer Ethik der Affektivität zu sprechen, wäre nur möglich, wenn ihr eine praktische Relevanz nachgewiesen werden könnte, das heißt wenn der theoretische Rahmen der Lebensphänomenologie eine solche Relevanz überhaupt zulässt. Erst dann könnte, in einem zweiten Schritt, diese Ethik inhaltlich mit anderen Ansätzen verglichen und diskutiert werden. Die folgenden Lösungsperspektiven verstehen sich als einleitende Skizzierung zur ersten dieser beiden Fragen. 3. Lösungsperspektiven Die gegenseitige Bedingtheit von Wissen und Werden der Affektivität würde, falls eine Ethik der Affektivität sich als unmöglich erweisen sollte, zur Folge haben, dass die Lebensphänomenologie insgesamt nicht zu einer Erweiterung des Verständnisses von Leben und Affektivität beitragen könnte. Sie würde bei ihrer Rezeption nur ein schon bestehendes Wissen bestätigen können und wäre für den, der die entsprechende Gewissheit nicht besitzt, unnahbar. Falls aber eine Ethik der Affektivität Sinn macht, dann liegt auch die Vermutung nahe, die Lebensphänomenologie sei insgesamt, per se und in all ihren Ausführungen, ethisch. Dieser letzte Fall erscheint mir als der wahrscheinlichere. Zunächst kann angenommen werden, dass die Ausarbeitung der Lebensphänomenologie einen durchaus praktischen Zweck für Michel Henry selbst erfüllt hat, nämlich den, das von ihm in Anspruch genommene „Erlebnis“ der lebendigen Gewissheit philosophisch zu untermauern und in eine sprachliche Form zu bringen. Der philosophische Diskurs kann in diesem Falle als eine Übersetzung des affektiv Gelebten in das Medium der Sprache und der philosophischen Begrifflichkeit angesehen werden. Zwar enthält nach Henry jede Formulierung, 25 und daher auch jede Philosophie, eine solche Übersetzung des Affektiven ins Sprachliche, doch kommt hier der Anspruch hinzu, dass es sich um eine wahre Übersetzung handeln soll: Die Lebensphänomenologie soll eben nicht nur Ausdruck der Affektivität, sondern ihre theoretische Darstellung sein. Doch wozu eine solche Darstellung, wenn die sie fundierende Gewissheit schon besteht, und welcher praktische Zweck soll damit erfüllt werden? Es ist kaum abwegig, Philosophie als eine Kulturleistung anzusehen, und im Rahmen der Lebensphänomenologie bedeutet dies, dass die philosophische Begrifflichkeit eine der Formen ist, mit denen das Leben sich selbst steigert, seinen Potenzialitäten zur Aktualität verhilft, was vom kontinuierlichen Werden der Affektivität selbst erfordert wird. Die philosophische theoria ist somit Teil einer lebendigen Praxis. Und für M. Henry gilt dies gerade für die Ethik: Als Ethos verstanden, entspricht sie dem unendlichen Prozess, in dem das Leben sein Wesen erfüllt (Henry 1987, 169; dt. 1994, 274), das heißt vorrangig in den Formen der Praxis, die zu seiner eigenen „Kultivierung“ beitragen und ihr entsprechen. Als philosophische Ethik hingegen ist sie für Henry gleichzusetzen mit der Selbstobjektivierung des Lebens und der ihr eigenen Gewissheit. Henry unterscheidet daher zwei Stufen der Ethik: 1. eine originäre Ethik, ein Ethos, in dem sich das Leben selbst erprobt und steigert; 2. eine theoretisch-normative Ethik, die sekundär hinzukommt und mit Hilfe derer das Leben sich selbst in seinem Bedürfen vorstellt: „Es kann sich dabei nur um Zwecke, Normen oder Werte handeln, die dem Leben selbst entstammen und mit deren Hilfe es sich zu repräsentieren versucht, was es will. Überdies geschieht eine solche Repräsentation nur gelegentlich und kennzeichnet ein Innehalten oder ein Zögern in der Handlung, die sich in der Unmittelbarkeit ihrer wesenhaft spontanen Selbstständigkeit abspielt, […]. Die explizite Setzung dieser Werte für sich selbst, die außergewöhnlich bleibt, ist nur die Selbstbejahung des Lebens in Gestalt seiner Selbstrepräsentation. Aber diese Selbstbejahung als Selbstobjektivierung verbleibt sekundär gegenüber einer älteren Selbstbejahung, die mit der Bewertung des Lebens selbst zusammenfällt, insofern es kontinuierliche Anstrengung ist, um in seinem Sein fortzubestehen oder sich zu steigern. 26 Eine solche Bewegung bildet die immanente Lebensteleologie, in der jede mögliche Ethik wurzelt.“ (ebd. 168 f.; dt. 1994, 273 f.) In Anlehnung an Spinoza versteht Henry das Leben als conatus. Dabei erscheint die philosophische Ethik als die eher gelegentlich vorgenommene Selbstobjektivierung eines an sich immanenten Bestrebens. Da es aber dazu kommt, muss eine derartige Selbstobjektivierung auch einen praktischen Zweck besitzen. Die zuvor zitierte Passage spricht dafür, dass es sich um den Zweck der begrifflichen Klarstellung handelt, und zwar im Kontext einer mit Zweifel oder Zögern besetzten Handlung. Die Objektivierung an sich ist daher nicht gleichbedeutend mit einer Flucht aus der Affektivität oder gar einer Negation derselben; entscheidend ist, inwieweit diese Objektivierung in ihrer Abhängigkeit zur Affektivität anerkannt oder ob ihr eine ontologische Bedeutung bzw. Vorrangstellung beigemessen wird. Wenn nun ein hinreichender Grund für die Produktion einer theoretischen Ethik „in der ersten Person“ besteht, bleibt zu untersuchen, ob es einen solchen auch für die entsprechende Rezeption durch Dritte gibt. Ein wichtiges Indiz dafür scheint der von Henry verwendete Begriff der „immanenten Teleologie“ zu sein. Von einer Teleologie der Affektivität auszugehen, erlaubt es, einen „Mittelweg“ zwischen reiner Kontingenz und Notwendigkeit zu finden: Die Wandlungen der Affektivität, zum Beispiel der Übergang von Vergessen zur Anerkennung des Lebens, entsprechen demnach keiner absoluten Notwendigkeit, sondern einem im Wesen des Lebens enthaltenen Telos. Dies wiederum würde gestatten, von einem immanenten Bestreben des Lebens nach Selbststeigerung zu sprechen und somit der theoretischen Ethik eine mögliche Rolle in der Aktualisierung dieser Tendenz zukommen zu lassen. Der ethische Diskurs hätte somit nicht die Aufgabe, die lebendige Gewissheit und Wirklichkeit zu ersetzen oder gar zu schaffen – er wäre also nicht performativ –, sondern nur quasi-performativ und hinweisend, und zwar in dem Sinne, dass er auf die radikal nicht zu entfremdende Gewissheit des Lebens hindeutet und an ihre Schwelle führt. Doch wie könnte er das tun, wenn die Affektivität als index sui und als Grund der Phänomenalisierung angesehen wird? Die Rolle, die dem cartesianischen Cogito im Aufbau der 27 Lebensphänomenologie zukommt, gibt hier einen wichtigen Ansatzpunkt: Die henrysche Interpretation des Cogito ist es nämlich, die die Unterscheidung zwischen Evidenz und Gewissheit einsichtig machen kann. Genau so verhält es sich mit dem für die Lebensphänomenologie charakteristischen Vorgehen der „Gegen-Reduktion“: M. Henry entdeckt sie bereits in der Zweiten Meditation Descartes’, und diese Entdeckung entspricht einem Vorgehen, das in der Rezeption dieser Schrift vom Leser angewendet und nachvollzogen werden muss, sodass diese Rezeption durch das gegen-reduktive Ausschalten der Evidenz praktisch auf die Gewissheit der cogitatio zurückführt (vgl. Henry 2000; dt. 2002a, Kap. 11). Der hier vorgeschlagene Begriff der Quasi-Performativität trägt der Tatsache Rechnung, dass dieses Vorgehen die immanente Gewissheit zwar nicht „schafft“, sie jedoch als alleiniges Resultat der Gegen-Reduktion übrig bleiben lässt und somit einem „Sprung“ in diese Gewissheit gleichkommt. Wieder bemerkt man, wie eng das erkenntnistheoretische Anliegen der (lebens)phänomenologischen Wahrheitsfindung mit dem der Ethik verbunden ist: Die immanente Selbstaffektion theoretisch einsichtig zu machen, ist nur möglich, wenn der Diskurs praktisch auf diese zurückführt. Dieses praktische Zurückführen auf die lebendige Gewissheit ist jedoch genau das Anliegen einer Ethik der Affektivität. Daher auch die Hypothese, die Lebensphänomenologie sei an sich ethisch: Als theoria des Lebens ist sie dem telos der Wiederentdeckung des pathischen Erscheinens „verpflichtet“. Doch als Philosophie kann sie „nur bis an den Rand führen“ und bleibt „im Vor-letzten“, denn von „diesem Rand des Möglichen in den Ruck zur Wirklichkeit führt nur das einzelne Handeln selbst“ (Heidegger 1983, 257). Die vorliegende Untersuchung geht den hier eingeführten Hypothesen nach. Im ersten Teil wird der Gegensatz Barbarei/Kultur und dessen Kontinuität in Henrys Werk als ethischer Ansatz der Lebensphänomenologie aufgezeigt. Der zweite Teil befragt diesen Ansatz auf seine phänomenologischen Grundlagen hin, insofern diese Bedingung für die Möglichkeit einer Ethik der Affektivität sind. Der dritte und letzte Teil untersucht die hier eingeführten Perspektiven im Hinblick auf eine ethische Praxis im 28 Sinne der Lebensphänomenologie. Er ist ausschlaggebend für die Frage, ob und in welcher Form es eine Ethik der Affektivität geben kann. 29