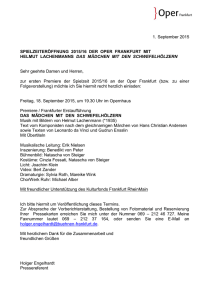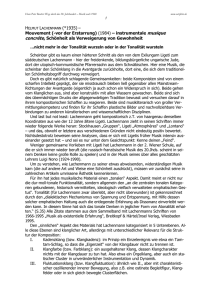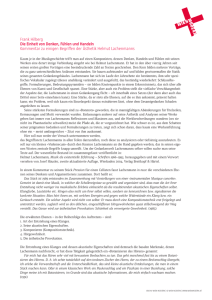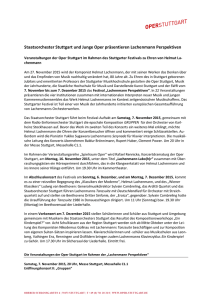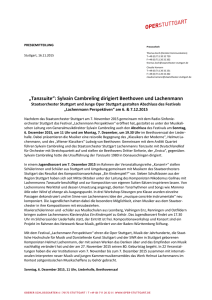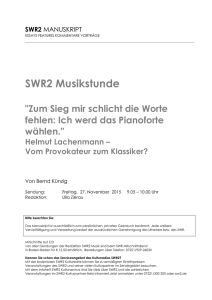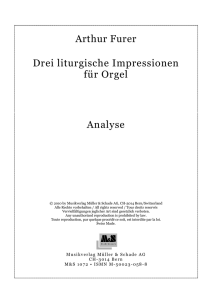Volltext
Werbung
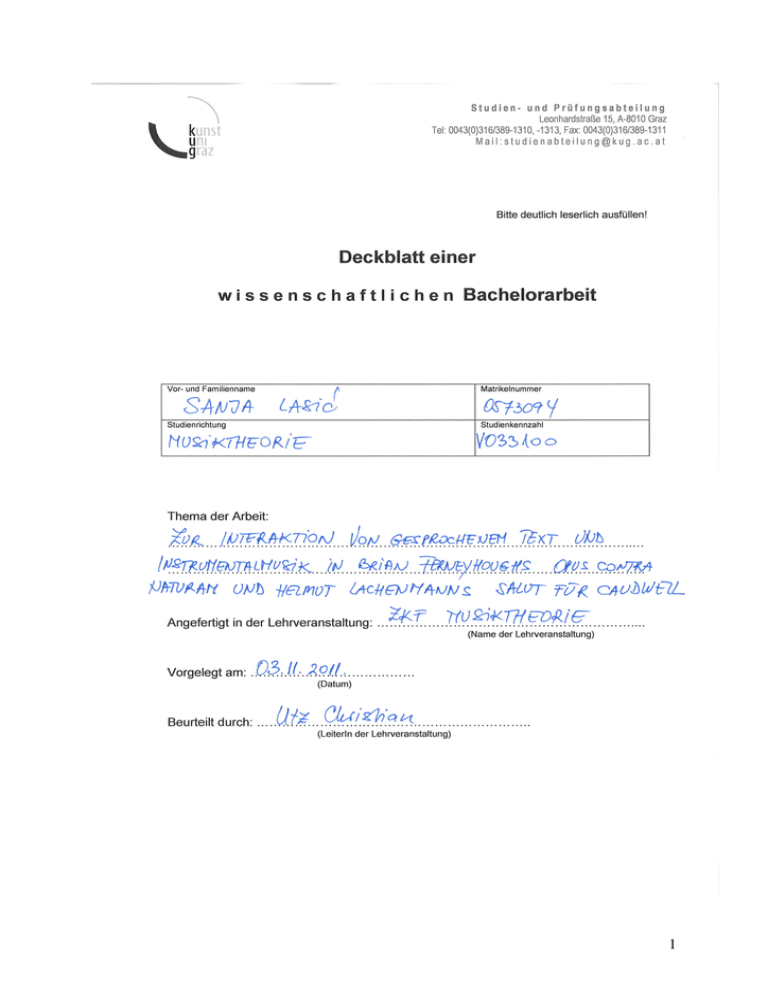
1 Inhaltverzeichnis EINLEITUNG ............................................................................................................................................................... 3 1. DAS GESPROCHENE IM MUSIKHISTORISCHEN KONTEXT ................................................................ 4 1.1 DAS GESPROCHENE WORT IM MUSIKALISCHEN ZUSAMMENHANG: MUSIKALISCHE RHETORIK-REZITATIV-MELODRAM…………………………………………………………………………4 1.2 DER SPRECHGESANG ALS EMANZIPATION DER SPRECHSTIMME .................................................. 5 2. BRIAN FERNEYHOUGH: OPUS CONTRA NATURAM …………..................................................….....9 2.1 BRIAN FERNEYHOGHS SHADOWTIME- AUFBAU UND LIBRETTO…………………….………...…..9 2.2 INTERAKTION VON SPRECH-UND KLAVIERPART IN OPUS CONTRA NATURAM………....……..11 2.2.1 I. SATZ……………………………………………………………………………………………...……...13 2.2.2 II. SATZ (KATABASIS)…………………………………………………………………………...………17 2.2.3 III. SATZ (KATAPLEXY)………………………………………………………………………...……….21 3. HELMUT LACHENMANN: SALUT FÜR CAUDWELL (1977) FÜR ZWEI GITARRISTEN………...25 3.1 KOMPOSITORISCHE UMSETZUNG DES CAUDWELL-TEXTES……………………………………...26 3.2 RHYTHMUS ALS BINDEGLIED……………………………………………………………………..……27 3.3 PHONETISIERUNG…………………………………………………………………………………...…….30 3.4 FUNKTIONEN DES GESPROCHENEN……………………………………………………………...…….35 4. ZUSAMMENFASSUNG……………………………………………………………………………………..37 ANHANG………………………………………………………………………………………………………...38 LITERATURVERZEICHNIS………………………………………………………………………………….41 2 EINLEITUNG Eine nicht geringe Anzahl zeitgenössischer Kompositionen wählt einen Text als zentrales musikalisches Material. Was jedoch einige Kompositionen besonders auszeichnet, ist die Rolle bzw. Behandlung des Textes. Diese Rolle änderte sich – auch in Bezug auf den musikalischen Fluss – durch die Entstehung und Entwicklung vokaler, vokal-instrumentaler bzw. szenischer Formen und Gattungen. Gesprochenes, das in musikalische Strukturen integriert wird, ist an sich kein Novum in der neuen Musik, sondern spätestens seit der Entstehung des Rezitativs ein wichtiger Bestandteil der Musiksprache verschiedener Epochen. Was die zwei in dieser Arbeit behandelten Kompositionen – Ferneyhoughs Opus Contra Naturam und Lachenmanns Salut für Caudwell – im musikhistorischen Kontext unterscheidet, ist die Tatsache, dass hier die Instrumentalisten selbst zum Sprechen angeleitet werden. Sie produzieren also sowohl instrumentalen als auch vokalen Klang. Mit der vorliegenden Analyse soll gezeigt werden, wie sich die zwei Kompositionen von historischen Herangehensweisen der Musik an (gesprochene) Sprache unterscheiden. Mein Ziel ist es dabei der Frage auf den Grund zu gehen, weshalb der gesprochene Text von einem Instrumentalisten und nicht von einem Sprecher interpretiert wird. Und welche Folgen haben die besonderen kompositorischen Verfahrensweisen in diesen Werken für das musikalische Gesamtgefüge? 3 1. DAS GESPROCHENE IM MUSIKHISTORISCHEN KONTEXT 1.1 Das gesprochene Wort im musikalischen Zusammenhang: Musikalische Rhetorik – Rezitativ – Melodram Das Verhältnis von Gesprochenem und Musik hat in der Geschichte immer wieder dazu gedient, die Sprache (den Text) im musikalischen Kontext zu einem gleichberechtigten Träger des Ausdrucks zu machen. Dabei denken wir in erster Linie an Rezitativ oder Melodram, im Wesentlichen also an musikdramatische oder -szenische Gattungen. Die Sprechkunst bzw. Rhetorik hat eine bis in die Antike zurückreichende Geschichte. Die Übertragung der Rhetorik auf die Musik wurde vor allem im Barock unternommen. Die so seit dem frühen 17. Jahrhundert entstehenden Figurenlehren kategorisierten melodische und harmonische Wendungen nach ihrer rhetorischen Funktion und wirkten damit sehr stark auf die Praxis der Textvertonung zurück. Insbesondere die ebenfalls um 1600 entstandene Gattung des Rezitativs machte die musikalische Rhetorik zu einem vorrangigen Prinzip. Das Rezitativ wird Teil der Oper, der Kantate, der Messe und des Oratoriums. Für das Rezitativ charakteristisch ist einerseits die gesprochene Art des Singens, andererseits erzählerische oder dialogische Elemente, die sich von Aria-Teilen unterscheiden. Vor allem im aus dieser Frühzeit hervorgehenden recitativo secco, für das die continuo-Begleitung typisch ist, wird so eine große rhythmische Freiheit gewonnen, im Gegensatz zur Form des recitativo accompagnato, in dem die Orchesterbegleitung eine festere Struktur vorgibt. Das Rezitativ ist auch fester Bestandteil der Oper des 19. Jahrhunderts geblieben. Mit Wagner und dem Musikdrama ändert sich jedoch das bisherige Konzept der Sprachbehandlung grundlegend und damit auch das Rezitativ und seine Funktion. Durch die „unendliche Melodie“ wird eine musikalisch-dramatische Einheit erreicht, die ein Rezitativ durch seinen sprechenden Charakter unterbrechen würde. Während das Rezitativ und Wagners sprachnaher Gesang letztlich mit einer sängerischen Technik realisiert werden, ist beim Melodram rein gesprochene Sprache mit Instrumentalmusik kombiniert. Dabei wurde allerdings wiederum ansatzweise versucht, über die Notation eine Annäherung an den Gesang herzustellen, eine Entwicklung, aus der der Sprechgesang resultierte (vgl. 1.2). 4 Die ersten Melodramen entstanden im ausgehenden 18. Jahrhundert.1 Jedoch wird das Prinzip des Melodrams im 19. Jahrhundert zum Bestandteil einiger musikszenischer Formen wie Singspiel und Oper, wobei es nicht selten für die Darstellung bestimmter dramatischer Spannungen eingesetzt wird, so z.B. in der Gefängnisszene in Beethovens Fidelio, in der Wolfsschluchtszene in Webers Freischütz, in Schuberts Zauberharfe und Des Teufels Lustschloss sowie in Schuberts Melodram für Klavier und Sprechstimme Abschied von der Erde. Auch Mendelssohn, Schumann, Liszt und viele andere erprobten dieses Genre. Der gesprochene Part wurde dabei in der Regel rhythmisch und melodisch nicht ausnotiert, sondern von Sprecherin oder Sprecher ad hoc mit dem musikalischen Fluss koordiniert. Im 18. Jahrhundert formiert sich in europäischen Ländern, besonders in Deutschland, eine Sprechkunstbewegung, die die verschiedenen Vortragsarten wie Rezitieren (basierend auf einer „reine[n] und vollständige[n] Aussprache jedes einzelnen Worts“2) und Deklamieren (eine kunstvolle, affektive Art des Redens, die sich gründsätzlich von der alltäglichen Konversation unterscheidet) pflegte. Gleichzeitig unternahm die Dichtung mit Autoren wie Goethe, Lessing oder Schiller eine starke Hinwendung zum Deklamatorischen. 1.2 Der Sprechgesang als Emanzipation der Sprechstimme Dass das Melodramatische in der Musik auch am Beginn des 20. Jahrhunderts existiert und sich in neue vokale bzw. instrumentale Formen fortsetzt, bestätigt in erster Linie Schönbergs Pierrot Lunaire op. 21 (1912), das am Anfang der Einbeziehung der Sprechstimme in die neuen Musik steht und damit neue Möglichkeiten des vokalen Ausdrucks eröffnete. 21 Melodramen bzw. „dreimal sieben Gedichte aus Albert Girauds Pierrot lunaire für Sprechstimme, Klavier, Flöte, Klarinette, Geige und Violoncello“ ist eines der radikalsten Beispiele in der Einführung einer kompositorisch festgelegten Art der Sprechmelodie, des so genannten Sprechgesangs, als einem Hauptmittel des musikalischen Ausdrucks. Im Vorwort der Partitur gibt Schönberg explizite Anleitungen zur Interpretation und führt dabei aus, wie sich Gesangston und Sprechton unterscheiden sollen: 1 2 Vgl. Schwarz-Danuser, Melodram. Meyer-Kalkus, Stimme und Sprechkünste im 20. Jahrhundert, S. 229. 5 Die in der Sprechstimme durch Noten angegebene Melodie ist (bis auf einzelne besonders bezeichnete Ausnahmen) nicht zum Singen bestimmt. Der Ausführende hat die Aufgabe, sie unter guter Berücksichtigung der vorgezeichneten Tonhöhen in eine S p r e c h m e l o d i e umzuwandeln. Das geschieht, indem er: I. den Rhythmus haarscharf so einhält, als ob er sänge, d. h. mit nicht mehr Freiheit, als er sich bei einer Gesangsmelodie gestatten dürfte; II. sich des Unterschieds zwischen G e s a n g s t o n und S p r e c h t o n genau bewußt wird: der Gesangston hält die Tonhöhe unabänderlich fest, der Sprechton gibt sie zwar an, verläßt sie aber durch Fallen oder Steigen sofort wieder. Der Ausführende muß sich aber sehr davon hüten, in eine „singende“ Sprechweise zu verfallen. Das ist absolut nicht gemeint. Es wird zwar keineswegs ein realistisch-natürliches Sprechen angestrebt. Im Gegenteil, der Unterschied zwischen gewöhnlichem und einem Sprechen, das in einer musikalischen Form mitwirkt, soll deutlich werden. Aber es darf auch nie an Gesang erinnern. Im übrigen sei über die Ausführung folgendes gesagt: Niemals haben die Ausführenden hier die Aufgabe, aus dem Sinn der Worte die Stimmung und den Charakter der einzelnen Stücke zu gestalten, sondern stets lediglich aus der Musik. Soweit dem Autor die tonmalerische Darstellung der im Text gegebenen Vorgänge und Gefühle wichtig war, findet sie sich ohnedies in der Musik. Wo der Ausführende sie vermißt, verzichte er darauf, etwas zu geben, was der Autor nicht gewollt hat. Er würde hier nicht geben, sondern nehmen.3 Sprechgesang steht so für eine eigenständige Art der Emanzipation der Sprechstimme. Er ist ein integraler, interaktiver Teil der musikalischen Idee. Schönberg selbst führt als Modell das so genannte „gebundene Melodram“ an, dessen Prinzip er von Engelbert Humperdinck übernahm und erweiterte.4 In der ersten Fassung seines Bühnenmelodrams Königskinder (1895) fixiert Humperdinck nicht nur den Rhythmus der Sprechstimme, sondern auch die Tonhöhen, wobei er die Notenköpfe jedoch mit einem x markiert, d.h. dass er anstelle der üblichen, runden Notenköpfe ein Kreuz benutzt. Alles ist jedoch in einem „normalen“ FünfLinien-System geschrieben. Mit dieser damals neu geschaffenen Notation wollte Humperdinck bewusst auf die Verschiedenheit zwischen dem Gesprochenem und Gesungenen hinweisen, auf einen „Zwischenraum“, in dem sich das Vokale bewegt: „Die Sprechnoten geben im allgemeinen nicht die absolute Tonhöhe, sondern die relative an, die Linie der Hebungen und Senkungen in der Stimme.“5 Der Text ist jedoch insofern vollkommen an den musikalischen Fluss gebunden, als er sich in seine rhythmische und teils harmonische bzw. Intervall-Struktur einfügt. Diese Verbundenheit zeigt auch der Text, den wir in der Partitur finden: „Die in den melodramatischen Sätzen angewandten ‚Sprechnoten’ 3 Schönberg, Pierrot lunaire op. 21, Partitur, Vorwort. Krämer, Zur Notation der Sprechstimme bei Schönberg, S. 6 5 Ebd., S. 11. 4 6 sind dazu bestimmt, Rhythmus und Tonfall der gesteigerten Rede (Melodie des Sprachverses) mit der begleitenden Musik in Einklang zu setzen.“6 Von Schönbergs Beschäftigung mit der Sprechstimme zeugt eine nicht geringe Anzahl an Kompositionen, deren Entwicklung sich über ein halbes Jahrhundert erstreckt, begonnen mit den Gurre-Liedern (1900/1901), der Glücklichen Hand op. 18 (1910–1913) über Pierrot Lunaire (1912), Moses und Aron (1930–1933) bis Ode an Napoleon op. 41 (1942), Ein Überlebender aus Warschau op. 46 (1947) und seine letzte Komposition, den Modernen Psalm op. 50c (1950). Während die Notation der Sprechstimme im Fünf-Linien-System noch ein rhythmisches Zusammenlegen und Koordinieren mit dem musikalischem Fluss erfordert und zugleich Tonhöhen evoziert, geht Schönberg mit Kompositionen wie Ode an Napoleon und Ein Überlebender aus Warschau einen anderen Weg, indem er hier den deklamierten Text nur auf einer Linie markiert. Der Text wird so stärker von jeglicher Art der Prädestination distanziert, seine Wiedergabe ist stärker an textspezifischen Charakteristika orientiert. Der Rhythmus dagegen wird – so wie auch die konventionelle rhythmische Notation – beibehalten. Die partielle Unabhängigkeit des gesprochenen Textes im musikalischen Zusammenhang wirft verstärkt die Frage über die Beziehung textlicher und musikalischer Strukturen auf. Unter diesem Gesichtspunkt erscheint Pierrot lunaire als Ausgangspunkt für viele spätere Entwicklungen. Die Anweisungen Schönbergs zur Ausführung des Sprechparts in Partitur und Vorwort zeugen von der Absicht, die spezifische Qualität des Gesprochenen hervorzuheben. Sinn und Qualität der Komposition aber werden erst durch die Interaktion der Sprechstimme mit der musikalischen Idee eingelöst. Unter „Vokalmusik“ kann heute mehr oder weniger jede Form der stimmlichen Artikulation zusammengefasst werden. Die Kombinationen und Möglichkeiten der Stimmbehandlung insgesamt sind kaum vollständig fassbar, vor allem aufgrund der Tatsache, dass die Entwicklung der Vokalmusik und der Einfluss „musikalischer“ Artikulationsweisen auf die Literatur der Moderne Hand in Hand gingen. Dadaismus, Lautpoesie, Konkrete Poesie und experimentelle Literatur, Autoren wie Franz Mon, Gerhard Rühm, Ernst Jandl u. a. öffneten auch der vokalen Musik neue Wege und waren ihrerseits von Tendenzen der neuen Musik beeinflusst. Insbesondere nach 1945 erweiterte sich das Spektrum der Vokaltechniken und 6 Allende-Blin, Über Sprechgesang, S. 49. 7 damit die Ausdruckspalette der Vokalmusik erheblich, nicht zuletzt in Wechselwirkung mit einer Erweiterung der Klangräume in der instrumentalen Musik. Flüstern, Schreien, aber auch Sprechgesang bzw. Sprechen wurden zum festen Bestandteil neuer Vokalwerke, und traten gleichberechtigt neben konventionellere stimmliche Formen der Artikulation. 8 2. BRIAN FERNEYHOUGH: OPUS CONTRA NATURAM Mit den folgenden Analysen werde ich die Interaktion zwischen dem Gesprochenem und Instrumentalen in zwei Schlüsselwerken der neuen Musik erläutern. Untersucht werden die verschiedene Umgangsweisen mit dem Text, genauer: die Art und Weise seiner kompositorischen Behandlung und seiner Beziehung zum instrumentalen Klang. 2.1. Brian Ferneyhoughs Shadowtime – Aufbau und Libretto Die Oper Shadowtime (2000, uraufgeführt 2004 bei der 9. Münchener Biennale für neues Musiktheater, Libretto: Charles Bernstein) ist bisher der einzige Beitrag Brian Ferneyhoughs zum Musiktheater. Sie ist um Leben, Werk und Tod des deutschen Kulturphilosophen Walter Benjamin herum entwickelt, der sich im Jahr 1940 in Portbou an der franzözisch-spanischen Grenze das Leben nahm. Benjamins Philosophie ist zentrales dramaturgisches Movens von Ferneyhoughs Oper. Auch die Anordnung der sieben Szenen und die musikalischen Strukturen der Oper lassen sich auf den Kontext von Benjamins philosophischem Denken beziehen. Text und Musik stehen in Shadowtime in einer engen Abhängigheit zueinander. Jede der sieben Szenen steht dabei einzeln für sich, wobei die Szenen durch unterschiedliche Texte, Instrumentation/ Besetzung und musikalische Anlage voneinander abgehoben sind, und zugleich durch eine gemeinsame dramaturgische Linie verbunden werden. Die Beziehungen zwischen den Sätzen sind auf mehreren Ebenen ersichtlich. Vor allem dient hier die Figur Walter Benjamins als Bindeglied, indem er als Ausführender von der ersten bis zur 5. Szene immer wieder transformiert erscheint. In seiner Rolle als Joker bzw. Clown in der vierten Szene wird er zugleich zum Rezitator. Nach der 5. Szene verschwindet die Figur Walter Benjamins, was Ferneyhough selbst für einen bedeutsamen Moment in der Komposition hält, nämlich als Übergang zu einer anderen Ebene. „...just as the avatar of Benjamin is becoming increasingly insubstantial and, at the end, has disappeared completely, so we are moving more and more into the world of the focused, subjective individual in Western culture. I like to think there’s a sort of cross-fade in this scene, between these two levels.“7 7 Ferneyhough, Content and Connotation, Distance and Proximity, S. 12. 9 „‚Before‘ and ‚after‘ were always in my mind at some level or another throughout this opera“8, sagte Ferneyhough, und dies ist höchstwahrscheinlich das stärkste gedankliche Bindeglied zwischen den Szenen der Oper Shadowtime. So stellt beispielsweise die erste Szene – New Angels/Transient Failure (Prologue) – eine „Reise“ in diverse Zeitdimensionen dar; eine Reise von der „Echtzeit“ über „reflektierende Zeit“ bis in die „erlösende Zeit“, vom Konkreten, namentlich Walter Benjamins Selbstmord, bis in die Sphäre der Besinnung und Rückerinnerung. Diese Reise durch die Zeit ist wesentlich für die Zeitkonzept des Werkes und ist ein bedeutendes Zusammenhang stiftendes Element, nicht nur innerhalb der einzelnen Sätze, sondern auch zwischen den Sätzen. In jeder der sieben Szenen realisiert Ferneyhough sein Material entweder durch unterschiedliche zeitliche Epochen oder Verweise auf bekannte Persönlichkeiten mit verschiedenen künstlerischen, philosophischen und auch politischen Profilen. Auf musikalischer Ebene werden dabei Formen und Gattungen früherer Epochen evoziert. Die 2. Szene – Les Froissements des Ailes de Gabriel (First Barrier) – ist ein rein instrumentaler Satz. Ein Teil dieses musikalischen Materials wird erneut in der 4. Szene Opus Contra Naturam verwendet, wodurch die Verknüpfung des musikalischen Materials in der Oper noch verstärkt wird. In der 3. Szene – The Doctrine of Similarity (13 Canons) – sowie in der 7. Szene Stelae for Failed Time (Solo for Melancholia as the Angel of History) dominiert der Chor mit verschiedenen Instrumentalensembles. Der Text der 6. Szene Seven Tableaux Vivants Representing the Angel of History as Melancholia (Second Barrier) wird – wie in der 4. Szene Opus Contra Naturam – gesprochen. Die 7. Szene bezieht sich auf Albrecht Dürers Kupferstich Melencolia I (1514). Auch die Skizzen zum formalen Ablauf, also zu den Verhältinissen zwischen den Szenen, suggerieren unzweifelhaft einen gemeinsamen Faden, der sich durch die Sätze zieht (vgl. Anhang, Beispiel 1: formale Skizze Ferneyhoughs). Obwohl die Szenen zu unterschiedlichen Gelegenheiten entstanden sind und auch als einzelne Stücke aufgeführt werden können, scheint aufgrund dieser dichten Beziehungen zwischen den Sätze eine Auskoppelung aus dem Kontext der Oper nur bedingt sinnvoll. Ebenso hängen Szenographie und Regie eng mit der Gesamtanlage des Werkes zusammen. Als Beispiel dafür kann die 4. Szene dienen: Das Klavier wird während der Aufführung fortwährend über die Bühne geschoben und verschwindet am Ende wieder im Dunklen. 8 Ebd. 10 In der Produktion der Uraufführung bestimmten auch die Akteure – Instrumentalisten und Sänger – die Szenographie selbst mit. „The singers and the musicians are the artists the production is constructed around“, so der Regisseur der Uraufführung Frédéric Fisbach.9 Das Szenarium der Oper, aber auch die Gliederung in Szenen sowie deren Aufbau und Inhalt, ist das Produkt einer engen Zusammenarbeit zwischen Ferneyhough und Charles Bernstein, einem amerikanischer Literaturtheoretiker und Dichter. Ausgangspunkt war die Voraussetzung, dass der Text für die Oper eine eigenständige Kunstform darstellen müsse: „Poesie sollte es sein, kein Schauspiel.“10 Ferneyhough selbst spricht von einer „Gedankenoper im Gegensatz zur Spieloper“.11 Bernsteins Text für Shadowtime ist eine poetisch-philosophische Collage. Das verarbeitete Textmaterial besteht aus Passagen aus Originaltexten Benjamins, aus Texten von Autoren, denen sich Benjamin verwandt fühlte, etwa von Gershom Scholem oder Friedrich Hölderlin, aber teilweise auch von Ferneyhough selbst (wie z. B. im ersten Satz von Opus contra Naturam). Daneben besteht der Text auch aus Zitaten aus dem Briefwechsel zwischen Benjamin und Theodor W. Adorno. Viele Textquellen wurden von Bernstein stilisiert und poetisch überarbeitet. Das resultierende Libretto hat somit eigenständiges ästhetisches Gewicht und erscheint als „für sich stimmiges Sprachkunstwerk“.12 2.2 Interaktion von Sprech-und Klavierpart in Opus Contra Naturam (2000)13 Das Klavierstück Opus Contra Naturam, die 4. Szene der Oper, steht für den Abstieg Benjamins in die Unterwelt und ist, in den Worten des Komponisten, „der zentrale slowdown, das gefrorene Herz der Oper“.14 Diese Szene ist allein für einen „sprechenden“ Pianisten bestimmt, der als Personifkation Benjamins einen Dialog mit dem Klavier führt. Die Szene spielt in einer Bar in Las Vegas, von Ferneyhough als Symbol für die westliche kulturelle Dekadenz verstanden: 9 Shadowtime, in: 9. Münchener Biennale, S. 44 Ebd., S. 42. 11 Ebd. 12 Ebd. 13 Uraufgeführt am 14. Oktober 2000 von Ian Pace beim Festival van Vlaanderen Vlaams-Brabant. 14 Shadowtime, in: 9. Münchener Biennale, S. 45. 10 11 Las Vegas ist für mich die Hyper-Simulation der Welt auf engstem Raum, Nachbildungen der Pyramiden stehen direkt neben Nachbildungen des heutigen New York. Die Stadt in der Wüste bietet eine unglaubliche und beängstigende Sammlung von Sinnbildern der westlichen Kultur. Und Las Vegas ist für mich das Hauptportal zur Unterwelt.15 Der Komponist merkt zur Gestaltung des Sprechparts an: The texts (in frames, usually above the staves to which they apply) are to be spoken approximately where their placement suggests. At several points, individual words are so located as to suggest exact coordination with individual attacks in the piano part. This coordination is intentional, but not specifically indicated as such, so that performers should consider themselves at liberty to adopt slightly different conventions. The texts should be spoken as if the pianist is engaged in a private, if somewhat conflictual conversation with the piano. In particular, careful consideration must be given to musical context when selecting a tone of voice for each vocal insert, since many are intended to appear to be reactions on the part of the performer to wayward tendencies on the part of the piano itself, i.e., its frequent veering into the realm of distorted late Romantic tonal harmony.16 Intendiert ist also, dass der Text vom Pianisten durchaus in individueller Weise gesprochen wird, als ob er sich in einem konflikthaftem Gespräch mit seinem Instrument (dem Klavier) befände. Bei der Wahl der Sprech-Intonation, der Sprech-Tonhöhe soll bei jedem Einsatz der durch den Klavierpart vorgegebene musikalische Kontext berücksichtigt werden. Es bestehen dabei Tendenzen einer suggerierten gegenseitigen Abhängigkeit: Das Klavierspiel scheint den Sprechduktus zu beeinflussen und umgekehrt. 15 16 Ebd. Ferneyhough, Shadowtime, Partitur, Perfomance Note. 12 2.2.1 I. Satz Der Text des ersten Satzes stammt vom Komponisten und versucht sich der Ästhetik und Sensibilität Walter Benjamins zu nähern. (Beispiel 1, Text 1). Beispiel 1: Im freien Versmaß beruht der Text auf einer klaren strukturellen Gliederung. Die ersten zwei Drittel des Textes folgen in Zweizeilern dem Schema Frage-Antwort, das in der ersten „Strophe“ vorgegeben ist. „Are the shadows of objects on cave walls themselves objects? / Undecidable.“ (Beispiel 2, Takt 5-6) Beispiel 2: 13 Das letzte Drittel des Textes verdichtet satzkettenartig knappe Bilder. Die Interpunktion ist von großer Bedeutung für die musikalische Struktur. Die ersten vier einführenden rein instrumentalen Takte deuten bereits ein rhetorisches Prinzip an: kurze von Pausen unterbrochene rhythmische Figuren kann man leicht mit der Gestalt kurzer Fragen identifizieren. Die längeren Notenwerten bezeichnen interpunktische musikalische Gesten. Im 5. Takt des I. Satzes, wo der gesprochene Text einsetzt, werden Musik und Sprache schon grafisch bzw. von der Partituranordnung her als zwei getrennte Ebenen ersichtlich. Der gesprochene Teil ist vom musikalischen Ablauf abgelöst. Genau dieser Abstand bzw. die Entkopplung von Musik und Sprache ist der entscheidende Faktor in Ferneyhoughs kompositorischem Modell, den wir in allen drei Sätzen verfolgen können. Das Prinzip der Entkopplung entfaltet seine Bedeutung schon in den ersten Takten durch die Tatsache, dass sich die Klavierstimme in zwei weit voneinander entfernten Lagen befindet und diesen Klaviersatz den ganzen ersten Satzes über beibehält. Wir können so nicht nur einen Dialog zwischen dem Pianisten und Benjamin, sondern auch zwischen Benjamin und seinem alter ego beobachten. Der gesprochene Text bildet, genau wie der instrumentale Part, eine Ebene für sich, was man unter anderem aus der Notation herauslesen kann: „The piano is deliberately objectivised, does not react in any way to the pianist’s soliloquy.“17 Die zwei getrennten Ebenen Text und Musik sind einem alchemistischen Prozess unterworfen, wie es der Titel der Komposition suggeriert (Opus Contra Naturam „is a term taken from renaissance alchemy and signifies one of the essential moments of transition/transformation which typify that arcane discipline“18). Klavier und Sprechstimme wechseln zunächst dialogisch ab. Die instrumentalen und gesprochenen Teile stehen in einer komplementären Beziehung. Der gesprochene Text ist in die Pausen der instrumentalen Syntax hineingesetzt. Die „Frage/Antwort“-Struktur des Textes wird konsequent im instrumentalen Part reflektiert. Später werden während der Rezitation des Textes die Notenwerte länger, was die dialogischen Beziehung von Stimme und Klavier potenziert (Beispiel 3, Takt 6-7). Auf diese Art und Weise wird eine Frage-Antwort-Form von Sprecher und Instrumentalisten geschaffen, und zwar sowohl auf der textuellen Ebene, als auch im Dialog mit sich selbst bzw. mit dem alter ego. Klavier und Stimme entwickeln dabei gemeinsame rhetorische Figuren. Evidente Beispiele gegenseitiger Abhängigkeit finden sich 17 18 Ferneyhough, Content and Connotation, Distance and Proximity, S. 10. Ferneyhough, Shadowtime, Partitur, Composer’s Note 14 schon in den ersten Takten der Komposition; nach dem gesprochenen Wort „Undecidable“ wird die Zensur in Takt 7 (Beispiel 3, Takt 6-7) fast zwangsläufig als „unentschlossene“ Geste gehört. Musik und Text greifen ineinander. Beispiel 3: Das Beispiel ist aber nicht isoliert; man kann annehmen, dass hier als Prinzip die Rhetorik des Textes in die Gestik der Musik einfließt. In Takt 8 – „Semantic insufficiency“ – stellt die Pause in der Klavierstimme einerseits eine interpunktische Geste dar und drückt anderseits semantisch das semantisch Unzureichende, die „Leerstelle“ aus, von der der Text spricht (Beispiel 4, Takt 8). Beispiel 4: In Takt 12 die rhythmische und gleichzeitig die melodische Figur als Echo der ausgesprochenen Wörter: „Then as when“ (Beispiel 5, Takt 12). 15 Beispiel 5: Die instrumentalen Interludien stellen ebenfalls eine musikalische Interpunktion des Textes dar; sie stehen immer am Ende einer Frage oder Antwort (Takt 6, 7, 9-12, 14, 16-17, 19, 2527). Nach vier Zweizeilern (T. 5-18) entwickelt sich eine neue textliche Struktur, eine Wortreihung, was die musikalische Rhetorik wiederum deutlich beeinflusst. Ab dem 20. Takt folgen die rhythmischen Figuren fast synchron mit dem gesprochenen Text aufeinander. Die musikalischen Gesten stimmen dabei mit den Charakteristika der gesprochenen Wörter überein. Das betrifft Artikulation, Sprechrhythmus und Bewegungsrichtung (Beipiel 6, T. 2021). Beispiel 6: Der erste Satz ist homorhythmisch angelegt. Der Rhythmus des Klavierparts verläuft in beiden Stimmen, mit Ausnahme der Takte 19 und 21, den ganzen Satz über gleich. Die extremen Lagen und die rhythmischen Figuren sind durch das Spiegelprinzip geprägt. Der Klavierpart besteht in erster Linie aus kleinen intervallischen Schritten. Diese sind allerdings nicht in beiden Stimmen gleich, es handelt sich also eher um vergleichbare Gesten, die auf 16 dem Prinzip der Spiegelung basieren und in einer Gegenbewegung resultieren. Daneben dominieren im Klaviersatz chromatische Schritte, wobei sich die Bewegungsrichtung oft als Geste zwischen einer Frage (aufwärts) und einer Antwort (abwärts) interpretieren lässt. Sprech- und Klavierstimme sind in diesem Dialog gleichberechtigt. Daneben zeigen Text und Musik des ersten Satzes eine semantische Klarheit. Der Text, wenn auch überaus poetisch assoziativ, ist in seiner Struktur klar verständlich. Fragen und darauffolgende Antworten sind deutlich als aufeinander bezogen vernehmbar. Es entsteht eine logische Folge wie sie charakteristisch für einen Dialog ist. Man kann also sagen, dass das Klavier auch auf eine eigene Art und Weise „spricht“ und somit einen „Sprachcharakter“ zeigt. Paradox ist dabei, dass sich auf diese Weise zugleich die Ebenen Klavier und Sprache zunehmend voneinander distanzieren und sich der Eindruck von zwei Meinungen bzw. Persönlichkeiten verstärkt. Entkopplung bleibt – auch bei offensichtlicher Interaktion zwischen Text und Musik – das Hauptcharakteristikum des I. Satzes. Trotz seiner klaren Stuktur und semantischen Verständlichkeit verhält sich der Text zum instrumentalem Part wie ein Fremdkörper. Und trotz der deutlichen, jedoch gescheiterten Versuche der Identifikation der Musik mit dem Text bleibt der musikalische Part isoliert. 2.2.2 II. Satz (Katabasis) Bereits der Titel des II. Satzes ist symptomatisch: Katabasis (Abstieg) steht hier für Benjamins Gang in die Unterwelt. Obwohl es sich um eine zentrale Figur der barocken Figurenlehre handelt, kommen klar als Figur abgegrenzte ausschließlich fallende Tonfolgen in diesem Satz kaum vor. Das Prinzip der Entkopplung der zwei Ebenen Text und Musik wird fortgeführt. Der erste Satz betonte semantische Klarheit, dies ändert sich im II. Satz grundlegend. Hier ist die musikalische Faktur dichter, wirrer, hektischer, und entspricht damit auch dem hier deutlich fragmentarischeren Text Bernsteins. Die Gedanken sind unterbrochen und dadurch nicht eindeutig (Beispiel 7). 17 Beispiel 7: Die Wörter stehen untereinander in Konflikt, was sich auch auf den musikalischen Fluss auswirkt. In diesem Satz sind Sprech- und Instrumentalpart zwar nach wie vor getrennt, auch hier ist aber Interaktion zu beobachten. Sprechpart und Klavierpart sind in sich geschlossen, jeder Part hat seinen eigenen Fluss, wobei der musikalische Fluss genauso frei ist wie der Sprachfluss (Beispiel 8, Takt 42-44). Beispiel 8: 18 Gegenseitige Opposition ist auch in der rhythmischen Struktur sichtbar. Der Klavierpart ist über weite Strecken in drei Systemen notiert, jedes System hat eine eigene rhythmische Grundstruktur. Die drei Schichten greifen häufig durch Stimmkreuzungen ineinander, die musikalische Faktur wird dabei durch „strong reminiscences of chromatic, tonal sonorities and progressions“19 bestimmt. Chromatik, intervallische Sprünge, aber auch agogische Expressivität sowie Pedalisierung sind die Mittel, mit denen der Klavierpart, zumeist gestisch, aber auch harmonisch immer wieder die rhapsodischen Formen der romantischen Klavierliteratur erinnert. Die unvollständige Struktur des Textes lässt Raum für eigenständige musikalische Entwicklungen; dies zeigt sich besonders in der großen Anzahl an rein instrumentalen Takten. Der „Konflikt“ zwischen Klavier und Sprechstimme schlägt sich in einem erhöhten Grad der Entkopplung nieder. Jedoch scheint es hier um eine andere Art von Konflikt zu gehen als im I. Satz. Letztendlich ist dabei neben der Entkopplung auch die Interaktion viel intensiver als sie im I. Satz war. Der Text bleibt eine Einheit für sich. Seine Anordnung innerhalb der Partitur ist genau so frei wie seine sprachliche Struktur. Nur gelegentlich stimmt der Rhythmus des Gesprochenen mit den rhythmischen Figuren des Klavierparts überein, sodass deren gestischer Charakter besonders hervortritt, z. B. in den Takten 94 („Does it frag?“), 96 („or does it mock?“), 102 („skin you“), 126 („like as“) und 127 („as like“). Sehr ähnlich ist auch Takt 51 (Beispiel 9, Takt 51) wo die Wiederholung des Wortes „as“ im Klavierpart durch eine gleichsam „steckenbleibende“ Geste wird (vergleichbare Situation tauchen auch im III. Satz wieder auf, vgl. Takt 28-29). 19 Ferneyhough, Content and Connotation, S. 11. 19 Beispiel 9: Solche repetitiven Figuren kann man in allen drei Sätzen finden (Beispiel 10 a, Takt 22, I Satz; Beispiel 10b, Takt 28, III. Satz). Beispiel 10a: Beispiel 10b: 20 Dadurch nähert sich das Instrumentale dem Gesprochenen an, wobei dies nur eine von vielen Spielarten der Interaktion zwischen Musik und Sprache ist. 2.2.3 III. Satz (Kataplexy) Die Entkopplung als Komplement von Interaktion, die auch der Titel der Komposition suggeriert (Opus/Naturam – Kunstwerk/Natur), erscheint in jedem der drei Sätze in verschiedenen Stadien bzw. Formen. Im III. Satz finden wir auf den ersten Blick das Gegenteil von Entkopplung, ein Amalgam vom Text und Musik, in äußerst enger Interaktion. Die Dichte des Textes ist dabei höher als in den ersten zwei Sätzen. Wieder orientiert sich die musikalische Anlage an der Struktur des Textes (Beispiel 11). Beispiel 8: Die Wörter folgen aufeinander ohne Interpunktion, wie ein unverbundener „Gedankenfluss“, in dem jedes Wort gleich relevant ist. Dieser Strom von Worten ist auch im instrumentalen 21 Teil präsent, der hier vom sprachlichen untrennbar ist. Im Prinzip entfällt auf jedes Wort ein Klang. So wird ist eine maximale Koordination zwischen Text und Musik hergestellt. Der musikalische Fluss mit seiner ab- oder aufsteigenden Linie beeinflusst dabei die Aussprache des Textes. Man kann vermuten, dass der Sprecher die Tonhöhen des Klavierparts instinktiv aufgreift. Der Rhythmus des musikalischen Ablaufs bestimmt den Rhythmus des gesprochenen Textes und umgekehrt. Die Stimme und der Klavierpart zeigen eine maximale Verbindung: „[T]he pianist finds himself utterly imprisoned in the piano’s meaninglessly frenetic motions.“20 Hier könnte man vielleicht eine Verbindung zum Titel des Satzes ziehen: Kataplexie ist ein akuter Anfall von Muskelversagen, „unkontrollierte“ Bewegungen sind im Klavierpart in höchster Komplexität auskompniert. Die repetitiven Töne, die im III. Satz sogar vorübergehend einen „alla marcia“ Charakter suggerieren (Beispiel 12, T. 41), „self-absorbed ‚fanfares‘ accompanying the arrival of the Benjamin avatar at the gates of Hades“.21 Beispiel 12: Worte und Klänge sind weitläufig in ständig wechselnde Lagen zerteilt und treffen immer wieder in Knotenpunkten zusammen, bei denen jede gesprochene Textsilbe einem Klangereignis entspricht. Man könnte sagen, dass der Text des III. Satzes, ein frei assoziativer Gedankenfluss, weitgehend auf nachvollziebare semantische Bedeutung verzichtet (vgl. z.B den Eingriff in die Worte „avail ables“; weiters die hauptsächlich klanglich orientierten Wortfolgen „lull to swell bell book cant to cant“ usw.). Gerade dadurch aber wird die Interaktion bzw. Beziehung zwischen Musik und Text gestärkt. Die bereits im II. Satz konstatierte paradoxe Situation 20 21 Ebd., S.12 Ebd., S. 11. 22 spitzt sich zu: Je unbestimmter sowohl Text als auch musikalische Struktur sind, umso mehr kann sich die Interaktion zwischen den beiden Medien entfalten. Anders gesagt: Auf der Interaktionsebene zwischen Sprech- und Klavierparts wird die entkoppelte Struktur immer mehr zu einer gekoppelten. Beide Strukturen (Text und Musik) scheinen sich immer stärker zu verbinden, je mehr sie auseinander gehen. Es entsteht so eine neuen übergeordnete Ebene, auf der beide Strukturen miteinander identifiziert werden können. *** Es kann insgesamt gezeigt werden, dass der Text in allen drei Sätzen, strukturell und vermutlich auch inhaltlich, wichtige Auswirkungen auf die musikalische Form hat. Aus der genauer Analyse der drei Sätze bezüglich der Interaktion zwischen Text und Musik, kann man folgende Schlüsse ziehen: 1. Textinhalt und -struktur scheinen die Gestaltung des Klavierparts nachhaltig zu prägen; 2. Die gesprochenen Teile prägen das akustische Gesamtgeschenen entscheidend; der Text zieht die Aufmerksamkeit des Hörers auf sich, willentlich oder unwillentlich versuchen wir ihn zu „verstehen“. Er drängt sich gegenüber dem musikalischen Ablauf fast „aggressiv“ auf: „Die Texte wirken wie Kontrahenten der Musik, wie verbale Attacken auf ein musikalisches Kontinuum, dem sie fremd sind und fremd bleiben, auch wenn sie es beeinflussen“.22 3. Die Entkopplung von Text und Musik, ein Prinzip, dass auch im Titel Opus Contra Naturam anklingt, ermöglicht zugleich eine neue Form der Interaktion. Die extreme Virtuosität und die „Überforderung“ des Instrumentalisten ist dabei, wie häufig bei Ferneyhough, Teil der Konzeption und zwingt den Interpreten zu eigenständigen Lösungen, die über die Interpretation eines Notentextes hinausweisen. 4. Jeder der drei Sätze findet auf der Grundlage einer jeweils unterschiedlichen Text-MusikStruktur eigenständige musikalisch-formale Lösungen. Die Interaktion zwischen dem Text und dem musikalischen Fluss ist evident. Wichtig dabei ist, dass der Text bei Ferneyhough trotzdem eine Kategorie für sich bleibt, auch wenn er in jedem der drei Sätze eine Symbiose mit der Musik eingeht. Sein Fluss wird aber nie zum integralen Bestandteil der musikalischen Struktur. Der Text bleibt sozusagen „unberührt“, ein unbearbeiteten Material. Darin liegt ein wesentlicher Unterschied zu Helmut Lachenmanns Verfahren (vgl. 3). 22 Shadowtime, in: 9. Münchener Biennale, S. 42. 23 Kann man davon sprechen, dass der Text bei Ferneyhough „musikalisiert“ ist? Ferneyhough stellt dem Text das Instrument entgegen. Die zwei Kategorien – musikalische und sprechende – bringen sich gegenseitig hervor. Der Zusammenhang zwischen gesprochenem Text und Instrumentalmusik wird erst auf einer neuen, übergeordneten Ebene hörbar. In dem Dialog zwischen dem Pianist und seinem alter ego bleiben Grundelemente aus der Geschichte des Melodrams präsent. Der wesentliche Aspekt, in dem Opus Contra Naturam sich von einer melodramatischen Form unterscheidet, ist die Besetzung: Der Pianist wird gleichzeitig zum Sprecher. Und sobald sich der Instrumentalist in die Rolle eines Sprechers transformiert, wird aus dem Konzertstück eine Art Theater. Die Tendenz zum Szenischen ist ein wichtige Eigenschaft, die Ferneyhoughs Werk mit Lachenmanns Salut für Caudwell verbindet. 24 3. HELMUT LACHENMANN: SALUT FÜR CAUDWELL (1977) FÜR ZWEI GITARRISTEN23 Der gesprochene Text in Helmut Lachenmanns Salut für Caudwell unterscheidet sich nicht nur hinsichtlich Kontext und Inhalt von jenem in Ferneyhoughs Werk, sondern hat auch eine ganz andere Rolle und folgt einem grundsätzlich verschiedenen ästhetischen Zugang. Die Textbehandlung, bzw. die Musikalisierung des Textes durch sprachlich-phonetische Verfremdung wird bei Lachenmann zum kompositorischen Hauptmerkmal. Der von Lachenmann herangezogene Text Christopher Caudwells hat eine politische Basis: Weil Eure Freiheit nur in einem Teil der Gesellschaft wurzelt, ist sie unvollständig. Alles Bewußtsein wird von der Gesellschaft mitgeprägt. Aber weil ihr davon nicht wißt, bildet ihr euch ein, ihr wäret frei. Diese von euch so stolz zur Schau getragene Illusion ist das Kennzeichen eurer Sklaverei. Ihr hofft, das Denken vom Leben abzusondern und damit einen Teil der menschlichen Freiheit zu bewahren. Freiheit ist jedoch keine Substanz zum Aufbewahren, sondern eine im aktiven Kampf mit den konkreten Problemen des Lebens geschaffene Kraft. Es gibt keine neutrale Kunstwelt. Ihr müßt wählen zwischen Kunst, die sich ihrer nicht bewußt und unfrei und unwahr ist, und Kunst, die ihre Bedingungen kennt und ausdrückt. Wir werden nicht aufhören, den bürgerlichen Inhalt eurer Kunst zu kritisieren. Wir stellen die einfache Forderung an euch, das Leben mit der Kunst und die Kunst mit dem Leben in Einklang zu bringen. Wir verlangen, daß ihr wirklich in der neuen Welt lebt und eure Seele nicht in der Vergangenheit zurücklaßt. Ihr seid noch gespalten, solange ihr es nicht lassen könnt, abgenutzte Kategorien der bürgerlichen Kunst mechanisch durcheinander zu mischen, oder Kategorien anderer proletarischer Bereiche mechanisch zu übernehmen. Ihr müßt den schwierigen, schöpferischen Weg gehen, die Gesetze und die Technik der Kunst neu gestalten, so daß sie die entstehende Welt ausdrückt und ein Teil ihrer Verwirklichung ist. Dann werden wir sagen...“24 Der Text ist eine Montage von Passagen aus Christopher Caudwells (1907–1937) Schrift Bürgerliche Illusion und Wirklichkeit (1937). Caudwell war ein englischer marxistischer Dichter, Journalist, Literaturkritiker und Philosoph. Lachenmann wählte die Fragmente des Textes aus dem Schlusskapitel Die Zukunft der Poesie. Er adaptierte dabei den Text an einigen Stellen. Die Abweichungen vom Original (vgl. Anhang, Beispiel 1) sind Lachenmanns persönliche Antwort auf Caudwells politischen Traktat. Mit der Auswahl der Fragmente wollte Lachenmann nicht die marxistische Ideologie propagieren, sondern identifizierte sich als Künstler mit der von Caudwell dargestellten Problematik: „Es lag mir nichts daran, die Caudwell’schen Heilsversprechungen mit aufzunehmen, vielmehr wollte ich jenen Worten ein Denkmal setzen, die – am Ende einer aufrüttelnden Schrift – das aussprechen, worum es mir selbst von jeher beim Komponieren gegangen ist.“25 Die Einbeziehung des Textes versteht Lachenmann als eine Art Denkmal für Caudwell, gewidmet 23 Uraufgeführt am 3. Dezember 1977, Baden-Baden. Caudwell, Die Zukunft der Poesie, S. 48. 25 Lachenmann, Struktur und Musikantik, S. 155. 24 25 „allen Außenseitern, die, weil sie die Gedanklosigkeit stören, schnell in einen Topf mit Zerstörern geworfen werden“.26 „So gedachte ich seiner auf meine Weise, bemächtigte mich jenes Textes, inszenierte in der Mitte des Werks eine Reihe von Salut-‚Schüssen‘, ließ am Ende der Form so etwas wie spanisches Kolorit durchscheinen und gab dem Werk seinen Namen“.27 Im Jahr 1937 wird Caudwell als Soldat der internationalen Brigaden im Kampf gegen das Franco-Regime ein Opfer des spanischen Bürgerkriegs. Genau 40 Jahre später, angeregt durch Caudwells Text, entsteht Lachenmanns Komposition, in der der Komponist auf seine eigene Art und Weise seine Haltung zu Künstler, Kunstwerk und Gesellschaft äußert. Lachenmann findet an Caudwells Text „das Insistieren auf einem auch technisch-ästhetischen Fortschritt der künstlerischen Mittel und des Materials“ sehr aktuell.28 3.1 Kompositorische Umsetzung des Caudwell-Textes Im Vorwort der Partitur gibt der Komponist genaue Anweisungen zur Aussprache des gegebenen Textes: Das ab Takt 55 eingefügte Caudwell-Zitat soll bei genauer Beachtung des vorgeschriebenen Rhythmus und der durch internationale Lautschrift präzisierten phonetischen Artikulation mit halblauter Stimme und völlig neutralem Ausdruck gesprochen, quasi ‚laut gelesen‘ werden. Instrument und Stimme sollen einander nicht übertönen. Akustische Textverständlichkeit sollte trotz der gefordeten quasi-staccato Sprechweise angestrebt werden.29 Die Art und Weise wie Lachenmann mit dem Text umgeht, zeigt eine doppelte Intention. Einerseits ist die Hervorbringung der semantischen Ebene deutlich: Caudwells Äußerungen über die Entstehung und Rezeption von Kunst sind für Lachenmanns Ästhetik wichtig, dadurch ist wohl zu erklären, dass Textverständlichkeit stark hervorgehoben wird. Andererseits inszeniert Lachenmann durch die Phonetisierung des Textes dessen klangliche Ebene und bringt sie in den Vordergrund des musikalischen Geschehens. Im Gegensatz dazu reduziert Ferneyhough die Wörter nicht auf einzelne Phoneme, der Text mit seiner stark 26 Lachenmann, Salut für Caudwell. Lachenmann, Struktur und Musikantik, S. 155. 28 Lück, Philosophie und Literatur im Werk Helmut Lachenmann, S. 50. 29 Lachenmann, Salut für Caudwell, Vorwort zur Partitur. 27 26 assoziativen und semantisch viel komplexeren Ebene bleibt in seiner Wortgestalt unangetastet. Aus Lachenmanns Ausführungsanweisung und aus der genaueren Analyse der Komposition treten insgesamt einige Charakteristika der musikalischen Struktur deutlich hervor, die im folgenden durch die Analyse erhellt werden sollen: 1. Rhythmisierung/Phonetisierung 2. Verständlichkeit bzw. Semantisierung 3. Musikalisierung. 3.2 Rhythmus als Bindeglied Der gesprochene Teil beginnt in Takt 55 (Beispiel 13). Beispiel 13: Ab diesem Moment bis inklusive Takt 176 folgen wir einer konstanten antiphonischen Abwechselung zwischen zwei Gitarren/Sprechern. Diese „Antiphonisierung“, die schon in einigen Takten des vorangehenden instrumentalen Teils durch das rhythmische Pulsieren (vgl. Takt 45-46) antizipiert ist, wird also im gesprochenen Teil zur Regel. Der rhythmische Verlauf wird durch den Achtelpuls geprägt, der zum ersten Mal in Takt 29 angedeutet wird (Beispiel 14, Takt 29-32). 27 Beispiel 14: Diese „Taktierung“ bzw. „Achtelrasterung“ des Hauptpulses wird in der Folge auch den Rhythmus des gesprochenen Textes und der Phonetisierung bestimmen (Beispiel 15). Beispiel 15: Die Pausen, auf die wir im gesprochenen Teil treffen, stehen ebenfalls im Zusammenhang mit dem Achtelpuls. Der deutlich werdende Marschcharakter bzw. -rhythmus ist schon in den Anfangstakten des Werkes angelegt, wobei er durch die Verteilung zwischen zwei Gitarren eher latent und „abgeschwächt“ ist (vgl. T. 6). Etwas konkreter wird er ab Takt 18. In den ersten Takten bzw. bis zum Takt 55, wo der Text zum ersten Mal erscheint, scheinen die Gitarrenklänge ein Gespräch anzudeuten. Die Präsenz eines Pulses wird in diesem Teil durch die Verwendung verschiedener Spieltechniken (wie z.B. Zupfen mit Plektrum, Flageolett) zusätzlich verstärkt. Der Text fügt sich so zunächst fast unbemerkt in den musikalischen Fluss und den bestehenden Charakter und integriert sich damit vollständig in die musikalische Struktur. Eine der wichtigsten Eigenschaften, die den gesprochenen Text zum Bestandteil des Strukturflusses werden lässt, ist die Homogenität des Rhythmus. Der rhetorische Charakter des instrumentalen Teils wird im Gespochenem reflektiert und umgekehrt. So ist beispielweise in den rhythmischen Figuren der rechten Hand im Takt 22-23 (Beispiel 16) in beiden Gitarren das Deklamieren des Textes antizipiert. 28 Beispiel 16: Neben solchen offensichtlichen besteht auch eine inhaltliche Verbindung zwischen dem instrumentalen ersten Teil und dem durch die Sprechstimmen dominerten zweiten Teil: Der Verzicht auf alles Pathetische charakterisiert instrumentale wie deklamatorische Abschnitte. Das kurze aufsteigende Glissando (Takt 19-20, Beispiel 17) lässt sich ebenfalls leicht mit dem Gesprochenen in Verbindung bringen. Beispiel 17: Die den gesamten Sprechtteil durchlaufenden ostinaten Viertelpulse mit eingefügten Achtelfiguren wirken, so der Komponist, wie ein „nacktes Metrum“30; der Puls bleibt stets konstant, wird jedoch an manchen Stellen „maskiert“ bzw. „verformt“. Im Takt 19-21 zum Beispiel, wird der Puls auf dem jeweils vierten Sechzehntel jeder Taktzeit, wie Hans-Peter Jahn in seiner Analyse bemerkt31, als Hauptimpuls wahrgenommen. Dazu tragen die gegensätzliche Dynamik der ersten und zweiten Gitarre sowie die scharfen, glissandoartigen Gesten bei, die in der ersten Gitarre auftaktig zu diesen verschobenen Akzenten hinführen. In Takt 22 wird der Puls scheinbar unterbrochen. Die Dynamik der Hauptbewegung wird schwächer, Flageoletts und zusätzliche Akzente verunklaren die rhythmische Situation. „Diese Art rhythmische Illusion ist ein kompositionstechnisches Detail, an dem sich zeigen lässt, wie sich Lachenmann der musikalischen Gewohnheit durch die Verfremdung tonaler 30 31 Lachenmann, Struktur und Musikantik, S. 158. Jahn, „… meinetwegen mickrig… schäbig… nicht bösartig…“. 29 Rhythmik verweigern will, indem er das Nichtzusammenspiel strikt komponiert.“32 So ist nicht nur das Gesprochene bzw. der Gitarrenklang verfremdet, sondern auch der Rhythmus, und dies in erster Linie durch Zusammenhang bzw. das konstante Variieren und Ausbrechen aus dem Konventionellen in das Unkonventionelle. Das rhythmische, ermüdende Pulsieren wirkt fast „hypnotisierend“, auch aufgrund der Tatsache, dass sich der rhythmische Fluss mit dem „Unbekannten“ vereinigt: “Lachenmann baut Hörerwartungen auf, die er aber sofort wieder enttäuscht.“33 3.3 Phonetisierung Das „Textliche“ ist also die Hauptcharakteristik der kompositorischen Struktur. Die musikalische Umsetzung ist davon wesentlich geprägt. Um jedoch die Verständlichkeit hervorzubringen, nutzt der Komponist entsprechende musikalische Mittel, darunter das Rhythmisieren bzw. Phonetisieren des Textes. Der Rhythmus, den Lachenmann im gesprochenen Teil verwendet, ist wie dargestellt dem instrumentalen Part entnommen. Jedoch unterscheidet sich der „komponierte“ Rhythmus vom Textrhythmus. So nutzt Lachenmann eine besondere Art der Phonetisierung; die spezifische Klangqualität jedes Phonemes wird durch die Dekonstruktion der Worte durchsichtig gemacht, wobei sich Lachenmann der internationalen Lautschrift (IPA) bedient. Die Sonorität der einzelnen Buchstaben und Laute hat dabei stets Vorrang vor dem Wortzusammenhang. Der Grund für diese Konzentration auf die kleinsten Wortelemente liegt in Lachenmanns klangorientierter Ästhetik. Deklamierte man die Wörter so wie bei einer üblichen Textlesung, verlöre ein großer Anteil der Buchstaben bzw. Laute an Ausdruckskraft. Dies lässt sich vor allem anhand der Frikative, aber auch der Plosive sowie der nasalen Konsonanten zeigen, die erst mit Hilfe des kompositorischen Eingriffs bzw. mit Hilfe des komponierten Rhythmus ihre Qualität voll entfalten können. Jedes Wort wird dabei bis zum Ende, bis zum letzten Buchstaben ausgesprochen, sodass eine Art von textlichem Tenuto entsteht. In der üblichen Aussprache „entfernte“ Phoneme können dabei durchaus erklingen. Dadurch wird eine geräuschhafte Qualität erreicht. Eine solche Form der rhythmisierten Phonetisierung ist eine wesentliche Idee der Komposition. 32 33 Sielecki, Das Politische in den Kompositionen von Helmut Lachenmann und Nicolaus A. Huber, S. 144. Ebd., S. 146. 30 Die Interaktion des Gesprochenen mit der musikalischen Struktur wird auf mehreren Ebenen deutlich. Dabei beeinflusst die rhythmische bzw. instrumentale Rhetorik jene des Gesprochenen und umgekehrt. Die Akzente des Achtelpulses finden eine Entsprechung in den Betonungen einzelner Wörter oder auch Phoneme. So werden etwa die Konsonanten im Rahmen der phonetischen Sprechart besonders akzentuiert. Ebenso werden zahlreiche instrumentale Gesten auf das Gesprochene projiziert und umgekehrt. Das Gitarren-Glissando in Takt 57 zum Beispiel schafft in Verbindung mit der Aussprache des Konsonants L eine neue, einzigartige Klangqualität. Das Glissando wird noch über eine bestimmte Anzahl an Schlägen wiederholt, den Viertelpuls fortsetzend. Das Instrumentale und das Gesprochene folgen demselben Gestus. Lachenmann will in seiner „Präsentation“ und Wahrnehmung von Caudwells Text jede Form von historisch etablierter Pathetik und Emotionalität vermeiden, mit der die menschliche Stimme so eng verbunden ist. Diese Absicht realisiert sich darin, die Aufmerksamkeit auf die dumpfe, fast mechanische, „entpersönlichte Sprechweise“34der Instrumentalisten zu lenken. Der musikalische Fluss dient dabei als Filter , durch den sich der Text neu erschließt: „Es geht also um den Transport eines Textes. Es geht um eine spezielle Musikalisierung der Sprache und ihrer Sprechweise.“35 Die menschliche Sprache ist „mechanisiert“, sie wird zur „Anti-Rede“. Unnatürlich und fremd, im Gegensatz zur gewohnten Art der Rede, wird die Sprache vollständig musikalisiert. Die besondere Form der Phonetisierung ist hier, in der Formulierung von Hans-Peter Jahn „nicht nur eine Flucht vor falscher Prononcierung, sondern auch ein Versuch, durch Sprache noch einmal neu zu ergreifen und zu ‚outen‘“.36 Solch eine Art des Redens betont nicht nur Wörter und Silben, sondern auch die besonderen Klangqualitäten einzelner Phoneme. Lachenmann mechanisiert/musikalisiert einerseits die Sprache bis zum kleinsten Bestandteil des Wortes, andererseits wird eine „Mechanisierung“ durch die Gitarrenspielbewegungen erreicht. Das Spielen erzeugt durch der Bewegung eine zusätzliche Rhythmusschicht, eine Choreographie. Die Instrumentalisten sind gleichzeitig Spieler, Sprecher, aber auch Schauspieler, genau wie es auch bei Ferneyhoughs Komposition der Fall ist. 34 Jahn, „… meinetwegen mickrig… schäbig… nicht bösartig…“, S. 216. Ebd. 36 Ebd., S. 217. 35 31 Die zwei Gitarristen sprechen den Text abwechselnd, wobei an manchen Stellen auch die Phoneme einzelner Wörter auf die beiden Parts aufgespalten werden. Dieses antiphonische Prinzip lässt einen eng verwobenen Dialog entstehen und trägt entscheidend zum sprechenden Charakter der Komposition bei. Dieses Dialogisieren wird auch auf den komponierten Rhythmus übertragen. Zwischen dem phonetisierten bzw. rhythmisierten Text und dem instrumentalen Teil realisiert sich auch ein resultierender übergeordneter Rhythmus, der vorwiegend in Achteln verläuft. Im Takt 71 wird zum ersten Mal ein Wort auf die beiden Instrumentalisten aufgeteilt (Beispiel 18, Takt 71). Beispiel 18: Dadurch wird die Phonetisierung des Textes bzw. die Interaktion zwischen Text und Musik vertieft. Dieses phonetische Abspaltungsprinzip kommt in den Takten 96-105 noch deutlicher zum Ausdruck. Hier wird das Material verdichtet. Dadurch wird eine Dramatisierung erreicht und die Bedeutung des Gesprochenen verstärkt. Der Text wird nicht mehr als alternierend, sondern als eine Einheit, als ein Gedanke erlebt. In der Folge werden nun auch Silben und Phoneme von einem Sprecher zum anderen übertragen. In Takt 99 werden die Konsonanten s und t aus dem Wort „Kunstwelt“ gleichzeitig von beiden Instrumentalisten gesprochen. Der Viertelpuls beider Gitarren gliedert hier den Velauf markant und lässt so die synchronisierten Sprechparts klar hervortreten. Eine ähnliche Situation finden wir in Takt 143: Auf der zweiten und dritten Achtel erklingen synchron die Phoneme a und b[p] aus dem Wort „abgenutzte“. Durch solche Momente eines verfremdeten Wort-Zusammenklangs oder „-akkords“ wird die Eigenständigkeit der phonetischen Ebene besonders deutlich akzentuiert. Diese phonetischen „Akkorde“ dienen dabei gleichzeitig einer inhaltlichen Akzentuierung: Die Worte 32 „Kunstwelt“ und „abgenutzt“ wurden gewiss nicht zufällig ausgewählt. Insgesamt sind die inhaltlichen Schlüsselstellen des Textes durch eine besondere Verdichtung des Materials gekennzeichnet. Die Interaktion von Instrumental- und Sprechparts erreicht ihre höchste Intensität bei den Zeilen „Es gibt keine neutrale Kunstwelt. Ihr müßt wählen zwischen Kunst, die sich ihrer nicht bewußt und unfrei und unwahr ist…“ und „Ihr seid noch gespalten, solange ihr es nicht lassen könnt, abgenutzte Kategorien der bürgerlichen Kunst mechanisch durcheinander zu mischen…“. Lachenmann hebt damit Caudwells Forderung, der Künstler müsse auf die ihn umgebende Welt reagieren, besonders hervor. Für die Eigenständigkeit des phonetischen Zusammenhangs ist auch die Herausbildung einer spezifisch phonetischen Klangqualität, die sich vom Klang der Gitarre abhebt, von großer Bedeutung. Auch auf dieser Ebene wird eine größtmögliche Interaktion erreicht. In Takt 78 setzt der vorzeitige Einsatz des zweiten Sprechers eine markante Geste, einen Impuls, ähnlich der erste Sprecher in Takt 96. Die hohe Dichte von Impulsen, die ja grundsätzlich Signalcharakter haben, erhöht die Aufmerksamkeit des Hörers, und hebt damit den gesprochenen Teil auch innerhalb der Gesamtanlage besonders heraus. Die akzenthafte Artikulation der Gitarren ist mit der phonetischen Impulshaftigkeit eng verbunden. Der Komponist erwähnt im Vorwort, dass die Wörter „quasi staccato“ auszusprechen sind, nimmt also eine (instrumental-)musikalische Anweisung zur Hilfe; das dazu analoge StaccatoZupfen der Saiten scheint also als archetypische Gitarrenspieltechnik in Ergänzung zu dieser Sprechweise besonders schlüssig. Die Wörter klingen daher nicht wie Fremdkörper, sondern fließen in die musikalische Rhetorik ein. Lachenmanns Handhabung der Gitarre spielt dabei eine wesentliche Rolle. Die technischen und klanglichen Möglichkeiten des Gitarrenspiels werden an äußerste Grenzen geführt: Es ist klar, daß ich ein solches Instrument mit einer so ausgeprägten und eigenwilligen Aura nicht einfach benutzen und mich seiner Musizierpraxis unterwerfen konnte. Weder konnte es darum gehen, mich dieser Aura schlau zu bedienen, noch darum, mich ihrer verzweifelt zu erwehren, sondern darum, die typische Klangwelt mit meinen Möglichkeiten zu durchdringen, aber auch mich selbst davon durchdringen lassen. In diesem Sinn bin ich von charakteristischen Spielformen dieses Instruments ausgegangen, habe sie einerseits lapidar reduziert, anderseits umgeformt und neu entwickelt, oft über die Grenzen der üblichen Praxis hinaus.37 37 Lachenmann, Struktur und Musikantik, S. 157 33 Lachenmann setzt also durchaus vertraute Techniken des Gitarrenspiels ein: Arpeggio, Akkordespiel, Barré, Zupfen, Klopfen usw., bei denen er jedoch neue Klangpotenziale entwickelt: Im Grunde gibt es nur den Barré-Griff: die quer über die Bünde gelegte Hand oder den Gleitstahl, sodaß im Harmonischen die Intervallverhältnisse der leeren Saiten dominieren. Die so zunächst erstarrte Harmonik allerdings wird weit differenziert durch Mischungen, Verwischungen, Verzerrungen, Ausdämpfungen usw.38 All diese Techniken stehen in ständiger Interaktion mit dem Text. Die Plosive etwa können eindeutig mit Klopfen, Pizzicato und „trocken“ gedämpftem Spiel in Verbindung gebracht werden Frikative mit Verwischungen. Mit Kopfstimme gesprochene Phoneme (Beispiel, 19 Takt 121-122) sind zu Flageoletts in den instrumentalen Parts analog. Beispiel 19: Der Klang der Gitarre ebenso wie das phonetisch und rhythmisch umgeformte Gesprochene sind also stark verfremdet und führen das Hören weg von etablierten Vorstellungen und Stereotypen. Im Takt 121 bringt der zweite Sprecher auf dem letzten Achtel des Taktes das Phonem L (aus dem Wort „Leben“). Er antizipiert damit den Einsatz des ersten Sprechers am Beginn von Takt 122. Auf solche isolierte Phoneme treffen wir auch in den Takten 122 und 124 (2. Gitarre). Die Musikalisierung des Textes findet hier also auf der Ebene des Phonems statt. Die dadurch entstehende auftaktige Geste ist aus den instrumentalen Parts vertraut (vgl. Takt 47). Instrumentales Material fließt in das gesprochenene ein und umgekehrt. Das Zitat „O Mensch, gib acht“ aus Friedrich Nietzsches Also sprach Zarathustra in den Takten 135-138, das den appellartigen Charakter des Textes verstärkt, lässt eine kontrapunktische Situation entstehen: Das einzige Mal sprechen die beiden Ausführenden hier 38 Ebd. 34 unterschiedliche Texte. Die Worte „O Mensch, gib acht!“ sind dabei so rhythmisiert bzw. phonetisiert, dass sie nicht mit den Phonemen des zweiten Sprechers zusammenfallen. Dabei kommt es am Ende zu einer rhythmischen Verdichtung (T. 139). Das letzte Phonem (th von „(gib) acht“) schließlich fällt auf dem vierten Achtel des Taktes mit dem Phonem t[d] (von „Ihr seid noch gespalten…“) des zweiten Sprechers zusammen (Beispiel 20). Beispiel 20: So wie der rhythmisierte Text fast unmerklich an den musikalischen Fluss gekettet war, so verliert er sich wieder in Takt 172. Das Pulsieren der Gitarren setzt sich noch einige Takte lang fort (bis Takt 176) und verklingt perdendosi. In Takt 177 bricht der Puls ab. 3.4 Funktionen des Gesprochenen Wie bereits dargestellt, war der Inhalt des Textes ein wichtiger Anreiz zur Entstehung der Komposition. Der Text ist zugleich Mittel und musikalisches Material. Seine Botschaft enthält einen Appell an die gesellschaftliche Rolle von Kunst, die Lachenmann affirmativ aufgreift: Kunst solchermaßen verstanden nicht nur als Aktivierung unserer Vorstellungskraft, sondern darüber hinaus als Eingriff in unsere Vorstellungswelt und darüber hinaus in unser existentielles Selbstverständnis und unser Weltbild, verdeutlicht die Wechselwirkung und den Zusammenhang zwischen individueller Empfindungswelt und gesellschaftlich vorgegebenen Wertmaßstäben und erinnert den Menschen an seine Möglichkeit und 35 Bestimmung, im Spannungsfeld von Innerlichkeit und Öffentlichkeit sich zu erkennen, sich auszudrücken – und verantwortlich zu leben und zu handeln.39 Vor diesem Hintergrund ist es von besonderer Bedeutung, warum und auf welche Art Lachenmann den Text in die musikalische Struktur integriert. Der 116 Takte lange gesprochene Teil bildet innerhalb von Salut für Caudwell nur eine Entwicklungsphase, die in die Logik der Gesamtform eingeht: „Hier in meinem Stück bildet es [das Prinzip einer Struktur-Halluzination, das Innenleben von Klang bzw. von Sprache als wesentliche Komponente des Ausdrucks wahrzunehmen] eine Station, die angesteuert und wieder verlassen wird, einen strukturellen Aggregatzustand, der sich ergibt und wieder wandelt.“40 Salut für Caudwell basiert auf den Prinzipien von Lachenmanns Musique concrète instrumentale. Die Musique concrète Pierre Schaeffers betrachtete ein unbearbeitetes „rohes“ Material als musikalisches Objekt. Dieses Objekt ist ein „konkretes Produkt seiner mechanischen Entstehung“.41 Lachenmann hat in einigen seiner Werke und vor allem im Salut eine solche Auffassung „auf Aspekte der Musiktradition (samt ihrer ‚Aura‘) verschoben“.42 Er nutzt standardisierte Gitarrentechniken und Sprachphoneme, die er jedoch neu formt und dabei auf ihre elementaren Klangerzeugungs- und -entstehungstechniken hin befragt. Klang und Sprache werden so auf einer höheren (oder „tieferen“) Ebene ineinander verschränkt. 39 Ebd., S. 156. Ebd., S. 158. 41 Hilberg, Geräusche?, S. 66. 42 Ebda. 40 36 4. ZUSAMMENFASSUNG Lachenmann tendiert schon in den ersten Takten von Salut für Caudwell zu einem sehr engen Zusammenhang zwischen Musik und Text. Rhythmus und Phonetisierung, die Musikalisierung des Textes und die Semantisierung der Klänge werden ineinander verflochten. Darin wird der wichtigste Unterschied zur Behandlung von Instrument und Stimme bei Ferneyhough sichtbar. Bei Ferneyhough stellt der Text eine Ebene für sich dar, auch wenn er in jeden der drei Sätze zugleich eine Art von Symbiose mit der Musik eingeht. Sein Fluss wird aber nie zum integralen Bestandteil der musikalischen Struktur. Er unterliegt keiner textlichen Rhythmisierung. Der Pianist hat bei der Interpretation des gesprochenen Textes deutlich mehr Freiheiten als die Gitarristen bei Lachenmann. Text und Musik bilden bei Ferneyhough als eigene Kategorien Ebenen der wechselseitigen Durchlässigkeit. Sie folgen einander, kommen sich näher und trennen sich wieder, bleiben jedoch für sich, jede in ihrem Fluss. In beiden Kompositionen sind die Instrumentalisten mehr als nur Interpreten. Ein Klaviersolo (Opus contra Naturam), welchem ein Text dazugegeben ist, wird so aus seiner rein instrumentalen Welt herausgerissen, und gewinnt dabei auch eine stark theatralische Ebene hinzu. Die Eröffnung dieser musikalisch-theatralischen Ebene macht es plausibel, dass dieses Werk seinen Platz in einer Oper gefunden hat. Äquivalentes geschieht auch bei Lachenmann. Das rein „instrumental“ besetzte Gitarrenduo entwickelt durch das Sprechen der Musiker eine theatralische Ebene. Das Gitarrenspiel selbst wird zu einer Choreographie von Bewegungen. So schafft es Lachenmann in diesem Stück auf raffinierte Weise die Bewegungen der Gitarren- und Sprachklänge zu einer neuen Dimension von Klang werden zu lassen. In zwei unterschiedlichen Werken und in zwei verschiedenen Gattungen gelingt es beiden Komponisten eine Synthese musikalischer Ereignisse zu schaffen, die Gestik, Sprache, Instrumentalklang und Theater untrennbar werden lassen. 37 ANHANG 1: FORMALE SKIZZE FERNEYHOUGHS 38 ANHANG 2 Der Originaltext aus Christopher Caudwells Bürgerliche Illusion und Wirklichkeit. Die von Lachenmann vertonten Textteile sind fett hervorgehoben. “Weil eure (Konzeption der) Freiheit nur in einem Teil der Gesellschaft wurzelt, ist sie (auch) unvollständig. (Alles Bewußtsein wird von der Gesellschaft, die es erzeugt, determiniert, aber weil ihr von diesem Modus der Determination nicht wißt, bildet ihr euch ein, euer Bewußtseinsei frei und nicht von eurer Erfahrung und der Geschichte determiniert). Alles Bewußtsein wird von der Geselschaft mitgeprägt. (Diese von euch so stolz zur Schau getragene Illusion ist das Kennzeichen eurer Sklaverei dem Gestern gegenüber, denn könntet ihr die Gründe sehen, die euer Denken determinieren, dann befändet ihr euch wie wir auf dem Weg zur Freiheit). Diese von euch so stolz zur Schau getragene Illusion ist das Kennzeichen eurer Sklaverei. Die Einsicht in die Notwendigkeit der Gessellschaft ist der einzige Weg zur Freiheit. Aber wenn wir sagen, das Bewußtsein wird von der Gesellschaft determiniert, die es erzeugt, dann meinen wir, daß das Denken letzlich vom konkreten Leben, von der Praxis nicht zu trennen ist. Eines gewährleistet und entwickelt die Freiheit des anderen. Ihr glaubt, das Denken von der “Zensur” zu befreien, wenn ihr die Theorie von der Praxis und von den mit der Praxis verbundenen gesellschaftlichen Verpflichtungen und Formen trennt. (Ihr hofft, das Denken vom Leben abzusondern, wenn ihr alles andere außer jenem aufgebt, und damit auf irgendeine Art und Weise einen Teil der menschlichen Freiheit zu bewahren, wie der Mann, der sein Talent im Vorborgenen hielt, anstatt es auf dem Markt einzusetzen). Ihr hofft, das Denken vom Leben abzusondern und damit einen Teil der menschlichen Freiheit zu bewahren. (Freiheit ist jedoch keine Substanz zum Aufbewahren und Isolieren, sondern eine im aktiven Kampf mit den konkreten Problemen des Lebens geschaffene Kraft. Ihr würdet das Denken der Knechtschaft unbewußt bürgerlicher Kategorien ausliefern; ihr würdet die Praxis ihrer Seele berauben). Freiheit ist jedoch keine Substanz zum Aufbewahren, sondern eine im aktiven Kampf mit den konkreten Problemen des Lebens geschaffene Kraft. Es gibt keine neutrale, (von Kategorien oder determinierenden Ursachen freie) Kunstwelt. Kunst ist eine gesellschaftliche Betätigung. Euch gehört die trügerische Freiheit des Traumes, der sich einbildet, spontan entstanden zu sein, obwohl er streng durch außerhalb des Bewußtseins befindliche Kräfte determiniert wird. (Ihr müßt wählen zwischen klassengebundener Kunst, die sich ihrer Kausalität nicht bewußt und entsprechend unwahr und unfrei ist, und proletarischer Kunst, die sich ihrer Kausalität bewußt ist und sich als wahrhaft freie Kunst des Kommunismus herausbilden wird.) Ihr müßt wählen zwischen Kunst, die sich ihrer nicht bewußt und unfrei und unwahr ist, und Kunst, die ihre Bedinungen kennt und ausdrückt. Es gibt außer der kommunistischen keine klassenlose Kunst, doch diese ist noch nicht entstanden; und die heutige klassengebundene Kunst kann nur die Kunst einer sterbenden Klasse sein, wenn sie nicht proletarisch ist. Wir werden nicht aufhören, den bürgerlichen Inhalt eurer Kunst zu kritisieren. 39 Ihr weist die “ökonomischen” Kategorien nicht deshalb unwilling zurück, weil sie unrichtig, sondern weil sie ökonomisch sind. Aber was gibt es denn für richtige ökonomische Kategorien außer den vom Leben bezogen? Wir stellen die einfache Forderung an euch, das Leben mit der Kunst und die Kunst mit dem Leben in Einklang zu bringen,(damit eure Kunst lebendig wird). Begreift ihr denn nicht, dass eben die Trennung von Kunst und Leben ein bürgerliches Übel ist? Begreift ihr nicht, daß ihr euch in dieser Sache in eine Reihe mit unseren Feinden stellt-ihr, unsere Bundesgenossen-, daß wir eure Theorie in diesem Punkte deshalb so scharf bekämpfen? Unsere Forderung, daß eure Kunst proletarisch sein soll, besagt nicht, ihr sollt dogmatische Kategorien und marxistische Phrasen auf die Kunst anwenden. Das zu tun wäre bürgerlich. Wir verlangen, daß ihr wirklich in der neuen Welt lebt und eure Seele nicht in der Vergangenheit zurücklaßt. Wir achten eure künstlerische Persönlichkeit; doch wie könnt ihr mit dem Herzen in einer neuen Welt weilen, wenn eure Kunst bürgerlich ist? Wir wissen, daß sich der Übergang vollzogen hat, wenn eure Kunst lebendig geworden ist; dann wird sie auch proletarisch sein. Dann werden wir aufhören, ihre Erstarrung zu kritisieren. Es liegt uns fern, eine Forderung zu stellen, die ihr im Reich der Kunst anerkennen sollt, obwohl ihr sie als proletarische Diktatur empfindet. Im Gegenteil, wir werden solange sagen, ihr seid noch bürgerlich, solange ihr euch selbst eine proletarische Diktatur aufbürdet und Formulierungen von anderen Gebieten der proletarischen Ideologie übernehmt, um sie mechanisch auf die Kunst anzuwenden. (Es besteht die Notwendigkeit, daß ihr, die Künstler proletarische Führer auf dem Gebiet der Kunst werdet und nicht einen der beiden im Wesen gleichen, bequemen Wege einschlagt-abgenutzte Kategorien bürgerlicher Kunst mechanisch durcheinander zu mischen oder Kategorien anderer proletarischer Gebiete mechanisch zu übernehmen). Ihr seid noch gespalten, solange ihr es nist lassen könnt, abgenutzte Kategorien deer bürgerlichen Kunst mechanisch durcheinander zu mischen, oder Kategorien anderer proletarischer Bereiche mechanisch zu übernehmen. Ihr müßt den schwierigen schöpferischen Weg gehen, die Kategorien und die (Technik) Gesetze und die Technik der Kunst neugestalten, so daß sie die entstehende neue Welt ausdrückt und ein Teil ihrer Verwirklichung ist. Dann werden wir sagen… Dann werden wir sagen, eure Kunst ist proletarisch und lebendig, ihr habt als Künstler die Vergangenheit hinter euch gelassen-ihr habt die Vergangenheit in die Gegenwart gezogen und die Verwirklichung der Zukunft beschleunigt. Ihr seid nicht mehr nur “eben Künstler” (was in Wirklichkeit bürgerlicher Künstler bedeutet); ihr seid proletarische Künstler geworden.”43 43 Caudwell, Bürgerliche Illusion und Wirklichkeit. S. 292–294. 40 LITERATURVERZEICHNIS Lachenmann, Helmut: Salut für Caudwell, für zwei Gitarristen. Spielpartitur, Breitkopf & Härtel, Wiesbaden 1985 Ferneyhough, Brian: Shadowtime. Libretto by Charles Bernstein. Score, Edition Peters Allende-Blin, Über Sprechgesang, in: Schönberg und der Sprechgesang (Musik-Konzepte 112/113), hrsg. von Heinz-Klaus Metzger und Rainer Riehn, München: edition text+kritik 2001, S. 46-61 Caudwell, Christopher: Bürgerliche Illusion und Wirklichkeit; zitiert nach: Lück, Philosophie und Literatur im Werk Helmut Lachenmann, S. 48. Ferneyhough, Brian: Content and Connotation, Distance and Proximity. Re-presenting the Auratic in Shadowtime, in: Komponieren in der Gegenwart, hrsg. von Jörn Peter Hiekel, Saarbrücken: Pfau 2006, S. 10-17. Hilberg, Frank: Geräusche? Über das Problem, der Klangwelt Lachenmanns gerecht zu werden, in: Helmut Lachenmann (Musik Konzepte 146), hrsg. von Ulrich Tadday, München: edition text + kritik 2009, S. 60-75. Jahn, Hans-Peter: »… meinetwegen mickrig… schäbig… nicht bösartig…« 12 Annäherungen an die (komponierende) Person Helmut Lachenmann, in: auf (-) und zuhören. 14 essayistische Reflexionen über die Musik und die Person Helmut Lachenmanns, h. Hrsg. Hans-Peter Jahn, von Hans-Peter Jahn. Hofheim: Wolke 2005, S. 211ff. Krämer, Zur Notation der Sprechstimme bei Schönberg, in: Schönberg und der Sprechgesang (Musik-Konzepte 112/113), hrsg. von Heinz-Klaus Metzger und Rainer Riehn, München: edition text+kritik 2001, S. 6-32 Lachenmann, Helmut: Struktur und Musikantik, in: Musik als existentielle Erfahrung. Schriften 1966-1995, hrsg. von Josef Häusler, Breitkkopf & Härtel, Wiesbaden 1996, S. 155-161. — Salut für Caudwell, in: ebda., S. 390. Lück, Hartmut: Philosophie und Literatur im Werk Helmut Lachenmann, in: Der Atem des Wanderers: der Komponist Helmut Lachenmann, Symposion, 17. Und 18. September 2005. hrsg. von Hans-Klaus Jungheinrich,Alte Oper Frankfurt am Main. Hrsg. von HansKlaus Jungheinrich, Mainz: Schott 2006, S. 41-56. Meyer-Kalkus, Reinhart: Stimme und Sprechkünste im 20. Jahrhundert, Berlin: Akademie Verlag, Berlin 2001. 41 Schwarz-.Danuser, Monika, „Melodram“ in: MGG, hrsg. von Ludwig Finscher, Bd.6, Bärenreiter-Verlag, 1977, Sp. 67-99. Shadowtime, in: 9. Münchener Biennale. Internationales Festival für neues Musiktheater, hrsg. von der Münchener Biennale, Redaktion Habakuk Traber, 2004, S. 40-45. Sielecki, Frank: Das Politische in den Kompositionen von Helmut Lachenmann und Nicolaus A. Huber, . Saarbrücken. Pfau 2000. 42